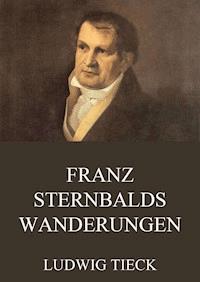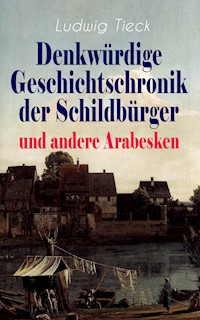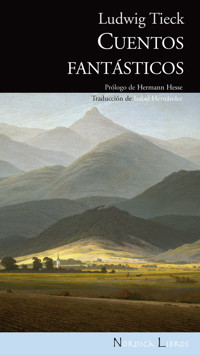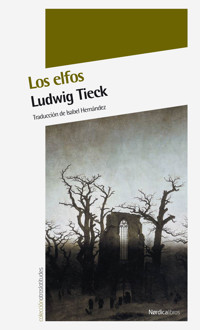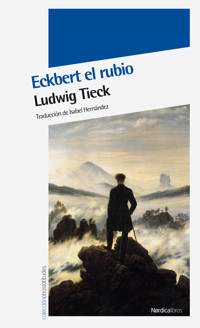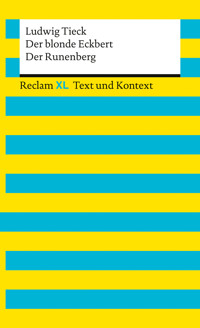Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im historischen Roman »Vittoria Accorombona« von 1840 zeichnet Ludwig Tieck das literarische Porträt einer um Selbstbestimmung ringenden Frau im Italien des 16. Jahrhunderts. Ludwig Tiecks Romanheldin Vittoria Accorombona entstammt einer römischen Patrizierfamilie, der es zu Beginn des Romans an nichts fehlt. Die krisenhafte Zeit mit ihren zahlreichen höfischen Intrigen, Verschwörungen und Verleumdungen hinterlässt in der Familie jedoch tiefe Spuren. Die Accorombonas erleben einen gesellschaftlichen Abstieg. Als sich Vittoria mit ihrem einstigen Gegenspieler, dem Herzog Bracciano, zu einem Paar zusammenfindet, scheint ihr Leben endlich eine glückliche Wendung zu finden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vittoria Accorombona
Vittoria AccorombonaErstes Buch Erstes Kapitel Zweites Kapital Drittes Kapitel Viertes Kapitel Zweites Buch Erstes Kapitel Zweites Kapitel Drittes Kapitel Viertes Kapitel Fünftes Kapitel Sechstes Kapitel Drittes Buch Erstes Kapitel Zweites Kapitel Drittes Kapitel Viertes Kapitel Viertes Buch Erstes Kapitel Zweites Kapitel Drittes Kapitel Viertes Kapitel Fünftes Kapitel Sechstes Kapitel Fünftes Buch Erstes Kapitel Zweites Kapitel Drittes Kapitel Viertes Kapitel Fünftes Kapitel Sechstes Kapitel Siebentes Kapitel Achtes Kapitel ImpressumLudwig Tieck
Vittoria Accorombona
Romanbiografie
Erstes Buch
Erstes Kapitel
Es war in dem Jahre des Jubiläums 1575, als sich die Familie Accoromboni in einem Gartenhause in dem anmutigen Tivoli aufhielt, um dort während der heißen Monate die frische Kühle, den Anblick der Wasserfälle und die schöne Aussicht auf den stürzenden Teverone und die zauberischen Hügel der reichen Landschaft zu genießen. Die Mutter der Familie, eine große, stolze Matrone, noch im Alter kräftig und nicht ohne Spuren ehemaliger Schönheit, regierte, obgleich nicht reich, ihr Haus mit so vieler Umsicht und Kenntnis, daß Anstand und Fülle sich zeigte und Fremde gern in dieser Familie verweilten, wo sie Bildung, musikalisches und poetisches Talent und selbst Gelehrsamkeit antrafen.
Diese Mutter, eine edle Römerin von hoher Gestalt, war die beseelende Kraft des Hauses, denn ihre mächtige Gegenwart gebot allen Bekannten und Fremden Ehrfurcht. Sie war stolz auf ihre edle Abkunft sowie auf ihre Kinder. Sie stammte von einem alten adligen Geschlecht, und ihr Gatte Accoromboni war in Rom ein angesehener Rechtsgelehrter gewesen, der für die Großen sowie den Staat die wichtigsten Angelegenheiten verwaltet, bedeutende Prozesse mit Ehren geführt und gewonnen hatte. Schon dessen Vater hatte als Rechtsgelehrter die Liebe und Achtung der Römer gewonnen, und beide Männer standen in vielfachem Verkehr mit Fürsten, den Patriziern und den berühmten Gelehrten und Schriftstellern in allen italienischen Staaten. So war das Haus der Accoromboni bekannt und besucht, und selten kam ein ausgezeichneter Fremder nach Rom, der sich nicht der stattlichen Mutter der Familie hätte vorstellen lassen.
Die meiste Befriedigung fand die hohe Frau aber in ihrer Familie und in Gesellschaft ihrer Kinder. Der älteste Sohn war durch seine Beschützer, unter welchen der große Kardinal Farnese obenan stand, schon Abt, und die Mutter rechnete darauf, ihn bald als Bischof begrüßen zu können, wohl gar etwas später ihm im Purpur des Kardinals ihre Verehrung zu bezeigen, denn er war als Gelehrter geachtet und als feiner Weltmann beliebt.
Marcello, der zweite Sohn, war wild und unbändig, streifte oft viele Tage im Gebirge umher, ohne nachher der Mutter Rechenschaft abzulegen, wo und mit wem er seine Zeit zugebracht habe. So sehr die Mutter mit dem stolzen Blick aus dem großen blauen Auge alle Menschen zur Ehrfurcht und gewissermaßen zum Gehorsam zwang, so wenig vermochte sie über das starre Gemüt dieses Marcello, der sich zu erniedrigen glaubte, wenn er einem Weibe gehorchte.
Sie hatte allen ihren Einfluß anwenden wollen, diesem Unbeugsamen die Stelle eines Hauptmanns in der Garde des Papstes zu verschaffen, er selber aber hatte am meisten dagegen gearbeitet, weil er seine Freiheit noch nicht aufopfern und sich keiner Disziplin fügen wollte.
Flaminio, der jüngste Sohn, schien ganz das Gegenteil von jenem. Er war schmiegsam, fein gebaut, zart in seinem Wesen, fast mädchenhaft, ein verehrender Diener seiner Mutter, deren Wink und Blick ihm Gebote waren. So war er der Geschäftige, alles Besorgende im Haushalt, der Aufseher der Dienerschaft, der Bote über Land, der Ratgeber anderer Jünglinge und der Liebling junger Mädchen, um deren Wohlwollen er aber, so freundlich er in seinem Betragen war, sich nicht sonderlich bemühte. Denn es schien, daß er seine ganze Liebe dem jüngsten Wesen in der Familie, seiner holdseligen Schwester Vittoria oder Virginia, wie sie auch zuweilen genannt wurde, zugewendet hatte. Ein Fremder, der sie beobachtete, hätte ihn eher für den verliebten Bräutigam als den Bruder der lieblichen Erscheinung halten sollen.
Diese Vittoria glänzte wie ein Wunder oder wie eines jener Bilder aus der alten Zeit, die der entzückte Beschauer, einmal gesehn, niemals wieder vergessen kann. Kaum in das siebenzehnte Jahr getreten, war sie fast schon so groß wie ihre Mutter, ihr Antlitz war blaß und nur mit leichter Röte gefärbt, die oft, bei selbst schwacher Bewegung des Gemütes, völlig entfloh oder sich, schnell wechselnd, so seltsam erhöhte, daß sie dann als ein anderes, dem vorigen fast unähnliches Wesen erschien. Ihr zart geformter Mund glühte in rubinroter Farbe; sein Lächeln unendlich erfreuend, sein Zürnen oder Schmollen erschreckend. Die längliche, sanft gekrümmte Nase hatte den edelsten Charakter im Oval des schönen Antlitzes, und die Augenbrauen, fein gezogen, dunkelschwarz, belebten den Ausdruck des feurigen Auges. Ihr Haar war dunkel und hatte im Lichte Purpurschimmer, es floß geregelt über Nacken und Schulter: saß sie nachdenkend, die langen schneeweißen Finger in die Fülle des Haares halb vergraben, so hätte Tizian kein holderes Modell zu seinem schönsten Bildnisse antreffen können.
Aber weder Tizian noch irgendein Maler hätten den Blick des Auges, das fast schwarz zu nennen war, den Ausdruck und das Feuer desselben auch nur schwach andeuten können. Dieser Ernst des Blickes, dieser Tiefsinn, dann wieder die aufblühende Freundlichkeit übten einen seltsamen Zauber, das Zornfeuer war selbst dem Frechen unerträglich. Es war ein liebliches Naturspiel, daß die langen Augenwimpern fast blond oder gelb waren, so daß sie wie Strahlen in der Bewegung blitzten oder so wundersam schimmerten wie jene lichten Goldstrahlen, die wir zuweilen an altgriechischen Bildnissen der Minerva wahrnehmen.
Wie mit beschränkten Mitteln die verständige Mutter Julia allen ihren Kindern auch eine gute Erziehung, Unterricht und Wissenschaft hatte geben können, so war doch Vittoria, diese hohe Erscheinung, ihr Liebling und diejenige, auf welche sie ihre stolzesten Hoffnungen gründete. Sie selber war oft über den früh gereiften Verstand dieses ihres Kindes erstaunt, sie mußte das Gedächtnis bewundern, in welchem Vittoria alles Gelesene und Gelernte aufbewahrte, wie sich die Mutter nicht weniger des Talentes erfreute, welches aus den Versen der Tochter hervorleuchtete.
Die Familie saß im Saale beisammen, als Marcello seinen Hut und Mantel nahm, den Degen umgürtete und von der Mutter Abschied nehmen wollte, indem diese mit ernster Miene fragte: „Wohin wieder?“
„Freunde, Bekannte besuchen,“ erwiderte der ungestüme Jüngling; „der Morgen ist so schön, und ihr alle werdet mich nicht vermissen.“
„Man hat mir sagen wollen,“ erwiderte die Mutter, „du haltest im Gebirge mit dem verdächtigen Ambrosio Umgang. Der rohe Mensch soll ja mit jenen Banditen in Verbindung stehn, die in der Gegend von Subiaco streifen.“
„Ei, meine Mutter!“ sagte Marcello, „man nennt heutzutage alles Banditen, was nicht Schulmeister, Priester oder Advokat ist. Und doch plündern diese oft mehr als jene freien Menschen, die sich zuzeiten aus sehr gegründeten Ursachen mit dem langweiligen Staate überworfen haben und unter denen man angesehene Grafen, tugendhafte Leute, ja Männer antrifft, die von fürstlichen Häusern abstammen.“
„Mein Sohn,“ sagte Julia sehr ernst und nahm dem übermütigen Sohne den Hut aus der Hand, den sie auf den Tisch legte, „du sprichst wie ein unbesonnener Knabe, der weder mit Welt noch Moral bekannt ist: magst du kindisch bleiben, wenn das dein Stolz ist; nur das vergiß niemals, daß dein herrlicher Vater sowie dein verehrter Großvater Advokaten waren.“
„Gewiß nicht,“ sagte Marcello, „stehen doch ihre Namen in so manchem verdrüßlichen Buche verzeichnet, daß man schon deshalb versucht wird, ein ganz entgegengesetztes Metier zu ergreifen.“
Hastig riß er den Hut vom Tische hinweg und sprang so eilig aus der Tür, daß der Mutter die beginnende Rede auf der zürnenden Lippe erstarb.
Flaminio stand auf und schloß die Türe wieder, die der Fortstürmende in seiner eilenden Hast offen gelassen hatte.
Vittoria sah von ihrem Buche auf, um mit einem sanften Lächeln dem Auge der Mutter zu begegnen. „Was denkst du, mein Kind?“ fragte Julia.
„Ich bin schon seit lange der Überzeugung,“ antwortete die Tochter, „daß man den Burschen gewähren lassen muß. Er sucht einen männlichen Stolz und Trost darin, dir nicht zu gehorchen, sondern zu widersprechen: je mehr du also ermahnst, je mehr sucht und findet er Gelegenheit, das zu tun, was du verbietest. Zeigst du dich seinetwegen unbekümmert, so wird er von selbst zur Vernunft zurückkehren, weil er sich dann einbilden kann, als freier Mensch zu handeln.“
„Wenn nur nicht vorher Unglück geschieht“, bemerkte die Mutter seufzend.
„Das, wie alles, muß man der Vorsehung anheimstellen,“ sagte Vittoria, „denn er ist doch der Erziehung und Ermahnung entwachsen.“
„Woher nur“, fing die Mutter wieder an, „hat der Knabe diese Unbändigkeit? Sein Vater war milde und sanft, nachgiebig, folgsam, ein Feind alles wilden, ungestümen Wesens: die Ruhe und Gesetztheit selbst. – Von wem?“
„Gewiß von dir“, sagte Vittoria lachend.
Die Mutter stand auf, ging nach dem Fenster, sah in die Landschaft hinaus, kehrte dann um, betrachtete die Tochter ganz nahe mit großen Augen und sagte kurz und schneidend: „Von mir?“
Vittoria ließ sich nicht irremachen, schloß ihr Buch, legte es in die Kapsel und sagte ruhig: „So denke ich mir die Anstammung dieses tobenden Blutes. Dein fester Sinn, dein großes, starkes Gemüt, dein edles Wesen, das für seine Überzeugung Blut und Leben hingeben würde, ist in ihm als Mann in diese jugendliche Roheit ungeschlagen, die sich später selber erziehen wird. War ich doch auch ein wildes Kind, und gewiß warst du nicht allzu zahm, als du noch mit deinem Püppchen spieltest.“
„Du magst recht haben,“ antwortete die Mutter, „mir ist der Gedanke noch nicht eingefallen. Freilich vergessen wir nur allzuleicht in späteren Verhältnissen, wie wir in unsern frühesten Jahren waren.“
„Ich habe da wieder den Camillo Mattei gesehen,“ fing die Matrone von neuem an; „er schien auf unser Haus zuzugehn: ich weiß nicht, was er immer hier will.“
„Er ist ja ein allerliebstes Kind,“ sagte Vittoria erfreut; „man neckt sich mit ihm so hübsch, er ist dabei so ehrlich und treu, daß man ihn liebhaben muß.“
„Was soll er uns?“ fragte Julia und wendete das Haupt unwillig ab; „er ist unwissend, einfältig, von geringem Herkommen; nun liegt er schon dem armen Weltpriester, seinem Ohm, seit Wochen zur Last: kann er nicht nach Rom zu seinen Eltern, den Bürgersleuten, zurückkehren, um seine Schulstudien fortzusetzen?“
„Laß ihn, liebe Mutter,“ bat Virginia, „er gefällt mir und uns allen im Hause; unsere Familie ist als eine gastfreundliche bekannt; sollen wir bei diesem guten Mattei eine Ausnahme machen? Frage nur unsre Amme oder unsern alten Guido, wie gut und lieb dieser immer freundliche Camillo ist.“
Die Mutter zwang sich, heiter zu erscheinen, als Camillo eintrat, sich demütig verbeugte und schüchtern stehn blieb, bis sich Flaminio zu ihm gesellte und ihm einen Sessel in seiner Nähe anbot.
„Camillo,“ fing Vittoria an, „Ihr habt neulich die Zeichnungen von den Bildern sehen wollen, die der Kardinal Farnese in seinem neuen Schlosse Caprarola von Zuccheri hat malen lassen: seht, hier ist das schöne Buch, er hat es uns gestern geschickt.“
Camillo blätterte und sagte dann etwas beschämt: „Ich verstehe zu wenig von diesen großen und sinnreichen Sachen. Und an diesen Kämpfen und Schlachten kann ich mich vollends nicht erfreuen. Freilich wohl, die Schlacht des Konstantin oder Attila von Raffael –“
„Läppischer Mensch!“ rief Vittoria, halb zürnend und halb lachend, „wenn er mit Raffael kommt, muß sich alles verkriechen. Und doch meint der Kardinal wohl und sein Maler noch mehr, er könne es mit dem jungen Manne und seinen vatikanischen Zimmern aufnehmen und stehe auf der Leiter der Kunst noch einige Stufen höher. Und diese Bilder hier aus dem Saale des Schlafs und der Träume sind auch echt poetisch; diese herrlichen Erfindungen werden immer als Muster gelten können.“
„Kann alles sein,“ erwiderte Camillo etwas verdrüßlich, „es ist aber ein so schöner, klarer Morgen und dabei noch gar nicht heiß, daß wir lieber mit den verehrten Damen einen Spaziergang machen sollten.“
Die Mutter nahm ihren Sonnenhut, und Vittoria folgte ihrem Beispiel. „Gehn wir denn nach der Villa Este“, sagte die Matrone, „und besehn einmal wieder die Herrlichkeiten des neuen Palastes und alle die Künste und Schönheiten des Gartens.“
„O nein!“ rief Vittoria unwillig, „alle diese kleinen Springbrunnen und Bildchen in Marmor, so fein gelegt und geschnitzt, – wären nicht die Zypressen hingesetzt, die doch dazwischen ein ernstes Wort reden, so wäre diese Anstalt ganz unerfreulich. Nein! hin zu den allerliebsten Wasserfällen! Zu Mäzens Villa, der Neptunsgrotte, da löst sich unser Herz und Gemüt, und die liebliche, unendlich schöne Natur faßt mich wie ein großer Dichter vertraulich bei der Hand und sagt mir so herzliche, rührende, erhebende und lustige Dinge in mein horchendes Ohr, wie sie in keinem Buche und in keiner Handschrift stehn.“
Flaminio führte die Mutter, und Camillo ging an der Jungfrau Seite. Man konnte es ihm ansehn, daß er sich neben der hohen schönen Gestalt beschämt und klein fühlte und doch zugleich geschmeichelt, daß er mit ihr so vertraulich wandeln durfte.
Als sie in die Nähe der Wasserfälle gekommen waren, setzte sich die Mutter mit ihrem Sohne in den Schatten der Olivenbäume und ließ ihr Auge sinnend an den Formen der schönen, ölbekränzten Hügel umherschweifen. Vittoria aber sprang an ihr vorüber, um sich in der Nähe des Wassers zu ergötzen. „Wie vieles wißt Ihr,“ fing Camillo leise an, „wie Unermeßliches – und ich – –“
„Laßt alle den Kram“, rief Vittoria übermütig und ging schneller. „O seht die alltäglichen Wunder dieser Landschaft und diese Wasser, diese Märchen und goldenen Fabeln, die es nicht müde werden, sich immer wieder selbst alles das poetische Zeug vorzuerzählen, und die uns doch, so sehr wir sie auswendig wissen, immer neu bleiben. Hier laßt uns Kinder sein, wahre Kinder, die sich immer in ihrem Spielwerk vergessen.“
Indem lief ihr ein Kaninchen vorüber, in den Berg hinein. Vittoria sprang ihm nach und warf einen buntgefärbten Ball, den sie bei sich trug, dem kleinen weißen Tiere nach. Der Ball rollte den Hügel hinab nach dem Flusse zu, der sich hier mit Brausen von bedeutender Höhe in die Tiefe stürzte und mit seinem Strudel unten einen Trichter bildete, den viele die Grotte des Neptun nannten. Aus Furcht, der Ball möchte vom Strudel fortgeführt werden, rannte sie so eilig hinab, daß Camillo ihr kaum folgen konnte, aber auch so unbesonnen, daß sie, unten angelangt und sich zu eilig und stark nach dem glänzenden Spielzeuge hinabbeugend, wirklich in den tosenden Strudel stürzte. Überwältigt und besinnungslos schrie Camillo laut auf und stürzte sich nach, erfaßte die schöne Gestalt, die sich nur eben noch an einem vorragenden Gesteine festhielt, fiel hart auf das Geklipp und rang sich mit der Beute, Brust an Brust verzweifelnd gedrängt, empor: er gewann Kraft, und schneller, als es sich spricht, hatte er sich mit ihr gerettet. Unbewußt und mit der Verzweiflung Riesenkraft trug der Kleinere die größere Gestalt fort, zwar nur wenige Schritte empor, aber doch entfernt genug, um in Sicherheit im blitzenden Grase neben der Geretteten ruhen zu können. Die Strahlen des nahen Wasserfalles spritzten, abstäubend vom fernen Fels, wie Staub oder gewebter farbiger Glanz über ihre Körper und Angesichter. Leichenblaß, aber still lächelnd, saß Vittoria im Grase, dankbar blickte sie ihren Retter an und reichte ihm die zitternde Hand. Camillo, erschrocken noch und entzückt, taumelnd, betäubt, küßte die dargebotene schöne Rechte mit Inbrunst. – „Wie kann ich dir lohnen?“ fragte sie. – „So!“ rief er aus, indem der Blöde, Verschämte brennende Küsse auf die schönen Lippen drückte. – Sie schwieg, wehrte ihn nicht ab, und nur, als der Berauschte von neuem und heftiger begann, wandte sie das Antlitz ab und schlug ihn lächelnd mit den glänzenden Fingern auf seinen heißen Mund.
Jetzt besann er sich, und es wurde ihm nun erst möglich, sie zu sehn und zu betrachten. Der Hut war mit dem Balle in den Wogen verloren gegangen, die schwarzen Locken des Haares waren aufgelöst, noch floß und triefte das Wasser vom Haupte, der schöne Busen mit seinen jugendlichen festen Marmorhügeln war fast ganz frei und glänzte blendend im lichten Dämmer, das Baum und Fels lieblich verbreiteten, an Leib und Hüfte schmiegte sich, die herrliche Form bezeichnend, das nasse Gewand, und so erschien sie dem Jüngling, wie man wohl die Nymphen der Quellen in schönen Gemälden abbildet, oder Amphitriten selbst, die hehre Gemahlin des göttlichen Neptun, der sie vielleicht vor wenigen Augenblicken von Liebe betört in seiner Grotte hatte zu sich entraffen wollen. Sie erfreute sich des Spiels, welches die Sonnenstrahlen in Dunst und Nebel des stäubenden Wassers trieben, denn viele glänzende Regenbogen tanzten und wogten wie selbständige Wesen im aufgelösten Kristall. „Sieh, Camillo!“ rief sie freudig aus, „ich halte die Fabel und das Unmögliche hier sichtbar in meiner Hand. Ja, ich kann sogar, so spielen die Geister der Natur, dir sichtlich und körperlich diese buntglänzende Woge hinreichen, das lachende Kind der Sonne. Und sieh! zu meinen Füßen spielen ebenso im Grase die lieblichen, neckischen Gespenster, die Tagesirrlichter, die dem Apollo mit freundlicher Widerspenstigkeit aus dem Dienst gelaufen sind. Und nun noch, Freund, hat uns der Waldvogel von drüben zum besten, der schreit ein höhnendes Triumphlied, als wenn wir ins Wasser gefallen wären, um uns unter die Fische anwerben zu lassen.“
„Aber“, sagte Camillo zögernd und warnend, „wir müssen zur Mutter zurück und nach Hause; du wirst dich erkälten und davon und vom Schreck krank werden.“
„Der Schreck ist längst verschwunden“, sagte sie, indem sie sich zögernd erhob und ihr Busentuch ordnen wollte, dessen Verlust sie erst jetzt mit einer kleinen Beschämung gewahr wurde. „Ja, wohl müssen wir zurück“, sagte sie dann mit leiser Stimme. „– Müssen wir? – O, über alles dies Müssen in unserer Alltagswelt. Freilich, die Fabel fliegt fort mit Schmetterlingen, Schwalben und Nachtigallen, wir kommen immer an das letzte Wort auch des schönsten Gedichtes, machen das Buch zu und legen es in den hölzernen Schrank. Nach dem herrlichsten Gesang erschallt die heisere Stimme des elenden Dieners und ladet die Gesellschaft an den Eßtisch. Muß denn das alles so sein? Oder könnten wir nicht mit einem Gott oder einem hohen Geist ein Paktum schließen, daß es anders sich gestaltete?“
Camillo sah sie mit großen Augen an und führte sie an der Hand den hohen und steilen Berg hinauf. Flaminio kam ihnen oben mit der Mutter schon entgegen. Wie erschraken beide, als ihnen Camillo mit kurzen, eiligen Worten das Abenteuer und die überstandene Gefahr erzählte. Flaminio erblaßte und ward so schwach, daß er sich an einen Baum lehnen mußte. Die Mutter ergoß sich in Danksagung und Lob Camillos über seine Kühnheit und Geistesgegenwart. „Kommt mit uns,“ beschloß sie, „teuerster Freund, kleidet Euch um, Flaminio wird Euch von seinen Kleidern geben, wärmt Euch in einem Bett, trinkt glühenden Wein und laßt Euch unsre Pflege gefallen.“
„Nein! nein!“ rief Camillo, „Eure Güte und huldreiche Freundlichkeit erkenne ich mit Dank, aber ich bedarf sie nicht. Ich fühle vom Wasser nichts, die Sonne scheint warm, ich laufe zu meinem Oheim, der gar nicht weit ist, und kleide mich um. Meine Wonne, daß ich Euch so habe dienen und Euch Eure herrliche Tochter retten können. Ein unverdientes Glück!“
So lief er fort, und die Matrone, ohne zu sprechen, führte ihre Kinder nach ihrem Hause. Vittoria war nachdenkend und Flaminio tief gerührt.
Als Camillo zu seinem alten Oheim kam und ihm die sonderbare Begebenheit erzählte, sagte der verdrüßliche Mann: „Immer Kindereien getrieben, die zum größten Unheil ausschlagen können. Wenn ihr nun beide ertrunken und vom Strudel verschlungen wärt! Ich hab es dir schon oft gesagt: der Umgang mit diesem hochmütigen Volke ziemt dir einfachem Bürgerkinde nicht. Was kannst du von ihnen erlangen? Du wirst mit deinem Stande unzufrieden werden und deine Zeit verlieren, und wenn du jeden Tag mit Leib- und Lebensgefahr einen von ihnen aus dem Wasser ziehst, hast du keinen Dank davon. Das geht mit Kardinälen und Baronen um; wenn der hochnäsige Abt, der älteste Bruder, einmal herkommt, sieht er mich kaum über die Achsel an. Der lange Mensch wird mir niemals etwas zu Gefallen tun, so sehr ich mich auch vor ihm demütige. – Jetzt in deine Kammer da hinein! Zieh dich aus, kriech ins Bett, daß du warm wirst, ich will dir das Essen hineinschicken.“
Camillo gehorchte ihm gern, nur um mit sich allein zu sein. Fast ohne zu wissen, was er tat, kleidete er sich aus, legte sich nieder und träumte die Begebenheit immer wieder von neuem. „Gott im Himmel!“ sprach er zu sich selbst, „wer bin ich? Und sie hat mich du genannt. Diesem himmlischen Munde habe ich Küsse rauben dürfen, und, ich habe es im Taumel wohl gefühlt, sie hat mich wieder geküßt. Nachher wendete sie sich weg, aber wie freundlich, wie zärtlich! Und das Angesicht! der Busen! O, was kann Marmor, Farbe nachbilden, wenn die Wahrheit, das Leben sich uns nahe und wirklich so hinstellt! – Ich habe gelebt. – Diesen Körper nahe am meinigen gefühlt, gedrückt, das Pochen ihres Herzens empfunden. – Und – der eine Augenblick – wo sich das Gewand weghob im Emporringen, und Bein und Knie sich entblößten. – Kann ich diesen Glanz je wieder vergessen? Wird die Erinnerung daran mich nicht elend, wohl gar rasend machen? – Wie matt ist Licht und Schimmer und Farbe und glänzendes Weiß gegen den Glanz und die Herrlichkeit, die uns der Körper eines schönen Weibes offenbart! Und diesen Himmel, einmal geschaut, will das Auge immer wieder sehn. – Wozu noch leben? Diese Momente kehren niemals, niemals wieder. – Hätte ich nicht vielleicht besser getan, mich mit ihr vom Strudel nieder in den ewig dunkeln Abgrund hinunterwälzen zu lassen? Sie zu morden, statt sie zu retten? Wissen wir denn, was der Tod ist? Mir wäre er Wollust, Himmel, Seligkeit gewesen, wenn auch im Grauen der Verzweiflung.“
So phantasierte Camillo und konnte weder den Schlaf finden noch wirklich wach sein.
Zweites Kapital
Da die Familie Accoromboni sehr viele Bekannte und Freunde hatte, vorzüglich im nahen Rom, so war es natürlich, daß alle diejenigen, die von ihnen wußten, bald durch das Gerücht jene Begebenheit erfuhren, und zwar mit Übertreibungen, so daß manche glauben mußten, die junge und schöne Vittoria sei der Welt durch einen frühzeitigen Tod entrissen worden. Die Mutter, welche ihre tiefe Rührung verbarg, da sie die Äußerung einer jeden Schwäche scheute, hoffte den jungen Camillo bald wiederzusehn und ihm noch einmal Dank zu sagen und bei ihm selbst zu erforschen, auf welche Art sie ihm vielleicht auf seinem künftigen Lebenswege nützlich sein könne. Als er aber nicht erschien, ward sie besorgt und Vittoria noch mehr, daß der Jüngling wohl erkrankt sein könne, denn sie konnten nicht glauben, daß er, ohne von ihnen Abschied zu nehmen, nach Rom zurückgereist wäre. In dieser Erwartung sagte die Mutter zur Tochter an einem Morgen: „Mein Kind, es ziemt sich nicht, daß wir uns um den jungen Menschen, dem wir dein Leben zu danken haben, so gar nicht kümmern. Er ist arm, seine Eltern, wie ich gehört habe, leben in der Stadt nur sehr kümmerlich, man sagt, daß er sich dem geistlichen Stande widmen soll, wir müssen also irgendeine Summe ihm oder seinen Eltern einhändigen, damit er seine Studien bequemer fortsetzen könne, und ihn nachher einigen unsrer wohlwollenden Gönner dringend empfehlen, damit er bald zu einer einträglichen Stelle befördert werde, so daß er nachher seine armen Eltern selber unterstützen kann. Bei solchen Gelegenheiten kehrt mir immer wieder der Wunsch zurück, daß ich reich sein möchte, um durch meine Wohltat das Glück eines solchen Hülfsbedürftigen auf dauernde Weise gründen zu können. Ans jeden Fall werde ich ihm die hundert Skudi geben, die ich neulich für unerwartete Fälle von meinem Ersparnis zurücklegen konnte. Empfehlung, wenn sie wirksam ist, kann nachher als eine große Summe angerechnet werden. Was meint ihr, Kinder, Flaminio und du, Vittoria, zu dieser meiner Absicht?“
Flaminio stimmte unbedingt der Mutter bei, doch Vittoria schüttelte lächelnd den Kopf, so daß die Mutter sie betroffen ansah und mit ihrem forschenden Blicke ihre Meinung erraten wollte. „Nein! nein!“ rief das lebhafte Mädchen, „glaubt mir nur, unser Camillo ist ganz anders, als wie ihr ihn euch denkt. Ich habe ihn seit lange beobachtet und kenne ihn ganz genau. So blöde das junge Wesen scheint, so schwachgemut und ungewiß in seinem Denken und Tun, was vielleicht daher kommt, daß sein Charakter noch nicht ausgebildet ist, so stolz ist doch dieser Jüngling, so daß er gewiß, verwundet und gekränkt, diese Wohltat, die ihm wohl gar als eine Bezahlung erscheinen möchte, ausschlagen würde. Glaube auch nicht, liebe Mutter, daß es sein Wunsch ist, ein Geistlicher zu werden. Er hat mir schon vor einigen Monaten in Rom bekannt, daß ihm dieser Stand verhaßt sei; Soldat möchte er werden oder als Handelsmann auf Reisen gehn, eine Seefahrt versuchen und fremde Länder sehn. Wunderliche Schicksale der Seeleute, der großen Feldherren und Kondottieri – das reizt ihn, solche Bücher wie das alte Gedicht von dem Feldhauptmann Picciuini liest er am liebsten und versäumt, wie er nur irgend kann, Messe und Gottesdienst, so daß ihm auch viele seiner Schulgenossen feind sind und ihn erbost nur den Ketzer und Lutheraner nennen. – Und dann – hundert Skudi! Liebe Mutter – wenn ich nun doch einmal bezahlt werden soll, bin ich denn nicht mehr wert? Diese Taxe ist allzu gering, dafür schlage ich mein Hündchen noch nicht einmal los.“
„Törichtes Wesen!“ sagte die Mutter lächelnd, „wie kindisch du zuweilen sprechen kannst, da dich doch viele kluge Männer in manchen Stunden wegen deines Verstandes bewundern wollen. Das Unbezahlbare, das Höchste läßt sich niemals mit Münze ausgleichen, das weiß ich so gut wie du. Aber ebendeswegen muß ein Leben wie das des Kindes, das die Mutter, wenn es entflohen ist, nicht mit Millionen zurückkaufen kann, mit Dank, mit Kleinigkeit, mit Hülfe erwidert und belohnt werden. Der Wohltäter fühlt dies auch selbst und nimmt das, was Freundschaft reicht, wenn er es bedarf, mit Rührung an, als wenn es ein großer Schatz wäre. Sind wir doch immerdar mit dem Leben und den Elementen, die uns beherrschen, im Kampf: kann ich dem Nebenmenschen diesen erleichtern, so tue ich, selbst durch eine Kleinigkeit, etwas Gutes.“
„Alles wahr,“ sagte Vittoria, „aber darum ist auch in diesem Falle, der so gewichtig ist, Wohlwollen und Freundschaft, ein Entgegenkommen im Vertrauen, ein kindliches und brüderliches Verhältnis, so daß ein solcher Wohltäter mit zur Familie gehört – für den Zartfühlenden der wahre Dank und die größte Belohnung. So sollten wir mit diesem freundlichen und bescheidenen Camillo sein und auch in Rom seine armen Eltern manchmal sehn, die sich gewiß durch solche Auszeichnung sehr geschmeichelt und beglückt fühlen würden.“
Die Mutter stand auf und ging heftig im Saale auf und ab. „Also dahin sollte es kommen?“ sagte sie und setzte sich wieder langsam in den Sessel. „Vielleicht bereitet sich uns allen von diesem Zufalle aus ein trauriges Schicksal. Eben alles dies, was du mir deklamierend hergesagt hast, wollte ich vermeiden und unmöglich machen, weil ich das menschliche Herz besser kenne als du. Weil sich so natürlich ein vertrauliches Verhältnis, eine brüderliche Annäherung aus solchem Unglück entwickelt, weil für dieses ein eigentlicher Dank und eine Belohnung unmöglich sind: so will der erst so großmütige Wohltäter nur gar zu leicht das gerettete Wesen selbst an Zahlungs Statt und vernichtet so seinen Dienst, indem er sich das Liebste eigennützig zum Opfer bestimmt; die Gerettete ist oft im Überschwang des Dankes schwach genug, eine solche Schuldforderung anzuerkennen, ohne einzusehn, daß sie auf diesem Wege nur später eines andern Todes stirbt. Und sollte ich dich je auf diese Weise verlieren können, so wäre es mir eben auch nicht schmerzlicher, wenn dich die rasenden Wogen dort verschlungen hätten. Gerade darum muß nun dieser Mattei unser Haus so wenig wie möglich betreten; wir sind ihm zum höchsten Dank verpflichtet, aber wir müssen uns ihm mehr als je entfremden; er muß fühlen, daß wir in verschiedenartigen Elementen leben und daß unsere Lebenskreise sich niemals berühren können.“
„Ihr überrascht mich, Mutter“, sagte Vittoria hoch errötend. „Nein, ich bin diesem kleinen freundlichen Camillo so gut, fast wie unserm Flaminio da – aber deswegen – – was du andeutest, Frau Julia, davon könnte ja niemals die Rede sein. Du sagst, du kennst das menschliche Herz besser als ich – kann sein; aber ich kenne mein eigenes Herz, mein Wesen, das dir doch vielleicht in einigen Teilen noch fremd und unbekannt ist.“
„Wie die Jugend in ihrer Unerfahrenheit spricht!“ antwortete die Matrone nicht ohne Heftigkeit. „Dein Herz! Dein Wesen! Hast du denn schon etwas derart, da du noch gar kein Schicksal, keinen großen, mächtigen Schmerz erfahren und erlebt hast? Ehe das Eisen geschmolzen, gehärtet und gehämmert wurde, ist es eine unscheinbare Erdscholle, ohne elastische Kraft, Schneide und Widerstand. Dein Wesen ist nur noch Traum und Ahnung; was du bis jetzt warst und geworden, ist nur noch Widerschein meines Geistes, Denkens und meiner Erfahrung. Glaube mir, Kind, es schlafen in uns gräßliche Gespenster, tief im Hintergrund unserer Seele, wohin der Blick der spielenden Jugend und die vorlaute Phantasie niemals reicht. Man lernt alle Menschen früher als sich selber kennen. Wäre nun dieser Camillo immerdar um dich, gewöhnte sein Gemüt so an deinen Umgang, daß dieser ihm zu seinem Dasein unentbehrlich würde, und du wolltest ihn nun als einen Überlästigen abschütteln, so würde er aus Eitelkeit, verletztem Gefühl, Zärtlichkeit und Kränkung in eine solche tödliche Leidenschaft geraten, so in Wut, Eigennutz und Aufopferung rasen, so vor deinen Augen hinsterben, daß dein Mitleid, Kummer, Gewissen, die Vorwürfe, die du dir machtest, dein eignes Wesen dir ganz verhüllen könnten, daß du auch auf eine Zeitlang glaubtest, dieselbe Leidenschaft zu empfinden, und du zu spät deine Aufopferung bereutest. Glaube mir, alles dies geschieht so gar nicht selten, und so erwachsen nur zu oft aus scheinbarer Liebe die unglücklichsten Ehen. In gewissen Stimmungen werfen wir unser Selbst und Heiligstes mit mehr Leichtsinn hinweg, als wir dem gierigen Hunde den Knochen hinschleudern. Eine freie und edle Wahl, meine Vittoria, muß deine Vermählung mit einem ausgezeichneten und hochstehenden Manne herbeiführen, er muß deiner wert sein, so daß dein reiches Wesen durch ihn gewinnt. Dazu gehört vor allen Dingen, daß er dich versteht, daß er die Welt und den Adel echter Geister kennt; ein solcher muß dich erheben, du nicht ihn. Das dürftigste Schicksal, das kläglichste, entwickelt sich in den Ehen, in welchen das Weib höher steht als der Mann.“
Vittoria hatte ihr feuriges Auge sinken lassen, ihr schönes Haupt ruhte zwischen beiden Händen, indem sie die Arme auf den Tisch stützte, so daß die fließenden Haare dunkel wie eine Wolke niederwallten. Plötzlich sah sie auf, wie von einem Traume erwachend, und erschrak fast, als sie ihren Bruder Flaminio in der Nähe erblickte. Sie stand auf, flüsterte dem Bruder leise etwas zu, worauf dieser das Zimmer verließ. „Was hast du, Tochter?“ fragte die erstaunte Mutter.
„Ich wollte dir nur sagen,“ erwiderte sie, „und das sollte mein junger Bruder nicht hören, daß ich gar nicht, niemals heiraten will und werde.“
„Du hast heute deinen törichten Tag,“ erwiderte jene, „kann mein Kind sich so etwas vornehmen oder beschließen?“
„Ich sehe wohl, Mutter,“ sagte Vittoria tief bewegt, „daß du mich, trotz deiner Liebe, nur geringe schätzest. Was nützen uns Bücher, der Umgang mit verständigen Männern, die Kenntnis der Vorzeit und alles, was uns die edelsten Geister singen und sagen, wenn das alles nur wie an Klötzen und Steinen vorübergeht und nicht zu unserem Geiste sagt: Stehe auf, die Morgenstunde ist da, rufe aus allen Kammern deines Herzens und Gehirns die Diener, daß sie an die Arbeit gehn, daß in den Wellen des Blutes Entschlüsse und Kräfte erwachen, die das Geistige, Unsichtbare in Tat und Wahrheit verwandeln! Ja, Mutter, und so bin ich geworden, bin so geschaffen, daß ich ein Grauen vor allen Männern empfinde, wenn ich den Gedanken fasse, daß ich ihnen angehören, daß ich ihnen mit meinem ganzen Wesen mich aufopfern soll. Sieh sie doch nur an, auch die besten, die wir kennen, auch die vornehmsten: wie dürftig, arm, unzulänglich und eitel sind alle, wenn sie alle Verlegenheit der ersten Besuche ablegen und sich so recht frei und offen zeigen. Diese klägliche Lüsternheit, die aus allen Zügen spricht, wenn das Wort Liebe oder Schönheit nur genannt wird; diese alberne hohnlächelnde Tugend, die jene andern, welche für moralisch gelten wollen, zur Schau tragen; diese Dienstbeflissenheit und das Kriechen vor den Weibern, die sie doch in ihrem Herzen verachten, – o weh! wenn ich in diesen Gesellschaften meine Heiterkeit behalten soll, so muß ich mich in einen Traum von Leichtsinn hüllen und meine Beobachtung zum Schlaf einwiegen. Und diesen Herzlosen, Gelangweilten, Geldgierigen, nach Ehrenstellen und Lob der Großen Durstenden soll ich das Kleinod meines reinen Leibes, meiner Keuschheit und Unschuld hingeben, wie man sich Tisch, Gefäß, Buch oder sonst ein Totes aneignet? Und – nur mit Entsetzen kann ich an diese Aufgabe unsers Lebens denken – wie aus einem Schrank, wie aus lebendigem Sarge soll mir unter Qualen ein Wesen genommen werden, das ich bin und doch nicht bin, das in seinem ersten materiellen Blödsinn mich ebensowenig kennt, vielleicht weniger wie die Nelke, die ich in meinem Scherben erziehe. O, mir graut, nur davon zu sprechen. Und dies Leiden, den Graus, den Abscheu zu erleben, wirklich zu erleben, ich ertrüg es nicht! Wie sehr tatest du recht, Mutter, mir unsere Bandello, Boccaz und den leuchtenden Ariost nicht zu verschließen, wie manche Eltern tun, denn statt zu verlocken, hat sich diese sogenannte Liebe, die immer nach diesem entsetzlichen Ziele strebt, die berühmte allwaltende Leidenschaft mir nur verhaßt gemacht.“
„Welche Unnatur!“ rief die Mutter aus, „Kind, deine entartete Phantasie ist es nur, die dir Grauen erregt, nicht diese Bedingung des Lebens selbst, die durch göttliche wie menschliche Gesetze ihre Weihe, wie alles Heilige, erhalten hat.“
„Ich verstehe ja auch“, erwiderte die Tochter, „den Willen Gottes und der Natur, ich verehre diese Satzung und begreife ihre Notwendigkeit – aber warum soll ich mich ebenfalls dem Ausspruch fügen und nicht zurücktreten dürfen wie so viele Priester, Nonnen und Heilige?“
„Und in ein Kloster wolltest du dich vergraben, du lebensmutiges Kind?“
„Nein, Mutter,“ rief Vittoria aus, „lieber sterben! Ich verehre die Ehe; bist du, herrliche Julia, doch Mutter geworden, und Mutter vieler Kinder; muß ich dir doch dafür danken, da ich nur durch dich in dies freundliche Dasein gerufen wurde. Laß mich gewähren. Vielleicht erzieht mich Zeit und Erfahrung noch anders. Du meinst, der Mann müsse höher stehen als das Weib. Noch habe ich keinen gesehn, der sich dir nur vergleichen dürfte; meinen teuern Vater habe ich nicht gekannt und kann mir kein Bild von ihm machen; aber müßte ich durchaus dem Gesetz nachgeben, so scheint mir vielmehr ein Mann wie Camillo meiner Ehe zu passen, den ich eigentlich ohne alle Bitterkeit unter mir fühle.“
„Ich werde noch lange“, sagte die Matrone, „über unser Gespräch und deine sonderbaren Meinungen nachzudenken haben. Demjenigen. was allem Lebensreiz, bewußt und unbewußt, der Poesie und aller Kunst zum Grunde liegt, dem willst du entsagen, und doch bist du für Malerei und Poesie begeistert, doch hast du Sinn für die männliche Schönheit: wie willst du mit deiner Unnatur dich in geselligem lebenden Kreise bewegen?“
„Mit Mut und Entschlossenheit macht sich alles“, erwiderte die Tochter mit heiterer Miene. „Gestern noch las ich das hübsche Büchelchen von der Tullia d'Aragon, ›Über die Unendlichkeit der Liebe‹. – Sieh, diese weltberühmte Frau hat sich niemals vermählt und wurde von der ganzen Welt vergöttert, in Bildnissen verherrlicht, und der große Bembo, der herrliche Poet Bernard Tasso und so viele andere berühmte Namen haben ihr gehuldigt.“
„Kind! Kind!“ sagte die Mutter mit schwerem Seufzer – „wohin gerätst du? Dieses Wesen, so schön, so poetisch sie war, durfte sich an Tugend und Hoheit niemals mit der vermählten Colonna und andern Dichterinnen vergleichen: du weißt auch, daß sie zum Teil deshalb bekannt und beliebt war, weil ihre Sitten, so sagt man, sich durch Leichtsinn auszeichneten; ihre platonische Liebe soll mehr als einmal zur irdischen herabgestiegen sein, und so könnte, weil auch du schön bist, dein Eigensinn dich, statt zur Gattin, zur Buhlerin machen.“
Vittoria legte der Mutter den Finger auf den Mund und sagte: „Bitte! bitte! Was sagt die Welt nicht alles von großartigen Frauen. Ich denke mir, daß sie ein schönes, reines Leben führte, das Edelste jener Gelehrten, Fürsten und Dichter sich aneignete, die zu ihren Füßen saßen. Hat nicht der ernste pedantische Orthodox, der alte Speron Sperone in Padua, einen eigenen Dialog über die Liebe geschrieben, wo sie auftritt und von dem großen Bernardo Tasso verehrt und gepriesen wird? Dieser herrliche Dichter verleugnete auch nie, daß sie seine Göttin war.“
„Vergiß nicht,“ sagte die Matrone, „daß der finstere Sperone damals jünger war und daß er gewissermaßen in einem spätern moralischen Dialog alle jene Äußerungen und Meinungen zurückgenommen hat.“
„Um so schlimmer für ihn!“ rief die Tochter aus, „denn was einmal wahres Eigentum unsers Geistes war, sollen wir niemals wieder weggeben. Wer gegen sich selbst nicht treu ist, kann es gegen niemand sein. Wer sich verleugnet, wird auch das Göttliche verleugnen. Da helfen sie sich denn freilich mit den traurigen eisernen Schranken einer dürren Moral und einer mißverstandenen Religion.“ –
„Camillo vergessen wir ganz darüber“, sagte die Mutter, indem sie aufstand. Sie ging in die Gesindestube und fühlte, daß dieses Gespräch eine Epoche ihres Lebens bilde, denn sie war dadurch in eine ganz andere Stellung zu ihrer Tochter gerückt worden. Diesen strengen Geist des eben erst aufgeblühten Kindes hatte sie nicht geahnet, sie sah jetzt ein, daß der poetische Leichtsinn, das Harmlose des schönen Wesens, der oft kindliche Übermut ebensoviel Vorsatz als Temperament war. Sie sorgte jetzt, das Düstere der Vorstellungen möchte einst über die Heiterkeit den Sieg davontragen. „Schwanken wir nicht immerdar“, sagte sie zu sich, „an der Grenze des Wahnsinns hin? Arbeit, Pflicht, Scherz und Andacht müssen uns immerdar zerstreuen, um nicht in den stets offnen Abgrund hineinzutaumeln, wie sie vor wenigen Tagen dort in den Wassersturz.“
Sie sendete Ursula, die alte Amme, da Flaminio nicht zugegen war, zum Weltpriester hin, um zu erfahren, ob Camillo Mattei nicht gar von jenem Wagnis krank geworden sei, da er noch immer nichts von sich hatte hören lassen. Die berührige geschwätzige Alte freute sich, in dem kleinen Orte, in welchem sie nur wenige Unterhaltung fand, wieder einmal eine neue Bekanntschaft zu machen. Nachdem sie ihre Kleidung verbessert und einen weißen Schleier umgelegt hatte, begab sie sich in das kleine Haus des Priesters. Der Alte sah verdrüßlich von seinem Gebetbuche auf nach der unbekannten Besucherin hin, die sogleich redselig die Grüße ihrer Herrschaft hersagte und sich dann erkundigte, warum denn der junge, liebenswürdige Mattei noch nicht wiedergekommen sei, um die herzlichsten Danksagungen der ganzen Familie zu empfangen.
„Setzt Euch, alte Person, ruht Euch aus,“ sagte der Priester; „das Schwatzen muß Euch sehr müde machen. Mein Neffe, Gott tröste ihn, ist krank. Die junge fröhliche Dame ist, wie ich höre, mit weniger selbst als einem blauen Auge davongekommen. So geht es immer mit den Vornehmen und Reichen: wir armes Gesindel müssen alles ausbaden und den Schaden bezahlen. Das Wasser hat meinem jungen Bengel nicht geschadet, aber beim Hineinspringen ist er so heftig auf die spitzen Steine aufgeschlagen, daß Rücken, Rippen, Hüften, alles ein Schmerz ist. Er hat Beulen und ist so blau gefärbt und angelaufen wie der damaszierte Stahl. – Das wißt Ihr doch von Eurer Jugend her, aus der Naturgeschichte, Ihr altes Kind, daß Steine nicht so weich sind wie das Wasser?“
„Lieber Himmel, nein,“ sagte Ursula, „das habe ich noch nicht vergessen. Ich habe alle meine Herrschaften aufgesäugt, sonst wäre meine gnädige Signora Julia auch wohl nicht so schön geblieben, und alle die Kinder, vorzüglich aber das älteste, der Herr Abbate, mögen mir vielen Verstand und Einsicht und Gedächtnis weggesogen haben, womit sie nun in der Welt prunken und Aufsehen erregen, aber diese Kenntnis und Einsicht ist mir doch geblieben. Ja, ehrwürdiger Herr, Steine sind in der Regel hart, aber auf verschiedene Art, nach seiner Temperatur ein jeder: aber darauf hinstürzen ist keinem Körper gesund. Sonst hätten die bösen Juden den heiligen Stephanus gar nicht steinigen können, wenn in den Kieseln nicht eine gewisse Härte wäre.“
„Eure Kenntnis wandelt auf dem ganz richtigen Wege,“ fuhr der Priester fort; „man freut sich, mit Menschen von Geist und Erfahrung Bekanntschaft zu machen, denn die Welt verdummt immer mehr. Aber meinen Neffen, den haben die Herrschaften, so scheint es mir, verbraucht; denn wenn er auch wieder aufkommen sollte, wird er doch zeitlebens ein Narr bleiben. Da phantasiert und tollt er auf seinem Lager herum und spricht von den alten heidnischen Göttern, von denen er wenigstens ein Dutzend, so schreit er es aus, da unten im Wasserfall kennen gelernt hat. Dann sagt er zur Abwechselung, er sei selbst eine von den alten Gottheiten, und Euer hochgewachsenes Fräulein habe ihn dazu gestempelt. Er meint in seiner philosophischen Raserei, er hätte sich eigentlich, wenn er Menschenverstand gehabt hätte, neulich umbringen sollen und die überweise Vittoria zugleich mit, so würden die beiden jetzt in den elysischen Gärten spazieren gehn und die reifsten und süßesten Maulaffenbeeren von den Bäumen herunternaschen. Von der Religion will er nun gar nichts wissen, weil er meint, die könne ihm zu seinem künftigen Fortkommen in der Hölle doch von keinem sonderlichen Nutzen sein; denn Herr Pluto und dessen unterirdische Richter examinierten die Kandidaten nach einem gar andern Katechismus. Kurz, der Bursche ist mir und der ganzen Christenheit dermalen verdorben, und das hat einzig Eure superkluge Herrschaft zu verantworten, die das junge Blut als einen Pudelhund mit sich nahm, um verlornen Hochmut aus dem Wasser wieder heraufzuholen. Ich habe sogleich den Apotheker müssen kommen lassen, der ihn bepflasterte und ihm Latwergen und Tränke und Tropfen mitgebracht hat, die ich armer Gesell aus meiner knappen Wirtschaft nun alle bezahlen muß; alles bittres, verfluchtes, niederträchtiges Zeug, wo sie mir noch viel Geldes dazu geben müßten, wenn ich sollte überredet werden, das gottlose Höllengesöff hinunterzuschlucken. Der einzige greifliche Vorteil bei der ganzen verfluchten Geschichte ist, daß das dumme Lammsgesicht in den ersten zehn Jahren nicht wieder braucht geprügelt zu werden, weil ihm Rücken und Rippen von der remarkablen Geschichte beinah zerquetscht und zertrümmert sind.“
„Geistlicher Herr,“ sagte Ursula, „Ihr beliebt so klug und so quatsch durcheinanderzusprechen, daß es fast unmöglich ist, Eure Meinung zu kapieren. Wenigstens macht Ihr es den Laien ziemlich schwer.“
„Nun, so seht Euch die Bescherung selbst an,“ sagte der Geistliche, „wenn Ihr Euch aus meiner Legende nicht zu vernehmen wißt.“
Sie gingen in die Kammer, wo der Kranke sich unruhig auf seinem schlechten Lager wälzte. Seine Augen glühten, und als die beiden eintraten, rief er ihnen entgegen: „Teuerster Monsignore Charon, bringt Er sie jetzt herüber, meine längst angetraute Gemahlin, die Dame Vittoria? Ei was! Ist sie schon seit den kurzen dreihundert Jahren so sehr gealtert, wie muß ich dann erst aussehn, der ich schon vor meiner Geburt ein alter Kerl war? – Wie? Runzeln in dem braunen Gesicht? Warum gerade so? Kann das Alter denn nicht bloß ehrwürdig erscheinen, warum muß es gerade lächerlich sein?“
„Nein, nein, junges Blut,“ rief Ursula unwillig aus; „ich bin nicht die Herrschaft, ich bin die Amme, die sie großgesäugt hat, darum laßt Eure Pasquinaden und wendet Euch an Gott, damit er Euch gesund mache und Euren verfallenen Verstand wiederherstelle.“
„Ihr habt sie mit Eurem Blut, mit Eurer Milch, mit Euren Lebenskräften gesäugt?“ rief der Kranke; „kommt näher, Musterbild aller Schönheit, denn auf die Weise hat sie ja nur von Euch ihre Vollkommenheiten. Ehe sie selber war, ruhten ihr Auge, die süßtönende Rede, die Himmelslippen, alle die Verse, die sie weiß und selber dichtet, schon in dieser verknöcherten, kastanienbraunen Brust? O kommt und reicht mir auch etwas von dieser Nahrung, damit ich doch einige Ähnlichkeit mit ihr bekomme.“
„Pfui!“ schrie die Alte erbittert, „Er sollte doch wenigstens auf eine dezente Art rasen, daß wohlerzogene Frauenzimmer sich über Seine Liebesphrasen nicht zu schämen brauchten.“
Sie ging böse und scheltend fort und erstattete der Herrschaft nur einen sehr unvollkommenen und verwirrten Bericht. Die Signora Julia schickte durch ihren jüngern Sohn eine bedeutende Summe zum Pfarrer, damit ihm der kranke Neffe nicht zu viele Ausgaben veranlasse, auch sorgte sie dafür, daß ein verständiger Arzt außer dem halbgelehrten Apotheker sich auf ihre Rechnung des Leidenden annahm. Auch kühlende Sachen, eingemachte Früchte und andere Erfrischungen besorgte sie, und so hoffte sie, bald von der Besserung und Genesung des Camillo Mattei zu vernehmen.
Drittes Kapitel
Es hatte sich mit Camillo gebessert. Die kräftige frische Jugend kämpfte das Fieber und die Krankheit nieder. Der Beistand, den ihm die Signora Julia durch ihre Bemühung verschafft hatte, indem sie ihm einen verständigen Arzt sendete, die Beruhigung, die sie durch ihre Unterstützung dem alten Priester gewährte, alles dies hatte die Wiederherstellung des jungen Mannes beschleunigt. Er meldete sich bei der Familie, um seinen Dank abzustatten, und die Mutter empfing ihn freundlich, aber zugleich mit einer gewissen Feierlichkeit. Auch Virginia, von dem strengen, beobachtenden Auge der Mutter beherrscht, hatte einen andern Ton gegen ihn angenommen, als den er bisher gewöhnt war, und so fühlte sich Camillo, der nach jener Szene ganz andere Erwartungen mitgebracht hatte, verletzt und gedemütigt; er war verlegen, und wenn ihn die Gesellschaft nicht beschämt hätte, so würde er sein Gefühl wohl in heißen Tränen ergossen haben.
„Ihr werdet nun wohl“, sagte die Mutter, um das zögernde Gespräch in Bewegung zu setzen, „zu Euren Eltern nach der Stadt zurückkehren, um weiterzustudieren. Seid Ihr erst etwas vorgeschritten, mein lieber junger Freund, so werde ich nicht ermangeln, Euch meinem Sohn, dem Abte, zu empfehlen, ja, ich werde vielleicht die Gelegenheit finden, zu Eurem Besten mit dem großen Kardinal Farnese zu sprechen, der jetzt wahrlich, zunächst unserm Heiligen Vater, den größten Einfluß auf die kirchlichen Angelegenheiten hat. Zeigt Ihr Euch nun wacker und unterrichtet, darf man später von Eurer Rechtgläubigkeit überzeugt sein, so wird es Euch gelingen, bald in eine einträgliche Stelle versetzt zu werden, von welcher Ihr allgemach höher steigen mögt, um auch Euren teuren Eltern ihre Liebe und die Opfer, die sie Euch gebracht haben, vergelten und ersetzen zu können.“
Vittoria war im Innern über diese wohlgesetzte Rede aufgebracht, aber sie hatte nicht den Mut, in Camillos Gegenwart ihr Erzürnen kund werden zu lassen, um nicht einen vielleicht unziemlichen Auftritt herbeizuführen. Die Mutter merkte ihre Verstimmung, sie hatte sich aber fest vorgenommen, sich durch nichts in ihrem Entschluß irremachen zu lassen. Camillo erwiderte stotternd und mit hoher Röte im Gesicht: „Signora, ich werde noch acht Tage hier in Tivoli verbleiben, so hat es mir der Arzt befohlen, den Ihr mir zu senden die Gnade hattet. Ich werde dann nach Rom zurückkehren, aber ganz in Zweifel und Ungewißheit, mehr als je, ob ich auch würdig genug sei, mich dem geistlichen Stande widmen zu können. Es ist gar zu schmerzlich, sein ganzes Leben einem Berufe zu weihen, den man mit entschiedenem Widerwillen antritt. Ihr wollt mich beschützen – o, wie glücklich würde ich mich fühlen, wenn Ihr mir irgendwo, sei es in Venedig, Florenz oder wo es auch wäre, eine Stelle und Aussicht beim Soldatenstande schaffen könntet. Oder wenn sich ein Kaufherr in Genua oder ein venezianischer meiner annehmen wollte. Ich fürchte, ich bin nicht fromm; zwinge ich mich also, ganz gegen Neigung, in das geistliche Wesen hinein, so ist zu besorgen, daß ich aus Tücke und Widerspruch, wie der Mensch nun einmal ist, auf gar arge Ketzereien geraten und in dem Zustaude Leib und Seele verlieren möchte.“ –
„Junger Mensch,“ sagte die Matrone mit kalter Sicherheit, „Ihr kennt Euch selbst noch nicht hinreichend. Folgt meinem Rate, denn er ist gewiß der beste. An meinem eigenen Sohne Marcello erlebe ich es, wie schwer es ist, den Söhnen eine andere Laufbahn als die der Kirche zu eröffnen. Beim Soldaten hat der Edelmann immerdar den Vorzug, und alle die großen Häuser in Italien sorgen dafür, daß bei allen Fürsten in den Ländern ihre Schützlinge und Anverwandten die einträglichen Stellen erhalten. Mit Kaufleuten stehe ich in gar keiner Bekanntschaft, denn meine Verbindungen, durch welche ich Euch nützen könnte, erstrecken sich eben nicht über Rom hinaus. Bei der Bestimmung unseres Lebens dürfen wir nicht zu viel auf unsere Neigungen oder Leidenschaften hinhören, denn das Schicksal des Daseins, dem wir in dem Augenblicke der Bestimmung entgegentreten und es herbeirufen, ist zu ernst, um Spiele und Gewöhnungen der Kindheit, jene leichten Blüten, die den Früchten weichen sollen, mit hinüberzunehmen. Dadurch, daß Ihr uns bekannt seid, daß wir Euch so innig verpflichtet wurden, so daß ich gezwungen bin, für Euch wie für einen lieben Verwandten zu denken und zu sorgen, dadurch, daß es sich fügt, daß wohlwollende Gönner und Freunde von großem Einfluß auf meine Worte, Bitten und Empfehlungen achten: dadurch, lieber Mattei, zwingt Euch das, was ich Schicksal nenne, Euch dieser Bestimmung und keiner andern zu ergeben. Und seid Ihr denn gar nicht stolz, junger Freund? Seht um Euch, wie große Männer allenthalben aus Armut und Niedrigkeit sich auf diesem so ehrenvollen Wege emporgeschwungen haben. Hier, im geistlichen Gebiet, ist die echte Republik, die Gleichheit aller Geschlechter und Stände; Kirchendiener, Bischöfe, Heilige, ja Päpste sind aus Armut und Dunkelheit emporgestiegen, um der Welt zu leuchten und ihre Familie zu verherrlichen. Haben wir nicht ganz in der Nähe ein Beispiel an unserm Kirchenfürsten, dem gelehrten großen Kardinal Montalto, dessen Familienname Peretti ist? Wer spricht im römischen Staat, ja in ganz Italien diesen Namen Peretti nicht mit Ehrfurcht aus? Und er ist einem so armen, niedrigen, schwachen Hause entsprungen, daß Eure wackern bürgerlichen Eltern sich gegen seine Familie wohl eine vornehme dünken möchten. Als Knabe war dieser große Geist genötigt, das Vieh zu hüten, durch Almosen ward er großgezogen, schwache, armutselige Priester und Mönche waren seine ersten Beschützer – und jetzt! Ist er auch nicht reich, so kann er doch, wie jeder Kardinal, in wenigen Jahren wohl selbst Papst werden. Seht, mein Freund, der Stand, den Ihr nicht achten wollt, ist einzig der, wo Fleiß und Charakter sich geltend machen und die Schwächsten, hier durchgerungen, die Welt beherrschen können.“
Die Frauen erschraken, als in diesem Augenblicke der erst verschüchterte Camillo ein lautes Lachen aufschlug. „O ja,“ rief er, „ich kann auch nach Asien wandern, mich für heilig ausgeben und der große Mogul werden. Was hindert mich, es auf den weltberühmten geheimnisvollen Priester Johannes anzulegen? Von Melchisedek und den drei Königen aus dem Morgenlande weiß man auch die Abstammung nicht. Dürfte es nicht auch geraten sein, sich mit dem ewigen Juden zu assoziieren und sich von dem Brausewind zum Kompagnon annehmen zu lassen? Der macht ja auch Geschäfte mit und in aller Welt.“
Plötzlich schwieg er still, sah starr vor sich nieder und trocknete sich heimlich eine Träne aus dem Auge. Mutter und Tochter sahen sich mit Erstaunen an, und die sonderbare Blässe des Marmors stand auf Vittorias Angesicht. Camillo richtete sich in mächtiger Verwirrung auf und sagte mit gebrochener Stimme: „Verzeiht mir, ihr Hochverehrten, meine Ungezogenheit. Ich bin ein elender Mensch und verdiene nicht, in guter Gesellschaft zugelassen zu sein. Mir geschieht recht, wenn ich von den Edlen ausgestoßen werde.“
Er erhob sich zitternd. Demütig nahte er der Signora Julia und küßte ihre Hand, dann näherte er sich der Tochter, faßte ihre Finger, hielt sie lange fest und konnte dann seine Lippen kaum entfernen, indem er fühlte, wie sein Druck, wenn auch nur leise, von der schönen Jungfrau erwidert wurde. So wankte er dann, wie ohnmächtig, zur Tür hinaus.
Mit dem Ausdruck der Heftigkeit stand die Matrone vom Sessel auf und ging an das Fenster. Vittoria blieb auf ihrem Stuhle und sah mit etwas scheuem Blicke nach der Mutter hinüber. – „Also schon jetzt!“ rief die Mutter aus; „ich habe es ja gesagt! So ist die elende Beschaffenheit unsrer menschlichen Seele, daß aus jedem Ohngefähr tolle Hoffnungen erwachsen, deren sie sich schwindelnd bemächtiget. Nun ist man stolz und trotzt und pocht in verächtlicher Aufregung einer rasenden Leidenschaft. Man spielt den Herrn der Welt, indem man tief unter dem blödsinnigen Bettler steht. Und eigentlich hast du es verschuldet!“
„Ich?“ fragte die Tochter erschreckend.
„Weil du kindlich und unerfahren dein Herz und deine Zunge nicht genug bewachtest. Deine unschuldige Neigung hat er in seinem männlichen Eigennutz ganz anders gedeutet: diese angeborne Eitelkeit und Anmaßung des Geschlechts hat dich ihm schon erniedrigt, weil du höher standest als er, weil du ihm reizend und wünschenswert erscheinst; seine Einbildung hat dich schon in Besitz genommen, und daß sein Irrsinn schon zur wahren Leidenschaft herangewachsen ist, zeigt seine Raserei, die wir von ihm haben ertragen müssen.“
„Was kann ich aber für das alles?“ warf Vittoria mit Schüchternheit ein.
„Wie, Törin?“ eiferte die Mutter, „sah ich es denn nicht (o ja, du kannst es meinem scharfen Auge nicht ableugnen),daß du ihm noch beim Abschied die Hand drücktest?“
„Und wenn es ist,“ sagte Vittoria, „gibt es etwas Unschuldigeres? Er tat mir so leid, weiter habe ich mir nichts dabei gedacht.“
„Und du meinst,“ antwortete die Matrone, „daß der Ungestüme sich diesen Druck nicht ganz anders wird ausgelegt haben? Für eine Liebeserklärung von deiner Seite hat er ihn genommen. Liebst du ihn wirklich, so tatst du etwas sehr Unrechtes, aber du handeltest ehrlich; liebst du ihn aber nicht, so war es ein armseliger Betrug und gehört zu jenen schlechten Künsten, mit denen Weiber, die mit Recht verrufen sind, Handel und Wandel treiben und nur gar zu oft durch fortgesetzte Unwahrheit die edelsten Männer zur Verzweiflung bringen.“
„Du gehst im Eifer zu weit“, sagte die Tochter mit großer Ruhe. „Gibt es denn außer wilder, roher Leidenschaft, die unbedingt auf Besitz dringt, und jener kalten, toten Gleichgültigkeit nichts Edles, Freundliches, Zartes, was zwischen diesen Äußersten liegt? Und daß ich es dir nur gestehe, ich war dem kleinen Camillo immer gut, aber noch niemals hat er mir so sehr gefallen als in seiner aberwitzigen komischen Rede, die dich so sehr gegen ihn aufgebracht hat. Diese Kraft hätte ich ihm niemals zugetraut. Ist es denn also möglich, wie du neulich äußertest, daß ich auch noch Leidenschaft und Wunsch nach der Ehe würde kennen lernen, nun so erzieht sich vielleicht meine Zärtlichkeit für meinen Mattei noch zu dieser Liebe. So laß denn diesen Gefühlen ihren Lauf, und es ergibt sich nach Jahren vielleicht, daß du richtig gesehen hast.“
„Daß der Wahnsinn ansteckend ist, erfahre ich nunmehr ganz deutlich“, sagte die Mutter und sprach nun kein Wort mehr. –
Camillo ging indessen langsam und zögernd nach dem Hause seines Oheims zurück. „Ja, ja,“ sprach er bei sich selbst, „recht hat der alte verdrüßliche Mensch! Die Vornehmen – sie taugen alle nichts! Nur bei der Armut wohnt Liebe und Tugend! Das sehe ich an meinen Eltern, an so vielen Elenden! O dieser verächtliche Hochmut der armen, vergänglichen Sterblichen! – Und diese hochgetürmte weise Hoffartsdame! Was ist sie denn Großes? Die Witwe eines wohlhabenden Advokaten und Richters. Dazu hätte mein Vater auch gelangen können, wenn er das Vermögen besessen hätte, zu studieren. Sie ist freilich aus einem adligen Hause: ist aber doch auch zu einem Rechtsgelehrten hinabgestiegen! – Unsinn, daß sich mit dieser – Ungleichheit auch die niedrigen Stände brüsten! – Ich ein Geistlicher! Lieber Kohlenbrenner, Räuber, Bandit. – Und sie – ach ja, da im Saal ist es anders als da unten, so nah an der Hölle, wo sie sich mir mit allen Kräften und Schönheiten ergab. Warum war ich so dumm und töricht, in diesem Taumel, wo wir die ganze Welt vergessen, nicht mehr zu verlangen? Sie hätt es nicht geweigert. Und was ist es denn Großes? Das Nächste, Natürlichste, was ein einfach unverdorbener Mensch nur denken und begehren kann. War doch Busen, Knie und glänzender Leib schon mein, und in den Küssen entfloh meine Seele über ihre himmlischen Lippen in ihr Wesen hinüber. – Nichts! nichts! Alles ist eitel! Auch sie verwelkt und vergeht, nichts ist echt und wahr als nur die Zeit und der Augenblick; und diesen muß der Kluge ergreifen! Wenn er dazu entschlossen ist. so gehört ihm die Welt.“
Zu Hause angelangt, legte er sich nieder, denn er war wieder ein Raub des Fiebers. –
Nach Tische wurde der Familie der allbekannte Hausfreund Don Cesare Caporale gemeldet. Mutter und Tochter waren erfreut, den wackern Mann begrüßen zu können, durch welchen sie aus ihrer Verstimmung gerissen wurden und der ihnen durch seine unzerstörbare Heiterkeit eine anmutige Zerstreuung versprach.
Cesare Caporale war eine jener hohen, schlanken Gestalten, die durch den Ausdruck harmloser Gutmütigkeit die Häßlichkeit ihres Gesichtes vergessen machen können. Sein Anstand und die Gebärde war edel, und man sah ihm an, daß er viel in der großen Welt gelebt hatte. Die kleine, zurückgekrümmte Nase in dem langen, gebräunten Gesicht, die vielen Falten gaben ihm neben dem fast Geringen und Possierlichen den Anschein eines höheren Alters, als er wirklich erreicht hatte, denn er war noch nicht fünfzig Jahr. Seine grauen, kleinen und lebhaften Augen verrieten den Schalk, denn sie begleiteten jedes seiner Worte mit so geistreichem Ausdruck, daß viele seiner Aussprüche von seinem Munde witzig schienen, die man oft als Rede eines andern für unbedeutend würde gehalten haben.
Mit seiner gewöhnlichen Gutmütigkeit schüttelte er den beiden Damen die Hand, setzte sich behaglich nieder und sagte: „Da bin ich wieder einmal bei euch, ihr Gotteskinder, und das tut mir wohl, wie die Frühlingssonne dem Kranken. Ich war wieder da hinten in meinem geliebten kleinen Perugia und habe eine Zeitlang fröhlich mit meinen Freunden in meiner Vaterstadt gelebt. Das liebe Nest steht noch auf dem alten Fleck, keiner meiner Bekannten ist in diesem Jahre gestorben, in meinem Vaterhause ist mein Quartier für mich immer offen, und so habe ich denn auch die Kirchen wieder besehn, die Berge besucht und mich an den Gebilden unsers alten Meisters Pietro und seines großen Schülers Raffael erfreut. Wie ich nach Rom komme, höre ich zu meinem Entsetzen, ihr alle hier wäret ersoffen oder, mit Erlaubnis zu sagen, ertrunken, was aber beinah auf eines hinausläuft. Das war ein Lamento bei allen den schönen geputzten jungen Narren, daß es nicht auszusagen ist. Je nun freilich, wenn man hübsch ist, wird man eher vermißt, als wenn man, wie ich leider, mit einer so fatalen Fratze herumläuft. Aber sagt um des Himmels willen, was habt ihr eigentlich angefangen, daß man euch so verleumden darf; denn ich sehe ja, daß ihr hier ganz als vernünftige Wesen auf dem Trocknen beisammensitzt. Die hochgesinnte Mutter, die ausbündige Vittoria und der hoffnungsvolle Flaminio sind alle wohlbehalten, wenn auch etwas nachdenkend, wo nicht gar gelangweilt, was ich aber doch nicht zu voreilig annehmen will.“
Die Mutter übernahm es, ihm in kurzen Worten die sonderbare Geschichte, die so leicht tragisch hätte endigen können, zu erzählen. „Seht! seht!“ sagte Cesare am Schluß; „ich habe immer behauptet, daß unsre Virginia für ihre große Gestalt in ihren Gebärden und Bewegungen zu hastig und berührig ist. Dergleichen schickt sich nur für kleine Persönchen, die es manchmal auch recht gut kleidet. Darum halte ich mich mit meinem hohen Körper, den langen Beinen und Armen immer so majestätisch. Fällt mir ein lumpiger Ball ins Wasser (ich trage aber niemals einen mit mir herum), so lasse ich ihn wegschwimmen; und dort gar in dem Höllenrachen, den ich immer die Grotte des Neptun genannt habe, obgleich strenggenommen der gewaltige Mann sich mit den Flüssen des Landes gar nicht einläßt. Wenn Ihr dort umgekommen wärt, so hätte ich Euch wohl gar, als Euer alter Anbeter, besingen und beklagen müssen, obgleich mir noch niemals ein ernsthafter Vers hat gelingen wollen.“
„Aber habt Ihr uns keine neue Komposition mitgebracht?“ fragte die Mutter.
„Der Poet“, antwortete Caporale, „ist zuweilen an Entwürfen und Plänen so reich, daß er darüber gar nicht dazu kommen kann, einen einzigen auszuführen. Ich lief in der schönen Gegend von Perugia viel herum und meditierte. Mein Gedicht über das Leben des Mäcenas ist nun fast fertig, aber außer einer neuen Komödie ist mir auch noch ein komischer Vorwurf dort in der Einsamkeit aufgestiegen. Ich dachte mir nämlich, wie Apollo auf seinem Jagdschloß eine Versammlung könnte ausschreiben lassen, daß sich alle, die sich für Poeten hielten, zu ihm einfinden sollten, um aus seinem Munde und von verständigen Richtern und Beisassen ihr Urteil zu empfangen. Die Aufgabe ist häklig und kitzlig: denn wie viele unserer jetzt lebenden Pedanten oder talentlosen Reimer würde man da ärgern und kränken müssen; darum gebe ich den Gedanken auch vielleicht wieder auf, wenn ich nicht einen anständigen Mittelweg entdecken kann.“
„O Bester!“ rief Vittoria lebhaft aus, „da müßt Ihr alle meine Lieblinge recht loben und diejenigen, die mich immer geärgert haben, recht beißend durchziehn und schwarz abschildern.“
„Zum Beispiel?“ fragte der Poet.
„Wen kann man wohl mehr loben“, fuhr sie fort, „als den edlen, herrlichen Bernard Tasso und dessen Sohn Torquato, wegen seines himmlischen Aminta? Schelten müßt Ihr auf den rechthaberischen kritischen Sperone.“
„Geht schon deswegen nicht,“ antwortete der Dichter, „weil ich ihn jetzt eben in Rom gesprochen habe und er sich recht freundlich gegen mich erwiesen hat. – Also um fortzufahren: ich wandelte dort in den Bergen von Perugia sinnend umher, voll Launen und Projekte, Verdruß und Freude. So kam ich auf ein grünes Feld in der Abendstunde, die Sonne ging unter, und es gemahnte mich, noch immer draußen zu bleiben. Mit einem Male blitzt mich aus dem grünen Gebüsch vor mir etwas so großäugig an, so unnatürlich feurig, daß ich dachte, die Sonne wäre vielleicht umgekehrt: und nun sah ichs, und es war Venus, der Abendstern. Aber noch nie hatte ich ihn in dieser Herrlichkeit gesehn. Nun gut, ich ließ es mir gern gefallen, daß es etwas so Schönes in der Welt und der Natur gab, und ging immer weiter, an mein dumpfes Gedicht denkend und spekulierend. Auch gibt es wirklich Epochen in unserem Leben, in welchen man die sogenannte Zeit völlig vergißt. So war es mit mir. Der Abend hatte mich ausgehn sehn, und die stille Nacht fand mich noch draußen. Wie ich noch so fortwandelte, deucht mir, es erhebe sich im Osten eine Art von lichtem Grau, ein klarer, wallender Schimmer, und wie ich mich noch darüber verwundre (denn ich hatte ganz vergessen, daß es wohl Morgen sein könne), fahre ich im Schrecken zurück, denn wieder blitzt eine solche Glutmaschine, so ein Jupiter, als wenn er eben einer Liebschaft wegen zur Erde gesunken wäre, mir entgegen, ein göttlich glänzender Stern, dicht auf dem grünen Boden, äugelnd im feuchten Grase und den triefenden Granaten liebkosend, – und siehe da, was ich für einen zerschnittenen Vollmond hielt – nur reiner, weißer glänzend – sei es Jupiter, Mars, Sirius – mir war es, dem Unwissenden, die göttliche Aphrodite, die Göttin der Liebe. –