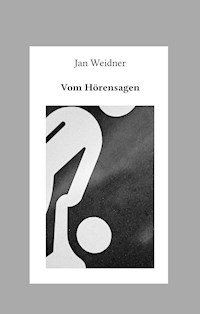
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Ihre Geschichte beginnt am Ende, mit dem letzten Satz Sommerreifen, der den Kontakt zum Asphalt verliert und für den Bruchteil einer Sekunde frei über der Böschung steht.“ – mit diesem Satz vom Ende her beginnt Jan Weidner seine Erzählung „Vom Hörensagen“, die auch eine Erzählung über das Erzählen ist, eine Geschichte darüber, wie etwas zur Geschichte wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 66
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
Ihre Geschichte beginnt am Ende, mit dem letzten Satz Sommerreifen, der den Kontakt zum Asphalt verliert und für den Bruchteil einer Sekunde frei über der Böschung steht.
Unten wird man noch Tage später die frische Narbe der beiden Fahrrillen sehen können, schnurgerade, gezogen vom Fuß der Böschung hin zu einem windschiefen Geräteschuppen, der sich, von der Straße aus gesehen, am Wiesenrand hinter den Stamm einer Birke duckt.
Die Frage, weshalb das Automobil die Straße verlassen hatte und ausgerechnet hier zu seinem abrupten Halt gekommen war, wird sie später zugunsten irrelevanter Details unbeantwortet lassen: Frühnebel, gereizte, aufgescheuchte Vogelstimmen. Qualm, der dem Motorraum entweicht. Tropfen von Tauwasser rinnen die Birkenblätter entlang und schlagen mit hellem Klang in die Pfütze am Boden einer Regentonne. Hinter einem Stück Wellblech ragt das metallene Schlangennest einer Rolle Stacheldraht hervor – anhand der Fotografien, die man später anfertigen und ihr vorzeigen wird, wird sie lediglich zu Protokoll geben, sich am Stacheldraht die Hosenbeine aufgerissen zu haben, als sie ihr Bündel hinterm Schuppen deponiert habe, zwischen morschen Holzlatten und rostigen, von Luftgewehrschüssen durchsiebten Blechdosen. Alles Andere, wird sie später sagen, sei ihr entfallen.
Als es getan ist, setzt sie sich wieder ans Steuer und schließt ihre zitternden Finger um die störrische Lenkvorrichtung. Die Nässe von Fahrersitz und Hosenboden verliert sich in der Taubheit ihres Unterleibs. Der Rückspiegel wirft ihr einen kritischen Blick zu, wirft ihr den kritischen Augenblick zurück, den sie damals, vor Jahrzehnten, in die Kameralinse gerichtet hatte:
Blumen im Haar, ausgezupfte, handverlesene Blütenblätter im Mund wie gestrandete Schiffe auf einer frech herausgestreckten Landzunge … die Mädchenbeine in ihrem ersten Paar Gummistiefel, rosafarben, ein Geschenk der Großeltern, die Zeit ihres Lebens praktisch veranlagte Menschen gewesen waren … aus akkurat angelegten Schützengräben kratzt der Weizen die Erde unter ihren Stiefelsohlen auf, mit spröden, tastenden Fingern … Sonnenflecken im Polaroidpapier, die ihr Vater, am Stubentisch sitzend, mit einem glimmenden Zigarettenstummel ins Fotoalbum brennt … schwarze Pupillen wie Einschusslöcher vom Luftgewehr … – Der hausgeborene, lumpengepackte Säugling, die Haare nach der Geburt so dunkel, dass ihr Vater außer sich gerät, aus der Stube stürmt – „Des is‘ net meins“ – der von der Großmutter im Wiegeschritt besungene Arme Teufel, der Täufling, in den Armen des Taufpaten, vom Regen in die Taufe kommend …
Es wird für die spätere Auswertung irrelevant sein, wann und ob überhaupt sie die Sonnenblende herunterklappt und das Papierfach leert, in dem sich zu diesem Zeitpunkt ein, zwei Dokumente, das Bildnis des Heiligen Christopher und die später von ihr erwähnte Fotografie aus der Guten Zeit befinden – die Momente, die soeben verstreichen, werden sich später, aus der lückenhaften Erinnerung heraus, mit der Betrachtung dieser Fotografie aus der Guten Zeit oder mit der Betrachtung ihrer eigenen Reflexion im Rückspiegel füllen lassen, mit flüchtigen Gedanken, die in keinem Gutachten Platz finden und sich mangels Relevanz in Rauch auflösen oder in den Rauch mischen werden, der weiterhin dem Motorraum entweicht.
Nach einigen Minuten, die sich in der späteren Schilderung zu einer leeren, aber sorgfältig bemessenen Zeitspanne addiert haben werden, löst sie ihre Hände wieder vom Lenkrad und tippt den Hilferuf einer schlussendlich verworfenen SMS in ihr Mobiltelefon.
EINS
Am Morgen hatte man sie abgeholt.
Stabat Mater dolorosa – Christi Mutter stand mit Schmerzen, denke ich mir, könnte ich später in mein Notizbuch eintragen und damit meine Schilderung des heutigen Morgens beginnen, an dem wir beide – sie: am Stubenfenster stehend, und ich: auf der Eckbank sitzend – das Auftauchen des Automobils an der Biegung der Dorfstraße erwarten.
Gleich zu Beginn hattest du ihr versprechen müssen, keine Geschichte draus zu machen.
Den Blick unbeirrt aus dem Fenster und somit auf die Biegung der Dorfstraße gerichtet, erwähnt sie zum wiederholten Mal am heutigen Morgen die Weihwasserschale, die in den, wie sie es ausdrückt, tönernen Armen einer Jungfrau Maria an der Stubentür gehangen habe. Genauer gesagt sei diese Muttergottes unter das Kruzifix am Türrahmen genagelt gewesen – Bei dem Kreuz und weint von Herzen, könnte ich später in mein Notizbuch eintragen – unter das elendige Kruzifix mit dem bleiernen Heiland, das ja immer noch am Türrahmen der Stubentür hänge, weil es ihr unmöglich sei, sich davon zu trennen. Schon zuvor sei es für sie undenkbar gewesen, sich von diesem elendigen Kruzifix zu trennen – es sei ihr aber erst recht unmöglich, seit ihr das Fehlen der Muttergottes mit der Weihwasserschale aufgefallen sei.
Von deinem Platz auf der Eckbank aus hattest du die leere Stelle an der Stubentür sehen können.
Seit Jahr und Tag, sagt sie, gehe sie schon durch diese Stubentür ein und aus, das Fehlen der Muttergottes sei ihr aber erst kürzlich aufgefallen – dabei müsse sie schon seit Jahr und Tag verschwunden sein, müsse seit Jahr und Tag lediglich ein Trugbild, das Überbleibsel einer kindlichen Erinnerung gewesen sein. Und jetzt, sagt sie, ohne den Blick von der Biegung der Dorfstraße abzuwenden, lasse ihr der Gedanke an die Muttergottes mit der Weihwasserschale keine Ruhe mehr. Dieses abrupte Auftauchen der Muttergottes vor ihrem, wie sie es ausdrückt, geistigen Auge bringe sie Nacht für Nacht um den Schlaf – bringe sie dazu, Nacht für Nacht ins Dunkel der Schlafstube zu starren, wo sie immerzu diese Muttergottes vor ihrem geistigen Auge sehe. Und auch jetzt, sagt sie, dränge diese Muttergottes mit der Weihwasserschale ja geradezu gewaltsam in das Geständnis, das sie eigentlich vor mir habe ablegen wollen, was doch das Mindeste sei. Es sei doch, wiederholt sie, das Mindeste, mir gegenüber ein umfassendes Geständnis abzulegen – denn immerhin sei ich es, der mit ihr zusammen auf das Automobil warte, das sicherlich jeden Moment an der Biegung der Dorfstraße auftauchen werde.
Hätte nicht jede Äußerung deinerseits dieses Geständnis verfälscht?
Zu guter Letzt, denke ich mir, wird mir eine Regung in ihrem bislang ausdruckslosen Gesicht den Moment verraten müssen, in dem das Automobil an der Biegung der Dorfstraße auftaucht – von meinem Platz auf der Eckbank sehe ich lediglich die Dächer der Nachbarhäuser, die Antennen und Satellitenschüsseln, die in einen blankpolierten Himmel ragen. Von draußen dringt das Geläut der Kirchenglocken in die Stube, der helle Klang von Sonntagsschuhen auf dem Trottoir.
Merkwürdig war es dir vorgekommen, dass sie ausgerechnet an einem Sonntag ins Dorf fahren würden.
In der Weihwasserschale, fährt sie fort, habe die Mutter jedes Mal, kaum sei sie nach Hause gekommen, ihre Finger befeuchtet – das Befeuchten der Finger sei für die Mutter stets das Erste gewesen, worauf sie, die Mutter, beim Nachhausekommen geachtet habe. Die Mutter sei noch nicht mit beiden Füßen über der Türschwelle gewesen, da habe sie auch schon ihre Finger ins Weihwasser getunkt, habe die vom Weihwasser triefnassen Finger in einer stummen Bewegung zur Stirn geführt und alles Weitere, alles Unausgesprochene mit einem triefnassen Kreuzzeichen hinter der Stirn verschlossen.
Augenblicklich hatte sich dir das Bild eines Tabernakels aufgedrängt.
Es sei dieser stets gleich gebliebene Ablauf, der ihr heute wieder lebendig vor die Augen trete, sagt sie, so sehr habe er sich in ihr Gedächtnis eingebrannt. Vor ihrem, wie sie es ausdrückt, geistigen Auge sehe sie also immerzu diese stumm ausgeführte Bewegung, dieses Sich-Bekreuzigen, mit dem die Mutter stets alles Weitere, alles Unausgesprochene ausradiert habe – all ihre kindlichen Fragen habe die Mutter damit ausradiert und wegradiert, jede einzelne dieser Fragen, die sie mir heute noch mühelos aufzählen könne. Ob Weihwasser giftig sei, habe sie die Mutter beim Nachhausekommen gefragt, ob kleine Kinder bei der Taufe erschreckten, ob sie fürchteten, ertrinken zu müssen – ob sie um ihr Leben schrien. Auch, ob der Pfarrer schon einmal vor Schreck einen dieser um sein Leben schreienden Täuflinge habe fallen lassen, habe sie die Mutter gefragt – die Mutter sei aber wie immer stumm geblieben, habe sich wortlos, wie immer, mit ihren weihwässrigen Fingern bekreuzigt und sei in die Küche gegangen, um das Essen für die Gäste zu richten.
Was erweckt mehr Misstrauen, hattest du dich gefragt, gläubiges oder ungläubiges Staunen?
Auch später, sagt sie, sei jedwede Aussprache mit der Mutter in den leeren Raum zwischen Tür und Angel





























