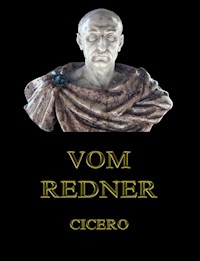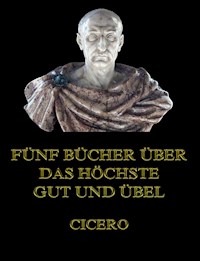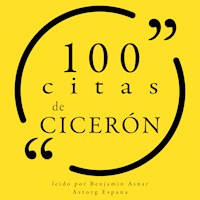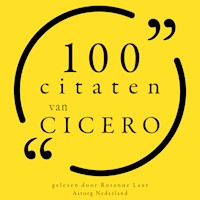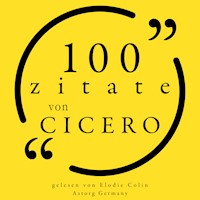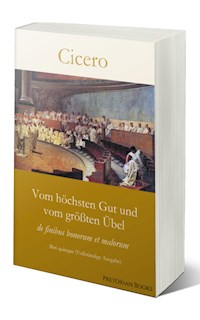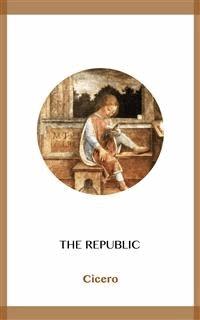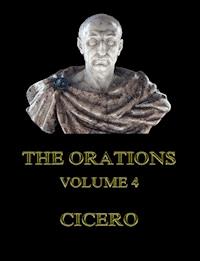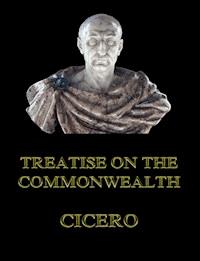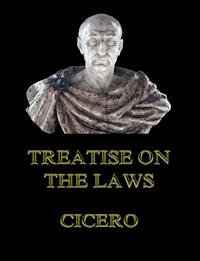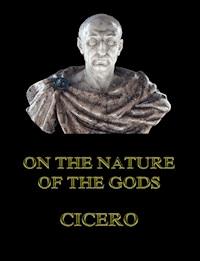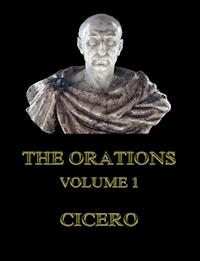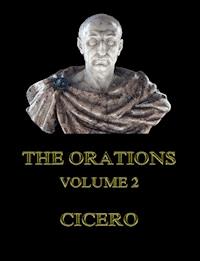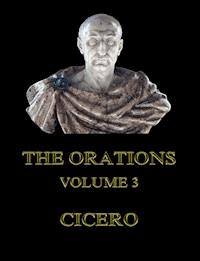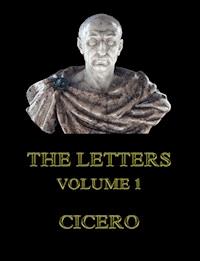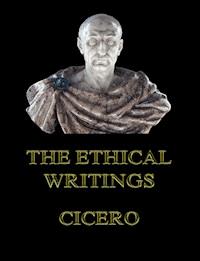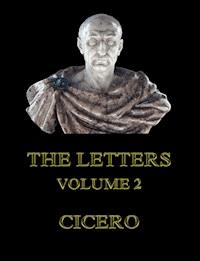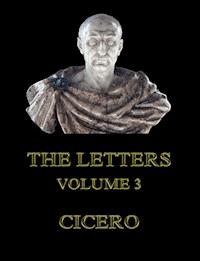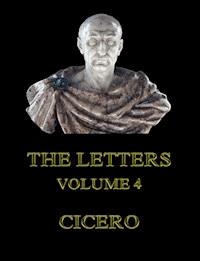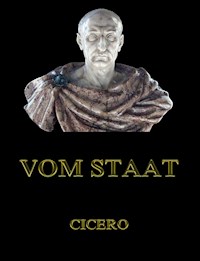
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Schrift De re publica (lat.: Vom Staat) ist ein staatstheoretisches Werk des römischen Politikers und Philosophen Marcus Tullius Cicero, das ursprünglich aus sechs Büchern bestand, deren Inhalt jedoch nur teilweise überliefert ist. Es wurde in den Jahren 54 bis 51 v. Chr. verfasst. Das Werk behandelt die Frage nach der besten Staatsform und des optimalen Staatslenkers und ist in Form eines platonischen Dialogs mit Scipio Aemilianus in der Hauptrolle geschrieben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vom Staat
Cicero
Inhalt:
Marcus Tullius Cicero – Biografie und Bibliografie
Vom Staat
Einleitung.
I. Ueber das Werk selbst.
II. Geschichte des Werkes.
III. Ueber die im Werke als sprechend aufgeführten Personen.
Uebersicht des ersten Buches.
Ueber die erste Lücke des Werkes,
Erstes Buch.
Zweites Buch.
Drittes Buch.
Viertes Buch.
Fünftes Buch.
Sechstes Buch.
Vom Staat, Cicero
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849607586
www.jazzybee-verlag.de
Marcus Tullius Cicero – Biografie und Bibliografie
Der berühmte Staatsmann und Redner, geb. 3. Jan. 106 v. Chr. in Arpinum als Sohn eines Ritters, gest. 7. Dez. 43 auf dem Landgut bei Formiä, widmete sich, in Rom vorgebildet, rhetorischen und philosophischen Studien und trat zuerst in Zivilprozessen als Redner auf; von seinen erhaltenen Reden ist die älteste die für P. Quinctus (81). Seinen Ruf begründete die (80) in einem Kriminalprozess gehaltene Verteidigungsrede für S. Roscius von Ameria, worin er einem Günstling Sullas entgegentrat. Zur Stärkung seiner Gesundheit und zur Förderung seiner philosophischen und rednerischen Ausbildung trat er 79 eine zweijährige Reise nach Griechenland und Asien an. 77 nach Rom zurückgekehrt, verwaltete er 75 die Quästur in Lilybäum auf Sizilien und gewann dann in Rom durch sein Rednertalent immer größeren Ruf. Als erster Redner galt er seit dem Prozess gegen den früheren Prätor in Sizilien, C. Verres (70). 69 bekleidete er die kurulische Ädilität; 66 unterstützte er als Prätor in der Rede für das Manilische Gesetz, seiner ersten Staatsrede, die Übertragung des Oberbefehls im Mithradatischen Krieg an Pompejus. Als Konsul erwarb er sich 63 durch Entdeckung und Unterdrückung der Catilinarischen Verschwörung ein großes Verdienst, das ihm den Ehrennamen »Vater des Vaterlandes« eintrug. Als er aber nach Errichtung des ersten Triumvirats (60) in Überschätzung seiner Bedeutung als Vertreter des Senats und der Nobilität die ehrgeizigen Pläne des Pompejus, Cäsar und Crassus zu bekämpfen unternahm, wurde er auf deren Anstiften durch P. Clodius, seinen persönlichen Feind, wegen der Hinrichtung der Genossen Catilinas um einer Anklage bedroht und ging 58 in die Verbannung. Schon im nächsten Jahr aufs ehrenvollste zurückberufen, sah er durch die Macht der Triumvirate seine politische Tätigkeit völlig gelähmt. Um so eifriger wirkte er als Gerichtsredner; auch begann er in dieser Zeit schriftstellerisch tätig zu sein. 53 wurde er zum Augur ernannt, und 51–50 verwaltete er als Prokonsul die Provinz Kilikien mit großem Eifer und damals unerhörter Uneigennützigkeit. Nach Ausbruch des Bürgerkriegs (Anfang 49) entschied er sich nach anfänglichem Schwanken für Pompejus und folgte ihm nach Griechenland, trat aber nach der Schlacht bei Pharsalos von dessen Partei zurück und erwirkte sich von Cäsar Verzeihung und die Erlaubnis, nach Rom zurückzukehren. Die Zeit bis zur Ermordung Cäsars (15. März 44) brachte er wieder in ähnlicher, durch häusliches Unglück nur noch viel gedrückterer Lage und Stimmung zu als vor dem Bürgerkrieg, obgleich Cäsar ihm Achtung und Gunst bewies; den einzigen Trost fand er in angestrengter schriftstellerischer Tätigkeit, der wir aus dieser Zeit die meisten seiner Werke verdanken. Nach Cäsars Ermordung, an der er selbst keinen Anteil hatte, war er für die Versöhnung der Parteien tätig und führte eine allgemeine Amnestie herbei; als er aber sah, dass Antonius statt Cäsars sich der Herrschaft in Rom bemächtigte, begann er mit der ersten, 2. Sept. 44 gehaltenen Philippischen Rede den Kampf gegen Antonius, der ihn noch einmal an die Spitze des Staates erhob. Nach Antonius' Niederlage bei Mutina schien die Herrschaft des Senats wiederhergestellt, als Oktavian, mit dessen Hilfe der Sieg gewonnen war, mit Antonius und Lepidus das zweite Triumvirat schloss. Eins der ersten Opfer der von diesen verhängten Proskriptionen war C. Im Begriff, sich durch die Flucht zu retten, wurde er auf seinem Landgut bei Formiä von den nach ihm ausgesandten Mördern ereilt und getötet. Seinen Kopf und seine rechte Hand stellte Antonius auf der Rednerbühne in Rom aus. C. war nicht ohne Schwächen, namentlich gingen ihm Charakterfestigkeit und Entschlossenheit ab, in so sturmbewegten Zeiten für einen Staatsmann unerlässliche Erfordernisse. Auch tritt in seinem Tun und Reden maßlose Eitelkeit und Selbstüberschätzung hervor. Anderseits bilden sein auf das Ideale gerichteter Sinn, seine Vaterlandsliebe, sein warmes Herz für Freunde und Angehörige, seine Gutherzigkeit und Sittenreinheit, seine rastlose Tätigkeit und seine rednerischen Leistungen, die den Höhepunkt der römischen Beredsamkeit bezeichnen, Lichtseiten in seinem Bilde, die seine Tadler, namentlich Drumaun (»Geschichte der Stadt Rom«, Bd. 5 u. 6) und Mommsen (»Römische Geschichte«, Bd. 3), nicht genügend gewürdigt haben. Über seine Familienverhältnisse ist zu bemerken, daß er von seiner Gemahlin Terentia, von der er sich nach 33jähriger Ehe (46) trennte, zwei Kinder hatte, eine Tochter, Tullia, die in dritter unglücklicher Ehe 45 zum größten Schmerz des Vaters starb, und einen Sohn (s. Cicero 3). Antike Büsten von C. gibt es mehrere; die vortrefflichste ist die im Apsley House zu London (früher in der Villa Mattei zu Rom).
Ciceros schriftstellerische Tätigkeit war außerordentlich vielseitig; die Zahl der auf uns gekommenen Schriften ist, obwohl nicht wenige verloren gegangen sind, sehr bedeutend. l) Reden. Die Zahl der erhaltenen Reden ist 57; außerdem besitzen wir von ungefähr 20 Bruchstücke, von 35 kennen wir die Titel. Von den erhaltenen verdienen teils wegen ihres Gegenstandes, teils wegen ihrer Vortrefflichkeit Hervorhebung: »Pro Roscio Amerino« (80), die 7 »In Verrem« (70), »De imperio Cn. Pompei« (66), die 4 »InCatilinam« (63), »Pro Murena« (63), »Pro Archia poeta« (62), »Pro Sestio« (56), »Pro Plancio« (54), »Pro Milone« (52) und die 14 »Orationes Philippicae« (41 und 43). Sie zeichnen sich durch lebendigen Fluß der Darstellung, kunstvollen Bau der Perioden, (freilich oft zu rhetorische) Fülle des Ausdrucks, öfters auch durch geistvollen, wenngleich nicht immer zu rechter Zeit und in rechter Weise angebrachten Witz aus; den Demosthenischen freilich stehen sie an Einfachheit, Kraft und Gesinnungstüchtigkeit weit nach. Sie wurden oft herausgegeben, so von Klotz (Leipz. 1835–39, 3 Bde.), in Auswahl für den Schulgebrauch von Halm-Laubmann (Berl.), Richter-Eberhard (Leipz.), Müller (das. 1889, 2 Bde.), Nohl (das.), Heine (Halle 1895) u. a. 2) Rhetorische Schriften, über die Theorie der Beredsamkeit, wobei C. namentlich seine eigne Stellung als Redner darlegt und begründet. Die bedeutendsten sind: »De oratore«, in 3 Büchern, verfasst 55 (hrsg. von Ellendt, Königsb. 1840; Piderit-Harnecker, 6. Aufl., Leipz. 1890; Bake, Amsterd. 1863; Sorof, 2. Aufl., Berl. 1882; Wilkins, 2. Aufl., Lond. 1892; Stangl, Leipz. 1893); »Brutus de claris oratoribus«, verfaßt 46, eine für uns sehr wertvolle Geschichte der römischen Beredsamkeit (hrsg. von Ellendt, Königsb. 1844; Jahn-Eberhard, 4. Aufl., Berl. 1877; Piderit-Friedrich, 3. Aufl., Leipz. 1889); »Orator«, verfaßt 46, über das Ideal eines Redners (hrsg. von Jahn-Eberhard, 4. Aufl., Berl. 1877; Piderit-Friedrich, 3. Aufl., Leipz. 1889; Stangl, das. 1886). 3) Briefe, 864, in vier Sammlungen, eine unerschöpfliche und unschätzbare Quelle für die Zeitgeschichte. Die vier Sammlungen sind: 16 Bücher vermischter Briefe, gewöhnlich »Ad familiares« betitelt, von 62–43 (kritische Hauptausgabe von Mendelssohn, Leipz. 1893ff.); »Ad Atticum«, 16 Bücher, von 68–44 (Ausg. von Boot, 2. Aufl., Amsterd. 1886, 2 Bde.); »Ad Quintum fratrem«, 3 Bücher, von 60–54, und von dem Briefwechsel mit M. Brutus 23 Briefe aus der Zeit nach Cäsars Tode. Gesamtausgaben der Briefe von Wesenberg (Leipz. 1872–73, 2 Bde.), Tyrrell und Purser (Dublin 1899, 6 Bde.); in Auswahl von Hoffmann, (1. Bd., 7. Aufl. von Sternkopf, Berl. 1898; 2. Bd., 3. Aufl. von Andresen 1895); Süpfle-Böckel (9. Aufl., Karlsr. 1893), Bardt (Leipz. 1898); übersetzt von Wieland (Zürich 1808–21, 7 Bde.; neue Ausg., Leipz. 1840–41, 12 Bde.). Vgl. Peter, Der Brief in der römischen Literatur (Leipz. 1901). 4) Philosophische Schriften in dialogischer Form, inhaltlich zwar ohne selbständigen Wert, weil überwiegend aus griechischen Quellen geschöpft (vgl. Hirzel, Untersuchungen zu Ciceros philosophischen Schriften, Leipz. 1876–83, 3 Bde.), aber doch höchst verdienstlich, weil C. damit seinen Landsleuten die griechische Philosophie in römischer Sprache erst zugänglich gemacht und für philosophische Begriffe und Entwickelungen die lateinische Terminologie geschaffen hat: »De re publica«, 6 Bücher, verfasst 54, nur teilweise erhalten (Ausg. von Mai, Rom 1822 u. 1846; Osann, Götting. 1847); »De legibus«, um 52 verfaßt, 3 Bücher, aber unvollendet (Ausg. von Vahlen, 2. Aufl., Berl. 1883; Du Mesnil, Leipz. 1880); »Paradoxa Stoicorum«, von 46 (hrsg. von Moser, Götting. 1816; Schneider, Leipz. 1891); ferner aus dem Jahr 45: »De finibus bonorum et malorum«, 5 Bücher (Ausg. von Madvig, 3. Aufl., Kopenh. 1876; Holstein, Leipz. 1873; deutsch von J. H. v. Kirchmann, das. 1874), und »Academica« (davon erhalten das 2. Buch einer ersten und das 1. einer zweiten Bearbeitung; Ausg. von Reid, 2. Aufl., Lond. 1885); aus dem Jahr 41: »Tusculanae disputationes«, 5 Bücher (Ausg. von Kühner, 5. Aufl., Hannov. 1874; Tischer-Sorof, 8. Aufl., Berl. 1884; Seyffert, Leipz. 1864; Heine, 4. Aufl., Leipz. 1896); »De natura deorum«, 3 Bücher (Ausg. von Schömann, 4. Aufl., Berl. 1876; Goethe, Leipz. 1887; Mayor, Cambridge 1885, 3 Bde.); »Cato maior de senectute« (Ausg. von Sommerbrodt, 12. Aufl., Berl. 1896; Meißner, 4. Aufl., Leipz. 1898); »De divinatione«, 2 Bücher (hrsg. von Giese, das. 1829); »Laelius de amicitia« (Ausg. von Seyffert, 2. Aufl., das. 1876; Nauck, 10. Aufl., Berl. 1902; Meißner, 2. Aufl., Leipz. 1898); »De officiis«, 3 Bücher (Ausg. von Zumpt, Braunschw. 1838; Heine, 6. Aufl., Berl. 1885; Schiche, 2. Aufl., Leipz. 1896; übersetzt von Kühner, Stuttg. 1859, u. a.). Verloren ist sein vielgerühmter Dialog »Hortensius«, eine Empfehlung der Philosophie (vgl. Plasberg, Berl. 1892). Auch als Dichter hat sich C. versucht, in seiner Jugendzeit zur Übung (von seiner Übersetzung des Aratos sind noch bedeutende Bruchstücke vorhanden; hrsg. in Baehrens' »Poetae latini minores«, Bd. 1, Leipz. 1879), später vornehmlich aus Eitelkeit, freilich ohne viel Glück.
Neuere Ausgaben sämtlicher Werke: Garatoni (unvollständig, Neap. 1777–88); Orelli (Zürich 1826–30, 4 Bde.; 5. Bd. 1833, enthaltend die Scholiasten; 6.–8. Bd. 1836–38, das »Onomasticon Tullianum«; 2. Aufl. von Orelli, Baiter und Halm das. 1845–62, 4 Bde., die kritische Hauptausgabe); Baiter und Kayser (das. 1862–69, 11 Bde.); Müller (das. 1878–98, 11 Bde.). Lexika zu Ciceros Werken: von Nizolius (»Thesaurus Ciceronianus«, Basel 1559 u. ö., zuletzt Lond. 1820); Merguet (zu den Reden, Jena 1884, 4 Bde.; zu den philosophischen Schriften, das. 1887ff.). Neuere Übersetzungen in der Metzlerschen Sammlung römischer Prosaiker (von Osiander u. a.) und der Langenscheidtschen Übersetzungsbibliothek römischer Klassiker (von Kühner, Mezger, Binder u. a.). Vgl. Gerlach, M. Tullius C. (Basel 1864); Teuffel, Studien und Charakteristiken (2. Aufl., Leipz. 1889); Aly, C., sein Leben und seine Schriften (Berl. 1891); Zielinski, C. im Wandel der Jahrhunderte (Leipz. 1897); Schneidewin, Die antike Humanität (Berl. 1897); G. Boissier, Cicéron et ses amis (12. Aufl., Par. 1902; deutsch von Döhler, Leipz. 1870); Lebreton, Étude sur la langue et la grammaire de Cicéron (Par. 1901); Cucheval, Cicéron orateur (das. 1901, 2 Bde.).
Vom Staat
Einleitung.
I. Ueber das Werk selbst.
Man mag über Cicero und seine philosophischen Werke urtheilen wie man will: auf jeden Fall wird man in ihm einen Denker, obgleich mehr einen Nachdenker, als einen Vordenker, achten und anerkennen müssen. Hat er in seinen rhetorischen und philosophischen Werken im Allgemeinen meistens die dialogische Form der Platonischen Werke zum Muster genommen, ohne jedoch den Redner verläugnen zu können und zu wollen, und finden wir bei ihm durchaus ein Bestreben, die Wissenschaft der Griechen mit eklektischer Vielseitigkeit auf Römischen Boden zu verpflanzen, oft (wie zwischen den Akademikern und Peripatetikern) mit der Absicht, vermittelnd und versöhnend auftreten zu wollen, oder noch lieber zu beweisen, daß gar keine Vermittelung und Versöhnung nöthig sey, weil sie nur in Worten, nicht in der Grundansicht von einander abweichen; so erblicken wir ihn in den Werken vom Staat und von den Gesetzen, schon in dem Titel beider Werke, recht eigentlich als Nachahmer seines Lieblings, oder vielmehr fast seines Abgottes, Plato. Aber diese Nachahmung der beiden großen Platonischen Werke gleiches Namens ist weder eine bloße Lateinische Umarbeitung derselben, mit etwas eigener Zuthat, wie das Werk von den Pflichten, das er dem des Panätius aus Rhodus, einem Stoikers, nachgebildet hat; noch ein Versuch, ähnliche Ideale, wie jene sind, aus eigenem freischaffendem Geiste hervorzubringen; sondern Cicero will aus dem Boden der Möglichkeit und Wirklichkeit, das Vorhandengewesene und zum Theil noch Vorhandene oder nach seiner Ansicht und Hoffnung Wiederherstellbare, in idealisirender Verschönerung an seinem eigenen Vaterlande, dessen Gründung und Verfassung, eine Art von Musterstaat hinstellen, auf ein Gleichgewicht gegründet, von dem er, ob es gleich zu keiner Zeit vollkommen so bestanden hat, die Hoffnung und Erwartung hegte, es werde, gestützt auf die Grundlage der Sittlichkeit und Gerechtigkeit, eine unverwüstliche Dauer haben können.
Cicero schrieb dieses Werk im Jahre Roms 700 (54. v. C. G.) in seinem vierundfünfzigsten Lebensjahre, nicht, wie seine meisten übrigen philosophischen Werke, zu einer Zeit, wo er nach dem Untergange der freien Verfassung Trost und Zerstreuung in den Wissenschaften suchte, sondern noch in der Zeit seiner regen Thätigkeit für das Vaterland, wo ihm auch daran liegen mußte, in einem mit besonderer Liebe bearbeiteten Denkmale seines Geistes etwas nicht bloß Ideelles, sondern wenigstens möglicherweise praktisch Nutzbares aufzustellen, das die Zuneigung seiner sich zum Idealen wenig hinneigenden Mitbürger gewinnen und erhalten sollte. Daß ihm dieses gelang, davon liegen die unzweideutigsten Beweise vor; aber eben so sichere von dem Fleiße und der Liebe, womit er das Werk anfing und vollendete. So ungerne er übrigens angefangene und schon weit vorgerückte Arbeiten umänderte oder gar wegwarf, so war er doch bei diesem Werke besonders streng gegen sich, und erklärt in einem Briefe an seinen Bruder: »wenn mir diese schwierige und anstrengende Arbeit gelingt, so wird meine Mühe wohl angewandt seyn; wo nicht, so werfe ich sie in das Meer, welches ich beim Schreiben vor Augen habe.« Und wirklich wurde nicht nur einmal der Plan und Ideengang verändert. Zwei Bücher waren vollendet, worin die Zeit der Handlung auf die neun Tage der Latinerferien unter den Consuln Tuditanus und Aquilius (625. n. R. E.) festgesetzt war und neun Bücher sollte auch das Werk erhalten; die sprechenden Personen sollten dieselben seyn, die jetzt darin auftreten. Späterhin ließ er sich von Atticus bereden, die Scene der Unterhaltung in seine Zeit zu verlegen, und selbst das Hauptwort der Unterredung zu führen. Doch weil dabei vieles bereits Fertige, das ihm gelungen schien, hätte weggeworfen werden müssen, so wurde der alte Plan wieder aufgenommen, allein auf sechs Bücher beschränkt, in denen die Unterhaltung dreier Tage zusammengefaßt war. Sie waren fertig, als er nach Cilicien abging, und wurden gleich nach ihrer Bekanntmachung allgemein mit Begierde gelesen. Es ist, nach Abwägung der Gründe für und wider, jetzt ausser Zweifel gesetzt, daß das Werk dem Atticus gewidmet war. Oft kommt Cicero in seinen spätern Schriften auf dieses Werk zurück, das er in bessern Tagen und bei bessern Aussichten und Hoffnungen geschrieben hatte, als diejenigen waren, die sich ihm bei seiner Rückkehr aus Cilicien darstellten und aufdrangen. Er wollte das Werk, auf dessen Inhalt offenbar auch das Geschichtswerk des Polybius großen Einfluß gehabt hat, gleichsam als sein politisches Testament betrachtet wissen, dem er später, aber in sehr veränderter Gemüthsstimmung, noch das Werk von den Gesetzen beifügte. Ob wir nun gleich in den folgenden Bruchstücken nicht einmal ein volles Drittheil des Ganzen gewonnen haben mögen, so läßt sich doch theils aus dem Vorhandenen, theils aus den Anführungen, Auszügen und Erörterungen darüber in dem Werke des Augustinus de Civitate Dei (zu dem sichtbar das Werk Cicero's die Idee hergegeben hat) und bei Lactantius, der Gedankengang und Inhalt der einzelnen Bücher mit mehr oder minder Sicherheit darthun und erschließen. Was wir, abgesehen von der Trefflichkeit der Darstellung und Gesinnung, die uns auch in diesen Trümmern erfreuen, materiell an diesem Funde gewonnen haben, namentlich für die in so vieler Hinsicht dunkle Geschichte der Ausbildung der Römischen Verfassung, Dieß ist von Andern, und an passendern Orten, als es hier geschehen würde, erörtert worden. Daß die Ausbeute nicht so groß war, als man hoffen und erwarten mochte, ist nicht zu verkennen; aber eben so wenig darf der hohe Werth des Dargebotenen darum verkannt und gering geachtet werden, weil man Wünsche und Anforderungen nicht befriedigt findet, die man, Alles wohl erwogen, nicht einmal zu hegen und zu machen ganz gegründete Befugniß hatte. Ueber den Inhalt der einzelnen Bücher werden wir unmittelbar vor jedem Buche sprechen.
II. Geschichte des Werkes.
Cicero's Werk vom Staate war zwar fortwährend ein Gegenstand der Bewunderung und Liebe, so wie des eifrigen Studiums der Bessern und Edlern im Römischen Volke; allein es ist begreiflich, daß in Zeiten, wo so ganz andere politische und sittliche Grundsätze herrschten, als hier ausgesprochen und empfohlen sind, in Zeiten, denen schon die Existenz eines solchen Werkes ein nur zu laut sprechender Vorwurf ist, Diejenigen es wenig erwähnen durften, die es mit den Machthabern nicht verderben wollten. Ausdrücklich erwähnt wird das Werk übrigens von Seneca, dem ältern Plinius, Fronto, Gellius, und einer ganzen Reihe von Grammatikern, besonders häufig von Nonius Marcellus, für den es ein rechter Tummelplatz für seine Wörter- und Phrasenjagd war. Ein eigenes Werk hatte, nach Suidas, Suetonius über den Cicero vom Staate geschrieben, und von Makrobius besitzen wir einen Commentar über einen Theil, den Schluß des sechsten Buches, der unter dem Namen Traum des Scipio seit vielen Jahrhunderten berühmt ist, welchem Commentare wir die Erhaltung des Traumes selbst zu danken haben, und ohne den wir auch jetzt kein Blatt vom sechsten Buche hätten. Großen Dank aber sind wir, auch noch nach der Wiederauffindung, dem Lactantius, und besonders dem Augustinus schuldig. Sie füllen nicht nur sehr willkommen oft bedeutende Lücken aus, sondern sind, da sie nicht selten dieselben Stellen geben, die sich in der aufgefundenen Handschrift finden, ein Beweismittel für die Aechtheit des Gefundenen, das lange und mühsame Deductionen erspart. Aus dem vierten Jahrhundert haben wir die Nachricht bei dem Geschichtschreiber Lampridius, daß Cicero's Republik eine Lieblingslectüre des Kaisers Alexanders Severus gewesen sey, welcher so viel besser war, als seine Zeit. Auch die Griechen nahmen Notiz von diesem Werke; wie denn Didymus schon im Zeitalter des Augustus ein Buch zur Bekämpfung desselben schrieb, mit dessen Widerlegung sich die oben angeführte Schrift des Suetonius beschäftigte: wogegen ein anderer unbekannter Grieche vielleicht aus Justinian's Zeitalter in einem noch ungedruckten Werke über Staatswissenschaft Cicero's Werk vom Staate sogar der Republik des Plato vorzieht. Im fünften, sechsten und siebenten Jahrhundert lassen sich allenfalls noch Spuren von Bekanntschaft mit dem Werke des Cicero nachweisen; aber von da an bis zum zehenten hat sich noch keine vorgefunden. In diesem Jahrhunderte verlangt Gerbert, Abt des Klosters des heiligen Columbanus zu Bobbio (späterhin Erzbischof zu Rheims, dann zu Ravenna, zuletzt Pabst), in einem Briefe an einen gewissen Scholasticus, Namens Constantinus, daß er ihm dieses Buch, nebst den Reden gegen den Verres und den Vertheidigungsreden des Cicero mitbringen soll. Im zwölften Jahrhunderte citirt Stellen aus unserm Werke der berühmte Johann von Salisbury (Johannes Salisburiensis) in seinem Policraticus, die er aber auch aus dem Augustinus und Macrobius haben konnte. Der Griechische Uebersetzer des Traums des Scipio, sey er nun der Mönch Planudes im 14ten oder der Grammatiker Theodor Gaza im 15ten Jahrhundert, hat ohne Zweifel nicht das Werk des Cicero, sondern blos den Macrobius vor sich gehabt. Suchte doch Francesco Petrarca, der so glücklich war, die Briefe Cicero's an seine Freunde aufzufinden, die Republik des Cicero auf Befehl Pabst Clemens VI. lange Zeit und mit vielem Kostenaufwande, aber ohne Erfolg. Auch im 15ten Jahrhunderte wurde sie, nach einem Briefe des Leonardo Bruni aus Arezzo an Poggio und einigen Stellen der Briefe des Letztern selbst (bei Jenem Ep. IV, 5; bei Diesem Ep. 26.), mühsam, aber vergebens, gesucht. Vom Ende des 15ten Jahrhunderts und aus dem 16ten hat man nur dunkle Sagen von vermuthlich da oder dort vorhanden gewesenen Handschriften des Werkes, und eben so aus dem 17ten. Die speciellsten Notizen von dem Daseyn des Werks hat man aus und über Polen, ohne daß jedoch sonderliche Hoffnung zur Wiederauffindung einer angeblich gegen Ende des 16ten Jahrhunderts aus der Moldau durch einen Volhynischen Edelmann, Namens Woinowsky, nach Polen gebrachten Handschrift vorhanden wäre. Seit der Mitte des 16ten Jahrhunderts hat man übrigens in allen Ausgaben des ganzen Cicero auch, ausser dem Traume des Scipio, eine Zusammenstellung der bei den angeführten Schriftstellern entdeckten Bruchstücke von bedeutender Anzahl, deren Text z. B. in der Schützischen Ausgabe (ohne den Traum) zwanzig Seiten ausmacht. Diese Fragmente, nebst den Stellen, wo Lactantius und Augustinus über das Werk sprechen, ohne eigentlich dessen Worte wiederzugeben, und so manche Aeußerungen Cicero's in seinen übrigen Werken über die Gegenstände, welche in dem Werke vom Staate wahrscheinlich zur Sprache gekommen seyn mochten, veranlaßten am Schlusse des 18ten Jahrhunderts einen gelehrten Franzosen, M. Bernardi, eine Art von musivischem Werke, oder Cento, zusammenzusetzen, das im Jahre 1807 in zwei Bänden mit Lateinischem Text und gegenüber gedruckter Französischer Uebersetzung in der zweiten Auflage erschien, und, ob es gleich seiner Natur nach nicht geeignet war, für das Verlorne irgend einen Ersatz zu leisten, doch nicht ohne Beifall aufgenommen wurde Endlich entdeckte im Jahre 1820 der Bibliothekar der Vaticanischen Bibliothek in Rom, Abbate Angelo Majo, schon seit 1813 als Entdecker verschiedener Werke des Alterthums auf Palimpsesten der Ambrosianischen Bibliothek zu Mailand, auch einiger Bruchstücke von den Reden des Cicero berühmt, bald nach seiner Versetzung nach Rom (1819), in einem Codex rescriptus die herrlichen Ueberreste, die wir hier unsern Lesern in einer Uebersetzung mittheilen. Aus dem Kloster des h. Columbanus zu Bobbio in Oberitalien, das im Mittelalter eine treffliche Bibliothek hatte, waren viele Handschriften in die Ambrosianische Bibliothek zu Mailand gekommen, einige auch nach Rom, unter andern um den Anfang des 17ten Jahrhunderts ein Codex, auf welchen, nach Auslöschung einer ältern Schrift, schon vor dem 10ten Jahrhundert der Commentar des h. Augustinus über die Psalmen (vom 119ten bis 141sten) geschrieben worden war. Die 304 Seiten, die die Handschrift hat, gehörten, bis auf zwei, alle Einem Werke an, in dessen verwischten sehr großen Buchstaben Majo bald kostbare Reste eines verlornen Ciceronischen Werkes erkannte. Aber da auch der Codex des Augustinus nicht ganz ist, und sogar zu diesem nicht das ganze alte Werk, wie es scheint, verwendet worden war, überdieß Derjenige, welcher den Augustinus darüber schrieb, sich um Erhaltung und Schonung des blinden Heiden natürlich nicht bekümmert hatte, so mußte der Zustand des durch Hülfe der Kunst unter dem neuen hervorgehenden alten im 2ten oder 3ten Jahrhundert abgeschriebenen, Werkes nothwendig nicht der beste seyn. Und so hatte denn der Entdecker dieses Schatzes, der uns nun fast wieder ein Drittheil des verlornen Ciceronischen Werkes vom Staate gibt, keine geringe Mühe mit Aufsuchung der Ordnung, in welcher die Blätter einander folgen müssen, mit Einreihung der früher bekannten Bruchstücke, mit Muthmaßungen über Ausfüllung der Lücken, mit Vergleichung des gefundenen Stoffes mit schon früher aus andern Schriftstellern eben so oder anders Bekanntem, mit Verbesserung der oft fehlerhaften Lesart, mit Ergänzung mangelnder Buchstaben und Wörter u. dgl.; und er hat diese Aufgabe im Ganzen trefflich gelöst, wenn auch im Einzelnen in fast jeder Hinsicht den spätern Bearbeitern Etwas zu thun übrig gelassen ist. Das Ausführliche über diese ganze Sache gibt die Vorrede des ersten Herausgebers, die in allen größern Ausgaben, die auf die erste Römische (von 1822.) gefolgt sind, sich abgedruckt findet. Verdient haben sich um das Werk, ausser A. M., gemacht: der erste Herausgeber und Uebersetzer in Frankreich, Hr. Villemain, durch werthvolle Abhandlungen und Anmerkungen (nicht philologischer Art), die zum Theil in einer, übrigens ganz werthlosen, deutschen Uebersetzung des Werkes von J. M. Pierre (2 Thle. Fulda, 1824.) übersetzt sind; ferner Hr. Prof. Heinrich in Bonn, durch vielfache Berichtigung des Textes (Bonn, 1825. 8.); Hr. Steinacker durch einzelne gute Bemerkungen und Verbesserungen (Ausg. Lips., 1823.); Hr. Lehner, eben so (Ausg. Solisbaci, 1823.); vorzüglich auch schon bei der Römischen Ausgabe der damals in Rom anwesende Hr. Geh. Staatsrath v. Niebuhr in Bonn; mehrere Recensenten des Werkes in deutschen und auswärtigen Literaturzeitungen; noch ein deutscher Uebersetzer F. v. Kobbe (Göttingen, 1824.), doch nicht ohne viele Verstöße; auch hat Hr. Geh. Hofrath v. Zachariä ein eigenes Werk über den neuen Fund herausgegeben (StaatswissenschaftlicheBetrachtungen über Cic. neu aufgefundenes Werk de rep. Heidelb., 1823.), und die HHrn. Prof. Burchardi (Bemerkungen über den Census der Römer. Kiel, 1824.) Prof. Franke (De Tribuum Curiarum atque Centuriarum ratione. Slesv., 1824.), Conrad Wolff (Obs. in – liber, de R. P. Fragm. 4. Flenop., 1824.), Dr. N. Bygon Krarup (Obss. critt. in libros Cic. de Rep. 8. Hafn. 1826. f. 2. Specimina); einzelne Stellen des Werkes beleuchtet, mehrere Andere übergehen wir der Kürze wegen. Der Verfasser dieser Uebersetzung hat sich durch seine Ausgabe des Werkes (Francof. ad M. Broenner, 1826.) auch um dasselbe verdient zu machen gesucht; nach ihm haben noch werthvolle Ausgaben desselben geliefert Hr. Prof. Zell in Freiburg (8. Stuttgartiae, 1827.) und besonders Hr. Prof. Orelli in Zürich, im vierten Theile seiner Gesammtausgabe der Werke des Cicero (Turici, 1828.).
III. Ueber die im Werke als sprechend aufgeführten Personen.
Es sprechen fünf Greise und vier jüngere Männer mit. Zu Jenen gehören Scipio, Lälius, etwas älter als Scipio; Philus und Mummius, gleiches Alters mit Lälius, ferner Manilius; die jüngern sind Tubero, Rutilius, Scävola und Fannius.
1. P. Cornelius Scipio Aemilianus Africanusminor, auch mit dem Beinamen Numantinus. Er war der Sohn des L. Aemilius Paullus, der den Perseus überwand und über ihn einen Triumph hielt, und wurde von dem Sohne des ältern Scipio Africanus in die Cornelische Familie adoptirt. Seine Lehrer waren Polybius, Panätius und Metrodorus. Er hatte sich mit der Lateinischen und Griechischen Literatur ganz vorzüglich vertraut gemacht; seine Unterhaltung über wissenschaftliche Gegenstände hatte oft einen Anflug von Sokratischer Ironie. Im J. Roms 608 zerstörte er Karthago, im J. 621 Numantia. Er starb im Winter des Jahrs 625, wenige Tage nach Beendigung dieser Unterhaltung (wie nämlich von Cicero angenommen wird) über den Staat, nicht ohne gegründeten Verdacht, daß sein Tod durch die Gracchische Partei, deren Feind er gewesen war, verursacht worden sey, sechs und fünfzig Jahre alt. Kurz vor seinem Tode hatte sich am Himmel eine Nebensonne gezeigt.
2. C. Lälius, mit dem Beinamen der Weise. Er war dem Scipio mit der innigsten Freundschaft zugethan, und ist Derselbe, der in dem Gespräche des Cicero von der Freundschaft das Wort führt, wo er über den kurz zuvor erfolgten Tod des Scipio mit der größten Rührung spricht. Ohne dem Scipio an kriegerischer Größe gleich zu kommen, war er doch dessen beständiger Rathgeber, auch bei der Belagerung von Karthago sein Legat. Als Oberfeldherr überwand er selbst den Viriathus. Consul war er im J. Roms 614.
3. L. Furius Philus (oder Pilus). Er war Consul im Jahre Roms 618. Er war es, der darauf antrug, den durch Mancinus mit den Numantinern geschlossenen Vertrag für ungültig zu erklären, auch brachte er wirklich den Mancinus nach Spanien zurück und lieferte ihn den Numantinern aus. Er war durch Beredsamkeit ausgezeichnet, und ein Liebhaber der Astronomie.
4. Manius Manilius. Er war im J. Roms 605 Consul, und Scipio damals in dem Africanischen Feldzuge sein Legat. Er war ein großer Kenner der Rechte und tüchtiger Sachwalter; dabei aber sehr uneigennützig und darum arm.
5. Spurius Mummius, Bruder des L. Mummius Achaicus, des Eroberers und Zerstörers von Korinth. Als Redner war er wenig berühmt: als Philosoph hielt er es mit der Stoa. Sein Charakter war lobenswerth. Er war vertrauter Freund des Scipio, Lälius, Philus und Rutilius.
6. Q. Aelius Tubero. Enkel des Aemilius Paullus, von der Aemilia, der Schwester des Africanus. Er war von Jugend auf Freund des Lälius; trennte sich von Tiberius Gracchus, als dieser seine demagogischen Plane in's Werk zu setzen begann. Bei dem Leichenbegängnisse seines Oheims, des Scipio Africanus, zeigte er auf eine unpopuläre Weise sich als Anhänger der Stoischen Philosophie, und sehr karg, wodurch er sich um die Prätur brachte. Sein Stoicismus machte ihn hart und zurückstoßend. Als Dialectiker und Rechtskenner zeichnete er sich aus, als Redner gar nicht.
7. P. Rutilius Rufus. Zur Zeit dieses Gesprächs kaum mannbarer Jüngling, der eben darum dem weit später geborenen Cicero das hier gehaltene Gespräch erzählen konnte. Er wurde vier und zwanzig Jahre nach dem Tode des Scipio im J. Roms 649 Consul. Als Cicero in seiner Jugend Kleinasien durchreiste, befand sich Rutilius, unschuldigerweise, verbannt, in Smyrna. Er war nach dem Zeugnisse des Alterthums einer der edelsten Menschen. Auch als Schriftsteller (Verfasser von Reden und Geschichtswerken) war er berühmt.
8. Q. Mucius Scävola, ein Augur. Diesem Manne wurde Cicero, als er in das männliche Alter trat, als Zögling zur Ausbildung für das praktische Leben zugeführt. Er war Consul im J. Roms 637. In Cicero's Werke vom Redner spielt er auch eine Rolle. Von ihm, erzählt Cicero, habe er des Lälius Vortrag über die Freundschaft gehört. Auch im Alter noch liebte er Laune und Scherz
9. C. Fannius, Eidam des Lälius. Er hatte in seinem Charakter, wie in seinem Vortrage, etwas Hartes, und so auch als Geschichtschreiber. Cicero nimmt an, Fannius sey am zweiten Tage der Gespräche vom Staat nicht zugegen gewesen. Uebrigens kommt weder er noch Scävola in den aufgefundenen Bruchstücken des gegenwärtigen Werkes zum Wort, wiewohl deßwegen nicht anzunehmen ist, daß sie stumme Personen gewesen seyen.
Der Uebersetzer legte vorzüglich den Text seiner eigenen im Jahr 1826 bei Brönner in Frankfurt erschienenen Ausgabe, mit besonderer Berücksichtigung der Orellischen (Cic. Opp. IV, 1. Turici 1828) zum Grunde.