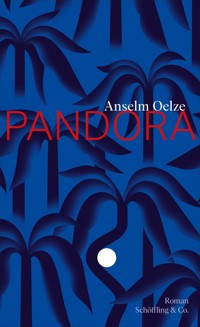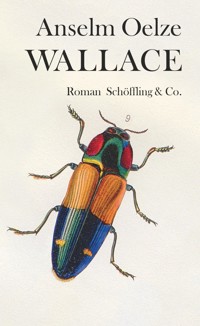
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Frühjahr 1858: Ein Brief verlässt eine kleine Insel in den Molukken. Sein Ziel ist Südengland, sein Inhalt: ein Aufsatz über den Ursprung der Arten. Kaum ein Jahr später sorgt die Schrift für Aufsehen und wird bekannt als Theorie der Evolution. Doch nicht der Verfasser des Briefes, der Artensammler Alfred Russel Wallace, erntet den Ruhm dafür, sondern sein Empfänger, der Naturforscher Charles Darwin. Von Wallace bleibt lediglich eine nach ihm benannte Trennlinie der Arten im Malaiischen Archipel.Einhundertfünfzig Jahre später stößt der Museumsnachtwächter Albrecht Bromberg auf das Schicksal des vergessenen Wallace. Er begibt sich auf seine Spuren und je länger er mit Wallace unterwegs ist, desto mehr zweifelt Bromberg an, ob alles so bleiben muss, wie es ist. Er fasst einen Plan, der endlich denjenigen ins Licht rücken soll, der bisher im Dunkeln war, und erkennt: Geschichte wird nicht gemacht, sondern geschrieben.Mit seinem Debüt ist Anselm Oelze ein philosophischer Abenteuerroman gelungen, ein literarisches Denkmal für die Außenseiter des Lebens und der Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
Widmung
Prolog
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Epilog
Autorenporträt
Über das Buch
Impressum
Selbstverständlich ist dies eine wahre Geschichte
Prolog
Worin im Frühjahr 1858 auf einer kleinen Insel in den Molukken ein bärtiger Engländer das Postschiff erwartet, Kisten mit seltsamem Inhalt verschifft und einen Brief erhält
Es war heller Mittag, als die Koningin der Nederlanden in die Bucht einlief. Ihre frisch gestrichenen weißen Planken glitzerten unter der grellen Sonne, die seit dem frühen Morgen schon im Zenit stand und zu Füßen des großen Vulkans, dessen grüne Hänge über dem kleinen Eiland aufragten, alles in eine träge, schläfrige Ruhe gezwungen hatte. Nur das unruhige Flirren der Lüfte lag über dem staubigen Hafenort, einer losen Ansammlung palmgedeckter Hütten und hölzerner Unterstände, gesäumt von einer steingestützten, bretterbeschlagenen Mole.
Noch war, dem schrillen Geläut der Schiffsglocke zum Trotz, das der landseitige Wind herantrug, niemand in Unruhe geraten, geschweige denn in Bewegung versetzt worden. Lediglich der hagere, bärtige Engländer schritt zwischen Türmen großer und kleiner Kisten am Anleger auf und ab. Nunmehr seit einer halben Stunde schon wartete er so, seit er den Dampfer vom nördlichen Horizont her hatte herannahen sehen.
Jetzt, da die Koningin längsseitig Kurs auf den Quai hielt, nahm er die drahtene Brille von der Nase, rieb sich die kleinen, geröteten Augen und sah blinzelnd dabei zu, wie die großen Schaufelräder des schmalen Schiffes stotternd ihr Rotieren einstellten. Mit der flachen Hand schirmte er den Blick gegen die blendende Weiße der Bootswände ab. Zwischen seinen dünnen Fingern jedoch drangen die Strahlen mühelos hindurch und fielen als weiße Punkte in sein blasses, von den fiebrigen Schüben der letzten Wochen gezeichnetes Gesicht.
Von der Schiffsbrücke ertönten barsche Rufe, Befehle schwirrten durch die Luft, und der malaiische Maat in seiner ockergelben Puffhose schlug so laut und energisch mit dem messingenen Klöppel gegen das glänzende Gehäuse der Glocke, dass es fast aus seiner Aufhängung zu springen drohte.
Am Quai liefen erste Schaulustige und Tagelöhnerzusammen. Sie krakeelten und lachten, bis schließlich auch der letzte dösende Molukke im Türrahmen seines Palmverschlags erschien, das Schiff erblickte und gen Anleger trottete.
Zufrieden schaute der Bärtige dem Treiben zu. Er freute sich, dass nun endlich Leben in die schläfrigen Glieder des Örtchens fuhr, wenigstens für eine knappe Stunde. Diese eine Stunde lang würde ihm das Gefühl vergönnt sein, sich am lebhaftesten Ort der Welt und nicht an ihrem gottverlassenen Ende, am Rande dieses Archipels, zu befinden.
Die Finger zwischen die trockenen Lippen gepresst, pfiff er einen plattnasigen Servant herbei, deutete auf die Kisten und bot drei Münzen für ihre Verladung an. Der Plattnasige wollte sich gerade daranmachen, den Lohn um wenigstens zwei Münzen nach oben zu treiben, als ein junger Bursche vom Schiff her auf den Bärtigen zugerannt kam.
»For you, Mister! For you!«, rief der Bursche mit dünnem Stimmchen, einen Packen zusammengeschnürter Briefe schwenkend.
»For you, Mister! For you!«, sagte er noch einmal, während er dem Bärtigen freudestrahlend die Briefe überreichte.
Der Bärtige nahm das Bündel entgegen, kramte eine Münze aus seiner Tasche hervor, gab sie dem Boten und begann, die Schnur von den Umschlägen zu lösen. Schon der Anblick des Absenders auf dem obersten Kuvert ließ seine eben noch trüben Augen leuchten. Aufgeregt rückte er sich die Brille auf der Nase zurecht und studierte eingehend die Poststempel.
Der Plattnasige stand noch immer neben ihm und wartete geduldig. Als er merkte, dass der Bärtige ihn vergessen hatte, begann er zunächst, kurz und zaghaft im Sand zu scharren, dann leerte er ausgiebig und geräuschvoll seine Nasennebenhöhlen. Als auch das nichts half, tippte er ihm mit dem Finger auf die Schulter.
Der Bärtige blickte kurz auf, gab ihm zu verstehen, dass er den Auftrag entweder für drei Münzen annehmen oder ohne eine einzige Münze davonziehen könne, und wandte sich wieder seinen Briefen zu.
Kaum dass der Plattnasige damit begonnen hatte, die erste Kiste die geländerlose Gangway hinaufzuhieven, verfluchte er sich bereits dafür, in den Dienst des dünnen Engländers getreten zu sein. Im Vergleich zur Plackerei, die er damit auf sich nahm, wäre es geradezu erholsam gewesen, am Heck des Schiffes beim Verladen der Säcke mit Gewürznelken zu helfen oder – noch besser – beim Löschen dessen, was die Koningin zum Verbleib auf der Insel mit sich geführt hatte, nämlich nichts weiter als einige Kisten schwarz gebrannten Wacholderschnapses, eine Ziege vom benachbarten Atoll sowie jenen Packen Post, der dem Bärtigen bereits übergeben worden war. Stattdessen mühte er sich nun ab mit schweren, sperrigen Kisten, deren Inhalt er, schon als er vor Tagen davon erfahren, für vollends sinnlos befunden hatte.
Zunächst waren es nur Gerüchte gewesen, die darüber kursierten, was sich in den Kisten des Bärtigen befand. Rostige Werkzeuge, sagten einige, eingelegte Lebensmittel, behaupteten andere. Doch Gewissheit herrschte erst seit dem Moment, als ein inselweit bekannter Obsthändler, dem ein langes, schwarzes Haar aus einem Muttermal über seinem Kinn wuchs, eine unaufschiebbare Notdurftpause des Bärtigen dazu genutzt hatte, die mit Schlössern gesicherten Kisten unter Zuhilfenahme eines mehrfach gebogenen Nagels zu öffnen, um anschließend gegen Zahlung eines kleinen, aber nicht unerheblichen Entgeltes vom Inhalt zu berichten. Dabei weidete er sich genüsslich an der Ungeduld und Neugierde jedes einzelnen Zuhörers und dachte keineswegs daran, sofort seine Erkenntnisse aus dem Innersten der wundersamen Kisten preiszugeben.
Er begann mit einer ausführlichen Erläuterung des sehr speziellen Verschlussmechanismus (der für sich genommen kein sonderlich spezieller war, was dem ungeübten Auge jedoch leicht entgehen konnte), ging von dort zu einer Erörterung von Schlössern und Schlüsseln im Allgemeinen über (was nun tatsächlich für die meisten Umstehenden etwas Neues war, da sie ihre Hütten entweder gar nicht oder nur mit einigen langen Schnüren aus Palmfasern zu verschließen pflegten) und schloss seine Vorrede mit einer geradezu philosophischen Betrachtung über die Geburt des Abschließens aus dem Geiste gegenseitigen Misstrauens. Wie er von dort zum eigentlichen Thema, zum Inhalt der Kisten, gelangen sollte, war nicht nur ihm selbst, sondern auch seinen Zuhörern ein Rätsel, doch überging er dieses Problem schlicht und ergreifend, indem er innehielt, das Haar an seinem Muttermal in die Länge zog, losließ und wartete, bis es sich von alleine in den krausen Ursprungszustand zurückgerollt hatte. Dann begann er, vom Eigentlichen zu erzählen.
»Käfer«, war das erste Wort, das er von sich gab, und »Käfer« lautete auch das zweite. Beim ersten wie auch beim zweiten Wort machte sich eine gewisse Ernüchterung breit, die bei manchen seiner Zuhörer in Enttäuschung umzuschlagen drohte, weshalb er sich bemühte, möglichst schnell ein drittes den beiden ersten folgen zu lassen. Dieses dritte Wort, das mit großer Spannung, mit noch größerer als die beiden vorigen, erwartet wurde, lautete: »Schmetterlinge«.
Käfer und Schmetterlinge, erklärte er, dies seien die Dinge, die in den Kisten zuoberst lägen, jeder Einzelne von ihnen aufgespießt auf eine dünne Nadel (und es war diese Information, die in das Gesicht von wenigstens einigen, die ihm zuhörten, Zufriedenheit zurückkehren ließ), eingepackt in Schachteln und umwickelt mit dünnem Papier, doch nicht etwa nur in einer Größe, Form und Farbe, sondern in allen erdenklichen Farben, Größen und Formen (wobei im Publikum schnell allgemeine Einigkeit darüber herrschte, dass Insekten gleich welcher Form, Farbe und Größe gegrillt und nicht verpackt gehörten).
Danach griff er nochmals nach jenem solitären Haar, das auf seinem Kinn wuchs, zog es erneut in die Länge und teilte mit, wer nun zu hören begehre, was unter den Käfern und Schmetterlingen liege, der dürfe gerne etwas näher treten, jedoch erst nach Zahlung eines angemessenen Aufpreises. Diesen Zuschlag halte er für mehr als gerechtfertigt, erklärte er, schließlich habe ihn das unbemerkte Vordringen in die eigentlichen Tiefen der Kisten nicht nur besonderes Geschick, sondern auch fast die Freiheit gekostet (was freilich übertrieben war, da der Bärtige in jenem Moment, in dem der Obsthändler in seinen Kisten herumfingerte, noch längst keine Anstalten machte, vom improvisierten Abort, der nur aus einer Grube, einem quer gelegten Bambusrohr und einer bei der Verrichtung des Geschäfts als Halteseil genutzten Liane bestand, zurückzukehren; schon seit Tagen plagte ihn eine gemeine Diarrhö). Aber weil dies den Zuhörern unbekannt war, kramte ein jeder aus der letzten Falte seiner langen, bauschigen Hose eine Münze hervor, entrichtete sie dem Obsthändler, der noch immer mit den Spitzen von Daumen und Zeigefinger das Haar umschloss, und wartete gespannt darauf, zu erfahren, was denn nun wirklich tief drinnen in den Kisten lagerte.
Anders als zuvor ließ der Obsthändler diesmal, als er zu einer Aussage ansetzte, indem er Luft durch seine winzigen Nasenlöcher einsog und den Mund öffnete, das Haar an seinem Kinn nicht los, sondern hielt es mit den Fingern fest umklammert und riss es, mehr unfreiwillig als beabsichtigt, heraus, als ihm das entscheidende Wort entfuhr: »Hühner«. Die Zuhörer wie auch der Obsthändler erschraken bei dieser Äußerung, der Obsthändler, weil ihm plötzlich gewahr wurde, in Zukunft ohne ein einziges Gesichtshaar auskommen zu müssen, und die Zuhörer, weil die Vorstellung in Holzkisten verpackten toten Federviehs sie tief verstörte. Dabei war nicht die Leblosigkeit der Tiere das eigentlich Bestürzende. Vielmehr entsetzte sie die Tatsache, dass man allen Ernstes auf die Idee kommen konnte, Hühner zu töten und in Kisten zu verfrachten. Dies machte nun wirklich gar keinen Sinn. Denn obwohl den meisten Insulanern nicht entgangen war, dass der bärtige Engländer während der ersten Wochen, die er auf der Insel verbracht hatte, vor allem damit beschäftigt gewesen war, Hühner selbst aus den entlegensten Ecken des Eilands herbeizuschaffen, so hatte doch niemand damit gerechnet, dass er sie eines Tages verschiffen würde, anstatt ihre Eier roh zu schlürfen oder ihr Fleisch in einem Nelkensud zu garen.
Doch genau dies war nun einmal die blanke Wahrheit, zumindest sofern man der Schilderung des Obsthändlers Glauben schenkte, der nach Beendigung seines Berichts, das krause Haar zwischen die Finger geklemmt, die einzige Straße des Hafenortes hinuntergelaufen war. Der plattnasige Servant sah keine Veranlassung dafür, die Geschichte des Händlers in Zweifel zu ziehen. Und über das viele Geld, das er dafür aufgewendet hatte, ärgerte er sich weniger als über den läppischen Betrag, den ihm der Bärtige für die Verladung der sinnlosen Fracht bezahlte.
Nachdem er die ersten beiden Kisten unter Deck verstaut hatte, schlenderte er die Gangway hinunter, setzte sich auf einen Stein an der Mole und sah den kreischenden Lachmöwen dabei zu, wie sie über dem Anleger ihre Bahnen zogen, in der Absicht, die lunchenden Matrosen um einige Stücke hellen Hühnerfleischs zu bringen. Am Gipfel des Vulkans zogen einzelne weißgraue Wölkchen auf, blieben hängen, verdichteten sich zu einem Haufen und hüllten die Spitze des Berges in einen dunstigen Schleier.
In einiger Entfernung stand noch immer der Bärtige, die Post in den Händen. Für die mangelnde Arbeitsmoral des Plattnasigen hatte er keinen Blick. Er war allein daran interessiert, so schnell wie möglich zum untersten Umschlag vorzudringen. Anfangs hatte dieser zuoberst gelegen. Doch weil der Bärtige die Besonderheit seines Inhalts bereits erahnte, wollte er es mit der Lektüre so halten, wie er es mit dem Verzehr einer Portion köstlichen Lammfleischs nach monatelanger Diät getan hätte: Er hob sie sich bis zum Schluss auf.
In all den Jahren, die er nun schon unterwegs war, hatte er sich daran gewöhnt, nur alle paar Monate Post aus der Heimat von einem der wenigen Schiffe zu empfangen, die den Archipel durchkreuzten. In der Regel handelte es sich dabei um einige durch die lange Reise arg in Mitleidenschaft gezogene Exemplare englischer Zeitungen, die ihm immerhin einen schwachen Eindruck davon vermittelten, was vor zwei bis drei Monaten zu Hause und im Rest der Welt geschehen war. Weiterhin enthielt das Bündel meist die zum Zeitpunkt ihres Versandes jüngsten Ausgaben verschiedener wissenschaftlicher Journale, deren Ergebnisse im Moment ihres Eintreffens jedoch nicht selten schon wieder überholt waren. Und nicht zuletzt bekam er mit der Post die üblichen Nachrichten von Freunden und Verwandten, die sich nach seinem Befinden und dem Datum seiner geplanten Rückkehr erkundigten. Beide Fragen beantwortete er, mit wechselnder Wortwahl, stets auf die gleiche Weise: Sein Befinden sei, den von Zeit zu Zeit auftretenden Fieberattacken zum Trotz, gut, und wann er zurückkehre, könne er nicht genau sagen, schließlich hänge dies davon ab, wie schnell die Arbeit erledigt sei. Was genau dies eigentlich heißen sollte, dass die Arbeit erledigt sei, wusste er selbst nicht. Doch solange seine Korrespondenten sich mit dieser Antwort zufriedengaben, sah er keinen Grund, nach einer anderen zu suchen.
Mit feuchten Fingern machte er sich daran, den letzten Brief zu öffnen. Das dünne, wellige Papier war noch nicht ganz auseinandergefaltet, da überflog er bereits die ersten Zeilen. Er las den Brief einmal von Anfang bis Ende durch, dann ein weiteres Mal, anschließend wandte er sich vom Anleger ab und lief, so schnell er konnte, den staubigen Weg hinauf zu seiner kärglichen Hütte. Wie die meisten Behausungen der Insel bestand sie aus nichts weiter als aus zusammengebundenen Bambusstäben und Palmwedeln. In Höhe, Länge und Breite maß sie nicht einmal ganz zehn Fuß und ragte, den täglichen Winden ausgesetzt, wie ein schiefer Baum aus dem schmutzigen Sand. Im Türrahmen, der nie eine Tür gesehen hatte, sondern lediglich mit einem dünnen Tuch behängt war, baumelten kopfüber mehrere Vogelbälge. Lange Kolonnen rötlicher Ameisen bemühten sich, diese zu erreichen, scheiterten jedoch weit vor dem Ziel an den eigens für sie aufgehängten Fallen mit Ingwersirup. Vor der Hütte, unter einem löchrigen Sonnensegel, stand ein Tisch, vollgepackt mit Papieren, Skizzen und Büchern. In einem Kasten lagen lange, spitze Pinnnadeln, scharfe, blankgeputzte Skalpelle sowie Garne unterschiedlicher Dicke und Länge.
Der Bärtige setzte sich an den Tisch, schob die Papiere und Bücher beiseite, spitzte eine Feder und begann, ohne sich um den Stand der Verladung seiner Kisten zu scheren, eilends eine Lage leerer Blätter zu beschreiben.
Unterdessen lief am Quai, neben der großen Koningin,eine zierliche Piroge ein. An Bord: der Gouverneur der Insel nebst einem blassgesichtigen, dünnhaarigen Begleiter. Ein Maat sprang an Land, nahm ein schmales Reep und wickelte es achtlos um einen der Poller. Der Bauch des kleinen, dicklichen Gouverneurs quoll in speckigen Wülsten aus der beigen Bundhose hervor. Er grinste zufrieden. Über ihm stiegen gräuliche Rauchwölkchen gen Himmel, in seinem Mund steckte eine Blue Sumatra.
Kaum dass die Piroge notdürftig vertäut war, wies er zwei Jungen an, ihn bei den Händen zu packen. Seinen blässlichen Begleiter forderte er auf, am Hinterteil kräftig zu schieben, damit man ihm die Arme nicht ausreiße, und kurz darauf stand er auf festem Boden, klopfte sich keuchend die Falten aus der Hose und verlangte nach einer weiteren Zigarre.
»Kommen Sie, kommen Sie!«, rief er dem Blassen zu und trat forschen Schrittes an eine Gruppe Malaien heran, die am Anleger herumsaßen. Einem kleinen, Betelnuss kauenden Schmächtigen haute er zur Begrüßung so kräftig auf den Rücken, dass dieser sich verschluckte und unter Tränen hustete, während der Gouverneur in schallendes Gelächter ausbrach.
Der Blassgesichtige stand unbeholfen und ängstlich in der Mitte des Bootes, das, um das Gewicht des Gouverneurs erleichtert, kräftig hin und her schaukelte. Immer wieder prallte es an die glitschigen Steine der Mole, und mit jedem Mal löste sich das lieblos um den Poller geworfene Reep ein Stückchen mehr.
»Kommen Sie, kommen Sie!«, rief der Gouverneur erneut, und weil er sich nicht traute, die Geduld des Inselverwalters über Gebühr zu strapazieren, nahm der Blassgesichtige allen Mut zusammen, wartete, bis das Boot so nah wie möglich an die Mole herangetrieben war, machte einen beherzten Sprung, landete mit dem linken Fuß erfolgreich auf dem Anleger, blieb jedoch mit dem rechten an einer der Bohlen hängen.
Mit schmerzverzerrtem Gesicht humpelte er zum Gouverneur, der ihn zu sich heranzog und mit dem Zeigefinger eine große Bahn beschrieb: von den Hütten um den Anleger herum, die Hänge des Vulkans hinauf bis zur wolkenverhangenen Spitze und wieder hinab zum Verschlag des Bärtigen.
Auf der Stirn des Bärtigen glänzten inzwischen deutliche Perlen frischen Schweißes, nur war er so sehr ins Schreiben vertieft, dass er nicht einmal bemerkte, wie einige von ihnen von der Stirn auf die Nase, von der Nase in den Bart und vom Bart aufs Papier tropften.
Ebenso wenig bemerkte er den kleinen Malaien, der sich flinken Schrittes seiner Hütte näherte. Erst als der Insulaner vor ihm stand und zaghaft zunächst, dann immer lauter seinen Namen rief, schaute er nach oben, erkundigte sich, was es gebe, und quittierte leise seufzend die Nachricht, dass der Gouverneur ihn zu sprechen wünsche.
Erstes Kapitel
In welchem dem Nachtwächter Albrecht Bromberg ein Buch auf die Füße fällt und die Geschichte ihren Lauf zu nehmen beginnt
Selbst die größten Umwälzungen der Geschichte beginnen bekanntlich mit einer Kleinigkeit. Und selbst die kleinste Kleinigkeit ist kaum klein genug, um nicht doch am Ende eine große Wirkung zu zeitigen.
So war es auch an diesem Morgen, als der Nachtwächter Albrecht Bromberg gegen fünf Uhr die Bibliothek des Museums für Natur- und Menschheitsgeschichte betrat. Wie immer schaltete er zunächst das Licht ein. Die Lampen auf den Tischen zuckten und flackerten, bevor sie vollends zu leuchten begannen, so als hätte man sie unsanft aus seligem Schlaf gerissen. Bromberg stöhnte leise, weil wie so oft auf etlichen Plätzen Bücher verstreut lagen, die faule Leser dort zurückgelassen hatten, anstatt sie zu den dafür vorgesehenen Wagen zu bringen. Er ging durch die Reihen, sammelte ein Wörterbuch des Elamitischen, einen Kommentar zum Codex Iustinianus, eine Studie zum Eheverständnis Dionysius des Kartäusers, einen Abriss über die Geschichte der Zugvögel Zentralasiens, ein Heft über Dampfmaschinen in Neuengland, eine Synopse der vier Evangelien sowie ein Buch ohne erkennbare Beschriftung ein. Dann bahnte er sich bis unters Kinn beladen einen Weg zwischen den Stühlen und Tischen hindurch.
Kurz vor der Theke – er war nur einen Moment lang unachtsam – blieb sein rechter Fuß unter dem welligen Saum des Läufers hängen, der quer durch den Lesesaal verlief. Bromberg stolperte, taumelte, wollte sich fangen, verlor jedoch den Halt und landete der Länge nach, die schweren Bände in alle Richtungen werfend, auf dem Boden. Fluchend und mit schmerzenden Knien tastete er nach seiner Brille.
Wäre genau in diesem Moment jemand zu ihm getreten, um ihm zu verkünden, dass dieser scheinbar bedeutungslose Stolperer sein Leben, ja nicht nur sein Leben, sondern auch das Leben anderer und den Lauf der Dinge insgesamt verändern sollte, er hätte nur verächtlich abgewinkt, wäre aufgestanden und davongegangen.
Seit jeher, das heißt, seit jenem Tag, an dem Bromberg als Nachtwächter im Museum zu arbeiten begonnen hatte, war der Ablauf seines Rundgangs stets der gleiche. Nur selten störte ein unvorhergesehenes Ereignis seinen gewohnten Trott. Vor einer Weile hatte sich ein Marder Zugang zu einem der Kabelschächte verschafft und dadurch einen Feuerwehrgroßeinsatz ausgelöst, weil plötzlich allerorten Rauchmelder Alarm schlugen, aber nirgends ein Brand auszumachen war. Erst als der Marder einige Tage später den verblüfften Museumsdirektor höchstpersönlich morgens in seinem Büro begrüßte und gänzlich unerschrocken an einem Stück Schinkenspeck nagte, das der adipöse Direktor, um der strengen Diät seiner Gattin zu entkommen, in einer Schublade seines Schreibtischs versteckt hatte, war die Ursache des Alarms gefunden, wenngleich der Direktor sich zierte zuzugeben, was den Marder in sein Büro gelockt haben mochte.
Ein anderes Mal hatte sich ein Zehnjähriger unbemerkt von seiner Schulklasse davongestohlen und bis zur Schließung des Gebäudes im Halbdunkel hinter einer Vitrine ausgeharrt. Punkt Mitternacht, als der Lärm der Tagesbesucher längst verklungen war und die Luft vollends rein schien, war er schließlich hervorgekrochen und dem Skelett des großen Brachiosaurus wie Siegfried dem Drachen entgegengetreten, mit dem Ergebnis, dass Bromberg ihn schon kurze Zeit später auf dem wackeligen Kniegelenk des riesigen Sauriers sitzend fand, laut wimmernd wie eine kleine, unerfahrene Katze, die einen hohen Baum zwar zu erklimmen, aber nicht wieder zu verlassen gewusst hatte. Seitdem musste Bromberg jede Nacht, wenn er die Galerie der Giganten betrat und die gewaltige Echse erblickte, daran denken, welch jämmerlichen und belustigenden Anblick zugleich der kleine Junge damals geboten hatte.
Die Galerie mit ihren naturgeschichtlichen Sammlungen, die den westlichen Trakt des Museums vollständig einnahm, war so groß wie das Langhaus einer mächtigen Kathedrale. Auch sonst glich sie in Form und Bauweise, mit ihren wuchtigen Säulen aus Stein, den bunt gegossenen Fenstern aus Bleiglas und dem Kreuzrippengewölbe, wie überhaupt das ganze Gebäude, eher einem Gotteshaus als einem Museum.Als Bromberg vor vielen Jahren zum ersten Mal die imposante Halle betreten hatte, meinte er, auf den Sockeln am Fuße der Säulen die Gesichter von Bibelvätern, Propheten, Kirchenlehrern und Heiligen auszumachen. Bei näherer Betrachtung jedoch stellte sich heraus, dass an ihre Stelle die ehrenwerten Köpfe der weltlichen Wissenschaften und großen Erfindungen getreten waren – Aristoteles, Hippokrates, Euklid, Galileo, Bacon, Newton, Leibniz, Watt, Linnaeus, Darwin und andere –, die nun mit versteinerten Mienen auf das kunterbunte Sammelsurium blickten.
Unter dem alles überspannenden Glasdach war auf mehreren Etagen ein Panoptikum der Lebewesen versammelt, welche die Natur im Laufe von Jahrmillionen hervorgebracht hatte. In mannshohen Gläsern schwammen giftige Vipern, Nesselquallen und Skorpione. Daneben standen ausgestopfte Sperber, Geier, Finken und Dohlen. Einen halbierten Elefantenschädel hatte man samt Haut und Haaren in Formaldehyd eingelegt. In Vitrinen und Schaukästen steckten die leblosen Leiber unzähliger Fliegen, Libellen, Wespen und Schaben. Unter Vergrößerungsgläsern lagen winzige Pfeilwürmer, Muschellarven und Krebstiere. Die riesigen Knochengerüste der Saurier teilten sich den Raum mit skelettierten Walen, Haien und Delfinen. In den Boden waren steinerne Platten mit fossilen Riesenfarnen eingelassen. An den stählernen Rippen des Daches hingen lebensgroße Nachbildungen von Pelagornis und Archäopteryx.
Brombergs Eindruck, man habe in diesem Dom die gesamte Ladung der Arche Noah versammelt, tat der alte, bucklige Kurator beim ersten Rundgang mit den Worten ab, die überforderten Taxonomen kennten auch nach Jahrhunderten des Sammelns, Vergleichens und Benennens noch nicht einmal ein Zehntel all dessen, was die Erde bevölkere, weshalb wohl noch mehrere Sintfluten vorübergehen müssten, bis auch nur annähernd alle Spezies aus dem Dunkel des Erdreichs, aus dem Dickicht der Wälder und den Untiefen der Ozeane heraufbefördert und so geordnete Zustände wie auf dem biblischen Boot hergestellt wären.
Tatsächlich war es um die Ordnung der Dinge im Hause nicht gerade bestens bestellt. Zwar folgte die Nomenklatur wie üblich dem bewährten Universalschema des Linnaeus, doch abseits dessen herrschte Systematik nur in den Augen des unbedarften Betrachters. In Wahrheit war fast jede Direktorengeneration ihrem eigenen Gutdünken gefolgt, wenn es galt, das Ausgestellte in Reih und Glied zu bringen.
Dem ersten Direktor erschien es einleuchtend, die Lebewesen entsprechend der Schöpfungstage zu arrangieren, und so hatte man zunächst Gräser, Kräuter und Bäume, darnach Wasserwesen, Fische und Vögel, anschließend Vieh, Gewürm und Feldgetier sowie schlussendlich den Menschen ausgestellt. Allerdings monierte der zweite, dass, wenn man der Heiligen Schrift folge, man leicht den gleichen Fehler wie Adam begehe, der nur den Vögeln, den Feldtieren und den Viechern Namen gegeben hatte. Daher schlug er vor, den Aufbau der Welt im Großen zum Aufbau des Hauses im Kleinen zu machen, ergo im Untergeschoss die Bewohner des Wassers und des Bodens zu präsentieren, zu ebener Erde sämtliche Tiere des Landes und auf den Emporen darüber, was in Sträuchern, Bäumen und Lüften fleuchte, damit nichts übersehen und vergessen werde.
Dem dritten gefiel diese Anordnung in der Vertikalen, doch überlegte er, ob nicht weniger das Vorkommen als vielmehr der Grad an Perfektion für eine Klassifikation entscheidend sei. Er begann, die Lebensformen wie auf einer Stufenleiter aufzustellen. Allerdings blieben seine Bemühungen auf halbem Wege stecken, weil unter den Helfern ein Streit entbrannte, welchen Merkmalen und Eigenschaften bei der Einteilung mehr Gewicht zukommen solle als anderen. Die Honigbiene, so argumentierten einige, beweise mit ihrem formvollendeten Bau hexagonaler Waben doch ebenso viel mathematischen Verstand wie der Mensch. Und der Luchs, meinten andere, übertreffe den Menschen an Sehsinn, weshalb man unmöglich behaupten könne, es sei der Mensch als Krone der Schöpfung längst ausgemacht.
Der sechste Direktor (Nummer 4 und 5 waren, gezeichnet von den Querelen ihres Vorgängers, angstvoll vor jeglicher Initiative zurückgeschreckt) fühlte sich zum flammenden Verfechter der geologischen Zeiteinteilung in Äonen, Ären, Perioden, Epochen und Alter berufen. Daher spielte es für ihn keine Rolle, ob ein Lebewesen der Schrift nach am zweiten oder dritten Tage erschaffen worden war, ob es zu Wasser, zu Land oder zu Luft lebte, ob es besser oder schlechter rechnen und sehen konnte. Was zählte, war sein erdgeschichtliches Erscheinen. Funde des Kambriums und Ordoviziums mussten in möglichst großer Entfernung von den Exponaten aus Jura und Kreide aufgestellt werden, weshalb er seinen verdutzten Sammlungsverwaltern auftrug, Jüngeres von Älterem zu trennen, woraufhin seine Ägide den Spöttern nach als Kataklysmus in die Annalen des Museums einging.
Auch sein Nachfolger sorgte nicht minder für geschäftiges Treiben, indem er beschloss, gebührendes Augenmerk auf die geographische Herkunft der Lebewesen zu legen. Es sei nicht nur das Wann, sondern auch das Wo des Auftretens von entscheidendem Wert, wenn nicht sogar am wichtigsten, betonte er und erklärte, versteinerte Gürteltiere aus der Pampa Südamerikas dürften nicht neben den mit Holzwolle gefüllten Orang-Utans Südostasiens landen. Seine Ordnung folgte nicht nur den natürlichen Grenzen der Kontinente, sondern sie berücksichtigte auch, ob ein Tier etwa am nördlichen oder südlichen Ufer des Amazonasstroms gefunden worden war. Dies könne, so erklärte er unermüdlich, einen erheblichen Unterschied bedeuten, jedenfalls wenn man den Worten eines findigen Sammlers aus dem brasilianischen Urwald Glauben schenken wolle, dessen Erkenntnisse ihm kürzlich zugetragen worden waren.
Der zehnte Direktor stimmte mit seinem Vorvorvorgänger darin überein, dass die Ergebnisse biogeographischer Forschungen gar nicht genug gewürdigt werden könnten. Und dennoch, dennoch, sagte er, entbinde dies nicht von der wissenschaftlichen Pflicht, die Lebewesen, wie schon so lange üblich, in Reiche, Stämme, Klassen, Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten, ja, wenn nötig, auch in feinere Taxa wie Überklassen und Unterklassen oder Teilordnungen einzusortieren. Schließlich gewähre nur dieses System ein lückenloses, einheitliches Erfassen aller Organismen, das nicht zuletzt die Grade der Verwandtschaft berücksichtige, was keinem Betrachter der Sammlung vorenthalten werden dürfe. Seine Nachfolger widersprachen in diesem Punkt nicht, und dennoch seufzten sie jedes Mal, wenn sich aufgrund einer Verfeinerung der wissenschaftlichen Methoden herausstellte, dass unzählige Exemplare dem falschen Taxon zugeordnet worden waren, wenn plötzlich eine neue Art oder eine neue Unterart zutage trat und somit dem Stammbaum des Lebens weitere, komplizierte Verästelungen hinzugefügt werden mussten. So hatten also die hehren Bemühungen um Übersicht und Ordnung über all die Jahre hinweg ein prächtiges Chaos hinterlassen, und es war fortan jedem Besucher selbst anheimgestellt, Ordnung zu sehen, wo er Ordnung sehen wollte, ungeachtet dessen, ob andere dort ebenfalls Ordnung oder aber nichts als Unordnung ausmachten.
Auch im östlichen Trakt des Museums, der der Menschheitsgeschichte gewidmet war, kämpfte man damit, der Überfülle von Objekten Herr zu werden. Ihre Aufbewahrung, Pflege und Auswertung bereiteten so manches Mal Probleme. Allerdings gab es im Vergleich zum Westteil nur selten Diskussionen darüber, wie die Ausstellungsstücke anzuordnen seien. Denn anders als die Geschichte der Natur, schien die Geschichte der Menschheit eine fortschreitende Entwicklung zu beschreiben. Während die Affen seit Jahrmillionen auf den Bäumen hockten, war der Mensch in den aufrechten Gang gewechselt, hatte anschließend das Rad, später sogar Flugobjekte erfunden und sich allmählich über die ganze Erdkugel verteilt, um sie sich Jahrtausende später endlich dem göttlichen Auftrag gemäß vollends untertan zu machen.
Gewiss verwarf nicht jede Menschheitsgeneration die Erfindungen und Entdeckungen der vorigen. Das Rad, das Feuer, das Geld – sie alle waren nach wie vor in Gebrauch und ein Ende ihrer Nutzung nicht absehbar. Dennoch war es üblich, vermeintlich nutzlos Gewordenes und Überholtes dem allgemeinen Vergessen anheimzugeben. Daher ließ sich im Museum nicht nur die zunehmende Verfeinerung des Rades von einem holprigen, rumpelnden Stein hin zum aalglatten Kautschukreifen begutachten, sondern es war auch, und vor allem, eine letzte Ruhestätte des Verworfenen. Nur ein besonders tiefsinniger, schwärmerischer Geist vermochte in den belächelten Rauchzeichen des Urmenschen den Vorgänger papierloser Kommunikation oder im brüchigen Faustkeil den Archetypus des Sturmgewehrs zu sehen.
Bromberg hatte gar nicht erst damit begonnen, eine besonders innige Beziehung zu den gehorteten Objekten aufzubauen. Für ihn waren sämtliche Exponate gleichermaßen Dinge, die es zu bewachen und zu schützen galt – mehr aber auch nicht.
Jede Nacht durchschritt er wenigstens einmal alle Flügel des Gebäudes, um nach dem Rechten zu sehen. Dazwischen hielt er sich im Wesentlichen mit drei Dingen auf, die ihm dabei helfen sollten, der nächtlichen Routine und der Ödnis des Museums zu entkommen. Das erste war die Pflege seiner Epiphyten, die über die Jahre zu einer prächtigen Sammlung herangewachsen waren und die selbst den gewieftesten Botanikern des Museums einigen Respekt abnötigten. Seine Zöglinge hießen Argentea, Balbisiana oder Dorothea, und weil sie in der freien Natur auf den Ästen großer Urwaldbäume wuchsen, die Bromberg ihnen im Museum nicht bieten konnte, hatte er für jede Einzelne von ihnen liebevoll ein kleines Drahtgestell gebastelt, in dem sie nun von der Decke der Portiersloge baumelten. Manchmal betrachtete er sie nur von Weitem, manchmal nahm er sie behutsam in die Hand und ab und zu streichelte er ihnen mit dem Finger vorsichtig über die Blätter.
Die zweite Ablenkung, die er pflegte, bestand im Lösen von Kreuzworträtseln. Doch löste er die Rätsel nicht, wie gewöhnliche Menschen es taten, mit einem Stift auf den Seiten einer Illustrierten, sondern im Kopf. Dabei war diese Technik weniger aus eigenem Antrieb als vielmehr aus der Not geboren. In einer der ersten Nächte im Museum nämlich hatte Bromberg unbedarft die Hefte vom Tisch der Portiersloge genommen und jedes freie Kästchen ausgefüllt, ohne zu ahnen, dass dies in einen handfesten Streit mit seinem Kollegen münden würde, dem die Hefte gehörten. Seitdem hütete er sich tunlichst, weiteren Anlass für Unmut zu bieten, und füllte die Kreuzworträtsel zwar aus, jedoch ohne auch nur den Hauch einer Spur zu hinterlassen. Des Öfteren entstanden dabei wahre Ungetüme von Wortgerüsten, die so groß wurden, dass sie über seinen Kopf hinauszuwachsen drohten, doch sah er mit der Zeit auch den alles entscheidenden Vorteil dieser Art des Rätsellösens: Sie kam ohne das lästige Durchstreichen, Überschreiben oder Radieren falscher Worte aus. Stattdessen ließ Bromberg jedes Wort, das nicht passen wollte, einfach fallen und machte damit Platz für ein neues, das dann im besten Falle das richtige darstellte. Hatte er das Rätsel gelöst und im Kopf die Buchstaben aus den nummerierten Kästchen in die Zeile mit dem Lösungswort eingetragen, rief er bei der sogenannten Gewinn-Hotline an, um die Lösung durchzugeben. In der Regel, so sein Gefühl, verhallten seine Worte ungehört in der Leitung. Nur ein einziges Mal war er mit einem Preis bedacht worden: einem Kugelschreiber mit der Aufschrift Rätsel dich reich!
Wenn nicht bereits ein Großteil der Nacht mit Epiphytenpflege und Kreuzworträtsellösen vergangen war, widmete sich Bromberg einem dritten Ablenkungsmanöver. Ähnlich wie beim Rätseln bemühte er sich auch bei dieser Beschäftigung, möglichst keine Spuren zu hinterlassen, allerdings nicht, weil er den Unmut, sondern in diesem Fall sogar das völlige Unverständnis vonseiten seiner Kollegen fürchtete. Mithilfe eines Wörterbuchs und einer Grammatik legte er nämlich endlose Listen mit Vokabeln und detaillierte Aufzeichnungen zu diversen Regeln des Mordwinischen an, einer Sprache, die er bei der ersten Begegnung in Form eines kleinen Büchleins mit Volkssagen für die Erfindung eines verrückten Schriftstellers gehalten hatte. Nach einigem Nachforschen aber hatte er sie als die Sprache der Bewohner einer kleinen autonomen Republik namens Mordwinien, einige hundert Kilometer südöstlich von Moskau, eingeklemmt zwischen mehreren Oblasten, unweit der Wolga, identifizieren können. Weder der eine noch der andere der beiden Hauptdialekte des Mordwinischen verfügten, wie Bromberg bald herausfand, über das Wörtchen »haben«. Und weil es ihm so natürlich schien, dieses oder jenes Ding zu haben, wollte er herausfinden, wie es sich anfühlte, wenn die Dinge nicht mehr zu haben waren, sondern nur noch bei einem sein konnten. Trotz intensiver Bemühungen musste er jedoch schon bald feststellen, dass sich gefühlsmäßig kein Unterschied zwischen diesen Zuständen einstellen wollte. Spätestens mit der ersten Grippe, die ihn eines Nachts im Museum heimsuchte, sah er ein, dass es völlig gleich war, ob man eine Grippe sprachlich haben konnte oder ob sie nur bei einem war. Nichtsdestotrotz setzte er seine Lektionen unvermindert fort und entschuldigte dies damit, dass man das meiste im Leben tue, ohne zu wissen, ob es irgendwann für irgendetwas gut sein würde.
Dass die Nächte trotz dieser Beschäftigungen manchmal unerträglich lang wurden, konnte Bromberg nicht verhehlen. Nicht selten blickte er auf die Zeiger der großen Uhr und sehnte das Ende seiner Schicht herbei. Gleichwohl hasste er seinen Beruf nicht. Und wenn er gefragt worden wäre, ob er glücklich sei, hätte er geantwortet, dass er nicht wisse, was das sein solle, Glück. Mit seinem Leben, wie es war, hatte er sich arrangiert, und er war froh, wenn er nicht unnötig behelligt wurde.
Schlag drei Uhr trat er nach draußen vor das Portal des Museums, um eine Pfeife zu rauchen. Sein punktgenaues Erscheinen war kein Zufall, sondern nur ein weiterer Ausdruck des selbst auferlegten Rigorismus, der es ihm ermöglichte, in seiner drögen Tätigkeit Erfüllung zu finden. Es verschaffte ihm jede Nacht eine gewisse Genugtuung, wenn er nicht um zwei Minuten vor oder um drei Minuten nach, sondern um Punkt zehn Uhr in der Pförtnerloge zur Ablösung erschien, wenn er nicht um fünf Minuten nach oder um zehn Minuten vor, sondern um Punkt drei Uhr die Pfeife zu stopfen begann. Zwar befiel ihn beim immer gleichen Verrichten der Dinge manchmal das ungute Gefühl, im Laufe der Jahre zu einem hoffnungslosen Pedanten verkommen zu sein, doch tröstete er sich mit dem Gedanken, es habe außer ihm selbst wenigstens sonst niemand darunter zu leiden.
Draußen vor dem Museum streckte er die Arme von sich und atmete in tiefen Zügen die klare Luft der Nacht ein. Er mochte die Stunden zwischen dem letzten und dem ersten Lärm. Auf der Straße vor dem Museum war meistens alles ruhig, nur ab und an rauschte ein Taxi vorbei oder ein Fahrradfahrer schlingerte betrunken der Nachtruhe entgegen. Brombergs Schicht endete jeweils um halb sieben Uhr morgens, und die Pause, die er sich um drei Uhr gönnen durfte, betrug exakt eine halbe Stunde. Neben dem Rauchen der Pfeife nutzte er diese Zeit dafür, sich über dem Lüftungsgitter die Beine zu wärmen und mit dem Landstreicher Henri Clochard eine Art einfachen Roulettes zu spielen.
Bromberg wusste nicht, wie Henri eigentlich hieß, ja, ob er überhaupt einen richtigen Namen hatte. Henri Clochard nannte er ihn, weil er stets eine Flasche Wein bei sich trug und ein Glas, in das er den Wein füllte, wann immer er sich irgendwo niederlegte oder setzte. Früher hatte Bromberg Henri hin und wieder in einer der Toiletten im Erdgeschoss des Museums gefunden. Durch ein nicht ganz sorgfältig geschlossenes Fenster hatte er sich Zugang verschafft und dann warm und zufrieden in einer der Kabinen gelegen, auf dem Spülkasten über sich das Weinglas, allein sein lautes, schnarrendes Röcheln verriet ihn jedes Mal. Inzwischen boten ihm die Toiletten kein ruhiges Versteck für die Nacht mehr. Wenn er nun bepackt mit klimpernden Tüten herantrabte, forderte er Bromberg immer schon von Weitem dazu auf, eine Münze aus der Tasche zu ziehen. Bromberg warf die Münze in die Luft, Henri prognostizierte, auf welcher Seite sie landen würde, und wenn die Voraussage richtig war, durfte er die Münze behalten, andernfalls ging sie wieder an Bromberg zurück. Seit ihrer ersten Begegnung schon spielten sie dieses Spiel, und weil die Gewinnchancen für alle Beteiligten bei genau fünfzig Prozent lagen, hielten sie den Deal beide für mehr als fair. Wenn Henri gewann, rief er jedes Mal lauthals und siegestrunken, er würde gewiss nicht wiederkommen, schließlich sei er nun ein gemachter Mann und könne sich mit seinem Reichtum zur Ruhe setzen. Bisher aber war noch keine Nacht vergangen, nach der er nicht doch wieder aufgetaucht war, und Bromberg wollte der Letzte sein, der ihm dies verübelte, hellte doch das kurze Spiel mit Henri stets seine Stimmung auf, bevor er ins Museum zurückmusste.
Die Runde nach dem Pfeifenrauchen galt in jeder Nacht der Inspektion der Bibliothek. Auch in dieser Nacht wäre sie von Bromberg ohne große Umstände absolviert worden, hätte nicht der wellige Läufer des Lesesaals ihn zu Fall gebracht. So stand er nun unter der hohen Kuppel, befühlte seine schmerzenden Knie, ärgerte sich über sich selbst und seine Unachtsamkeit, noch viel mehr aber über die Existenz des Läufers.
Er bückte sich, um eines der Bücher aufzuheben, die bei seinem Sturz in alle Richtungen geflogen waren, und hielt inne, als ihn die Blicke der beiden Männer trafen. Der jüngere von beiden stand, den rechten Arm in die Hüfte, die linke Hand auf die Stuhllehne gelegt, mit leicht geöffneten Beinen neben seinem älteren, bärtigen Begleiter. Seine Haltung war ruhig, sein Blick konzentriert. Das rechte Knie des Bärtigen ruhte auf dem samtigen Polster, seine rechte Hand hielt, in akkurater Spiegelung der Pose des Jüngeren, die Lehne, die linke war in die Hüfte gestützt. Beide Männer waren von hagerer Gestalt, trugen leuchtend weiße Hosen über schwarzen, frisch gewichsten Schuhen. Von ihren Schultern hingen dunkle, schmal geschnittene Mäntel fast wie Kittel, darunter schauten feine, einreihige Westen mit breitem Revers und weißen Hemden hervor.
Den Hals des Jüngeren zierte eine schwarze Schleife, seine Wangen und sein Kinn waren glatt rasiert, nur auf der Oberlippe hatte er feinsäuberlich einen schmalen Streifen stehen lassen, der ihm etwas Schmieriges verlieh. Der Hals des Älteren war nicht zu sehen, stattdessen kräuselte sich sein voller Bart nach allen Seiten. Auf der Nase saß eine kleine Nickelbrille, auf dem Kopf ein rundlicher Bowlerhut mit gebogener Krempe. Die Kopfbedeckung des Jüngeren bestand nicht aus einem Hut, sondern einer Art Mütze, die ihm etwas Lächerliches verlieh. Sie besaß keine Krempe und war so gestaucht, als hätte ihm jemand eine übergezogen. Ihm selbst schien dies nichts anzuhaben, nur die Augen des Bärtigen neben ihm funkelten schelmisch, seine Lippen umspielte ein wissendes Schmunzeln.
Auch Bromberg schmunzelte er an, aber Bromberg war nicht nach Schmunzeln zumute. Seine Knie schmerzten noch immer, und das Einzige, was er wünschte, war, die Bibliothek so schnell wie möglich zu verlassen, um die letzten Stunden seiner Schicht so ungestört wie möglich zuzubringen. Deshalb klappte er, ohne die beiden Männer eines weiteren Blickes zu würdigen, das Buch zu, sammelte auch die übrigen Bücher ein und brachte sie zur Theke. Anschließend ließ er seinen Blick ein letztes Mal durch den großen Saal schweifen. Dann schaltete er das Licht aus.
Zweites Kapitel
Worin der junge Bärtige in Amazonien einen Sandfloh aus seinem Fuß entfernt, ein Krokodil verspeist, auf Eingeborene trifft und sich im Urwald verläuft
E