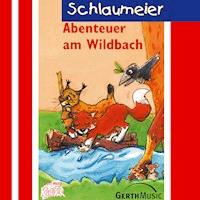Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Eine mittlere Stadt in Baden-Württemberg in den 80er Jahren, gut bürgerliche Wohngegend, nicht wirklich aufregend. Hier lebt Anne, aparte Mittdreißigerin, verheiratet und Mutter von Zwillingen. Alles scheint seinen normalen, vorbestimmten Weg zu gehen, bis eines Tages ein dramatische Ereignis ihrem Leben einen Domino-Effekt gibt: wird sie den Fortlauf stoppen, Ihre Emotionen in den Griff bekommen und vor allem: das Geheimnis ihrer Herkunft bewahren können?“
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Simon,
ohne den dieses Buch nie zustande gekommen wäre.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 1
Der 9. Januar war ein Montag und ein Wintertag von der Sorte, die einen mehr an Frühlingshimmel als an klirrenden Frost denken lassen.
Lea erinnerte sich, irgendwo gelesen zu haben, daß man besonders schöne Erinnerungen in Einweckgläsern haltbar machen und so die Zeit überbrücken könne, die nicht so schön ist. Sie beschloß, sich nachher ein Glas »Urlaub im Süden, Sonne, den Duft von Rosenbüschen im Tessin und den der Lavendelfelder der Provence« aufzumachen.
Sie war in der Zwischenzeit mit dem Frühstück fertig, die knapp neunjährigen Zwillinge Simon und Andreas in der Schule, und die Hausarbeit nebst einem Berg Schmutzwäsche warteten auf sie. Während sie das Waschbecken putzte, betrachtete sie sich im Spiegel: Ihr längliches Gesicht mit diesen schlecht zu beschreibenden Augen, deren Farbe an die von einem billigen grünen Preßglasaschenbecher erinnerte; »das einzige, was zählt in deinem Gesicht, sind die Augen, den Rest kannste vergessen«, hörte sie ihren Mann sagen. Na ja, so unrecht hat er nicht, dachte sie, der Rest war wirklich nicht der Rede wert: die lange schmale Nase, deren echte Herkunft sie erst vor wenigen Jahren erfahren hatte, der kleine, schmallippige Mund, der sie in Teenagerzeiten zu gewagten Schminktricks veranlaßt hatte und mit dem sie jetzt ungeschminkt besser zurechtkam. Genauso wie sie sich jetzt zu ihren kupferroten Haaren bekannte, deretwegen sie in ihrer Jugend oft gehänselt worden war. Als sehr rücksichtsvoll und diskret konnte man die Gegend nicht bezeichnen, in der sie aufgewachsen war. »Rothaarig und geil!« hatte man ihr als Sechzehnjähriger nachgerufen. Und als sie Jahre später während einer Auseinandersetzung ihren Mann gefragt hatte, weshalb er sie denn überhaupt geheiratet habe, hatte er, ohne zu überlegen, geantwortet: »Weil du die Geilste von allen warst.« Damals wäre ihr es lieber gewesen, wenn er statt dessen zugeschlagen hätte. Unter »Geilheit« verstand sie etwas anderes als das, wie sie sich sah: eine sinnliche Frau von fünfunddreißig Jahren, der man ihr Alter – wenn überhaupt – nur beim Lachen ansah; dann legte sich ein Kranz feiner Fältchen um ihre Augen, was diese im übrigen gar nicht unvorteilhaft unterstrich. Und sie lachte gern und viel.
Ihre Figur war eher die einer Fünfundzwanzigjährigen, »wie ein Mannequin, nur mit zuviel Busen«, pflegte ihre Freundin Dagmar ohne Neid zu sagen. Und Neid gab es zwischen den beiden nicht, dreißig Jahre kannten sie sich, hatten Kindheit und den größten Teil ihrer Jugend zusammen in der gleichen Straße verbracht, bis sie Heirat und verschiedene Wohnsitze getrennt hatten. Erst nach den Kindern, einem Haus- bzw. Umbau beider Elternhäuser kamen sie nach zehn Jahren wieder zusammen, und es war, als wären sie nie getrennt gewesen.
Obwohl sie sich äußerlich so stark unterschieden wie kaum zwei gleichaltrige Frauen gleicher Rasse, teilten sie doch fast alle Ansichten, konnten über das gleiche lachen und fanden ein- und dasselbe widerwärtig oder geschmacklos. Auch ihre Kinder glichen sich in der Beziehung; zumindest zwei davon: Andreas und Dagmars Alexander waren nahezu unzertrennlich. Obwohl sie äußerlich ebenso verschieden waren wie ihre Mütter; gegen Andreas mit der Ballettfigur seiner Mutter, dem betonten Hinterkopf seines Vaters und der legendären Nase seiner Vorfahren war Alex die identische Nachbildung seiner Mutter: Mit seinem schweren Knochenbau, trotz seiner zehn Jahre bereits breithüftig und mit einer deutlichen Neigung zu einem Bauchansatz ausgestattet, dem fröhlichen Lockenkopf seiner Mutter und der ererbten Kurzsichtigkeit seines Vaters gewiß nicht von der Natur verwöhnt, trug er alles mit dem ebenso genetisch veranlagten Mutterwitz und Humor, wie er in der Form bei Kindern seines Alters gewiß nicht häufig vorkommt.
Als vor zwei Jahren Leas Mutter starb und kurz darauf Joachim die Leitung einer Zweigstelle in Leas Heimatstadt angeboten wurde, überlegten beide nicht lange und bauten das Haus ihrer Mutter um; das heißt, es wurde fast vollständig abgerissen und neu angebaut. Nur die Straßenfassade blieb in ihrer ursprünglichen Bauweise und wurde renoviert. Lea dachte gerne an die Baustellenzeit zurück; schließlich war es auch die Zeit der »Selbstverwirklichung«, obwohl sie diesen stark abgenutzten Begriff eigentlich nicht mochte. Aber er gab doch das wieder, was sie in dieser Zeit alles einbringen und verwirklichen konnte, was bisher nicht möglich gewesen war.
Es war ihr so gut gelungen, daß sogar eine vielgelesene Wohnzeitschrift um einen Fototermin bat und das Ganze dann auch veröffentlichte; sehr zum Verdruß ihres Mannes, der all diesen Rummel haßte und doch seinen Stolz kaum verbergen konnte. In zwölf Ehejahren spielen sich gewisse Verhaltensweisen aufeinander ein, wie das Kochen eines gemeinsamen Gerichtes, das Lächeln in einer bestimmten Situation oder das Verändern der Stimme an ein- und derselben Stelle, das den Partner aufhorchen läßt.
Er ließ ihr diesen Rahmen, den sie brauchte, und all das viele Neue, das sie immer wieder gegen seinen gespielten Widerwillen durchsetzte. Bewegungen, die sie in erstarrte Formen brachte, stellte er Dritten gegenüber gerne als »sein Werk« vor. Sie konnte gut leben damit, und obwohl sie nie ein Wort darüber verloren, war ihr dies im Grunde eigentlich lieber, als für eine dieser vorlauten, hysterischen und ständig ihren Mann herunterputzenden »Emmis« gehalten zu werden. Lea und Joachim amüsierten sich oft, nachdem sie solche Gäste zu Besuch gehabt hatten, wenn Lea sie anschließend überzeichnend parodierte.
Als das Telefon klingelte, lächelte sie: Joachim rief oft in der Mittagszeit zu Hause an, um zu fragen, ob »alles in Ordnung« sei. Außenstehende empfanden es vielleicht als Kontrolle, Lea sah es als Anteilnahme an ihrem häuslichen Alltag; ein Stück ihrer Geborgenheit.
»Hier spricht das 2. Polizeirevier der Autobahnpolizei, Hauptwachmeister Münzer. Spreche ich mit Frau Engelhorn?« Leas Herz klopfte plötzlich im Hals, und sie brachte keinen Ton heraus. »Können Sie in die Unfallklinik kommen, wir erwarten Sie.« – »Ist was mit meinem Mann?« hörte sie sich fragen und hatte Angst vor der Antwort. Doch der Polizist hatte bereits aufgelegt.
Kapitel 2
Das Personal der Unfallchirurgie war gewohnt, wahrscheinlich auch geschult, mit Angehörigen sogenannter »verstorbener Unfallopfer« umzugehen. Sie taten das umsichtig, fast routiniert. Man hatte Lea eine Beruhigungsspritze gegeben, nicht ohne vorher zu fragen, ob Kinder zu versorgen, weitere Angehörige zu verständigen oder wichtige Anrufe zu erledigen seien. »Dazu sind Sie nachher nicht mehr in der Lage«, meinte der Stationsarzt lakonisch. Lea wollte nur heim, weg von hier. Panik ergriff sie, als sie Joachim identifizieren sollte; man holte sie erst am Ende des Flures wieder ein. Dann kam der Schock. »Das Übliche«, vermerkte der behandelnde Arzt in seinem Bericht.
Trotz der Spritze blieb die Ratlosigkeit. Sie wollte nur heim. Helmut, ein ehemaliger Schulkamerad und heute Polizist, erkannte sie auf dem Krankenhausflur und fuhr sie schweigend nach Hause. Mit wenigen Worten hatte er Dagmar die Situation erklärt. Sie nahm die Kinder zu sich und bat den Hausarzt, nach Lea zu sehen. Anschließend rief sie den Pfarrer an. Eigentlich wollte sie nur die Todesnachricht übermitteln und wegen eines Beerdigungstermines nachfragen, aber eigentlich hoffte sie auch darauf, er möge Lea besuchen, um etwas von ihrer Verzweiflung nehmen zu können. Aber das Pfarramt war an diesem Tag nur von dem neuen Diakon besetzt, der vor einer Woche hier sein Diakonatsjahr angetreten hatte. Dagmar versuchte, ihm in wenigen Sätzen das Geschehene zu schildern, und er versprach, es dem Pfarrer auszurichten, der bei einer Beerdigung sei.
Nachdem Dagmar aufgelegt hatte, beschloß sie – die Bodenständige, die stets durch ihre klare Realitätsbezogenheit hervorstach und sich so leicht nicht aus dem Konzept bringen ließ – etwas zu Mittag zu kochen. Diese »Das-Leben-gehtweiter«-Theorie« war ihre große Stärke; sie behielt in noch so großer Hektik den Überblick. Und das war heute auch nicht anders. Spätestens heute abend, dachte sie, wird mich die Erkenntnis, daß Joachim nicht mehr lebt, wie ein Dampfhammer in den Boden rammen. Aber jetzt haben die Kinder Hunger. Und ich auch. Schon als Kind hatte sie gefuttert, sobald Probleme aufgetaucht waren. Darin unterschied sie sich gründlich von Lea; während die einen »Knoten in die Speiseröhre« bekam, sobald sie Sorgen hatte, war es bezeichnend für Dagmar, als ihr Jüngster unter dramatischen Umständen ins Krankenhaus gebracht werden mußte, daß man sie zu Hause mitten in der Nacht Leberwurstbrote verschlingen sah.
Und als jetzt das ganze Haus nach Bratkartoffeln mit Frikadellen und Gurkensalat duftete, setzten sich alle um den großen, runden Eßtisch in Dagmars Küche, während sie mit Tellern und Besteck klapperte. Es klingelte an der Haustür. Dr. Scholl brachte Dagmar ein Rezept und sagte, daß Lea jetzt schlafe. Auch er konnte dem Geruch und der Einladung nicht widerstehen, obwohl die Frikadellen nicht reichten. »Ich brate mir ein paar Rühreier, machen Sie sich keine Sorgen um mich; ich komm’ schon zu meinen Sach’«, lächelte Dagmar. Während er, der Zyniker, in anderer Situation wohl auf die Kalorien zu sprechen gekommen wäre, zu denen sie dann auch kommen würde, sagte er entgegen seinem sonstigen Tonfall: »Was ein Glück, daß es Sie gibt! Und daß Lea Sie hat.«
Kapitel 3
Die Beerdigung war an einem Freitag, dem 13. Joachim hätte bestimmt gesagt: »So was kann auch nur dir passieren.« Zwar für zehn Uhr vorgesehen, waren schon kurz nach neun gut zwei Dutzend Menschen vor der Friedhofskapelle versammelt. Lea kam mit Absicht sehr spät. Es war ein bitterkalter Januarmorgen, und die Trauergäste saßen bereits, und wer keinen Sitzplatz mehr bekam, stand mit scharrenden Füßen auf dem kalten Terrazzo-Boden der Trauerhalle. Erst als das asthmatische Harmonium »So nimm denn meine Hände« zu spielen anfing, kam Lea hocherhobenen Hauptes, das Gesicht weiß und unbewegt, den Mittelgang entlang. Ohne nach rechts oder links zu blicken, setzte sie sich in die vorderste Reihe, neben Joachims Bruder, dessen Frau und Töchter sowie seiner Mutter, die die Reihe rechts außen abschloß, auf den äußersten linken Stuhl, fast unmittelbar vor den Sarg. Danach teilte sich nochmals die Menschenmenge, um dem Priester, dem Diakon sowie zwei Ministranten Platz zu machen. Die vier verbeugten sich vor dem Sarg, beweihräucherten ihn und drehten sich anschließend der Gemeinde zu, und dann geschah das, was Michael später als den Augenblick bezeichnete, der sein gesamtes Leben verändert habe. Er sah Lea.
Zunächst sah er nur ihre Augen. Diese unbeschreibliche Farbe von innen leuchtenden grünen Steinen, vielleicht Smaragden, aber er hatte noch nie angestrahlte Smaragde gesehen. Lea hatte ihre Augen ziemlich stark geschminkt, teils um die Spuren der durchweinten Nacht zu beseitigen; in erster Linie allerdings, weil sie wußte, wie sehr Joachim es liebte, wenn sie die Augen anmalte, wie er das nannte. Und heute hatte sie es nur für ihn gemacht. Die schwungvoll gebogenen Brauen, eigentlich kräftiger als zur Zeit Mode war, dann diese unvergleichliche Nase – gleichbleibend breit von der Nasenwurzel bis zur Spitze, die sich tiefer biegt als die Nasenflügel –, darunter ein Mund, der im herkömmlichen Sinne vielleicht nicht unbedingt schön, auf Michael allerdings ungeheuer erotisch wirkte. So wie das ganze Gesicht und ihre ganze Gestalt eine vollkommene Synthese fleischgewordener Sinnlichkeit, ja Vollkommenheit darstellten. An genau berechneten Stellen schienen Fältchen zu sitzen, die der Mimik ihres Gesichtes eine große Tiefe gaben und das Trauern dramatischer, das Lachen übermütiger und die Leidenschaft intensiver machten.
Michael war wie verzaubert. Man sah ihm seine vielen kleinen Fehler, Patzer und Unaufmerksamkeiten, die ihm von jetzt an passierten, wegen der kurzen Zeit, die er als Diakon tätig war, nach. Das einzige, was es ihm offenbar nicht verschlagen hatte, war seine Stimme: Er hatte einen ausgebildeten Bariton, dessen Fülle und Reinheit ursprünglich der Grund zum Musikstudium gewesen waren. Daß er dann über die Kirchenmusik zur Theologie kam, ist eine andere Geschichte. Jedenfalls sang er auf dieser Beerdigung wie ein »junger Gott«, wie anschließend viele meinten. Selbst Lea fiel das durch die Glocke, die sie sich durch die vielen Beruhigungsmittel übergestülpt hatte, auf, und sie überlegte, wer wohl diesen Opernsänger bestellt haben könnte, wo allgemein bekannt war, für wie geschmacklos sie so was auf Beisetzungen hielt. Allerdings beeindruckten sie die Festigkeit und Stärke der Stimme, und als sie bemerkte, daß sie dem jungen Diakon gehörte, war sie so etwas wie beruhigt.
Das schier endlose Kondolieren am Grab ging schließlich doch über ihre Kräfte. Nach einer Stunde in dieser Eiseskälte erlitt sie einen Kollaps, und ihr Schwager wollte sie nach Hause fahren. Sie protestierte heftig; erstens ginge es ihr schon wieder viel besser, und zweitens wolle sie unbedingt am anschließenden Seelenamt teilnehmen, das für Joachim in der Gemeindekirche gehalten würde. Er gab nur zögernd nach, aber als sie auf dem Parkplatz aus dem Auto stieg, wurden ihr erneut die Knie weich, und hätte der junge Diakon nicht in dem Moment das Pfarrhaus verlassen, um in die Kirche zu gehen … Zusammen mit Leas Schwager stützten sie sie bis zur Sakristei und setzten sie dort vorsichtig auf eine Bank. Ihr Kreislauf spielte verrückt, und der kalte Schweiß war ihr ausgebrochen. Sie öffnete ihren Nerzmantel und murmelte mit blutleeren Lippen: »In meiner Handtasche, die Flasche, zwanzig Tropfen.« Nun gab es in der Sakristei weit und breit keinen Löffel, und so tröpfelte der Diakon in den leicht geöffneten Mund ihres weit zurückgelegten Kopfes die Medizin. Für ihn war die Situation so erregend wie verwirrend, wie er den Oberkörper einer jungen, schönen Frau auf sich fühlte, die mit hochgerutschtem Rock und schweißnasser Seidenbluse, die sich an zwei große, runde Brüste klebte, ihren Kopf in seine Armbeuge legte und die Augen schloß. Doch dann ging plötzlich ein Ruck durch ihren Körper, sie stand rasch auf, strich ihren Rock glatt, schloß den Mantel, brachte mit zehn Fingern und einer kräftigen Schüttelbewegung ihre Frisur in Ordnung und verschloß ihr Gesicht zu dem, was es den ganzen Vormittag gewesen war: eine starre Maske.
Michael kannte ganz wenige Menschen, die eine solch strenge Disziplin hatten; denn so, wie sie jetzt mit leicht staksigen, aber selbstbewußten Schritten die Kirche betrat, hätte niemand vermutet, wie es ihr vor wenigen Minuten – und vielleicht jetzt noch – ergangen war. Michael sah sie auf die ersten Bankreihen zuwanken und glaubte, sie jeden Augenblick hinstürzen zu sehen, dachte aber auch merkwürdigerweise im selben Moment, schönere Beine noch nie gesehen zu haben. Er war verwirrt und schuldbewußt zugleich, und diese Zwiespältigkeit seiner Gefühle sollte sich in den kommenden Wochen und Monaten noch verstärken.
Kapitel 4
Am Donnerstag, dem 2. Februar, einem katholischen Feiertag, der sich »Maria Lichtmeß« nennt, wurden die Zwillinge neun Jahre alt. Lea wollte ursprünglich mit den Kindern ein buntes, fröhliches Fest feiern, aber dazu hatte keiner mehr so rechte Lust. Jedes der Kinder hatte den Tod des Vaters verschieden aufgenommen; Andreas, der verschlossene, fast introvertierte Typ, trug seinen Schmerz in sich. Für den vier Minuten jüngeren Simon war der Verlust ebenso schlimm, aber für Lea greifbarer: Er schrie seinen Schmerz hinaus, schlug wie wild um sich und tobte, trampelte gegen Tür und Wände – und dann war es vorüber. Zumindest äußerlich. Inzwischen gingen beide wieder in die Schule, und jeder kompensierte auf seine Art die Trauer: Andreas wurde noch ruhiger, während Simon, der lebhaftere, fast aggressiv geworden war. So hielten sie es beispielsweise auch mit der Musik. Andreas konnte sich stundenlang mit Übungen auf seinem Cello beschäftigen, dafür drehte Simon die Stereoanlage mit einem herzschlagrhythmusähnlichen Hard Rock auf, daß Lea manchmal glaubte, ihr fielen die Ohren ab.
So war es auch an der Geburtstagsfeier; beide Jungen wußten, was sie nicht wollten: ein Kinderfest. Andreas war für Hausmusik, Simon auch. Nur verstand jeder etwas total anderes darunter. Andreas wollte, von Lea am Klavier begleitet, ein bißchen Vivaldi, vielleicht auch »was Leichtes« von Bach spielen, während in Simons Zimmer eine E-Gitarre durch den Verstärker gejagt wurde.
Schließlich einigte man sich auf einen Kompromiß. Einmal wöchentlich kamen vier Kinder nachmittags zu Lea, die sie zusammen mit ihren Zwillingen auf ihre Erstkommunion vorbereitete. Seit Jahren war es in der Gemeinde, in der sie lebten, üblich, daß den Kindern von ein paar engagierten, dafür angeleiteten Müttern die Bedeutung des Sakramentes nahegebracht wurde, und Lea wollte das auch nach dem Tode Joachims weitermachen. Bis Ende April erzählte, sang und bastelte sie mit den Kindern, und sie war um diese Ablenkung nicht unglücklich. So auch am Geburtstag ihrer Kinder, der zufällig auf einen dieser Gruppennachmittage fiel und mit dem Auspacken kleiner Geschenke, einem Quiz-Spiel und Musizieren ausgefüllt war.
Gegen Abend gingen sie alle mit ihren Tauf- und Kommunionkerzen dem Brauch entsprechend zur Kerzenweihe. Als sie jedoch mit ihren brennenden Kerzen nach Hause gehen wollten, mußten sie enttäuscht feststellen, daß es zu regnen begonnen hatte. Während sie alle unschlüssig vor der Kirchentür stehenblieben, kam der Diakon dazu und erbot sich, sie heimzufahren. Dort angekommen, stellte sich heraus, daß er nicht unvorbereitet gekommen war: Für Andreas hatte er ein Buch aus dessen Lieblingsreihe »Erzählungen römischer Krieger«. Simon freute sich über eine Platte seiner Lieblingsgruppe, die Lea »je-lauter-je-lieber« nannte. Für Lea selbst holte er aus dem Kofferraum seines Wagens einen Arm voller gelber Narzissen, die üppig mit frischem Birkengrund zu einem dicken Strauß gebunden waren. »Aber wie komme ich denn dazu?« fragte sie ihn, und er erwiderte mit einem zauberhaften Lächeln: »Ich wollte Ihnen einfach eine kleine Freude machen.« – »Also, die ist nicht klein, die ist riesig. Dafür müssen Sie uns jetzt die Freude machen, mit uns Abendbrot zu essen! So wie ich meine Freundin Dagmar kenne, steht eine ihrer berühmten hausgemachten Pasteten im Backofen.«
Während sie außerdem noch geputzten Salat nebst angemachter Tunke im Kühlschrank vorfand, bat sie Michael, sich um die Getränke zu kümmern, und die Kinder, den Tisch zu decken. »Dazu gehört eigentlich ein trockener Weißwein«, sagte Michael, und weil Lea ihm ins Wort fiel, sagten sie beide wie aus einem Mund: »Aber ich trinke lieber Rotwein.« Während sie darüber lachte, schaute er sie nachdenklich und eine Spur zu lange an. Sie hätte ihn gerne gefragt, was los ist, hätten die Zwillinge nicht laut »Hunger!« geschrien.
Für Michael war es »Seelenmassage«, daß er mit Lea zusammen war. Das außergewöhnliche Haus mit seiner ganz eigenen, fast als intim zu bezeichnenden Atmosphäre, die größtenteils auf Lea zurückzuführen war: der zweigeschossige Wohnraum, in der Mitte offen, und wohin man sehen konnte, sah man als sichtbares Baumaterial nur Holz, viel helles Holz. Von oben, von einer ebenfalls hölzernen Galerie herunter, konnte man das geschickt aufgeteilte Wohnzimmer gut überblicken, und hier oben stand man in einer großen, lichtdurchfluteten Halle, in der musiziert wurde, und von hier oben ging es auch in die Kinderzimmer und deren Bad, Leas Schlafzimmer lag unter der Dachschräge des Vorderhauses und war durch einen separaten Treppenturm, der von außen wie ein der Länge nach halbierter Zylinder mit einer schräg abgeschnittenen Spitze aussah, zu erreichen.
Als Michael zum ersten Mal das Haus betrat, konnte er seine Überwältigung kaum verbergen. Lea, der das nicht fremd war, ließ ihn ungestört umhergehen und war amüsiert und erstaunt zugleich, als er, wie ein beschenktes Kind unterm Weihnachtsbaum, das nicht weiß, womit es zuerst spielen soll, herumging, Bilder betrachtete, Sessel ausprobierte und bei vielen ihrer Bücher in dem sich über beide Geschosse ausdehnenden Regal immer wieder rief: »Das hab ich auch!« oder: »Leihen Sie mir das mal aus?« Sie dachte, daß es gut sei, einen Menschen in ihrer Nähe zu wissen, mit dem sie sich über Literatur unterhalten konnte, zumal offenbar die gleichen Bücher dieselben Reaktionen bei beiden hervorriefen. Offenbar war er in kunstgeschichtlicher Hinsicht ebenso belesen; jedenfalls konnte er die beiden alten Stiche, die sie besaß, historisch einordnen und die Putte aus der Ettaler Gegend und die Ikone aus dem zaristischen Rußland machten ihm ebenfalls keine Probleme. Nur mit den »Neuen Wilden« und der modernen Grafik, die Lea seit ein paar Jahren sammelte, hatte er Schwierigkeiten, wollte aber alles davon wissen, und sie versprach, ihm einen Ausstellungskatalog zu besorgen. Bei längerem Hinsehen stellte sich heraus, daß er mehr analytischen Verstand besaß und mehr aus den Bildern herauslesen konnte als sie, die »aus dem Bauch heraus« entschied, wie sie das ausdrückte.
Nie zuvor hatte er sich in einem Haus auf Anhieb so wohl gefühlt wie hier. Sie saßen in einer großen Küche, die drei Treppenstufen höher als der übrige Raum lag und deren Stirnwand fast ganz aus holzgerahmtem Glas bestand. Der Boden war mit matten, lehmroten Ziegeln belegt und hatte an den Wänden, wie im ganzen übrigen Haus, weißes Sichtmauerwerk. Die Einrichtung bestand aus überwiegend alten Stücken, so auch der etwa drei Meter lange Gesindetisch, an dem sie jetzt saßen.
Daran standen etwa zehn Stühle, von denen keiner dem anderen glich, die einzige Gemeinsamkeit bestand darin, daß sie aus der gleichen Zeit stammten und alle ein Sitzkissen mit demselben Leinenbezug hatten. Etwas außerhalb der Mitte, aber noch freihstehend war ein Kochblock, der Michael unwillkürlich an die Feuerstelle in einer Höhle erinnerte, um die sich die Bewohner scharten. Von der rustikalen Balkendecke hingen unzählig viele Trockensträuße, teils Blumen, teils Kräuter; sogar einen Schinken und ein Bündel Mailänder Salami konnte er entdecken. Die Kücheneinrichtung war im Gegensatz zu den übrigen Möbeln sehr modern; es fehlten weder Glaskeramik-Kochplatten noch Mikrowellengerät oder Tiefkühlschrank, wogegen wiederum der alte Weichholzschrank, übervoll mit altem Keramikgeschirr aus der Provence, sowie von der Decke baumelnde Kupferpfannen und Kasserollen aus der Toskana einen totalen Gegensatz bildeten. Und trotzdem – war es das weiche Licht, das die beiden nesselbespannten Hängelampen über dem Tisch und die zum Teil aus unsichtbaren Strahlern angeleuchtete Decke abgaben, oder war es ganz einfach die Stimmung, die das alles zusammen ausmachte, er konnte es nicht beschreiben. Und da war es wieder: eine Lust, ein tolles Gefühl – und gleich darauf das schlechte Gewissen, ein Schuldbewußtsein, wobei er nicht wußte, weshalb.
Leas Stimme riß ihn aus seinen Gedanken, als sie ihn beim Tischabräumen fragte, ob er einen Kaffee mittrinke. Er sagte freudig zu, aber Andreas protestierte: Sie habe ihm versprochen, nach dem Essen noch ein wenig zu musizieren. »Ich weiß ja gar nicht, ob Herrn Bergmann unsere Musik gefällt, wir sind ja keine Profis«, versuchte sie auszuweichen, aber er widersprach, daß er, wenn überhaupt, bestenfalls im pastoralen Fach ein Profi sei, und das auch noch nicht. »Aber Sie haben doch gesungen!« Sie vermied das Wort »Beerdigung« auszusprechen, aber er wußte auch so, welchen Anlaß sie meinte. Er erzählte ihr seinen Werdegang bis jetzt: Als Einzelkind aufgewachsen, hatte er früh begonnen, verschiedene Instrumente zu spielen, nahm neben der Schule Gesangunterricht und begann nach dem Abitur mit dem Musikstudium. Er war in einem kleinen Dorf in einer erzkatholischen Gegend aufgewachsen; als Meßdiener, Pfadfinder der Katholischen Jugend und Kirchenchor-Mitglied. In seiner Welt existierte nicht das, was in der Großstadt, in der er nun studierte, als normal galt. Als suchte er sich seine Werte selbst; so hatte er mal in einer Männerschola mitgesungen, die Orgel gespielt und eine Missa brevis einstudiert – und schon war er mittendrin in der Kirchenmusik. Nicht, daß ihm das nicht gefallen hätte; schließlich kann man damit auch ganz gut Karriere machen, und zunächst strebte er das Amt des Bezirkskirchenmusikers an und machte den dafür erforderlichen »C-Schein«. Aber irgendwie war er dann tiefer in die Sache reingerutscht, als er zunächst gewollt hatte, engagierte sich mit viel Vehemenz für sogenannte folklorale Gottesdienste, für neue pastorale Musik generell, und so blieb es nicht aus, daß dies weder dem zuständigen Dekan noch dem Erzbischof verborgen blieb.
Nach vielen, langen und ernstgeführten Gesprächen begann er dann mit dem Theologiestudium, allerdings immer noch mit dem Hintertürchen des Pastoralassistenten, oder sollte er gar nicht mehr weitermachen, immer noch in die philosophische Fakultät umsteigen zu können.
Von Semester zu Semester sei ihm der nun eingeschlagene Weg als der richtige vorgekommen. Freunde, Bekannte und am meisten seine Eltern reagierten von verständnislos bis entsetzt. Sein Vater hielt ihm reinen Opportunismus vor, wobei ihn der Sohn daran erinnerte, daß es bei ihm, dem Vater, vor zehn Jahren auch nichts anderes gewesen sein konnte, als er sich in diesem »schwarzen Nest« als einzigen SPD-Kandidaten aufstellen ließ und dabei nicht nur das Mandat, sondern auch die Wertschätzung der Dorfgemeinschaft und die Freundschaft des Pfarrers verlor.
»Daraus habe ich gelernt, und diese Erfahrung habe ich dir voraus. Verrenn dich nicht in etwas, was du unter anderen Umständen nicht auf dich genommen hättest«, sagte damals sein Vater.
Kapitel 5
Man einigte sich auf was »Leichtes« von Bach, das Lea am Klavier begleitete. Michael war tief beeindruckt von der hohen Musikalität Andreas’, mehr noch beobachtete er Lea, die voller Konzentration auf die Noten achtete. Nur Simon fehlte. In dem Augenblick, als Michael nach ihm fragen wollte, jaulte durch die geschlossene Tür seines Zimmers harter Beat, der binnen weniger Takte als eindeutiger Sieger gegen Bach hervorging. Wütend wollte Lea ins Kinderzimmer rauschen, als Michael sie aufhielt und wissen wollte, ob Simon ein Instrument spiele. »Über Blockflöte ist er nie hinausgekommen, was weniger auf einen Mangel an Begabung als an Geduld zurückzuführen ist«, antwortete sie. Mit ein paar Notenblättern in der Hand ging er in Simons Zimmer und kam kurze Zeit später mit ihm und einer Flöte in der Hand zurück. »Paß auf, Simon«, sagte er, »hier habe ich ein paar Lieder gefunden, die deine Mutter und dein Bruder nicht besonders gut können. Ich möchte sie aber singen und brauche jemand, der mich begleitet. Wollen wir zwei den beiden anderen helfen?« Simon blieb kaum Zeit, seinen Stolz in Überheblichkeit umzuwandeln, wie das seine Art war, räusperte sich und sagte: »Klar!« Nach einigen Übungstakten spielten sie dann, und Michael sang: »Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder«, das Schumann-Lied von der Forelle und zum Schluß »Der Mond ist aufgegangen«. Michael sang vom letzten Lied alle Strophen, und als er mit »… und unsern kranken Nachbarn auch« endete, saßen alle noch sekundenlang und starrten gedankenverloren vor sich hin. Simon war der erste, der die Sprache wiederfand und sagte: »Das war unheimlich toll.« Lea hatte den richtigen Blick für die Situation und rief: »So jetzt ist es Zeit fürs Bett. Morgen früh müßt ihr wieder in die Schule.« Widerspruchslos trotteten sie ins Bad, und Lea wollte endlich den Kaffee trinken, der seit einer halben Stunde in der Maschine auf sie wartete. »Die sind noch ganz benommen«, sagte sie, als sie den Kindern gute Nacht gesagt hatte und Michael Kaffee eingoß. »Ich auch«, sagte er und hatte sofort wieder Schuldgefühle. Lea spürte seine Anspannung im Gesicht, in seiner Körperhaltung und fragte ihn, ob das jetzt schlimm sei oder gegen irgendwelche Regeln verstoße, wenn er hier mit ihr sitze und Kaffee trinke. »Nein, natürlich nicht. Erstens wollte ich Sie nach dem Tod Ihres Mannes eh besuchen, zweitens haben die Zwillinge heute Geburtstag, und drittens hatte es ja geregnet.« – »Das ist ja eine ganze Latte von Gründen!« lachte sie. »Wenn Sie pro Anlaß einmal kämen, hätten wir mehr davon.« Michael wurde brennend rot im Gesicht, und jetzt war es Lea, die Schuldgefühle bekam.
»Verzeihen Sie«, sagte sie und trank ihren Kaffee aus. »Da gibt es nichts zu verzeihen. Ich habe noch genügend Anlässe, Sie zu besuchen: Die Kommuniongruppen sollen nacheinander aufgesucht werden, am Tag nach dem Weißen Sonntag soll ich einen Ausflug mit den Kindern machen und noch ein, zwei Helfer als Begleitpersonen mitnehmen. Da muß ich Sie zu Hause aufsuchen, wenn ich Sie fragen soll, ob Sie mitfahren, und außerdem haben Sie im Mai Geburtstag, am 15., wenn ich nicht irre. Sie sehen, so schnell gehen mir die Gründe nicht aus!« Lea wußte nicht so recht, was sie drauf erwidern sollte. Sie sah ihn lange an und bemerkte, daß sie ihn eigentlich noch nie bewußt angeschaut hatte: die schwarzen Haare, die er, wenn er verlegen oder unsicher war, mit gespreizten Fingern von vorn nach hinten durchfuhr, und den ebenso schwarzen Vollbart, der ihm in wenigen Tagen den Spitznamen »Rasputin« in der Gemeinde eingebracht hatte; und dann diese Augen: Erst jetzt bemerkte sie, daß sein rechtes Auge braun und das linke grau war, was seinem Gesicht eine gewisse Asymmetrie gab, die durch gelegentliches Schräghalten des Kopfes noch unterstrichen wurde. Jetzt auch fiel ihr das kleine Stück behaarte Brust auf, das oberhalb des letzten Hemdknopfes wie schwarze Wolle hervorquoll, und sie mußte unwillkürlich an Joachim denken. Irgendwann, als sie erschöpft nebeneinander auf dem Bett lagen und Lea gedankenverloren mit seinen Brusthaaren Zöpfchen drehte, fragte er sie, was sie am besten an ihm fände, und sie antwortete ganz spontan: »Deine Haare auf der Brust!«
Entweder hatte er so Ähnliches gedacht oder ihre Gedanken erraten, als er plötzlich unvermittelt fragte: »Haben Sie ein Foto von Ihrem Mann?« Als habe sie seine Frage nicht richtig verstanden, sah sie ihn gedankenverloren an, nickte schließlich und stand auf. »Oben auf dem Klavier«, sagte sie und ging die Treppen zur Galerie hinauf. Von hinten sah sie mit ihren enganliegenden Jeans und der weiten Strickjacke, auf deren Rücken eine ganze Landschaft, Wege, Zaun, Haus und Bäume eingestickt waren, wie ein junges Mädchen aus. Als sie die Treppe mit einem silbernen Rahmen in der Hand herunterkam, konnte er keinen Blick von dem bei jeder Stufe, die sie heruntersprang, sich bewegenden Busen wenden. Da war wieder diese bisher unbekannte Erregung wie damals in der Sakristei, und dieses Mal war sie fast stärker als seine Beherrschung; jedenfalls zitterten seine Hände, als sie ihm das Foto reichte.
Das Bild zeigte einen kräftigen Mann mit Halbglatze. Unter gutmütigen Augen eine recht große, fleischige Nase, das Lächeln – es hatte etwas, was man auf den ersten Blick nicht gleich einordnen konnte, da war etwas Lauerndes, um es nicht hinterhältig zu nennen, aber nicht unbedingt unsympathisch. Er sah aus einem geöffneten Autofenster und mußte sehr groß gewesen sein. Michael fragte Lea danach. »Zwei Meter, zwei Zentner, das sagte er auch immer, wenn jemand auf seine Statur zu sprechen kam.« – »Erzählen Sie mir von ihm«, bat Michael.
Kapitel 6
M