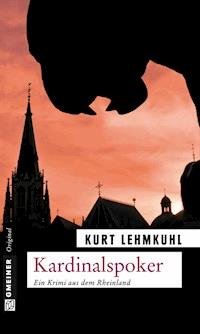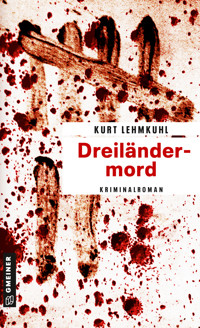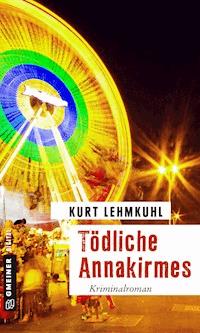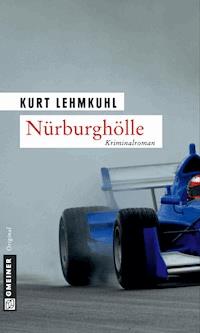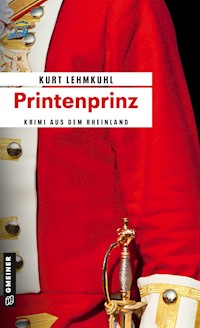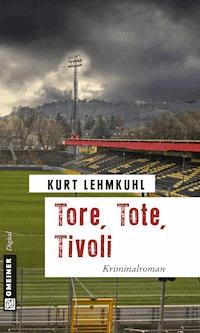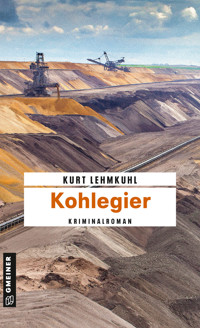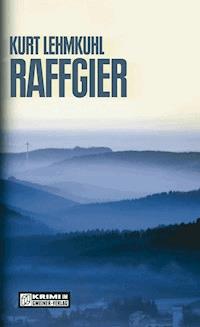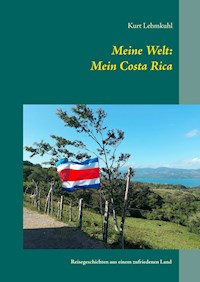Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Böhnke und Rechtsanwalt Grundler
- Sprache: Deutsch
Der Arzt Dr. Gottfried Weiß hat vor 30 Jahren Lieselotte Kleinereich, der Lebensgefährtin des pensionierten Kommissars Rudolf-Günther Böhnke, das Leben gerettet. Böhnke gab ihm aus Dankbarkeit das Versprechen, jederzeit für ihn da zu sein. Jetzt fordert Weiß dieses Versprechen ein. Bei Operationen ist es zu Todesfällen gekommen, für die er sich vor Gericht verantworten soll. Böhnke soll seine Unschuld beweisen. Als er glaubt, den Fall gelöst zu haben, gibt es eine Wendung mit dramatischen Folgen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurt Lehmkuhl
Weißgott
Kriminalroman
Zum Buch
Tod auf dem OP-Tisch Vor rund 30 Jahren rettete der Arzt Dr. Gottfried Weiß der Lebensgefährtin des pensionierten Kommissars Rudolf-Günther Böhnke das Leben. Böhnke gab ihm aus Dankbarkeit das Versprechen, jederzeit für ihn da zu sein. Jetzt fordert der Arzt das Einlösen des Versprechens: Er hat eine marode Klinik gekauft, in der es bei Operationen vermehrt zu Todesfällen kam, für die ihm nun der Strafprozess gemacht wird. Böhnke gerät in eine Zwickmühle: Wegen des Versprechens sieht er sich gezwungen, Weiß’ Unschuld zu beweisen. Allerdings soll er für seinen Freund, den Rechtsanwalt Tobias Grundler, Beweise für Weiß’ Schuld finden. Grundler vertritt die Familie eines Verstorbenen als Nebenkläger im Strafprozess. Böhnkes Recherche in der Klinik führt zu erstaunlichen Ergebnissen. Als Böhnke schon glaubt, den Fall gelöst zu haben, nimmt dieser eine verblüffende Wendung mit dramatischen Folgen …
Kurt Lehmkuhl, 1952 in der Nähe von Aachen an einem Sonntag geboren, war mehr als 30 Jahren als Redakteur im Zeitungsverlag Aachen tätig. Durch die Beschäftigung mit dem Strafrecht im Rahmen des Jurastudiums in Bonn hat er schon früh damit angefangen, Kriminalromane zu schreiben, zunächst nur gedacht als Geschenke für Freunde. Zur ersten Veröffentlichung kam es 1996, als er von einem Verlag darauf angesprochen wurde.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Mörderisches Aachen(2017)
Kofferjäger, E-Book only (2016)
Mallorquinische Träume,
E-Book only (2016)
Tödliches Roulette, E-Book only (2016)
Vertrauen bis in den Tod,
E-Book only (2016)
Spritzen für die Ewigkeit,
E-Book only (2016)
Aachener Grenzgänger,
E-Book only (2016)
Die Aachen-Mallorca-Connection, E-Book only (2016)
Ein CHIO ohne Rasputin,
E-Book only (2016)
Tödliche Annakirmes,
E-Book only (2016)
Tödliche Recherche, E-Book only (2016)
Kohlegier (2016)
Fundsachen (2015)
Blut klebt am Karlspreis,
E-Book only (2015)
Ein Sarg für Lennet Kann,
E-Book only (2015)
Mörderische Kaiser-Route, E-Book only (2015)
Tore, Tote, Tivoli, E-Book only (2014)
Printenprinz (2013)
Begraben in Garzweiler II,
E-Book only (2013)
Kardinalspoker (2012)
Dreiländermord (2010)
Nürburghölle (2009)
Raffgier (2008)
Impressum
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2017
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © xy / fotolia.com
ISBN 978-3-8392-5518-6
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
1. Kapitel
»Mach, dass du wegkommst!«, fauchte er den Kollegen an. Energisch stieß er ihn zur Seite. Der Mundschutz hatte der Schärfe und der Lautstärke seiner Anordnung nur wenig Wucht genommen. »Du bringst sie um.«
Niemand außer ihm hatte den Fehler bemerkt, der zur tödlichen Katastrophe werden konnte. Die Umstehenden hatten nur die Wirkung, aber nicht die Ursache des fatalen Fehlschnitts erkennen können, als das Blut in einem gewaltigen Schwall aus der Bauchhöhle quoll.
Konzentriert beugte er sich über die Frau auf dem Operationstisch und gab knappe, präzise Anweisungen. Es schien ihm zu lange, bis endlich der Blutfluss versiegte.
»Das war knapp.« Er pustete erleichtert durch, während er beobachtete, wie eine OP-Schwester die Bluttransfusion mit einem weiteren Beutel fortsetzte. Der Blick auf die unbestechlichen Kontrollmonitore und das angedeutete Kopfnicken eines Assistenten gaben ihm die Zuversicht, dass die Frau den Operationssaal lebend verlassen würde.
Souverän erledigte er die erforderlichen Arbeitsschritte. Er sah seinem Kollegen nach, der mit verkniffener Miene neben der Schleusentür gestanden hatte und nun geradezu fluchtartig den Raum verließ.
Wie erwartet, fand er ihn im Arztzimmer. Am Schreibtisch sitzend, gedankenversunken in der Kaffeetasse rührend, die Zigarette im Aschenbecher abstreifend. Es war nicht der erste Lungentorpedo, wie er an den zahlreichen Kippen erkannte.
»Schwein gehabt«, sagte er. »Da wäre deine Karriere bald schon wieder vorbei gewesen, bevor sie richtig begonnen hat. Ein Exitus während einer OP macht sich nicht gut in den Bewerbungsunterlagen.« Vor allem dann nicht, wenn es sich um einen Eingriff handelt, den selbst sie als Anfänger problemlos vornehmen konnten. Es durfte einfach nicht passieren, dass der Schnitt mit dem Skalpell falsch angesetzt wurde, mit beinahe tödlichen Folgen für die Patientin. »Du hast echt Scheiße gebaut. Der OP sieht aus wie bei einem Metzger, dem das angestochene Schwein von der Schlachtbank gehüpft ist.«
Die Operation würde sicherlich bei der nächsten Besprechung im Kollegium thematisiert werden. Der Vorfall ließ sich nicht verschweigen, zumal durch die Bluttransfusionen und seine Rettungsaktion Mehrkosten angefallen waren, die die Fallpauschale bei Weitem überstiegen. Da würden Erklärungen verlangt und Verantwortliche gesucht werden. Aber müsste man dann von einem missratenen Eingriff sprechen?
»Ich weiß, ich habe Scheiße gebaut.« Der Kollege, der auch sein Freund war, gab sein Versagen unumwunden zu. »Du hast mir den Arsch gerettet. Ohne dich …«, er beendete den Satz nicht. Beide wussten, was gemeint war.
Gemeinsam formulierten sie einen zweiten Bericht über den medizinischen Eingriff. Den ersten Bericht, den sein Freund schon geschrieben hatte, wollte er nicht unterzeichnen. Darin hatte dieser seinen Fehler zugegeben und ihn als Retter dargestellt.
Es war ein akuter Notfall gewesen, der ihnen am Sonntagnachmittag auf den Tisch gelegt worden war, so lautete die Version, auf die sie sich einigten. Der Notarzt hatte sich nur zu einer vagen Diagnose durchringen können. Er wollte wohl nicht verantwortlich gemacht werden, wenn er sich irrtümlich auf eine Ursache festgelegt hatte, die sich während des Eingriffs dann als falsch erwiesen hätte. Ihre Vermutung, es handele sich um einen Blinddarmdurchbruch, hatte sich während der Operation als zutreffend erwiesen. Insofern hatten sie alles richtig gemacht und wahrscheinlich auch das Leben der Patientin gerettet.
Wenn da nicht der fatale Schnitt gewesen wäre, der der Frau doch noch beinahe das Leben gekostet hätte.
Die beiden Freunde brauchten lange, bis sie die Formulierung gefunden hatten, die den Fehler verschwieg und die zugleich die zusätzlichen Maßnahmen rechtfertigte. Sie waren sich schließlich einig geworden, den Wechsel in der OP-Führung unter den Tisch fallen zu lassen. Der hätte nur zu den unangenehmen Nachfragen geführt, die sie vermeiden wollten. So würde das Versagen des Kollegen nicht auffallen und in Vergessenheit geraten.
Er hatte kein Problem mit dieser Verfälschung der Tatsachen, die für das Ergebnis der Operation keine Auswirkung hatte und die den Freund vor Schwierigkeiten bewahrten. Sie handelten so, wie sie es schon zu Studienzeiten immer gemacht hatten: Der eine war für den anderen da. So war es und so würde es immer sein, wenn sie planmäßig in ein paar Jahren ihre Gemeinschaftspraxis eröffneten.
Die Frau, der sie im Prinzip das Leben gerettet hatten, würde es ihnen nicht nachtragen, wenn sie von den Komplikationen erfahren sollte. Oder sollten sie sie über die Dramatik der OP überhaupt aufklären? Wäre es nicht besser, darüber gänzlich zu schweigen?
Er fühlte sich zu müde, um sich über die Fragen Gedanken zu machen. Gähnend legte er die Patientenakte auf den Stapel.
Er war sich absolut sicher: Lieselotte Kleinereich aus Aachen würde das Krankenhaus auf eigenen Beinen verlassen.
2. Kapitel
Die Entscheidung fiel denkbar knapp aus. Mit acht gegen sieben Stimmen beschloss der Stadtrat beim letzten Tagesordnungspunkt seiner nicht öffentlichen Sitzung den Verkauf der Städtischen Krankenhaus GmbH St. Raphael. Schlussendlich hatte das Votum des Bürgermeisters den Ausschlag gegeben.
Nicht nur in der Diskussion vor der Abstimmung war es turbulent zugegangen. Schon in den letzten Wochen und Monaten war der von der Stadt angestrebte Verkauf der Klinik das beherrschende Thema auf den Straßen, in den Familien und bei Veranstaltungen von Parteien, Kirchen und Verbänden gewesen. Die hitzige Auseinandersetzung würde in den nächsten Tagen weitergehen, auch wenn der Beschluss unveränderbar war: Das Krankenhaus St. Raphael würde aus dem Eigentum der Stadt in die Hände eines Privatmannes wechseln. In der mehr als 100-jährigen Geschichte des Hauses musste ein neues Kapitel aufgeschlagen werden. Ehemals von Nonnen gegründet und danach von der Kirche betrieben, war das Krankenhaus Anfang der 50er-Jahre von der Stadt übernommen worden. Stets waren die Inhaberwechsel zum Wohle des Hauses und der Einwohner gewesen. Jedes Mal hatte es umfangreiche Erneuerungen am Gebäude und der Einrichtung gegeben.
Und jetzt? Was hatten die Bürger nach dem Verkauf zu erwarten? Würde das St. Raphael als ihr Krankenhaus erhalten bleiben? Würde es geschlossen und zu einem Seniorenwohnheim mit Altenpflegestätte werden? Oder würde der neue Eigentümer daraus eine Privatklinik machen, in der er Scheichs und andere Neureiche behandelte, wie auf den Straßen gemunkelt wurde?
»Es ging nicht anders«, raunte der Bürgermeister seinem Beigeordneten zu, während er seine Unterlagen zusammenräumte. Er hatte die Sitzung beendet und die Ratsmitglieder zum Aufbruch gebeten. »Das weißt du auch.«
Wütende Buh-Rufe, gellende Pfiffe und ohrenbetäubende Trillerpfeifen empfingen die Teilnehmer der Versammlung, als sie die Tür zum Flur öffneten.
Dicht gedrängt hatten dort die Menschen ausgeharrt und auf die Abstimmung gewartet. Was sie von dem Ergebnis hielten, war unverkennbar. »Totengräber«, »Volksverräter«, schallte den Stadtverordneten und den Verwaltungsmitarbeitern entgegen. Das Votum hatte sich in Windeseile herumgesprochen und fand keine Zustimmung. Nur einige Politiker durften sich über anerkennende Schulterklopfer freuen; diejenigen, die vor wenigen Minuten gegen den Verkauf gestimmt hatten. Ob sie aus Überzeugung oder Opportunismus gehandelt hatten, das spielte für die erzürnte Menge keine Rolle. Sie waren die sieben Aufrechten, die acht anderen Schurken.
Der Bürgermeister hatte mit dem Verkauf des Krankenhauses das aus seiner Sicht Richtige getan. Die Stadt hätte die GmbH nicht mehr halten können. Die Insolvenz der hochverschuldeten Gesellschaft war nur noch eine Frage von Wochen und Monaten gewesen. Die Stadt als Eigentümerin hatte weder das Geld, um die aufgelaufenen Schulden zahlen zu können, noch besaß sie die Finanzmittel, um die unaufschiebbare Sanierung und Erweiterung der Klinik durchführen zu können. Mit seinen 100 Betten war das Krankenhaus im Wettbewerb der Kliniken einfach zu klein. Nur mit einer Chirurgie, einer Station für Innere Medizin, einer kleinen Abteilung für Urologie, die geschichtlich bedingt, aber im Prinzip überflüssig war, und einer Aufnahme für Unfallopfer und Notfälle war das Haus nicht zu halten, zumal es diese Disziplinen, ebenso wie andere, auch in der unmittelbaren Nachbarschaft der Großstadt gab. Beim geringsten Zweifel ließen sich die Kranken in eine Klinik in der Großstadt einweisen. Dort waren die Zimmer geräumiger, die Versorgung umfangreicher und, und das war das ausschlaggebende Argument, die medizinische Behandlung dank der modernsten Geräte und der Vielzahl der Spezialisten besser. In der ständigen landespolitischen Diskussion über den Abbau der Bettenberge in den Krankenhäusern war das St. Raphael immer wieder genannt worden, wenn über ein Streichkonzert nachgedacht wurde. Die letzten Signale aus der Kreisverwaltung und aus dem Landtag sprachen nicht dafür, dass dem St. Raphael noch viele Jahre blieben. Das Defizit wurde nicht geringer; schlimmer noch, das Raphael hatte durch die negativen Geschäftsergebnisse und die letzte Sanierung vor 15 Jahren maßgeblich dazu beigetragen, dass die Stadt mehr und mehr in eine finanzielle Schieflage geraten war. Die Stadt war nicht weniger pleite als ihre Krankenhaus GmbH. Und es war auch hier nur eine Frage der Zeit, bis man dem Bürgermeister und dem Stadtrat das Heft des Handelns aus der Hand nahm und der Kreis und das Land mittels eines Haushaltssicherungskonzeptes und eines Sparkommissars bestimmen würden, was vor Ort zu tun und zu lassen sei.
Die Schließung der Klinik schien unvermeidlich. Da war das Kaufangebot des Arztes wie ein Sonnenstrahl, der die dunkle Wolkendecke durchbrach. Es deutete zumindest eine Option für eine Zukunft des Hauses an.
Im Prinzip wussten es alle Beteiligten, die Geschäftsführung des Krankenhauses ebenso wie die Gesellschafter der GmbH, die Mitarbeiter ebenso wie die Ratsvertreter: Der Verkauf konnte eine Alternative zur Schließung sein. Vielleicht war so das Haus doch noch zu retten – in welcher Form auch immer.
»Da stimme ich dir vollkommen zu. Es ging nicht anders«, flüsterte der Beigeordnete, zugleich Geschäftsführer des Krankenhauses, dem Bürgermeister, zugleich Vorsitzender der Gesellschafter, zu. Über eine zweite Verkaufsoption hatte er den Rat nicht informiert. Eine Aktiengesellschaft, die ihre Geschäfte mit dem Betrieb von Kliniken und Sanatorien machte, hatte ihm in einer privaten Anfrage ihr Interesse signalisiert. Der Investor erwartete allerdings, von der Stadt Geld für eine Übernahme zu erhalten. Da waren die internen Verhandlungen schon im frühen Stadium abgebrochen worden, ohne dass die Politik überhaupt davon Wind bekommen hatte. Beide Parteien hatten Stillschweigen über diesen schon im Ansatz gescheiterten Annäherungsversuch vereinbart; was gab es auch zu sagen über etwas, das nicht infrage kam? Das hätte nur für unnötige Unruhe gesorgt. Nein, zum Verkauf an den Arzt gab es keine Alternative. Das wusste Bürgermeister Gerhard Kohl ebenso wie seine rechte Hand, der Beigeordnete Helmut Schröder, die im Rathaus wohlwollend »Kanzler-Zwillinge« oder despektierlich »Kanzler-Bande« genannt wurden.
Die beiden wurden gestoßen und geschubst, als sie sich einen Weg durch die schimpfende Menge bahnten. Mancher Wutbürger glaubte, seine Meinung mit Spucke betonen zu müssen. Die Lust auf einen Absacker in einer Kneipe, wie sonst nach einer Sitzung üblich, war ihnen vergangen. Sie wollten nur noch nach Hause nach dieser nervenden Auseinandersetzung in der Ratssitzung und den Pöbeleien danach.
Der Bürgermeister spürte sofort nach dem Anlassen seines Dienstwagens, dass etwas nicht stimmte. Was ihn beunruhigte, stellte er bei einem Rundgang um das Auto fest. Sämtliche vier Reifen waren zerstochen worden.
3. Kapitel
Seine beiden Verfolger gaben sich keinerlei Mühe, ihre Anwesenheit zu verbergen. Kaum hatte er das Haus verlassen, hatten sie sich an seine Fersen geheftet und beobachteten ihn auf Schritt und Tritt. Schnell hatten sie bemerkt, dass ihr Zielobjekt nicht von seiner alltäglichen Routine abwich. Der Beobachtete hatte einen Weg talwärts eingeschlagen, der nur zu einem Ziel führen konnte, nämlich zur Ansiedlung auf der anderen Seite, die nur über die kleine Serpentinenstraße zu erreichen war. Gelegentlich schlugen sich die Verfolger in die Büsche, um an anderer Stelle wieder in sein Blickfeld zu geraten.
Die eignen sich überhaupt nicht für eine Observation verdächtiger Personen, schmunzelte der pensionierte Kriminalhauptkommissar. Er sah keine Veranlassung, seine beiden Verfolger über ihr stümperhaftes Verhalten aufzuklären. Es hätte auch keinen Zweck gehabt.
Die beiden jungen Bernhardiner Helma und Selma hatten vor seinem Haus darauf gewartet, den Ruheständler bei seinem regelmäßigen Spaziergang zu begleiten. Heute stand der Einkaufsgang nach Simmerath auf dem Programm. Von Huppenbroich durchs Tiefenbachtal in den zentralen Ort der Gemeinde führte sein Weg, immer aufmerksam beobachtet von den tierischen Begleitern. Helma und Selma, die auf einem Bauernhof eine ursprünglich nur vorübergehende Bleibe gefunden hatten, waren ihm ans Herz gewachsen. Sie streunten oft durch das kleine Dorf in der Nordeifel, kannten wohl mittlerweile jeden der rund 400 Einwohner und hatten wahrscheinlich jede der zigtausend Buchen beschnüffelt, die im Dorf und in den Wäldern rundherum wuchsen. Von Leinenzwang oder gar Maulkorb war keine Rede.
Helma und Selma gehörten inzwischen zu Huppenbroich wie Rudolf-Günther Böhnke. Der ehemalige Leiter der Abteilung für Tötungsdelikte im Polizeipräsidium Aachen hatte nach dem krankheitsbedingten Ausscheiden aus dem Dienst seinen Wohnsitz in diesen Ort verlegt. Hier fand er die Ruhe und die Natur, die er in der Kaiserstadt erst nach langer Suche finden konnte, hier gab es mit dem Rursee in der Nähe das Wasser, auf das er im Aachener Talkessel verzichten musste, hier konnte er unbeschwert und unbesorgt durch die Wiesen und Felder streifen, ohne von Straßenlärm oder abgashaltiger Luft gestört zu werden.
Lediglich seine Hoffnung, in dieser Abgeschiedenheit nicht mehr an seinen Beruf erinnert zu werden und von Verbrechen verschont zu bleiben, die hatte sich nicht erfüllt. Wahrscheinlich würde sich daran auch nichts ändern, bis er einmal das Zeitliche gesegnet hatte. Das konnte schnell und jederzeit passieren. Seine Krankheit, für die es weder eine richtige Therapie noch passende Medikamente gab, konnte sein Dasein abrupt beenden. Mit diesem Wissen lebte er schon seit einigen Jahren; mehr zur Verwunderung der Ärzte als zu seiner eigenen. Für ihn war das Glas halb voll und nicht halb leer. So ging er das Leben an, und er würde sein Leben beenden, wenn er es für richtig hielt. Den Zeitpunkt seines Todes wollte er selbst bestimmen und damit der Krankheit ein Schnippchen schlagen.
So hatte er es für sich beschlossen, aber niemandem gesagt, selbst seiner Liebsten Lieselotte nicht.
Helma und Selma stand der Sinn nach Stöckchenwerfen. Auffordernd liefen sie ihm mit kleinen Ästen in den Mäulern entgegen.
»Ihr seid ja saudoof«, sagte Böhnke fast liebevoll. Mit den Plastiktüten vom Einkauf in den Händen stapfte er auf der steilen Straße die Kurven hinauf. Er war ins Schwitzen geraten, hatte sich mal wieder viel zu warm angezogen für den goldenen Oktober. Eine Winterjacke war für einen Einkaufsbummel einfach zu dick, aber er hatte ja auf seine Lebensgefährtin nicht hören wollen, die ihm eine Jacke für den Übergang aufschwatzen wollte. Was sollte das? Es gab Frühling, Sommer, Herbst und Winter, und sie sprach von Übergang. Nein, so eine Jacke brauchte er nicht. Da schwitzte er lieber.
Dabei musste er sich im Prinzip an die eigene Nase packen, statt zu nörgeln. Er hätte ja eine Alternative für seinen Großeinkauf gehabt, sagte er sich, wenn er ein paar Tage gewartet hätte. Die Fahrt mit dem Auto nach Simmerath wäre bequemer gewesen als der kilometerlange Fußmarsch über Berg und Tal. Das Verstauen der Einkäufe im Kofferraum wäre bei Weitem nicht so beschwerlich gewesen wie das Schleppen der Tüten, bei dem immer die Gefahr des Reißens bestand und die Tragegriffe schmerzhaft in die Finger schnitten.
Aber er hatte sich gegen das Auto und für den Spaziergang entschieden. Nicht wegen Helma und Selma, über deren Begleitung er sich durchaus freute. Der Brief des Autohändlers aus Imgenbroich war der Anlass gewesen, den Wagen vor dem Haus stehen zu lassen. Darin war von einer Rückrufaktion die Rede. Der Airbag auf der Beifahrerseite könnte unter Umständen defekt sein. Es sei nicht mit absoluter Sicherheit auszuschließen, dass er sich aus Versehen ohne erkennbaren Anlass aufblase oder bei einem Unfall oder einem starken Aufprall nicht auslöse. Deshalb müsste er ausgetauscht werden.
Und das bei einem Polo, den Lieselotte erst vor ein paar Wochen gebraucht gekauft hatte!
Der Aufforderung, die Werkstatt aufzusuchen, war er im Auftrag seiner Lebensgefährtin sofort nachgekommen. Dort war aber nicht der Airbag ausgetauscht, sondern nur dessen elektronische Auslösung abgeschaltet worden. Man werde ihn informieren, sobald der Ersatz geliefert sei. Der Wagen könne in der Zwischenzeit unbedenklich genutzt werden, immerhin würden die Sicherheitsgurte eine große Sicherheit gewährleisten, und der Airbag sei eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, wurde ihm versichert.
Vielleicht war er zu vorsichtig, wenn er auf eine Autofahrt verzichtete. Da war seine Partnerin anders gestrickt. Sie hatte sich kurzerhand ihren Wagen geschnappt und war damit zur Arbeit gefahren, schlussendlich mit dem Argument, der Beifahrer sei bei einem Unfall betroffen, nicht aber sie, wenn sie hinter dem Lenkrad sitze.
Sie hatte ihn ausgelacht, als er zu bedenken gab, möglicherweise könnte sich der defekte Airbag ja auch ohne Grund auslösen oder sie hätte als Beifahrerin keinen Schutz bei einem Unfall. Ohnehin war sie leichtfertiger als er. Oft genug musste er sie ermahnen, sich anzuschnallen, wenn sie auf Tour gingen.
»Commissario, wir haben schon so viele gefährliche Situationen überlebt, da werde ich auch bei einer Autofahrt mit dir nicht sterben, selbst wenn ich für ein paar Tage auf einen Airbag verzichten muss«, sagte Lieselotte Kleinereich unbekümmert.
4. Kapitel
Zufrieden pfiff er vor sich hin. Eine Melodie, die eigentlich gar keine war, sondern eine zufällige Aufeinanderfolge von gepfiffenen Tönen. Aber ihn störte die fehlende Harmonie nicht, und Zuhörer hatte er nicht in der Garage. Rücklings lag er auf einem hölzernen Rollbrett unter dem aufgebockten Oldtimer, den er vor ein paar Wochen von einem Landwirt für einen lächerlichen Preis erworben hatte. In einer Scheune hatte der verrostete und verdreckte Käfer aus der ersten Nachkriegsserie von Volkswagen ein unbeachtetes Dasein in einer dunklen Ecke gefristet. Durch den Tipp seines Freundes, der die Frau des Landwirts medizinisch betreut hatte, war er auf die fahruntüchtige Rostlaube aufmerksam geworden. Die 50 Euro als Kaufpreis waren eher eine Entsorgungsgebühr gewesen als ein tatsächlicher Gegenwert für diesen Haufen Altmetall mit Stoffbeilage.
Aber er liebte das, was nicht nur seine Frau als Schrottberg bezeichnete. Er hatte immer schon den Käfer geliebt, der auch das Auto seines Vaters gewesen war, und er genoss es, dieses vergessene Vehikel aus den 50er-Jahren wieder fit für die Straße zu machen. Dieser Käfer würde das Dutzend in seiner Sammlung vollmachen.
Die frühe Liebe zum Käfer war auch der Grund gewesen, weshalb er nach dem qualifizierten Hauptschulabschluss nach der zehnten Klasse eine Lehre in der örtlichen Kfz-Werkstatt begonnen hatte. Eine Alternative zu einer Lehre besaß er eh nicht in der Abgeschiedenheit des Westerwalds. Gerne wäre er auf ein Gymnasium gewechselt, doch hatte es ihm der Vater strikt untersagt. Zu weit weg, zu teuer, nichts für einen Sohn aus einer Arbeiterfamilie. Das Übliche halt: Er sollte schnell Geld verdienen und damit auch der Familie helfen. Ein Moped mit 16, das war das Höchste der Gefühle, was ihm der Vater erlaubte. Er gehorchte und schwieg, bastelte mit wachsender Begeisterung in der Autowerkstatt an den Käfern herum und ging insgeheim doch seinen eigenen Weg, den ihm sein Vater vorenthalten hatte. In der Abendschule lernte er parallel zur Lehre fürs Abitur. Beides absolvierte er mit Bravour, die Ausbildung zum Kfz-Mechaniker ebenso wie die Reifeprüfung. Sein Vater war aufgebracht, nachdem er mit dem Gesellenbrief in der Hand verkündete, er würde das Dorf verlassen und nach Aachen ziehen, um dort Physik zu studieren.
Nach dem Fortzug hatte er kein Wort mehr mit den Eltern gewechselt, sich auch nicht mehr um einen Kontakt bemüht. Ihm war es egal, ob sie noch lebten oder schon gestorben waren. Er war stolz auf sich und seine Leistung. Er studierte und arbeitete zugleich bei einem VW-Händler. Ein Studienwechsel zu den Maschinenbauern hatte er nur kurz erwogen, er entschied sich dagegen. Er würde das Physikstudium durchziehen, in der Mindeststudienzeit und mit einem sehr guten Abschluss.
Nach einem vergnügten Abend mit vier Freunden in Monschau hatte ihr Fahrer bei schlechter Sicht und mit Alkohol im Blut die Kontrolle über ihren Kleinwagen verloren. Nachdem das Auto gegen einen Baum geprallt war, schleuderte es in den Straßengraben, in dem es auf dem Dach liegen blieb. Ihm gelang es, aus dem Wrack zu klettern, bevor es in Flammen aufging. Neben sich liegend fand er seine Freundin, stark blutend, schwer atmend. Er war hilflos, wusste nichts zu tun, und musste mit ansehen, wie sie starb. Sein Entschluss stand fest nach dem Tod seiner vier Begleiter: Er würde nie mehr tatenlos zusehen müssen, wenn es um Leben oder Tod ging. Als Diplomphysiker begann er ein Medizinstudium in Mainz.
»Herr Doktor, dein Typ wird verlangt.« Die Stimme seiner Frau riss ihn aus der Konzentration. »Telefon.«
»Wer denn?«, fragte er, während er unter dem Wagen hervorkrabbelte.
»Wer schon?«, antwortete sie lächelnd. »Jemand, mit dem ich nie im Leben mithalten kann.«
Unsinn, mit seiner Frau konnte niemand mithalten. Sie war die fürsorgliche Mutter seiner beiden Söhne, eine tolle Familienmanagerin und seine willige Gespielin mit einer Traumfigur. Eine Frau, die er nie für sich hätte gewinnen können, wenn er als Kfz-Mechaniker im Westerwald geblieben wäre.
5. Kapitel
»Raphael zum Spottpreis verscherbelt«. Die Überschrift in der Tageszeitung bestätigte die Meinung der weitaus meisten Bürger. Der Redakteur gab sich keine Mühe, in der Berichterstattung objektiv zu bleiben. Er schrieb das, was fast alle meinten, und verschwieg, was niemand glauben oder zur Kenntnis nehmen wollte.
Das Krankenhaus, in dem schon seit Generationen geboren und gestorben wurde, in dem Krankheiten behandelt wurden und Unfallopfer Erste Hilfe erfuhren, »ihr« Krankenhaus stand vor einer ungewissen Zukunft. Die Schließung als öffentliches Krankenhaus und die Nutzung als Privatklinik für Betuchte geisterte durch die Köpfe und festigte sich als Tatsache. Niemand fragte nach, ob diese Ansicht zutraf.
Damit war die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung bedroht. Schlichtweg nicht bedacht wurde der Umstand, dass die Ärzte des Raphael-Krankenhauses in den letzten Jahren immer schon Patienten in die Kliniken der Nachbarstadt verlegt hatten, wenn sie Zweifel bei einer Diagnose hegten oder heikle Operationen zum Wohle ihrer Patienten scheuten. Aber das zählte nicht mehr in der Diskussion. Immer wieder hieß es nur in Leserbriefen, Diskussionsrunden und an Stammtischen: Der neue Eigentümer baut das Raphael zur Bonzenklinik um.
Die Stadt half ihm dabei sogar noch, so die allgemeine Überzeugung. Zwar hatte niemand den Kaufvertrag gesehen, aber alle wussten, dass der Neue die Krankenhaus GmbH für einen Euro erworben hatte. Der Erwerber, den niemand kannte, war von vornherein der Bösewicht, der Totengräber der Gesundheitsvorsorge, der Verräter an den Einwohnern dieser Stadt. Seine Helfershelfer waren keinen Deut besser. Allen voran die Kanzlerbande und die Ratsmehrheit, die dem Verrat der bürgerlichen Interessen zugestimmt hatten.
Hatte es überhaupt Zweck, sich gegen die aufgestaute Bürgerwut und die meinungsbildenden Populisten zu stemmen? Was sollte er gegen eine Zeitung tun, die unter Berufung auf einen nicht genannten Makler behauptete, der Wert des Krankenhauses liege bei fünf Millionen Euro für Grundstück und Gebäude?
In einer solchen Zeit der aufgestauten Emotionen Bürgermeister zu sein, war nicht leicht. Kohl konnte sich denken, wer hinter den Informationen steckte, die aus den nicht öffentlichen Sitzungen und den geheimen Gesprächen an die Medien und an die Mitarbeiter des Krankenhauses gelangten. Es lag auf der Hand, dass ein isolierter Ratsherr der Freien Wähler, den niemand ernst nahm, diese Informationen weitergab, immerhin war seine Schwester Betriebsratsvorsitzende im Raphael. Sie war die Erste gewesen, die von einem vermeintlichen Verkauf geredet hatte und von den Nachteilen für die Belegschaft und die Einwohner der Stadt. Es gab fast keinen Zeitungsartikel, in dem sie nicht zu Wort kam. Sie drohte keifend jedem mit Verleumdung, der auch nur die Vermutung äußerte, sie könnte ihr Wissen von ihrem Bruder haben.
Selbstverständlich war der Kaufpreis von einem Euro nur ein symbolischer. Der Wert der Immobilie lag nach den Berechnungen des städtischen Bauamtes und eines unabhängigen Gutachters bei rund drei Millionen Euro. Er deckte damit nicht einmal die Schulden, die das Krankenhaus in den letzten Jahren erwirtschaftet hatte. Das Raphael war für die städtischen Finanzen längst zu einem Fass mit einem löchrigen Boden geworden, der Jahr für Jahr durchlässiger wurde. Der millionenschwere Umbau zu einem Altersheim war für die Stadt ebenso wenig zu stemmen wie die unabdingbare Sanierung. Schon seit Jahren war sie überfällig, ebenso wie schon seit Jahren die Erneuerung der beiden Operationssäle und der medizinischen Apparaturen. Es war schlichtweg kein Geld im Stadtsäckel, zumal es auch bei Schulen, Kindergärten, Sporthallen und sogar beim Rathaus einen Sanierungsstau gab. Seine Vorgänger in Rat und Verwaltung hatten die Stadt munter abgewirtschaftet, den Finanzkollaps heraufbeschworen und an ihre Wähler Wahlgeschenke in Form von Freikarten fürs Schwimmbad, subventionierten Theaterabonnements und unangemessen günstigen Müllgebühren verteilt, statt die Finanzschrauben anzudrehen, Gebühren zu erhöhen und Leistungen einzustellen.
Da kam das Angebot des Mediziners wie vom Himmel gesandt.
Er wollte sämtliche Schulden bezahlen, in einer Fünf-Jahres-Planung die Sanierung betreiben und das Krankenhaus in einer geeigneten Form fortführen. An diesem Begriff der geeigneten Form schieden sich auch im Stadtrat die Geister.
Er werde, so hatte er versichert, alles dafür tun, um das Raphael als Allgemeinkrankenhaus zu erhalten. Aber er könne den Erhalt nicht garantieren, hatte er in den Verhandlungen frank und frei erklärt. Erst als er einem Passus im Kaufvertrag zustimmte, in dem die Schließung des Krankenhauses ausgeschlossen und der Erhalt als öffentliches Krankenhaus mindestens für den Zeitraum der Sanierung festgeschrieben wurde, war die Ratsmehrheit einverstanden.
Davon stand nichts in den Zeitungsberichten, davon sprach keiner der Kritiker, die gegen den Verkauf des Raphaels wetterten. Es war immer nur von dem Spottpreis von einem Euro die Rede und von der Absicht, das Raphael zu schließen.
Ob bei der Betriebsversammlung und der anschließenden Pressekonferenz der neue Eigentümer Gehör und seine Argumente Zustimmung finden würden, darüber war der Bürgermeister im Zweifel. Es gab viele Bedenkenträger und viele, die es nicht gutheißen konnten, dass das Krankenhaus einen neuen Eigentümer bekam.
Bürgermeister Kohl hatte andere Probleme. Was war von der feigen Drohung zu halten, die ihm anonym per Kurznachricht zugestellt worden war? Wer so leichtfertig die Gesundheit der Bevölkerung aufs Spiel setzt, sollte sich einmal ernsthaft Gedanken über sein eigenes Leben machen, hatte er lesen müssen. Vielleicht gab es, so befürchtete es der Bürgermeister, nicht nur für ihn zu viele Feinde, sondern auch für den neuen Klinik-Chef, für Privatdozent Dr. med. Gottfried Weiß.
6. Kapitel
Helma und Selma hatten die Begleitung des pensionierten Kommissars längst aufgegeben. Sie hatten die Kaltblüter des ehemaligen Gastwirtes entdeckt, die wohl zum letzten Mal in diesem Jahr auf einer Weide grasten, und machten sich einen Spaß daraus, sie kläffend zu umtänzeln. Da war der spielunwillige Zweibeiner uninteressant geworden und verdiente keine Aufmerksamkeit mehr.
Böhnke schlurfte schwitzend und schwer atmend am ehemaligen Löschteich entlang, als ihm der gelbe Wagen des Paketzustelldienstes entgegenkam. Das dauernde Aufleuchten der Lichthupe machte ihm deutlich, dass der Fahrer ihn ansprechen wollte.
Immer, wenn man ihn brauche, sei er nicht da, scherzte der Zusteller. Er habe ein dickes Päckchen für ihn und brauche eine Unterschrift.
»Du kannst mich mal«, knurrte Böhnke. War der Typ so blind oder folgte er nur bürokratischen Gepflogenheiten? »Siehst du nicht, dass ich beladen bin wie ein Packesel?«
»Und ich habe meine Vorschriften. Ohne Unterschrift keine Zustellung.«
Er möge sich seine Zustellung sonst wohin schieben, entgegnete Böhnke. Er erwartete kein Paket, und auch Lieselotte hatte nichts von einer Bestellung oder Lieferung gesagt. Dennoch konnte er seine Neugier nicht verbergen: »Von wem ist denn das Paket?«
»Postgeheimnis. Kannst du selber lesen, wenn du den Empfang quittiert hast.«
»Dann bring mir mal dein Postgeheimnis nach Hause«, sagte Böhnke und schlurfte weiter. Das hätte ihm noch gefehlt, dass ihm der Mann das Päckchen aufgedrückt hätte. Er hatte bloß zwei Hände. Ein Rucksack, wie Lieselotte ihm wiederholt empfohlen hatte, war vielleicht doch nicht die schlechteste Idee, sagte er sich. Aber diese Idee brachte ihn momentan auch nicht weiter.
»Mach deine Runde durchs Dorf. Du musst ja eh wieder bei mir vorbei«, schlug er dem Zusteller vor. Bisweilen war es von Vorteil, wenn es nur eine Zufahrtsstraße nach Huppenbroich gab und auf der Verbindung durchs Tiefenbachtal nach Simmerath in den meisten Monaten des Jahres ein Durchfahrtsverbot herrschte. Die zwar kurze, aber kurvenreiche Strecke stellte, vor allem bei Nässe, Glatteis oder Schnee, den unerfahrenen Autofahrer vor Probleme. Es war schon richtig, um Schwierigkeiten und Unfälle zu vermeiden, durch Verbotsschilder die Durchfahrt auf dieser Straße in den Wintermonaten zu untersagen – und der Winter kam in der Nordeifel erfahrungsgemäß immer ein paar Wochen früher als wenige Kilometer weiter nördlich im Aachener Talkessel. Dort hatte Böhnke jahrelang gearbeitet, dort arbeitete Lieselotte immer noch. Dauerhaft würden sie ihre gemeinsame Wohnung in Huppenbroich wohl erst mit dem Abschied aus ihrer Apotheke beziehen.
»Wir sehen uns also gleich im Hühnerstall«, bestätigte der Zusteller versöhnlich. Es war ja nicht das erste Mal, dass er Böhnke nicht in dessen Haus antraf, das eigentlich ein geräumiges Ferienhaus in einem ehemals in der Nachkriegszeit als Hühnerstall genutzten Backsteinbau war. Häufig war Böhnke im Dorf als Spaziergänger unterwegs oder als ehrenamtlicher Geschäftsführer zweier Stiftungen in Billas Haus, fast schon sein Zweitwohnsitz in dem Dorf, beschäftigt. Ihn wegen eines Einschreibens oder einer Quittung zu Hause anzutreffen, war da schon Glückssache. Insofern war auch diese Zustellung nicht außergewöhnlich.
Außergewöhnlich war eher der Absender des Päckchens. Böhnke kannte keinen Patrick Oebels von der Euskirchener Straße in Köln. Warum dieser Mann ihm etwas in einer stabilen, gelben Verpackung zukommen ließ, war ihm schleierhaft.
»Wird schon keine Paketbombe sein«, hatte der Zusteller schmunzelnd gemeint.
Und wenn doch? Böhnke schwieg und verzog sich mit dem Paket ins Haus.
Warum hatte er gute Beziehungen ins Kölner Rathaus, wenn er sie nicht nutzte? Kurzerhand rief Böhnke den Kölner Oberbürgermeister an, der mit ihm in einem der Stiftungsräte saß.
Der kurze Dienstweg ist der schnellste. Diese Erfahrungen aus seinem früheren ständigen Kampf mit der Bürokratie bestätigte sich auch dieses Mal.
Es dauerte nur wenige Minuten, bis Werner Müller zurückrief. Seine Auskunft war nicht dazu angetan, Böhnkes Begeisterung über das nicht bestellte und nicht erwartete Päckchen zu wecken. Der Absender des Päckchens war ein 96-jähriger, ehemaliger Autoverkäufer.
»Kenn ich nicht. Habe ich nie was mit zu tun gehabt«, kommentierte Böhnke die Mitteilung.
»Den werden Sie auch nicht kennenlernen«, entgegnete Müller trocken. Er hatte wie selbstverständlich Böhnkes Wunsch erfüllt, sich über den Mann kundig zu machen. Böhnke hatte so viel für ihn getan, dass er noch einiges bei ihm gut hatte – und eine kurze Personenklärung gehörte zu den leichtesten Dingen, selbst in der Kölner Stadtverwaltung. »Patrick Oebels ist nämlich tot. Laut Sterbeurkunde vor vier Tagen in einem Hospiz gestorben. Unverheiratet, keine Kinder, keine weiteren Verwandten.«
Paketpost von einem Verblichenen. Was sollte das? Das Päckchen war nachweislich in einem Kölner Postamt aufgegeben worden, als der vermeintliche Absender nicht mehr lebte. War da ein Witzbold am Werk, der auf diese Weise seine tote Katze entsorgen wollte? Oder ein Verwirrter, der sich nur geirrt hatte? Oder jemand, der ihm tatsächlich Böses wollte?
Hatte er jemals in einem Ermittlungsverfahren mit einem Patrick Oebels zu tun gehabt? Er konnte sich nicht erinnern.
Kurz entschlossen griff Böhnke zum Telefon. Die Verbindung zu seinem ehemaligen Kollegen Palmen im Polizeipräsidium war schnell hergestellt. Er konnte warten, bis er die Erkenntnisse erhielt, die in den Dateien der Behörden gesammelt waren. Doch weiter brachten ihn diese nicht.
»Chef, der Patrick Oebels war an keinem Verfahren beteiligt, das irgendwo in Deutschland registriert ist, weder als Beschuldigter noch als Opfer oder Zeuge oder als Anzeigenerstatter«, berichtete Palmen fast schon bedauernd. »Der Mann ist wie ein unbeschriebenes weißes Blatt.«
Geboren, um zu leben und zu sterben, dachte sich Böhnke. Ein Zeitgenosse, der keine Spuren in der Weltgeschichte hinterlassen hatte; bis auf die, dass ein Unbekannter Oebels Namen für das Versenden eines Päckchens missbraucht hatte. Wahrscheinlich hatte der Versender den Namen einer Todesanzeige des Hospizes entnommen, vermutete Böhnke.
»Wird schon keine Paketbombe sein«, hatte der Zusteller gesagt.
»Dann will ich ihm glauben, immerhin ist das Versenden explosiver Güter auf dem Postweg verboten«, sagte Böhnke laut zu sich und schnitt entschlossen das Klebeband auf.
Vom Inhalt des Päckchens war er beim ersten Anblick enttäuscht. Er hielt einen gut gefüllten, schwarzen Aktenordner mit einem unbeschrifteten Rücken in der Hand. Nachdenklich öffnete er ihn. Sein Blick fiel auf das erste Blatt, auf dem in Maschinenschrift nur ein Satz zu lesen war: »Sie müssen dem Mann helfen!«
7. Kapitel
Die Zeit, in der die Kollegen die Nase rümpften, wenn er noch in Arbeitsmontur zu einer Notoperation in die Klinik gekommen war, war längst vorbei. Inzwischen meldete sich fast jeder bei ihm, wenn er technische Probleme mit seinem Fahrzeug hatte. Sein Rat war gefragt, nicht nur als Arzt, sondern auch als Kfz-Mechaniker.
Auch sein Freund verließ sich voll und ganz auf ihn, wenn er auf Autosuche ging. Doch jetzt hatte der Freund andere Sorgen. Die komplizierte Operation des Unfallopfers war ihm aus den Fingern geglitten, der langjährige Kumpel war die letzte Rettung. Sein Hilferuf ging selbstverständlich nicht ins Leere. Er wusste, der Kumpel würde sofort das Werkzeug aus der Hand legen und sich in den Passat Kombi setzen, um in die Klinik zu kommen. Er musste nur den Zustand der Patientin stabilisieren und hoffen, dass die Hilfe nicht zu spät kam.
Beim Medizinstudium in Mainz hatten sie sich kennengelernt; er, der es langsam anging und sich mehr schlecht als recht durch die Prüfungen schlängelte, und sein Kumpel, der zielgerichtet und konzentriert auf einen sehr guten Abschluss hinarbeitete. Das war schon ein komischer Vogel gewesen, dieser Diplomphysiker, der Chirurg werden wollte. Wenn er ehrlich zu sich selbst war, musste er sich eingestehen, dass er ohne diesen komischen Vogel niemals zu einem erfolgreichen Ende seiner Ausbildung gekommen wäre. Er hatte sich an den fünf Jahre älteren Kumpel angehängt, dessen Lernmethoden übernommen, mit ihm gepaukt, ihm bei praktischen Übungen in der Pathologie über die Schulter geblickt und sich von ihm einige Tricks abgeschaut, wie man einen Eingriff schnell und sicher vornahm. Es mache keinen großen Unterschied, ob man einen Motor auseinandernehme und wieder zusammensetze oder ob man eine Operation am offenen Herzen vornehme, hatte der Kumpel gesagt, in beiden Fällen müsse man konzentriert und fehlerfrei arbeiten, sonst sei das Ende tödlich, für den Patienten oder für den Autofahrer, wenn ihm der Motor um die Ohren fliege.
Ihre Freundschaft wurde nur einmal auf die Probe gestellt. Das war, als ihm der Kumpel die schärfste Krankenschwester ausspannte, mit der er selbst in ihrem Praktischen Jahr ein Verhältnis begonnen hatte. Mittlerweile hatte sein Freund mit der Frau zwei Söhne, aber die Niederlage von damals nagte immer noch an ihm, Frank Petersmann, auch wenn er längst selbst Familienvater war. Doch hatte der Alltag die vorübergehende private Unstimmigkeit schnell verdrängt. Als der Kumpel ihm bei einer Operation geholfen hatte, die durch seinen Fehlgriff beinahe gescheitert wäre, war die Dankbarkeit größer als der Ärger. Mehr noch, die gegenseitige Unterstützung im Operationssaal stärkte ihre Freundschaft. Petersmann konnte, wie der Kumpel unumwunden einräumte, schneller und sicherer in Zweifelsfällen zutreffende Diagnosen stellen. Der Kumpel war der bessere Handwerker, wenn das Skalpell benötigt wurde. Dessen gelegentliche, unerklärliche Ausrutscher konnten sie meistens gemeinsam beheben. Wenn sie darüber schwiegen, hatte das auch noch einen anderen Grund. Petersmann durfte sich nur deshalb Dr. med. nennen, weil ihm der Kumpel dazu verholfen hatte. Er selbst war viel zu bequem, wegen der Promotion noch länger zu lernen und zu forschen. An ihrer gemeinsamen Fallstudie über die Auswirkungen eines neuen Medikamentes auf Männer und Frauen hatte Petersmann fast keinen Anteil. Sein Kumpel hatte seinen Part, nämlich die Auswirkungen auf das weibliche Geschlecht, mit übernommen. Er brauchte sich im Prinzip nur noch als Autor des Textes auszugeben.
Sein Part während ihrer gemeinsamen Studienzeit hatte vornehmlich darin bestanden, für Unterhaltung und Geselligkeit zu sorgen und dem Kumpel bei alltäglichen Schwierigkeiten zu helfen, wenn etwa ein Protokoll wegen Falschparkens bezahlt werden musste oder er ihm Geld für die Miete vorstrecken musste, weil der Kumpel wie fast immer in Finanznöten steckte.
Endlich bog der Passat auf den Klinikparkplatz ein. Er eilte dem Freund entgegen und informierte ihn während der Vorbereitung auf den Einsatz im Operationssaal über die Situation auf dem OP-Tisch.
»Das kriegen wir schon hin«, sagte der Mann mit der ihm eigenen Selbstsicherheit, die er so bewunderte. Der Typ, der so unscheinbar aussah, mit dem Diplom in Physik in der Tasche, figürlich klein und rundlich und mit schon beginnendem Haarausfall, strahlte eine Sicherheit aus, die sich auf seine Umgebung übertrug. Man hing an seinen Lippen, wenn er sprach, man tat, was er anordnete, man sah fasziniert zu, wenn er operierte, kurzum, man bewunderte ihn.
Und der Mann wusste, wie man die Menschen für sich einnahm.
»Das kriegen wir schon hin«, wiederholte er.
Er hatte nicht zu viel versprochen. Die Operation gelang, die Patientin würde leben.
Petersmann pustete durch, als sie sich nach der Arbeit umkleideten: »Weiß Gott, wie die Geschichte ohne dich ausgegangen wäre.«
8. Kapitel
In einer gemeinsamen Presseerklärung wollten sie an die Öffentlichkeit treten. So hatten es der neue Klinikchef und der Bürgermeister verabredet. Unmittelbar im Anschluss an eine Personalversammlung im Raphael sollte der Text den Medien zugestellt werden. Zu der internen Versammlung war den Pressevertretern kein Zutritt gewährt worden. Zu gegebener Zeit würde eine Pressekonferenz stattfinden, in der gerne alle Fragen gestellt werden könnten und selbstverständlich auch beantwortet würden.
»Also nie«, wie der Vertreter einer privaten Rundfunkanstalt verärgert kommentierte, als er wie alle anderen Journalisten unter Berufung auf das Hausrecht des Klinikgeländes verwiesen wurde.
Die Verärgerung bei den Medienvertretern wuchs, als sie endlich per Mail die angekündigte Pressemitteilung, versandt aus dem Rathaus, erhielten. Gerne hätten sie mehr erfahren als den inzwischen im Städtchen längst bekannten Kaufpreis von einem Euro, die Zusicherung des neuen Eigentümers, das Haus mit einem Millionenaufwand zu sanieren, und die Absicht, das Raphael als öffentliches Krankenhaus zu erhalten. Die Eigentumsübergabe sei bereits erfolgt, die notariellen Beurkundungen seien erledigt, die Verträge juristisch überprüft und von den Aufsichtsbehörden genehmigt worden.
Rücksprachen mit dem neuen Eigentümer seien derzeit nicht möglich, da er sich auf seine neue und schwierige Aufgabe zum Wohle des Krankenhauses und der Stadt konzentriere. Die Stadt selbst sei nicht mehr zu Auskünften berechtigt, die Medien mögen daher von Nachfragen absehen, schrieb der Bürgermeister abschließend.
Der Artikel, der am nächsten Tag in der Zeitung zu lesen war, hatte nur wenig Ähnlichkeit mit der offiziellen Pressemitteilung.
»Wie viele Mitarbeiter müssen gehen? Welche Ärzte bleiben? Was hat Weiß vor?« So lauteten die Fragen, die der Journalist an den Anfang seiner Berichterstattung gestellt hatte. Wie er schrieb, habe der Bürgermeister zu Beginn der Personalversammlung den Mitarbeitern des Krankenhauses noch einmal erklärt, warum der Verkauf zwingend erforderlich war. Der städtische Beigeordnete hatte in seiner Eigenschaft als nunmehr ehemaliger Geschäftsführer und kaufmännischer Leiter der Krankenhaus GmbH die Finanzlage dargestellt, von der katastrophalen Auslastung des Hauses, die unter 50 Prozent liege, gesprochen und von der Unmöglichkeit der Stadt, das Krankenhaus weiterzubetreiben. Zum Verkauf hätte es keine Alternative gegeben. Ohne Verkauf wäre es zu einer Schließung gekommen und damit zum Verlust aller Arbeitsplätze. Ärzte, Pflegepersonal, Verwaltungspersonal, technische Mitarbeiter, die Küchenbelegschaft, das Reinigungspersonal; alle Angestellten und Arbeiter wären arbeitslos geworden. Allerdings, das räumte der Geschäftsführer ein, werde der Wechsel nicht gänzlich ohne Personalabbau vonstattengehen können. Er sei der Erste, der seinen Platz hätte räumen müssen, sagte Schröder mit dem Versuch, witzig zu sein.