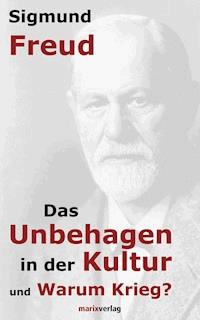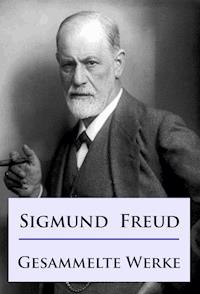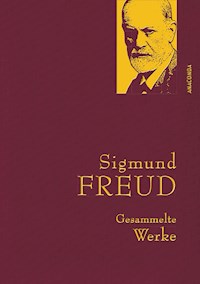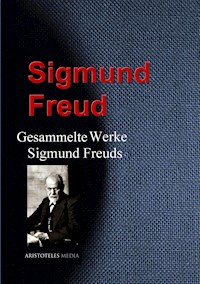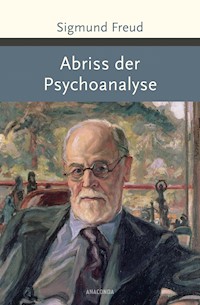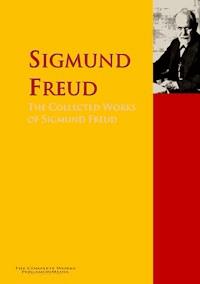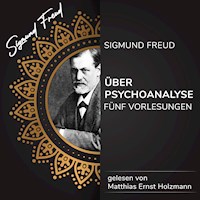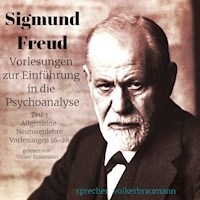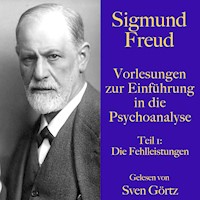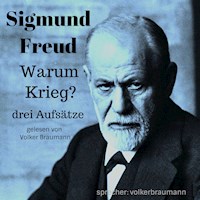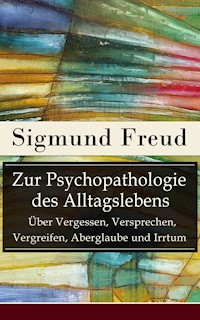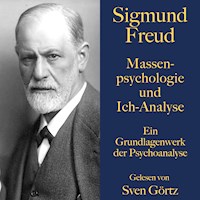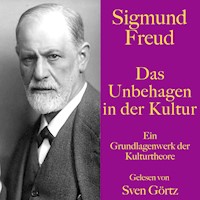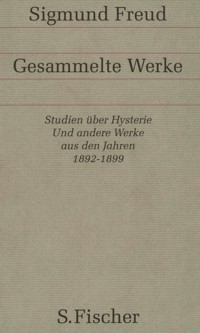
79,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Gesammelte Werke in 18 Bänden mit einem Nachtragsband
- Sprache: Deutsch
Gesammelte Werke in Einzelbänden, Band 1: Ein Fall von hypnotischer Heilung Charcot Die Abwehr-Neuropsychosen Studien über Hysterie - Über den psychischen Mechanismus hysterischer Phänomene - Krankengeschichten - Zur Psychotherapie der Hysterie Zur ›Angstneurose‹ Zur Ätiologie der Hysterie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 793
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Sigmund Freud
Band 1:Werke aus den Jahren 1892-1899
Über dieses Buch
Gesammelte Werke in Einzelbänden,
Band 1:
Ein Fall von hypnotischer Heilung
Charcot
Die Abwehr-Neuropsychosen
Studien über Hysterie
- Über den psychischen Mechanismus hysterischer Phänomene
- Krankengeschichten
- Zur Psychotherapie der Hysterie
Zur ›Angstneurose‹
Zur Ätiologie der Hysterie
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
© 1952 by Imago Publishing Co., Ltd., London
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung, vorbehalten durch S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main
Digitalisierung: pagina GmbH, Tübingen
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Hinweise zur Zitierfähigkeit dieser Ausgabe:
Textgrundlage dieser Ausgabe ist: Sigmund Freud, Gesammelte Werke. Bd. 1, Werke aus den Jahren 1892-1899.
Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag, 1991. 6. Auflage.
Die grauen Zahlen in geschweiften Klammern markieren jeweils den Beginn einer neuen, entsprechend paginierten Seite in der genannten Buchausgabe. Die Seitenzahlen im Register beziehen sich ebenfalls auf diese Ausgabe.
ISBN 978-3-10-400152-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
VORWORT DER HERAUSGEBER
[Hauptteil]
EIN FALL VON HYPNOTISCHER HEILUNG
[Hauptteil]
CHARCOT
[Hauptteil]
QUELQUES CONSIDÉRATIONS POUR UNE ÉTUDE COMPARATIVE DES PARALYSIES MOTRICES ORGANIQUES ET HYSTÉRIQUES
I
II
III
IV
[Hauptteil]
DIE ABWEHR-NEUROPSYCHOSEN
I
II
III
STUDIEN ÜBER HYSTERIE
VORWORT ZUR ERSTEN AUFLAGE
VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE
ÜBER DEN PSYCHISCHEN MECHANISMUS HYSTERISCHER PHÄNOMENE
KRANKENGESCHICHTEN
A Frau Emmy v. N.…, vierzig Jahre, aus Livland
B Miß Lucy R., dreißig Jahre
C Katharina …
D Fräulein Elisabeth v. R …
ZUR PSYCHOTHERAPIE DER HYSTERIE
[Hauptteil]
ÜBER DIE BERECHTIGUNG VON DER NEURASTHENIE EINEN BESTIMMTEN SYMPTOMENKOMPLEX ALS »ANGST-NEUROSE« ABZUTRENNEN
I Klinische Symptomatologie der Angstneurose
II Vorkommen und Ätiologie der Angstneurose
III Ansätze zu einer Theorie der Angstneurose
IV Beziehung zu anderen Neurosen
[Hauptteil]
OBSESSIONS ET PHOBIES
I
II
[Hauptteil]
ZUR KRITIK DER »ANGSTNEUROSE«
[Hauptteil]
WEITERE BEMERKUNGEN ÜBER DIE ABWEHR-NEUROPSYCHOSEN
I Die „spezifische“ Ätiologie der Hysterie
II Wesen und Mechanismus der Zwangsneurose
III Analyse eines Falles von chronischer Paranoia
[Hauptteil]
L’ HÉRÉDITÉ ET L’ ÉTIOLOGIE DES NÉVROSES
I
II
[Hauptteil]
ZUR ÄTIOLOGIE DER HYSTERIE
Meine Herren! Wenn wir [...]
II
III
INHALTSANGABEN DER WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN DES PRIVATDOCENTEN Dr. SIGM. FREUD 1877 – 1897
A. VOR ERLANGUNG DER DOCENTUR
B. SEIT ERLANGUNG DER DOCENTUR
ANHANG
[Hauptteil]
DIE SEXUALITÄT IN DER ÄTIOLOGIE DER NEUROSEN
[Hauptteil]
ZUM PSYCHISCHEN MECHANISMUS DER VERGESSLICHKEIT
[Hauptteil]
ÜBER DECKERINNERUNGEN
ZUSATZ ZUM VII. BANDE
VORWORT
ZUSATZ ZUM XIV. BANDE: EINIGE NACHTRÄGE ZUM GANZEN DER TRAUMDEUTUNG
EINIGE NACHTRÄGE ZUM GANZEN DER TRAUMDEUTUNG
a) Die Grenzen der Deutbarkeit
b) Die sittliche Verantwortung für den Inhalt der Träume
c) Die okkulte Bedeutung des Traumes
BIBLIOGRAPHISCHE ANMERKUNG
INDEX
VORWORT DER HERAUSGEBER
Die ersten „Gesammelten Schriften von Sigm. Freud“ erschienen im Internationalen Psychoanalytischen Verlag, Wien, in den Jahren 1924–1934, geplant, zusammengestellt und herausgegeben von A. J. Storfer, dem damaligen Leiter des Verlags. Die Ausgabe war äußerlich ausgezeichnet ausgestattet, 12bändig, in Quartformat und mit wenigen Ausnahmen nach Themen geordnet, um den Verkauf von Einzelbänden sowie die photostatische Reproduktion einzelner Bände in Taschenformat zu ermöglichen. Bei der zwangsweisen Liquidierung des Verlags unter den Nationalsozialisten im März 1938 wurden mit den anderen Verlagsbeständen auch mehrere tausend Exemplare der „Gesammelten Schriften“ eingestampft.
Zum Ersatz für diese vernichtete Ausgabe begannen im Herbst 1938 im Rahmen der neugegründeten Imago Publishing Co., London, mit Hilfe einer großzügigen Spende von Prinzessin Marie Bonaparte, die Pläne für die hier vorliegenden „Gesammelten Werke von Sigm. Freud“. Ein Komitee von Herausgebern, bestehend aus Dr. Edward Bibring, Dr. Ernst Kris und der Unterzeichneten, besorgte die Aufteilung des Materials auf 17 Bände und nahm die kritische Durcharbeitung des Textes und die Zusammenstellung der Bibliographie in Angriff. Nach längerer Überlegung entschied das Komitee sich dafür, die thematische Einteilung der „Gesammelten Schriften“ durch eine chronologische Einteilung zu ersetzen, eine Anordnung, die den Bedürfnissen des wissenschaftlichen Arbeiters und des an der Entstehung der psychoanalytischen Wissenschaft interessierten Lesers besser zu entsprechen schien. Die Absicht der Herausgeber, einige der voranalytischen Arbeiten Freuds in die „Gesammelten Werke“ aufzunehmen, wurde nach Besprechung mit dem Autor auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin wieder fallengelassen.
Die Umstände, unter denen die Vorarbeiten für die neue Ausgabe im Jahre 1938/39 begonnen hatten und die Bände VI, IX, XI und XIV veröffentlicht wurden, veränderten sich infolge des Kriegsausbruchs im September 1939 in verschiedenen Beziehungen. Dr. Edward Bibring und Dr. Ernst Kris wanderten im Jahre 1940/41 nach Amerika aus und mußten ihre Mitarbeit einschränken; Dr. Willi Hoffer (London) und Dr. Otto Isakower (New York) wurden in das Herausgeberkomitee kooptiert. Der Kriegsbetrieb im Druckerei- und Buchbindergewerbe führte zu endlosen Verzögerungen. Druck und Papierpreise stiegen auf ein Vielfaches der veranschlagten Kosten. Daß trotz dieser fast unüberwindlichen Hindernisse die Publikation der „Gesammelten Werke“ fortgesetzt werden konnte und die Ausgabe heute fertig vorliegt, verdankt sie einer kleinen Anzahl gelegentlicher privater Spender, der nicht erschütterten Geduld und Zuversicht des Leiters der Imago Publishing Co., Mr. John Rodker, und vor allem der unermüdlichen und uneigennützigen Herausgeberarbeit von Dr. Willi Hoffer.
Der Ungunst der äußeren Verhältnisse sind, neben der Verlangsamung des Erscheinens, auch verschiedene Unvollkommenheiten der Ausgabe zuzuschreiben. Gewisse bibliographische Anmerkungen mußten zu Zeiten fertiggestellt werden, in denen notwendiges Material, wie die neuesten Übersetzungen in fremde Sprachen, nicht zugänglich war. Daraus entstandene Irrtümer und Auslassungen sollen in späteren Auflagen richtiggestellt und ergänzt werden. Der durch die unruhigen Zeiten unvermeidliche Wechsel von Mitarbeitern macht sich vor allem in mangelnder Einheitlichkeit in der Ausführung des Sach- und Personenindex fühlbar. Die Herausgeber hoffen, die entstandenen Ungleichheiten im Gesamtindex (18. Band) wiedergutzumachen.
Zur Durchführung der chronologischen Anordnung des Materials sind folgende Bemerkungen zu machen:
Das chronologische Prinzip wurde nur an einer einzigen Stelle absichtlich durchbrochen, und zwar zugunsten der Einheitlichkeit in der Wiedergabe der „Traumdeutung“. Während in den „Gesammelten Schriften“ Band II die erste Auflage der „Traumdeutung“, Band III alle späteren Zusätze enthält, reproduzieren die „Gesammelten Werke“ in Band II/III die achte Auflage der „Traumdeutung“, in deren Text die Zusätze aus späteren Jahren in die erste Auflage eingeschaltet sind. Band II/III der „Gesammelten Werke“ enthält daher, ohne Rücksicht auf Chronologie, Beiträge aus den Jahren 1900-1929.
Zwei weitere Verstöße gegen die chronologische Ordnung beruhen auf Versehen. Das „Vorwort zur Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre“, 1906 (in den VII. Band gehörig) und „Einige Nachträge zum Ganzen der Traumdeutung“, 1924 (in den XIV. Band gehörig) wurden beim Druck dieser Bände ausgelassen. Sie finden sich unter separatem Titel (Zusatz zum VII., resp. XIV. Band) am Ende des zuletzt gedruckten I. Bandes.
Die Herausgeber benützen die Gelegenheit, um Mr. James Strachey für wertvolle Hinweise und Frau Lily Neurath, B.A., für ihre uneigennützige und tatkräftige Mithilfe beim Auffinden von sinnstörenden Irrtümern und Druckfehlern zu danken.
Für die Herausgeber:
ANNA FREUD
London, Juli 1951.
[Hauptteil]
EIN FALL VON HYPNOTISCHER HEILUNG
NEBST BEMERKUNGEN ÜBER DIE ENTSTEHUNG HYSTERISCHER SYMPTOME DURCH DEN „GEGENWILLEN“
Ich entschließe mich hier, einen einzelnen Fall von Heilung durch hypnotische Suggestion zu veröffentlichen, weil derselbe durch eine Reihe von Nebenumständen beweiskräftiger und durchsichtiger geworden ist, als die Mehrzahl unserer Heilerfolge zu sein pflegt.
Die Frau, welcher ich in einem für sie bedeutsamen Moment ihrer Existenz Hilfe leisten konnte, war mir seit Jahren bekannt und blieb mehrere Jahre später unter meiner Beobachtung; die Störung, von welcher sie die hypnotische Suggestion befreite, war einige Zeit vorher zum erstenmal aufgetreten, erfolglos bekämpft worden und hatte der Kranken einen Verzicht abgenötigt, dessen sie das zweitemal durch meine Hilfe enthoben war, während ein Jahr später dieselbe Störung sich neuerdings einstellte, und auf dieselbe Weise neuerdings überwunden wurde. Der Erfolg der Therapie war ein für die Kranke wertvoller, der auch so lange anhielt, als die Kranke die der Störung unterworfene Funktion ausüben wollte; und endlich dürfte es für diesen Fall gelungen sein, den einfachen psychischen Mechanismus der Störung nachzuweisen und ihn mit ähnlichen Vorgängen auf dem Gebiete der Nervenpathologie in Beziehung zu setzen.
Es handelt sich, um nicht länger in Rätseln sprechen zu müssen, um einen Fall, in dem eine Mutter ihr Neugeborenes nicht zu nähren vermochte, ehe sich die hypnotische Suggestion eingemengt hatte, und in dem die Vorgänge bei einem früheren und einem späteren Kinde eine nur selten mögliche Kontrolle des therapeutischen Erfolges gestatteten.
Das Objekt der nachstehenden Krankengeschichte ist eine junge Frau zwischen zwanzig und dreißig Jahren, mit der ich zufällig seit den Kinderjahren in Verkehr gestanden hatte, und die infolge ihrer Tüchtigkeit, ruhigen Besonnenheit und Natürlichkeit bei niemandem, auch nicht bei ihrem Hausarzte, im Rufe einer Nervösen stand. Mit Rücksicht auf die hier erzählten Begebenheiten muß ich sie als eine hystérique d’ occasion nach Charcots glücklichem Ausdruck bezeichnen. Man weiß, daß diese Kategorie der vortrefflichsten Mischung von Eigenschaften und einer sonst ungestörten nervösen Gesundheit nicht widerspricht. Von ihrer Familie kenne ich die in keiner Weise nervöse Mutter und eine ähnlich geartete, gesunde, jüngere Schwester. Ein Bruder hat eine typische Jugendneurasthenie durchgemacht, die ihn auch zum Scheitern in seinen Lebensplänen gebracht hat. Ich kenne die Ätiologie und den Verlauf dieser Erkrankung, die sich in meiner ärztlichen Erfahrung alljährlich mehrmals in der nämlichen Weise wiederholt. Bei ursprünglich guter Anlage die gewöhnliche sexuelle Verirrung der Pubertätszeit, dann die Überarbeitung der Studentenjahre, das Prüfungsstudium, eine Gonorrhoe und im Anschluß an diese der plötzliche Ausbruch einer Dyspepsie in Begleitung jener hartnäckigen, fast unbegreiflichen Stuhlverstopfung. Nach Monaten Ablösung dieser Verstopfung durch Kopfdruck, Verstimmung, Arbeitsunfähigkeit, und von da an entwickelt sich jene Charaktereinschränkung und egoistische Verkümmerung, welche den Kranken zur Geißel seiner Familie machen. Es ist mir nicht sicher, ob diese Form von Neurasthenie nicht in allen Stücken erworben werden kann, und ich lasse daher, zumal da ich die anderen Verwandten meiner Patientin nicht kenne, die Frage offen, ob in ihrer Familie eine hereditäre Disposition für Neurosen anzunehmen ist.
Die Patientin hatte, als die Geburt des ersten Kindes aus ihrer glücklichen Ehe herannahte, die Absicht, dasselbe selbst zu nähren. Der Geburtsakt verlief nicht schwieriger, als es bei älteren Erstgebärenden zu sein pflegt, wurde durch Forceps beendigt. Der Wöchnerin gelang es aber nicht, trotz ihres günstigen Körperbaues, dem Kinde eine gute Nährmutter zu sein. Die Milch kam nicht reichlich, das Anlegen verursachte Schmerzen, der Appetit mangelte, ein bedenklicher Widerwille gegen die Nahrungsaufnahme stellte sich ein, die Nächte waren erregt und schlaflos, und um Mutter und Kind nicht weiter zu gefährden, wurde der Versuch nach vierzehn Tagen als mißglückt abgebrochen und das Kind einer Amme übergeben, wonach alle Beschwerden der Mutter rasch verschwanden. Ich bemerke, daß ich von diesem ersten Laktationsversuch nicht als Arzt und Augenzeuge berichten kann.
Drei Jahre später erfolgte die Geburt eines zweiten Kindes und diesmal ließen auch äußere Umstände es wünschenswert erscheinen, eine Amme zu umgehen. Die Bemühungen der Mutter, selbst zu nähren, schienen aber weniger Erfolg zu haben und peinlichere Erscheinungen hervorzurufen als das erstemal. Die junge Mutter erbrach alle Nahrung, geriet in Aufregung, wenn sie dieselbe an ihr Bett bringen sah, war absolut schlaflos und so verstimmt über ihre Unfähigkeit, daß die beiden Ärzte der Familie, die in dieser Stadt so allgemein bekannten Ärzte Dr. Breuer und Dr. Lott, diesmal von einer längeren Fortsetzung des Versuches nichts wissen wollten. Sie rieten nur noch zu einem Versuch mit hypnotischer Suggestion und setzten durch, daß ich am Abend des vierten Tages als Arzt zu der mir befreundeten Frau geholt wurde.
Ich fand sie mit hochgeröteten Wangen zu Bette liegend, wütend über ihre Unfähigkeit, das Kind zu nähren, die sich bei jedem Versuch steigerte und der sie doch mit allen Kräften widerstrebte. Um das Erbrechen zu vermeiden, hatte sie diesen Tag über nichts zu sich genommen. Das Epigastrium war vorgewölbt, auf Druck empfindlich, die aufgelegte Hand fühlte den Magen unruhig, von Zeit zu Zeit erfolgte geruchloses Aufstoßen, die Kranke klagte über beständigen üblen Geschmack im Munde. Die Ära des hochtympanitischen Magenschalles war erheblich vergrößert. Ich wurde nicht als willkommener Retter aus der Not begrüßt, sondern offenbar nur widerwillig angenommen und durfte auf nicht viel Zutrauen rechnen.
Ich versuchte sofort, die Hypnose durch Fixierenlassen bei beständigem Einreden der Symptome des Schlafes herbeizuführen. Nach drei Minuten lag die Kranke mit dem ruhigen Gesichtsausdruck einer tief Schlafenden da. Ich weiß mich nicht zu erinnern, ob ich auf Katalepsie und andere Erscheinungen von Folgsamkeit geprüft habe. Ich bediente mich der Suggestion, um allen ihren Befürchtungen und den Empfindungen, auf welche sich die Befürchtungen stützten, zu widersprechen. „Haben Sie keine Angst, Sie werden eine ausgezeichnete Amme sein, bei der das Kind prächtig gedeihen wird. Ihr Magen ist ganz ruhig, Ihr Appetit ausgezeichnet, Sie sehnen sich nach einer Mahlzeit u. dgl.“ Die Kranke schlief weiter, als ich sie für einige Minuten verließ, und zeigte sich amnestisch, nachdem ich sie erweckt hatte. Ehe ich fortging, mußte ich noch einer besorgten Bemerkung des Mannes widersprechen, daß die Hypnose wohl die Nerven einer Frau gründlich ruinieren könne.
Am nächsten Abend erfuhr ich, was mir als ein Unterpfand des Erfolges galt, den Angehörigen und der Kranken aber merkwürdigerweise keinen Eindruck gemacht hatte. Die Wöchnerin hatte ohne Beschwerde zu Abend gegessen, ruhig geschlafen und auch am Vormittag sich wie das Kind tadellos ernährt. Die etwas reichliche Mittagsmahlzeit war aber zuviel für sie gewesen. Kaum daß dieselbe aufgetragen war, erwachte in ihr der frühere Widerwille, es trat Erbrechen ein, noch ehe sie etwas berührt hatte, das Kind anzulegen war unmöglich geworden, und alle objektiven Zeichen waren bei meinem Erscheinen wieder wie am Vorabend. Mein Argument, daß jetzt alles gewonnen sei, nachdem sie sich überzeugt hätte, daß die Störung weichen könne und auch für einen halben Tag gewichen sei, blieb wirkungslos. Ich war nun bei der zweiten Hypnose, die ebenso rasch zum Somnambulismus führte, energischer und zuversichtlicher. Die Kranke werde fünf Minuten nach meinem Fortgehen die Ihrigen etwas unwillig anfahren: wo denn das Essen bleibe, ob man denn die Absicht habe, sie auszuhungern, woher sie denn das Kind nähren solle, wenn sie nichts bekäme u. dgl. Als ich am dritten Abend wiederkehrte, ließ die Wöchnerin keine weitere Behandlung zu. Es fehle ihr nichts mehr, sie habe ausgezeichneten Appetit und reichlich Milch für das Kind, das Anlegen des Kindes mache ihr nicht die geringsten Schwierigkeiten u. dgl. Dem Manne war es etwas unheimlich erschienen, daß sie gestern Abend bald nach meinem Fortgehen so ungestüm nach Nahrung verlangt und der Mutter Vorwürfe gemacht habe, wie es niemals ihre Art gewesen. Seither gehe aber alles gut.
Ich hatte nichts mehr dabei zu tun. Die Frau nährte das Kind acht Monate lang, und ich hatte häufig Gelegenheit, mich freundschaftlich von dem Wohlbefinden beider Personen zu überzeugen. Nur fand ich es unverständlich und verdrießlich, daß von jener merkwürdigen Leistung niemals zwischen uns die Rede war.
Indessen kam meine Zeit ein Jahr später, als ein drittes Kind dieselben Ansprüche an die Mutter stellte, welche sie ebenso wenig wie die vorigen Male zu befriedigen vermochte. Ich traf die Frau in demselben Zustande wie voriges Jahr, und geradezu erbittert gegen sich, daß sie gegen die Eßabneigung und die anderen Symptome mit ihrem Willen nichts vermochte. Die Hypnose des ersten Abends hatte auch nur den Erfolg, die Kranke noch hoffnungsloser zu machen. Nach der zweiten Hypnose war der Symptomkomplex wiederum so vollständig abgeschnitten, daß es einer dritten nicht bedurfte. Die Frau hat auch dieses Kind, das heute eineinhalb Jahre alt ist, ohne alle Beschwerde genährt und sich des ungestörtesten Wohlbefindens erfreut.
Angesichts dieser Wiederholung des Erfolges tauten nun auch die beiden Eheleute auf und bekannten das Motiv, welches ihr Benehmen gegen mich geleitet hatte. Ich habe mich geschämt, sagte mir die Frau, daß so etwas wie die Hypnose nützen soll, da, wo ich mit all meiner Willenskraft machtlos war. Ich glaube indes nicht, daß sie oder ihr Mann ihre Abneigung gegen die Hypnose überwunden haben.
Ich gehe nun zu der Erörterung über, welches wohl der psychische Mechanismus jener durch Suggestion behobenen Störung bei meiner Patientin war. Ich habe nicht wie in anderen Fällen, von denen ein andermal die Rede sein soll, direkte Auskunft darüber, sondern bin darauf angewiesen, ihn zu erraten.
Es gibt Vorstellungen, mit denen ein Erwartungsaffekt verbunden ist, und zwar sind dieselben von zweierlei Art, Vorstellungen, daß ich dies oder jenes tun werde, sogenannte Vorsätze und Vorstellungen, daß dies oder jenes mit mir geschehen wird, eigentlich Erwartungen. Der daran geknüpfte Affekt hängt von zwei Faktoren ab, erstens von der Bedeutung, den der Ausfall für mich hat, zweitens von dem Grade von Unsicherheit, mit welchem die Erwartung desselben behaftet ist. Die subjektive Unsicherheit, die Gegenerwartung, wird selbst durch eine Summe von Vorstellungen dargestellt, welche wir als „peinliche Kontrastvorstellungen“ bezeichnen wollen. Für den Fall des Vorsatzes lauten diese Kontrastvorstellungen so: Es wird mir nicht gelingen, meinen Vorsatz auszuführen, weil dies oder jenes für mich zu schwer ist, ich dafür ungeeignet bin; auch weiß ich, daß es bestimmten anderen Personen in ähnlicher Lage gleichfalls mißlungen ist. Der andere Fall, der der Erwartung, ist ohneweiters klar; die Gegenerwartung beruht auf der Erwägung aller anderen Möglichkeiten, die mir zustoßen können, bis auf die eine, die ich wünsche. Die weitere Erörterung dieses Falles führt zu den Phobien, die in der Symptomatologie der Neurosen eine so große Rolle spielen. Wir verbleiben bei der ersten Kategorie, bei den Vorsätzen. Was tut nun ein gesundes Vorstellungsleben mit den Kontrastvorstellungen gegen den Vorsatz? Es unterdrückt und hemmt dieselben nach Möglichkeit, wie es dem kräftigen Selbstbewußtsein der Gesundheit entspricht, schließt sie von der Assoziation aus, und dies gelingt häufig in so hohem Grade, daß die Existenz der Kontrastvorstellung gegen den Vorsatz meist nicht evident ist, sondern erst durch die Betrachtung der Neurosen wahrscheinlich gemacht wird. Bei den Neurosen hingegen, – und ich beziehe mich durchaus nicht allein auf die Hysterie, sondern auf den Status nervosus im allgemeinen, – ist als primär vorhanden eine Tendenz zur Verstimmung, zur Herabsetzung des Selbstbewußtseins anzunehmen, wie wir sie als höchstentwickeltes und vereinzeltes Symptom bei der Melancholie kennen. Bei den Neurosen fällt nun auch den Kontrastvorstellungen gegen den Vorsatz eine große Beachtung zu, vielleicht weil deren Inhalt zu der Stimmungsfärbung der Neurose paßt, oder vielleicht in der Weise, daß auf dem Boden der Neurose Kontrastvorstellungen entstehen, die sonst unterblieben wären.
Diese Kräftigung der Kontrastvorstellungen zeigt sich nun beim einfachen Status nervosus auf die Erwartung bezogen als allgemein pessimistische Neigung, bei der Neurasthenie gibt sie durch Assoziation mit den zufälligsten Empfindungen Anlaß zu den mannigfachen Phobien der Neurastheniker. Auf die Vorsätze übertragen, erzeugt dieser Faktor jene Störungen, die als folie de doute zusammengefaßt werden, und die das Mißtrauen des Individuums in die eigene Leistung zum Inhalt haben. Gerade hier verhalten sich die beiden großen Neurosen, Neurasthenie und Hysterie, in einer für jede charakteristischen Weise verschieden. Bei der Neurasthenie wird die krankhaft gesteigerte Kontrastvorstellung mit der Willensvorstellung zu einem Bewußtseinsakt verknüpft, sie zieht sich von letzterer ab und erzeugt die auffällige Willensschwäche der Neurastheniker, die ihnen selbst bewußt ist. Der Vorgang bei der Hysterie hingegen weicht in zwei Punkten ab, oder vielleicht nur in einem einzigen. Wie es der Neigung der Hysterie zur Dissoziation des Bewußtseins entspricht, wird die peinliche Kontrastvorstellung, die anscheinend gehemmt ist, außer Assoziation mit dem Vorsatz gebracht und besteht, oft dem Kranken selbst unbewußt, als abgesonderte Vorstellung weiter. Exquisit hysterisch ist es nun, daß sich diese gehemmte Kontrastvorstellung, wenn es zur Ausführung des Vorsatzes kommen soll, mit derselben Leichtigkeit durch Innervation des Körpers objektiviert wie im normalen Zustande die Willensvorstellung. Die Kontrastvorstellung etabliert sich sozusagen als „Gegenwille“, während sich der Kranke mit Erstaunen eines entschiedenen aber machtlosen Willens bewußt ist. Vielleicht sind, wie gesagt, die beiden Momente im Grunde nur eines, etwa so, daß die Kontrastvorstellung nur darum den Weg zur Objektivierung findet, weil sie nicht durch die Verknüpfung mit dem Vorsatz selbst gehemmt ist, wie sie diesen hemmt.[1]
In unserem Falle einer Mutter, die durch nervöse Schwierigkeit am Säuggeschäft verhindert wird, hätte sich eine Neurasthenica etwa so benommen: Sie hätte sich mit Bewußtsein vor der ihr gestellten Aufgabe gefürchtet, sich viel mit den möglichen Zwischenfällen und Gefahren beschäftigt und nach vielem Zaudern unter Bangen und Zweifeln doch das Säugen ohne Schwierigkeit durchgeführt, oder wenn die Kontrastvorstellung die Oberhand behalten hätte, es unterlassen, weil sie sich dessen nicht getraut. Die Hysterica benimmt sich dabei anders, sie ist sich ihrer Furcht vielleicht nicht bewußt, hat den festen Vorsatz es durchzuführen und geht ohne Zögern daran. Dann aber benimmt sie sich so, als ob sie den Willen hätte, das Kind auf keinen Fall zu säugen, und dieser Wille ruft bei ihr alle jene subjektiven Symptome hervor, welche eine Simulantin angeben würde, um sich dem Säuggeschäft zu entziehen: Die Appetitlosigkeit, den Abscheu vor der Speise, die Schmerzen beim Anlegen des Kindes und außerdem, da der Gegenwille der bewußten Simulation in der Beherrschung des Körpers überlegen ist, eine Reihe von objektiven Zeichen am Verdauungstrakt, welche die Simulation nicht herzustellen vermag. Im Gegensatz zur Willensschwäche der Neurasthenie besteht hier Willensperversion, und im Gegensatz zur resignierten Unentschlossenheit dort, hier Staunen und Erbitterung über den der Kranken unverständlichen Zwiespalt.
Ich halte mich also für berechtigt, meine Kranke als eine hystérique d’ occasion zu bezeichnen, da sie unter dem Einfluß einer Gelegenheitsursache einen Symptomkomplex von so exquisit hysterischem Mechanismus zu produzieren imstande war. Als Gelegenheitsursache mag hier die Erregung vor der ersten Entbindung oder die Erschöpfung nach derselben angenommen werden, wie denn die erste Entbindung der größten Erschütterung entspricht, welcher der weibliche Organismus ausgesetzt ist, in deren Gefolge auch die Frau alle neurotischen Symptome zu produzieren pflegt, zu denen die Anlage in ihr schlummert.
Wahrscheinlich ist der Fall meiner Patientin vorbildlich und aufklärend für eine große Reihe anderer Fälle, in denen das Säuggeschäft oder ähnliche Verrichtungen durch nervöse Einflüsse verhindert werden. Da ich aber den psychischen Mechanismus des von mir beschriebenen Falles bloß erschlossen habe, beeile ich mich mit der Versicherung fortzusetzen, daß es mir durch Ausforschung der Kranken in der Hypnose wiederholt gelungen ist, einen derartigen psychischen Mechanismus für hysterische Symptome direkt nachzuweisen.[2]
Ich führe nur eines der auffälligsten Beispiele hier an: Vor Jahren behandelte ich eine hysterische Dame, die ebenso willensstark in all den Stücken war, in welche sich ihre Krankheit nicht eingemengt hatte, wie anderseits schwer belastet mit mannigfaltigen und drückenden hysterischen Verhinderungen und Unfähigkeiten. Unter anderem fiel sie durch ein eigentümliches Geräusch auf, welches sie ticartig in ihre Konversation einschob, und das ich als ein besonderes Zungenschnalzen mit plötzlichem Durchbruch des krampfhaften Lippenverschlusses beschreiben möchte. Nachdem ich es wochenlang mitangehört hatte, erkundigte ich mich einmal, wann und bei welcher Gelegenheit es entstanden sei. Die Antwort war: „Ich weiß nicht wann, o schon seit langer Zeit.“ Ich hielt es darum auch für einen echten Tic, bis es mir einmal einfiel, der Kranken in tiefer Hypnose dieselbe Frage zu stellen. In der Hypnose verfügte diese Kranke – ohne daß man sie dazu suggerieren mußte – sofort über ihr ganzes Erinnerungsvermögen; ich möchte sagen über den ganzen, im Wachen eingeengten Umfang ihres Bewußtseins. Sie antwortete prompt: „Wie mein kleineres Kind so krank war, den ganzen Tag Krämpfe gehabt hatte und endlich am Abend eingeschlafen war, und wie ich dann am Bette saß und mir dachte: Jetzt mußt du aber recht ruhig sein, um sie nicht aufzuwecken, da … bekam ich das Schnalzen zum erstenmal. Es verging dann wieder; wie wir aber viele Jahre später einmal nachts durch den Wald bei ** fuhren, und ein großes Gewitter losbrach und der Blitz gerade in einen Baumstamm vor uns am Wege einschlug, so daß der Kutscher die Pferde zurückreißen mußte, und ich mir dachte: Jetzt darfst du nur ja nicht schreien, sonst werden die Pferde scheu, da – kam es wieder und ist seitdem geblieben.“ Ich konnte mich überzeugen, daß jenes Schnalzen kein echter Tic war, denn es war von dieser Zurückführung auf seinen Grund an beseitigt und blieb so durch Jahre, so lange ich die Kranke verfolgen konnte. Ich hatte aber damals zum erstenmal Gelegenheit, die Entstehung hysterischer Symptome durch die Objektivierung der peinlichen Kontrastvorstellung, durch den Gegenwillen zu erfassen. Die durch Angst und Krankenpflege erschöpfte Mutter nimmt sich vor, ja keinen Laut über ihre Lippen zu bringen, um das Kind nicht in dem so spät eingetretenen Schlaf zu stören. In ihrer Erschöpfung erweist sich die begleitende Kontrastvorstellung, sie werde es doch tun, als die stärkere, gelangt zur Innervation der Zunge, welche zu hemmen der Vorsatz lautlos zu bleiben, vielleicht vergessen hatte, durchbricht den Verschluß der Lippen und erzeugt ein Geräusch, welches sich von nun an, zumal seit einer Wiederholung desselben Vorganges, für viele Jahre fixiert.
Das Verständnis dieses Vorganges ist kein vollkommenes, so lange nicht ein bestimmter Einwand erledigt worden ist. Man wird fragen dürfen, wie es komme, daß bei einer allgemeinen Erschöpfung – die doch die Disposition für jenen Vorgang darstellt – gerade die Kontrastvorstellung die Oberhand gewinnt? Ich möchte darauf mit der Annahme erwidern, daß diese Erschöpfung eine bloß partielle ist. Erschöpft sind diejenigen Elemente des Nervensystems, welche die materiellen Grundlagen der zum primären Bewußtsein assoziierten Vorstellungen sind; die von dieser Assoziationskette – des normalen Ichs – ausgeschlossenen, die gehemmten und unterdrückten Vorstellungen sind nicht erschöpft und überwiegen daher im Momente der hysterischen Disposition.
Jeder Kenner der Hysterie wird aber bemerken, daß der hier geschilderte psychische Mechanismus nicht bloß vereinzelte hysterische Zufälle, sondern große Stücke des Symptombildes der Hysterie sowie einen geradezu auffälligen Charakterzug derselben aufzuklären vermag. Halten wir fest, daß es die peinlichen Kontrastvorstellungen, welche das normale Bewußtsein hemmt und zurückweist, waren, die im Momente der hysterischen Disposition hervortraten und den Weg zur Körperinnervation fanden, so haben wir den Schlüssel auch zum Verständnis der Eigentümlichkeit hysterischer Anfallsdelirien in der Hand. Es ist nicht zufällig, daß die hysterischen Delirien der Nonnen in den Epidemien des Mittelalters aus schweren Gotteslästerungen und ungezügelter Erotik bestanden, oder daß gerade bei wohlerzogenen und artigen Knaben, wie Charcot (Leçons du Mardi, vol. I.) hervorhebt, hysterische Anfälle vorkommen, in denen jeder Gassenbüberei, jeder Bubentollheit und Unart freier Lauf gelassen wird. Die unterdrückten und mühsam unterdrückten Vorstellungsreihen sind es, die hier infolge einer Art von Gegenwillen in Aktion umgesetzt werden, wenn die Person der hysterischen Erschöpfung verfallen ist. Ja der Zusammenhang ist vielleicht mitunter ein intimerer, indem gerade durch die mühevolle Unterdrückung jener hysterische Zustand erzeugt wird, – auf dessen psychologische Kennzeichnung ich hier übrigens nicht eingegangen bin. Ich habe es hier nur mit der Erklärung zu tun, warum – jenen Zustand hysterischer Disposition vorausgesetzt – die Symptome so ausfallen, wie wir sie tatsächlich beobachten.
Im ganzen verdankt die Hysterie diesem Hervortreten des Gegenwillens jenen dämonischen Zug, der ihr so häufig zukommt, der sich darin äußert, daß die Kranken gerade dann und dort etwas nicht können, wo sie es am sehnlichsten wollen, daß sie das genaue Gegenteil von dem tun, um was man sie gebeten hat, und daß sie, was ihnen am teuersten ist, beschimpfen und verdächtigen müssen. Die Charakterperversion der Hysterie, der Kitzel, das Schlechte zu tun, sich krank stellen zu müssen, wo sie sehnlichst die Gesundheit wünschen, – wer hysterische Kranke kennt, weiß, daß dieser Zwang oft genug die tadellosesten Charaktere betrifft, die ihren Kontrastvorstellungen für eine Zeit hilflos preisgegeben sind.
Die Frage: Was wird aus den gehemmten Vorsätzen? scheint für das normale Vorstellungsleben sinnlos zu sein. Man möchte darauf antworten, sie kommen eben nicht zustande. Das Studium der Hysterie zeigt, daß sie dennoch zustandekommen, d. h. daß die ihnen entsprechende materielle Veränderung erhalten bleibt, und daß sie aufbewahrt werden, in einer Art von Schattenreich eine ungeahnte Existenz fristen, bis sie als Spuk hervortreten und sich des Körpers bemächtigen, der sonst dem herrschenden Ichbewußtsein gedient hat.
Ich habe vorhin gesagt, daß dieser Mechanismus ein exquisit hysterischer ist; ich muß hinzufügen, daß er nicht ausschließlich der Hysterie zukommt. Er findet sich in auffälliger Weise beim tic convulsif wieder, einer Neurose, die so viel symptomatische Ähnlichkeit mit der Hysterie hat, daß ihr ganzes Bild als Teilerscheinung der Hysterie auftreten kann, so daß Charcot, wenn ich seine Lehren darüber nicht von Grund aus mißverstanden habe, nach längerer Sonderung kein anderes Unterscheidungsmerkmal gelten lassen kann, als daß der hysterische Tic sich wieder einmal löst, der echte fortbestehen bleibt. Das Bild eines schweren tic convulsif setzt sich bekanntlich zusammen aus unwillkürlichen Bewegungen, häufig (nach Charcot und Guinon immer) vom Charakter der Grimassen oder einmal zweckmäßig gewesener Verrichtungen, aus Koprolalie, Echolalie und Zwangsvorstellungen aus der Reihe der folie de doute. Es ist nun überraschend zu hören, daß Guinon, dem das Eingehen in den psychischen Mechanismus dieser Symptome ferne liegt, von einigen seiner Kranken berichtet, sie seien zu ihren Zuckungen und Grimassen auf dem Wege der Objektivierung der Kontrastvorstellung gelangt. Diese Kranken geben an, sie hätten bei einer bestimmten Gelegenheit einen ähnlichen Tic oder einen Komiker, der seine Mienen absichtlich so verzerrte, gesehen und dabei die Furcht empfunden, diese häßlichen Bewegungen nachahmen zu müssen. Von da an hätten sie auch wirklich mit der Nachahmung begonnen. Gewiß entsteht nur ein kleiner Teil der unwillkürlichen Bewegungen bei den tiqueurs auf diese Weise. Dagegen könnte man versucht sein, diesen Mechanismus der Entstehung der Koprolalie unterzulegen, mit welchem Terminus bekanntlich das unwillkürliche, besser widerwillige Hervorstoßen der unflätigsten Worte bei den tiqueurs bezeichnet wird. Die Wurzel der Koprolalie wäre die Wahrnehmung des Kranken, daß er es nicht unterlassen kann, gewisse Laute, meist ein hm, hm, hervorzustoßen. Daran würde sich die Furcht schließen, auch die Herrschaft über andere Laute, besonders über jene Worte zu verlieren, die der wohlerzogene Mensch auszusprechen sich hütet, und diese Furcht würde zur Verwirklichung des Gefürchteten führen. Ich finde bei Guinon keine Anamnese, welche diese Vermutung bestätigt und habe selbst nie Gelegenheit gehabt, einen Kranken mit Koprolalie auszufragen. Dagegen finde ich bei demselben Autor den Bericht über einen anderen Fall von Tic, bei dem das unwillkürlich ausgesprochene Wort ausnahmsweise nicht dem Sprachschatz der Koprolalie angehörte. Dieser Fall betrifft einen erwachsenen Mann, der mit dem Ausruf „Maria“ behaftet war. Er hatte als Schüler eine Schwärmerei für ein Mädchen dieses Namens gehabt, die ihn damals ganz in Anspruch nahm, wie wir annehmen wollen, zur Neurose disponierte. Damals begann er den Namen seiner Angebeteten mitten in den Schulstunden laut zu rufen, und dieser Name verblieb ihm als Tic, nachdem seine Liebschaft seit einem halben Menschenleben überwunden war. Ich denke, es kann kaum anders zugegangen sein, als daß das ernsthafteste Bemühen, den Namen geheim zu halten, in einem Moment besonderer Erregung in den Gegenwillen umschlug, und daß von da ab der Tic verblieb, ähnlich wie im Falle meiner zweiten Kranken.
Ist die Erklärung dieses Beispiels richtig, so liegt die Versuchung nahe, den eigentlich koprolalischen Tic auf denselben Mechanismus zurückzuführen, denn die unflätigen Worte sind Geheimnisse, die wir alle kennen, und deren Kenntnis wir stets voreinander zu verbergen streben.[3]
[Hauptteil]
CHARCOT
Mit J. M. Charcot, den nach einem glücklichen und ruhmvollen Leben am 16. August d. J. ein rascher Tod ohne Leiden und Krankheit ereilte, hat die junge Wissenschaft der Neurologie ihren größten Förderer, haben die Neurologen aller Länder ihren Lehrmeister, hat Frankreich einen seiner ersten Männer allzufrüh verloren. Er war erst 68 Jahre alt, seine körperliche Kraft wie seine geistige Frische schienen ihn im Einklange mit seinen unverhohlenen Wünschen für jene Langlebigkeit zu bestimmen, die nicht wenigen Geistesarbeitern dieses Jahrhunderts zuteil geworden ist. Die stattlichen neun Bände seiner Oeuvres complètes, in denen seine Schüler seine Beiträge zur Medizin und Neuropathologie gesammelt hatten, dazu die Leçons du Mardi, die Jahresberichte seiner Klinik in der Salpêtrière u. a. m., alle diese Publikationen die der Wissenschaft und seinen Schülern teuer bleiben werden, können uns den Mann nicht ersetzen, der noch viel mehr zu geben und zu lehren hatte, dessen Person oder dessen Werken noch niemand genaht war, ohne von ihnen zu lernen.
Er hatte eine rechtschaffene menschliche Freude an seinem großen Erfolge und pflegte sich gern über seine Anfänge und den Weg, den er gegangen, zu äußern. Seine wissenschaftliche Neugierde war frühzeitig durch das reiche und damals völlig unverstandene Material neuropathologischer Tatsachen erregt worden, wie er erzählte, schon als er junger Interne (Sekundararzt) war. Wenn er damals mit seinem Primararzt die Visite auf einer der Abteilungen der Salpêtrière (Versorgungshaus für Frauen) machte, durch all die Wildnis von Lähmungen, Zuckungen und Krämpfen, für die es vor vierzig Jahren keine Namen und kein Verständnis gab, pflegte er zu sagen: „faudrait y retourner et y rester“ und er hielt Wort. Als er médecin des hôpitaux (Primararzt) geworden war, trachtete er alsbald in die Salpêtrière zu kommen, auf eine jener Abteilungen, die die Nervenkranken beherbergten, und einmal dort angelangt, verblieb er auch dort, anstatt, wie es den französischen Primarärzten freisteht, im regelmäßigen Turnus Spital und Abteilung und damit auch die Spezialität zu wechseln.
So war sein erster Eindruck und der Vorsatz, zu dem er geführt hatte, bestimmend für seine gesamte weitere Entwicklung geworden. Die Verfügung über ein großes Material an chronisch Nervenkranken gestattete ihm nun, seine eigentümliche Begabung zu verwerten. Er war kein Grübler, kein Denker, sondern eine künstlerisch begabte Natur, wie er es selbst nannte, ein visuel, ein Seher. Von seiner Arbeitsweise erzählte er uns selbst folgendes: Er pflegte sich die Dinge, die er nicht kannte, immer von neuem anzusehen, Tag für Tag den Eindruck zu verstärken, bis ihm dann plötzlich das Verständnis derselben aufging. Vor seinem geistigen Auge ordnete sich dann das Chaos, welches durch die Wiederkehr immer derselben Symptome vorgetäuscht wurde; es ergaben sich die neuen Krankheitsbilder, gekennzeichnet durch die konstante Verknüpfung gewisser Symptomgruppen; die vollständigen und extremen Fälle, die „Typen“, ließen sich mit Hilfe einer gewissen Art von Schematisierung hervorheben, und von den Typen aus blickte das Auge auf die lange Reihe der abgeschwächten Fälle, der formes frustes, die von dem oder jenem charakteristischen Merkmal des Typus her ins Unbestimmte ausliefen. Er nannte diese Art der Geistesarbeit, in der er keinen Gleichen hatte, „Nosographie treiben“ und war stolz auf sie. Man konnte ihn sagen hören, die größte Befriedigung, die ein Mensch erleben könne, sei, etwas Neues zu sehen, d. h. es als neu zu erkennen, und in immer wiederholten Bemerkungen kam er auf die Schwierigkeit und Verdienstlichkeit dieses „Sehens“ zurück. Woher es denn komme, daß die Menschen in der Medizin immer nur sehen, was sie zu sehen bereits gelernt haben, wie wunderbar es sei, daß man plötzlich neue Dinge – neue Krankheitszustände – sehen könne, die doch wahrscheinlich so alt seien wie das Menschengeschlecht, und wie er sich selbst sagen müsse, er sehe jetzt manches, was er durch 30 Jahre auf seinen Krankenzimmern übersehen habe. Welchen Reichtum an Formen die Neuropathologie durch ihn gewann, welche Verschärfung und Sicherheit der Diagnose durch seine Beobachtungen ermöglicht wurde, braucht man dem Arzte nur anzudeuten. Der Schüler aber, der mit ihm einen stundenlangen Gang durch die Krankenzimmer der Salpêtrière, dieses Museums von klinischen Fakten, gemacht hatte, deren Namen und Besonderheit größtenteils von ihm selbst herrührten, wurde an Cuvier erinnert, dessen Statue vor dem Jardin des plantes den großen Kenner und Beschreiber der Tierwelt, umgeben von der Fülle tierischer Gestalten, zeigt, oder er mußte an den Mythus von Adam denken, der jenen von Charcot gepriesenen intellektuellen Genuß im höchsten Ausmaß erlebt haben mochte, als ihm Gott die Lebewesen des Paradieses zur Sonderung und Benennung vorführte.
Charcot wurde auch niemals müde, die Rechte der rein klinischen Arbeit, die im Sehen und Ordnen besteht, gegen die Übergriffe der theoretischen Medizin zu verteidigen. Wir waren einmal eine kleine Schar von Fremden beisammen, die, in der deutschen Schulphysiologie auferzogen, ihm durch die Beanständung seiner klinischen Neuheiten lästig fielen: „Das kann doch nicht sein,“ wendete ihm einmal einer von uns ein, „das widerspricht ja der Theorie von Young-Helmholtz“. Er erwiderte nicht: „Um so ärger für die Theorie, die Tatsachen der Klinik haben den Vorrang“ u. dgl., aber er sagte uns doch, was uns einen großen Eindruck machte: „La théorie, c’ est bon, mais ça n’ empêche pas d’ exister.“
Durch eine ganze Reihe von Jahren hatte Charcot die Professur für pathologische Anatomie in Paris inne, und seine neuropathologischen Arbeiten und Vorlesungen, die ihn rasch auch im Auslande berühmt machten, betrieb er ohne Auftrag als Nebenbeschäftigung; für die Neuropathologie war es aber ein Glück, daß derselbe Mann die Leistung zweier Instanzen auf sich nehmen konnte, einerseits durch klinische Beobachtung die Krankheitsbilder schuf und anderseits beim Typus wie bei der forme fruste die gleiche anatomische Veränderung als Grundlage des Leidens nachwies. Es ist allgemein bekannt, welche Erfolge diese anatomisch-klinische Methode Charcots auf dem Gebiete der organischen Nervenkrankheiten, der Tabes, multiplen Sklerose, der amyotrophischen Lateralsklerose usw. erzielte. Oft bedurfte es jahrelangen geduldigen Harrens, ehe bei diesen chronischen, nicht direkt zum Tode führenden Affektionen der Nachweis der organischen Veränderung gelang, und nur ein Siechenhaus, wie die Salpêtrière, konnte gestatten, die Kranken durch so lange Zeiträume zu verfolgen und zu erhalten. Die erste Feststellung dieser Art machte Charcot übrigens, ehe er über eine Abteilung verfügen konnte. Der Zufall führte ihm während seiner Studienzeit eine Bedienerin zu, die an einem eigentümlichen Zittern litt und wegen ihrer Ungeschicklichkeit keine Stelle bekommen konnte. Charcot erkannte ihren Zustand als die von Duchenne bereits beschriebene paralysie choréiforme, von der aber nicht bekannt war, worauf sie beruhe. Er behielt die interessante Bedienerin, obwohl sie im Laufe der Jahre ein kleines Vermögen an Schüsseln und Tellern kostete, und als sie endlich starb, konnte er an ihr nachweisen, daß die paralysie choréiforme der klinische Ausdruck der multiplen cerebrospinalen Sklerose sei.
Die pathologische Anatomie hat für die Neuropathologie zweierlei zu leisten: neben dem Nachweis der krankhaften Veränderung die Feststellung von deren Lokalisation, und wir alle wissen, daß in den letzten beiden Dezennien der zweite Teil der Aufgabe das größere Interesse gefunden und die größere Förderung erfahren hat. Charcot hat auch an diesem Werke in hervorragendster Weise mitgearbeitet, wenngleich die bahnbrechenden Funde nicht von ihm herrühren. Er folgte zunächst den Spuren unseres Landsmannes Türck, der, wie es heißt, ziemlich einsam in unserer Mitte gelebt und geforscht hat, und als dann die beiden großen Neuerungen kamen, die eine neue Epoche für unsere Kenntnis der „Lokalisation der Nervenkrankheiten“ einleiteten, die Reizungsversuche von Hitzig-Fritsch und die Markentwicklungsbefunde von Flechsig, hat er in seinen Vorlesungen über die Lokalisation das Meiste und das Beste dazu getan, die neuen Lehren mit der Klinik zu vereinigen und für sie fruchtbar zu machen. Was speziell die Beziehung der Körpermuskulatur zur motorischen Zone des menschlichen Großhirns betrifft, so erinnere ich daran, wie lange die genauere Art und Topik dieser Beziehung in Frage stand (gemeinsame Vertretung beider Extremitäten an denselben Stellen – Vertretung der oberen Extremität in der vorderen, der unteren in der hinteren Zentralwindung, also vertikale Gliederung), bis endlich fortgesetzte klinische Beobachtungen und Reiz- wie Exstirpationsversuche am lebenden Menschen bei Gelegenheit chirurgischer Eingriffe zugunsten der Ansicht von Charcot und Pitres entschieden, daß das mittlere Drittel der Zentralwindungen vorwiegend der Armvertretung, das obere Drittel und der mediale Anteil der Beinvertretung diene, daß also eine horizontale Gliederung in der motorischen Region durchgeführt sei.
Es würde nicht gelingen, die Bedeutung Charcots für die Neuropathologie durch die Aufzählung einzelner Leistungen zu erweisen, denn es hat in den letzten zwei Dezennien überhaupt nicht viele Themata von einigem Belang gegeben, an deren Aufstellung und Diskussion die Schule der Salpêtrière nicht einen hervorragenden Anteil genommen hätte. „Die Schule der Salpêtrière“, das war natürlich Charcot selbst, der mit dem Reichtume seiner Erfahrung, der durchsichtigen Klarheit seiner Diktion und der Plastik seiner Schilderungen unschwer in jeder Schülerarbeit zu erkennen war. Aus dem Kreise von jungen Männern, die er so an sich heranzog und zu Teilnehmern seiner Forschungen machte, erhoben sich dann einzelne zum Bewußtsein ihrer Individualität, gewannen für sich selbst einen glänzenden Namen, und hie und da kam es auch vor, daß einer mit einer Behauptung hervortrat, die dem Meister mehr geistreich als richtig erschien und die er in Gesprächen und Vorlesungen sarkastisch genug bekämpfte, ohne daß das Verhältnis zu dem geliebten Schüler darunter litt. Tatsächlich hinterläßt Charcot eine Schar von Schülern, deren geistige Qualität und bisherige Leistungen eine Bürgschaft bieten, daß die Pflege der Neuropathologie in Paris nicht so bald von der Höhe heruntergleiten wird, zu der Charcot sie geführt hat.
Wir haben in Wien wiederholt die Erfahrung machen können, daß die geistige Bedeutung eines akademischen Lehrers nicht ohneweiters mit jener direkten persönlichen Beeinflussung der Jugend vereinigt sein muß, die sich in der Schöpfung einer zahlreichen und bedeutsamen Schule äußert. Wenn Charcot in diesem Punkte so viel glücklicher war, so mußte man dies den persönlichen Eigenschaften des Mannes zuschreiben, dem Zauber, der von seiner Erscheinung und Stimme ausging, der liebenswürdigen Offenheit, die sein Benehmen auszeichnete, sobald einmal die gegenseitigen Beziehungen das Stadium der ersten Fremdheit überwunden hatten, der Bereitwilligkeit, mit der er seinen Schülern alles zur Verfügung stellte, und der Treue, die er ihnen durch das Leben hielt. Die Stunden, die er auf seinen Krankenzimmern verbrachte, waren Stunden des Beisammenseins und des Gedankenaustausches mit seinem gesamten ärztlichen Stab; er schloß sich da niemals ein; der jüngste Externe hatte Gelegenheit, ihn bei der Arbeit zu sehen und durfte ihn in dieser Arbeit stören, und dieselbe Freiheit genossen die Fremden, die in späteren Jahren niemals bei seiner Visite fehlten. Endlich, wenn am Abend Madame Charcot ihr gastliches Haus einer auserlesenen Gesellschaft öffnete, unterstützt von einer hochbegabten, in der Ähnlichkeit des Vaters aufblühenden Tochter, so standen die nie fehlenden Schüler und ärztlichen Gehilfen ihres Mannes als ein Teil der Familie den Gästen gegenüber.
Das Jahr 1882 oder 83 brachte die endgültige Gestaltung in Charcots Lebens- und Arbeitsbedingungen. Man war zur Einsicht gekommen, daß das Wirken dieses Mannes einen Teil des Besitzstandes der nationalen Glorie bilde, der nach dem unglücklichen Kriege von 1870/71 um so eifersüchtiger behütet wurde. Die Regierung, an deren Spitze Charcots alter Freund Gambetta stand, schuf für ihn einen Lehrstuhl für Neuropathologie an der Fakultät, für welchen er der pathologischen Anatomie entsagen konnte, und eine Klinik samt wissenschaftlichen Nebeninstituten in der Salpêtrière. „Le service de M. Charcot“ umfaßte jetzt nebst den früheren mit chronisch Kranken belegten Räumen mehrere klinische Zimmer, in welche auch Männer Aufnahme fanden, eine riesige Ambulanz, die Consultation externe, ein histologisches Laboratorium, ein Museum, eine elektrotherapeutische, eine Augen- und Ohrenabteilung und ein eigenes photographisches Atelier, als ebensoviel Anlässe, um ehemalige Assistenten und Schüler in festen Stellungen dauernd an die Klinik zu binden. Die zwei Stock hohen, verwittert aussehenden Gebäude mit den Höfen, die sie umschlossen, erinnerten den Fremden auffällig an unser Allgemeines Krankenhaus, aber die Ähnlichkeit ging wohl nicht weit genug. „Es ist vielleicht nicht schön hier,“ sagte Charcot, wenn er dem Besucher seinen Besitz zeigte, „aber man findet Platz für alles, was man machen will.“
Charcot stand auf der Höhe des Lebens, als ihm diese Fülle von Lehr- und Forschungsmitteln zur Verfügung gestellt wurde. Er war ein unermüdlicher Arbeiter, ich glaube, immer noch der fleißigste der ganzen Schule. Eine Privatordination, zu der sich die Kranken „aus Samarkand und von den Antillen“ drängten, vermochte es nicht, ihn seiner Lehrtätigkeit oder seinen Forschungen zu entfremden. Sicherlich wandte sich dieser Zulauf von Menschen nicht allein an den berühmten Forscher, sondern ebensosehr an den großen Arzt und Menschenfreund, der immer einen Bescheid zu finden wußte und dort erriet, wo der gegenwärtige Zustand der Wissenschaft ihm nicht gestattete zu wissen. Man hat ihm vielfach seine Therapie zum Vorwurf gemacht, die durch ihren Reichtum an Verschreibungen ein rationalistisches Gewissen beleidigen mußte. Allein er setzte einfach die örtlich und zeitlich gebräuchlichen Methoden fort, ohne sich über deren Wirksamkeit viel zu täuschen. In der therapeutischen Erwartung war er übrigens nicht pessimistisch und hat früher und später die Hand dazu geboten, neue Behandlungsmethoden an seiner Klinik zu versuchen, deren kurzlebiger Erfolg von anderer Seite her seine Aufklärung fand. Als Lehrer war Charcot geradezu fesselnd, jeder seiner Vorträge ein kleines Kunstwerk an Aufbau und Gliederung, formvollendet und in einer Weise eindringlich, daß man den ganzen Tag über das gehörte Wort nicht aus seinem Ohr und das demonstrierte Objekt nicht aus dem Sinne bringen konnte. Er demonstrierte selten einen einzigen Kranken, meist eine Reihe oder Gegenstücke, die er miteinander verglich. Der Saal, in welchem er seine Vorlesungen hielt, war mit einem Bilde geschmückt, welches den „Bürger“ Pinel darstellt, wie er den armen Irrsinnigen der Salpêtrière die Fesseln abnehmen läßt; die Salpêtrière, die während der Revolution so viel Schrecken gesehen, war doch auch die Stätte dieser humansten aller Umwälzungen gewesen. Meister Charcot selbst machte bei einer solchen Vorlesung einen eigentümlichen Eindruck; er, der sonst vor Lebhaftigkeit und Heiterkeit übersprudelte, auf dessen Lippen der Witz nicht erstarb, sah dann unter seinem Samtkäppchen ernst und feierlich, ja eigentlich gealtert aus, seine Stimme klang uns wie gedämpft, und wir konnten etwa verstehen, wieso übelwollende Fremde dazu kamen, der ganzen Vorlesung den Vorwurf des Theatralischen zu machen. Die so sprachen, waren wohl die Formlosigkeit des deutschen klinischen Vortrags gewöhnt oder vergaßen, daß Charcot nur eine Vorlesung in der Woche hielt, die er also sorgfältig vorbereiten konnte.
Folgte Charcot mit dieser feierlichen Vorlesung, in der alles vorbereitet war und alles eintreffen mußte, wahrscheinlich einer eingewurzelten Tradition, so empfand er doch auch das Bedürfnis, seinen Hörern ein minder verkünsteltes Bild seiner Tätigkeit zu geben. Dazu diente ihm die Ambulanz der Klinik, die er in den sogenannten Leçons du Mardi persönlich erledigte. Da nahm er ihm völlig unbekannte Fälle vor, setzte sich allen Wechselfällen des Examens, allen Irrwegen einer ersten Untersuchung aus, warf seine Autorität von sich, um gelegentlich einzugestehen, daß dieser Fall keine Diagnose zulasse, daß in jenem ihn der Anschein getäuscht habe, und niemals erschien er seinen Hörern größer, als nachdem er sich so bemüht hatte, durch die eingehendste Rechenschaft über seine Gedankengänge, durch die größte Offenheit in seinen Zweifeln und Bedenken die Kluft zwischen Lehrer und Schülern zu verringern. Die Veröffentlichung dieser improvisierten Vorträge aus den Jahren 1887 und 1888, zunächst in französischer, gegenwärtig auch in deutscher Sprache, hat auch den Kreis seiner Bewunderer ins Ungemessene erweitert, und niemals hat ein neuropathologisches Werk einen ähnlichen Erfolg im ärztlichen Publikum erzielt wie dieses.
Ungefähr gleichzeitig mit der Errichtung der Klinik und dem Zurücktreten der pathologischen Anatomie vollzog sich eine Wandlung in Charcots wissenschaftlichen Neigungen, der wir die schönsten seiner Arbeiten danken. Er erklärte nun, die Lehre von den organischen Nervenkrankheiten sei vorderhand ziemlich abgeschlossen, und begann sein Interesse fast ausschließlich der Hysterie zuzuwenden, die so mit einem Schlage in den Brennpunkt der allgemeinen Aufmerksamkeit gelangte. Diese rätselhafteste aller Nervenkrankheiten, für deren Beurteilung die Ärzte noch keinen tauglichen Gesichtspunkt gefunden hatten, war gerade damals recht in Mißkredit geraten, der sich sowohl auf die Kranken als auf die Ärzte erstreckte, die sich mit der Neurose beschäftigten. Es hieß, bei der Hysterie ist alles möglich, und den Hysterischen wollte man nichts glauben. Die Arbeit Charcots gab dem Thema zunächst seine Würde wieder; man gewöhnte sich allmählich das höhnische Lächeln ab, auf das die Kranke damals sicher rechnen konnte; sie mußte nicht mehr eine Simulantin sein, da Charcot mit seiner vollen Autorität für die Echtheit und Objektivität der hysterischen Phänomene eintrat. Charcot hatte im kleinen die Tat der Befreiung wiederholt, wegen welcher das Bild Pinels den Hörsaal der Salpêtrière zierte. Nachdem man nun der blinden Furcht entsagt hatte, von den armen Kranken genarrt zu werden, welche einer ernsthaften Beschäftigung mit der Neurose bisher im Wege gestanden war, konnte es sich fragen, welche Art der Bearbeitung auf dem kürzesten Wege zur Lösung des Problems führen würde. Für einen ganz unbefangenen Beobachter hätte sich folgende Anknüpfung dargeboten: Wenn ich einen Menschen in einem Zustande finde, der alle Zeichen eines schmerzhaften Affekts an sich trägt, im Weinen, Schreien, Toben, so liegt mir der Schluß nahe, einen seelischen Vorgang in diesem Menschen zu vermuten, dessen berechtigte Äußerung jene körperlichen Phänomene sind. Der Gesunde wäre dann imstande mitzuteilen, welcher Eindruck ihn peinigt, der Hysterische würde antworten, er wisse es nicht, und das Problem wäre sofort gegeben, woher es komme, daß der Hysterische einem Affekt unterliegt, von dessen Veranlassung er nichts zu wissen behauptet. Hält man nun an seinem Schlusse fest, daß ein entsprechender psychischer Vorgang vorhanden sein müsse, und schenkt dabei doch der Behauptung des Kranken Glauben, der denselben verleugnet, sammelt man die vielfachen Anzeichen, aus denen hervorgeht, daß der Kranke sich so benimmt, als wüßte er doch darum, forscht man in der Lebensgeschichte des Kranken nach und findet in derselben einen Anlaß, ein Trauma, welches geeignet ist, gerade solche Affektäußerungen zu erzeugen, so drängt dies alles zur Lösung, daß der Kranke sich in einem besonderen Seelenzustande befinde, in dem das Band des Zusammenhanges nicht mehr alle Eindrücke oder Erinnerungen an solche umschlinge, in dem es einer Erinnerung möglich sei, ihren Affekt durch körperliche Phänomene zu äußern, ohne daß die Gruppe der anderen seelischen Vorgänge, das Ich, darum wisse oder hindernd eingreifen könne, und die Erinnerung an die allbekannte psychologische Verschiedenheit von Schlaf und Wachen hätte das Fremdartige dieser Annahme verringern können. Man wende nicht ein, daß die Theorie einer Spaltung des Bewußtseins als Lösung des Rätsels der Hysterie viel zu ferne liegt, als daß sie sich dem unbefangenen und ungeschulten Beobachter aufdrängen könnte. Tatsächlich hatte das Mittelalter doch diese Lösung gewählt, indem es die Besessenheit durch einen Dämon für die Ursache der hysterischen Phänomene erklärte; es hätte sich nur darum gehandelt, für die religiöse Terminologie jener dunkeln und abergläubischen Zeit die wissenschaftliche der Gegenwart einzusetzen.
Charcot betrat nicht diesen Weg zur Aufklärung der Hysterie, obwohl er aus den erhaltenen Berichten der Hexenprozesse und der Besessenheit reichlich schöpfte, um zu erweisen, daß die Erscheinungen der Neurose damals dieselben gewesen seien wie heute. Er behandelte die Hysterie wie ein anderes Thema der Neuropathologie, gab die vollständige Beschreibung ihrer Erscheinungen, wies Gesetz und Regel in denselben nach, lehrte die Symptome kennen, welche eine Diagnose der Hysterie ermöglichen. Die sorgfältigsten Untersuchungen, die von ihm und seinen Schülern ausgingen, verbreiteten sich über die Sensibilitätsstörungen der Hysterie an der Haut und den tiefen Teilen, das Verhalten der Sinnesorgane, die Eigentümlichkeiten der hysterischen Kontrakturen und Lähmungen, der trophischen Störungen und der Veränderungen des Stoffwechsels. Die mannigfachen Formen des hysterischen Anfalls wurden beschrieben, ein Schema aufgestellt, welches die typische Gestaltung des großen hysterischen Anfalls in vier Stadien schilderte und die Zurückführung der gemeinhin beobachteten „kleinen“ Anfälle auf den Typus gestattete, ebenso die Lage und Häufigkeit der sogenannten hysterogenen Zonen, deren Beziehung zu den Anfällen studiert usw. Mit all diesen Kenntnissen über die Erscheinung der Hysterie ausgestattet, machte man nun eine Reihe überraschender Entdeckungen; man fand die Hysterie beim männlichen Geschlechte und besonders bei den Männern der Arbeiterklasse mit einer Häufigkeit, die man nicht vermutet hatte, man überzeugte sich, daß gewisse Zufälle, die man der Alkohol-, der Blei-Intoxikation zugeschrieben hatte, der Hysterie angehörten, man war imstande, eine ganze Anzahl von bisher unverstanden und isoliert dastehenden Affektionen unter die Hysterie zu subsumieren und den Anteil der Hysterie auszuscheiden, wo sich die Neurose mit anderen Affektionen zu komplexen Bildern vereinigt hatte. Am weittragendsten waren wohl die Forschungen über die Nervenerkrankungen nach schweren Traumen, die „traumatischen Neurosen“, deren Auffassung jetzt noch in Diskussion steht, und bei welchen Charcot das Recht der Hysterie erfolgreich vertreten hat.
Nachdem die letzten Ausdehnungen des Begriffes der Hysterie so häufig zur Verwerfung ätiologischer Diagnosen geführt hatten, ergab sich die Notwendigkeit, auf die Ätiologie der Hysterie einzugehen. Charcot stellte eine einfache Formel für diese auf: als einzige Ursache hat die Heredität zu gelten, die Hysterie ist demnach eine Form der Entartung, ein Mitglied der famille névropathique; alle anderen ätiologischen Momente spielen die Rolle von Gelegenheitsursachen, von agents provocateurs.
Der Aufbau dieses großen Gebäudes fand natürlich nicht ohne heftigen Widerspruch statt, allein es war der unfruchtbare Widerspruch einer alten Generation, die ihre Anschauungen nicht verändert wissen wollte; die Jüngeren unter den Neuropathologen, auch Deutschlands, nahmen Charcots Lehren in größerem oder geringerem Ausmaße an. Charcot selbst war des Sieges seiner Lehren von der Hysterie vollkommen sicher; wollte man ihm einwenden, daß die vier Stadien des Anfalls, die Hysterie bei Männern usw., anderswo als in Frankreich nicht zu beobachten seien, so wies er darauf hin, wie lange er diese Dinge selbst übersehen habe, und wiederholte, die Hysterie sei allerorten und zu allen Zeiten die nämliche. Gegen den Vorwurf, daß die Franzosen eine weit nervösere Nation seien als andere, die Hysterie gleichsam eine nationale Unart, war er sehr empfindlich und konnte sich sehr freuen, wenn eine Publikation „über einen Fall von Reflexepilepsie“ bei einem preußischen Grenadier ihm auf Distanz die Diagnose der Hysterie ermöglichte.
An einer Stelle seiner Arbeit ging Charcot noch über das Niveau seiner sonstigen Behandlung der Hysterie hinaus und tat einen Schritt, der ihm für alle Zeiten auch den Ruhm des ersten Erklärers der Hysterie sichert. Mit dem Studium der hysterischen Lähmungen beschäftigt, die nach Traumen entstehen, kam er auf den Einfall, diese Lähmungen, die er vorher sorgfältig von den organischen differenziert hatte, künstlich zu reproduzieren, und bediente sich hiezu hysterischer Patienten, die er durch Hypnotisieren in den Zustand des Somnambulismus versetzte. Es gelang ihm durch lückenlose Schlußfolge nachzuweisen, daß diese Lähmungen Erfolge von Vorstellungen seien, die in Momenten besonderer Disposition das Gehirn des Kranken beherrscht hatten. Damit war zum ersten Male der Mechanismus eines hysterischen Phänomens aufgeklärt, und an dieses unvergleichlich schöne Stück klinischer Forschung knüpfte dann sein eigener Schüler P. Janet, knüpften Breuer u. a. an, um eine Theorie der Neurose zu entwerfen, welche sich mit der Auffassung des Mittelalters deckt, nachdem sie den „Dämon“ der priesterlichen Phantasie durch eine psychologische Formel ersetzt hat.
Charcots Beschäftigung mit den hypnotischen Phänomenen bei Hysterischen gereichte diesem bedeutungsvollen Gebiet von bisher vernachlässigten und verachteten Tatsachen zur größten Förderung, indem das Gewicht seines Namens dem Zweifel an der Realität der hypnotischen Erscheinungen ein für allemal ein Ende machte. Allein der rein psychologische Gegenstand vertrug die ausschließlich nosographische Behandlung nicht, die er bei der Schule der Salpêtrière fand. Die Beschränkung des Studiums der Hypnose auf die Hysterischen, die Unterscheidung von großem und kleinem Hypnotismus, die Aufstellung dreier Stadien der „großen Hypnose“ und deren Kennzeichnung durch somatische Phänomene, dies alles unterlag in der Schätzung der Zeitgenossen, als Liébaults Schüler Bernheim es unternahm, die Lehre vom Hypnotismus auf einer umfassenderen psychologischen Grundlage aufzubauen und die Suggestion zum Kernpunkt der Hypnose zu machen. Nur die Gegner des Hypnotismus, die sich damit zufrieden geben, ihren Mangel an eigener Erfahrung durch Berufung auf eine Autorität zu verdecken, halten noch an den Aufstellungen Charcots fest und lieben es, eine aus seinen letzten Jahren stammende Äußerung zu verwerten, die der Hypnose eine jede Bedeutung als Heilmittel abspricht.
Auch an den ätiologischen Theorien, die Charcot in seiner Lehre von der famille névropathique vertrat, und die er zur Grundlage seiner gesamten Auffassung der Nervenkrankheiten gemacht hatte, wird wohl bald zu rütteln und zu korrigieren sein. Charcot überschätzte die Heredität als Ursache so sehr, daß kein Raum für die Erwerbung von Neuropathien übrig blieb, er wies der Syphilis nur einen bescheidenen Platz unter den agents provocateurs an, und er trennte weder für die Ätiologie, noch sonst hinreichend scharf die organischen Nervenaffektionen von den Neurosen. Es ist unausbleiblich, daß der Fortschritt unserer Wissenschaft, indem er unsere Kenntnisse vermehrt, auch manches von dem entwertet, was uns Charcot gelehrt hat, aber kein Wechsel der Zeiten oder der Meinungen wird den Nachruhm des Mannes zu schmälern vermögen, um den wir jetzt – in Frankreich und anderwärts – alle trauern.
Wien, im August 1893.
[Hauptteil]
QUELQUES CONSIDÉRATIONS POUR UNE ÉTUDE COMPARATIVE DES PARALYSIES MOTRICES ORGANIQUES ET HYSTÉRIQUES[1]
M. Charcot, dont j’ ai été l’ élève en 1885 et 1886, a bien voulu, à cette époque, me confier le soin de faire une étude comparative des paralysies motrices organiques et hystériques, basée sur les observations de la Salpêtrière, qui pourrait servir à saisir quelques caractères généraux de la névrose et conduire à une conception sur la nature de cette dernière. Des causes accidentelles et personnelles m’ ont empêché pendant longtemps d’ obéir à son inspiration; aussi je ne veux apporter maintenant que quelques résultats de mes recherches, laissant de côté les détails nécessaires pour une démonstration complète de mes opinions.
I
Il faudra commencer par quelques remarques sur les paralysies motrices organiques, d’ ailleurs généralement admises. La clinique nerveuse reconnaît deux sortes de paralysies motrices, la paralysie périphéro-spinale (ou bulbaire) et la paralysie cérébrale. Cette distinction est parfaitement en accord avec les données de l’ anatomie du système nerveux qui nous montrent qu’ il n’ y a que deux segments sur le parcours des fibres motrices conductrices, le premier qui va de la périphérie jusqu’ aux cellules des cornes antérieures dans la moelle, et le second qui va de là jusqu’ à l’ écorce cérébrale. La nouvelle histologie du système nerveux, fondée sur les travaux de Golgi, Ramón y Cajal, Kölliker etc., traduit ce fait par les mots: „le trajet des fibres de conduction motrices est constitué par deux neurones (unités nerveuses cellulofibrillaires), qui se rencontrent pour entrer en relation au niveau des cellules dites motrices des cornes antérieures.“ La différence essentielle de ces deux sortes de paralysies, en clinique, est la suivante: La paralysie périphéro-spinale est une paralysie détaillée, la paralysie cérébrale est une paralysie en masse. Le type de la première est la paralysie faciale dans la maladie de Bell, la paralysie dans la poliomyélite aiguë de l’ enfance, etc. Or, dans ces affections, chaque muscle, on pourrait dire chaque fibre musculaire, peut être paralysée individuellement et isolément. Cela ne dépend que du siège et de l’ étendue de la lésion nerveuse, et il n’ y a pas de règle fixe pour que l’ un des éléments périphériques échappe à la paralysie, tandis que l’ autre en souffre d’ une manière constante.
La paralysie cérébrale, au contraire, est toujours une affection qui attaque une grande partie de la périphérie, une extrémité, un segment de celle-ci, un appareil moteur compliqué. Jamais elle n’ affecte un muscle individuellement, par exemple le biceps du bras, le tibial isolément, etc., et s’ il y a des exceptions apparentes à cette règle (le ptosis cortical, par exemple), on voit bien qu’ il s’ agit de muscles qui, à eux seuls, remplissent une fonction de laquelle ils sont l’ instrument unique.
Dans les paralysies cérébrales des extrémités, on peut remarquer que les segments périphériques souffrent toujours plus que les segments rapprochés du centre; la main, par exemple, est plus paralysée que l’ épaule. Il n’ y a pas, que je sache, une paralysie cérébrale isolée de l’ épaule, la main conservant sa motilité, tandis que le contraire est la règle dans les paralysies qui ne sont pas complètes.
Dans une étude critique sur l’ aphasie, publiée en 1891, Zur Auffassung der Aphasien, Wien, 1891, j’ ai tâché de montrer que la cause de cette différence importante entre la paralysie périphérospinale et la paralysie cérébrale doit être cherchée dans la structure du système nerveux. Chaque élément de la périphérie correspond à un élément dans l’ axe gris, qui est, comme le dit M. Charcot, son aboutissant nerveux; la périphérie est pour ainsi dire projetée sur la substance grise de la moelle, point pour point, élément pour élément. J’ ai proposé de dénommer la paralysie détaillée périphéro-spinale, paralysie de projection. Mais il n’ en est pas de même pour les relations entre les éléments de la moelle et ceux de l’ écorce. Le nombre des fibres conductrices ne suffirait plus pour donner une seconde projection de la périphérie sur l’ écorce. Il faut supposer que les fibres qui vont de la moelle à l’ écorce ne représentent plus chacune un seul élément périphérique, mais plutôt un groupe de ceux-ci et que même, d’ autre part, un élément périphérique peut correspondre à plusieurs fibres conductrices spino-corticales. C’ est qu’ il y a un changement d’ arrangement qui a eu lieu au point de connexion entre les deux segments du système moteur.