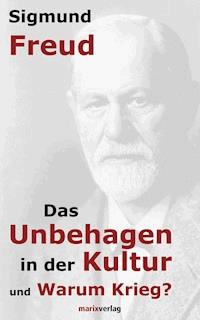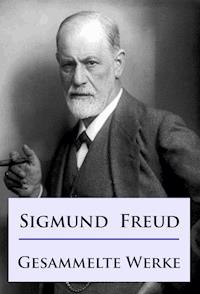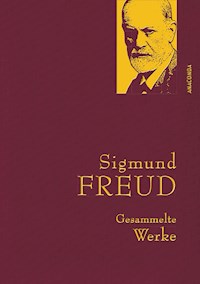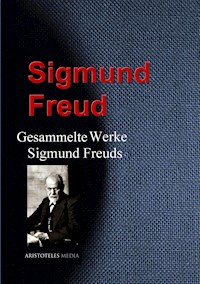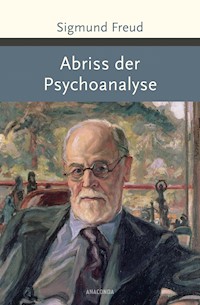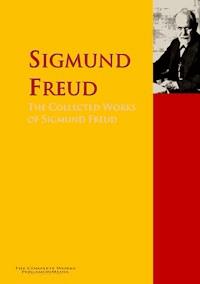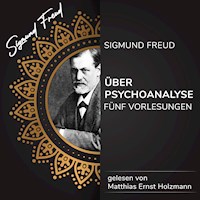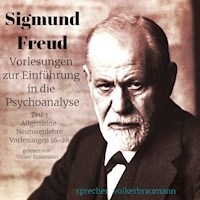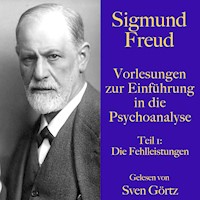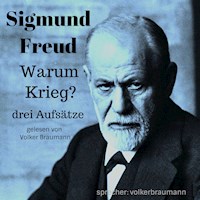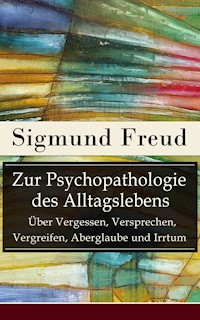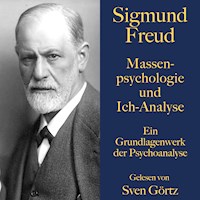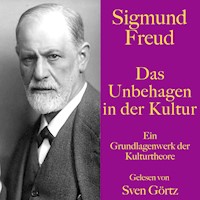79,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Gesammelte Werke in 18 Bänden mit einem Nachtragsband
- Sprache: Deutsch
Gesammelte Werke in Einzelbänden, Band VII Tatbestandsdiagnostik und Psychoanalyse Zur sexuellen Aufklärung der Kinder Zwangshandlungen und Religionsübungen Die ›kulturelle‹ Sexualmoral und die moderne Nervosität Über infantile Sexualtheorien Charakter und Analerotik Der Dichter und das Phantasieren Allgemeines über den hysterischen Anfall Analyse und Phobie eines fünfjährigen Knaben Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneurose
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 645
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Sigmund Freud
Band 7:Werke aus den Jahren 1906-1909
Über dieses Buch
Gesammelte Werke in Einzelbänden, Band VII
Tatbestandsdiagnostik und Psychoanalyse
Zur sexuellen Aufklärung der Kinder
Zwangshandlungen und Religionsübungen
Die ›kulturelle‹ Sexualmoral und die moderne Nervosität
Über infantile Sexualtheorien
Charakter und Analerotik
Der Dichter und das Phantasieren
Allgemeines über den hysterischen Anfall
Analyse und Phobie eines fünfjährigen Knaben
Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneurose
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
© 1941 by Imago Publishing Co., Ltd., London
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung, vorbehalten durch S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main
Digitalisierung: pagina GmbH, Tübingen
Hinweise zur Zitierfähigkeit dieser Ausgabe:
Textgrundlage dieser Ausgabe ist: Sigmund Freud, Gesammelte Werke. Bd. 7, Werke aus den Jahren 1906-1909.
Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag, 1993. 7. Auflage.
Die grauen Zahlen in geschweiften Klammern markieren jeweils den Beginn einer neuen, entsprechend paginierten Seite in der genannten Buchausgabe. Die Seitenzahlen im Register beziehen sich ebenfalls auf diese Ausgabe.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-400157-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
TATBESTANDSDIAGNOSTIK UND PSYCHOANALYSE
TATBESTANDSDIAGNOSTIK UND PSYCHOANALYSE
ZUR SEXUELLEN AUFKLÄRUNG DER KINDER
ZUR SEXUELLEN AUFKLÄRUNG DER KINDER
DER WAHN UND DIE TRÄUME IN W. JENSENS »GRADIVA«
I
II
III
IV
NACHTRAG
ZWANGSHANDLUNGEN UND RELIGIONSÜBUNGEN
ZWANGSHANDLUNGEN UND RELIGIONSÜBUNGEN
DIE „KULTURELLE“ SEXUALMORAL UND DIE MODERNE NERVOSITÄT
DIE »KULTURELLE« SEXUALMORAL UND DIE MODERNE NERVOSITÄT
ÜBER INFANTILE SEXUALTHEORIEN
ÜBER INFANTILE SEXUALTHEORIEN
HYSTERISCHE PHANTASIEN UND IHRE BEZIEHUNG ZUR BISEXUALITÄT
HYSTERISCHE PHANTASIEN UND IHRE BEZIEHUNG ZUR BISEXUALITÄT
CHARAKTER UND ANALEROTIK
CHARAKTER UND ANALEROTIK
DER DICHTER UND DAS PHANTASIEREN
DER DICHTER UND DAS PHANTASIEREN
DER FAMILIENROMAN DER NEUROTIKER
DER FAMILIENROMAN DER NEUROTIKER
ALLGEMEINES ÜBER DEN HYSTERISCHEN ANFALL
ALLGEMEINES ÜBER DEN HYSTERISCHEN ANFALL
A
B
C
D
ANALYSE DER PHOBIE EINES FÜNFJÄHRIGEN KNABEN
I EINLEITUNG
II KRANKENGESCHICHTE UND ANALYSE
III EPIKRISE
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
BEMERKUNGEN ÜBER EINEN FALL VON ZWANGSNEUROSE
I AUS DER KRANKENGESCHICHTE
II ZUR THEORIE
VORREDEN
VORWORT
VORWORT
BIBLIOGRAPHISCHE ANMERKUNG
INDEX
TATBESTANDSDIAGNOSTIK UND PSYCHOANALYSE
TATBESTANDSDIAGNOSTIK UND PSYCHOANALYSE
Meine Herren! Die wachsende Einsicht in die Unzuverlässigkeit der Zeugenaussage, welche doch gegenwärtig die Grundlage so vieler Verurteilungen in Streitfällen bildet, hat bei Ihnen allen, künftigen Richtern und Verteidigern, das Interesse für ein neues Untersuchungsverfahren gesteigert, welches den Angeklagten selbst nötigen soll, seine Schuld oder Unschuld durch objektive Zeichen zu erweisen. Dieses Verfahren besteht in einem psychologischen Experimente und ist auf psychologische Arbeiten begründet; es hängt innig mit gewissen Anschauungen zusammen, die in der medizinischen Psychologie erst kürzlich zur Geltung gekommen sind. Ich weiß, daß Sie damit beschäftigt sind, die Handhabung und Tragweite dieser neuen Methode zunächst in Versuchen, die man „Phantomübungen“ nennen könnte, zu prüfen, und bin bereitwillig der Aufforderung Ihres Vorsitzenden, Prof. Löffler, gefolgt, Ihnen die Beziehungen dieses Verfahrens zur Psychologie ausführlicher auseinanderzusetzen.
Ihnen allen ist das Gesellschafts- und Kinderspiel bekannt, in dem der eine dem anderen ein beliebiges Wort zuruft, zu welchem dieser ein zweites Wort fügen soll, das mit dem ersten ein zusammengesetztes Wort ergibt. Zum Beispiel Dampf-Schiff; also Dampfschiff. Nichts anderes als eine Modifikation dieses Kinderspieles ist der von der Wundtschen Schule in die Psychologie eingeführte Assoziationsversuch, der bloß auf eine Bedingtheit jenes Spieles verzichtet hat. Er besteht also darin, daß man einer Person ein Wort zuruft, – das Reizwort, – worauf sie möglichst rasch mit einem zweiten Wort antwortet, das ihr dazu einfällt, der sogenannten „Reaktion“, ohne daß sie in der Wahl dieser Reaktion durch irgend etwas beengt worden wäre. Die Zeit, die zur Reaktion verbraucht wird, und das Verhältnis von Reizwort und Reaktion, das sehr mannigfaltig sein kann, sind die Gegenstände der Beobachtung. Man kann nun nicht behaupten, daß bei diesen Versuchen zunächst viel herausgekommen ist. Begreiflich, denn sie waren ohne sichere Fragestellung gemacht, und es fehlte an einer Idee, die auf die Ergebnisse anzuwenden wäre. Sinnvoll und fruchtbar wurden sie erst, als Bleuler in Zürich und seine Schüler, insbesondere Jung, sich mit solchen „Assoziationsexperimenten“ zu beschäftigen begannen. Wert erhielten ihre Versuche aber durch die Voraussetzung, daß die Reaktion auf das Reizwort nichts Zufälliges sein könne, sondern durch einen beim Reagierenden vorhandenen Vorstellungsinhalt determiniert sein müsse.
Man hat sich gewöhnt, einen solchen Vorstellungsinhalt, der imstande ist, die Reaktion auf das Reizwort zu beeinflussen, einen „Komplex“ zu heißen. Die Beeinflussung geht entweder so vor sich, indem das Reizwort den Komplex direkt streift, oder indem es letzterem gelingt, sich durch Mittelglieder mit dem Reizwort in Verbindung zu setzen. Diese Determinierung der Reaktion ist eine sehr merkwürdige Tatsache; Sie können die Verwunderung darüber in der Literatur des Gegenstandes unverhohlen ausgedrückt finden. Aber an ihrer Richtigkeit ist nicht zu zweifeln, denn Sie können in der Regel den beeinflussenden Komplex nachweisen und die sonst unverständlichen Reaktionen aus ihm verstehen, wenn Sie die reagierende Person selbst nach den Gründen ihrer Reaktion befragen. Beispiele wie die auf Seite 6 und 8 bis 9 der Jungschen Abhandlung[1)] sind sehr geeignet, uns am Zufalle und an der angeblichen Willkür im seelischen Geschehen zweifeln zu machen.
Nun werfen Sie mit mir einen Blick auf die Vorgeschichte des Bleuler-Jungschen Gedankens von der Determinierung der Reaktion durch den Komplex bei der examinierten Person. Im Jahre 1901 habe ich in einer Abhandlung[2)] dargetan, daß eine ganze Reihe von Aktionen, die man für unmotiviert hielt, vielmehr strenge determiniert sind und um soviel die psychische Willkür einschränken geholfen. Ich habe die kleinen Fehlleistungen des Vergessens, Versprechens, Verschreibens, Verlegens zum Gegenstande genommen und gezeigt, daß, wenn ein Mensch sich verspricht, nicht der Zufall, auch nicht allein Artikulationsschwierigkeiten und Lautähnlichkeiten dafür verantwortlich zu machen sind, sondern daß jedesmal ein störender Vorstellungsinhalt – Komplex – nachweisbar ist, welcher die intendierte Rede in seinem Sinne, anscheinend zum Fehler, abändert. Ich habe ferner die kleinen, anscheinend absichtslosen und zufälligen Handlungen der Menschen, ihr Tändeln, Spielen usw. in Betracht gezogen und sie als „Symptomhandlungen“ entlarvt, die mit einem verborgenen Sinn in Beziehung stehen und diesem einen unauffälligen Ausdruck verschaffen sollen. Es hat sich mir ferner ergeben, daß man sich nicht einmal einen Vornamen willkürlich einfallen lassen kann, der sich nicht als durch einen mächtigen Vorstellungskomplex bestimmt erwiese; ja, daß Zahlen, die man anscheinend willkürlich wählt, sich auf einen solchen verborgenen Komplex zurückführen lassen. Ein Kollege, Dr. Alfred Adler, hat einige Jahre später diese befremdendste meiner Aufstellungen durch einige schöne Beispiele belegen können.[1)] Hat man sich nun an solche Auffassung der Bedingtheit im psychischen Leben gewöhnt, so ergibt sich als eine berechtigte Ableitung aus den Resultaten der Psychopathologie des Alltagslebens, daß auch die Einfälle der Person beim Assoziationsexperimente nicht willkürlich, sondern durch einen in ihr wirksamen Vorstellungsinhalt bedingt sein mögen.
Nun, meine Herren, kehren wir zum Assoziationsexperimente zurück! In den bisher betrachteten Fällen war es die examinierte Person, die uns über die Herkunft der Reaktionen aufklärte, und diese Bedingung macht den Versuch eigentlich für die Rechtspflege uninteressant. Wie aber, wenn wir die Versuchsanordnungen abändern, etwa wie man eine Gleichung mit mehreren Größen nach der einen oder der anderen auflösen, das a oder das b in ihr zum gesuchten x machen kann? Bisher war uns Prüfern der Komplex unbekannt, wir prüften mit beliebig gewählten Reizworten, und die Versuchsperson denunzierte uns den Komplex, der durch die Reizworte zur Äußerung gebracht worden war. Machen wir es nun anders, nehmen wir einen uns bekannten Komplex her, reagieren auf ihn mit absichtlich gewählten Reizworten, wälzen das x auf die Seite der reagierenden Person, ist es dann möglich, aus dem Ausfalle der Reaktionen zu entscheiden, ob die examinierte Person den gewählten Komplex gleichfalls in sich trägt? Sie sehen ein, diese Versuchsanordnung entspricht genau dem Falle des Untersuchungsrichters, der erfahren möchte, ob ein gewisser ihm bekannter Tatbestand auch dem Angeklagten als Täter bekannt ist. Es scheint, daß Wertheimer und Klein, zwei Schüler des Strafrechtslehrers Hans Groß in Prag, zuerst diese für Sie bedeutsame Abänderung der Versuchsanordnung vorgenommen haben.[2)]
Sie wissen bereits aus Ihren eigenen Versuchen, daß sich bei solcher Fragestellung an den Reaktionen viererlei Anhaltspunkte zur Entscheidung der Frage ergeben, ob die examinierte Person den Komplex besitzt, auf den Sie mit Reizworten reagieren. Ich will Ihnen dieselben der Reihe nach aufzählen: 1) Der ungewöhnliche Inhalt der Reaktion, der ja Aufklärung fordert. 2) Die Verlängerung der Reaktionszeit, indem es sich herausstellt, daß Reizworte, welche den Komplex getroffen haben, erst nach deutlicher Verspätung (oft das Mehrfache der sonstigen Reaktionszeit) mit der Reaktion beantwortet werden. 3) Der Irrtum bei der Reproduktion. Sie wissen, welche merkwürdige Tatsache damit gemeint ist. Wenn man eine kurze Zeit nach dem Abschlusse des Versuches mit einer längeren Reihe von Reizwörtern dieselben dem Examinierten nochmals vorlegt, so wiederholt er die nämlichen Reaktionen wie beim ersten Male. Nur bei denjenigen Reizworten, welche den Komplex direkt getroffen haben, ersetzt er die frühere Reaktion leicht durch eine andere. 4) Die Tatsache der Perseveration (vielleicht sagten wir besser: Nachwirkung). Es kommt nämlich häufig vor, daß die Wirkung der Erweckung des Komplexes durch ein ihn betreffendes („kritisches“) Reizwort, also z. B. die Verlängerung der Reaktionszeit, anhält und noch die Reaktionen auf die nächsten nicht kritischen Worte verändert. Wo nun alle oder mehrere dieser Anzeichen zusammentreffen, da hat sich der uns bekannte Komplex als beim Angerufenen störend vorhanden erwiesen. Sie verstehen diese Störung in der Weise, daß der beim Angerufenen vorhandene Komplex mit Affekt besetzt und befähigt ist, der Aufgabe des Reagierens Aufmerksamkeit zu entziehen, finden also in dieser Störung einen „psychischen Selbstverrat“.
Ich weiß, daß Sie gegenwärtig mit den Chancen und Schwierigkeiten dieses Verfahrens, welches den Beschuldigten zum objektiven Selbstverrat bringen soll, beschäftigt sind, und lenke Ihre Aufmerksamkeit darum auf die Mitteilung, daß ein ganz analoges Aufdeckungsverfahren für verborgenes oder verheimlichtes Seelisches seit länger als einem Dezennium auf einem anderen Gebiete in Übung ist. Es soll meine Aufgabe sein, Ihnen die Ähnlichkeit und die Verschiedenheit der Verhältnisse hier und dort vorzuführen.
Dies Gebiet ist ein von dem Ihrigen wohl recht verschiedenes. Ich meine nämlich die Therapie gewisser „Nervenkrankheiten“, der sogenannten Psychoneurosen, für welche Sie Hysterie und Zwangsvorstellen als Muster nehmen können. Das Verfahren heißt dort Psychoanalyse und ist von mir aus dem zuerst von J. Breuer[1)] in Wien geübten „kathartischen“ Heilverfahren entwickelt worden. Um Ihrer Verwunderung zu begegnen, muß ich eine Analogie zwischen dem Verbrecher und dem Hysteriker durchführen. Bei beiden handelt es sich um ein Geheimnis, um etwas Verborgenes. Aber, um nicht paradox zu werden, muß ich auch gleich den Unterschied hervorheben. Beim Verbrecher handelt es sich um ein Geheimnis, das er weiß und vor Ihnen verbirgt, beim Hysteriker um ein Geheimnis, das auch er selbst nicht weiß, das sich vor ihm selbst verbirgt. Wie ist das möglich? Nun, wir wissen durch mühevolle Erforschungen, daß alle diese Erkrankungen darauf beruhen, daß solche Personen es zustande gebracht haben, gewisse stark affektbesetzte Vorstellungen und Erinnerungen und die auf sie gebauten Wünsche so zu verdrängen, daß sie in ihrem Denken keine Rolle spielen, in ihrem Bewußtsein nicht auftreten und somit ihnen selbst geheim bleiben. Aus diesem verdrängten psychischen Material, aus diesen „Komplexen“, rühren aber die somatischen und psychischen Symptome her, welche ganz nach Art eines bösen Gewissens die Kranken quälen. Der Unterschied zwischen dem Verbrecher und dem Hysteriker ist also in diesem einen Punkte fundamental.
Die Aufgabe des Therapeuten ist aber die nämliche wie die des Untersuchungsrichters; wir sollen das verborgene Psychische aufdecken und haben zu diesem Zwecke eine Reihe von Detektivkünsten erfunden, von denen uns also jetzt die Herren Juristen einige nachahmen werden.
Es wird Sie für Ihre Arbeit interessieren zu hören, in welcher Weise wir Ärzte bei der Psychoanalyse vorgehen. Nachdem der Kranke ein erstes Mal seine Geschichte erzählt hat, fordern wir ihn auf, sich ganz seinen Einfällen zu überlassen und ohne jeden kritischen Rückhalt vorzubringen, was ihm in den Sinn kommt. Wir gehen also von der Voraussetzung aus, die er gar nicht teilt, daß diese Einfälle nicht willkürliche, sondern durch die Beziehung zu seinem Geheimnisse, seinem „Komplex“, bestimmt sein werden, sozusagen als Abkömmlinge dieses Komplexes aufgefaßt werden können. Sie sehen, es ist die nämliche Voraussetzung, mit deren Hilfe Sie die Assoziationsexperimente deutbar gefunden haben. Der Kranke aber, dem man die Befolgung der Regel aufträgt, alle seine Einfälle mitzuteilen, scheint nicht imstande zu sein, dies zu tun. Er hält doch bald diesen, bald jenen Einfall zurück und bedient sich dabei verschiedener Motivierungen, entweder: das sei ganz unwichtig, oder: es gehört nicht dazu, oder: es sei überhaupt ganz sinnlos. Wir verlangen dann, daß er den Einfall trotz dieser Einwendungen mitteile und verfolge; denn gerade die sich geltend machende Kritik ist uns ein Beweis für die Zugehörigkeit des Einfalles zum „Komplex“, den wir aufzudecken suchen. In solchem Verhalten der Kranken erblicken wir eine Äußerung des in ihm vorhandenen „Widerstandes“, der uns während der ganzen Dauer der Behandlung nicht verläßt. Ich will nur kurz andeuten, daß der Begriff des Widerstandes für unser Verständnis der Krankheitsgenese wie des Heilungsmechanismus die größte Bedeutung gewonnen hat.
Eine derartige Kritik der Einfälle beobachten Sie nun bei Ihren Versuchen nicht direkt; dafür sind wir bei der Psychoanalyse in der Lage, alle Ihnen auffälligen Zeichen eines Komplexes zu beobachten. Wenn der Kranke es nicht mehr wagt, die ihm gegebene Regel zu verletzen, so merken wir doch, daß er zeitweilig in der Reproduktion der Einfälle stockt, zögert, Pausen macht. Jede solche Zögerung ist uns eine Äußerung des Widerstandes und dient uns als Zeichen der Zugehörigkeit zum „Komplex“. Ja, sie ist uns das wichtigste Anzeichen solcher Bedeutung, ganz wie Ihnen die analoge Verlängerung der Reaktionszeit. Wir sind gewöhnt, die Zögerung in diesem Sinne zu deuten, auch wenn der Inhalt des zurückgehaltenen Einfalles gar keinen Anstoß zu bieten scheint, wenn der Kranke versichert, er könne sich gar nicht denken, warum er zögern sollte, ihn mitzuteilen. Die Pausen, die in der Psychoanalyse vorkommen, sind in der Regel vielmals größer als die Verspätungen, die Sie bei den Reaktionsversuchen notieren.
Auch das andere Ihrer Komplexanzeichen, die inhaltliche Veränderung der Reaktion, spielt seine Rolle in der Technik der Psychoanalyse. Wir pflegen selbst leise Abweichungen von der gebräuchlichen Ausdrucksweise bei unserem Kranken ganz allgemein als Anzeichen für einen verborgenen Sinn anzusehen und setzen uns selbst mit solchen Deutungen gerne für eine Weile seinem Spotte aus. Wir lauern bei ihm geradezu auf Reden, die ins Zweideutige schillern, und bei denen der verborgene Sinn durch den harmlosen Ausdruck hindurchschimmert. Nicht nur der Kranke, auch Kollegen, die der psychoanalytischen Technik und ihrer besonderen Verhältnisse unkundig sind, versagen uns da ihren Glauben und werfen uns Witzelei und Wortklauberei vor, aber wir behalten fast immer Recht. Es ist schließlich nicht schwer zu verstehen, daß ein sorgfältig gehütetes Geheimnis sich nur durch feine, höchstens durch zweideutige Andeutungen verrät. Der Kranke gewöhnt sich schließlich daran, uns in sogenannter „indirekter Darstellung“ all das zu geben, was wir zur Aufdeckung des Komplexes benötigen.
Auf einem beschränkteren Gebiet verwerten wir in der Technik der Psychoanalyse das dritte Ihrer Komplexanzeichen, den Irrtum, d. h. die Abänderung bei der Reproduktion. Eine Aufgabe, die uns häufig gestellt wird, ist die Deutung von Träumen, das ist die Übersetzung des erinnerten Trauminhaltes in dessen verborgenen Sinn. Es kommt dabei vor, daß wir unschlüssig sind, an welcher Stelle wir die Aufgabe anfassen sollen, und in diesem Falle können wir uns einer empirisch gefundenen Regel bedienen, welche uns rät, die Traumerzählung wiederholen zu lassen. Der Träumer verändert dabei gewöhnlich seine Ausdrucksweise an manchen Stellen, während er sich an anderen getreulich wiederholt. Wir aber klammern uns an die Stellen, in denen die Reproduktion durch Abänderung, oft auch durch Auslassung, fehlerhaft ist, weil uns diese Untreue die Zugehörigkeit zum Komplex verbürgt und den besten Zugang zum geheimen Sinn des Traumes verspricht.[1)]
Sie sollen nun nicht den Eindruck empfangen, als hätte die von mir verfolgte Übereinstimmung ein Ende gefunden, wenn ich Ihnen gestehe, daß ein der „Perseveration“ ähnliches Phänomen in der Psychoanalyse nicht zum Vorschein kommt. Dieser scheinbare Unterschied rührt nur von den besonderen Bedingungen Ihrer Experimente her. Sie lassen ja der Komplexwirkung eigentlich keine Zeit sich zu entwickeln; kaum daß sie begonnen hat, rufen Sie die Aufmerksamkeit des Examinierten durch ein neues, wahrscheinlich harmloses Reizwort wieder ab und dann können Sie beobachten, daß die Versuchsperson manchmal trotz Ihrer Störungen bei der Beschäftigung mit dem Komplex verharrt. Wir aber vermeiden solche Störungen in der Psychoanalyse, wir erhalten den Kranken bei seiner Beschäftigung mit dem Komplex, und weil bei uns sozusagen alles Perseveration ist, können wir dies Phänomen nicht als vereinzeltes Vorkommnis beobachten.
Wir dürfen die Behauptung aufstellen, daß es uns durch Techniken wie die mitgeteilten prinzipiell gelingt, dem Kranken das Verdrängte, sein Geheimnis, bewußt zu machen und dadurch die psychologische Bedingtheit seiner Leidenssymptome aufzuheben. Ehe Sie nun aus diesem Erfolge Schlüsse auf die Chancen Ihrer Arbeiten ziehen, wollen wir die Unterschiede in der psychologischen Situation hier und dort beleuchten.
Den Hauptunterschied haben wir schon genannt: Beim Neurotiker Geheimnis vor seinem eigenen Bewußtsein, beim Verbrecher nur vor Ihnen; beim ersteren ein echtes Nichtwissen, obwohl nicht in jedem Sinne, beim letzteren nur Simulation des Nichtwissens. Damit ist ein anderer, praktisch wichtiger Unterschied verknüpft. In der Psychoanalyse hilft der Kranke mit seiner bewußten Bemühung gegen seinen Widerstand, denn er hat ja einen Nutzen von dem Examen zu erwarten, die Heilung; der Verbrecher hingegen arbeitet nicht mit Ihnen, er würde gegen sein ganzes Ich arbeiten. Wie zur Ausgleichung kommt es bei Ihrer Untersuchung nur darauf an, daß Sie eine objektive Überzeugung gewinnen, während bei der Therapie gefordert wird, daß der Kranke selbst sich die gleiche Überzeugung schaffe. Es bleibt aber abzuwarten, welche Erschwerungen oder Abänderungen an Ihrem Verfahren Ihnen der Wegfall der Mitarbeiterschaft des Untersuchten bereiten wird. Es ist dies auch ein Fall, den Sie sich in Ihren Seminarversuchen niemals herstellen können, denn Ihr Kollege, der sich in die Rolle des Beschuldigten fügt, bleibt doch Ihr Mitarbeiter und hilft Ihnen trotz seines bewußten Vorsatzes, sich nicht zu verraten.
Wenn Sie auf die Vergleichung der beiden Situationen näher eingehen, so ergibt sich Ihnen überhaupt, daß in der Psychoanalyse ein einfacherer, ein Spezialfall der Aufgabe, Verborgenes im Seelenleben aufzudecken, vorliegt, in Ihrer Arbeit dagegen ein umfassenderer. Daß es sich bei den Psychoneurotikern ganz regelmäßig um einen verdrängten sexuellen Komplex (im weitesten Sinne genommen) handelt, das kommt als Unterschied für Sie nicht in Betracht. Wohl aber etwas anderes. Die Aufgabe der Psychoanalyse lautet ganz uniform für alle Fälle, es seien Komplexe aufzudecken, die infolge von Unlustgefühlen verdrängt sind und beim Versuch der Einführung ins Bewußtsein Anzeichen des Widerstandes von sich geben. Dieser Widerstand ist gleichsam lokalisiert, er entsteht an dem Grenzübergang zwischen Unbewußtem und Bewußtem. In Ihren Fällen handelt es sich um einen Widerstand, der ganz aus dem Bewußtsein herrührt. Sie werden diese Ungleichheit nicht ohneweiters vernachlässigen können und erst durch Versuche festzustellen haben, ob sich der bewußte Widerstand durch ganz dieselben Anzeichen verrät wie der unbewußte. Ferner meine ich, daß Sie noch nicht sicher sein können, ob Sie Ihre objektiven Komplexanzeichen so wie wir Psychotherapeuten als „Widerstand“ deuten dürfen. Wenn auch nicht sehr häufig bei Verbrechern, so doch bei Ihren Versuchspersonen mag sich der Fall ereignen, daß der Komplex, an den Sie streifen, ein mit Lust betonter ist, und es fragt sich, ob dieser dieselben Reaktionen geben wird wie ein mit Unlust betonter.
Ich möchte auch hervorheben, daß Ihr Versuch möglicherweise einer Einmengung unterliegen kann, die in der Psychoanalyse wie selbstverständlich entfällt. Sie können nämlich bei Ihrer Untersuchung vom Neurotiker irregeführt werden, der so reagiert, als ob er schuldig wäre, obwohl er unschuldig ist, weil ein in ihm bereitliegendes und lauerndes Schuldbewußtsein sich der Beschuldigung des besonderen Falles bemächtigt. Halten Sie diesen Fall nicht für eine müßige Erfindung; denken Sie an die Kinderstube, in der man ihn häufig genug beobachten kann. Es kommt vor, daß ein Kind, dem man eine Untat vorwirft, die Schuld mit Entschiedenheit leugnet, dabei aber weint wie ein überführter Sünder. Sie werden vielleicht meinen, daß das Kind lügt, während es seine Unschuld versichert, aber der Fall kann anders liegen. Das Kind hat die eine Untat, die Sie ihm zur Last legen, wirklich nicht verübt, aber dafür eine andere, ähnliche, von der Sie nichts wissen und deren Sie es nicht beschuldigen. Es leugnet also mit Recht seine Schuld – an dem einen, – und dabei verrät sich doch sein Schuldbewußtsein – wegen des anderen. Der erwachsene Neurotiker verhält sich in diesem – wie in vielen anderen Punkten – ganz so wie ein Kind; es gibt viele solcher Menschen, und es ist noch fraglich, ob es Ihrer Technik gelingen wird, solche Selbstbeschuldiger von den wirklich Schuldigen zu unterscheiden. Endlich noch eines: Sie wissen, daß Sie nach Ihrer Strafprozeßordnung den Angeklagten durch kein Verfahren überrumpeln dürfen. Er wird also wissen, daß es sich beim Experiment darum handelt, sich nicht zu verraten, und es entsteht die weitere Frage, ob man auf dieselben Reaktionen zu rechnen hat, wenn die Aufmerksamkeit dem Komplex zugewendet ist wie bei abgewendeter, und wie weit der Vorsatz zu verbergen bei verschiedenen Personen in die Reaktionsweise hineinreichen kann.
Gerade weil die Ihren Untersuchungen unterliegenden Situationen so mannigfaltig sind, ist die Psychologie an dem Ausfall derselben lebhaft interessiert, und man möchte Sie bitten, an der praktischen Verwertbarkeit derselben ja nicht zu rasch zu verzweifeln. Gestatten Sie mir, der ich der praktischen Rechtspflege so ferne stehe, noch einen anderen Vorschlag! So unentbehrlich Experimente im Seminar zur Vorbereitung und Fragestellung sein mögen, so werden Sie doch die gleiche psychologische Situation wie bei der Untersuchung Beschuldigter im Straffalle hier nie herstellen können. Es bleiben Phantomübungen, auf welche sich die praktische Verwendung im Strafprozeß niemals begründen läßt. Wenn wir auf letztere nicht verzichten wollen, so bietet sich folgender Ausweg. Es möge Ihnen verstattet, ja zur Pflicht gemacht werden, solche Untersuchungen durch eine Reihe von Jahren an allen realen Fällen von Strafbeschuldigung vorzunehmen, ohne daß den Ergebnissen derselben ein Einfluß auf die Entscheidung der richtenden Instanz zugestanden würde. Am besten, wenn die letztere überhaupt nicht zur Kenntnis Ihrer aus der Untersuchung gezogenen Schlußfolgerung über die Schuld des Angeklagten kommt. Nach jahrelanger Sammlung und vergleichender Bearbeitung der so gewonnenen Erfahrungen müßten wohl alle Zweifel an der Brauchbarkeit dieses psychologischen Untersuchungsverfahrens gelöst sein. Ich weiß freilich, daß die Verwirklichung dieses Vorschlages nicht allein von Ihnen und Ihrem geschatzten Lehrer abhängt.
Fußnoten
[1)]
Jung: Die psychologische Diagnose des Tatbestandes, 1906. (Juristisch-psychiatrische Grenzfragen, IV, 2.)
[2)]
Zur Psychopathologie des Alltagslebens. Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie, Bd. X. [1904 als Buch erschienen, 10. Aufl. 1924; Gesammelte Werke, Bd. IV.]
[1)]
Adler: Drei Psychoanalysen von Zahleneinfällen und obsedierenden Zahlen. Psychiatrisch-neurologische Wochenschrift von Bresler, 1905, Nr. 28.
[2)]
Nach Jung, l. c.
[1)]
J. Breuer und Sigm. Freud: Studien über Hysterie. 1895. [Gesammelte Werke, Bd. I.]
[1)]
Vgl. meine „Traumdeutung“, 1900. [Gesammelte Werke, Bd. II und III.]
ZUR SEXUELLEN AUFKLÄRUNG DER KINDER
ZUR SEXUELLEN AUFKLÄRUNG DER KINDER
OFFENER BRIEF AN DR. M. FÜRST
Geehrter Herr Kollege!
Wenn Sie von mir eine Äußerung über die „sexuelle Aufklärung der Kinder“ verlangen, so nehme ich an, daß Sie keine regelrechte und förmliche Abhandlung mit Berücksichtigung der ganzen, über Gebühr angewachsenen Literatur erwarten, sondern das selbständige Urteil eines einzelnen Arztes hören wollen, dem seine Berufstätigkeit besondere Anregung geboten hat, sich mit den sexuellen Problemen zu beschäftigen. Ich weiß, daß Sie meine wissenschaftlichen Bemühungen mit Interesse verfolgt haben und mich nicht wie viele andere Kollegen darum ohne Prüfung abweisen, weil ich in der psychosexuellen Konstitution und in Schädlichkeiten des Sexuallebens die wichtigsten Ursachen der so häufigen neurotischen Erkrankungen erblicke; auch meine „Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie“, in denen ich die Zusammensetzung des Geschlechtstriebes und die Störungen in der Entwicklung des Geschlechtstriebes zur Sexualfunktion darlege, haben kürzlich eine freundliche Erwähnung in Ihrer Zeitschrift gefunden.
Ich soll Ihnen also die Fragen beantworten, ob man den Kindern überhaupt Aufklärungen über die Tatsachen des Geschlechtslebens geben darf, in welchem Alter dies geschehen kann und in welcher Weise. Nehmen Sie nun gleich zu Anfang mein Geständnis entgegen, daß ich eine Diskussion über den zweiten und dritten Punkt ganz begreiflich finde, daß es aber für meine Einsicht völlig unfaßbar ist, wie der erste dieser Fragepunkte ein Gegenstand von Meinungsverschiedenheit werden konnte. Was will man denn erreichen, wenn man den Kindern – oder sagen wir der Jugend – solche Aufklärungen über das menschliche Geschlechtsleben vorenthält? Fürchtet man, ihr Interesse für diese Dinge vorzeitig zu wecken, ehe es sich in ihnen selbst regt? Hofft man, durch solche Verhehlung den Geschlechtstrieb überhaupt zurückzuhalten bis zur Zeit, da er in die ihm von der bürgerlichen Gesellschaftsordnung allein geöffneten Bahnen einlenken kann? Meint man, daß die Kinder für die Tatsachen und Rätsel des Geschlechtslebens kein Interesse oder kein Verständnis zeigten, wenn sie nicht von fremder Seite darauf hingewiesen würden? Hält man es für möglich, daß ihnen die Kenntnis, welche man ihnen versagt, nicht auf anderen Wegen zugeführt wird? Oder verfolgt man wirklich und ernsthaft die Absicht, daß sie späterhin alles Geschlechtliche als etwas Niedriges und Verabscheuenswertes beurteilen mögen, von dem ihre Eltern und Erzieher sie so lange als möglich fernhalten wollten?
Ich weiß wirklich nicht, in welcher dieser Absichten ich das Motiv für das tatsächlich geübte Verstecken des Sexuellen vor den Kindern erblicken soll; ich weiß nur, daß sie alle gleich töricht sind, und daß es mir schwer fällt, sie durch ernsthafte Widerlegungen auszuzeichnen. Ich erinnere mich aber, daß ich in den Familienbriefen des großen Denkers und Menschenfreundes Multatuli einige Zeilen gefunden habe, die als Antwort mehr als bloß genügen können.[1)]
„Im allgemeinen werden einzelne Dinge nach meinem Gefühl zu sehr umschleiert. Man tut recht, die Phantasie der Kinder reinzuhalten, aber diese Reinheit wird nicht bewahrt durch Unwissenheit. Ich glaube eher, daß das Verdecken von etwas den Knaben und das Mädchen um so mehr die Wahrheit argwöhnen läßt. Man spürt aus Neugierde Dingen nach, die uns, wenn sie uns ohne viel Umstände mitgeteilt würden, wenig oder kein Interesse einflößen würden. Wäre diese Unwissenheit noch zu bewahren, so könnte ich mich damit versöhnen, aber das ist nicht möglich; das Kind kommt in Berührung mit anderen Kindern, es bekommt Bücher in die Hände, die es zum Nachdenken bringen; gerade die Geheimtuerei, womit das dennoch Begriffene von den Eltern behandelt wird, erhöht das Verlangen, mehr zu wissen. Dieses Verlangen, nur zum Teil, nur heimlich befriedigt, erhitzt das Herz und verdirbt die Phantasie, das Kind sündigt bereits, und die Eltern meinen noch, daß es nicht weiß, was Sünde ist.“
Ich weiß nicht, was man hierüber Besseres sagen könnte, aber vielleicht läßt sich einiges hinzufügen. Es ist gewiß nichts anderes als die gewohnte Prüderie und das eigene schlechte Gewissen in Sachen der Sexualität, was die Erwachsenen zur „Geheimtuerei“ vor den Kindern veranlaßt; aber möglicherweise wirkt da auch ein Stück theoretischer Unwissenheit mit, dem man durch die Aufklärung der Erwachsenen entgegentreten kann. Man meint nämlich, daß den Kindern der Geschlechtstrieb fehle und sich erst zur Pubertätszeit mit der Reife der Geschlechtsorgane bei ihnen einstelle. Das ist ein grober, für die Kenntnis wie für die Praxis folgenschwerer Irrtum. Es ist so leicht, ihn durch die Beobachtung zu korrigieren, daß man sich verwundern muß, wie er überhaupt entstehen konnte. In Wahrheit bringt das Neugeborene Sexualität mit auf die Welt, gewisse Sexualempfindungen begleiten seine Entwicklung durch die Säuglings- und Kinderzeiten, und die wenigsten Kinder dürften sexuellen Betätigungen und Empfindungen vor ihrer Pubertät entgehen. Wer die ausführliche Darlegung dieser Behauptungen kennen lernen will, möge sie in meinen erwähnten „Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, Wien 1905“ aufsuchen. Er wird dort erfahren, daß die eigentlichen Reproduktionsorgane nicht die einzigen Körperteile sind, welche sexuelle Lustempfindungen vermitteln, und daß die Natur es recht zwingend so eingerichtet hat, daß selbst Reizungen der Genitalien während der Kinderzeit unvermeidlich sind. Man bezeichnet diese Lebenszeit, in welcher durch die Erregung verschiedener Hautstellen (erogener Zonen), durch die Betätigung gewisser biologischer Triebe und als Miterregung bei vielen affektiven Zuständen ein gewisser Betrag von sicher sexueller Lust erzeugt wird, mit einem von Havelock Ellis eingeführten Ausdrucke als die Periode des Autoerotismus. Die Pubertät leistet nichts anderes, als daß sie unter allen lusterzeugenden Zonen und Quellen den Genitalien das Primat verschafft und dadurch die Erotik in den Dienst der Fortpflanzungsfunktion zwingt, ein Prozeß, der natürlich gewissen Hemmungen unterliegen kann und sich bei vielen Personen, den späteren Perversen und Neurotikern, nur in unvollkommener Weise vollzieht. Anderseits ist das Kind der meisten psychischen Leistungen des Liebeslebens (der Zärtlichkeit, der Hingebung, der Eifersucht) lange vor erreichter Pubertät fähig, und oft genug stellt sich auch der Durchbruch dieser seelischen Zustände zu den körperlichen Empfindungen der Sexualerregung her, so daß das Kind über die Zusammengehörigkeit der beiden nicht im Zweifel bleiben kann. Kurz gesagt, das Kind ist lange vor der Pubertät ein bis auf die Fortpflanzungsfähigkeit fertiges Liebeswesen, und man darf es aussprechen, daß man ihm mit jener „Geheimtuerei“ nur die Fähigkeit zur intellektuellen Bewältigung solcher Leistungen vorenthält, für die es psychisch vorbereitet und somatisch eingestellt ist.
Das intellektuelle Interesse des Kindes für die Rätsel des Geschlechtslebens, seine sexuelle Wißbegierde äußert sich denn auch zu einer unvermutet frühen Lebenszeit. Es muß wohl so zugehen, daß die Eltern für dieses Interesse des Kindes wie mit Blindheit geschlagen sind oder sich sofort bemühen, es zu ersticken, falls sie es nicht übersehen können, wenn Beobachtungen wie die nun mitzuteilende nicht häufiger gemacht werden können. Ich kenne da einen prächtigen Jungen von jetzt vier Jahren, dessen verständige Eltern darauf verzichten, ein Stück der Entwicklung des Kindes gewaltsam zu unterdrücken. Der kleine Hans, der sicherlich keinem verführenden Einflusse von seiten einer Warteperson unterlegen ist, zeigt schon seit einiger Zeit das lebhafteste Interesse für jenes Stück seines Körpers, das er als „Wiwimacher“ zu bezeichnen pflegt. Schon mit drei Jahren hat er die Mutter gefragt: „Mama, hast du auch einen Wiwimacher?“ Worauf die Mama geantwortet: „Natürlich, was hast du denn gedacht?“ Dieselbe Frage hat er zu wiederholten Malen an den Vater gerichtet. Im selben Alter zuerst in einen Stall geführt, hat er beim Melken einer Kuh zugeschaut und dann verwundert ausgerufen: „Schau, aus dem Wiwimacher kommt Milch.“ Mit dreidreiviertel Jahren ist er auf dem Wege, durch seine Beobachtungen selbständig richtige Kategorien zu entdecken. Er sieht, wie aus einer Lokomotive Wasser ausgelassen wird und sagt: „Schau, die Lokomotive macht Wiwi; wo hat sie denn den Wiwimacher?“ Später setzt er nachdenklich hinzu: „Ein Hund und ein Pferd hat einen Wiwimacher; ein Tisch und ein Sessel nicht.“ Vor kurzem hat er zugesehen, wie man sein einwöchiges Schwesterchen badet, und dabei bemerkt: „Aber ihr Wiwimacher ist noch klein. Wenn sie wächst, wird er schon größer werden.“ (Dieselbe Stellung zum Problem der Geschlechtsunterschiede ist mir auch von anderen Knaben gleichen Alters berichtet worden.) Ich möchte ausdrücklich bestreiten, daß der kleine Hans ein sinnliches oder gar ein pathologisch veranlagtes Kind sei; ich meine nur, er ist nicht eingeschüchtert worden, wird nicht vom Schuldbewußtsein geplagt und gibt darum arglos von seinen Denkvorgängen Kunde.[1)]
Das zweite große Problem, welches dem Denken der Kinder – wohl erst in etwas späteren Jahren – Aufgaben stellt, ist die Frage nach der Herkunft der Kinder, die zumeist an die unerwünschte Erscheinung eines neuen kleinen Bruders oder Schwesterchens anknüpft. Es ist dies die älteste und die brennendste Frage der jungen Menschheit; wer Mythen und Überlieferungen zu deuten versteht, kann sie aus dem Rätsel heraushören, welches die thebaische Sphinx dem Ödipus aufgibt. Durch die in der Kinderstube gebräuchlichen Antworten wird der ehrliche Forschertrieb des Kindes verletzt, meist auch dessen Vertrauen zu seinen Eltern zum erstenmal erschüttert; von da an beginnt es zumeist den Erwachsenen zu mißtrauen und seine intimsten Interessen vor ihnen geheimzuhalten. Ein kleines Dokument mag zeigen, wie quälend sich gerade diese Wißbegierde oft bei älteren Kindern gestaltet, der Brief eines mutterlosen, elfeinhalbjährigen Mädchens, welches über das Problem mit seiner jüngeren Schwester spekuliert hat:
„Liebe Tante Mali!“
„Ich bitte Dich, sei so gut und schreibe mir, wie Du die Christel oder den Paul bekommen hast. Du mußt es ja wissen, da Du verheiratet bist. Wir haben uns nämlich gestern abend darüber gestritten und wünschen die Wahrheit zu wissen. Wir haben ja sonst niemanden, den wir fragen könnten. Wann kommt Ihr denn nach Salzburg? Weißt Du, liebe Tante Mali, wir können halt nicht begreifen, wie der Storch die Kinder bringt. Trudel hat geglaubt, der Storch bringt sie im Hemde. Dann möchten wir auch wissen, ob er sie aus dem Teiche nimmt und warum man die Kinder nie im Teich sieht. Ich bitte Dich, sag’ mir auch, wieso man vorher weiß, wann man sie bekommt. Schreibe mir darüber ausführlich Antwort.
Mit tausend Grüßen und Küssen von uns allen
Deine neugierige Lilli.“
Ich glaube nicht, daß dieser rührende Brief den beiden Schwestern die geforderte Aufklärung brachte. Die Schreiberin ist später an jener Neurose erkrankt, die sich von unbeantworteten unbewußten Fragen ableitet, an Zwangsgrübelsucht.[1)]
Ich glaube nicht, daß nur ein einziger Grund vorliegt, um Kindern die Aufklärung, nach der ihre Wißbegierde verlangt, zu verweigern. Freilich, wenn es die Absicht der Erzieher ist, die Fähigkeit der Kinder zum selbständigen Denken möglichst frühzeitig zugunsten der so hochgeschätzten „Bravheit“ zu ersticken, so kann dies nicht besser als durch Irreführung auf sexuellem und durch Einschüchterung auf religiösem Gebiete versucht werden. Die stärkeren Naturen widerstehen allerdings diesen Beeinflussungen und werden zu Rebellen gegen die elterliche und später gegen jede andere Autorität. Erhalten die Kinder jene Aufklärungen nicht, um die sie sich an Ältere gewendet haben, so quälen sie sich im Geheimen mit dem Problem weiter und bringen Lösungsversuche zustande, in denen das geahnte Richtige auf die merkwürdigste Weise mit grotesk Unrichtigem vermengt ist, oder sie flüstern einander Mitteilungen zu, in welchen zufolge des Schuldbewußtseins der jugendlichen Forscher dem Sexualleben das Gepräge des Gräßlichen und Ekelhaften aufgedrückt wird. Diese kindlichen Sexualtheorien wären wohl einer Sammlung und Würdigung wert. Meist haben die Kinder von diesem Zeitpunkte an die einzig richtige Stellung zu den Fragen des Geschlechts verloren, und viele unter ihnen finden sie überhaupt nicht wieder.
Es scheint, daß die überwiegende Mehrheit männlicher und weiblicher Autoren, welche über die sexuelle Aufklärung der Jugend geschrieben haben, sich im bejahenden Sinn entscheiden. Aber aus dem Ungeschick der meisten Vorschläge, wann und wie dies zu geschehen hat, ist man versucht zu schließen, daß dies Zugeständnis den Betreffenden nicht leicht geworden ist. Ganz vereinzelt steht nach meiner Literaturkenntnis jener reizende Aufklärungsbrief da, den eine Frau Emma Eckstein an ihren etwa zehnjährigen Sohn zu schreiben vorgibt.[1)] Wie man es sonst macht, daß man den Kindern die längste Zeit jede Kenntnis des Sexuellen vorenthält, um ihnen dann einmal in schwülstig-feierlichen Worten eine auch nur halb aufrichtige Eröffnung zu schenken, die überdies meist zu spät kommt, das ist offenbar nicht ganz das Richtige. Die meisten Beantwortungen der Frage „wie sag’s ich meinem Kinde?“ machen mir wenigstens einen so kläglichen Eindruck, daß ich vorziehen würde, wenn die Eltern sich überhaupt nicht um die Aufklärung bekümmern würden. Es kommt vielmehr darauf an, daß die Kinder niemals auf die Idee geraten, man wolle ihnen aus den Tatsachen des Geschlechtslebens eher ein Geheimnis machen als aus anderem, was ihrem Verständnisse noch nicht zugänglich ist. Und um dies zu erzielen, ist es erforderlich, daß das Geschlechtliche von allem Anfange an gleich wie anderes Wissenswerte behandelt werde. Vor allem ist es Aufgabe der Schule, der Erwähnung des Geschlechtlichen nicht auszuweichen, die großen Tatsachen der Fortpflanzung beim Unterrichte über die Tierwelt in ihre Bedeutung einzusetzen und sogleich zu betonen, daß der Mensch alles Wesentliche seiner Organisation mit den höheren Tieren teilt. Wenn dann das Haus nicht auf Denkabschreckung hinarbeitet, wird es sich wohl öfter ereignen, was ich einmal in einer Kinderstube belauscht habe, daß ein Knabe seinem jüngeren Schwesterchen vorhält: „Aber wie kannst du denken, daß der Storch die kleinen Kinder bringt. Du weißt ja, daß der Mensch ein Säugetier ist, und glaubst du denn, daß der Storch den anderen Säugetieren die Jungen bringt?“ Die Neugierde des Kindes wird dann nie einen hohen Grad erreichen, wenn sie auf jeder Stufe des Lernens die entsprechende Befriedigung findet. Die Aufklärung über die spezifisch menschlichen Verhältnisse des Geschlechtslebens und der Hinweis auf die soziale Bedeutung desselben hätte sich dann am Schlusse des Volksschulunterrichtes (und vor Eintritt in die Mittelschule), also nicht nach dem Alter von zehn Jahren, anzuschließen. Endlich würde sich der Zeitpunkt der Konfirmation wie kein anderer dazu eignen, dem bereits über alles Körperliche aufgeklärten Kinde die sittlichen Verpflichtungen, welche an die Ausübung des Triebes geknüpft sind, darzulegen. Eine solche stufenweise fortschreitende und eigentlich zu keiner Zeit unterbrochene Aufklärung über das Geschlechtsleben, zu welcher die Schule die Initiative ergreift, erscheint mir als die einzige, welche der Entwicklung des Kindes Rechnung trägt und darum die vorhandene Gefahr glücklich vermeidet.
Ich halte es für den bedeutsamsten Fortschritt in der Kindererziehung, daß der französische Staat an Stelle des Katechismus ein Elementarbuch eingeführt hat, welches dem Kinde die ersten Kenntnisse seiner staatsbürgerlichen Stellung und der ihm dereinst zufallenden ethischen Pflichten vermittelt. Aber dieser Elementarunterricht ist in arger Weise unvollständig, wenn er nicht das Gebiet des Geschlechtslebens mit umschließt. Hier ist die Lücke, deren Ausfüllung Erzieher und Reformer in Angriff nehmen sollten! In Staaten, welche die Kindererziehung ganz oder teilweise in den Händen der Geistlichkeit belassen haben, darf man allerdings solche Forderung nicht erheben. Der Geistliche wird die Wesensgleichheit von Mensch und Tier nie zugeben, da er auf die unsterbliche Seele nicht verzichten kann, die er braucht, um die Moralforderung zu begründen. So bewährt es sich denn wieder einmal, wie unklug es ist, einem zerlumpten Rock einen einzigen seidenen Lappen aufzunähen, wie unmöglich es ist, eine vereinzelte Reform durchzuführen, ohne an den Grundlagen des Systems zu ändern!
Fußnoten
[1)]
Multatuli - Briefe, herausgegeben von W. Spohr, 1906, Bd. I, S. 26.
[1)]
[Zusatz 1924:] Über die spätere neurotische Erkrankung und Herstellung dieses „kleinen Hans“ siehe „Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben“ im VII. Band dieser Gesamtausgabe.
[1)]
Die Grübelsucht machte aber nach Jahren einer Dementia praecox Platz.
[1)]
E. Eckstein, Die Sexualfrage in der Erziehung des Kindes. 1904.
DER WAHN UND DIE TRÄUME IN W. JENSENS »GRADIVA«
I
In einem Kreise von Männern, denen es als ausgemacht gilt, daß die wesentlichsten Rätsel des Traumes durch die Bemühung des Verfassers[1)] gelöst worden sind, erwachte eines Tages die Neugierde, sich um jene Träume zu kümmern, die überhaupt niemals geträumt worden, die von Dichtern geschaffen und erfundenen Personen im Zusammenhange einer Erzählung beigelegt werden. Der Vorschlag, diese Gattung von Träumen einer Untersuchung zu unterziehen, mochte müßig und befremdend erscheinen; von einer Seite her konnte man ihn als berechtigt hinstellen. Es wird ja keineswegs allgemein geglaubt, daß der Traum etwas Sinnvolles und Deutbares ist. Die Wissenschaft und die Mehrzahl der Gebildeten lächeln, wenn man ihnen die Aufgabe einer Traumdeutung stellt; nur das am Aberglauben hängende Volk, das hierin die Überzeugungen des Altertums fortsetzt, will von der Deutbarkeit der Träume nicht ablassen, und der Verfasser der Traumdeutung hat es gewagt, gegen den Einspruch der gestrengen Wissenschaft Partei für die Alten und für den Aberglauben zu nehmen. Er ist allerdings weit davon entfernt, im Traume eine Ankündigung der Zukunft anzuerkennen, nach deren Enthüllung der Mensch seit jeher mit allen unerlaubten Mitteln vergeblich strebt. Aber völlig konnte auch er nicht die Beziehung des Traumes zur Zukunft verwerfen, denn nach Vollendung einer mühseligen Übersetzungsarbeit erwies sich ihm der Traum als ein erfüllt dargestellter Wunsch des Träumers, und wer könnte bestreiten, daß Wünsche sich vorwiegend der Zukunft zuzuwenden pflegen.
Ich sagte eben: der Traum sei ein erfüllter Wunsch. Wer sich nicht scheut, ein schwieriges Buch durchzuarbeiten, wer nicht fordert, daß ein verwickeltes Problem zur Schonung seiner Bemühung und auf Kosten von Treue und Wahrheit ihm als leicht und einfach vorgehalten werde, der mag in der erwähnten „Traumdeutung“ den weitläufigen Beweis für diesen Satz aufsuchen und bis dahin die ihm sicherlich aufsteigenden Einwendungen gegen die Gleichstellung von Traum und Wunscherfüllung zur Seite drängen.
Aber wir haben weit vorgegriffen. Es handelt sich noch gar nicht darum, festzustellen, ob der Sinn eines Traumes in jedem Falle durch einen erfüllten Wunsch wiederzugeben sei, oder nicht auch ebenso häufig durch eine ängstliche Erwartung, einen Vorsatz, eine Überlegung usw. Vielmehr steht erst in Frage, ob der Traum überhaupt einen Sinn habe, ob man ihm den Wert eines seelischen Vorganges zugestehen solle. Die Wissenschaft antwortet mit Nein, sie erklärt das Träumen für einen bloß physiologischen Vorgang, hinter dem man also Sinn, Bedeutung, Absicht nicht zu suchen brauche. Körperliche Reize spielten während des Schlafes auf dem seelischen Instrument und brächten so bald diese, bald jene der alles seelischen Zusammenhalts beraubten Vorstellungen zum Bewußtsein. Die Träume wären nur Zuckungen, nicht aber Ausdrucksbewegungen des Seelenlebens vergleichbar.
In diesem Streite über die Würdigung des Traumes scheinen nun die Dichter auf derselben Seite zu stehen wie die Alten, wie das abergläubische Volk und wie der Verfasser der „Traumdeutung“. Denn wenn sie die von ihrer Phantasie gestalteten Personen träumen lassen, so folgen sie der alltäglichen Erfahrung, daß das Denken und Fühlen der Menschen sich in den Schlaf hinein fortsetzt und suchen nichts anderes, als die Seelenzustände ihrer Helden durch deren Träume zu schildern. Wertvolle Bundesgenossen sind aber die Dichter und ihr Zeugnis ist hoch anzuschlagen, denn sie pflegen eine Menge von Dingen zwischen Himmel und Erde zu wissen, von denen sich unsere Schulweisheit noch nichts träumen läßt. In der Seelenkunde gar sind sie uns Alltagsmenschen weit voraus, weil sie da aus Quellen schöpfen, welche wir noch nicht für die Wissenschaft erschlossen haben. Wäre diese Parteinahme der Dichter für die sinnvolle Natur der Träume nur unzweideutiger! Eine schärfere Kritik könnte ja einwenden, der Dichter nehme weder für noch gegen die psychische Bedeutung des einzelnen Traumes Partei; er begnüge sich zu zeigen, wie die schlafende Seele unter den Erregungen aufzuckt, die als Ausläufer des Wachlebens in ihr kräftig verblieben sind.
Unser Interesse für die Art, wie sich die Dichter des Traumes bedienen, ist indes auch durch diese Ernüchterung nicht gedämpft. Wenn uns die Untersuchung auch nichts Neues über das Wesen der Träume lehren sollte, vielleicht gestattet sie uns von diesem Winkel aus einen kleinen Einblick in die Natur der dichterischen Produktion. Die wirklichen Träume gelten zwar bereits als zügellose und regelfreie Bildungen, und nun erst die freien Nachbildungen solcher Träume! Aber es gibt viel weniger Freiheit und Willkür im Seelenleben, als wir geneigt sind anzunehmen; vielleicht überhaupt keine. Was wir in der Welt draußen Zufälligkeit heißen, löst sich bekanntermaßen in Gesetze auf; auch was wir im Seelischen Willkür heißen, ruht auf – derzeit erst dunkel geahnten – Gesetzen. Sehen wir also zu!
Es gäbe zwei Wege für diese Untersuchung. Der eine wäre die Vertiefung in einen Spezialfall, in die Traumschöpfungen eines Dichters in einem seiner Werke. Der andere bestünde im Zusammentragen und Gegeneinanderhalten all der Beispiele, die sich in den Werken verschiedener Dichter von der Verwendung der Träume finden lassen. Der zweite Weg scheint der bei weitem trefflichere zu sein, vielleicht der einzig berechtigte, denn er befreit uns sofort von den Schädigungen, die mit der Aufnahme des künstlichen Einheitsbegriffes „der Dichter“ verbunden sind. Diese Einheit zerfällt bei der Untersuchung in die so sehr verschiedenwertigen Dichterindividuen, unter denen wir in einzelnen die tiefsten Kenner des menschlichen Seelenlebens zu verehren gewohnt sind. Dennoch aber werden diese Blätter von einer Untersuchung der ersten Art ausgefüllt sein. Es hatte sich in jenem Kreise von Männern, unter denen die Anregung auftauchte, so gefügt, daß jemand sich besann, in dem Dichtwerke, das zuletzt sein Wohlgefallen erweckt, wären mehrere Träume enthalten gewesen, die ihn gleichsam mit vertrauten Zügen angeblickt hätten und ihn einlüden, die Methode der „Traumdeutung“ an ihnen zu versuchen. Er gestand zu, Stoff und Örtlichkeit der kleinen Dichtung wären wohl an der Entstehung seines Wohlgefallens hauptsächlich beteiligt gewesen, denn die Geschichte spiele auf dem Boden von Pompeji und handle von einem jungen Archäologen, der das Interesse für das Leben gegen das an den Resten der klassischen Vergangenheit hingegeben hätte und nun auf einem merkwürdigen, aber völlig korrekten Umwege ins Leben zurückgebracht werde. Während der Behandlung dieses echt poetischen Stoffes rege sich allerlei Verwandtes und dazu Stimmendes im Leser. Die Dichtung aber sei die kleine Novelle „Gradiva“ von Wilhelm Jensen, vom Autor selbst als „pompejanisches Phantasiestück“ bezeichnet.
Und nun müßte ich eigentlich alle meine Leser bitten, dieses Heft aus der Hand zu legen und es für eine ganze Weile durch die 1903 im Buchhandel erschienene „Gradiva“ zu ersetzen, damit ich mich im weiteren auf Bekanntes beziehen kann. Denjenigen aber, welche die „Gradiva“ bereits gelesen haben, will ich den Inhalt der Erzählung durch einen kurzen Auszug ins Gedächtnis zurückrufen, und rechne darauf, daß ihre Erinnerung allen dabei abgestreiften Reiz aus eigenem wiederherstellen wird.
Ein junger Archäologe, Norbert Hanold, hat in einer Antikensammlung Roms ein Reliefbild entdeckt, das ihn so ausnehmend angezogen, daß er sehr erfreut gewesen ist, einen vortrefflichen Gipsabguß davon erhalten zu können, den er in seiner Studierstube in einer deutschen Universitätsstadt aufhängen und mit Interesse studieren kann. Das Bild stellt ein reifes junges Mädchen im Schreiten dar, welches sein reichfaltiges Gewand ein wenig aufgerafft hat, so daß die Füße in den Sandalen sichtbar werden. Der eine Fuß ruht ganz auf dem Boden, der andere hat sich zum Nachfolgen vom Boden abgehoben und berührt ihn nur mit den Zehenspitzen, während Sohle und Ferse sich fast senkrecht emporheben. Der hier dargestellte ungewöhnliche und besonders reizvolle Gang hatte wahrscheinlich die Aufmerksamkeit des Künstlers erregt und fesselt nach so viel Jahrhunderten nun den Blick unseres archäologischen Beschauers.
Dies Interesse des Helden der Erzählung für das geschilderte Reliefbild ist die psychologische Grundtatsache unserer Dichtung. Es ist nicht ohne weiteres erklärbar. „Doktor Norbert Hanold, Dozent der Archäologie, fand eigentlich für seine Wissenschaft an dem Relief nichts sonderlich Beachtenswertes.“ (Gradiva p. 3.) „Er wußte sich nicht klarzustellen, was daran seine Aufmerksamkeit erregt habe, nur daß er von etwas angezogen worden und diese Wirkung sich seitdem unverändert forterhalten habe.“ Aber seine Phantasie läßt nicht ab, sich mit dem Bilde zu beschäftigen. Er findet etwas „Heutiges“ darin, als ob der Künstler den Anblick auf der Straße „nach dem Leben“ festgehalten habe. Er verleiht dem im Schreiten dargestellten Mädchen einen Namen: „Gradiva“, die „Vorschreitende“; er fabuliert, sie sei gewiß die Tochter eines vornehmen Hauses, vielleicht „eines patrizischen Aedilis, der sein Amt im Namen der Ceres ausübte“, und befinde sich auf dem Wege zum Tempel der Göttin. Dann widerstrebt es ihm, ihre ruhige, stille Art in das Getriebe einer Großstadt einzufügen, vielmehr erschafft er sich die Überzeugung, daß sie nach Pompeji zu versetzen sei und dort irgendwo auf den wieder ausgegrabenen eigentümlichen Trittsteinen schreite, die bei regnerischem Wetter einen trockenen Übergang von einer Seite der Straße zur anderen ermöglicht und doch auch Durchlaß für Wagenräder gestattet hatten. Ihr Gesichtsschnitt dünkt ihm griechischer Art, ihre hellenische Abstammung unzweifelhaft; seine ganze Altertumswissenschaft stellt sich allmählich in den Dienst dieser und anderer auf das Urbild des Reliefs bezüglichen Phantasien.
Dann aber drängt sich ihm ein angeblich wissenschaftliches Problem auf, das nach Erledigung verlangt. Es handelt sich für ihn um eine kritische Urteilsabgabe, „ob der Künstler den Vorgang des Ausschreitens bei der Gradiva dem Leben entsprechend wiedergegeben habe“. Er selbst vermag ihn an sich nicht hervorzurufen; bei der Suche nach der „Wirklichkeit“ dieser Gangart gelangt er nun dazu, „zur Aufhellung der Sache selbst Beobachtungen nach dem Leben anzustellen“. (G. p. 9.) Das nötigt ihn allerdings zu einem ihm durchaus fremdartigen Tun. „Das weibliche Geschlecht war bisher für ihn nur ein Begriff aus Marmor oder Erzguß gewesen, und er hatte seinen zeitgenössischen Vertreterinnen desselben niemals die geringste Beachtung geschenkt.“ Pflege der Gesellschaft war ihm immer nur als unabweisbare Plage erschienen; junge Damen, mit denen er dort zusammentraf, sah und hörte er so wenig, daß er bei einer nächsten Begegnung grußlos an ihnen vorüberging, was ihn natürlich in kein günstiges Licht bei ihnen brachte. Nun aber nötigte ihn die wissenschaftliche Aufgabe, die er sich gestellt, bei trockener, besonders aber bei nasser Witterung eifrig nach den sichtbar werdenden Füßen der Frauen und Mädchen auf der Straße zu schauen, welche Tätigkeit ihm manchen unmutigen und manchen ermutigenden Blick der so Beobachteten eintrug; „doch kam ihm das eine so wenig zum Verständnis wie das andere.“ (G. p. 10.) Als Ergebnis dieser sorgfältigen Studien mußte er finden, daß die Gangart der Gradiva in der Wirklichkeit nicht nachzuweisen war, was ihn mit Bedauern und Verdruß erfüllte.
Bald nachher hatte er einen schreckvoll beängstigenden Traum, der ihn in das alte Pompeji am Tage des Vesuvausbruches versetzte und zum Zeugen des Unterganges der Stadt machte. „Wie er so am Rande des Forums neben dem Jupitertempel stand, sah er plötzlich in geringer Entfernung die Gradiva vor sich; bis dahin hatte ihn kein Gedanke an ihr Hiersein angerührt, jetzt aber ging ihm auf einmal und als natürlich auf, da sie ja eine Pompejanerin sei, lebe sie in ihrer Vaterstadt und, ohne daß er’s geahnt habe, gleichzeitig mit ihm.“ (G. p. 12.) Angst um das ihr bevorstehende Schicksal entlockte ihm einen Warnruf, auf den die gleichmütig fortschreitende Erscheinung ihm ihr Gesicht zuwendete. Sie setzte aber dann unbekümmert ihren Weg bis zum Portikus des Tempels fort, setzte sich dort auf eine Treppenstufe und legte langsam den Kopf auf diese nieder, während ihr Gesicht sich immer blasser färbte, als ob es sich zu weißem Marmor umwandelte. Als er nacheilte, fand er sie mit ruhigem Ausdruck wie schlafend auf der breiten Stufe hingestreckt, bis dann der Aschenregen ihre Gestalt begrub.
Als er erwachte, glaubte er noch das verworrene Geschrei der nach Rettung suchenden Bewohner Pompejis und die dumpfdröhnende Brandung der erregten See im Ohre zu haben. Aber auch nachdem die wiederkehrende Besinnung diese Geräusche als die weckenden Lebensäußerungen der lärmenden Großstadt erkannt hatte, behielt er für eine lange Zeit den Glauben an die Wirklichkeit des Geträumten; als er sich endlich von der Vorstellung frei gemacht, daß er selbst vor bald zwei Jahrtausenden dem Untergang Pompejis beigewohnt, verblieb ihm doch wie eine wahrhafte Überzeugung, daß die Gradiva in Pompeji gelebt und dort im Jahre 79 mit verschüttet worden sei. Solche Fortsetzung fanden seine Phantasien über die Gradiva durch die Nachwirkung dieses Traumes, daß er sie jetzt erst wie eine Verlorene betrauerte.
Während er, von diesen Gedanken befangen, aus dem Fenster lehnte, zog ein Kanarienvogel seine Aufmerksamkeit auf sich, der an einem offenstehenden Fenster des Hauses gegenüber im Käfig sein Lied schmetterte. Plötzlich durchfuhr etwas wie ein Ruck den, wie es scheint, noch nicht völlig aus seinem Traum Erwachten. Er glaubte, auf der Straße eine Gestalt wie die seiner Gradiva gesehen und selbst den für sie charakteristischen Gang erkannt zu haben, eilte unbedenklich auf die Straße, um sie einzuholen, und erst das Lachen und Spotten der Leute über seine unschickliche Morgenkleidung trieb ihn rasch wieder in seine Wohnung zurück. In seinem Zimmer war es wieder der singende Kanarienvogel im Käfig, der ihn beschäftigte und ihn zum Vergleiche mit seiner eigenen Person anregte. Auch er sitze wie im Käfig, fand er, doch habe er es leichter, seinen Käfig zu verlassen. Wie in weiterer Nachwirkung des Traumes, vielleicht auch unter dem Einflusse der linden Frühlingsluft gestaltete sich in ihm der Entschluß einer Frühjahrsreise nach Italien, für welche ein wissenschaftlicher Vorwand bald gefunden wurde, wenn auch „der Antrieb zu dieser Reise ihm aus einer unbenennbaren Empfindung entsprungen war.“ (G. p. 24.)
Bei dieser merkwürdig locker motivierten Reise wollen wir einen Moment Halt machen und die Persönlichkeit wie das Treiben unseres Helden näher ins Auge fassen. Er erscheint uns noch unverständlich und töricht; wir ahnen nicht, auf welchem Wege seine besondere Torheit sich mit der Menschlichkeit verknüpfen wird, um unsere Teilnahme zu erzwingen. Es ist das Vorrecht des Dichters, uns in solcher Unsicherheit belassen zu dürfen; mit der Schönheit seiner Sprache, der Sinnigkeit seiner Einfälle lohnt er uns vorläufig das Vertrauen, das wir ihm schenken, und die Sympathie, die wir, noch unverdient, für seinen Helden bereithalten. Von diesem teilt er uns noch mit, daß er schon durch die Familientradition zum Altertumsforscher bestimmt, sich in seiner späteren Vereinsamung und Unabhängigkeit ganz in seine Wissenschaft versenkt und ganz vom Leben und seinen Genüssen abgewendet hatte. Marmor und Bronze waren für sein Gefühl das einzig wirklich Lebendige, den Zweck und Wert des Menschenlebens zum Ausdruck Bringende. Doch hatte vielleicht in wohlmeinender Absicht die Natur ihm ein Korrektiv durchaus unwissenschaftlicher Art ins Blut gelegt, eine überaus lebhafte Phantasie, die sich nicht nur in Träumen, sondern auch oft im Wachen zur Geltung bringen konnte. Durch solche Absonderung der Phantasie vom Denkvermögen mußte er zum Dichter oder zum Neurotiker bestimmt sein, gehörte er jenen Menschen an, deren Reich nicht von dieser Welt ist. So konnte es sich ihm ereignen, daß er mit seinem Interesse an einem Reliefbild hängen blieb, welches ein eigentümlich schreitendes Mädchen darstellte, daß er dieses mit seinen Phantasien umspann, ihm Namen und Herkunft fabulierte, und die von ihm geschaffene Person in das vor mehr als 1800 Jahren verschüttete Pompeji versetzte, endlich nach einem merkwürdigen Angsttraum die Phantasie von der Existenz und dem Untergang des Gradiva genannten Mädchens zu einem Wahn erhob, der auf sein Handeln Einfluß gewann. Sonderbar und undurchsichtig würden uns diese Leistungen der Phantasie erscheinen, wenn wir ihnen bei einem wirklich Lebenden begegnen würden. Da unser Held Norbert Hanold ein Geschöpf des Dichters ist, möchten wir etwa an diesen die schüchterne Frage richten, ob seine Phantasie von anderen Mächten als von ihrer eigenen Willkür bestimmt worden ist.
Unseren Helden hatten wir verlassen, als er sich anscheinend durch das Singen eines Kanarienvogels zu einer Reise nach Italien bewegen ließ, deren Motiv ihm offenbar nicht klar war. Wir erfahren weiter, daß auch Ziel und Zweck dieser Reise ihm nicht feststand. Eine innere Unruhe und Unbefriedigung treibt ihn von Rom nach Neapel und von da weiter weg. Er gerät in den Schwarm der Hochzeitsreisenden und genötigt, sich mit den zärtlichen „August“ und „Grete“ zu beschäftigen, findet er sich ganz außer stande, das Tun und Treiben dieser Paare zu verstehen. Er kommt zu dem Ergebnis, unter allen Torheiten der Menschen „nehme jedenfalls das Heiraten, als die größte und unbegreiflichste, den obersten Rang ein, und ihre sinnlosen Hochzeitsreisen nach Italien setzten gewissermaßen dieser Narretei die Krone auf.“ (G. p. 27.) In Rom durch die Nähe eines zärtlichen Paares in seinem Schlaf gestört, flieht er alsbald nach Neapel, nur um dort andere „August und Grete“ wiederzufinden. Da er aus deren Gesprächen zu entnehmen glaubt, daß die Mehrheit dieser Vogelpaare nicht im Sinne habe, zwischen dem Schutt von Pompeji zu nisten, sondern den Flug nach Capri zu richten, beschließt er, das zu tun, was sie nicht täten, und befindet sich „wider Erwarten und Absicht“ wenige Tage nach seiner Abreise in Pompeji.
Ohne aber dort die Ruhe zu finden, die er gesucht. Die Rolle, welche bis dahin die Hochzeitspaare gespielt, die sein Gemüt beunruhigt und seine Sinne belästigt hatten, wird jetzt von den Stubenfliegen übernommen, in denen er die Verkörperung des absolut Bösen und Überflüssigen zu erblicken geneigt wird. Beiderlei Quälgeister verschwimmen ihm zu einer Einheit; manche Fliegenpaare erinnern ihn an Hochzeitsreisende, reden sich vermutlich in ihrer Sprache auch „mein einziger August“ und „meine süße Grete“ an. Er kann endlich nicht umhin zu erkennen, „daß seine Unbefriedigung nicht allein durch das um ihn herum Befindliche verursacht werde, sondern etwas ihren Ursprung auch aus ihm selbst schöpfe“. (G. p. 42.) Er fühlt, „daß er mißmutig sei, weil ihm etwas fehle, ohne daß er sich aufhellen könne, was.“
Am nächsten Morgen begibt er sich durch den „Ingresso“ nach Pompeji und durchstreift nach Verabschiedung des Führers planlos die Stadt, merkwürdigerweise ohne sich dabei zu erinnern, daß er vor einiger Zeit im Traume bei der Verschüttung Pompejis zugegen gewesen. Als dann in der „heißen, heiligen“ Mittagsstunde, die ja den Alten als Geisterstunde galt, die anderen Besucher sich geflüchtet haben, und die Trümmerhaufen verödet und sonnenglanzübergossen vor ihm liegen, da regt sich in ihm die Fähigkeit, sich in das versunkene Leben zurückzuversetzen, aber nicht mit Hilfe der Wissenschaft. „Was diese lehrte, war eine leblose archäologische Anschauung, und was ihr vom Mund kam, eine tote, philologische Sprache. Die verhalfen zu keinem Begreifen mit der Seele, dem Gemüt, dem Herzen, wie man’s nennen wollte, sondern wer danach Verlangen in sich trug, der mußte als einzig Lebendiger allein in der heißen Mittagsstille hier zwischen den Überresten der Vergangenheit stehen, um nicht mit den körperlichen Augen zu sehen und nicht mit den leiblichen Ohren zu hören. Dann … wachten die Toten auf und Pompeji fing an, wieder zu leben.“ (G. p. 55.)
Während er so die Vergangenheit mit seiner Phantasie belebt, sieht er plötzlich die unverkennbare Gradiva seines Reliefs aus einem Hause heraustreten und leichtbehend über die Lavatrittsteine zur anderen Seite der Straße schreiten, ganz so, wie er sie im Traume jener Nacht gesehen, als sie sich wie zum Schlafen auf die Stufen des Apollotempels hingelegt hatte. „Und mit dieser Erinnerung zusammen kommt ihm noch etwas anderes zum erstenmal zum Bewußtsein: Er sei, ohne selbst von dem Antrieb in seinem Innern zu wissen, deshalb nach Italien und ohne Aufenthalt von Rom und Neapel bis Pompeji weitergefahren, um danach zu suchen, ob er hier Spuren von ihr auffinden könne. Und zwar im wörtlichen Sinne, denn bei ihrer besonderen Gangart mußte sie in der Asche einen von allen übrigen sich unterscheidenden Abdruck der Zehen hinterlassen haben.“ (G. p. 58.)
Die Spannung, in welcher der Dichter uns bisher erhalten hat, steigert sich hier an dieser Stelle für einen Augenblick zu peinlicher Verwirrung. Nicht nur, daß unser Held offenbar aus dem Gleichgewicht geraten ist, auch wir finden uns angesichts der Erscheinung der Gradiva, die bisher ein Stein- und dann ein Phantasiebild war, nicht zurecht. Ist’s eine Halluzination unseres vom Wahn betörten Helden, ein „wirkliches“ Gespenst oder eine leibhaftige Person? Nicht daß wir an Gespenster zu glauben brauchten, um diese Reihe aufzustellen. Der Dichter, der seine Erzählung ein „Phantasiestück“ benannte, hat ja noch keinen Anlaß gefunden, uns aufzuklären, ob er uns in unserer, als nüchtern verschrieenen, von den Gesetzen der Wissenschaft beherrschten Welt belassen oder in eine andere phantastische Welt führen will, in der Geistern und Gespenstern Wirklichkeit zugesprochen wird. Wie das Beispiel des Hamlet, des Macbeth, beweist, sind wir ohne Zögern bereit, ihm in eine solche zu folgen. Der Wahn des phantasievollen Archäologen wäre in diesem Falle an einem anderen Maßstabe zu messen. Ja, wenn wir bedenken, wie unwahrscheinlich die reale Existenz einer Person sein muß, die in ihrer Erscheinung jenes antike Steinbild getreulich wiederholt, so schrumpft unsere Reihe zu einer Alternative ein: Halluzination oder Mittagsgespenst. Ein kleiner Zug der Schilderung streicht dann bald die erstere Möglichkeit. Eine große Eidechse liegt bewegungslos im Sonnenlichte ausgestreckt, die aber vor dem herannahenden Fuß der Gradiva entflieht und sich über die Lavaplatten der Straßen davonringelt. Also keine Halluzination, etwas außerhalb der Sinne unseres Träumers. Aber sollte die Wirklichkeit einer Rediviva eine Eidechse stören können?