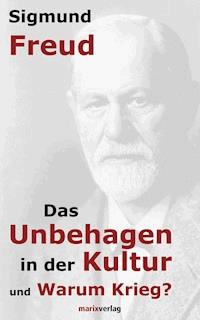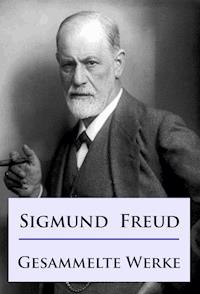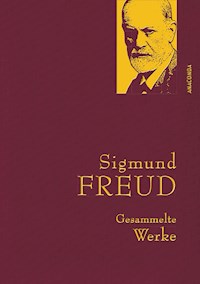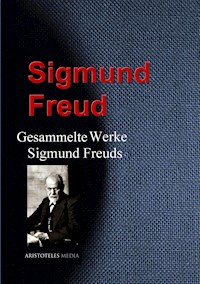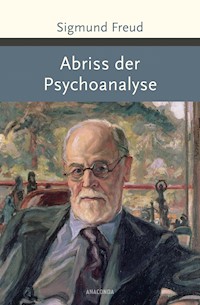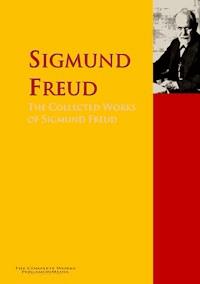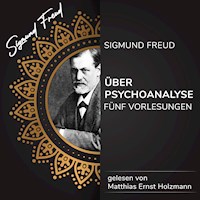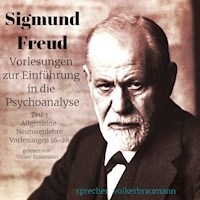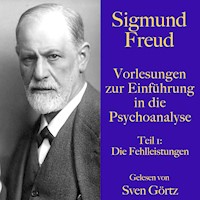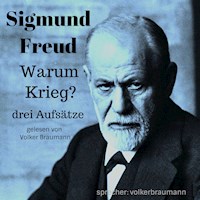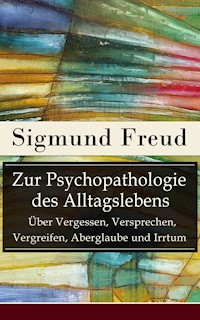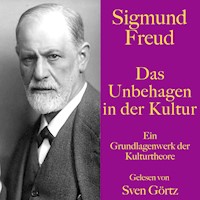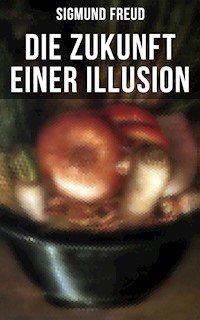44,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Gesammelte Werke in 18 Bänden mit einem Nachtragsband
- Sprache: Deutsch
Gesammelte Werke in Einzelbänden, Band XVI: Zur Gewinnung des Feuers Warum Krieg? Nachschrift und Selbstdarstellung Die Feinheit einer Fehlhandlung Konstruktionen in der Analyse Die endliche und die unendliche Analyse Der Mann Moses und die monotheistische Religion Thomas Mann zum 60. Geburtstag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Sigmund Freud
Band 16:Werke aus den Jahren 1932-1939
Fischer e-books
ZUR GEWINNUNG DES FEUERS
ZUR GEWINNUNG DES FEUERS
In einer Anmerkung meiner Schrift „Das Unbehagen in der Kultur“ (S. 449, Bd. XIV) habe ich – eher beiläufig – erwähnt, welche Vermutung über die Gewinnung des Feuers durch den Urmenschen man sich auf Grund des psychoanalytischen Materials bilden könnte. Der Widerspruch von Albrecht Schaeffer („Die Psychoanalytische Bewegung“, Jahrgang II, 1930, S. 251) und der überraschende Hinweis in vorstehender Mitteilung von Erlenmeyer[1] über das mongolische Verbot, auf Asche zu pissen[2], veranlassen mich, das Thema wieder aufzunehmen.[3]
Ich meine nämlich, daß meine Annahme, die Vorbedingung der Bemächtigung des Feuers sei der Verzicht auf die homosexuellbetonte Lust gewesen, es durch den Harnstrahl zu löschen, lasse {4}sich durch die Deutung der griechischen Prometheussage bestätigen, wenn man die zu erwartenden Entstellungen von der Tatsache bis zum Inhalt des Mythus in Betracht zieht. Diese Entstellungen sind von derselben Art und nicht ärger als jene, die wir alltäglich anerkennen, wenn wir aus den Träumen von Patienten ihre verdrängten, doch so überaus bedeutsamen Kindheitserlebnisse rekonstruieren. Die dabei verwendeten Mechanismen sind die Darstellung durch Symbole und die Verwandlung ins Gegenteil. Ich kann es nicht wagen, alle Züge des Mythus in solcher Art zu erklären; außer dem ursprünglichen Sachverhalt mögen andere und spätere Vorgänge zu seinem Inhalt beigetragen haben. Aber die Elemente, die eine analytische Deutung zulassen, sind doch die auffälligsten und wichtigsten, nämlich die Art, wie Prometheus das Feuer transportiert, der Charakter der Tat (Frevel, Diebstahl, Betrug an den Göttern) und der Sinn seiner Bestrafung.
Der Titane Prometheus, ein noch göttlicher Kulturheros,[4] vielleicht selbst ursprünglich ein Demiurg und Menschenschöpfer, bringt also den Menschen das Feuer, das er den Göttern entwendet hat, versteckt in einem hohlen Stock, Fenchelrohr. Einen solchen Gegenstand würden wir in einer Traumdeutung gern als Penissymbol verstehen wollen, wenngleich die nicht gewöhnliche Betonung der Höhlung uns dabei stört. Aber wie bringen wir dieses Penisrohr mit der Aufbewahrung des Feuers zusammen? Das scheint aussichtslos, bis wir uns an den im Traum so häufigen Vorgang der Verkehrung, Verwandlung ins Gegenteil, Umkehrung der Beziehungen erinnern, der uns so oft den Sinn des Traumes verbirgt. Nicht das Feuer beherbergt der Mensch in seinem Penisrohr, sondern im Gegenteil das Mittel, um das Feuer zu löschen, das Wasser seines Harnstrahls. An diese Beziehung zwischen Feuer und Wasser knüpft dann reiches, wohlbekanntes analytisches Material an.
Zweitens, der Erwerb des Feuers ist ein Frevel, es wird durch {5}Raub oder Diebstahl gewonnen. Dies ist ein konstanter Zug aller Sagen über die Gewinnung des Feuers, er findet sich bei den verschiedensten und entlegensten Völkern, nicht nur in der griechischen Sage vom Feuerbringer Prometheus. Hier muß also der wesentliche Inhalt der entstellten Menschheitsreminiszenz enthalten sein. Aber warum ist die Feuergewinnung untrennbar mit der Vorstellung eines Frevels verknüpft? Wer ist dabei der Geschädigte, Betrogene? Die Sage bei Hesiod gibt eine direkte Antwort, indem sie in einer anderen Erzählung, die nicht direkt mit dem Feuer zusammenhängt, Prometheus bei der Einrichtung der Opfer Zeus zugunsten der Menschen übervorteilen läßt. Also die Götter sind die Betrogenen! Den Göttern teilt der Mythus bekanntlich die Befriedigung aller Gelüste zu, auf die das Menschenkind verzichten muß, wie wir es vom Inzest her kennen. Wir würden in analytischer Ausdrucksweise sagen, das Triebleben, das Es, sei der durch die Feuerlöschentsagung betrogene Gott, ein menschliches Gelüste ist in der Sage in ein göttliches Vorrecht umgewandelt. Aber die Gottheit hat in der Sage nichts vom Charakter eines Über-Ichs, sie ist noch Repräsentant des übermächtigen Trieblebens.
Die Umwandlung ins Gegenteil ist am gründlichsten in einem dritten Zug der Sage, in der Bestrafung des Feuerbringers. Prometheus wird an einen Felsen geschmiedet, ein Geier frißt täglich an seiner Leber. Auch in den Feuersagen anderer Völker spielt ein Vogel eine Rolle, er muß etwas mit der Sache zu tun haben, ich enthalte mich zunächst der Deutung. Dagegen fühlen wir uns auf sicherem Boden, wenn es sich um die Erklärung handelt, warum die Leber zum Ort der Bestrafung gewählt ist. Die Leber galt den Alten als der Sitz aller Leidenschaften und Begierden; eine Strafe wie die des Prometheus war also das Richtige für einen triebhaften Verbrecher, der gefrevelt hatte unter dem Antrieb böser Gelüste. Das genaue Gegenteil trifft aber für den Feuerbringer zu; er hatte Triebverzicht geübt und gezeigt, wie wohltätig, aber auch wie unerläßlich ein solcher Triebverzicht in kultureller Absicht ist. Und {6}warum mußte eine solche kulturelle Wohltat überhaupt von der Sage als strafwürdiges Verbrechen behandelt werden? Nun, wenn sie durch alle Entstellungen durchschimmern läßt, daß die Gewinnung des Feuers einen Triebverzicht zur Voraussetzung hatte, so drückt sie doch unverhohlen den Groll aus, den die triebhafte Menschheit gegen den Kulturheros verspüren mußte. Und das stimmt zu unseren Einsichten und Erwartungen. Wir wissen, daß die Aufforderung zum Triebverzicht und die Durchsetzung desselben Feindseligkeit und Aggressionslust hervorruft, die sich erst in einer späteren Phase der psychischen Entwicklung in Schuldgefühl umsetzt.
Die Undurchsichtigkeit der Prometheussage wie anderer Feuermythen wird durch den Umstand gesteigert, daß das Feuer dem Primitiven als etwas der verliebten Leidenschaft Analoges – wir würden sagen: als Symbol der Libido – erscheinen mußte. Die Wärme, die das Feuer ausstrahlt, ruft dieselbe Empfindung hervor, die den Zustand sexueller Erregtheit begleitet, und die Flamme mahnt in Form und Bewegungen an den tätigen Phallus. Daß die Flamme dem mythischen Sinn als Phallus erschien, kann nicht zweifelhaft sein, noch die Abkunftsage des römischen Königs Servius Tullius zeugt dafür. Wenn wir selbst von dem zehrenden Feuer der Leidenschaft und von den züngelnden Flammen reden, also die Flamme einer Zunge vergleichen, haben wir uns vom Denken unserer primitiven Ahnen nicht so sehr weit entfernt. In unserer Herleitung der Feuergewinnung war ja auch die Voraussetzung enthalten, daß dem Urmenschen der Versuch, das Feuer durch sein eigenes Wasser zu löschen, ein lustvolles Ringen mit einem anderen Phallus bedeutete.
Auf dem Wege dieser symbolischen Angleichung mögen also auch andere, rein phantastische Elemente in den Mythus eingedrungen und in ihm mit den historischen verwebt worden sein. Man kann sich ja kaum der Idee erwehren, daß, wenn die Leber der Sitz der Leidenschaft ist, sie symbolisch dasselbe bedeutet wie das Feuer selbst und daß dann ihre tägliche Aufzehrung und Er{7}neuerung eine zutreffende Schilderung von dem Verhalten der Liebesgelüste ist, die, täglich befriedigt, sich täglich wiederherstellen. Dem Vogel, der sich an der Leber sättigt, fiele dabei die Bedeutung des Penis zu, die ihm auch sonst nicht fremd ist, wie Sagen, Träume, Sprachgebrauch und plastische Darstellungen aus dem Altertum erkennen lassen. Ein kleiner Schritt weiter führt zum Vogel Phönix, der aus jedem seiner Feuertode neu verjüngt hervorgeht, und der wahrscheinlich eher und früher den nach seiner Erschlaffung neu belebten Phallus gemeint hat als die im Abendrot untergehende und dann wieder aufgehende Sonne.
Man darf die Frage aufwerfen, ob man es der mythenbildenden Tätigkeit zumuten darf, sich – gleichsam spielerisch – in der verkleideten Darstellung allgemeinbekannter, wenn auch höchst interessanter seelischer Vorgänge mit körperlicher Äußerung zu versuchen ohne anderes Motiv als bloße Darstellungslust. Darauf kann man gewiß keine sichere Antwort geben, ohne das Wesen des Mythus verstanden zu haben, aber für unsere beiden Fälle ist es leicht, den nämlichen Inhalt und damit eine bestimmte Tendenz zu erkennen. Sie beschreiben die Wiederherstellung der libidinösen Gelüste nach ihrem Erlöschen durch eine Sättigung, also ihre Unzerstörbarkeit, und diese Hervorhebung ist als Trost durchaus an ihrem Platz, wenn der historische Kern des Mythus eine Niederlage des Trieblebens, einen notwendig gewordenen Triebverzicht behandelt. Es ist wie das zweite Stück der begreiflichen Reaktion des in seinem Triebleben gekränkten Urmenschen; nach der Bestrafung des Frevlers die Versicherung, daß er im Grunde doch nichts ausgerichtet hat.
An unerwarteter Stelle begegnen wir der Verkehrung ins Gegenteil in einem anderen Mythus, der anscheinend sehr wenig mit dem Feuermythus zu tun hat. Die lernäische Hydra mit ihren zahllosen züngelnden Schlangenköpfen – unter ihnen ein unsterblicher – ist nach dem Zeugnis ihres Namens ein Wasserdrache. Der Kulturheros Herakles bekämpft sie, indem er ihre {8}Köpfe abhaut, aber die wachsen immer nach, und er wird des Untiers erst Herr, nachdem er den unsterblichen Kopf mit Feuer ausgebrannt hat. Ein Wasserdrache, der durch das Feuer gebändigt wird – das ergibt doch keinen Sinn. Wohl aber, wie in so vielen Träumen, die Umkehrung des manifesten Inhalts. Dann ist die Hydra ein Brand, die züngelnden Schlangenköpfe sind die Flammen des Brandes, und als Beweis ihrer libidinösen Natur zeigen sie wie die Leber des Prometheus wieder das Phänomen des Nachwachsens, der Erneuerung nach der versuchten Zerstörung. Herakles löscht nun diesen Brand durch – Wasser. (Der unsterbliche Kopf ist wohl der Phallus selbst, seine Vernichtung die Kastration.) Herakles ist aber auch der Befreier des Prometheus, der den an der Leber fressenden Vogel tötet. Sollte man nicht einen tieferen Zusammenhang zwischen beiden Mythen erraten? Es ist ja so, als ob die Tat des einen Heros durch den anderen gutgemacht würde. Prometheus hatte die Löschung des Feuers verboten, – wie das Gesetz des Mongolen, – Herakles sie für den Fall des Unheil drohenden Brandes freigegeben. Der zweite Mythus scheint der Reaktion einer späteren Kulturzeit auf den Anlaß der Feuergewinnung zu entsprechen. Man gewinnt den Eindruck, daß man von hier aus ein ganzes Stück weit in die Geheimnisse des Mythus eindringen könnte, aber freilich wird man nur für eine kurze Strecke vom Gefühl der Sicherheit begleitet.
Für den Gegensatz von Feuer und Wasser, der das ganze Gebiet dieser Mythen beherrscht, ist außer dem historischen und dem symbolisch-phantastischen noch ein drittes Moment aufzeigbar, eine physiologische Tatsache, die der Dichter in den Zeilen beschreibt:
„Was dem Menschen dient zum Seichen, Damit schafft er Seinesgleichen.“ (Heine).
Das Glied des Mannes hat zwei Funktionen, deren Beisammensein manchem ein Ärgernis ist. Es besorgt die Entleerung des Harnes und es führt den Liebesakt aus, der das Sehnen der ge{9}nitalen Libido stillt. Das Kind glaubt noch, die beiden Funktionen vereinen zu können; nach seiner Theorie kommen die Kinder dadurch zustande, daß der Mann in den Leib des Weibes uriniert. Aber der Erwachsene weiß, daß die beiden Akte in Wirklichkeit unverträglich miteinander sind – so unverträglich wie Feuer und Wasser. Wenn das Glied in jenen Zustand von Erregung gerät, der ihm die Gleichstellung mit dem Vogel eingetragen hat, und während jene Empfindungen verspürt werden, die an die Wärme des Feuers mahnen, ist das Urinieren unmöglich; und umgekehrt, wenn das Glied der Entleerung des Körperwassers dient, scheinen alle seine Beziehungen zur Genitalfunktion erloschen. Der Gegensatz der beiden Funktionen könnte uns veranlassen zu sagen, daß der Mensch sein eigenes Feuer durch sein eigenes Wasser löscht. Und der Urmensch, der darauf angewiesen war, die Außenwelt mit Hilfe seiner eigenen Körperempfindungen und Körperverhältnisse zu begreifen, dürfte die Analogien, die ihm das Verhalten des Feuers zeigte, nicht unbemerkt und ungenützt gelassen haben.
WARUM KRIEG?
Im Jahre 1931 hat das „Comité permanent des Lettres et des Arts de la Société des Nations“ die Internationale Kommission für geistige Zusammenarbeit aufgefordert, „einen Briefwechsel zwischen den repräsentativen Vertretern des Geisteslebens anzuregen, ähnlich jenem Gedankenaustausch, der in dieser Form stets, vor allem in den großen Epochen der europäischen Geschichte stattgefunden hat; dafür Themen auszuwählen, die am besten geeignet sind, den gemeinsamen Interessen des Völkerbundes und des geistigen Lebens zu dienen; und diesen Briefwechsel periodisch zu veröffentlichen.“
In Ausführung dieses Beschlusses gab das Völkerbundsinstitut für geistige Zusammenarbeit (Institut International de Coopération Intellectuelle) in Paris eine Serie „Correspondance“, „Open letters“ heraus. Den Inhalt des zweiten Bandes dieser Serie, der Anfang 1933 unter dem Titel „Warum Krieg?“, „Pourquoi la guerre?“, „Why war?“ zugleich in deutscher, französischer und englischer Sprache in Paris erschienen ist (Copyright by Institut International de Coopération Intellectuelle) bilden ein Brief Albert Einsteins und der nachfolgende Brief des Verfassers. Die Übersetzung des deutschen Urtextes ins Französische hat Blaise Briod, die Übersetzung ins Englische Stuart Gilbert besorgt.
Albert Einstein hat in seinem vom 30. Juli 1932 datierten Brief an den Verfasser den Gegenstand des Briefaustausches in der Frage umrissen: „Gibt es einen Weg, die Menschen vom Verhängnis des Krieges zu befreien?“ Hier entstünden Probleme, die nur der Psychologe beleuchten kann. Albert Einstein entwickelt sodann seine Gedanken zur Aufgabe der Kriegsverhütung; er führt aus, daß ihm „die äußere, bzw. organisatorische Seite des Problems“ einfach erscheine: „Die Staaten schaffen eine legislative und gerichtliche Behörde zur Schlichtung aller zwischen ihnen entstehenden Konflikte“ und übernehmen die Verpflichtung, sich der Autorität dieser Behörde zu fügen. Hier begegne man der ersten Schwierigkeit: das Gericht, als menschliche Einrichtung, sei außerrechtlichen Einrichtungen umso zugänglicher, je weniger Macht es besitze. Wir seien aber derzeit weit davon entfernt, eine überstaatliche Organisation zu besitzen, die der Exekution ihres Erkenntnisses absoluten Gehorsam zu erzwingen imstande wäre. Im einzelnen formuliert Einstein folgende Fragen: „Wie ist es möglich, daß die soeben genannte Minderheit“ (sc. der Herrschenden) „die Masse des Volkes ihren Gelüsten dienstbar machen kann, die durch einen Krieg nur zu leiden und zu verlieren hat?“ ... „Wie ist es möglich, daß sich die Masse durch die genannten Mittel“ (i. e. die Minderheit der jeweils Herrschenden habe vor allem die Schule, die Presse und meistens auch die religiösen Organisationen in ihrer Hand) „bis zur Raserei und Selbstaufopferung entflammen läßt?“ ... „Gibt es eine Möglichkeit, die psychische Entwicklung der Menschen so zu leiten, daß sie den Psychosen des Hasses und des Vernichtens gegenüber widerstandsfähiger werden?“
Wien, im September 1932
Lieber Herr Einstein!
Als ich hörte, daß Sie die Absicht haben, mich zum Gedankenaustausch über ein Thema aufzufordern, dem Sie Ihr Interesse schenken und das Ihnen auch des Interesses Anderer würdig erscheint, stimmte ich bereitwillig zu. Ich erwartete, Sie würden ein Problem an der Grenze des heute Wißbaren wählen, zu dem ein jeder von uns, der Physiker wie der Psycholog, sich seinen besonderen Zugang bahnen könnte, so daß sie sich von verschiedenen Seiten her auf demselben Boden träfen. Sie haben mich dann durch die Fragestellung überrascht, was man tun könne, um das Verhängnis des Krieges von den Menschen abzuwehren. Ich erschrak zunächst unter dem Eindruck meiner – fast hätte ich gesagt: unserer – Inkompetenz, denn das erschien mir als eine praktische Aufgabe, die den Staatsmännern zufällt. Ich verstand dann aber, daß Sie die Frage nicht als Naturforscher und Physiker erhoben haben, sondern als Menschenfreund, der den Anregungen des Völkerbunds gefolgt war, ähnlich wie der Polarforscher Fridtjof Nansen es auf sich genommen hatte, den Hungernden und den heimatlosen Opfern des Weltkrieges Hilfe zu bringen. Ich besann mich auch, daß mir nicht zugemutet wird, praktische Vorschläge zu machen, sondern daß ich nur angeben soll, wie sich das Problem der Kriegsverhütung einer psychologischen Betrachtung darstellt.
Aber auch hierüber haben Sie in Ihrem Schreiben das meiste {14}gesagt. Sie haben mir gleichsam den Wind aus den Segeln genommen, aber ich fahre gern in Ihrem Kielwasser und bescheide mich damit, alles zu bestätigen, was Sie vorbringen, indem ich es nach meinem besten Wissen – oder Vermuten – breiter ausführe.
Sie beginnen mit dem Verhältnis von Recht und Macht. Das ist gewiß der richtige Ausgangspunkt für unsere Untersuchung. Darf ich das Wort „Macht“ durch das grellere, härtere Wort „Gewalt“ ersetzen? Recht und Gewalt sind uns heute Gegensätze. Es ist leicht zu zeigen, daß sich das eine aus dem anderen entwickelt hat, und wenn wir auf die Uranfänge zurückgehen und nachsehen, wie das zuerst geschehen ist, so fällt uns die Lösung des Problems mühelos zu. Entschuldigen Sie mich aber, wenn ich im folgenden allgemein Bekanntes und Anerkanntes erzähle, als ob es neu wäre; der Zusammenhang nötigt mich dazu.
Interessenkonflikte unter den Menschen werden also prinzipiell durch die Anwendung von Gewalt entschieden. So ist es im ganzen Tierreich, von dem der Mensch sich nicht ausschließen sollte; für den Menschen kommen allerdings noch Meinungskonflikte hinzu, die bis zu den höchsten Höhen der Abstraktion reichen und eine andere Technik der Entscheidung zu fordern scheinen. Aber das ist eine spätere Komplikation. Anfänglich, in einer kleinen Menschenhorde, entschied die stärkere Muskelkraft darüber, wem etwas gehören oder wessen Wille zur Ausführung gebracht werden sollte. Muskelkraft verstärkt und ersetzt sich bald durch den Gebrauch von Werkzeugen; es siegt, wer die besseren Waffen hat oder sie geschickter verwendet. Mit der Einführung der Waffe beginnt bereits die geistige Überlegenheit die Stelle der rohen Muskelkraft einzunehmen; die Endabsicht des Kampfes bleibt die nämliche, der eine Teil soll durch die Schädigung, die er erfährt, und durch die Lähmung seiner Kräfte gezwungen werden, seinen Anspruch oder Widerspruch aufzugeben. Dies wird am gründlichsten erreicht, wenn die Gewalt den Gegner dauernd beseitigt, also tötet. Es hat zwei Vorteile, daß er seine Gegnerschaft nicht ein andermal wieder auf{15}nehmen kann und daß sein Schicksal andere abschreckt, seinem Beispiel zu folgen. Außerdem befriedigt die Tötung des Feindes eine triebhafte Neigung, die später erwähnt werden muß. Der Tötungsabsicht kann sich die Erwägung widersetzen, daß der Feind zu nützlichen Dienstleistungen verwendet werden kann, wenn man ihn eingeschüchtert am Leben läßt. Dann begnügt sich also die Gewalt damit, ihn zu unterwerfen, anstatt ihn zu töten. Es ist der Anfang der Schonung des Feindes, aber der Sieger hat von nun an mit der lauernden Rachsucht des Besiegten zu rechnen, gibt ein Stück seiner eigenen Sicherheit auf.
Das ist also der ursprüngliche Zustand, die Herrschaft der größeren Macht, der rohen oder intellektuell gestützten Gewalt. Wir wissen, dies Regime ist im Laufe der Entwicklung abgeändert worden, es führte ein Weg von der Gewalt zum Recht, aber welcher? Nur ein einziger, meine ich. Er führte über die Tatsache, daß die größere Stärke des Einen wettgemacht werden konnte durch die Vereinigung mehrerer Schwachen. „L’union fait la force.“ Gewalt wird gebrochen durch Einigung, die Macht dieser Geeinigten stellt nun das Recht dar im Gegensatz zur Gewalt des Einzelnen. Wir sehen, das Recht ist die Macht einer Gemeinschaft. Es ist noch immer Gewalt, bereit sich gegen jeden Einzelnen zu wenden, der sich ihr widersetzt, arbeitet mit denselben Mitteln, verfolgt dieselben Zwecke; der Unterschied liegt wirklich nur darin, daß es nicht mehr die Gewalt eines Einzelnen ist, die sich durchsetzt, sondern die der Gemeinschaft. Aber damit sich dieser Übergang von der Gewalt zum neuen Recht vollziehe, muß eine psychologische Bedingung erfüllt werden. Die Einigung der Mehreren muß eine beständige, dauerhafte sein. Stellte sie sich nur zum Zweck der Bekämpfung des einen Übermächtigen her und zerfiele nach seiner Überwältigung, so wäre nichts erreicht. Der nächste, der sich für stärker hält, würde wiederum eine Gewaltherrschaft anstreben, und das Spiel würde sich endlos wiederholen. Die Gemeinschaft muß permanent erhalten werden, {16}sich organisieren, Vorschriften schaffen, die den gefürchteten Auflehnungen vorbeugen, Organe bestimmen, die über die Einhaltung der Vorschriften – Gesetze – wachen und die Ausführung der rechtmäßigen Gewaltakte besorgen. In der Anerkennung einer solchen Interessengemeinschaft stellen sich unter den Mitgliedern einer geeinigten Menschengruppe Gefühlsbindungen her, Gemeinschaftsgefühle, in denen ihre eigentliche Stärke beruht.
Damit, denke ich, ist alles Wesentliche bereits gegeben: die Überwindung der Gewalt durch Übertragung der Macht an eine größere Einheit, die durch Gefühlsbindungen ihrer Mitglieder zusammengehalten wird. Alles Weitere sind Ausführungen und Wiederholungen. Die Verhältnisse sind einfach, solange die Gemeinschaft nur aus einer Anzahl gleich starker Individuen besteht. Die Gesetze dieser Vereinigung bestimmen dann, auf welches Maß von persönlicher Freiheit, seine Kraft als Gewalt anzuwenden, der Einzelne verzichten muß, um ein gesichertes Zusammenleben zu ermöglichen. Aber ein solcher Ruhezustand ist nur theoretisch denkbar, in Wirklichkeit kompliziert sich der Sachverhalt dadurch, daß die Gemeinschaft von Anfang an ungleich mächtige Elemente umfaßt, Männer und Frauen, Eltern und Kinder, und bald infolge von Krieg und Unterwerfung Siegreiche und Besiegte, die sich in Herren und Sklaven umsetzen. Das Recht der Gemeinschaft wird dann zum Ausdruck der ungleichen Machtverhältnisse in ihrer Mitte, die Gesetze werden von und für die Herrschenden gemacht werden und den Unterworfenen wenig Rechte einräumen. Von da an gibt es in der Gemeinschaft zwei Quellen von Rechtsunruhe, aber auch von Rechtsfortbildung. Erstens die Versuche Einzelner unter den Herren, sich über die für alle gültigen Einschränkungen zu erheben, also von der Rechtsherrschaft auf die Gewaltherrschaft zurückzugreifen, zweitens die ständigen Bestrebungen der Unterdrückten, sich mehr Macht zu verschaffen und diese Änderungen im Gesetz anerkannt zu sehen, also im Gegenteil vom ungleichen Recht zum gleichen Recht für alle vorzu{17}dringen. Diese letztere Strömung wird besonders bedeutsam werden, wenn sich im Inneren des Gemeinwesens wirklich Verschiebungen der Machtverhältnisse ergeben, wie es infolge mannigfacher historischer Momente geschehen kann. Das Recht kann sich dann allmählich den neuen Machtverhältnissen anpassen, oder, was häufiger geschieht, die herrschende Klasse ist nicht bereit, dieser Änderung Rechnung zu tragen, es kommt zu Auflehnung, Bürgerkrieg, also zur zeitweiligen Aufhebung des Rechts und zu neuen Gewaltproben, nach deren Ausgang eine neue Rechtsordnung eingesetzt wird. Es gibt noch eine andere Quelle der Rechtsänderung, die sich nur in friedlicher Weise äußert, das ist die kulturelle Wandlung der Mitglieder des Gemeinwesens, aber die gehört in einen Zusammenhang, der erst später berücksichtigt werden kann.
Wir sehen also, auch innerhalb eines Gemeinwesens ist die gewaltsame Erledigung von Interessenkonflikten nicht vermieden worden. Aber die Notwendigkeiten und Gemeinsamkeiten, die sich aus dem Zusammenleben auf demselben Boden ableiten, sind einer raschen Beendigung solcher Kämpfe günstig und die Wahrscheinlichkeit friedlicher Lösungen unter diesen Bedingungen nimmt stetig zu. Ein Blick in die Menschheitsgeschichte zeigt uns aber eine unaufhörliche Reihe von Konflikten zwischen einem Gemeinwesen und einem oder mehreren anderen, zwischen größeren und kleineren Einheiten, Stadtgebieten, Landschaften, Stämmen, Völkern, Reichen, die fast immer durch die Kraftprobe des Krieges entschieden werden. Solche Kriege gehen entweder in Beraubung oder in volle Unterwerfung, Eroberung des einen Teils, aus. Man kann die Eroberungskriege nicht einheitlich beurteilen. Manche, wie die der Mongolen und Türken, haben nur Unheil gebracht, andere im Gegenteil zur Umwandlung von Gewalt in Recht beigetragen, indem sie größere Einheiten herstellten, innerhalb deren nun die Möglichkeit der Gewaltanwendung aufgehört hatte und eine neue Rechtsordnung die Konflikte schlichtete. So haben die Eroberungen der Römer den Mittelmeerländern die kostbare pax {18}romana gegeben. Die Vergrößerungslust der französischen Könige hat ein friedlich geeinigtes, blühendes Frankreich geschaffen. So paradox es klingt, man muß doch zugestehen, der Krieg wäre kein ungeeignetes Mittel zur Herstellung des ersehnten „ewigen“ Friedens, weil er imstande ist, jene großen Einheiten zu schaffen, innerhalb deren eine starke Zentralgewalt weitere Kriege unmöglich macht. Aber er taugt doch nicht dazu, denn die Erfolge der Eroberung sind in der Regel nicht dauerhaft; die neu geschaffenen Einheiten zerfallen wieder, meist infolge des mangelnden Zusammenhalts der gewaltsam geeinigten Teile. Und außerdem konnte die Eroberung bisher nur partielle Einigungen, wenn auch von größerem Umfang, schaffen, deren Konflikte die gewaltsame Entscheidung erst recht herausforderten. So ergab sich als die Folge all dieser kriegerischen Anstrengungen nur, daß die Menschheit zahlreiche, ja unaufhörliche Kleinkriege gegen seltene, aber umsomehr verheerende Großkriege eintauschte.
Auf unsere Gegenwart angewendet ergibt sich das gleiche Resultat, zu dem Sie auf kürzerem Weg gelangt sind. Eine sichere Verhütung der Kriege ist nur möglich, wenn sich die Menschen zur Einsetzung einer Zentralgewalt einigen, welcher der Richtspruch in allen Interessenkonflikten übertragen wird. Hier sind offenbar zwei Forderungen vereinigt, daß eine solche übergeordnete Instanz geschaffen und daß ihr die erforderliche Macht gegeben werde. Das eine allein würde nicht nützen. Nun ist der Völkerbund als solche Instanz gedacht, aber die andere Bedingung ist nicht erfüllt; der Völkerbund hat keine eigene Macht und kann sie nur bekommen, wenn die Mitglieder der neuen Einigung, die einzelnen Staaten, sie ihm abtreten. Dazu scheint aber derzeit wenig Aussicht vorhanden. Man stünde der Institution des Völkerbundes nun ganz ohne Verständnis gegenüber, wenn man nicht wüßte, daß hier ein Versuch vorliegt, der in der Geschichte der Menschheit nicht oft – vielleicht noch nie in diesem Maß – gewagt worden ist. Es ist der Versuch, die Autorität, – d. i. den zwingenden Ein{19}fluß, – die sonst auf dem Besitz der Macht ruht, durch die Berufung auf bestimmte ideelle Einstellungen zu erwerben. Wir haben gehört, was eine Gemeinschaft zusammenhält, sind zwei Dinge: der Zwang der Gewalt und die Gefühlsbindungen – Identifizierungen heißt man sie technisch – der Mitglieder. Fällt das eine Moment weg, so kann möglicherweise das andere die Gemeinschaft aufrecht halten. Jene Ideen haben natürlich nur dann eine Bedeutung, wenn sie wichtigen Gemeinsamkeiten der Mitglieder Ausdruck geben. Es fragt sich dann, wie stark sie sind. Die Geschichte lehrt, daß sie in der Tat ihre Wirkung geübt haben. Die panhellenische Idee z. B., das Bewußtsein, daß man etwas Besseres sei als die umwohnenden Barbaren, das in den Amphiktyonien, den Orakeln und Festspielen so kräftigen Ausdruck fand, war stark genug, um die Sitten der Kriegsführung unter Griechen zu mildern, aber selbstverständlich nicht imstande, kriegerische Streitigkeiten zwischen den Partikeln des Griechenvolkes zu verhüten, ja nicht einmal, um eine Stadt oder einen Städtebund abzuhalten, sich zum Schaden eines Rivalen mit dem Perserfeind zu verbünden. Ebensowenig hat das christliche Gemeingefühl, das doch mächtig genug war, im Renaissancezeitalter christliche Klein- und Großstaaten daran gehindert, in ihren Kriegen miteinander um die Hilfe des Sultans zu werben. Auch in unserer Zeit gibt es keine Idee, der man eine solche einigende Autorität zumuten könnte. Daß die heute die Völker beherrschenden nationalen Ideale zu einer gegenteiligen Wirkung drängen, ist ja allzu deutlich. Es gibt Personen, die vorhersagen, erst das allgemeine Durchdringen der bolschewistischen Denkungsart werde den Kriegen ein Ende machen können, aber von solchem Ziel sind wir heute jedenfalls weit entfernt, und vielleicht wäre es nur nach schrecklichen Bürgerkriegen erreichbar. So scheint es also, daß der Versuch, reale Macht durch die Macht der Ideen zu ersetzen, heute noch zum Fehlschlagen verurteilt ist. Es ist ein Fehler in der Rechnung, wenn man nicht berücksichtigt, daß Recht ursprüng{20}lich rohe Gewalt war und noch heute der Stützung durch die Gewalt nicht entbehren kann.
Ich kann nun daran gehen, einen anderen Ihrer Sätze zu glossieren. Sie verwundern sich darüber, daß es so leicht ist, die Menschen für den Krieg zu begeistern, und vermuten, daß etwas in ihnen wirksam ist, ein Trieb zum Hassen und Vernichten, der solcher Verhetzung entgegenkommt. Wiederum kann ich Ihnen nur uneingeschränkt beistimmen. Wir glauben an die Existenz eines solchen Triebes und haben uns gerade in den letzten Jahren bemüht, seine Äußerungen zu studieren. Darf ich Ihnen aus diesem Anlaß ein Stück der Trieblehre vortragen, zu der wir in der Psychoanalyse nach vielem Tasten und Schwanken gekommen sind? Wir nehmen an, daß die Triebe des Menschen nur von zweierlei Art sind, entweder solche, die erhalten und vereinigen wollen, – wir heißen sie erotische, ganz im Sinne des Eros im Symposion Platos, oder sexuelle mit bewußter Überdehnung des populären Begriffs von Sexualität, – und andere, die zerstören und töten wollen; wir fassen diese als Aggressionstrieb oder Destruktionstrieb zusammen. Sie sehen, das ist eigentlich nur die theoretische Verklärung des weltbekannten Gegensatzes von Lieben und Hassen, der vielleicht zu der Polarität von Anziehung und Abstoßung eine Urbeziehung unterhält, die auf Ihrem Gebiet eine Rolle spielt. Nun lassen Sie uns nicht zu rasch mit den Wertungen von Gut und Böse einsetzen. Der eine dieser Triebe ist ebenso unerläßlich wie der andere, aus dem Zusammen- und Gegeneinanderwirken der Beiden gehen die Erscheinungen des Lebens hervor. Nun scheint es, daß kaum jemals ein Trieb der einen Art sich isoliert betätigen kann, er ist immer mit einem gewissen Betrag von der anderen Seite verbunden, wie wir sagen: legiert, der sein Ziel modifiziert oder ihm unter Umständen dessen Erreichung erst möglich macht. So ist z. B. der Selbsterhaltungstrieb gewiß erotischer Natur, aber gerade er bedarf der Verfügung über die Aggression, wenn er seine Absicht durchsetzen soll. Ebenso benötigt {21}der auf Objekte gerichtete Liebestrieb eines Zusatzes vom Bemächtigungstrieb, wenn er seines Objekts überhaupt habhaft werden soll. Die Schwierigkeit, die beiden Triebarten in ihren Äußerungen zu isolieren, hat uns ja solange in ihrer Erkenntnis behindert.
Wenn Sie mit mir ein Stück weitergehen wollen, so hören Sie, daß die menschlichen Handlungen noch eine Komplikation von anderer Art erkennen lassen. Ganz selten ist die Handlung das Werk einer einzigen Triebregung, die an und für sich bereits aus Eros und Destruktion zusammengesetzt sein muß. In der Regel müssen mehrere in der gleichen Weise aufgebaute Motive zusammentreffen, um die Handlung zu ermöglichen. Einer Ihrer Fachgenossen hat das bereits gewußt, ein Prof. G. Ch. Lichtenberg, der zur Zeit unserer Klassiker in Göttingen Physik lehrte; aber vielleicht war er als Psycholog noch bedeutender denn als Physiker. Er erfand die Motivenrose, indem er sagte: „Die Bewegungsgründe[5] woraus man etwas tut, könnten so wie die 32 Winde geordnet und ihre Namen auf eine ähnliche Art formiert werden, z. B. Brot – Brot – Ruhm oder Ruhm – Ruhm – Brot“. Wenn also die Menschen zum Krieg aufgefordert werden, so mögen eine ganze Anzahl von Motiven in ihnen zustimmend antworten, edle und gemeine, solche, von denen man laut spricht, und andere, die man beschweigt. Wir haben keinen Anlaß sie alle bloßzulegen. Die Lust an der Aggression und Destruktion ist gewiß darunter; ungezählte Grausamkeiten der Geschichte und des Alltags bekräftigen ihre Existenz und ihre Stärke. Die Verquickung dieser destruktiven Strebungen mit anderen, erotischen und ideellen, erleichtert natürlich deren Befriedigung. Manchmal haben wir, wenn wir von den Greueltaten der Geschichte hören, den Eindruck, die ideellen Motive hätten den destruktiven Gelüsten nur als Vorwände gedient, andere Male, z. B. bei den Grausamkeiten der heiligen Inquisition, meinen wir, die ideellen Motive hätten sich {22}im Bewußtsein vorgedrängt, die destruktiven ihnen eine unbewußte Verstärkung gebracht. Beides ist möglich.
Ich habe Bedenken, Ihr Interesse zu mißbrauchen, das ja der Kriegsverhütung gilt, nicht unseren Theorien. Doch möchte ich noch einen Augenblick bei unserem Destruktionstrieb verweilen, dessen Beliebtheit keineswegs Schritt hält mit seiner Bedeutung. Mit etwas Aufwand von Spekulation sind wir nämlich zu der Auffassung gelangt, daß dieser Trieb innerhalb jedes lebenden Wesens arbeitet und dann das Bestreben hat, es zum Zerfall zu bringen, das Leben zum Zustand der unbelebten Materie zurückzuführen. Er verdiente in allem Ernst den Namen eines Todestriebes, während die erotischen Triebe die Bestrebungen zum Leben repräsentieren. Der Todestrieb wird zum Destruktionstrieb, indem er mit Hilfe besonderer Organe nach außen, gegen die Objekte, gewendet wird. Das Lebewesen bewahrt sozusagen sein eigenes Leben dadurch, daß es fremdes zerstört. Ein Anteil des Todestriebes verbleibt aber im Innern des Lebewesens tätig und wir haben versucht, eine ganze Anzahl von normalen und pathologischen Phänomenen von dieser Verinnerlichung des Destruktionstriebes abzuleiten. Wir haben sogar die Ketzerei begangen, die Entstehung unseres Gewissens durch eine solche Wendung der Aggression nach innen zu erklären. Sie merken, es ist gar nicht so unbedenklich, wenn sich dieser Vorgang in allzu großem Ausmaß vollzieht, es ist direkt ungesund, während die Wendung dieser Triebkräfte zur Destruktion in der Außenwelt das Lebewesen entlastet, wohltuend wirken muß. Das diene zur biologischen Entschuldigung all der häßlichen und gefährlichen Strebungen, gegen die wir ankämpfen. Man muß zugeben, sie sind der Natur näher als unser Widerstand dagegen, für den wir auch noch eine Erklärung finden müssen. Vielleicht haben Sie den Eindruck, unsere Theorien seien eine Art von Mythologie, nicht einmal eine erfreuliche in diesem Fall. Aber läuft nicht jede Naturwissenschaft auf eine solche Art von Mythologie hinaus? Geht es Ihnen heute in der Physik anders?
Aus dem Vorstehenden entnehmen wir für unsere nächsten Zwecke soviel, daß es keine Aussicht hat, die aggressiven Neigungen der Menschen abschaffen zu wollen. Es soll in glücklichen Gegenden der Erde, wo die Natur alles, was der Mensch braucht, überreichlich zur Verfügung stellt, Völkerstämme geben, deren Leben in Sanftmut verläuft, bei denen Zwang und Aggression unbekannt sind. Ich kann es kaum glauben, möchte gern mehr über diese Glücklichen erfahren. Auch die Bolschewisten hoffen, daß sie die menschliche Aggression zum Verschwinden bringen können dadurch, daß sie die Befriedigung der materiellen Bedürfnisse verbürgen und sonst Gleichheit unter den Teilnehmern an der Gemeinschaft herstellen. Ich halte das für eine Illusion. Vorläufig sind sie auf das sorgfältigste bewaffnet und halten ihre Anhänger nicht zum mindesten durch den Haß gegen alle Außenstehenden zusammen. Übrigens handelt es sich, wie Sie selbst bemerken, nicht darum, die menschliche Aggressionsneigung völlig zu beseitigen; man kann versuchen, sie so weit abzulenken, daß sie nicht ihren Ausdruck im Kriege finden muß.
Von unserer mythologischen Trieblehre her finden wir leicht eine Formel für die indirekten Wege zur Bekämpfung des Krieges. Wenn die Bereitwilligkeit zum Krieg ein Ausfluß des Destruktionstriebs ist, so liegt es nahe, gegen sie den Gegenspieler dieses Triebes, den Eros, anzurufen. Alles, was Gefühlsbindungen unter den Menschen herstellt, muß dem Krieg entgegenwirken. Diese Bindungen können von zweierlei Art sein. Erstens Beziehungen wie zu einem Liebesobjekt, wenn auch ohne sexuelle Ziele. Die Psychoanalyse braucht sich nicht zu schämen, wenn sie hier von Liebe spricht, denn die Religion sagt dasselbe: Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst. Das ist nun leicht gefordert, aber schwer zu erfüllen. Die andere Art von Gefühlsbindung ist die durch Identifizierung. Alles was bedeutsame Gemeinsamkeiten unter den Menschen herstellt, ruft solche Gemeingefühle, Identifizierungen, hervor. Auf ihnen ruht zum guten Teil der Aufbau der menschlichen Gesellschaft.
Einer Klage von Ihnen über den Mißbrauch der Autorität entnehme ich einen zweiten Wink zur indirekten Bekämpfung der Kriegsneigung. Es ist ein Stück der angeborenen und nicht zu beseitigenden Ungleichheit der Menschen, daß sie in Führer und in Abhängige zerfallen. Die letzteren sind die übergroße Mehrheit, sie bedürfen einer Autorität, welche für sie Entscheidungen fällt, denen sie sich meist bedingungslos unterwerfen. Hier wäre anzuknüpfen, man müßte mehr Sorge als bisher aufwenden, um eine Oberschicht selbständig denkender, der Einschüchterung unzugänglicher, nach Wahrheit ringender Menschen zu erziehen, denen die Lenkung der unselbständigen Massen zufallen würde. Daß die Übergriffe der Staatsgewalten und das Denkverbot der Kirche einer solchen Aufzucht nicht günstig sind, bedarf keines Beweises. Der ideale Zustand wäre natürlich eine Gemeinschaft von Menschen, die ihr Triebleben der Diktatur der Vernunft unterworfen haben. Nichts anderes könnte eine so vollkommene und widerstandsfähige Einigung der Menschen hervorrufen, selbst unter Verzicht auf die Gefühlsbindungen zwischen ihnen. Aber das ist höchst wahrscheinlich eine utopische Hoffnung. Die anderen Wege einer indirekten Verhinderung des Krieges sind gewiß eher gangbar, aber sie versprechen keinen raschen Erfolg. Ungern denkt man an Mühlen, die so langsam mahlen, daß man verhungern könnte, ehe man das Mehl bekommt.
Sie sehen, es kommt nicht viel dabei heraus, wenn man bei dringenden praktischen Aufgaben den weltfremden Theoretiker zu Rate zieht. Besser, man bemüht sich in jedem einzelnen Fall, der Gefahr zu begegnen mit den Mitteln, die eben zur Hand sind. Ich möchte aber noch eine Frage behandeln, die Sie in Ihrem Schreiben nicht aufwerfen und die mich besonders interessiert. Warum empören wir uns so sehr gegen den Krieg, Sie und ich und so viele andere, warum nehmen wir ihn nicht hin wie eine andere der vielen peinlichen Notlagen des Lebens? Er scheint doch naturgemäß, biologisch wohl begründet, praktisch kaum vermeidbar. {25}Entsetzen Sie sich nicht über meine Fragestellung. Zum Zweck einer Untersuchung darf man vielleicht die Maske einer Überlegenheit vornehmen, über die man in Wirklichkeit nicht verfügt. Die Antwort wird lauten, weil jeder Mensch ein Recht auf sein eigenes Leben hat, weil der Krieg hoffnungsvolle Menschenleben vernichtet, den einzelnen Menschen in Lagen bringt, die ihn entwürdigen, ihn zwingt, andere zu morden, was er nicht will, kostbare materielle Werte, Ergebnis von Menschenarbeit, zerstört, und anderes mehr. Auch daß der Krieg in seiner gegenwärtigen Gestaltung keine Gelegenheit mehr gibt, das alte heldische Ideal zu erfüllen, und daß ein zukünftiger Krieg infolge der Vervollkommnung der Zerstörungsmittel die Ausrottung eines oder vielleicht beider Gegner bedeuten würde. Das ist alles wahr und scheint so unbestreitbar, daß man sich nur verwundert, wenn das Kriegführen noch nicht durch allgemeine menschliche Übereinkunft verworfen worden ist. Man kann zwar über einzelne dieser Punkte diskutieren. Es ist fraglich, ob die Gemeinschaft nicht auch ein Recht auf das Leben des Einzelnen haben soll; man kann nicht alle Arten von Krieg in gleichem Maß verdammen; solange es Reiche und Nationen gibt, die zur rücksichtslosen Vernichtung anderer bereit sind, müssen diese anderen zum Krieg gerüstet sein. Aber wir wollen über all das rasch hinweggehen, das ist nicht die Diskussion, zu der Sie mich aufgefordert haben. Ich ziele auf etwas anderes hin; ich glaube, der Hauptgrund, weshalb wir uns gegen den Krieg empören, ist, daß wir nicht anders können. Wir sind Pazifisten, weil wir es aus organischen Gründen sein müssen. Wir haben es dann leicht, unsere Einstellung durch Argumente zu rechtfertigen.
Das ist wohl ohne Erklärung nicht zu verstehen. Ich meine das Folgende: Seit unvordenklichen Zeiten zieht sich über die Menschheit der Prozeß der Kulturentwicklung hin. (Ich weiß, andere heißen ihn lieber: Zivilisation.) Diesem Prozeß verdanken wir das Beste, was wir geworden sind, und ein gut Teil von {26}dem, woran wir leiden. Seine Anlässe und Anfänge sind dunkel, sein Ausgang ungewiß, einige seiner Charaktere leicht ersichtlich. Vielleicht führt er zum Erlöschen der Menschenart, denn er beeinträchtigt die Sexualfunktion in mehr als einer Weise, und schon heute vermehren sich unkultivierte Rassen und zurückgebliebene Schichten der Bevölkerung stärker als hochkultivierte. Vielleicht ist dieser Prozeß mit der Domestikation gewisser Tierarten vergleichbar; ohne Zweifel bringt er körperliche Veränderungen mit sich; man hat sich noch nicht mit der Vorstellung vertraut gemacht, daß die Kulturentwickelung ein solcher organischer Prozeß sei. Die mit dem Kulturprozeß einhergehenden psychischen Veränderungen sind auffällig und unzweideutig. Sie bestehen in einer fortschreitenden Verschiebung der Triebziele und Einschränkung der Triebregungen. Sensationen, die unseren Vorahnen lustvoll waren, sind für uns indifferent oder selbst unleidlich geworden; es hat organische Begründungen, wenn unsere ethischen und ästhetischen Idealforderungen sich geändert haben. Von den psychologischen Charakteren der Kultur scheinen zwei die wichtigsten: die Erstarkung des Intellekts, der das Triebleben zu beherrschen beginnt, und die Verinnerlichung der Aggressionsneigung mit all ihren vorteilhaften und gefährlichen Folgen. Den psychischen Einstellungen, die uns der Kulturprozeß aufnötigt, widerspricht nun der Krieg in der grellsten Weise, darum müssen wir uns gegen ihn empören, wir vertragen ihn einfach nicht mehr, es ist nicht bloß eine intellektuelle und affektive Ablehnung, es ist bei uns Pazifisten eine konstitutionelle Intoleranz, eine Idiosynkrasie gleichsam in äußerster Vergrößerung. Und zwar scheint es, daß die ästhetischen Erniedrigungen des Krieges nicht viel weniger Anteil an unserer Auflehnung haben als seine Grausamkeiten.
Wie lange müssen wir nun warten, bis auch die Anderen Pazifisten werden? Es ist nicht zu sagen, aber vielleicht ist es keine utopische Hoffnung, daß der Einfluß dieser beiden Momente, der {27}kulturellen Einstellung und der berechtigten Angst vor den Wirkungen eines Zukunftskrieges, dem Kriegführen in absehbarer Zeit ein Ende setzen wird. Auf welchen Wegen oder Umwegen, können wir nicht erraten. Unterdes dürfen wir uns sagen: Alles, was die Kulturentwicklung fördert, arbeitet auch gegen den Krieg.
Ich grüße Sie herzlich und bitte Sie um Verzeihung, wenn meine Ausführungen Sie enttäuscht haben.
Ihr
Sigm. Freud
NACHSCHRIFT 1935 ZUR „SELBSTDARSTELLUNG“
NACHSCHRIFT 1935[6]
Der Herausgeber dieser Sammlung von „Selbstdarstellungen“ hatte es meines Wissens nicht in Aussicht genommen, daß eine derselben nach Ablauf eines gewissen Zeitraums eine Fortsetzung finden sollte. Es ist möglich, daß es hier zum ersten Mal geschieht. Anlaß zu diesem Unternehmen wurde der Wunsch des amerikanischen Verlegers, die kleine Schrift seinem Publikum in einer neuen Ausgabe vorzulegen. Sie war zuerst im Jahre 1927 in Amerika (bei Brentano) erschienen unter dem Titel „An Autobiographical Study“, aber ungeschickter Weise mit einem anderen Essay verkoppelt und durch dessen Titel „The Problem of Lay-Analyses“ verdeckt. Zwei Themen ziehen sich durch diese Arbeit, das meiner Lebensschicksale und das der Geschichte der Psychoanalyse. Sie treten in die innigste Verbindung zueinander. Die „Selbstdarstellung“ zeigt, wie die Psychoanalyse mein Lebensinhalt wird, und folgt dann der berechtigten Annahme, daß nichts, was mir persönlich begegnet ist, neben meinen Beziehungen zur Wissenschaft Interesse verdient. Kurz vor der Abfassung der „Selbstdarstellung“ hatte es den Anschein gehabt, als würde mein Leben durch die Rezidive einer bösartigen Erkrankung zu einem baldigen Abschluß kommen; allein die Kunst des {32}Chirurgen hatte mir 1923 Rettung gebracht und ich blieb lebens- und leistungsfähig, wenn auch nie mehr beschwerdefrei. In den mehr als zehn Jahren seither habe ich nicht aufgehört, analytisch zu arbeiten und zu publizieren, wie meine mit dem XII. Band abgeschlossenen „Gesammelten Schriften“ (beim Internat. Psychoanalyt. Verlag in Wien) erweisen. Aber ich finde selbst einen bedeutsamen Unterschied gegen früher. Fäden, die sich in meiner Entwicklung miteinander verschlungen hatten, begannen sich voneinander zu lösen, später erworbene Interessen sind zurückgetreten und ältere, ursprünglichere, haben sich wieder durchgesetzt. Zwar habe ich in diesem letzten Dezennium noch manch wichtiges Stück analytischer Arbeit unternommen, wie die Revision des Angstproblems in der Schrift „Hemmung, Symptom und Angst“ 1926, oder es gelang mir 1927 die glatte Aufklärung des sexuellen „Fetischismus“; aber es ist doch richtig zu sagen, daß ich seit der Aufstellung der zwei Triebarten (Eros und Todestrieb) und der Zerlegung der psychischen Persönlichkeit in Ich, Über-Ich und Es (1923) keine entscheidenden Beiträge mehr zur Psychoanalyse geliefert, und was ich später geschrieben habe, hätte schadlos wegbleiben können oder wäre bald von anderer Seite beigebracht worden. Dies hing mit einer Wandlung bei mir zusammen, mit einem Stück regressiver Entwicklung, wenn man es so nennen will. Nach dem lebenslangen Umweg über die Naturwissenschaften, Medizin und Psychotherapie war mein Interesse zu jenen kulturellen Problemen zurückgekehrt, die dereinst den kaum zum Denken erwachten Jüngling gefesselt hatten. Bereits mitten auf der Höhe der psychoanalytischen Arbeit, im Jahre 1912, hatte ich in „Totem und Tabu“ den Versuch gemacht, die neu gewonnenen analytischen Einsichten zur Erforschung der Ursprünge von Religion und Sittlichkeit auszunützen. Zwei spätere Essays „Die Zukunft einer Illusion“ 1927 und „Das Unbehagen in der Kultur“ 1930 setzten dann diese Arbeitsrichtung fort. Immer klarer erkannte ich, daß die Geschehnisse der Menschheitsgeschichte, die Wechselwirkungen zwischen Menschennatur, Kulturentwicklung und jenen Niederschlägen {33}urzeitlicher Erlebnisse, als deren Vertretung sich die Religion vordrängt, nur die Spiegelung der dynamischen Konflikte zwischen Ich, Es und Über-Ich sind, welche die Psychoanalyse beim Einzelmenschen studiert, die gleichen Vorgänge, auf einer weiteren Bühne wiederholt. In der „Zukunft einer Illusion“ hatte ich die Religion hauptsächlich negativ gewürdigt; ich fand später die Formel, die ihr bessere Gerechtigkeit erweist: ihre Macht beruhe allerdings auf ihrem Wahrheitsgehalt, aber diese Wahrheit sei keine materielle, sondern eine historische.
Diese von der Psychoanalyse ausgehenden, aber weit über sie hinausgreifenden Studien haben vielleicht mehr Anklang beim Publikum gefunden als die Psychoanalyse selbst. Sie mögen ihren Anteil an der Entstehung der kurzlebigen Illusion gehabt haben, daß man zu den Autoren gehört, denen eine große Nation wie die deutsche bereit ist, Gehör zu schenken. Es war im Jahre 1929, daß Thomas Mann, einer der berufensten Wortführer des deutschen Volkes, mir eine Stellung in der modernen Geistesgeschichte zuwies in ebenso inhaltsvollen wie wohlwollenden Sätzen. Wenig später wurde meine Tochter Anna auf dem Rathaus von Frankfurt a. M. gefeiert, als sie dort in meiner Vertretung erschienen war, um den mir verliehenen Goethepreis für 1930 zu holen. Es war der Höhepunkt meines bürgerlichen Lebens; kurze Zeit nachher hatte sich unser Vaterland verengt und die Nation wollte nichts von uns wissen.
Hier darf ich mir gestatten, meine autobiographischen Mitteilungen abzuschließen. Was sonst meine persönlichen Verhältnisse, meine Kämpfe, Enttäuschungen und Erfolge betrifft, so hat die Öffentlichkeit kein Recht, mehr davon zu erfahren. Ich bin ohnedies in einigen meiner Schriften – Traumdeutung, Alltagsleben – offenherziger und aufrichtiger gewesen, als Personen zu sein pflegen, die ihr Leben für die Mit- oder Nachwelt beschreiben. Man hat mir wenig Dank dafür gewußt; ich kann nach meinen Erfahrungen niemand raten, es mir gleichzutun.
Noch einige Worte über die Schicksale der Psychoanalyse in diesem {34}letzten Jahrzehnt! Es ist kein Zweifel mehr, daß sie fortbestehen wird, sie hat ihre Lebens- und Entwicklungsfähigkeit erwiesen als Wissenszweig wie als Therapie. Die Anzahl ihrer Anhänger, die in der „Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung“ organisiert sind, hat sich erheblich vermehrt; zu den älteren Ortsgruppen Wien, Berlin, Budapest, London, Holland, Schweiz sind neue hinzugekommen in Paris, Calcutta, zwei in Japan, mehrere in den Vereinigten Staaten, zuletzt je eine in Jerusalem, Südafrika und zwei in Skandinavien. Diese Ortsgruppen unterhalten aus ihren eigenen Mitteln Lehrinstitute, in denen die Unterweisung in der Psychoanalyse nach einem einheitlichen Lehrplan geübt wird, und Ambulatorien, in denen erfahrene Analytiker wie Zöglinge den Bedürftigen unentgeltliche Behandlung geben, oder sie sind um die Schöpfung solcher Institute bemüht. Die Mitglieder der I. P. V. treffen jedes zweite Jahr in Kongressen zusammen, in denen wissenschaftliche Vorträge gehalten und Fragen der Organisation entschieden werden. Der XIII. dieser Kongresse, die ich selbst nicht mehr besuchen kann, fand 1934 in Luzern statt. Die Bestrebungen der Mitglieder gehen von dem allen Gemeinsamen aus nach verschiedenen Richtungen auseinander. Die einen legen den Hauptwert in die Klärung und Vertiefung der psychologischen Erkenntnisse, andere bemühen sich um die Pflege der Zusammenhänge mit der internen Medizin und der Psychiatrie. In praktischer Hinsicht hat sich ein Teil der Analytiker zum Ziel gesetzt, die Anerkennung der Psychoanalyse durch die Universitäten und ihre Aufnahme in den medizinischen Lehrplan zu erreichen, andere bescheiden sich damit, außerhalb dieser Institutionen zu bleiben, und wollen die pädagogische Bedeutung der Psychoanalyse nicht gegen ihre ärztliche zurücktreten lassen. Von Zeit zu Zeit ereignet es sich immer wieder, daß ein analytischer Mitarbeiter sich bei der Bemühung isoliert, einen einzigen der psychoanalytischen Funde oder Gesichtspunkte auf Kosten aller anderer zur Geltung zu bringen. Das Ganze macht aber den erfreulichen Eindruck von ernsthafter wissenschaftlicher Arbeit auf hohem Niveau.
DIE FEINHEIT EINER FEHLHANDLUNG
DIE FEINHEIT EINER FEHLHANDLUNG
Ich bereite ein Geburtstagsgeschenk für eine Freundin vor, eine kleine Gemme, die zu einem Ring verarbeitet werden soll. Auf eine steife Karte, in deren Mitte das Steinchen befestigt ist, schreibe ich: „Bon für einen Goldring bei Uhrmacher L. anzufertigen ... für beigelegten Stein, der ein Schiff mit Segel und Rudern zeigt.“ An der Stelle, die im Druck freigeblieben ist, zwischen „anzufertigen“ und „für“, stand aber ein Wort, das ich dann als völlig unzugehörig durchstreichen mußte, das kleine Wort „bis“. Ja, warum habe ich das überhaupt geschrieben?
Beim Durchlesen des kurzen Textes fällt mir auf, daß er zweimal bald nacheinander die Präposition „für“ enthält. „Bon für einen Ring – für beigelegten Stein.“ Das klingt übel und sollte vermieden werden. Nun bekomme ich den Eindruck, die Einschiebung von „bis“ anstatt „für“ sei ein solcher Versuch zur Vermeidung der stilistischen Ungeschicklichkeit gewesen. Das wird wohl richtig sein. Aber ein Versuch mit besonders unzureichenden Mitteln. Die Präposition „bis“ ist an dieser Stelle ganz unpassend und kann das unbedingt erforderliche „für“ nicht ersetzen. Warum also grade „bis“?
Aber vielleicht ist das Wörtchen „bis“ überhaupt nicht die eine Zeitgrenze bestimmende Präposition, sondern etwas ganz anderes. Es ist das lateinische bis (zum zweiten Mal), das mit der gleichen Bedeutung ins Französische übergegangen ist. Ne bis in idem heißt es im römischen Recht. Bis, bis, ruft der Franzose, wenn er die Wiederholung eines Vortragsstücks verlangt. Das ist also die Erklärung meines unsinnigen Verschreibens. Vor dem zweiten „für“, bekam ich die Warnung, das nämliche Wort nicht zu wiederholen. Also etwas anderes an Stelle von „für“! Der zufällige Gleichklang des fremdsprachigen bis im Einwand gegen die ursprüngliche Diktion mit der deutschen Präposition macht es nun möglich, das „für“ wie in einem Irrtum durch „bis“ zu ersetzen. Aber diese Fehlleistung erreicht ihre Absicht, nicht, indem sie sich durchsetzt, sondern erst, wenn sie gutgemacht wird. Ich muß das „bis“ wieder durchstreichen und damit habe ich gleichsam die mich störende Wiederholung selbst beseitigt. Eine nicht uninteressante Variante im Mechanismus einer Fehlleistung!
Ich bin von dieser Lösung sehr befriedigt, aber bei Selbstanalysen ist die Gefahr der Unvollständigkeit besonders groß. Man begnügt sich zu bald mit einer partiellen Aufklärung, hinter der der Widerstand leicht zurückhält, was möglicherweise wichtiger ist. Meine Tochter, der ich von dieser kleinen Analyse erzähle, findet sofort ihre Fortsetzung: „Du hast ihr ja schon früher einmal eine solche Gemme für einen Ring geschenkt. Wahrscheinlich ist das die Wiederholung, die du vermeiden willst. Man mag doch nicht immer wieder dasselbe Geschenk machen.“ Das leuchtet mir ein, offenbar handelt es sich um einen Einwand gegen die Wiederholung des gleichen Geschenks, nicht des nämlichen Wortes. Dies letztere ist nur eine Verschiebung auf etwas Geringfügiges, zur Ablenkung von etwas Belangreicherem bestimmt, eine ästhetische Schwierigkeit vielleicht an Stelle eines Triebkonflikts.
Denn die weitere Fortsetzung ist leicht zu finden. Ich suche ein Motiv, um diese Gemme nicht zu schenken. Es findet sich in der {39}