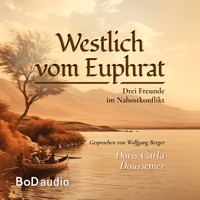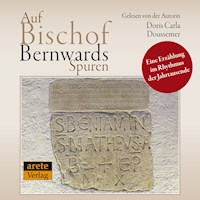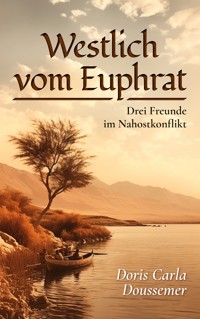
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dies ist die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft in Zeiten eines weltpolitischen Konflikts. Hans, ein pazifistischer Deutscher, Hayât, eine syrische Christin, und Koby, ein lebensfroher Israeli, sind als Pantomimenschüler in Paris unzertrennlich. In ihren Sommerferien im Juni 1967 begleitet Hans Hayât in ihre syrische Heimat. Als der Sechs-Tage-Krieg beginnt, gerät Hans auf dem Golan zwischen die Frontlinien und wird von einer Kugel in den Kopf getroffen. Erst gilt er als vermisst und dann - fälschlicherweise - als tot. Seine beiden Freunde, die durch den Krieg auf einmal feindlichen Lagern angehören, machen sich auf die Suche nach Hans und einer Erklärung für sein Schicksal. Dabei werden sie immer tiefer in die Auseinandersetzungen zwischen Juden und Arabern hineingezogen und müssen lernen, ihre eigene Position jenseits von Propaganda, Hass und Gewalt zu finden. Ein spannender Roman über die komplizierte Liebesgeschichte dreier junger Menschen, die eigentlich nur miteinander glücklich sein wollten, vor dem Hintergrund eines Konflikts, der bis heute ungelöst ist und die Welt in Atem hält.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Teil I Journal des Hans im Glück
Teil II Nie-wieder-Krieg
Teil III Im Tal der Tränen oder Ich habe mein Leben gefunden
Auszüge aus den im Text erwähnten UNO-Resolutionen zu Palästina
»Es wird erst Frieden auf Erden geben, wenn der Friede den letzten Soldaten, der ihn noch verteidigen will, entwaffnet hat.«
Mikhail Nu’aymeh (1889–1988)
Teil I
Journal des Hans im Glück
»It’s only words, And words are all I have To take your heart away …«
(Bee Gees, 1968)
Paris, 30. Mai 1967
Lange Nacht durchwacht, zusammen mit Koby und Hayât, wir sind unzertrennlich. Un-zer-trenn-lich!
So gegen 23 Uhr war der Abschlussabend in der Mime-Schule vorbei, aber keiner ging direkt nach Hause. Erhitzt und erregt, wie wir waren nach diesem Pantomimenmarathon, strömten wir, die Schüler mit den Lehrern, Freunden und eingeladenen Gästen auf die Straße, die Rue des Trois Frères, bezeichnenderweise. Dort standen wir in kleinen Grüppchen und alle schwatzten wild durcheinander, total excités. Mannomann, das war vielleicht ein Unternehmen gewesen, da hab ich Blut und Wasser geschwitzt, das Letzte hergegeben, vor allem bei der Improvisation. Man stand geblendet im Scheinwerferlicht, nahm die dunkle Masse der Zuschauer wahr, warm und kribbelig, sehr weit weg und doch ganz nah, das Thema wurde einem zugerufen und krack – hatte man sich zu verwandeln in diese Welt: Schraubenzieher, Nebel, Konfitüre …
Die poetische Welt der Körpersprache hatte mich durchdrungen bis in die letzte Faser meines Seins.
Nachdem der kühle Nachtwind die erhitzten Körper und Gemüter ein bisschen gefächelt hatte, bummelten wir die Rue des Trois Frères hinunter bis zur Place Charles Dullin und zu Ehren dieses illustren Schauspielvorfahren zogen wir dort mit 10 bis 12 Leuten in ein Bistro. Ununterbrochen wurde gefachsimpelt, geschätzt oder verworfen, gelobt oder kritisiert. Manche kriegten sogar schon wieder neue Ideen. Ich war völlig ausgebrannt, nahm den Boden nicht mehr wahr unter den Füßen, ich befand mich in einem Schwebezustand. Einer von den Zuschauern, der an einer anderen Schule war und schon in kleinen Theatern spielte, sagte mir, er hätte noch nie in seinem Leben so etwas Gutes gesehen wie meine Konfitüre. Na, das ging mir aber glatt runter. Spürte ganz lebendig warm, vibrierend und kribbelnd neben mir rechts Hayât, links Koby. Beide diskutierten heftig. Ich war relativ still (mein Französisch ist leider immer noch nicht so doll), aber ganz Ohr und Haut. Und was da reingeschwemmt kam übers Ohr und die Haut, das war Glückseligkeit, das war Zärtlichkeit, vor allem von rechts, aber auch ein bisschen von links, das war totale Euphorie! Und ich sagte mir: Siehst du, Hans im Glück, da bist du nun, einfach so da, so absolut herausgehoben und schwerelos, frei und glücklich. Und so eingekeilt zwischen rechts und links, dass ich die Atmung und den Puls meiner Nachbarn spüren konnte, praktisch das Herz der beiden glaubte ich wahrnehmen zu können, ihr Zwerchfell, wenn sie lachten, ihre Kehlköpfe, ihre Lungen, ihre Wirbelsäulen, ja ihre Gedanken. Ich verschmolz mit ihnen, wollte sagen: Verweile doch, du Augenblick, da fiel mein Blick auf die Uhr und ich sah, es war Viertel vor eins. Drei viertel eins, wie man bei mir to Huus in Niedersachsen sagt, fährt immer die letzte Metro aus der Endstation ab, und ich wusste, wenn wir jetzt nicht gehen würden, wäre die letzte Metro weg. Normalerweise setzte ich mich direkt in Trab, um die letzte Metro ja nicht zu verpassen. Ich hätte nie Geld für ein Taxi gehabt. Diese Nacht blieb ich einfach sitzen und kostete das Glücksgefühl aus und hoffte, es würde nie aufhören. Meine Nachbarn legten jeder einen Arm um mich, Koby über die Schultern, Hayât um die Taille, und meinten, es sei in dieser orpheischen Wundernacht ja kein Problem, von Montmartre bis zur Cité Université zu Fuß zu gehen. Andando, Amigo. Wo waren nur meine Beine? Vor ein paar Stunden hatte ich jeden kleinsten Beinmuskel noch ganz präzise eingesetzt, jetzt war mir, als hätten sie sich aufgelöst im Kir Royal, den wir uns genehmigt hatten zur Feier des Tages.
So machten wir drei Unzertrennlichen uns auf den Weg in Richtung Porte d’ Orléans. Immer geradeaus nach Süden, das war ja nachts nicht schwierig. Der rhythmische Kontakt der Füße mit dem Asphalt brachte die Beine wieder ins Bewusstsein. Unsere Füße führten uns auf den Friedhof von Montmartre, wo Koby und ich uns oft zurückgezogen und tiefsinnige Gespräche geführt hatten. Hier, in Anwesenheit der vielen berühmten Toten, gab es Raum für unsere Gedanken, um die Welt aus den Angeln zu heben, wie Koby das nannte. Kennst du das Grab von Enrisch N, hatte Koby mich gefragt, und ich hatte den ganzen labyrinthischen Weg dorthin keine Ahnung gehabt, wen er meinte, bis ich die weiße Büste sah und das deutsche Gedicht und vor Lachen und Erstaunen mich flach auf den Boden zwischen die Gräber hatte legen müssen. Hier am Grab hatte mir Koby die Geschichte seiner Eltern erzählt und wir hatten unsere jüdisch-deutschen Gemeinsamkeiten entdeckt. Hayât war heute zum ersten Mal mit, wir hockten uns ans Grab. Schön war’s, kühl der weiße Marmor, kein Kreuz und kein Davidstern, nur eine Sanduhr, eine Leier mit den Rosen und darüber ein Schmetterling, sonst nichts. Koby zitierte Gedichte. Als unsere Augen sich an das Dunkel gewöhnt hatten, entdeckten wir einen Mann, der im Stau stand mit seinem Samen und versuchte, da etwas Druck abzulassen. Hayât wollte gehen und wir zogen ab, hinunter in Richtung Boulevard de Clichy. Beim Anblick der vielen Sexshops, die sich dort aneinanderreihten, fing Koby an zu singen. Ich krümmte mich vor Lachen, was Hayât dazu bewegte, sich längs über meinen Rücken zu legen, um ein bisschen auszuruhen. Ich ging sanft gebeugt weiter, Hayât an den Händen haltend, damit sie nicht abrutschen konnte. Sie war so leicht, und da sie sich völlig entspannte, gelang es uns, Rücken an Rücken, konvex und konkav, gehend die Balance zu halten. Koby schmetterte einige Arien aus der Zauberflöte, auf Deutsch. Er mimte einen etwas abgestiegenen Tenor: »Dies Bildnis ist bezaubernd schön …« Ich musste Hayât absetzen, da ich mich vor Lachen nicht mehr halten konnte. Wir waren keineswegs duun, von dem bisschen Kir konnte man nicht blau sein, nur total herausgehoben. Das Gehen fiel uns immer leichter, die Füße bewegten sich wie von alleine. Vor lauter Lachen waren wir ein bisschen von der Richtung ab und zu weit nach Osten geraten, was wir erst merkten, als wir auf den Boulevard de Magenta kamen, der uns dann zur Place de la République führte.
In der Rue du Temple wechselte Koby zu sehr melancholischen hebräischen Liedern. Er ging nicht mehr, er tanzte jetzt, die Arme in die Höhe gehoben. Er zeigte uns die Tür einer Synagoge, für mich als solche nicht erkennbar. Schlagartig kippte die Stimmung um. Vor meinem inneren Auge lebten die Bilder wieder auf von den Geschichten, die uns der Lehrer in der ersten Klasse erzählt hatte: Joseph und seine Brüder, wie sie ihn verkauft hatten nach Ägypten, Mose als Baby auf dem Nil ausgesetzt, der Durchzug durch das Rote Meer. Als Kind hatten mich diese Geschichten so bewegt, dass mir, zum großen Erstaunen des Lehrers, die Tränen über die Wangen liefen, während er erzählte. Jetzt war sie wieder da, die Trauer über Ungerechtigkeit und Verrat. Auch Hayât wurde so traurig, dass sie nicht mehr weitergehen wollte. Sie ließ sich kraftlos auf den Bürgersteig sinken:
»Wenn ich dein Lied höre, sehe ich das armenische Volk in der Wüste wandern. Ich sehe Deir ez-Zor. Ich sehe die Henker, ich sehe den Tod. Ich gehe nicht weiter, keinen Schritt.«
Koby beugte sich zu Hayât hinab und sagte unendlich zärtlich:
»Ma petite Um-Hayât-Chérie, weine nicht um dein Volk.«
Er hob sie auf, unendlich sanft, und da er und ich die gleiche Größe haben, konnten wir sie auf unsere Schultern setzen, meine rechte, seine linke. Um sie da oben im Gleichgewicht zu halten, mussten Koby und ich uns auf einen Gleichschritt einigen, der möglichst wenige Erschütterungen enthielt. Über unseren Kontakt der Arme verschmolzen unsere beiden Körper zu einer Einheit (wie schon im Café kurz vorher), wir wählten, ohne uns abzusprechen, den »marche sans accent statique«, bei Decroux gelernt, und bildeten so die tragende Einheit wie eine königliche Sänfte für unsere kostbare Last. Die spontane Verständigung, die über unsere Körpersprache funktionierte, erfüllte mich mit einem starken Freundschaftsgefühl. Ich hatte mich von unserer ersten Begegnung an zu Koby hingezogen gefühlt, aber durch die gemeinsame Arbeit der Pantomime hatte sich eine solide und tragfähige Beziehung entwickelt. Die Freude über diese Verbindung kam auch bei Hayât oben an, und sie wurde bald wieder ganz fröhlich. Wir überquerten eine Seine-Brücke und erreichten Notre-Dame.
»Kommt auf die île St.Louis«, sagte Koby, ich weiß da einen schönen Platz.«
Gleich hinter Notre-Dame war Paris still und menschenleer, wir schlenderten über eine Fußgängerbrücke, ein paar Treppenstufen hinab und schon umfing uns die starke, ganz besondere Atmosphäre der Insel. Herausgelöst aus dem geschäftigen, immer lauten Treiben der Großstadt, fühlte man sich auf der Insel wie auf einem friedlichen Steinschiff, fest verankert inmitten der wogenden Seine. Ganz vorne (oder ganz hinten, das kommt drauf an, wohin man schaut) setzten wir uns auf die von der Tageshitze noch warmen Steine und ließen die Beine über die Brüstung baumeln. Koby saß in der Mitte. Er steckte seine Pfeife an mit einem ausgezeichneten Tabak. Die Pfeife wanderte von einem zum anderen, wir rauchten schweigend, auf das Wasser der Seine blickend. Ein leichter Wind kräuselte die Wasseroberfläche, die Blätter eines dicht hinter uns stehenden Kastanienbaums tuschelten. Mir war, als glitten wir wie die Indianer auf einem Schiff durch die Nacht, die Friedenspfeife besiegelte unsere Blutsbrüderschaft.
Koby stimmte wieder sein c-moll-Lied an:
»Hineh matov umanaim,
shevet achim gamjachad«
und ich schluckte schwer, um die aufsteigenden Tränen zu bekämpfen. Wie viel Millionen hatten wir vergast und in Öfen verbrannt? Ich konnte die Zahl nicht denken. Sie überstieg mein seelisches Vorstellungsvermögen.
»Übersetz doch mal«, sagte Hayât leise.
»Siehe, wie fein und lieblich es ist,
wenn Brüder in Eintracht beisammen wohnen.
Psalm soundso.«
»Kannst du das auf Arabisch sagen?«, fragte ich Hayât.
»Ma atyaba, wa ma ahla,
an yaskuna al-ichwatu ma’an.«
»Klingt ganz verwandt«, meinte ich, »ziemlich viel a drin.«
»Logo, sind doch beides semitische Sprachen.«
»Leider keine Garantie, sich zu verstehen!«
»Sagt mal«, wechselte Koby abrupt das Thema, »was machen wir eigentlich nächstes Jahr? Ihr macht doch beide weiter bei Decroux, oder? Wollen wir nicht eine Truppe gründen heute Nacht? Habt ihr gesehen, wie komisch wir sind zu dritt? Die Leute lachten doch schon, bevor wir richtig anfingen. Oder willst du etwa ins Land der Teutonen zurück?«
»Denk’ ich an Deutschland in der Nacht,
dann bin ich um den Schlaf gebracht …«, entrutschte es mir als Antwort.
Koby und Hayât lachten. »Ich sehe richtig, wie er sich im Bette wälzt, der gute alte Enrisch N und an seine Mutter denkt«, sagte Koby.
»Mutter habe ich nicht. Das vereinfacht die Sache. Ich bleibe hier!«
»Und du, Hayât?«
»Anfang Juni ich muss nach Damaskus, um meine Examen zu machen. Nur wenn ich die bestehe, lässt meine Vater mich wieder reisen. Und natürlich nur so lange, wie meine Bruder auch noch in Paris studiert. Das war die Abmachung und so ich hoffe, im September ich bin wieder hier.«
Wie immer, wenn Hayât deutsch sprach, lauschte ich hingerissen. Ihr leichter arabischer Akzent und die kleinen Fehler, die sie machte, verzauberten mich bis ins Innerste und ich hätte sie am liebsten jedes Mal umarmt.
»Gut, ich auch«, fügte Koby hinzu. »Juli, August arbeite ich in unserem Kibbuz, September fangen wir unser neues Programm an, d’accord?«
»Ich werde im Juni 18 und muss dann zur Musterung. Mein Oller ist einverstanden, dass ich verweigere und Zivildienst mache. Mir hat vorgeschwebt, ihn in einem Kibbuz zu machen, meinst du, das geht?«
»Klar, ich werde mich erkundigen, ob es bei uns geht. Du kannst ja gleich im Sommer kommen.«
»Vorsicht«, warf Hayât ein, »wenn du eine Stempel von Israel im Pass hast, du kannst nicht mehr in Syrien einreisen.«
»Dann fahre ich eben jetzt im Juni mit dir, wenn dir das recht ist, und danach zu Koby.«
»Abgemacht!« Wir legten unsere drei rechten Hände zusammen und schüttelten sie.
»Alles klar!«
Wir überblickten noch einmal unsere gemeinsame Arbeit. Ich war erst im November zur Mime-Schule gekommen. Die beiden hatten schon im Oktober angefangen. Ich verstand nur Bahnhof die ganze erste Zeit und war froh, wenn Koby sich anbot zum Übersetzen, um die gröbsten Missverständnisse zu vermeiden. Ich bewunderte ihn, er sprach Deutsch und Hebräisch und Französisch fließend, Englisch auch ziemlich gut. Dass auch Hayât ein ausgezeichnetes Deutsch sprach, ließ sie erst im Laufe der Zeit ganz schüchtern durchblicken.
Wir vermieden es, in Gesellschaft Deutsch zu sprechen, da die Franzosen das gar nicht gerne hörten. So radebrechte ich, so gut es ging, und übte mich im buddhistischen Lächeln, wenn ich nix verstand. Das Lächeln am Fuße der Leiter … war meine stärkste Nummer …
Ziemlich bald hatten wir den Beckett entdeckt: »Acte sans paroles II«. Das war spannend, diese beiden Figuren A und B lebendig werden zu lassen. Der Text von Beckett war knapp und beschränkte sich auf die äußeren Handlungen. Es war uns überlassen, Leben in die Angaben zu hauchen, das war echte Création. Wir waren Gott. Koby ließ seinen A träumen, gähnen und beten, ich versuchte, als B zackig und pedantisch, militärisch akkurat zu sein, das fiel mir ganz schön schwer. Hayât übernahm den Stachel. Das sei die größte Rolle ihres Lebens, meinte sie lachend, sie hätte noch nie so viel Zeit fürs Schminken verwendet wie beim Stachel. (Man sieht sie nämlich überhaupt nicht die ganze Zeit, sie schiebt nur den Stachel ganz langsam und gleichmäßig zu den Säcken von A und B.) Lange waren wir uns nicht sicher, ob wir mit unserer Interpretation richtig lagen. Da trafen wir eines Tages Samuel Beckett auf einem Spaziergang im Parc Montsouris. Erst trauten wir uns nicht, ihn anzusprechen, dann preschte der k.K. (= der kühne Koby) vor und erreichte tatsächlich, dass Beckett eines Tages bei einer Probe vorbeischaute, uns seine Zustimmung und noch ein paar wertvolle Tipps mit auf den Weg gab.
Hayât hatte sich eine Nummer mit Masken ausgedacht und ich half ihr beim Anfertigen der weißen Masken aus Gips. Einer legt die kalten, nassen Gipsläppchen auf das Gesicht des anderen, der die ganze Zeit still liegen muss wie eine Mumie, bis die Maske getrocknet ist und abgenommen werden kann. Während der Wartezeit hatten wir die ersten Zärtlichkeiten ausgetauscht, das wäre ein guter Film geworden: Kunst der Liebe mit einer Mumie!
Koby wollte unbedingt Geschichten des Alten Testamentes spielen, so wie David und Goliath von Marcel Marceau, aber er fand keine, die sich gut spielen ließ. Hayât meinte, das Alte Testament sei sowieso »caduc«. Ich wusste nicht, was caduc heißt und schrieb es erstmal in mein Heft. Jeden Abend schreibe ich eine lange Liste von Wörtern, die ich nicht kenne, in ein Heft, um sie im Wörterbuch nachzuschlagen. Oft kam ich tagelang nicht dazu und hatte mir in der Zeit angewöhnt, das Wort so zu benutzen. Das gab eine Sprache, bei der sich jeder Logopädin die Haare gesträubt hätten, aber mir gefiel sie. Das Alte Testament war also caduc, das wollte ich nachprüfen. Ich schrieb einen Brief an meinen Ollen, Karl den Großen, das war sowieso nötig, denn er musste sich mächtig Sorgen machen über die Zukunft seines verlorenen Sohnes. Also schrieb ich einen langen Brief mit lauter Lobeshymnen auf Paris und wie gut es mir ging und so weiter und so weiter und bat ihn, mir doch die Luther-Bibel zu schicken, die ich zur Konfirmation bekommen hatte. Erst kam eine Weile gar nichts, dann überreichte mir der Concierge eines Tages ein dickes Paket und einen Brief von Friedrich dem Großen, meinem geliebten Großvater, in zittriger deutscher Schrift, die ich fast kaum noch lesen kann. Ich entnahm dem Schreiben mühsam, dass Karl der Große sich einer sehr komplizierten Operation hatte unterziehen müssen. Nach einer Kneipp-Kur hatten sich mehrere Splitter in der Nackengegend und am Kehlkopf in Bewegung gesetzt und auf ihrer Wanderung hochempfindliche Nerven berührt, sodass er es vor Schmerzen nicht mehr aushalten konnte. Obwohl gerade dieser Bereich voller Nerven so gefährlich war, wollten sie die Operation wagen und sie sei auch geglückt, aber Karl erhole sich nur sehr langsam davon. Erst jetzt sei Marie dazu gekommen, die Bibel zu verpacken. Wozu ich die wohl bräuchte? Ob ich plötzlich fromm geworden sei? Der Brief endete mit: Gott behüte Dich. Wann kommst Du wieder? Wir warten sehnsüchtig auf Deine Rückkehr. Deine Dich liebenden Großeltern.
Den Brief packte ich schnell weg, denn da hatte ich wieder diesen Kloß im Hals und den hatte ich gar nicht gerne. Machte mich ans Lesen der Bibel, was ganze Nächte in Anspruch nahm. Hayât las ihre arabische Bibel und Koby seine hebräische, aber wir konnten zu keiner Entscheidung kommen. Der heilige Elias war schon nicht schlecht, wie er auf seinem Feuerwagen daherzischte, Koby kriegte das ganz eindrucksvoll hin, aber es ergab noch keine ganze Nummer. Ruth wäre vielleicht eine interessante Frau, meinte Hayât, aber schließlich fanden wir es doch blöd, wie sie da ihrer Schwiegermutter hinterherläuft und sich dem Boas zu Füßen legt. Kann man auch nicht auf die Bühne bringen im 20. Jahrhundert. Lots Frau, die zur Salzsäule erstarrt, machte sich gut, wurde aber dann doch verworfen, weil das Thema schon zu oft benutzt worden war.
Hayât fand schließlich, die wichtigste Geschichte sei doch, wie Sarah ihre Nebenbuhlerin, die Ägypterin Hagar, mit dem Kind Ismael in die Wüste schicken will. Erbarmungslos geht Sarah davon aus, dass die beiden verdursten werden. Sie kann sich diese Geste jetzt leisten, weil sie selbst ein Kind hat und damit bei Abraham ein Recht, eine Stellung, die ihr Macht verschafft. Vorher, ohne Kind, war sie nichts und musste die Nebenfrau, die ihre Sklavin war und die sie zu Abraham ins Bett geschickt hatte, so steht es jedenfalls in der Bibel, dulden.
Jetzt möchte sie die beiden lieber loswerden, sie sind ihr lästig. Aber Gott der Allmächtige, so setzt der Bibelschreiber zu unserer Erleichterung die Geschichte fort, Gott der Allmächtige hat Erbarmen mit Hagar und ihrem Sohn und lässt kurz vor dem Verdursten mitten in der Wüste einen Wasserbrunnen entstehen, aus dem, Gott sei’s gedankt, Hagar und Ismael ihren Durst löschen und fröhlich überleben dürfen. Leichtsinnigerweise macht Gott der Allmächtige, so steht es jedenfalls in der Bibel, auch den beiden noch ein Versprechen, dass er ihre Nachfahren segnen und vermehren würde und ihnen viel Land geben würde. Solche Versprechen zu geben, scheint auch für den lieben Gott ganz einfach zu sein. Wenn dann nachher beide Völker die Landschaft beanspruchen, dann sind Gott und die, ihr wisst schon, dann sind die längst nicht mehr zu sprechen und wissen auch nicht, wie das eigentlich gehen soll. Hayât meinte, dass die Nachfahren von Sarah und Abraham sich sehr schwer getan hätten mit ihrer Rolle des auserwählten Volkes. Wie oft seien sie abgefallen vom Glauben, wie zum Beispiel in der Geschichte mit dem Goldenen Kalb, die ja nur die bekannteste sei. Die Nachfahren von Hagar und Ismael seien viel standhafter im Glauben gewesen und sie hätten Vertreibung und Hass immer geduldig ertragen. Koby teilte diese Meinung nicht, aber er wollte sich doch auf eine Inszenierung einlassen. Ich schaute bei den Proben zu.
Koby als Abraham wies mit einer großartigen Zornesgeste, den Zeigefinger in Richtung Wüste, Hayât als Hagar, mit hängendem Kopf, ihr Kind an die Brust gepresst, ins Nichts hinaus.
»Kopf hoch«, sagte ich, »du gehst doch stolz, tief verletzt, aber stolz!«
Hayât übte einige triple-dessins des Kopfes und dann schritt sie davon, hoheitsvoll. Und dann kam diese Wendung, die uns alle so beeindruckte bei der Aufführung, Hayât drehte nur den Kopf und die Brust ganz langsam wie in Zeitlupe, die Füße und der Unterleib schritten weiter in Richtung Wüste, dann neigte sich der Kopf, eine Verzögerung trat ein, jeder Schritt mit diesem zurückgedrehten Kopf ein stumm schreiender Ausdruck von Wehmut, Trauer und Trennungsschmerz. Abraham-Koby ließ den Arm seiner herrischen Ausweisungsgeste sinken, der Brustkorb sackte zusammen, er stolperte auf Hagar-Hayât zu und rief, alle Regeln der stummen Kunst missachtend:
»Bleib bei mir, Hagar, ich will ohne dich nicht leben!«
»Klappe«, schrie ich und sprang auf. Ich mimte den Aufgebrachten. »Wenn ihr die Bibel verfälscht, können wir das nicht bringen!«
»Lass doch mal«, meinte Koby, der anfing, Gefallen an dieser Version zu finden. »Lass doch mal sehen, wie das weiter geht.«
Abraham-Koby machte einen weiteren Schritt in Richtung Hagar-Hayât. Er streckte ihr die Arme entgegen mit zum Himmel geöffneten Handflächen, so als wolle er sie anflehen, doch zu bleiben. Hagar-Hayât drehte nun die Fußspitzen in die Richtung ihres Blickes, hob ihren Sohn auf die Höhe ihres Herzens, so als wolle sie auf seine Bedeutung und ihre Liebe zu ihm hinweisen und sagte, ebenfalls die Regeln der stummen Kunst verachtend:
»Dein Glück, sonst hätte ich dich jetzt mitsamt deiner eifersüchtigen Frau ins Meer geworfen.«
Sie änderte nun das Tempo, blitzschnell mit einem toc-toc senkte sie den Kopf, presste das Kind jetzt ganz fest an sich und rammte dann, mit einer gewissen Zärtlichkeit, den Kopf Koby-Abraham vor die Brust. Der klappte zusammen wie ein Schweizer Taschenmesser.
»Aufhören«, schrie ich wieder. »So geht das nicht. Ihr könnt doch nicht die ganze Weltgeschichte über den Haufen werfen.«
»Warum eigentlich nicht«, meinte Hayât, die über ihre Reaktion nachdenklich geworden war. »Warum eigentlich nicht? Ich sage doch, das Alte Testament ist caduc. Wir drehen die Geschichte zurück und spielen die Szene neu, 2000 Jahre nach Christi Geburt: Abraham setzt sich durch gegen Sarah, gibt beiden Frauen ein Haus und beiden Kindern ein Existenzrecht.«
»Bravo!«, riefen die Zuschauer und klatschten begeistert, als die beiden ihre nun fertige, den Regeln der stummen Kunst entsprechende Nummer am Abschlussabend vorführten.
»Feiern wir unsern Erfolg und nächstes Jahr machen wir weiter! Wir könnten ja die Geschichte ›Le roi et l’oiseau‹ von Prévert inszenieren.«
»Gute Idee«, bestätigte Koby, »nachdem ich wochenlang ›den Adler‹ von Decroux geübt habe, kann ich meine Schulterblätter wie echte Flügel benutzen. Versprochen, dass wir weitermachen?«
»Versprochen!«
Wir erhoben uns feierlich und überkreuzten unsere sechs Hände. In seiner prophetischen Art, tiefe Weisheit ganz einfach auszusprechen, sagte Koby:
»Im Leben kann fruchtbar nur sein, wenn Drei beim Ursprung zusammenkommen.«
So kam es zum Rütli-Schwur auf der Insel St. Louis und zur Gründung unserer un-zer-trenn-lichen Truppe »Hinehmatov«. Und wenn man die Endsilbe so richtig scharf »toff« aussprach, dann klang das schon ganz vielversprechend, diese toffe Truppe mit Clown Karamel, Scheherezade und Meister Jakob, Frère Jacques. Unser Trio begann zu tanzen und wir drehten uns im Kreise mit wilden Sprüngen, bis der Schwur vereidigt war.
Wir baten Koby, uns doch noch mal seine Einzelimprovisation, den Engel der Apokalypse, vorzuspielen. Er erhob sich, Hayât und ich rückten ein wenig zurück, um ein paar Meter Abstand zu haben. Koby stand gefährlich auf Kippe über dem Abgrund. Es hatte etwas Surrealistisches an sich, wie er da als Silhouette vor dem schwarzen Nachthimmel, als Bugfigur unseres ruhig fahrenden Steinschiffes, mit zunächst ganz langsamen Bewegungen anfing, Bedrohung anzukündigen, bis er über ein immer schneller werdendes rhythmisches Stampfen der Füße in eine rasende Vernichtungsekstase geriet. Wir waren wieder fasziniert von der Eindringlichkeit seiner Interpretation. Koby beschwor alle Massenvernichtungskatastrophen herauf und durchlief alle Etappen der Angst und des Entsetzens. Hayât und ich bekamen eine Gänsehaut. Hayâts Hand tastete Schutz suchend nach der meinen, die ich ihr natürlich männlich stark, wie kann es anders sein, Schutz gebend überließ. Ob Koby es darauf angelegt hatte, wussten wir nicht, jedenfalls verlor er bei einem besonders wilden akrobatischen Angriffssprung das Gleichgewicht, kippte hintenüber und verschwand vor unseren Augen. Wir hörten noch einen Jubelschrei, dann den Aufplatsch im Wasser. Wir stürzten zur Brüstung, nach kurzer Zeit erschien Kobys Kopf über dem Wasser.
»Hey!«, rief er lachend, »das ist herrlich! Kommt runter! Das ist die Taufe von Hinehmatov!«
Da Hayât und ich uns immer noch an den Händen hielten, sprangen wir gemeinsam los, lösten die Hände auch im Wasser nicht, bis wir Kobys Hände fanden. »So dreckig ist das gar nicht. Nur ein bisschen Motoröl.»
Wir schwammen eine Weile, wild planschend und spritzend, bis wir entdeckten, dass ein paar Stufen in der schrägen Steinmauer uns ermöglichten, leicht wieder an Land zu klettern.
Die Abkühlung hatte uns gutgetan, aber Hayât schlotterte. Wir setzten uns in Trab Richtung Süden. Das Quartier Latin durchliefen wir flott, da trocknete der Wind die Klamotten. Nach Reden war uns nun nicht mehr zumute. Wir fanden einen guten Dauerlaufrhythmus zu dritt, die Straßen waren leer zu dieser Zeit, der klare Sternenhimmel über uns und wir liefen, gingen, liefen, gingen …
Es war kurz nach vier, als wir in der Cité U ankamen und nun mussten wir uns trennen, jeder wohnte in einem anderen Haus. Hayât in der Maison d’Arménie, ich gleich gegenüber im Collège Néerlandais und Koby ging noch ein bisschen weiter zur Maison Enrisch N.
Ganz gegen unsere Gewohnheit ging das Sichtrennen diesmal schnell. »Hinehmatov« grüßten wir. Wir, Hayât, Koby und Hans im Glück, die glücklichsten Menschen von allen in dieser Nacht. Die Welt gehörte uns, die Zukunft lag offen vor uns.
»Am 30. Mai ist der Weltuntergang …«, ohne dass ich es verhindern konnte, war dieses blöde Lied meinem Mund entwischt. Ich schämte mich direkt, vor allem vor Hayât, die auch prompt etwas irritiert meinte:
»Ihr Deutschen habt aber komische Lieder.« Sie drehte sich auf ihrem Absatz um und ging geschwind in ihr Haus. Ich stand verwirrt da und hätte das stumpfsinnige Lied gerne ausgelöscht, da hörte ich, wie Koby von Ferne das Echo dröhnte:
»Wir leben nicht mehr lang …«
Ich ging hastig ins Haus und legte mich direkt ins Bett, so wie ich war. Erst der Schlaf, der wie eine Bombe über mich fiel, vermochte diesen seltsamen Schleier, den das Lied über mein Glück geworfen hatte, wegzuwischen. Seltsam. Ich war Hans im Glück und ich wollte es auch bleiben.
31. Mai 1967
Der heutige Tag verging mit Reisevorbereitungen und Tagebuchschreiben. Morgens mit Hayât auf der syrischen Ambassade, um mein Visum abzuholen. Anschließend die Tickets bei den Syrian Airlines. Nachmittags, während Hayât ihre zweiunddreißig Koffer packte, hockten Koby und ich bei ihr im Zimmer und besprachen die neuen Projekte. Meine Idee war, was über die Sinnlosigkeit des Krieges zu machen. Gut, es war ein bisschen bei »les petits soldats« von Decroux geklaut, aber nur ganz entfernt. Mir schwebte eine ganz andere Interpretation vor. Koby ließ sich drauf ein, Hayât die immer zwischen Koffer und Schrank hin- und herging, sagte knapp:
»Wenn Ihr Krieg spielt, mach ich nicht mit. Da gibt es für mich keine Rolle. Frauen hassen Krieg!«
»Mutter Courage hätte aber gut zu dir gepasst.«
»Nein danke«, sagte sie scharf und klappte den Deckel des letzten Koffers zu. »Krieg ist dumm, Krieg ist eine Krankheit! Wir Frauen aller Länder sollten uns zusammentun und in die ›Résistance‹ gehen gegen jegliche Art von Krieg.«
Am Abend packte ich meinen Rucksack, das ging superschnell. Ich nahm nur das Nötigste mit, das war mein Prinzip: Hans im Glück reiste immer ganz leicht, nur mit einem Knotentuch am Stock über der Schulter, so stand es geschrieben bei den Gebrüdern Grimm.
Wie der Rucksack gepackt an der Tür stand, erinnerte ich mich an meine Ankunft an der Gare de l’Est vor sieben Monaten. Nie vergesse ich dieses Gefühl der Freiheit, das mich berauschte. Gefühl des Angekommenseins, endlich da zu sein, wo ich atmen konnte. Ich hatte es geschafft, Deutschland zu verlassen, das war alles, was zählte. In Deutschland war mir alles zu eng, muffig, spießig. Die Leute waren auch muffig, gereizt, unfreundlich bis bösartig. Nie wusste man, ob es sich nicht um einen verkappten Nazi handelte. Es herrschte eine Atmosphäre der Unaufrichtigkeit, der Lügen, die sich wie ein Spinnennetz um meinen Kopf spannte. Als dann auch noch eine Mauer gebaut wurde längs durch Berlin, war es ganz aus: ich konnte nicht mehr atmen und dachte nur noch ans Auswandern. Die Schule stank mir total, Abitur wollte ich nicht machen. Der einzige Beruf, der für mich in Frage kam, war Clown. So nutzlos durch die Gegend stolpern und dabei herrlich schön Violine spielen und damit drei Saltos machen, ohne die Melodie zu unterbrechen, das war mein Traum. Mein Oller wollte natürlich, dass ich Lehrer werde so wie er, aber für mich gab es nur Clown und das Handwerk dazu konnte man nur in Paris oder Prag lernen, so stand mein Plan ganz felsenfest. Ich wusste nur nicht, wie ich das meinem Ollen verklickern sollte. Die Ereignisse halfen dann nach. Eines Nachts bekam Karl der Große wieder seine Schreianfälle. Er hatte schon seit Wochen nicht schlafen können wegen irrer Kopfschmerzen, verursacht durch die Splitter. Friedrich und ich gingen los, um den Arzt zu holen. Wir hakten uns unter, denn es war Glatteis. Ich spürte die Bärenkraft, die von meinem Großvater ausging, obwohl er sehr in Sorge war. Wir weckten den Arzt, der dann auch gleich kam. Als er das Schlafzimmer betrat, gebärdete sich Karl wie wild. Er hatte sich eine Kapuzenmütze aufgesetzt, die nur das Gesicht frei ließ, und schrie den Arzt an:
»Sie sind doch auch ein alter Nazi, was wollen Sie denn hier? Machen Sie, dass Sie rauskommen!«
Der Arzt tat mir total leid, er war sauer, ließ sich aber nichts anmerken, verpasste Karl eine Spritze und überwies ihn in die psychiatrische Landesklinik. Zehn Minuten später war der Kran kenwagen da. Karl lachte, als er die verwunderten Gesichter der Krankenwärter sah. »Ja, da staunt ihr, wie ich aussehe. Ihr denkt wohl, ich komme vom Mond. Richtig getippt, genau da komme ich her!«
Ich sehe ihn noch mit seiner Skimütze lachend mit den Krankenwärtern aus der Haustür gehen. Friedrich saß auf der Treppe und weinte leise: »Unser guter Junge, unser guter Junge.«
In dieser Nacht schrieb ich mein erstes Gedicht, frei nach Nietzsche: »Ecce homo«. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es ging, aber es war nicht menschenfreundlich, das kann ich versichern. Es gab mir Rückenwind für meinen Auswanderungsplan und ich bereitete meine Ansprache vor. Drei Wochen lang ging ich täglich in die Klinik. Karl schlief immer wie ein Toter. Wahrscheinlich hatten sie ihn mit Valium vollgepumpt. Ich saß jeden Tag mehrere Stunden am Bett und wartete darauf, dass er aufwachte. In dieser Zeit reifte mein Monolog, den ich mir für den Fall des Aufwachens vorbereitete. Nach drei Wochen war es soweit, Karl schlug die Augen auf mit einem Blick von ganz weit her. Mindestens vom Mond, dachte ich. Eigentlich tat er mir furchtbar leid, aber ich wollte gerade jetzt nicht schlappmachen. »Vater«, setzte ich zum Angriff an, »ich weiß, ihr habt Schreckliches durchgemacht, die Großeltern und du und Mutter, bevor sie starb. Und ihr verdient es nicht, dass euer einziger Sohn euch verlässt. Aber glaube mir, ich will euch nicht wehtun, ich will nur weg aus diesem Land, ich kann hier nicht leben. Ich will auch kein Abitur machen und einen ordentlichen Beruf erlernen. Ich will nach Paris gehen und Clown werden. Ich werde mich schon durchschlagen, glaube mir. Ich brauche nur dein Einverständnis, weil ich erst 17 bin. Bitte, gib mir dein Einverständnis.«
Karl hatte die ganze Zeit starr nach oben an die Decke geschaut. Nun holte er mit einer großen Anstrengung den Blick von der Decke und schwenkte ihn ganz langsam zu mir herüber bis in meine Augen. Er schwieg noch immer, aber sein Blick war jetzt nicht mehr leer. Und ich forschte und glaubte schließlich, ein Nicken des Kopfes zu vernehmen, eine Andeutung von Nicken. Ich umarmte ihn und ging.
An der Gare de l’Est ließ ich mich in dem Strom der Menschen, die aus dem Zug ausstiegen, mittreiben. Vom Bahnsteig ging es in eine sehr lange, geräumige Passage, in der mir das hohe, gewölbte, mit metallenen Strebebalken versehene, transparente Glasdach auffiel. An Cafés und Zeitungsständen vorbei wurde ich durch einen römischen Rundbogen hindurch in eine riesige Halle geschwemmt. Dort blieb ich wie gebannt stehen und löste mich aus dem Strom. Ich starrte auf ein riesiges Gemälde links an der Wand hoch oben, eine Szene darstellend von Soldaten, die Abschied nehmen von ihren Familien und in den Zug steigen. Der Schock war gewaltig. Krieg auch hier, Krieg überall, Krieg verfolgt mich. Und diesen hier, den kannte ich gut, das war Friedrich sein Krieg, von dem hatte er mir viel erzählt. Als wir bei Villers-Cotterêts lagen … im Ersten Weltkrieg lagen die immer, wie konnten sie da fallen, wenn sie eh schon lagen? Bei Stalingrad haben sie gestanden, soviel ich weiß, bevor sie fielen. Das war dann schon eher ein Heldentod. Jedenfalls begannen Friedrichs Geschichten immer mit: Als wir da und da lagen … Verdun, zum Beispiel, da lagen fünf seiner Brüder. Und die liegen da jetzt immer noch, liegen da nun schon fünfzig Jahre und vergammeln in der blutgetränkten Erde. Und das Abschiednehmen an den Bahnhöfen ist immer dasselbe, hüben wie drüben. Nur sah ich es jetzt von der anderen Seite. Ich konnte mich von dem Bild nicht lösen und stand eine Ewigkeit davor, bis sich etwas in meinem Bewusstsein verschob. Ich sah nicht mehr Franzosen, die sich freuten, ihren Erz- und Erbfeind, die Deutschen, zu besiegen, ich sah nur Menschen. Einige warfen jubelnd die Arme in die Luft und lachten, einige winkten mit Fahnen und strahlten Zuversicht aus, einige weinten und verbargen ihr Gesicht, einige guckten ganz bekümmert und verzweifelt, Kinder rannten und spielten, Säuglinge schliefen friedlich. Es schien um ein und dieselbe Sache zu gehen, aber so viele verschiedene Gefühlsschattierungen waren möglich. Ich forschte lange in den Gesichtern und Gesten der Männer und Frauen, wollte genau verstehen, was sich da abspielte, und plötzlich sah ich sie: ganz links im Bild, ein älteres Ehepaar mit sorgevollem, bekümmertem Blick, ein paar Kinder, die sich für die Provianttasche des Soldaten interessierten, und dann: ja, das war sie, Marie, sie hatte die Hand ausgestreckt nach ihrem Neugeborenen, das Friedrich fest in den Armen hielt und zum letzten Gruß noch einmal an die Wange drückte.
Mir war, als sei ich über den Rhein gesprungen mit einem Salto und blickte nun, so als stünde ich neben mir, auf mich zurück. Ich war in einem anderen und in mir. Ich war über die Mauer gesprungen in der Hoffnung, sie zu überwinden. Aber wenn ich mich umdrehte, sah ich wieder nur eine Mauer. Ich sah eine hässliche Fratze auf dem Bild, eine Art Monster, das hämisch grinste. Ich trat näher an das Bild, da erwies sich die Fratze als Täuschung, es war der Proviantkorb gewesen. Ich stand jetzt ganz dicht davor. Das Bild war 1926 gemalt von einem Albert Herter.
Bewegt trat ich ins Freie vor dem Bahnhof und da war dieses starke Gefühl des Angekommenseins, gemischt mit einem Gefühl der Beunruhigung über die neue Fähigkeit, aus der Perspektive des anderen zu sehen. Und ein Zitat von Camus kam mir in den Sinn, das ich zu Hause an der Wand aufgehängt hatte:
Ich hatte immer das Gefühl, auf hohem Meer zu leben, bedroht, im Herzen eines königlichen Glücks.
Die Sonne blendete mich voll und ich meinte, den Blick aller Passanten spöttisch auf mir zu spüren. Schaut, da steht er, der kleine Germane, der große Barbar, was will der hier, haben wir nicht genug unter ihnen gelitten?
Mein Herz fing an zu kreisen und in wilden Sprüngen zu klopfen. Mir war, als hätte ich einen gelben Stern auf der Brust mit einem großen S. S stand für schuldig. Und alle starrten sie mir auf die Brust. Alle sahen sie den Stern und lächelten spöttisch. Hastig legte ich die Hand auf mein Herz, um den Stern zu verdecken, mein Gehirn übernahm augenblicklich die Verteidigung.
Wieso schuldig? Hören Sie, sagte ich in Richtung eines vorbeigehenden Mannes, mein Vater hat keinen einzigen Franzosen umgebracht in sechs Jahren. Er war immer an der Ostfront.
Der Mann ging teilnahmslos seines Weges.
Eben drum, sagte mein Herz. Schuldig. Weißt du nichts von der Brutalität der deutschen Wehrmacht im Osten? Polen total verwüstet. Russland 20 Millionen Tote. Die hat ja wohl nicht der Wind umgeblasen.
Ich machte einen Schritt auf eine alte Oma zu, die mit ihrem Köfferchen in den Bahnhof wollte.
Glauben Sie mir, mein Vater war bei den Pionieren, er hat nie einen umgebracht, er hat immer nur Brücken gebaut und Brücken zerstört.
Sie ging gleichgültig weiter.
Trotzdem!, sagte mein Herz und kreiste rasend. Schuldig! Die fünf Millionen Juden hast du wohl ganz vergessen, oder?
Aber nicht doch, versetzte schlagfertig mein Gehirn, die linke Kortexhälfte war besonders findig als Advokat, das ist dummes Gerede, du warst doch noch gar nicht geboren, als das geschah.
Trotzdem, sagte mein Herz, schuldig!
Meine Knie, das spürte ich, hielten dem Aufprall des Dialogs zwischen Hirn und Herz nicht stand. Sie fingen an zu zittern, so stark, dass ich mich setzen musste. Mein geliebter Rucksack diente als Sitz und der Rücken lehnte gegen die Wand. So versuchte ich Herr zu werden über die streitenden Parteien. Ich wurde es natürlich nicht, ich ahnte, dass ich diese Gefühle würde annehmen müssen, um mit ihnen zu leben, vielleicht sehr lange. Erschöpft und mit wackelnden Knien war ich dann in Richtung Stadt gezogen, um mir ein Hotelzimmer zu suchen.
Da bist du, Rucksack, mein Freund.
Ich schrieb dann noch einen Brief an Karl den Großen, bat ihnum eine Geldüberweisung für den Flug nach Syrien und erklärte ihm, dass ich meinen Zivildienst in einem Kibbuz in Israel machen wollte. Er wusste ja, dass ich am 9. Juni 18 wurde und eine Entscheidung wegen der Einberufung zum Bund fällen musste. Dass ich Zivildienst machte, war von Anfang an klar gewesen. Er hatte mich ja total antimilitärisch erzogen. Wie er allerdings auf die Idee mit dem Kibbuz reagieren würde, konnte ich nicht abschätzen. Ich wusste nicht, wie er zu Israel und Juden stand. Wir hatten nie darüber gesprochen. Ich warf den Brief ein und trank noch ein Glas mit Koby. Wir diskutierten lange über Militärdienst. Ich verteidigte mit Eifer meinen Standpunkt, dass der Mensch keine Waffen tragen und auch deren Gebrauch nicht erlernen soll, es sei denn, er sei Förster oder Jäger. Aber Koby meinte, in Israel seien die Grenzen so nah. Wir debattierten heftig über eine Welt ohne Grenzen, ich bin nur jetzt so müde, dass ich das nicht mehr aufschreiben kann. Gute Nacht.
1. Juni 1967
Morgens ganz verdattert aufgewacht. Hatte einen irren Traum, der mich den ganzen Morgen nicht losließ. Seit ich die Pantomime mache, hat sich mein Träumen vollständig verändert. Viele dramatische Situationen mit Kampf und Angst oder auch lauter verrückte, oft sehr komische und poetische Bilder, in denen die Schwerkraft nicht existiert und mein Körper die verrücktesten Sachen macht.
Ich sollte nach Deutschland, um dort einen geheimen, wichtigen Auftrag auszuführen, und brauchte dazu als Erlaubnis ein sehr wichtiges Papier, das sehr schwer zu bekommen war. In kafkaesken Fluren herumirrend, konnte ich an einem Schalter (er ähnelte den Schaltern auf der Préfecture, wo man sich die Aufenthaltsgenehmigung holen muss) eine Frau dazu bewegen, kurz vor der Schließung ihres Schalters, mir das Papier auszustellen. Sie erklärt mir, ich müsse ein Boot nehmen über Tunesien und Marokko. Schon bin ich auf dem Schiff, schönes Wetter, ich bin froh. Plötzlich verändert sich die Atmosphäre, ich spüre deutlich einen Sog an meinen Beinen, das Schiff schwankt, starker Wind wirbelt. Das Schiffsholz beginnt zu krachen und zu ächzen und plötzlich brechen überall große Spalten und Ritzen auf, wie wenn ein Gletscher auseinander bricht. Direkt vor mir tut sich ein Abgrund auf, ich schaue entsetzt in die unendliche Tiefe, in der unten brodelnd das Meer tobt, blau-schwarz mit weißem Schaum. Mit aller Kraft stemme ich mich gegen den Sog, der mich in den Abgrund ziehen will. Ich kann mich gerade noch halten, aber nicht verhindern, dass neben mir ein Kind in den Abgrund gerissen wird. Das Schiff scheint in zwei Teile gespalten zu sein. Auf der anderen Seite schreien Menschen, ich solle ja nicht zu ihnen kommen, dort sei alles noch viel schlimmer. Noch stehe ich sicher. Aber plötzlich erfasst es auch mich. Mit ungeheurer Kraft zerrt etwas an meiner Tasche, die ich verbissen umklammere, aber sie wird mir weggerissen und über das ganze Deck gefegt. Ich schreie: mein Papier, mein Papier! Die atmosphärischen Strudel beruhigen sich, aber mein Papier ist weg.
Schweißgebadet wachte ich auf.
In solchen Momenten konfuser Daseinsproblematik und existenzieller Hürdenüberwindung ist Schreiben immer die beste Therapie. Ich griff zum Tagebuch, wir hatten ja noch Zeit bis zum Abflug.
Ich erinnerte mich an eine Episode, als wir am 8. Mai Kobys Geburtstag gefeiert hatten. Koby hatte eingeladen ins Maison Enrisch N, wir hockten alle auf seiner Bude, die hinten zum Périphérique raus lag, weswegen wir nie ein Fenster aufmachen konnten, so stark war der Autolärm. Hayât hatte mit Koby massenhaft Tabbuleh zubereitet und der Rotwein floss in Mengen. Die Runde war fröhlich und wurde sehr schnell gesprächig. Ich war der einzige Deutsche in der ganzen Mannschaft, eine Situation, die mir besonders gut gefiel. Zu unseren Mime-Freunden waren noch einige seriöse Vertreter der Wissenschaften gestoßen, die sich ihr Anrecht auf Wohnen in der Cité U durch fleißiges Studieren und ausgezeichnete Zensuren erarbeitet hatten, wie zum Beispiel Amin, der Bruder von Hayât, der eine Doktorarbeit über Émile Zola schrieb. So Künstler-Schlamperlwie mich, die den ganzen Tag auf der faulen Haut lagen und erst nachts aus den Löchern kamen, um »sozusagen« zu arbeiten, gab es nur zu 5 Prozent. Wir saßen über das Zimmer verteilt, auf dem Boden, auf dem Bett und auf dem Tisch. Fairuz schallte aus dem Radio, alle schwatzten in angeregter Diskussion, Koby und Amin schienen sich besonders gut zu verstehen. Ich schnappte ein paar Gesprächsfetzen auf: Es ging um die Dreyfus-Affäre und den Brief von Émile Zola: J’accuse.
Dann überreichte Ilan, ein Freund von Koby aus Israel, ihm ein Geschenk, es war ein französisches Buch mit jüdischen Witzen, von einem Juden gesammelt und herausgegeben, Koby vertiefte sich sogleich hinein und begann schallend zu lachen.
»Hier, hört mal alle her, wollt ihr eine Kostprobe?«
Alle verstummten und hörten zu.
»Warum hat Hitler den Krieg verloren?«
Mir gefror das Blut in den Adern. Wie konnte man so locker mit diesem Thema umgehen, ich wurde ganz steif vor Angst und schaute unruhig in die Runde. Niemand schien meine Beklemmung zu teilen, nur Hayât nagte misstrauisch an ihrer Unterlippe, das kannte ich schon bei ihr, wenn ihr etwas nicht behagte.
»Weil er keine jüdischen Generäle hatte.«
Alles lachte, ich wurde noch steifer und bemühte mich, mitzulachen, es wollte aber nicht gelingen.
Hayât stand auf und drehte die Stimme von Fairuz lauter. Das allgemeine Gemurmel der sich unterhaltenden Leute setzte wieder ein. Koby und Amin hatten großen Spaß mit dem Witzebuch, denn die Araber kriegten natürlich auch ihr Fett ab.
Urplötzlich riss der Stimmenwirrwarr ab und alle schauten zu Koby und Amin, die sich gerade gegenseitig vor Vergnügen auf die Schultern klopften. Jemand fragte:
»Was würdet ihr eigentlich machen, ihr zwei, wenn ihr euch an der Grenze eurer beiden Länder gegenüberstündet und der Befehl hieße, zu schießen?«
Die Stille wurde zum eiskalten Schweigen. Keine Bewegung mehr im Raum. Alle starrten auf den Israeli und den Syrer. Koby fasste sich als Erster und sagte:
»Ich würde dir die Hand geben, mich bei dir entschuldigen und dich dann abknallen.«
»Genau das würde ich auch tun«, versetzte Amin zustimmend.
In ihrer absurden Übereinstimmung hatten die beiden etwas Rührendes.
Mit einem Knall wie ein Schuss fiel die Zimmertür ins Schloss, Hayât war gegangen.
Das Stimmengewirr brauste wieder auf, keiner bemerkte, dass ich Hayât folgte. Ich musste eine Weile suchen, dann fand ich sie im Park, an einen Baumstamm gelehnt, sitzend, die Tränen strömten ihr übers Gesicht. Ich hockte mich vor sie hin und nahm ihr Gesicht in beide Hände. Mit den Daumen strich ich über ihre Wangen, um die Tränen fortzuwischen, aber sie strömten so unaufhörlich, dass mir nichts Besseres einfiel, als sie wegzuküssen.
»Hayât, mein Liebes, wein doch nicht so.«
Sie ballte ihre beiden Fäuste gegen meine Brust und schluchzte:
»Das ist absurd, das ist grotesk … Männer sind unglücklich im Frieden, das ist die Wahrheit, sie langweiligen sich, und wenn sie einen abknallen können, dann macht das Leben mehr Spaß. So ist es doch.«
Ganz gegen unsere Gewohnheit hatten wir beide deutsch gesprochen. Ihre Worte ließen mich schmelzen, ich fiel neben ihr ins Gras. Sie hämmerte mit einer geballten Faust auf mein Brustbein:
»Und wenn du ein andere abgeknallt hast, dann du bist ein Mann! Vorher du bist ein Kind.«
Ich versuchte es mit Trösten. »Schau, die Franzosen und die Deutschen haben auch aufgehört, nach Jahrhunderten von Kriegen und Feindschaft. Einfach aufgehört, Schluss gemacht, jetzt bauen sie Europa, und Europa ist eine sehr, sehr gute Idee.«
Nun war es Hayât, die mein Gesicht in beide Hände nahm und mir ihre feuchten Lippen sanft auf Augen, Nase, Mund und Wangen drückte.
»Du lieber kleiner großer Träumer, du, du europäischer Träumer.«
Sie sprang auf.
»Du wirst sehen, der Nahe Osten ist ein Pulverfass, da denkt keiner an aufhören.«
***
Mittags nach Orly. Schmucker Vogel. Ich total aufgeregt. Der erste Flug in meinem fantastischen Leben. Wieder legte sich ein Schleier auf mein Glück. Beim Abschied küssten sich Koby und Hayât lange, sehr lange, viel zu lange …
Dann gab es Schwierigkeiten mit dem Gepäck. Hayât hatte 36 Kilo, das war doppelt so viel wie erlaubt. Mein Freund, der leichte Rucksack, rettete uns, da ich ihn als Handgepäck nehmen konnte und so 18 Kilo von Hayâts Gepäck auf mein Konto kamen.
Wir hoben ab. Hayât hatte mir den Fensterplatz überlassen, weil ich zum ersten Mal in einem Flugzeug saß. Wie einem kleinen Kind, dachte ich, dem man gönnerhaft etwas zugesteht. Auch dieser Stachel saß wieder. Wir schwiegen. Ich schaute aus dem Fenster, Hayât las zerstreut in einer Zeitschrift. Wir schwiegen. Lange. Ich schaute aus dem Fenster, aber was ich sah, waren Koby und Hayât, die sich küssten. Das Bild ging nicht weg. Ich versuchte intensiv, die Wolkenbildung unter uns zu studieren. Sah plötzlich zwei menschliche Figuren, die mit erhobenem Schwert miteinander kämpften. »Schau mal, was da für lustige Wolken sind«, sagte ich zu Hayât. Sie beugte sich zum Fenster herüber, wobei der Duft ihres Haares meine Nase kitzelte. Ich spürte ihren weichen, warmen Körper, der meine Brust berührte. Ich nahm mit beiden Händen ihre seidene, schwarze, lockige Haarpracht hoch und küsste sie auf die Stelle zwischen oberstem Halswirbel und Haaransatz, wo alle empfindlichen Lebensnerven gebündelt sind. Ziemlich ausdauernd. Bis ihre vom Beugen gespannten Schultern sich lösten und sie entspannt an meiner Brust lag.
Sie schlief ein und ich fühlte mich als Wächter ihrer Träume. Ich spürte, dass ich etwas sehr Wertvolles mit meinen Armen umfing, ein kostbares Wesen, dass ich nur erahnte und dem ich mich eng verwandt fühlte. Eigentlich wusste ich gar nichts über Hayât, ihre Herkunft und ihr Leben, sie war mir fremd und doch ganz nah. Das war ein Paradox, das sich entwickelte, weil wir Mime zusammengemacht hatten. Es war dasselbe Phänomen wie mit der Musik. Die Tatsache, zusammenzuspielen oder zu singen, bringt eine solche intime Nähe, dass man meint, man sei mit dem anderen in harmonischer Weise verbunden auf derselben horizontalen Ebene, man glaubt, den anderen zu erkennen. Erst wenn man miteinander spricht und der Intellekt mehr ins Spiel kommt, treten die trennenden Faktoren ins Spiel, unsere Repräsentationen, die uns blockieren und gefangen halten. Musik verbindet Völker, das ist eine bekannte Tatsache. Ich hatte erlebt, dass auch ein gemeinsames Sich-Bewegen diese Wirkung hat. Musik und Bewegung wirken wie ein Zauberwort, das Tore öffnet.
Als die Stewardess Essen und Trinken brachte, wachte Hayât auf und setzte sich zurecht. Sie lächelte mir zu.
»Hayât verzeih, ich muss es wissen: Liebst du Koby?«
»Ja, aber nicht mehr als dich. Ihr seid wie Brüder und ich liebe euch beide!«
Ich nahm mir vor, diese memorable Antwort in mein Tagebuch zu schreiben, damit ich Zeit bekäme, sie zu verstehen, wenn ich wieder festen Boden unter beiden Füßen spürte. Anscheinend war es meine Aufgabe in diesem Leben, mit Paradoxen zu leben. Aber hatte nicht »verstehen« etwas mit »stehen« zu tun? Zumindest im Deutschen. Der Mensch steht auf zwei Beinen. Warum sollte Hayât nicht zwei Männer lieben? Hier oben, durchs helle Licht gleitend, erschien mir das völlig plausibel. Logo, würde Koby sagen. Aber was kommt nach der Landung?
»Merkwürdig«, meinte ich, »über den Wolken erscheint einem alles viel leichter, findest du nicht? Es ist so ein krasser Gegensatz zwischen diesem Gleiten in pausenlos heller Dauerbeleuchtung und dem, was man auf der Erde an Finsternis erleben kann. Wenn ich mit meiner Großmutter durch die Stadt ging, als ich noch klein war, sah ich überall nur schwarze Ruinen. Manchmal wuchs schon wieder Gras und sogar Büsche und Bäume über dem Gestein, aber der Eindruck, der mir blieb als Kind, war schwarze Verwüstung. Dabei ging der Wiederaufbau bestimmt rasant schnell vor sich, trotzdem legte sich dieser schwarze Eindruck wie Pech auf meine kindliche Seele. Da halfen auch alle Geschichten meiner Großmutter nichts, die immer versuchte, mich aufzuheitern. Sie sagte, die Stadt würde wieder so schön wie vorher und es würde nun keinen Krieg mehr geben.«
»Genau wie meine Großmutter«, meinte Hayât, »sie wollte mich immer fröhlich sehen und dachte sich Dinge aus, die mich zum Lachen brachten. Ich sollte nicht an die Ausrottung der Armenier denken und was dann kam, 1948, die Nakba, die große Katastrophe. Sie wollte, dass ich es vergesse und ein unbeschwertes Leben führe.«
Ich muss wohl ziemlich intelligent dreingeschaut haben, denn ich wusste nichts von den Armeniern und auch nicht, was 1948 passiert war. Nur, dass wir da Währungsreform gehabt hatten und jeder mit 40 DM ein neues Leben begonnen hatte. Geduldig begann Hayât, wir hatten noch vier Stunden gleißende Sonne über den Wolken vor uns, mir die Geschichte des armenischen Volkes zu erzählen. Ich hörte hingerissen zu. Was mich am meisten schockte, war die Tatsache meiner Ignoranz. Und dass anscheinend niemand diese Katastrophe hatte verhindern können.
»Hat denn niemand versucht, die Türken aufzuhalten?«
»Doch, sicher, viele Diplomaten, Militärs und Kirchenmänner haben sich bemüht, es hat auch einen deutschen Pastor gegeben, Johannes Lepsius, hat mein Vater immer erzählt, er hat mit allen seinen Kräften versucht, die Türken am Morden zu hindern und die Regierungen der Alliierten auf das furchtbare Geschehen aufmerksam zu machen, aber vergeblich. Seine Gespräche mit Enver Pascha verhallten im Nichts.«
Ich war so aufgewühlt von dem, was Hayât mir erzählt hatte, ich sprang auf von meinem Platz und ging im engen Gang des Flugzeuges hin und her wie ein Tiger im Käfig. Die Stewardess fragte mich, ob mir nicht gut sei. In mir brodelte es: Wieso hatte ich das nicht gewusst? Anderthalb Millionen Menschen vernichtet, so ganz stiekum, ohne dass einer was merkt, denn die Europäer waren sehr beschäftigt, sich gegenseitig umzubringen, das braucht ja auch alle Aufmerksamkeit, so ein Morden, da kann man nicht noch den Türken auf die Finger klopfen, bloß weil sie da ein paar Armenier in die Wüste schicken. Na, logisch, Leichenberge hatten sie ja genug in Europa. Was hatte ich gelernt in der Schule über den Ersten Weltkrieg? Insgesamt acht Millionen Tote, davon Frankreich eine Million vierhunderttausend Tote, Deutschland eine Million achthunderttausend Tote, das hatte ich auswendig gelernt. Da kommt es natürlich auf ein paar Millionen Armenier weniger überhaupt nicht mehr an. Überhaupt nicht, das merkt doch gar keiner. Das war doch ganz einfach. Man beginnt mit Verleumdungen, Verschwindenlassen, Verhaftungen – alles Wörter, die mit der Vorsilbe ver- beginnen, wie das Wort Vernichtung. Genau so hatte es mit den Juden angefangen, immer fing es so an. Nach den Massenverhaftungen kommt die Vertreibung, da wird marschiert, wochenlang ohne Essen und Trinken, wer sich weigert, wird verschossen, darf dann am Wegrand verbleiben. Wer es schafft bis zur Wüste, der hat selber Schuld, der ist dann dort verstorben. Man kann die ja auch nicht alle noch ernähren in der Wüste, diese Armenier, wie sollte man das, wo das Wasser doch so knapp ist in der Wüste. Die Leichenberge, die hat man dann verbrannt, dann ist das Ganze verraucht und dann hat man das vergessen. –- Wieso habe ich das in der Schule nicht gelernt? Oder habe ich es übersehen? Stand es in meinem Geschichtsbuch oder nicht? Ich muss unbedingt in mein Geschichtsbuch schauen. Das ließ mir keine Ruhe mehr. Gleich von Damaskus aus werde ich Friedrich schreiben, er solle mir mein Geschichtsbuch schicken. Und er selber, ob er es wohl gewusst hat?
Na ja, der hat sich mit den Franzosen rumgeschlagen, das war kein Zuckerschlecken. Und in Rumänien ist er gewesen, das hat er mir erzählt. Das soll da ganz gemütlich gewesen sein. Da haben sie Rotwein getrunken und viel gesungen. Während der Mittagspause haben beide Seiten nicht geschossen, das war vielleicht human. Armenien war natürlich weit weg. Aber hat er es gewusst?! Das war die entscheidende Frage. Ich konnte mich nicht beruhigen, tigerte weiter durch den Gang, setzte mich schließlich wieder hin.
»Steht es in deinem Geschichtsbuch?«
Hayât lachte: »Geschichtsbuch? Es steht in mein Herz, es steht auf Stirn von meine Vater, auf gebeugte Rücken von meine Großvater steht es, da kannst du es lesen.«
Ich nahm ihre Hand in die meine. Sie fügte hinzu:
»Und 1917, die Déclaration de Balfour? Die wird ja wohl drin stehen in deine Geschichtenbuch, oder? Damit hat alles angefangen, das ganze Elend von Palästinenser.«
Ich nickte stumm und blickte dabei verlegen aus dem Fenster. Lieber hätte ich mir die Zunge abgebissen, als vor Hayât einzugestehen, dass ich keine Ahnung hatte, wo Balfour lag.
»Wir haben noch etwas gemeinsam«, sagte ich, »bei unserer Geburt starben unsere Mütter. Erzählst du mir davon?«
Hayât-Scheherezade seufzte lange, ehe sie begann:
»Mein Vater, der Elias heißt und meine Großvater in allem nacheiferte, wurde auch Fotograf. Das war verständlich, das war bestimmt der faszinierendste und spannendste Beruf in der Zeit. Auch mein Vater wurde bald berühmt mit seine Fotos. Er spezialisierte sich auf Szenen aus tägliche Leben, Männer bei die Arbeit, Kinder und Frauen in ihre soziale Zusammenhang. Er suchte Ausdruck in Fotos von Menschen, die engagiert waren im Kampf gegen zionistische Kolonisation und das britannische Mandat. Oft reiste er wochenlang, um schöne Bilder zu finden, wie zum Beispiel Fischer mit ihre Boote am See Tiberiade oder nein, wie sagt ihr?«
»Du meinst den See Genezareth?«
»Ja, genau. Auf einer dieser Reisen machte er ein Foto von eine Frau, die Wasser schöpft aus eine Brunnen. Es war meine Mutter, die Lehrerin im Dorf, er verliebte sich in sie und sie wurde seine Frau. Sie blieben im Dorf und führten dort ein friedliche Leben. Sie ernährten sich von dem, was die Erde ihnen gab rund um das Haus, von Oliven, Gemüse und Früchten, von die Hühner und Ziegen und Schafen. Was Elias mit der Fotografie verdiente, reichte aus, um die Familie zu erhalten. Die Familie wuchs und gedieh bis 1948. Meine Mutter war mit mir schwanger, als der erste israelisch-arabische Krieg ausbrach.«
Nun dämmerte mir wieder, was ich gelernt hatte.
»Richtig. Das war der Unabhängigkeitskrieg der Israelis.«
»Mag sein, dass sie ihn so nennen. Für die Palästinenser ist es die Nakba, die Katastrophe. Und das war es auch für meine Familie. Ich kann das nicht so gut erzählen, weißt du, das ist so schwer … Ich will es kurz machen. Die israelische Armee vertrieb uns mit ihren Panzern aus dem Dorf und brannte alles nieder. Meine Familie versuchte zu flüchten, aber bei meine Mutter setzten die Wehen ein. Ich wurde auf den Weg geboren, es gelang meine Vater mit Hilfe von Hebamme aus dem Dorf, mich zu retten. Nur meine Mutter hat es nicht überlebt. Sie verlor all ihr Blut und starb, während meine ganze Familie und alle anderen vor den Soldaten von Haganah wegliefen. Kein einziges Foto ist geblieben, die Kamera verbrannt. Ein Teil von Familie kam bis Kuneitra und fing dort ein neues Leben an. Mein Vater mit uns Kinder ging bis Damaskus. Aber genug jetzt, du wolltest mir doch deine Geschichte erzählen.«
Da die Stewardess uns aufforderte, uns anzuschnallen, wachten wir aus unserem Vergangenheitstraum auf und merkten, dass das Flugzeug sich zur Landung anschickte.
»Dann erzähle ich sie dir ein andermal«, sagte ich, »das verspreche ich dir.«
Unsere Ankunft abends in Damaskus war überwältigend.
Damaskus, 3. Juni 1967
Gestern keine Zeit gehabt zum Schreiben. Es ist phantastisch! Welch eine Stadt, welch eine Welt! Welch eine Familie, die von Hayât. Bin einfach überwältigt von so viel Herzlichkeit, Gastfreundschaft und Fröhlichkeit. Die Frauen kochten gerade Rosenmarmelade und das ganze Haus duftete nach Rosen. Abends gab es ein wunderbares Essen, viele, viele Vorspeisen, Tabbuleh, Hummus, Jabrak, dann Reis mit Pinienkernen, Hackfleisch und Rosinen, zum Abschluss wunderbar leckere Pistazienrollen und Butterkekse mit Walnussfüllung, dazu einen herrlich duftenden Kaffee mit Kardamom … ich war regelrecht berauscht von diesen guten Sachen und der Musik dazu, ein Mann spielte auf einer Laute und sang wehmütige Melodien. Wer hatte gesagt, Damaskus gleiche dem Paradies? Es musste wohl stimmen, vor allem die Fröhlichkeit und das Lachen der Familie waren absolut ansteckend. Morgen wollen wir Damaskus erobern, am 5. Juni beginnen für Hayât die Examen, da soll ich mit einem Onkel von ihr mit dem Auto nach Kuneitra fahren, um dort bei Verwandten der Familie ihrer Mutter zu wohnen. Hans im Glück, nun halt dich fest. Nun wirst du die Golan-Höhen sehen und den Jordan, Berg Hermon und vielleicht auch den See Genezareth. Ein Traum wird wahr, all diese Stätten zu sehen und den Boden zu berühren dieser Orte, die mir so viel bedeuten. Warum sie mir so viel bedeuten, weiß ich eigentlich gar nicht so genau.
4. Juni 1967
Unser Eroberungszug einer der ältesten Städte dieser Erde begann ganz früh morgens für Hayât, ihre Schwester Suhair, ihren Vater Elias und mich. Wir erkraxelten den Berg Kassyun, von dort oben hatte man einen herrlichen Blick über die Stadt. Wie ich so hinter Elias bergauf herstapfte, begriff ich seine Pilgeridee, die er uns vermitteln wollte mit diesem frühmorgendlichen Aufstieg; abgesehen davon, dass wir gegen Mittag die Sonne gar nicht mehr ertragen hätten, lag ein Zauber über dieser Morgenstunde. Ab und zu bückte Elias sich und nahm einen Stein auf, den er dann lange in der Hand hielt. Mehrere Male hielten wir an, um zu verschnaufen, Elias murmelte längere Sätze, die sich wie Gebete anhörten oder Gedichte. Von ganz oben erklärte er mir Damaskus, weltberühmte Handels- und Kulturstadt, Stadt der Religionen, und zwar sehr viele nebeneinander. Nicht nur, dass Schiiten und Sunniten vertreten waren, er zeigte mir die Moscheen, sondern auch von den christlichen Konfessionen waren unglaublich viele verschiedene Kirchen im Kern der Altstadt zu sehen: dort die syrisch-katholische Kirche, dort die St. Johannes-Kirche (hört, hört), die St. Georg-Kirche, diese da die armenisch-katholische Kirche, dort die armenisch-orthodoxe Kirche, maronitische Kirche, Paulus Kapelle, und so weiter, mehr konnte ich gar nicht behalten. Früher hätten auch viele Juden in Damaskus gelebt, aber das nehme jetzt sehr ab, sagte er. Nach dem Abstieg nahmen wir eins von diesen verrückten gelben Taxis und düsten bis zur Zitadelle. Dann pilgerten wir durch den al-Hamidije-Suk, eine wunderbare Einrichtung, diese überdachten, endlosen Einkaufsstraßen, in denen man alles bekam, was das Herz begehrte. Es roch nach Gewürzen und Leder. Elias wies uns auf die vielen kleinen Löcher im Dach des Suk hin: eine Erinnerung an die Maschinengewehre der Franzosen. Am Ende des Suk stießen wir auf das Westportal der Omaijaden-Moschee, im Inneren ein Quell der Ruhe und Meditationsstimmung, welch ein Kontrast zu den quirligen, unruhigen Suks. Diese große Moschee riss mich total vom Stängel. Zeitlich und räumlich stapelten sich hier die Religionen. Zuunterst, wenn man so will, oder zuerst ein Tempel, dem westsemitischen Wetter- und Sturmgott Haddad-Ramman geweiht, der später zu Zeus und Jupiter wurde. In römischer Zeit unter Theodosis wurde eine Kirche zu Ehren von Johannes dem Täufer gebaut und noch 200 Jahre später eine Moschee. Christen und Moslems beteten friedlich nebeneinander, Johannes wurde von den Moslems verehrt, und von einem Minarett der Moschee, so erzählt es die islamische Legende, soll Issa, unser guter Jesus, eines Tages das Jüngste Gericht einleiten und endgültig über den Antichrist siegen.
Wir verweilten lange in dem Gebetsraum, in dem sich der Schrein Johannes des Täufers befindet. Ob auch das enthauptete Haupt meines Namensvetters sich hier befindet, ist mir nicht ganz klar geworden. Elias meinte, die Moslems hätten Jahya an der Stelle gelassen, weil sein Haupt anfing zu bluten, als sie ihn bewegen wollten.