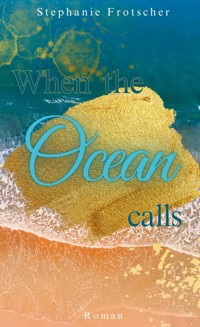
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Water-Dilogie
- Sprache: Deutsch
Für Literaturstudentin Haylie geht ein Traum in Erfüllung, als sie ihre Semesterferien in New York verbringen darf. Trotzt ihrer sozialen Angststörung verliebt sie sich Hals über Kopf in ihren Nachbarn Lark, der ihre Ängste zu verstehen scheint. Alles könnte perfekt sein, wären da nicht ihr Arbeitskollege Ricky, der ihr Herz ungewollt höherschlagen lässt und ihre traumatische Vergangenheit, die sie immer wieder einholt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Triggerwarnung
Dieser Roman enthält potentiell triggernde Inhalte. Dazu gehören soziale Angststörungen, häusliche Gewalt, Mobbing, sexuelle Belästigung, Trauer, Suizid und Tod.
Bitte lies dieses Buch nicht, wenn dich eines dieser Themen triggern könnte. Pass auf dich auf.
Für alle, die das Gefühl haben, nicht verstanden zu werden.
Ihr seid nicht allein.
Inhaltsverzeichnis
Playlist
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Epilog
Nachwort & Danksagung
Playlist
Start of Something New – Olivia Rodrigo
Welcome To New York (Taylor`s Version) – Taylor Swift
Drown – Bring me the Horizon
Complicated – Avril Lavigne
What Was I Made For? – Billie Eilish
You broke me first – Tate McRae
Before You Go – Lewis Capaldi
Another Love – Tom Odell
Lonely – Palaye Royale
i hate u, i love u – gnash feat. Olivia O’Brien
It’s Ok – Tom Rosenthal
Somewhere Only We know – Kaene
All Too Well (Taylor`s Version) – Taylor Swift
Rise Up – Andra Day
Prolog
Ich laufe einfach drauf los, schließlich habe ich mein Ziel schon längst im Blick. Der einzig richtige Weg ist der Weg zum Meer. Denn genau da möchte ich jetzt hin.
Ich gehe ungefähr anderthalb Meilen die Straße hinunter, bis ich schließlich ein Schild sehe, auf dem in Großbuchstaben ROCKAWAY BEACH steht. Mein Herz hüpft vor Vorfreude und ich gehe ein wenig schneller. Ein paar Schritte noch, dann bin ich endlich da. Ich spüre den Sand, der langsam in meine Schuhe rinnt, und dann sehe ich es direkt vor mir - das Meer.
Ich fühle mich, als wäre ich nach einer unendlich langen Reise endlich angekommen. Und damit meine ich nicht die Fahrt hierher, sondern mein gesamtes Leben mit all den Höhen und Tiefen. Okay, vor allem Tiefen …
Ich blicke in die weite Ferne und blende für einen Moment die ganzen Leute aus, die sich am Strand tummeln und jede noch so kleine Ecke mit Handtüchern und Strandmuscheln ausgefüllt haben. Ich bahne mir einen Weg vorbei an all diesen Menschen und blicke nur in die endlose Weite, die sich vor mir erstreckt und mich in ihren Bann zieht, als würde sie nach mir rufen.
Das sanfte Rauschen der Wellen und das Geschrei der Möwen machen den Moment perfekt. Meine Gedanken werden leiser, je lauter die Wellen rauschen, je lauter das Meer meinen Namen ruft. Und in diesem Augenblick wird mir bewusst, dass man sich nach etwas sehnen kann, das man vorher noch gar nicht kannte, weil das Herz schon längst wusste, dass es das braucht. Manchmal wissen Herzen so etwas einfach, bevor es der Verstand überhaupt erahnen kann ...
Kapitel 1
Ein paar Tage zuvor …
Eist ein rauer Herbstmorgen im Oktober. Ich spüre den Wind, der sanft durch meine Haare weht und atme tief ein. Die Luft riecht nach Salzwasser und Algen. Möwen singen und krächzen laut vor sich hin, während ich in die Ferne blicke. Ich lausche dem Rauschen der Wellen und genieße den Anblick der endlosen Weite. Es ist alles so perfekt und ich bin für einen Moment der glücklichste Mensch auf diesem Planeten.
„Nimm mal deine Tasche weg!“, höre ich plötzlich die Stimme einer älteren Frau neben mir. Schnell hat mich die Realität wieder aus meinen Tagträumen eingeholt und ich schnappe mir hastig meine Tasche, damit die Dame sich hinsetzen kann. Schwer ausatmend denke ich darüber nach, wie es wäre, einfach von hier wegzugehen. Nicht nur für ein paar Tage, sondern für immer.
Einfach jeden Tag mit Meeresrauschen aufwachen, sorglos in den Tag starten ... wenn es doch nur so einfach wäre! In den Büchern, die ich lese, klingt immer alles so simpel und vollkommen. Leider sieht die Realität anders aus. Aber meine Träume kann mir wenigstens niemand nehmen. Auch, wenn sie nur von kurzer Dauer sind, fühlt es sich manchmal fast wie Urlaub an. Zumindest, wenn ich es mir lang genug einrede.
Ich steige aus dem überfüllten Bus und habe endlich das Gefühl, wieder frei atmen zu können. Menschen drängen sich an mir vorbei und hasten durch die Straßen zur nächsten Haltestelle. Alle starren nur noch auf ihre Smartphones.
In meiner Magengegend macht sich ein flaues Gefühl bemerkbar. Am liebsten würde ich wieder umdrehen. Einfach nach Hause fahren. Oder ans Meer. Hauptsache weg. Aber, wie ich schon sagte - die Realität sieht eben anders aus. Und so beginne auch ich, etwas schneller zu gehen, damit ich wenigstens pünktlich bei meiner Praktikumsstelle ankomme. Ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass ich kaum noch Zeit habe. In exakt fünf Minuten bin ich wieder für acht Stunden in einer Gefängniszelle gefangen. Eigentlich mag ich meinen Praktikumsplatz, schließlich habe ich immer davon geträumt, in einem Buchverlag zu arbeiten. Zudem werde ich von allen gut behandelt und kann dort das tun, was mir Spaß macht. Und dennoch fühlt es sich jedes Mal an, als sei ich dort gefangen. Ich kann dieses Gefühl nicht genau erklären, es ist einfach da. Und es ist immer präsent. Ich schaue noch einmal auf die Uhr.
Noch drei Minuten, dann werde ich durch diese Tür gehen und so tun, als sei ich der gelassenste und fröhlichste Mensch der Welt.
Nun stehe ich vor dem riesigen Gebäude und atme noch einmal tief durch. Du schaffst das, sage ich zu mir selbst und öffne zögerlich die schwere Holztür. Ein Blick nach links und rechts verdeutlicht mir, dass gerade alle in ihren Büros sitzen oder irgendwelche Termine haben. Erleichtert steuere ich fast schleichend auf das kleine Büro zu, in dem ich arbeite. Ich bete insgeheim, dass mich niemand bemerkt. Behutsam drücke ich die Türklinke herunter und betrete das kleine Zimmer.
„Guten Morgen, ich habe Sie schon erwartet, Miss Bennet.“
Ich zucke zusammen und erblicke Mrs Kelly, meine Chefin. Das kann nichts Gutes heißen, denke ich mir und sie deutet mit einer Handbewegung an, dass ich mich setzen soll.
„Guten Morgen.“, krächze ich und bin sichtlich nervös. Was könnte sie nur wollen? Tausend Dinge schießen mir durch den Kopf. Bekomme ich die Kündigung? Habe ich irgendetwas falsch gemacht?
Ehe ich weiter darüber nachdenken und mir das schlimmste Worst-Case-Szenario ausmalen kann, rattert sie auch schon los.
„Ich weiß, Sie sind noch nicht lange bei uns ... Sie stehen ja auch noch ganz am Anfang Ihrer Karriere. Aber mein Mann und ich haben uns eine Weile über Sie unterhalten und ...“
Moment mal, meine Vorgesetzten haben sich über mich unterhalten? Ich erröte und starre sie verwirrt an. Sie spricht immer so dermaßen schnell, dass mir gar keine Zeit bleibt, das Gesagte zu verarbeiten.
„... was ich aber eigentlich sagen wollte ist, dass wir mehr als nur zufrieden mit Ihrer Leistung sind. Sie haben großes Talent! Darum haben wir eine kleine Überraschung für Sie vorbereitet.“
Ich spüre, wie die anfängliche Anspannung förmlich von mir abfällt und ich leicht zu grinsen beginne. Sie sind scheinbar wirklich zufrieden mit mir, sie mögen mich!
Die Andeutung auf eine Überraschung weckt meine Neugier und ich schaue meiner Chefin erwartungsvoll in die Augen. Obwohl sie sonst immer wie ein Wasserfall redet, macht sie ausgerechnet in diesem Moment eine Kunstpause, die eine gefühlte Ewigkeit anhält, bis sie endlich aufsteht und etwas aus einem der großen Büroschränke holt.
„Da Sie ja noch knapp zwei Monate Semesterferien haben ...“ Sie reicht mir einen Umschlag. Ich zögere nicht lange und öffne ihn vorsichtig. Zwei Sekunden später halte ich es in den Händen: Ein Zugticket nach New York! Ich brauche einen Moment, bis ich realisiere, dass das gerade kein Traum ist.
„Freuen Sie sich denn gar nicht?“
„Äh, doch, doch klar! Ich bin nur so ...“
Ja, was ist man in so einem Moment? Überrascht? Überrumpelt?
„... überwältigt!“, antworte ich, froh, die halbwegs passenden Worte gefunden zu haben. Ich bin nicht der Typ Mensch, der seine Freude offen nach außen zeigt. Ich freue mich eher innerlich, weiß jedoch nie so richtig, wie ich mich in solchen Situationen verhalten soll. Fragen über Fragen füllen augenblicklich meinen Kopf.
„Ich freue mich wirklich sehr, aber was mache ich denn dort, in New York? Und wo schlafe ich dort, wer bezahlt das denn alles?“
Mrs Kelly musste schon bemerkt haben, dass ich mir mal wieder den Kopf zerbreche und kann mich zum Glück beruhigen.
„Keine Sorge, wir haben alles perfekt organisiert. Unsere New Yorker Hauptverwaltung erwartet Sie schon. Sie werden dort zusammen mit weiteren Praktikanten erstklassig betreut. Und natürlich können Sie dort eine Menge über das Schreiben und Lektorieren von Büchern lernen. Sie werden von uns selbstverständlich auch vergütet, sodass Sie Ihre Miete vor Ort auch bezahlen können. So eine Chance bekommt nicht jeder, nutzen Sie sie. Morgen um acht Uhr fährt der Zug ab. Fahren Sie ruhig nach Hause und packen Sie in Ruhe Ihre Sachen, es wird ein langer Tag morgen.“
Mit diesen Worten verlässt sie das Büro. Ich denke noch einmal darüber nach, was mir bevorsteht und muss lächeln. New York City, eine Stadt am Meer. Vor ein paar Stunden habe ich noch sehnsüchtig davon geträumt, am Meer zu leben.
So weit weg ist New York von hier aus eigentlich gar nicht, es sind nur knapp fünf Stunden Zugfahrt. Dennoch konnte es sich meine Familie nie leisten, einen solchen Ausflug, geschweige denn Urlaub zu machen. Daher blieb es immer ein unerfüllter Traum für mich. Doch nun würde dieser Traum wahr werden, wenn auch nur für knapp acht Wochen. Der Gedanke an das Meer lässt mich vor Freude hüpfen. Ich stehe auf, packe noch ein paar Schreibutensilien von meinem Schreibtisch ein und stürme schließlich leichtfüßig aus dem Bürogebäude. Nordatlantik, ich komme!
Kapitel 2
Völlig aus der Puste schließe ich die Tür meines kleinen Apartments auf. Ich gehe ins Schlafzimmer und lasse mich auf mein altes Holzbett fallen.
New York City, eine Stadt am Meer. Mein Herz klopft bis zum Hals. Als ich vor einem halben Jahr bei meinen Eltern ausgezogen bin, dachte ich, das sei die beste Entscheidung meines Lebens gewesen. Ich hatte gehofft, dass ich dann endlich anfangen würde, mein Leben zu genießen. Aber dem war nicht so. Nun sitze ich jeden Tag allein in meiner Wohnung, umgeben von Stille.
Die Wohnung hat etwas Melancholisches an sich. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich keine der Wände gestrichen habe. Alles wirkt sehr monoton und erdrückend. Freunde habe ich auch keine, zumindest keine richtigen. Und mit richtigen Freunden meine ich die Art Freunde, die man zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen und ihnen sein Herz ausschütten kann. So etwas kenne ich leider nur aus Büchern und Filmen.
Ich stelle fest, dass meine Gedanken schon wieder kreisen und gebe mir einen Ruck. Auch, wenn das Verhältnis zu meiner Mutter nicht das Beste ist, wähle ich ihre Nummer. Zu meinem Vater habe ich kaum noch Kontakt, seitdem meine Eltern sich scheiden ließen.
Es klingelt. Einmal, zweimal, mein Herz schlägt schneller. Doch bevor ich mir die passenden Worte zurechtlegen kann, nimmt sie ab. Statt einer herzlichen Begrüßung bekomme ich nur ein „Ich dachte schon, du rufst nie an!“ zu hören. Wir sprechen über dies und das, doch ehe ich mich versehe, platzt es aus mir heraus.
„Ich gehe nach New York! New York City, um genau zu sein. Direkt am Meer! Ist das nicht toll?“
Ich kann meine Freude kaum zurückhalten und hoffe, dass sie sich einfach mit mir mitfreuen kann. Wenigstens dieses eine Mal. Aber da habe ich mich geirrt. Stattdessen bekomme ich eine halbstündige Standpauke zu hören, gefolgt von sich immer wiederholenden Moralpredigten.
Das ist viel zu gefährlich, lass das sein, dort leben doch nur Verrückte, bla bla bla ...
Ich rolle schon zum hundertsten Mal mit den Augen, bis sie schließlich kurz verstummt und ich endlich zu Wort komme.
„Ich werde dorthin gehen. Ich bin volljährig und erfülle mir damit einen Traum, diese Chance bekomme ich wahrscheinlich nie wieder! Und ich muss mich nicht vor dir rechtfertigen, es ist mein Leben!“
Ich höre einen lauten Seufzer, dann antwortet sie mit
„Ist ja gut, du hörst ja sowieso nie auf mich. Melde dich, wenn du in New York bist.“
Ehe ich noch irgendetwas erwidern kann, hat sie schon aufgelegt. Ich bin aufgewühlt und brauche einen Moment, um mich wieder zu sammeln. Was habe ich denn auch erwartet? Dass sie sich freuen würde und stolz auf mich sei? Ich hätte wissen müssen, dass sie so reagiert. Sie war noch nie die Art Mutter, die einfach nur stolz auf ihr Kind ist. Nein, sie musste schon immer allem skeptisch gegenübertreten und für jede noch so tolle Nachricht ein Gegenargument finden. So ist sie nun einmal und ich muss damit wohl leben.
Die nächsten Stunden vergehen wie im Flug. Überall stapeln sich Klamottenberge und Bücher, die ich niemals alle mitnehmen kann. In diesen winzigen grauen Koffer, den ich mir letztes Jahr gekauft, aber noch nie benutzt habe, passt einfach nichts hinein! Ich fluche, stöhne und jammere noch den ganzen Abend, quetsche Hosen, Jacken und alle möglichen Kleidungsstücke in den Koffer und schwitze, als würde ich einen Marathon laufen. Eine Reisetasche, einen Rucksack und eine vollbepackte Handtasche später habe ich es endlich geschafft, alles Nötige einigermaßen zu verstauen. Wie ich das alles transportieren soll, weiß ich nicht, aber darum kann ich mich morgen noch kümmern.
Ich begebe mich als nächstes in meine kleine, ungemütliche Küche. In einem Film würde die Hauptperson jetzt das Radio einschalten, tanzend vor dem Herd stehen und Pancakes zubereiten. Mein Leben ist aber nun mal leider kein Film und ich bin alles andere als eine Hauptperson, wie ich mal wieder traurig bemerke. Zutaten für Pancakes habe ich natürlich auch keine, wie ich nach einem kurzen Blick in den Kühlschrank feststelle. Also hocke ich mich in eine Ecke, öffne Spotify auf meinem Handy und esse eine ungetoastete Toastscheibe mit Erdbeermarmelade. Aus den Lautsprechern meines Smartphones dröhnt der Song „Start of Something New“ und obwohl ich es noch gar nicht richtig glauben kann, habe ich es im Gefühl. Jetzt wird alles besser werden, jetzt beginnt ein Neuanfang.
Mein Neuanfang. In dem Song singen sie von Liebe und Leidenschaft und ich stelle mir vor, wie schön es wäre, wieder jemanden an meiner Seite zu haben, mit dem ich meine Freude teilen könnte. Jemand, der mich versteht und für mich da ist, wenn es mir schlecht geht. Jemand, der mich einfach in den Arm nimmt. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, aber ich werde mich vermutlich nie trauen, jemanden persönlich anzusprechen. Daher habe ich meinen Exfreund damals auch im Internet kennengelernt. Im Nachhinein betrachtet war das schon sehr armselig, aber für mich war es der einfachste Weg, jemanden zu finden. Anfangs lief auch alles gut, wir unternahmen viel und ich war froh, aus meiner Komfortzone herauszukommen. Aber von Zeit zu Zeit wendete sich das Blatt und es entwickelte sich bald eine toxische Beziehung daraus. Immer wieder kritisierte er mich, gab mir an jedem noch so kleinen Dilemma die Schuld und machte mich emotional immer weiter kaputt. Ich verfiel in Depressionen und suchte die Fehler immer bei mir. Bis zum Tag X, an dem ich endlich erkannte, dass er der Auslöser für all das war. Nach der Trennung ging es mir so gut wie nie und obwohl ich davon träumte, irgendwann den Richtigen zu finden, gab ich die Hoffnung irgendwann auf.
Dann bleibt das eben definitiv ein Traum. Ich möchte mich komplett auf meine Karriere konzentrieren. Und wenn ich von meiner Abenteuerreise zurückkomme, habe ich sicherlich genügend Erfahrungen gesammelt, um hier meine berufliche Karriere als zukünftige Lektorin oder vielleicht sogar Autorin voranzutreiben. Ich sehe es schon vor mir, mein erstes eigenes Buch. Das war immer mein größter Traum gewesen. Hier in der Kleinstadt, in der ich lebe, gibt es keinen einzigen Verlag, der mir diesen Wunsch erfüllen könnte. Aber in New York bekomme ich vielleicht endlich die langersehnte Chance, mich zu beweisen.
Schon als Kind habe ich gern Geschichten geschrieben. Und als ich dann älter wurde, fasste ich den Entschluss. Ich wollte Autorin werden. Darum begann ich auch mein Studium im Bereich Sprachwissenschaften und suchte mir für die Semesterferien einen Praktikumsplatz in einem Buchverlag. Und nun sitze ich hier voller Aufregung und Tatendrang und werde schon morgen in eine fremde Stadt fahren, um mein Praktikum dort fortzuführen.
Als ich mit dem Essen fertig bin, stehe ich auf und mache mich bettfertig. Morgen steht mir ein anstrengender Tag bevor, darum gehe ich früh schlafen. Ich denke noch einmal an das Meer und die Wellen, dann schlafe ich ein.
Kapitel 3
Ein lautes „Rrrrrrriiiiiiiiinnng!“ reißt mich aus meinem Traum. Völlig verschlafen greife ich nach meinem Handy, schalte den Wecker aus und verfluche ihn mit einem genervten „Halt die Klappe!“. Ich hasse es, wenn der Wecker klingelt, vor allem, wenn ich gerade etwas träume. Stöhnend strecke ich Arme und Beine von mir. Heute ist mein Tag.
Als ich mir wieder ins Gedächtnis rufe, dass New York und vor allen Dingen das Meer auf mich warten, springe ich auf und sprinte beinahe ins Badezimmer.
Meine Müdigkeit ist auf einmal wie weggeblasen. Ich muss mich beeilen, denn in einer halben Stunde fährt bereits der Zug. In Sekundenschnelle putze ich mir die Zähne, knote meine mehrfach überfärbten Haare zu einem fransigen Dutt zusammen und ziehe mir für die Reise etwas Bequemes an.
Etwas gehetzt trete ich vor die Haustür. Gedankenverloren blicke ich vor mir auf den schmalen Kieselweg. Ich habe eine lange Reise vor mir.
Aber: Jeder noch so weite Weg beginnt mit dem ersten Schritt.
Mit diesem Gedanken ziehe ich los. Glücklicherweise ist der Bahnhof nicht weit von meiner Wohnung entfernt, sodass ich das Gepäck nur ein paar Minuten schleppen muss. Keuchend komme ich schließlich am Gleis zwei an. Mein Zug steht schon da, auf der Digitalanzeige leuchtet mir in Großbuchstaben NEW YORK CITY entgegen. In diesem Moment ist es mir egal, wie schwer und unhandlich mein Gepäck ist. Mir ist alles egal. Bis zu dem Augenblick, in dem ich einsteige und enttäuscht feststellen muss, dass alle Plätze belegt sind.
Aber, Moment mal ... ich habe doch ein Ticket mit Sitzplatzreservierung! Nach fast vergeblicher Suche finde ich endlich den Platz, auf dem eigentlich ich hätte sitzen sollen.
„Entschuldigung, das hier ist ...“, ich halte mein Ticket der Frau, die es sich dort gemütlich gemacht hat, zitternd entgegen, „... mein Platz.“
Die Frau starrt mich entgeistert an. Sie hat glänzendes, blondiertes Haar, ist sehr stark geschminkt und riecht nach Zigaretten und Gras. Auf mich wirkt sie irgendwie einschüchternd. Obwohl ich neben ihr stehe und dadurch größer bin als sie, schaut sie mich an, als würde sie von oben auf mich herabblicken.
„Sorry, das kannste vergessen. Is' mein Platz, und jetzt verzieh dich!“, entgegnet sie mir und formt eine Kaugummiblase, die sie dann vor meinen Augen platzen lässt. Wenn ich den Mut hätte, würde ich zum Zugpersonal gehen und darauf bestehen, mich auf meinen Platz setzen zu dürfen. Ich würde die Frau sicherlich auch zur Rede stellen und sie würde beleidigt den Platz räumen. Aber so bin ich nun einmal nicht. Also setze ich mich auf den Boden und lehne mich an mein Gepäck. So unbequem ist es gar nicht. Zumindest, wenn ich es mir lang genug einrede.
Wir sind schon eine Weile unterwegs, als ich vorsichtig um mich blicke. Manche Menschen schlafen auf ihren Taschen, andere essen Kartoffelchips oder trinken Sekt aus der Flasche. Ein älterer Herr hat sich auf zwei Sitzen ausgebreitet und tippt irgendetwas in seinen Laptop. Ich beobachte fasziniert, wie jeder sich auf eine andere Art und Weise die Zeit vertreibt. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Menschen alle ein eigenes Leben führen, voller Höhen und Tiefen. Ich bin einer von ihnen. Wir sind alle so unterschiedlich, aber dennoch verbindet uns etwas wie ein unsichtbares Band. Wir alle haben ein Ziel - New York. Für manche von ihnen ist dies sicherlich nichts Besonderes. Einige arbeiten wahrscheinlich dort und fahren diese Strecke jede Woche. Aber für mich ist diese Fahrt nicht nur irgendeine Zugfahrt, eingepfercht zwischen Menschen mit starken Körpergerüchen und umhüllt von stickiger, nach Zigarettenrauch und Billigparfüm riechender Luft. Nein, für mich ist dies der Beginn einer Reise. Nicht nur in eine andere Stadt, sondern auch zu mir selbst. Und egal, was passieren wird, ich werde an meinen Träumen festhalten und mich von nichts und niemandem davon abhalten lassen.
Die Zeit zieht sich in die Länge wie Kaugummi. Ob die anderen Praktikanten auch in diesem Zug sitzen, weiß ich nicht, aber ehrlicherweise bin ich froh, mit niemandem sprechen zu müssen. Ich weiß auch nicht, wie lange wir schon unterwegs sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis wir die Endstation erreichen. Langsam werde ich unruhig.
Nun, wo es bald ernst wird, schießen mir direkt wieder tausend Gedanken durch den Kopf. Wird mich jemand empfangen? Falls nicht, wo muss ich hin? Werde ich Freunde finden? Was mache ich, wenn niemand mich mag? Fragen über Fragen. Ich weiß, dass ich keine Antwort darauf bekomme, solange ich es nicht einfach selbst herausfinde. Ich sollte es einfach auf mich zukommen lassen und abwarten, was passiert.
Aber das ist nun einmal nicht meine Art, die Dinge anzugehen. Ich muss alles bis ins kleinste Detail durchgeplant und analysiert haben, damit ich beruhigt sein kann. Und auch, wenn ich mich auf New York freue, gefällt mir diese Spontanität so ganz und gar nicht. Ich hasse diese Situation, in der ich mich gerade befinde.
Voller Ungewissheit, was gleich geschehen wird. Doch ehe ich weiter grübeln kann, ertönt eine blecherne Durchsage.
„Nächster Halt: New York. Dies ist die Endstation. Wir bitten alle Fahrgäste, auszusteigen. Bitte kontrollieren Sie Ihre Sitze, damit Sie nichts liegen lassen.“
Und dann bricht das Chaos aus. Menschen springen förmlich von ihren Sitzen, einige rennen in Richtung Ausgang. Es wird gedrängelt, geschubst, geflucht. Ich bleibe auf meinem Gepäck sitzen und warte ab, bis ich in aller Ruhe aussteigen kann. Insgesamt dreimal drehe ich mich zu meinem Platz um, um sicherzugehen, dass ich auch nichts vergessen habe. Ich muss eben alles unter Kontrolle haben.
Einen Moment später atme ich endlich wieder frische Luft ein. Ich blicke erst nach links, dann nach rechts. Da ist niemand. Niemand, der ein Schild mit meinem Namen hochhält. Niemand, der mich freudig empfängt.
Ich stöhne auf. Das hätte ich mir doch denken können! Auf mich wartet natürlich niemand. Dennoch verfalle ich nicht in Panik. Morgen ist mein erster Arbeitstag und ich werde schon irgendwie zu dieser Unterkunft finden, die meine Chefin mir am Tag zuvor im Internet gezeigt hat. Trotzdem bin ich enttäuscht.
Ich schlendere langsam zum Ausgang des Bahnhofes. Doch ich komme nicht weit. Schon nach ein paar Schritten hält mich ein Typ auf, der auf den ersten Blick wie ein Straßenmusiker aussieht. Zerrissene Jeans, ein rotes Karohemd, Springerstiefel. Die Haare hat er zu einem wilden Dutt zusammengebunden.
„Entschuldige, du bist doch Haylie, oder?“
Ich zucke zusammen. Woher kennt dieser seltsame Typ meinen Namen?
„Äh, ja, das bin ich ... was ...?“ Ich schaue ihn fragend an.
„Ich bin Jamie, von Kelly Publishing. Du bist doch eine der neuen Praktikanten, richtig? Ich bin für die Neuankömmlinge zuständig. Einer wohnt bereits seit einer Weile in seiner Unterkunft, die anderen beiden haben leider abgesagt.“
Moment mal, dieser Kerl soll zu dem Verlag gehören, bei dem ich arbeite? Er wirkt auf mich nicht sehr seriös und meine Skepsis ist mir deutlich anzusehen.
„Ich weiß, was du jetzt denkst. Wie kann so ein Penner in so einer krassen Bude arbeiten?“
Er grinst, und ich bin erschrocken darüber, wie gut er meine Gedanken lesen kann.
„Aber mach dir keine Sorgen, Kleines. Ich hatte schon viele Praktikanten an meiner Seite und sie leben alle noch.“
Er lacht, aber es ist kein herzliches Lachen. Eher so ein hinterlistiges, gruseliges Gelächter. Mir läuft ein kalter Schauer über den Rücken. Aber vermutlich hat er Recht und er ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie ich befürchte. Ich lächle ihn etwas verunsichert an und er bedeutet mir mit einer Handbewegung, dass wir aufbrechen sollten. Wie selbstverständlich nimmt er mein Gepäck und wir gehen zum Ausgang.
Die Fahrt bis zu meiner Unterkunft vergeht wie im Flug. Ich bin komplett überwältigt von den ganzen neuen Eindrücken dieser Stadt mit ihren riesigen Wolkenkratzern und dem chaotischen Stadtverkehr. Bei jedem Hupen, das ich höre, zucke ich zusammen und ich habe ständig Angst, dass wir bald einen Unfall bauen, wenn dieser Jamie weiter so wie ein Henker rast. Aber von Minute zu Minute werde ich ruhiger und gewöhne mich fast an diese gewöhnungsbedürftige Fahrweise.
Ich blicke aus dem Fenster und kurbele die Scheibe runter, um den Fahrtwind zu spüren. Für einen Moment schließe ich die Augen und recke meinen Kopf leicht hinaus. Mich überkommt ein Gefühl, das ich nicht so recht definieren kann. Als hätte ich zu viel Brausepulver geschluckt. Oder zu viele Cocktails geschlürft. Als ich die Augen öffne, wird mir dann klar, was das für ein Gefühl ist. Es ist pures Glück.
„So, wir sind da. Aussteigen, Lady Haylie!“
Ich zucke kurz zusammen. Lady Haylie ... so hatte er mich auch immer genannt. Zu der Zeit, als alles noch rosarot und wunderschön war. Ja, es war wunderschön. Aber diese Zeiten sind nun einmal vorbei. Ich gebe mir einen Ruck und steige aus dem Wagen, ohne weiter über dieses Arschloch nachzudenken, das mir mein Herz gebrochen hat. Wirklich eigenartig, dass dieser Jamie mir den gleichen Spitznamen verpasst.
„Komm, folge mir. Ich zeige dir erst einmal deine Wohnung, dein Gepäck bringe ich dir nachher gleich.“
Ich folge Jamie zu einem mehrstöckigen Hochhaus. Es ist keiner dieser unvorstellbar hohen Wolkenkratzer, aber es sieht definitiv nach New York und Stadtfeeling aus. Wir betreten das Treppenhaus. Am Aufzug hängt ein Schild mit der Aufschrift „Defekt, bitte Treppe benutzen“. Na toll, auch das noch, denke ich mir und stöhne genervt. Jamie bemerkt es sofort.
„Keine Sorge, Kleines, dein Apartment ist nur im dritten Stock. Kein Weltuntergang.“
Ich atme erleichtert auf und steige zusammen mit Jamie die Treppen hinauf. Das Treppenhaus ist sehr eng und macht auf mich einen erdrückenden Eindruck.
Nur ein kleines Fenster bringt etwas Licht ins Dunkle und ich hoffe, dass meine Bleibe wenigstens ein bisschen freundlicher wirken wird.
Kurz darauf erreichen wir endlich die Tür zu meiner Wohnung. Meine Beine fühlen sich wie Wackelpudding an und ich bin total außer Atem. Die Nervosität, gleich meine Bleibe für die nächsten Wochen zu sehen, beschleunigt ebenfalls meine Atmung und meinen Herzschlag. Jamie betritt zuerst den Flur und ich folge ihm. Am liebsten würde ich mich an ihm vorbeidrängen, weil ich es kaum erwarten kann, alles genau in Augenschein zu nehmen. Er zeigt mir alle Räume und erklärt einige Dinge, doch ich höre nur mit halbem Ohr zu. Meine Gedanken kreisen wieder und ich kann an nichts anderes denken, als endlich den Ausblick aus dem Wohnzimmer zu sehen.
„... und hier ist das Wohnzimmer. Ja, es ist nicht sonderlich groß, aber ...“
Wow. Nicht sonderlich groß, da hat Jamie Recht. Aber es ist gemütlich. Und noch mehr als das, denn es ist perfekt. Perfekt für mich, um mich mit einem Buch auf dem Sofa einzurollen und in Gedanken zu schwelgen.
Ich sehe mich in dem kleinen Raum um und entdecke ein Fenster, welches ebenfalls nicht besonders groß ist. Doch als ich hinausblicke, schlägt mein Herz auf einmal viele kleine Salti. Auch, wenn es nur ein kleiner Spalt zwischen hohen Häusern ist, kann ich es endlich sehen - das Meer. Es ist nur ein kleiner Streifen am Horizont, vielleicht ist es auch nur eine Illusion, aber ich halte daran fest. Meine Mundwinkel zucken nach oben und auch, wenn der Ausblick nicht der allerbeste ist, ist er für mich nahezu perfekt.
„Ich lasse dich dann mal allein. Wenn du irgendetwas brauchst, hier ist meine Visitenkarte. Ruf mich einfach an. Morgen früh gegen neun solltest du im Büro sein. Wir sehen uns morgen.“
Mit diesen Worten verabschiedet sich Jamie und legt seine Karte auf den schmalen Couchtisch. Ich lasse mich auf das alte Sofa fallen und schließe die Augen. Und ehe ich mich versehe, schlafe ich ein.
Kapitel 4
Als ich aufwache, scheint es schon nach Mitternacht zu sein, denn draußen ist alles stockdunkel. Man könnte meinen, in New York sei es nie komplett dunkel und ruhig, denn diese Stadt lebt.
Jedoch ist das hier nicht die typische New Yorker Innenstadt, wie man sie vielleicht aus dem Fernsehen oder aus Büchern kennt. Dieses Viertel, in dem ich vorübergehend wohne, ist erstaunlich ruhig, was mir schon beinahe unheimlich vorkommt. Ich quäle mich verschlafen vom Sofa hoch und wanke zum Fenster.
Sehen kann ich es nicht, aber ich spüre es. Das Meer ist zum Greifen nah und ich kann es kaum abwarten, endlich am Strand entlang zu rennen und das Freiheitsgefühl zu genießen, das ich mir immer erträumt habe. Ich öffne behutsam das alte Holzfenster und inhaliere die lauwarme Sommerluft. Vielleicht ist es nur Einbildung, aber ich bin der festen Überzeugung, dass ich sogar das Salzwasser riechen kann. Ich lächle zufrieden und begebe mich zum Schlafzimmer, denn morgen wird ein langer Tag. Voller Vorfreude und Aufregung schlafe ich ein und träume von hohen Wellen, die mich immer wieder zu sich rufen.
Ich werde wach, kurz bevor der Wecker klingeln würde. Meine Müdigkeit verschwindet in Sekundenschnelle, weil ich mich so sehr auf diesen Tag freue.
Heute werde ich endlich das Meer sehen und mein neues Büro kennenlernen. Aber nicht nur irgendein Büro, davon gibt es schließlich viele. Nein, ein New Yorker Büro. Mein New Yorker Büro. Je länger ich darüber nachdenke, umso schräger und faszinierender klingt es. Ich kneife mich kurz selbst in den Arm, um zu checken, ob ich träume. Aber dem ist nicht so. Ich bin hellwach und mitten im Hier und Jetzt. Das hier ist tatsächlich mein Leben.
Ich stehe auf und gehe in die offene Küche, wo ich feststellen muss, dass nichts Essbares in den Hängeschränken oder im Kühlschrank zu finden ist. Ich hatte überhaupt nicht daran gedacht, einzukaufen. Egal, dann werde ich mir eben unterwegs etwas zum Frühstück besorgen. Das sollte in so einer Großstadt wie New York ja kein Problem sein.
Ich ziehe mich in Windeseile um und schnappe mir meinen braunen Rucksack. Einen Wimpernschlag später trete ich auch schon aus der Tür, bereit für meinen ersten Arbeitstag. Bereit für New York. Bereit für das Meer. Oder für mehr.
Die Luft ist lau und es weht ein leichter Wind, als ich den ersten Fuß vor die Haustür setze. Auch, wenn ich nicht viel Zeit habe und zügig durch die Straßen laufe, sauge ich alles in mich auf. Das laute Hupen der Autos, das Kreischen der Möwen, den Anblick der riesigen Gebäude. Ein Mann mittleren Alters geht schnellen Schrittes den Gehweg auf und ab und schreit dabei alle paar Sekunden in sein Handy. Ein kleines Mädchen kommt mir mit ihrem Chihuahua entgegen, der wie wild an der Leine zerrt. Ständig muss ich aufpassen, dass mich niemand anrempelt. Die Straßen und Gehwege sind prall gefüllt und doch fasziniert mich dieser Ort. Andere Leute wären von diesem Trubel sofort gestresst, ich hingegen genieße es beinahe. Aber nicht, weil ich Menschenmassen so toll finde, nein, ganz gewiss nicht. Es ist eher diese Anonymität, die ich hier habe. Niemand kennt mich, niemand beachtet mich inmitten dieser unzähligen Stimmen und Bewegungen.
Ich bin so weit weg von zu Hause, dass ich mich wie ein neuer Mensch fühle. Ein neuer Mensch in einer neuen Stadt.
Ein paar Schritte weiter bin ich auch schon da und stehe vor einem beachtlichen Bürogebäude. Wahnsinn, denke ich und atme noch einmal tief durch, bevor ich die Tür öffnen will. Ich rüttle an der weißen Glastür, doch es passiert nichts. Okay, ganz ruhig. Vielleicht muss ich irgendwo klingeln. Die werden mich ganz sicher nicht vergessen haben. Ich schaue mich um und gehe ein Stück weiter, um nach der Klingel zu suchen. Fehlanzeige. Wie kann so ein riesiger Bürokomplex denn keine verdammte Klingel haben? Das darf doch alles nicht wahr sein!
In Gedanken packe ich schon meine Koffer und bereite mich auf die Rückreise vor, als mir jemand auf die Schulter tippt. Erschrocken drehe ich mich um und blicke in zwei wunderschöne blaue Augen.
„Suchst du was Bestimmtes?“, fragt mich mein Gegenüber und mustert mich von oben bis unten. Mein erster Gedanke: Arrogantes Arschloch! Okay, aber ein verdammt gutaussehendes arrogantes Arschloch.
„Ich, ähm, ich bin die Praktikantin.“, stammele ich vor mich hin.
Na toll, da begegne ich an meinem ersten Tag so einem gutaussehenden Typen und ich vermassele es gleich zu Beginn. Einen zweiten Satz bekomme ich erst gar nicht zustande. Stattdessen nehme ich den Typen genauer unter die Lupe in der Hoffnung, dass er es nicht mitbekommt. Er trägt einen dunkelblau-grauen Hoodie, vermutlich irgendein Markenteil. Seine Hose ist in schlichtem Schwarz gehalten und hat kleine Löcher an den Knien und er trägt weiße Sneakers.
Erst jetzt bemerke ich, dass er mich anstarrt. Ganz toll, jetzt hat er also doch bemerkt, wie ich ihn gemustert habe!
Ich blicke etwas schuldbewusst zu ihm auf, obwohl ich eigentlich gar nichts falsch gemacht habe, aber es fühlt sich so an. Ich sollte mich wirklich zusammenreißen. Wahrscheinlich werde ich diesen Typen nie wiedersehen. Man begegnet so vielen Menschen am Tag, also sollte ich kein Drama daraus machen und einfach weitergehen. Oder ihn zumindest fragen, ob er sich hier auskennt, und danach abhauen.
Erst jetzt fallen mir seine mittelblonden Haare auf, die er zu einem leichten Seitenscheitel frisiert hat. Und diese Lippen ...
„Wo machst du denn Praktikum? Die Reinigungsfirma ist auf der anderen Straßenseite.“
Ist das sein Ernst? Nur, weil ich keine Designerklamotten trage, muss ich mich von einem Schnösel wie ihm nicht gleich so behandeln lassen! Ich nehme all meinen Mut zusammen und schaue ihm direkt in die Augen.
„Ich mache ein Praktikum in einem Verlag, in diesem Haus hier.“ Ich zeige auf das Gebäude neben mir.
„Also, wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich muss zur Arbeit.“, hänge ich noch hinterher und wende mich von ihm ab, um schnurstracks in Richtung Tür zu stolzieren. Dass die Tür verschlossen ist und ich nicht reinkomme, muss er ja nicht wissen. Doch ich bemerke, dass er mir folgt. Warum zur Hölle folgt er mir? Will er mich entführen? Vergewaltigen? Umbringen?
Ich drehe mich zu ihm um und sehe ihn fragend an. Solange ich mir meine Angst nicht anmerken lasse, kann er mir nichts tun. Zumindest ist das meine Herangehensweise, denn praktisch gesehen ist diese Ansicht totaler Bullshit.
„Der Eingang für Mitarbeiter ist da hinten um die Ecke. Das hier ...“, er zeigt auf die Glastür, an der ich vorhin wie eine Verrückte gerüttelt habe, „... ist nur der Eingang für Besucher. Und der wird erst in einer Stunde geöffnet.“
Moment mal ...
Woher weiß dieser Schnösel, wo der Eingang ist? Langsam dämmert es mir ...
„Na komm, oder willst du hier Wurzeln schlagen?“ Mit diesen Worten wendet sich der dubiose Typ von mir ab und steuert tatsächlich auf die Hausecke zu. Zögernd folge ich ihm bis zu besagtem Mitarbeitereingang. Mein letztes Fünkchen Hoffnung, dass dieser Kerl vielleicht doch nicht hier arbeiten könnte stirbt, als er seinen Mitarbeiterausweis an die Tür hält und diese sich daraufhin öffnet. Der Tag fängt ja echt gut an.
Kapitel 5
Der Geruch von geröstetem Kaffee und Druckertinte steigt mir in die Nase, als ich einen Schritt in das Bürogebäude setze. Gerade, als ich mich etwas umsehen möchte, kommt mir eine quirlige Blondine mittleren Alters entgegen. Mit einem Aktenordner unter ihrem Arm und einem Kaffee in der Hand versucht sie, mich zu begrüßen, was mit vollen Händen irgendwie nicht so gut funktioniert und etwas unbeholfen aussieht.
„Hi, du musst Haylie sein! Ich bin Melinda, eure Praktikantenbetreuerin. Und hi, Ricky.“





























