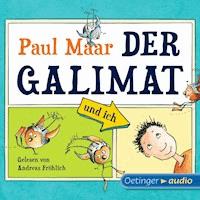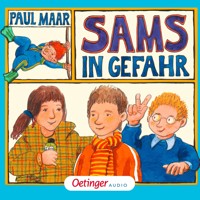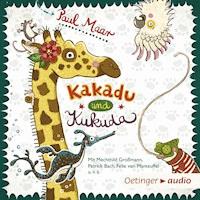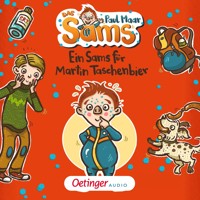9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der »Sams«-Erfinder Paul Maar erzählt den Roman seiner Kindheit Paul Maar erinnert sich an den frühen Tod seiner Mutter, den viele Jahre im Krieg verschwundenen Vater, die neue Mutter, er erinnert sich an das Paradies bei den Großeltern und die unbarmherzige Strenge in den Wirtschaftswunderjahren. Paul Maars Erinnerungen sind zugleich Abenteuer- und Freundschaftsgeschichte, ein Vater-Sohn-Roman und eine Liebeserklärung an seine Frau Nele. Vor allem aber sind sie eine Feier der Lebensfreude, die er seinem Leben abtrotzen musste. Paul Maar beschreibt in seinen bewegenden Erinnerungen das, womit er sich auskennt wie kein Zweiter: die innere Insel, auf die sich Kinder zurückziehen. Wer dieses Buch gelesen hat, weiß, warum Paul Maar das »Sams« erfinden musste.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Paul Maar
Wie alles kam
Roman meiner Kindheit
Über dieses Buch
Paul Maar erinnert sich an den frühen Tod seiner Mutter, den viele Jahre im Krieg verschwundenen Vater, die neue Mutter, er erinnert sich an das Paradies bei den Großeltern und die unbarmherzige Strenge in den Wirtschaftswunderjahren. Paul Maars Erinnerungen sind zugleich Abenteuer- und Freundschaftsgeschichte, ein Vater-Sohn-Roman und eine Liebeserklärung an seine Frau Nele. Vor allem aber sind sie eine Feier der Lebensfreude, die er seinem Leben abtrotzen musste. Paul Maar beschreibt in seinen bewegenden Erinnerungen das, womit er sich auskennt wie kein Zweiter: die innere Insel, auf die sich Kinder zurückziehen. Wer dieses Buch gelesen hat, weiß, warum Paul Maar das Sams erfinden musste.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Paul Maar ist einer der beliebtesten und erfolgreichsten deutschen Kinder- und Jugendbuchautoren. Er wurde 1937 in Schweinfurt geboren, studierte Malerei und Kunstgeschichte und war einige Jahre als Lehrer und Kunsterzieher an einem Gymnasium tätig, bevor er sich als freier Autor und Illustrator ganz auf seine künstlerische Arbeit konzentrierte. Sein Werk wurde mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt, u.a. mit dem E.T.-A.-Hoffmann-Preis und dem Friedrich-Rückert-Preis. Etliche Schulen in Deutschland tragen seinen Namen.
Inhalt
[Widmung]
Schwebende Fische
Große und kleine Pfützen
Der Schatten meines Vaters
Im Himmel
Nebenzimmerstil
Wellenkreise
Manche Hunde gehen nicht gern ins Wasser
Der Englische Gruß
Lesen und Reden
Der Mond, der sich um die Erde dreht
Herzunter
In der Fremde
Das harte und das weiche B
Die Angst, bis zuletzt übrigzubleiben
Einer soll es machen, nur für uns
Rhönsträsser und Vogelschüsser
Primavera
Auf dem Soziussitz
Wenn alle Tage ein Brief käme
Meinen Kindern Michael, Katja und Anne gewidmet.
Schwebende Fische
Die Ereignisse eines Vormittags sind fest in meinem Gedächtnis verankert. Es ist Frühjahr, vielleicht März. Im vergangenen Dezember hatte ich meinen vierten Geburtstag gefeiert.
Mit dem Spruch »Raus aus Metz, die Festung brennt!« schlägt Oma Kuni die Bettdecke zurück, reicht mir die Hand und zieht mich hoch. Schlaftrunken sitze ich am Bettrand und mache mir klar: Ich bin nicht zu Hause, dies ist auch nicht mein Kinderzimmer, ich bin zu Besuch bei meinen Großeltern in Obertheres. Genauer gesagt, bei meinen Stiefgroßeltern. Meine echte Großmutter, Oma Margarethe, von allen Rethel genannt, ist in unserem Haus in Schweinfurt geblieben.
Oma Kuni schiebt mir die viel zu großen Pantoffeln hin. Dann tastet sie unter der prallgefüllten Zudecke nach dem Ziegelstein, den sie am Abend vorher in der Bratröhre des Küchenherds aufgeheizt und in mein Bett gelegt hat. Sie nimmt den inzwischen erkalteten Stein in die eine Hand und führt mich an der anderen die steile, dunkle Treppe hinunter in die Küche, wo Opa Schorsch und das Frühstück auf mich warten.
Ich sitze im knöchellangen Biberstoffnachthemd neben ihm. Es gibt Rührei auf selbstgebackenem Brot, dazu Pfefferminztee. Das Brot ist dünn mit Schmalz bestrichen. Butter wäre zu kostbar.
Oma Kuni hat schon gefrühstückt. Sie steht vor dem kleinen Spiegel neben dem Eisschrank und drückt sich mit der Brennschere Wellen ins graue Haar. Sie kann jetzt nicht sprechen. Zwischen ihren Lippen steckt eine Versammlung von Haarspangen, den gebogenen Teil nach innen, die stachligen Spitzen drohend nach außen gerichtet. So, denke ich, sollte sie mich lieber nicht küssen.
Dann dreht sie die Haare zu einem Nest ein, zu einem Knoten am Hinterkopf. Den steckt sie mit den Klammern fest und kann wieder sprechen.
Sie schickt mich hoch und gibt mir einen Krug mit warmem Wasser in die Hand. Ich soll mich waschen und anziehen. Oben schütte ich das Wasser in eine Porzellanschüssel. Sie steht auf dem Waschtisch aus unechtem Marmor. Nun muss ich achtgeben, dass ich den Waschlappen, der für meine obere Körperhälfte bestimmt ist, genannt der Obenrum, nicht mit dem Untenrum verwechsle. Das ist letztlich kein großes Problem für mich. Der Obenrum hängt an der seitlich angebrachten Stange weiter vorne. Außerdem ist er meist weiß oder hellgelb. Der Untenrum ist dunkler. Blau oder grün. Ein Badezimmer oder eine Dusche gibt es nicht. In keinem der Bauernhäuser ringsum gibt es ein Badezimmer oder eine Badewanne.
Nach dem Waschen trockne ich mich ab und verspüre nicht die geringste Lust, mich anzuziehen. Ich lege mich wieder ins Bett. Eigentlich will ich nur noch ein wenig dösen. Da geschieht etwas Unvergessliches.
Mit einem Mal ist das Zimmer mit blauer Luft gefüllt und in diesem Blau sehe ich Fische und fischähnliche Tiere schweben. Ich weiß, dass ich nicht träume. Ich kann den Kopf wenden und die schwebenden Tiere aus einer anderen Perspektive sehen. Sie sind bunt und bewegen sich langsam mit unterschiedlicher Geschwindigkeit von links nach rechts durch das Zimmer. Ganz deutlich erkenne ich jede Einzelheit an ihnen. Sie sind sogar im Spiegel des Kleiderschranks zu sehen. Bevor sie die Spiegelfläche berühren, drehen sie ab und müssen jetzt in die Gegenrichtung schwimmen. Dabei weichen sie elegant den anderen aus. Mit ihren gelben Augen blicken sie mich unentwegt an. Ich sehe, wie sich ihre Mäuler bewegen, scheinbar atmen sie. Später werde ich lernen, dass Fische durch ihre Kiemen Sauerstoff aus dem Wasser aufnehmen. Meine Wesen atmen durch den Mund.
Ich ahne zwar, dass diese Kreaturen nicht real sind, drehe aber immer mal am Gehirnschalter, um mich zu vergewissern, dass ich noch in Omas Schlafzimmer im Bett liege. Es ist nicht einfach, aber ich kann mich in die Realität zurückversetzen. Die Schüssel mit meinem Waschwasser steht noch auf dem Waschtisch. Oma Kuni wird sie später hinuntertragen und im Hof ausschütten. An der Wand steht stoisch der dunkelbraune Kleiderschrank, in dessen großem Spiegel ich jetzt das Unterteil des Bettes erkenne, in dem ich halb aufgerichtet liege. Jetzt, da ich sicher bin, dass die reale Welt immer noch besteht, gebe ich mich wieder ganz den Trugbildern hin.
Plötzlich gerate ich in Panik, ein so tiefer Schrecken durchfährt mich, wie ich ihn nie mehr in meinem späteren Leben erfahren habe. Ich schaffe es nicht mehr, in die Realität zu wechseln. Die Tiere ziehen im Blau des Zimmers beharrlich ihre Bahn. Ich kann sie nicht zum Verschwinden bringen. Ich schließe die Augen, warte einige Sekunden, öffne sie wieder und hoffe, dass ich das normale Zimmer vor mir sehe. Vergeblich. Die Fische schweben unbeirrt weiter.
Als Erwachsener habe ich mich gefragt, was es mit dieser so real wirkenden Vision auf sich hatte. Es scheint fast, als hätte ich damals unter Drogeneinfluss gestanden. Aber wo hätte die Droge herkommen sollen? Als ich auf den Romantitel St. Petri Schnee von Leo Perutz stieß und mich darüber kundig machen wollte, erfuhr ich, dass St. Petri Schnee auch unter den Namen Mutterkorn, Kornmutter, Hungerkorn, Armeseelentau oder Tollkorn bekannt ist und Halluzinationen hervorruft. Es ist ein kleiner Pilz, der auf Getreidekörnern nistet, bevorzugt auf Roggenkörnern. Oma Kuni backte jede Woche das Brot für die kommenden sieben Tage. Der Roggen stammte vom eigenen Getreidefeld. Vielleicht hatte sie den unscheinbaren Pilz übersehen und mitgebacken, und ich hatte beim morgendlichen Frühstück mit Opa Schorsch ausgerechnet die Scheibe Brot gegessen, in der er eingeschlossen war?
Erst später werde ich die Bedeutung des Ausdrucks »verrückt« lernen. Aber in diesem Moment glaube ich zu wissen, dass ich verrückt werde, wenn ich es jetzt nicht schaffe, mit letzter Willenskraft den Rückweg in die Realität zu finden. Es gelingt mir schließlich, und ich weiß: Nie mehr darf ich den Weg in diese andere Welt zulassen!
Große und kleine Pfützen
Es gibt Menschen, die können sich in ihre früheste Kindheit zurückversetzen. Mein Schulfreund Franz behauptete, er erinnere sich sogar an die Angst, die er während seiner Geburt ausgestanden habe und an das Gefühl der Befreiung, als er endlich aus dem Mutterleib draußen war. Ich glaube nicht, dass er bewusst erfand oder prahlen wollte. Neue Studien zeigen ja, wie wenig wir unserem Gedächtnis trauen können. Wenn ich Erinnerungen aus der Kinderzeit mit meinem inzwischen auch achtzigjährigen Freund Lud austausche, staunen wir beide, wie unterschiedlich sich Situationen und Personen bei uns eingeprägt haben. Wenn wir nicht von unserem flatterhaften, unzuverlässigen Gedächtnis wüssten, wären wir manchmal nahe dran, den anderen der Lüge zu bezichtigen.
Trotzdem scheint etwas an Franzens Behauptung dran zu sein. Er war nicht fähig, enge, dunkle Räume zu betreten. Wenn wir einen alten Munitionsstollen aus dem Zweiten Weltkrieg irgendwo im Wald entdeckten und drinnen nach Patronen fahndeten, wartete er geduldig draußen, bis wir mit unserer Beute wieder ans Tageslicht kamen. Die Patronen wurden dann zum Halsschmuck. Es war unter uns Pubertierenden Mode, die Gewehrpatrone mit einem dünnen Lederriemen zu umwickeln und sie als Talisman wie eine Halskette zu tragen. Unter dem Hemd natürlich. Sie wäre schnell weg gewesen, wenn ein Erwachsener sie entdeckt hätte.
Wenn die Wissenschaft von der infantilen Amnesie spricht, lässt sie diese meistens mit dem dritten Lebensjahr enden. Bei mir setzen die Erinnerungen um die Zeit ein, als ich ungefähr vier Jahre alt war.
Lange war ich versucht, mich als Spätentwickler zu sehen, nicht fähig, sich an den Dreijährigen zu erinnern. Dann las ich in Nabokovs »Sprich, Erinnerung, sprich«, dass auch seine früheste Erinnerung einsetzte, als er vier war. Umso präziser und minutiöser kann er dann die folgenden Kinderjahre beschreiben.
Schön wäre es, wenn sich Erinnerungen wie an einer Perlenschnur von der frühesten Kindheit bis in die Jetztzeit aneinanderreihen würden. Oder, um ein anderes Bild zu gebrauchen, wenn aus einem schmalen Bach, gespeist durch immer neue Lebensmomente, ein Fluss würde, der sich zuletzt als breiter Erinnerungsstrom ins Heute ergießt. So ist es aber nicht. Erinnerungen sind keine Tagebücher. Dem Vergleich mit einem Fluss halten sie nicht stand. Eher sind es verstreute große und kleine Pfützen nach einem Starkregen. Schafft man es, mit einem Stock eine Furche zu einer benachbarten Pfütze in die feuchte Erde zu ziehen, verbindet sich der Inhalt der einen mit der anderen zu einer starken Erinnerung. Die meisten Pfützen bleiben aber isoliert.
Es gelang mir am ehesten, diesen Pfützen auf den Grund zu gehen, wenn ich versuchte, mich an die Gerüche meiner Kindheit zu erinnern. Marcel Prousts Erinnerung an die Kindheit, ausgelöst durch den Geschmack einer in den Tee getauchten Madeleine, ist so bekannt, dass sogar in einer populären Fernseh-Quiz-Show der »Madeleine-Effekt« zu erraten war.
Ich versetzte mich nicht in die Vergangenheit, indem ich versuchte, bestimmte Gerüche herzustellen und mich an ihnen in die Kindheit zu hangeln, mir genügte die Erinnerung daran. Stellte ich mir etwa den Geruch des Montagmorgens vor, entstand vor mir das Bild der Gastwirtschaft meiner Großeltern.
Wenn ich am Montag auf dem Weg zur Schule durch die Gaststube ging, empfing mich der dumpfe Geruch kalten Rauchs und begleitete mich bis nach draußen.
Am Sonntagabend wurde an vielen Tischen gekartet, und die meisten der alten Männer rauchten dabei ihren Stumpen, eine vorne und hinten stumpf abgeschnittene Zigarre. Jüngere hätten wahrscheinlich Zigaretten geraucht, aber die jungen Männer waren alle Soldaten und im Krieg.
Kaum war abends der letzte Gast gegangen, sammelte meine Großmutter die Aschenbecher ein, ovale Schalen aus geriffeltem Glas, in die der Name des Sponsors eingraviert war: »Hiernickel-Bräu«. Obwohl sie die Aschenreste und Zigarrenkippen gleich im Abfalleimer entsorgte, und den Inhalt draußen im Hof in die Tonne kippte, ließ sich der Geruch nicht vertreiben. Er war schon von den Rauchern in deren Kleidern mitgebracht worden und hatte sich in den Vorhängen festgesetzt.
Der Zigarrengeruch hielt sich ein paar Tage. Spätestens am Mittwoch wurde er abgelöst vom Geruch des abgestandenen Biers, das sich unter dem ständig tropfenden Zapfhahn in der gelochten Auffangschale sammelte.
Im Frühsommer kam ein neuer, angenehmer Geruch dazu. Wenn die Großmutter morgens die Fenster der Wirtsstube aufriss, wehte ein süßlicher, fast schwülstiger Duft vom blühenden Akazienbaum neben der Kegelbahn herüber. Der üppige Nektar tropfte in solchen Mengen auf den Boden, dass man fast mit den Schuhsohlen daran festklebte, während über einem das Flügelschlagen Hunderter Bienen zu einem einzigen tiefen Summton verschmolz.
Fast noch stärker erinnere ich mich an unser Schulzimmer. Ein Gemisch aus dem stumpfen Geruch der Tafelkreide, dem schwachen Gummigeruch, den das kleine Schwämmchen ausströmte, das mit einer gedrehten Schnur an meiner Schiefertafel hing, und den Stallgeruch, der meine Sitznachbarn umfing, die vor Schulbeginn noch das Vieh füttern mussten. Zusammen mit der Erinnerung an die Gerüche kommt eine an die schabenden Geräusche, wenn die Erstklässler mit schwerer Hand Buchstaben in den schwarzen Schiefer ritzten.
Am stärksten allerdings werden meine Erinnerungen durch alte Fotografien heraufbeschworen.
Es gibt kaum Fotos aus meiner Kindheit. Vor achtzig Jahren besaß niemand in meiner Familie eine Kamera. Die erhaltenen Bilder stammen alle von reichen Verwandten oder von Freunden meines Vaters.
Beim Betrachten dieser Fotos versuche ich immer, und oft vergeblich, mich an die Situation zu erinnern, in der das Bild entstand.
Ein frühes Foto zeigt mich vor einer Kirche. Hinter mir geht mein Vater im dunklen Anzug, neben ihm weht der weiße Schleier seiner neuen Frau. Ich bin ungefähr drei Jahre alt, trage eine kurze Hose aus schwarzem Samt, die durch schmale Hosenträger so straff hochgezogen ist, dass unterhalb der Hosenbeine eine weiße Unterhose hervorblitzt. In der Hand trage ich ein Körbchen, prall gefüllt mit Blumenköpfen, die ich wohl vor dem Brautpaar auf den Weg streuen soll. Es sieht nicht so aus, als hätte ich Lust dazu. Mein Gesichtsausdruck ist desinteressiert, einfach nur gelangweilt.
Meine Tante, die Schwester meiner Stiefmutter, erzählte, ich hätte während der Trauung laut »Mama« durchs Kirchenschiff gerufen und damit meine neue Mutter gemeint. Ich habe nicht die geringste Erinnerung daran, nicht einmal an die Trauung selbst. Überhaupt finde ich es verwirrend, dass ich die neue Mutter schon als »Mama« bezeichnet haben soll. Ich kannte sie ja kaum. Meine echte Mutter war gestorben, als ich sieben Wochen alt war. Sie konnte ich nicht gemeint haben.
Ein anderes Foto zeigt mich zusammen mit Oma Rethel, der Mutter meines Vaters. Wir sitzen nebeneinander im Hof vor der Hauswand. Sie in einem Korbsessel, ich in einem fahrbaren Kinderstuhl mit Armlehnen und einem dazugehörigen Tischchen. Die Sonne scheint. Die kurzen Schatten verraten mir, dass das Foto um die Mittagszeit aufgenommen wurde. Ich habe lange, dunkelblonde, stark gewellte Haare wie ein Mädchen. Sämtliche Knöpfe meiner weißen Bluse sind zugeknöpft. Auch der oberste. Die breiten Hosenträger aus Stoff haben zwei Querteile. Wie eine Leiter, die nur aus zwei Sprossen besteht. Die Querverstrebungen spannen sich vor meiner Brust und ziehen die Hosenträger aus der Senkrechten. Am unteren Bildrand ist noch ein Zentimeter meiner Hose zu sehen. Sie ist genauso gemustert wie die Hosenträger: kleine, senkrecht stehende Rauten. Es ist ein Schwarzweißfoto. Die Hose könnte blau gewesen sein. Vielleicht hellblau.
Oma Rethel liest Zeitung. Sie hält sie ausgestreckt mit beiden Händen. Auf ihrer Nasenspitze hängt die Brille mit dicken runden Gläsern.
Auf dem kleinen Tisch vor mir sitzt ein einäugiger Plüschbär mit einem dunklen, runden Fleck, wo mal das zweite Auge war. Das Fell des Bären ist von der Sonne ausgebleicht. Am dunklen Fleck, der durch das Porzellanauge verdeckt war, kann man die ursprüngliche Fellfarbe erkennen. Daneben liegen in einer Holzschachtel Bauklötze, die auf jeder Seite mit einem Märchenmotiv beklebt sind. Vier mal drei Steine passen in den Holzkasten. Vier waagrechte und drei senkrechte Reihen. Es ist ein Puzzle. Man muss die Klötze so anordnen, dass eine vollständige Märchenszene entsteht. Auf den Bildern im Kastendeckel kann man sehen, wie das Bild auszusehen hat. Ist zum Beispiel das Bild endlich fertig, auf dem man sehen kann, wie der Prügel aus dem Sack den betrügerischen Wirt verhaut, kann ich ein neues Bild bauen. Dabei muss ich jeweils vier der Klötze einmal um die eigene Achse drehen. Ich fasse eine Viererreihe an beiden Enden und presse sie beim Drehen aneinander. Presst man nicht stark genug, prasseln die Bauklötze auseinander und über die noch nicht gedrehten Klötze in der Schachtel. Meist von einem Wutausbruch begleitet, der so heftig sein kann, dass die ungehorsamen Klötze auf dem Boden landen. Schaffe ich es, nacheinander alle drei Reihen zu drehen, werde ich mit einem neuen Märchenbild belohnt. Schneewittchen im gläsernen Sarg, umgeben von trauernden Zwergen.
Ich habe nicht die geringste Erinnerung an die mittägliche Szene vor der Hauswand, sehe aber einige der sechs Märchenmotive so genau vor mir, dass ich sie nachzeichnen könnte: Rotkäppchen mit dem Wolf, der wie ein harmloser Schäferhund aussieht. Oder das Aschenputtel vor dem Herd, umgeben von den Tauben beim gemeinsamen Linsensortieren. Die guten in den Topf, die schlechten in den Kropf. (Kropf aus dem germanischen Wort Kruppa: die Beule.) Oder man sah Dornröschen im Turmzimmer, unvorsichtig genug, sich an einer Spindel zu stechen. Sehr dramatisch das Bild, auf dem der Wolf in die Stube stürzt und die sieben Geißlein schutzsuchend durch den Raum rennen. Immerhin wird wenigstens eines entkommen. Das ist tröstlich. Es wird sich im Uhrkasten verstecken. Was ein Uhrkasten ist, wusste ich schon als Vierjähriger. Das war das Unterteil der mannshohen Standuhr in Oma Rethels Schlafzimmer.
Bei einigen Bauklötzen hatten sich die aufgeklebten Bilder durch das häufige Drehen und Werfen am Rand gelöst. Manchmal waren sie dadurch ein- oder abgerissen, und ein weißer dreieckiger Fleck hatte dem Wolf den Schwanz genommen oder einem Zwerg eine weiße Mütze beschert.
Mein bester Freund aus den Kindertagen in Obertheres war der Nachbarjunge Ludwig. Ich nannte ihn Lud. Er war damit einverstanden. Wenn ich schon unter all den Walter, Adolf, Wilhelm, Erwin und Heinrich im Dorf der Einzige mit einem nur einsilbigen Vornamen war, sollte mein Freund nicht bessergestellt sein.
Wir verbrachten fast all unsere freie Zeit miteinander. Das hinderte mich nicht daran, mich den andern Dorfkindern anzuschließen, die ihn im Chor als »Glatzenkönig, Glatzenkönig!« verhöhnten. Lud stand mit kahlgeschorenem Kopf unter dem gewölbten Steinbogen des Hoftors und wagte sich nicht hinaus. Zwar schrie ich nicht mit, kam ihm aber auch nicht zu Hilfe. Lud sah mit dem haarlosen Kopf wie ein fremdes Kind aus. Gar nicht mehr wie mein Freund.
Als schaulustiger Beobachter wurde ich in die anschließende Bestrafungsaktion mit einbezogen. Ich hatte nicht mitgesungen, hatte danach aber genauso viele rote Streifen auf der Wade wie die Spötter. Herr Viering, Luds Vater, hatte die Hohngesänge gehört. Wahrscheinlich fühlte er sich schuldig, denn er war es gewesen, der seinem Sohn den sommerlichen Kahlschnitt verpasst hatte. Er stürmte aus dem Stall, die lederne Pferdepeitsche in der Hand, und ließ die Peitschenschnur um unsere nackten Beine zwirbeln.
Auch Lud bekam zu Hause manchmal solche Hiebe zu spüren. Er sprach nicht gerne darüber. Wenn er geschlagen wurde, fühlte er sich schuldig und fand die Bestrafung angebracht. Einmal hatte er Steine auf einen vorbeifahrenden Güterzug geworfen, ein andermal hatte er trotz des Verbots wieder einen Pfennig auf die Schienen gelegt.
Das war eine Zeitlang die Lieblingsbeschäftigung unter uns Dorfkindern gewesen und hatte sogar zu einem Artikel im Haßfurter Tagblatt geführt mit der Überschrift »Die bösen Jungen aus Obertheres«.
Die Häuser im Unterdorf, auch das meiner Großeltern, standen aufgereiht an der Bundesstraße. Zu meiner Kinderzeit hieß sie Reichsstraße acht. Sie wurde auf der gegenüberliegenden Seite begrenzt von einer Heckenreihe. Unmittelbar dahinter verliefen die Eisenbahnschienen.
Irgendeiner von uns Jungen war auf die Idee gekommen, sich durch die Hecke zu zwängen und eine Pfennigmünze auf die Schiene zu legen, als sich ein Zug näherte. Danach hatte er stolz seine Trophäe herumgezeigt. Der Pfennig war durch das Gewicht der Lokomotive plattgewalzt und glich mit seinen unregelmäßig geformten Rändern einem kleinen, metallenen Pfannkuchen.
Das hatte sofort Nachahmer gefunden, und bald meldete ein Lokomotivführer dem Bahnhofsvorstand, Herrn Gerner, dass außerhalb des Dorfes immer eine Horde von Kindern auf dem Bahndamm nahe der Gleise lagerte und somit sich und den Bahnverkehr gefährde. So war es in dem Zeitungsartikel formuliert.
Wir lagen tatsächlich vor den Gleisen auf dem Bauch, wenn ein Zug dicht an uns vorbeifuhr. Denn wir alle hatten unsere Pfennige nebeneinander auf die Schiene gelegt, auch die bereits breitgewalzten, und mussten genau beobachten, wo unser Pfennig hinflog. Die meisten der Münzen wurden von der Schiene weg weit nach außen oder zwischen die Gleise geschleudert. Und es durfte keine Verwechslungen geben. Nicht dass etwa Norbert oder Erwin meinen Pfennig beanspruchten, der schon dreimal überwalzt worden und fast so breit war wie ein Kartoffelplätzchen in der Pfanne.
Herr Gerner war mit ernstem Gesicht von Familie zu Familie gegangen und hatte gedroht, die Eltern anzuzeigen, wenn sie in Zukunft nicht verhinderten, dass ihre Jungen das Pfennigspiel betrieben.
Auch bei Opa Schorsch war er erschienen. Ich hatte versprochen, den Bahnschienen fernzubleiben und hielt mich auch daran, wie die übrigen Jungen auch. Nur Lud wollte noch ein einziges Mal den Pfennig überfahren lassen.
Dabei hatte ihn sein Vater erwischt.
Einmal war ich sogar Zeuge von Luds Bestrafung. Er war damit beschäftigt, eines der Felder der Familie Viering zu eggen. Ich begleitete ihn und half mit. Lud führte das einzige Pferd der Vierings am Zügel, einen stämmigen Ackergaul namens Seppel. Das Pferd zog eine Egge hinter sich her, ein flaches Eisengitter, aus dem unten spitze Zinken ragten. Sie zerkleinerten grobe Erdklumpen und bereiteten so den Boden für die Aussaat vor. Der Acker war quadratisch, und Lud hatte von seinem Vater den Auftrag bekommen, das kahle, schon umgepflügte Feld in zwei Richtungen zu eggen, einmal längs, einmal quer. Ich ging hinter dem Gaul neben der Egge her und hatte die Aufgabe, die Egge an einem seitlich angebrachten dicken Strick anzuheben, wenn sie auf einen Stein stieß und hängen blieb.
Nach einer Weile fand ich es an der Zeit, auch mal den Gaul zu führen. Lud sollte die Egge anheben. Wir tauschten. Als ich das Pferd vom Rand des Ackers bis zu dessen Ende geführt und sogar geschafft hatte, es zu wenden und zurückzuführen zum Ausgangspunkt, schickte mich Lud wieder zu meinem Platz an der Egge. Ich hatte das Pferd nicht energisch genug geführt und war zu weit nach außen gekommen. Mit dem Ergebnis, dass nun zwischen zwei Streifen glatten Bodens ein schmaler Steg voller Erdklumpen zu sehen war, den Lud noch mal nachbearbeiten musste.
Nachdem der Acker vollständig der Länge nach geeggt war, machten wir Pause, spannten Seppel aus, nahmen ihm das Halsjoch ab, und setzen uns auf den grasbewachsenen Wegrain. Dort erzählte ich Lud eine Geschichte aus meinem Indianerbuch, während das Pferd friedlich neben uns graste.
Danach waren wir beide der Meinung, dass der Acker schon so schön glatt sei, dass wir uns das Eggen in der Querrichtung sparen könnten.
Als Luds Vater dazukam, sah er es sofort an der Spur, und fragte: »Hast du in beide Richtungen geeggt, wie ich dir gesagt habe?«
»Ja, habe ich.«
»Er lügt den eigenen Vater an!«, rief Herr Viering und gab Lud eine Ohrfeige.
Ich war erschrocken und gleichzeitig empört. Es war das erste Mal, dass ich Zeuge körperlicher Gewalt wurde.
»Du gehst jetzt heim!«, befahl mir Herr Viering, und zu Lud sagte er: »Spann sofort den Seppel wieder an! Jetzt soll ich auch noch eggen. Als ob ich nichts anderes zu tun hätte. Wozu hab ich eigentlich einen Sohn?«
Im Weggehen sah ich noch, wie Herr Viering das Pferd führte und Lud neben der Egge herging. Als sein Vater in die andere Richtung blickte, winkte mir Lud schnell zu.
Ich fragte meine Mutter, weshalb manche Väter ihre Kinder schlagen. Wie zum Beispiel Herr Viering meinen Freund Lud. Herr Viering habe ihn ins Gesicht gehauen.
»Du meinst, er hat ihm eine Ohrfeige gegeben?«, fragte sie.
»Ohrfeige?« Das Wort kannte ich nicht.
»Wenn man jemandem mit der Hand auf die Backe schlägt«, übersetzte sie mir.
»Ja, das hat er«, bestätigte ich. »Warum darf er das?«
»Er kennt es nicht anders, weil er selber geschlagen wurde«, sagte sie. »In der Bibel steht ja auch, dass man seinen Sohn strafen soll.«
Dabei bezog sie sich auf eine Predigt unseres Pfarrers. Einige ältere Jungen hatten während der Messe laut gesprochen, sogar während der Wandlung, bei der doch andächtige Stille herrschen sollte.
Die These des Herrn Pfarrers war, die heutigen Jungen und Jugendlichen seien viel frecher und ungebärdiger als früher. Schuld daran sei, dass die Väter alle im Krieg seien und die Jungen nun in der Obhut der viel zu nachgiebigen Mütter. Diesen Müttern wolle er den Inhalt des Hebräerbriefs dringend ans Herz legen: Wer sein Kind liebt, der züchtigt es.
»Was ist züchtigen?«, wollte ich wissen.
»Nun, schlagen eben«, sagte sie.
Ich fragte, ob dies auch umgekehrt gelte? Wer seinen Sohn züchtigt, der liebt ihn? Liebt Herr Viering seinen Sohn? Sie lachte und nannte mich spitzfindig.
Herr Viering starb dann an Magenkrebs. In der Gastwirtschaft meines Großvaters waren sich die Stammgäste einig: Der Krebs kam daher, weil der Viering sein Bier immer eiskalt getrunken hatte. Auch im Winter. Direkt aus dem Eisschrank. Damals sagte man noch nicht Kühlschrank. Es war ja auch wirklich ein Eisschrank. Alle zwei Wochen hielt der Lastwagen mit der seitlichen Aufschrift »Hiernickel-Bräu« vor unserer Wirtschaft. Der Fahrer trug eine Eisstange ins Haus. Sie lag auf seiner linken Schulter, war einen Meter lang, viereckig, und hatte etwa den Durchmesser von Opas Zigarrenkiste. Er trug dicke Handschuhe und hatte als Schutz vor der Eiseskälte ein Lederteil über die Schulter geschnallt, auf der die Eisstange ruhte. Es erinnerte mich an einen Pferdesattel und war mit einem Riemen unter der Achsel und einem zweiten quer über seine Brust vor dem Verrutschen gesichert. Die Eisstange wurde im Keller gelagert.
Einmal hörte ich aus dem Nebenzimmer, wie Alfred, der Bierfahrer, sich bei Oma Kuni über seine Aufgabe beklagte und von seinem Rheumatismus in der linken Schulter sprach. Er nannte es »Reißmatismus«. Das weckte Oma Kunis Mitgefühl und bewirkte eine Steigerung des Trinkgelds.
Opa Schorsch ging jeden Tag in den Keller, schlug mit dem Hammer kleine Stücke vom Eisblock ab, sammelte sie in einem Eimer und leerte ihn einen Stock höher im Eisschrank der Gaststube über dem hölzernen Bierfass aus. So blieb das Bier auch im Sommer frisch.
Dabei verabscheuten die meisten Gäste das kalte Bier und verlangten nach einem Bierwärmer. Oma Kuni füllte dann heißes Wasser in ein dünnes, metallenes Rohr mit Schraubverschluss, dem Bierwärmer, und hängte ihn an einem unten offenen, gebogenen Henkel ins Bierglas.
Besonders die alten Gäste verzichteten nicht auf ihr angewärmtes Bier. Wobei man im Dorf schon als alt galt, wenn man die sechzig überschritten hatte. Mit fünfundsiebzig war man uralt. Dann war es an der Zeit zu gehen. Die meisten hielten sich daran. Nicht so der alte Meidler. Der wurde älter und älter, ohne ans Sterben zu denken. Er saß immer allein an einem der Ecktische. Er hatte im Zuchthaus gesessen und war knapp an der Todesstrafe vorbeigeschrammt, erzählte man mir.
Viel später, als Kunststudent, besuchte ich von Stuttgart aus manchmal meine alt gewordenen Großeltern. Sie betrieben immer noch die Wirtschaft, und Herr Meidler saß immer noch am Ecktisch. Jedes Mal nahm ich mir vor, ihn beim nächsten Mal mit Tonbandgerät und Mikrophon nach seinen Erlebnissen in China zu befragen.
Als ich endlich daran dachte und ein Gerät nach Obertheres mitbrachte, war der Platz am Ecktisch leer. Herr Meidler war im Alter von hundert Jahren gestorben.
Opa Schorsch erzählte mir Meidlers Geschichte. Als junger Mann, der nie aus seinem Heimatdorf hinausgekommen war, wurde der Soldat Meidler dem Ostasiatischen Infanterieregiment zugeordnet und per Schiff nach China verfrachtet. Dort sollte er den Boxerkrieg im Sinne seines Kaisers gewinnen helfen. In Meidlers Wortwahl hatte er den Boxeraufstand niedergeschlagen. Nach seiner Entlassung und Rückkehr erzählte er in der Gaststube gern davon, wie sie den Auftrag Kaiser Wilhelms II. bei der Einschiffung des Regiments in Bremerhaven treulich umgesetzt hatten. In seiner berühmten Hunnenrede hatte der Kaiser von den Soldaten gefordert, kein Pardon zu geben und keine Gefangenen zu machen. Daran, erzählte Meidler, habe man sich gehalten, erst den gefangenen Boxern die langen Zöpfe abgeschnitten und dann den Kopf abgehauen. Danach, erzählte er lachend, seien sie zopf- und kopflos gewesen. Dieses Wortspiel gefiel ihm so gut, dass er es in keiner China-Erzählung fehlen ließ.
Wenn er betrunken war und mit schwerer Stimme von seinen Taten prahlte, rückten selbst hartgesottene Patrioten und Kaiseranhänger von ihm ab und ließen ihn alleine am Tisch zurück, wo er von der Plünderung Pekings brabbelte und wie sie jeden niedergestochen hatten, der sich wehrte. Auch die Frauen. Oma Kuni warf ihn einmal sogar aus dem Lokal, weil sie seine abscheulichen Zoten nicht mehr aushielt. Sie nahm in Kauf, dass er schimpfend verschwand, ohne sein Bier zu bezahlen.
Zur Katastrophe kam es, als er an der Straße zwischen Ober- und Untertheres eine junge Frau mit vielen Messerstichen umbrachte.
Opa Schorsch kaufte manchmal bei seinem Bruder Valtin in Untertheres einige ausgezogene Krapfen. Er nahm das als Vorwand, um Erbschaftsangelegenheiten zu besprechen. Valtin war Besitzer einer Bäckerei. Ich durfte Großvater oft nach Untertheres begleiten. Auf halber Strecke kommt man an einer Stelle vorbei, wo zwei alte, hohe Bäume links und rechts die Straße begrenzen. Meistens blieb Großvater neben einem der Bäume stehen, bekreuzigte sich, und sagte: Das ist die Stelle, wo der Meidler die arme junge Frau erstochen hat. Da im Straßengraben hat man sie gefunden.
»Warum hat er das gemacht?«, fragte ich.
Bei der Gerichtsverhandlung hat er ausgesagt, er sei in einen Blutrausch geraten, als er der Frau von seinen chinesischen Abenteuern erzählt habe.
»Blutrausch?«, fragte ich.
So hat er es genannt. Das hat ihm die Todesstrafe erspart. Weil er für das Vaterland in China so viele Boxer umbringen musste, dass er das Töten gelernt hat, erklärte mir Großvater.
Meine Mutter starb an den Spätfolgen meiner Geburt, als ich sieben Wochen alt war. Das Stillen hatte ihr starke Schmerzen bereitet. Mein Vater holte den Hausarzt. Der untersuchte die Kranke flüchtig und sagte, sie solle nicht so zimperlich sein. Die Frauen heutzutage seien alle verzärtelt und verweichlicht. Früher hätten die Mütter klaglos durchgehalten und ihr Kind gestillt, auch wenn es ein wenig weh tat und hätten nicht gleich den Arzt kommen lassen. Damit ging er. Zwei Tage später starb sie an der Brustentzündung.
Am Tag nach der Beerdigung seiner Frau lehnte mein Vater am unteren Ende der Bergstraße an einer Gartenmauer. Gegenüber stand das Privathaus des Arztes, der meine Mutter zimperlich genannt hatte. Es war ein kalter Februarmorgen, mein Vater trug einen Wintermantel. In der Manteltasche steckte der Revolver, mit dem er den Arzt erschießen würde, sobald der aus dem Haus trat. Den Revolver hatte ihm jemand besorgt, dessen Namen mein Vater auch später nicht verraten wollte, als er die Geschichte erzählte. Es war ein Turnbruder aus der Turngemeinde Schweinfurt.
Mein Vater war ein begeisterter Turner gewesen, und für viele ein Star. Die Trophäen, die er bei Wettkämpfen gewonnen hatte, meist hohe Kelche aus Metall und kleine Trinkbecher mit eingeprägten Wappen, standen noch in der Wohnzimmervitrine hinter Glas, als ich Nele, meine zukünftige Frau, den Eltern vorstellte. Mein Vater vergaß nicht, Nele vor die Vitrine zu führen und auf die Schaustücke hinzuweisen.
In einem alten Fotoalbum gibt es ein Bild, das ihn mit drei anderen Turnern bei der Darstellung einer lebendigen Statue zeigt. Das Ereignis fand bei einem Jubiläum der Turngemeinde statt. Die jungen Männer sind bis auf einen kleinen Lendenschurz nackt und vollständig mit Silberbronze bemalt. Selbst der Lendenschurz schimmert metallisch. Die vier haben theatralische Posen angenommen. Drei der Standbilder knien links von meinem Vater. Er steht am rechten Rand und reckt triumphierend eine große silberne Kugel in die Höhe.
Man musste die Silberbronze gleich nach dem Posieren und Fotografieren wieder entfernen, sonst hätte die Haut nicht atmen können und die vier antiken Helden wären erstickt.
Vielleicht war es einer der drei, der ihm Revolver und Munition besorgt hatte.
Lange stand mein Vater vor dem Arzthaus und wartete. Wie er wusste, pflegte der Doktor gegen acht Uhr das Privathaus zu verlassen, um seine Praxis in der Altstadt aufzusuchen.
An diesem Morgen kam er nicht. So beschloss mein Vater, zu klingeln und ihn im Haus zu erschießen. Eigentlich hatte er der Frau des Arztes den Anblick ersparen wollen. Die Gartenpforte war abgeschlossen. Eine Frau im Nachbarhaus sah ihn an der Pforte rütteln und rief ihm aus dem Fenster zu, dass der Arzt mit seiner Frau in den Skiurlaub gefahren sei. Glück für den Arzt. Aber auch für meinen Vater und für mich. Hätte er nicht unverrichteter Dinge nach Hause gehen müssen, wäre ich nicht nur mutterlos, sondern wahrscheinlich auch ohne Vater aufgewachsen.
Einige Tage später kam mein Vater wohl schon besser mit Wut und Zorn zurecht. Gegen Mitternacht ging er auf die Ludwigsbrücke, bis zur Mitte. Als er sich vergewissert hatte, dass ihn niemand beobachtete, warf er den Revolver über die Brüstung. Ins tiefe Wasser des Mains, wie er annahm. In der kalten Februarnacht hatten sich aber die treibenden Eisschollen vor einem Wehr gestaut und zu einer Eisdecke verfestigt. So landete der Revolver nicht mit einem lauten Klatschen im Fluss, sondern blieb mit einem dumpfen Aufschlag auf der Eisdecke liegen.
Mein Vater ging in den nächsten Tagen immer wieder auf die Brücke, um sich zu vergewissern, dass die Waffe noch dalag: von hoch oben aus ein unscheinbarer dunkler Fleck inmitten aller Steine und Zweige, die Kinder inzwischen aufs Eis geworfen hatten, um die Festigkeit der Eisdecke zu prüfen. Da lag er, bis es wärmer wurde und er im Wasser versank. Vielleicht ruht er noch auf dem Grund des Mains.
Die ersten Jahre nach dem Tod meiner Mutter sind für mich ein schwarzes Loch. Irgendwer muss mich versorgt, mich gewickelt und mir das Fläschchen gegeben haben. Ich weiß nicht wer, und es lebt auch niemand mehr, den ich danach fragen könnte. Wäre das Verhältnis zu meinem Vater besser gewesen, hätte ich mich wahrscheinlich bei ihm danach erkundigt.
Es gibt ein paar Anhaltspunkte, winzige Inseln im schwarzen Meer. Mein Vater erzählte in Gesellschaft oft voll Stolz, wie er seinem Baby den Arzt ersparte. Ich litt länger als ein Jahr an einer Furunkulose. Am Nacken und am Rücken hatten sich eitergefüllte Beulen gebildet. Von der »verseuchten Milch«, die ich getrunken hatte, wie es mein Vater ausdrückte.
Er glühte sein Taschenmesser in einer Gasflamme aus, um es steril zu machen, legte mich auf den Bauch, schnitt die Furunkel auf, drückte den Inhalt aus und desinfizierte die Wunde mit hochprozentigem Zwetschgenschnaps.
Ein weiteres Anhaltsstück ist das Foto, auf dem man mich als Drei- oder Vierjährigen neben meiner Oma Rethel vor unserem Haus in der Schützenstraße sitzen sieht. Sie muss aus ihrer Wohnung in der Hadergasse zum Haus meines Vaters umgesiedelt sein. Sie könnte es gewesen sein, die sich um mich gekümmert hat.
Dann gibt es die Geschichten von den unzuverlässigen Hausmädchen. Auch die waren wohl angestellt worden, um mich zu versorgen.
Das eine Hausmädchen hatte im Kleiderschrank spioniert und die Kleider meiner verstorbenen Mutter entdeckt. Dem Anblick eines besonders schönen Kostüms konnte sie nicht widerstehen, hatte es angezogen und war gerade dabei, sich im Frisierspiegel zu bewundern, als mein Vater überraschend nach Hause kam und sie dabei ertappte.
Zuerst gab er ihr zwei Ohrfeigen, eine links, eine rechts. In seiner Sprache: »Ich hab ihr zwei mordstrumm Schelln verpasst«. So erzählte er es später Opa Benker, dem Vater meiner leiblichen Mutter. Dann musste sie das Kostüm ausziehen und er habe sie im Unterrock »nausgeschmissen«.
Auch ein zweites Hausmädchen bekam seine Hand zu spüren, bevor er auch sie hinausschmiss, weil sie gestohlen hatte. Sie war mit zwanzig Mark in die Apotheke geschickt worden, um ein Medikament zu kaufen, kam weinend wieder und behauptete, sie habe den Zwanzigmarkschein auf dem Hinweg verloren. Das war aber nicht sehr logisch, denn sie hatte das Medikament in der Tasche und musste es folglich gekauft haben.
Von meinem Vater kannte ich nur Geschichten von betrügerischen oder unverschämten Hausmädchen und deren Bestrafung. Bestimmt gab es dazwischen auch andere, die sich nichts zuschulden kommen ließen und in den Berichten meines Vaters ausgespart wurden.
Alles wurde anders für mich, als mein Vater ein zweites Mal heiratete und ich eine neue Mutter bekam. Da ich keine Erinnerung an meine leibliche Mutter habe, und meine neue selbst in meinen frühesten Erinnerungen schon bei mir war, habe ich sie immer als meine Mutter angesehen und geliebt. Ein Foto meiner leiblichen Mutter hing lange gerahmt an der Wohnzimmerwand. Wenn ich fragte, wer die Frau auf dem Bild sei, sagte man mir nie: »deine Mutter«. Die freundlich blickende Frau war die »Himmelmama«.
Die Geschichte, wie mein Vater die neue Frau kennenlernte und für sich gewann, kann ich nur aus unterschiedlichen Quellen rekonstruieren.
Der beste Freund meines Vaters war Hannes, der Ziehharmonikaspieler. Die beiden pflegten zusammen zu trinken und zu singen. Mit meiner Mutter, deren schöne Stimme von ihrer Mutter, Oma Lina, oft hervorgehoben wurde, hatten sie ein Gesangstrio gebildet.
Hannes war es, der meinen Vater auf eine hübsche Gastwirtstochter in Obertheres aufmerksam machte. Der kleine Paul müsse doch endlich eine Mutter bekommen, es sei quasi die Pflicht meines Vaters, die Verstorbene ruhen zu lassen und in die Zukunft zu schauen.
Die beiden fuhren mit dem Auto meines Vaters, einem PKW der Marke Horch, nach Obertheres, nahmen Platz im Gasthaus Mattenheimer, ließen sich von der Wirtstochter ein Bier bringen und verwickelten sie in ein Gespräch. Sie hieß Johanna, war wirklich sehr hübsch, Hannes hatte nicht übertrieben, und sie sah trotz ihrer zwanzig Jahre wie eine Sechzehnjährige aus. Hannes hatte seine Handharmonika dabei, und mein Vater und er beeindruckten nicht ohne Hintersinn die Wirtshausgäste mit Musik und Gesang. Beim Lied »Muss i denn zum Städtele hinaus« habe mein Vater bei der Textzeile »Wenn i komm, kehr ich ein mein Schatz bei dir« der Wirtstochter in die Augen geblickt und sie habe ihm zum ersten Mal zugelächelt.
Elvis Presley hat später genau dieses Lied auf Deutsch gesungen und auf Schallplatte veröffentlicht.
Beim nächsten Mal brachte mein Vater mich, den Zweijährigen, mit und erzählte von seinem Dasein als Witwer. Meine Mutter – und ich werde sie ab jetzt immer so bezeichnen – behauptete später, bevor sie sich in meinen Vater verliebt habe, sei sie schon in mich, den zweijährigen Lockenkopf, verliebt gewesen.
Die Hochzeit fand dann in der Marienkapelle in Obertheres statt.
Samstags holt Opa Schorsch eine große Zinkwanne aus der Waschküche und schleppt sie in die Küche. Es gibt kein fließendes Wasser im Dorf. Alle müssen es aus dem Dorfbrunnen hochpumpen. Wir haben aber das Glück, unter dem Haus einen eigenen Brunnen zu besitzen. In einer Nische im Hausflur gibt es eine Schwengelpumpe mit einem armlangen hölzernen Schwengel. Den schwenkt man vor und zurück. Dadurch wird Wasser aus dem unterirdischen Brunnen angesaugt und fließt in einen Eimer. Dreimal füllt Opa Schorsch den Eimer, trägt ihn in die Küche, und leert das kalte Wasser in die Wanne.
Gleichzeitig wird im Wasserschiff des Herdes, einem länglichen, seitlich im Herd eingelassenen Metallkasten, Wasser heiß gemacht und ebenfalls in die Wanne gekippt. Jetzt kann man baden. Zuerst darf ich hinein. Ich bin noch klein und mache am wenigsten Dreck, wie Oma es ausdrückt. Dann werden die Fenster verhängt und ich werde weggeschickt. Nun baden Oma und Opa. Wer nach mir zuerst ins warme Wasser darf, weiß ich nicht. Ich muss ja draußen bleiben und darf nicht gucken.
Mein Vater hatte sich eigentlich ein Mädchen gewünscht und musste 18 Jahre warten, bis ihm mit meiner Halbschwester Barbara dieser Wunsch erfüllt wurde.