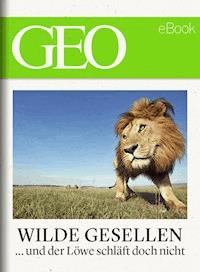
Wilde Gesellen: 13 Expeditionen in die Welt der Tiere (GEO eBook) E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gruner + Jahr
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Tiere in freier Wildbahn: Sie bezaubern uns, weil sie uns so rätselhaft vorkommen. Sie machen einfach ihr Ding. Und was das genau bedeutet - das ist für uns Menschen oft nur schwer herauszufinden. GEO-Reporter haben sich angepirscht - eine Auswahl ihrer besten Tierreportagen sind in diesem eBook als pure Lesestücke versammelt: Journalisten beobachten dabei die Seifenoper im Hyänen-Rudel, überwinden ihre Angst vor den unfassbar giftigen Schlangen Australiens und erforschen in ganz Europa, wie die wilden Tiere längst verlorenes Terrain zurückerobern - ganz in unserer Nähe. Kapitel Hyänen: Die unterschätzten Räuber Löwen: Das Herrscherkollektiv Tiger: Tod im Wald Nashörner: Hornkrieg im Süden Afrikas Schlangen: Der Marathon des Giftforschers Seekühe: Bedrohte Grazien Amphibien: Auf dem Sprung ins Nirgendwo Nautilus: Jagd auf einen Sonderling Natur in Europa: Wieviel Wildheit wollen wir? Zoonosen: Angriff aus dem Tierreich Wildtier-Handel 1: Der Ausverkauf der Schöpfung Wildtier-Handel 2: Wo beginnt unsere Mitschuld? Tierpräparatoren: Kunst am Kadaver
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Wilde Gesellen
13 GEO-Expeditionenin die Welt der Tiere
Herausgeber:GEODie Welt mit anderen Augen sehenGruner + Jahr AG & Co KG, Druck- und VerlagshausAm Baumwall 11, 20459 Hamburgwww.geo.de/ebooksTitelbild: Anup Shah
Liebe Leserin, lieber Leser,
wo Tiere eine Funktion in unserer Nahrungskette sind, malen wir sie uns im lebendigen Zustand meist nicht sonderlich aus. Warum aber verzückt uns ein kleiner Eisbär, warum beeindruckt uns zuverlässig jede Raubkatze? Über die psycho-emotionalen Grundlagen der fast universalen menschlichen Leidenschaft für Tiere lässt sich lange spekulieren. Ist es die Sehnsucht des domestizierten, urbanen Menschen nach der freien Kreatur, nach dem unbeherrschbaren, wilden Leben, in dem es kein Gut und kein Böse gibt, keine Moral? Oder frappiert uns, dass Tiere eine geheimnisvolle Intelligenz aufzuweisen scheinen? Dass sie in der Überzahl sind auf unserem Planeten? Dass sie weiter springen, tiefer tauchen, höher wachsen und länger leben können als wir?
Die 13 Reportagen, die wir in diesem eBook zusammengefasst haben, handeln von wilden Tieren. Aber es geht dabei nicht bloß um Fakten zu Population und Kopulation. Unsere Reporter sind auf die großen Fragen gestoßen: Wie entsteht Intelligenz? (Am Beispiel der überraschend schlauen Hyänen.) Oder: Wie können sich Raubtiere und Menschen einen Lebensraum teilen? (Am Beispiel der Tiger in den Sümpfen der Sundarbans.) Oder: Was sind die Kräfte hinter dem Werden und Vergehen ganzer Arten oder Gattungen? (Am Beispiel jenes Killer-Pilzes, der die Gesamtheit der Frösche und Lurche bedroht.)
Und nicht nur aufs einzelne Tier-Beispiel haben unsere Autorinnen und Autoren geschaut – auch der übergeordneten Frage nach unserem Verhältnis zu unseren Mitgeschöpfen gehen einige der Texte nach: Wie Menschen wilde Tiere zur Handelsware machen, berichtet Reporterin Anke Sparmann. Wie Tiere uns Menschen krank machen können, erklärt Andreas Weber. Und von einer ganz besonderen Mensch-Tier-Beziehung (und der dazugehörigen Europameisterschaft) berichtet der Autor Andreas Wenderoth in seinem Text aus der Welt der Tierpräparatoren.
Herzlich IhrPeter-Matthias GaedeChefredakteur GEO
Inhalt
Hyänen
Die unterschätzten Räuber
Von Carsten Jasner
Löwen
Das Herrscherkollektiv
Von Uta Henschel
Tiger
Tod im Wald
Von Florian Hanig
Rhinozeros
Der Hornkrieg im Süden Afrikas
Von Richard Conniff
Schlangen
Der Marathon des Giftforschers
Von Hania Luczak
Florida-Seekühe
Bedrohte Grazien
Von Anke Sparmann
Amphibien
Auf dem Sprung ins Nirgendwo
Von Markus Wolff
Nautilus
Jagd auf einen Sonderling
Von Jörn Auf dem Kampe
Tiermigration
Wildes Europa?
Von Anke Sparmann
Zoonosen
Angriff aus dem Tierreich
Von Andreas Weber
Wildtierhandel I
Der Ausverkauf der Schöpfung
Von Anke Sparmann
Wildtierhandel II
Wo beginnt unsere Mitschuld?
Von Anke Sparmann
Tierpräparatoren
Kunst am Kadaver
Von Andreas Wenderoth
Zum Weiterlesen:
GEO-eBooks
Hyänen
Die unterschätzten Räuber
Dumm sind sie, niederträchtig, hässlich. So denkt die Welt über Tüpfelhyänen. Nur eine Frau sieht das anders. Die amerikanische Forscherin Kay Holekamp hat den afrikanischen Raubtieren ein halbes Leben gewidmet. Und vor allem der Frage: Kann es sein, dass die „Katzenartigen“ so schlau sind wie sogar manche Affen? Ihr Gemeinwesen zumindest ist ebenso komplex
Von Carsten Jasner
„Dominiert Reagan über Obama?“
„Keine Ahnung.“
„Reagan ist verschwunden, vermutlich wurde er getötet.“
„Welches Geschlecht hat Obama eigentlich?“
„Sie ist weiblich.“
Es scheint, als hätte sich in Ostafrika die geballte Prominenz der abendländischen Geschichte versammelt, lauscht man dem Dialog der beiden Studenten, die unter einer Zeltplane im Wildreservat Maasai Mara sitzen, nördlich der Serengeti. Die Äquatorsonne steigt über das Wäldchen am Talekfluss, in dessen Schatten es noch dunkel um Küchen-, Lager- und Wohnzelte ist. Auf einer Fläche von 1500 Quadratkilometern, so hört es sich an, tummeln sich Präsidenten, Entdecker, Rockstars, Modeschöpfer, Indianer und griechische Götter. Es kommt vor, dass die erhabene Göttin Artemis Jimi Hendrix attackiert oder Wellington mit Gucci anbändelt. Dass eine Squaw namens Navajo Jimmy Carter liebkost, während Joan Baez mit Vasco da Gama um ein Frühstück streitet.
Die Träger dieser klangvollen Namen sind sämtlich Tüpfelhyänen, deren Fotos die Studenten gerade beschriften und in Klarsichthüllen sortieren.
Dass die Tiere nicht Peter oder 3117 getauft worden sind, hat praktische Gründe: Immerhin sechs Hyänen-Großclans mit jeweils rund 50 Tieren behalten die Verhaltensforscher hier seit Jahren im Auge. Da ist es hilfreich, die Tiere nach Themen zu benennen, die ihren Verwandtschaftsgrad erkennen lassen.
Jimi Hendrix, Joan Baez und Johnny Cash sind ebenso Halbgeschwister wie Reagan, Obama, Roosevelt und Clinton, deren 17 Jahre alte Mutter Navajo einer Generation von Indianerstämmen angehört. Die Clan-Chefin Murphy, wie ihre Geschwister nach einem amerikanischen Komiker benannt, hat unter anderem Pan, Artemis und Morpheus in die Steppe gesetzt, während Gucci eine Sippe italienischer Traditionsgerichte hervorgebracht hat, darunter Tortellini, Ravioli und Gelato.
Tüpfelhyänen gehören in der Regel nicht zu den Tieren, denen Menschen Namen geben. Das hat mit mangelnder Sympathie zu tun. Es gibt kaum eine Spezies, der vom Volksglauben, aber auch von Experten so viel Unschönes nachgesagt wird. Von Aristoteles bis Alfred Brehm waren sich alle einig: Hyänen sind feige, bösartig, hässlich und dumm.
Um solche Urteile zu widerlegen, zumindest zu überprüfen, braucht es Wissenschaftler, die sich auch als Anwälte verstehen. Die nicht nur genau hinsehen und Beweise sammeln, sondern Leidenschaft entwickeln für ihre Studienobjekte. Die ihnen Namen geben. Und die vielleicht sogar mutig genug sind, eine Gegenthese aufzustellen: Was wäre, wenn Hyänen nicht nur gar nicht so dumm, sondern genauso intelligent sind wie Primaten? Und wenn sich an diesen oft geschmähten Räubern am Ende sogar die Wurzel auch unserer eigenen, der menschlichen Denkfähigkeit erklären ließe?
Oberhalb einer Sandbank, auf der sich ein Krokodil am Talekfluss sonnt, steht das Zelt der Frau, die mit solchen Fragestellungen die Fachwelt verwundert hat: Kay Holekamp, 57 Jahre alt, Professorin für Zoologie an der Michigan State University. Sie ist eine freundliche, etwas schüchterne Frau mit rotblonden Haaren; wenn sie durchs Camp läuft, streift ihr Blick meist gedankenverloren über den Boden.
Den Eingang zu ihrem Zelt ziert ein Schädel, dem man auf Anhieb ansieht, weshalb Hyänen imstande sind, den Oberschenkel einer Giraffe wie mit einer Brechschere zerbersten zu lassen. Ihr monströses Gebiss mit seinen haiartigen Reiß- und drei Zentimeter langen Eckzähnen kann eine Kraft von bis zu 9000 Newton entwickeln – achtmal so viel wie zwei menschliche Kiefer.
Doch Holekamp beschäftigt vor allem, was sich im Inneren eines solchen Schädels abspielt. Gleich hinter dem Stirnknochen, erklärt sie, liege ein Bereich, der bei Tüpfelhyänen wie auch bei Menschen auffallend stark entwickelt sei. Bei Menschen wird diese Region, der „frontale Kortex“, immer dann aktiv, wenn sie entscheiden müssen, wen sie beschützen, mit wem sie gut Freund sein und mit wem sie lieber nichts zu tun haben wollen. Bei diesen Hyänen sei es ähnlich, sagt Holekamp, weshalb dieser Bereich ebenso stark beansprucht werde.
Denn in den Clans der Tiere herrscht eine strikt vertikale Ordnung, in der die Weibchen den Ton angeben und sich die Rangfolge der Macht mit jedem neuen Jungtier verändert. Das mache die Gesellschaft der Tüpfelhyänen so komplex, „wie man es sonst von uns Menschenaffen kennt“, ist Holekamps Überzeugung.
Eine wunderlich anmutende These. Denn der letzte gemeinsame Vorfahre von Menschen und Hyänen lebte vor 90 bis 100 Millionen Jahren. Es gibt also, rein genetisch, nicht viel, was uns und andere gewitzte Affen mit den Raubtieren aus der Familie der Katzenartigen verbindet. Umso unerhörter klingt Holekamps Idee: Wenn Menschenaffen und Tüpfelhyänen sich von anderen Tieren durch die Komplexität ihre Gesellschaftsstrukturen unterscheiden – dann könnten sie, trotz der Trennung ihrer Entwicklungsgeschichten, in Jahrmillionen auch noch mehr einzigartige Gemeinsamkeiten ausgebildet haben. Höhere Intelligenz, zum Beispiel.
Es ist noch stockdunkel, als Holekamp und die 26-jährige Doktorandin Leslie Curren Videokamera, Ferngläser, Taschenlampen und GPS-Gerät im Geländewagen verstauen. Um halb sechs an diesem Tag fahren sie aus dem Schutz des Wäldchens aufs offene Feld. Sterne übersäen den Himmel wie Kristallzucker, bis eine schwarze Wolke sich vor sie schiebt; bald schlagen erste Tropfen gegen die Frontscheibe.
Unter ihrem Kopfhörer horcht Leslie Curren nach den Signalen von Hyänen, die Sendehalsbänder tragen. Es riecht nach feuchtem Gras. Mit Suchscheinwerfern tasten die Frauen den Boden nach morastigen Stellen ab: Dort finden die Hyänen oft Warzenschweine, die zu ihren Beutetieren gehören.
Im Scheinwerferlicht taucht schließlich ein Trupp ruhender Antilopen auf, Impalas, die Leibspeise der Hyänen. Sie rappeln sich auf und staksen beiseite, als Leslie Curren ein lauter werdendes Klacken hört. Sie gibt Kay Holekamp ein Zeichen, die daraufhin das Lenkrad einschlägt und mit zusammengekniffenen Augen die gelben Lichtkegel verfolgt, die im 100-Meter-Radius über Gras, Büsche und einzelne Bäume huschen. Vier, fünf Hyänen sind plötzlich zu sehen. Gazellen stieben vor ihnen davon. Holekamp durchquert einen Graben, treibt den Wagen noch einige Meter durchs Gelände und stellt dann den Motor ab. Unter einer Schirmakazie, keine 50 Schritt vom Auto entfernt, liegt der Bau der Hyänen.
Für Ungeübte sind die Tiere, zumal im allerersten Morgenlicht, kaum voneinander zu unterscheiden. Kay Holekamp aber erkennt die meisten ihrer etwa 300 Probanden an der Anordnung ihrer Tüpfel, an einer besonderen Orange-Nuance ihrer Nackenhaare oder an ihrem Gesicht. Für sie ist jedes dieser struppigen, graubraunen Exemplare unverwechselbar.
Nach und nach trudeln die Hyänen nun aus allen Richtungen ein. Bald gleicht die Gegend um den Gemeinschaftsbau einem Dorfplatz. Die Tiere begrüßen einander, indem sie ihre Genitalien beschnüffeln. Eine Mutter mit prallen Zitzen wird in den Nacken gebissen. Die Attackierte kreischt auf und prescht zur Seite; ein weiteres Tier geht auf sie los.
„Ich erlebe diese Exkursionen wie die Folgen einer Soap-Opera“, sagt Holekamp. Die Programmvorschau für heute könnte lauten: Ein feindliches Rudel dringt ins Territorium des West-Talek-Clans ein – und hinterlässt ein Geschenk. Fozzy, der ewige Querulant, triumphiert. Während Navajo versucht, mit der größten Schlappe ihres Lebens fertigzuwerden.
Ahnungslose Beobachter, die weder Drehbuch noch Darsteller kennen, müssen das Drama für eine zufällige Abfolge von Naturszenen halten: Da balgen sich auf einer Anhöhe sieben Hyänen um ein halbes Gnu; sie rupfen krachend Rippen aus dem Kadaver, stecken die Schnauzen tief in die Innereien. Da jagen zwei Tiere einem einzelnen hinterher, das ein Bein des Gnus mit sich fortschleppt. Da verlässt ein Fünfer-Trupp wie auf Kommando den Fressplatz, rennt einige Hundert Meter weit fort und beginnt, entlang einer unsichtbaren Linie Duftmarken zu setzen. Kaum zurückgekehrt, stürzen sich die fünf auf ein Einzeltier, das sich demütig, mit eingezwängtem Schwanz, der abgenagten Gnu-Wirbelsäule nähert, und beißen es in Nacken und Ohren.
„Zicken!“, zischt Holekamp, während die Geschlagene, panische Kicherlaute ausstoßend, davonrennt.
Die Empörung der Forscherin ist echt; sie begleitet die Tiere mit einer Anteilnahme, als ginge es um ihre eigene Familie. Freut sich über Nachwuchs, der sich erstmals aus den unterirdischen Gängen wagt; sorgt sich, ob ein Clan-Mitglied womöglich den Löwen oder den Speeren der Maasai zum Opfer gefallen ist; schimpft, wenn Ranghöhere auf Schwächere losgehen. Und als einmal eine betäubte Hyäne bei einer Untersuchung zu atmen aufhörte, hat sie das Raubtier per Mund-zu-Mund-Beatmung gerettet. Kein Wunder, dass die Maasai in der Region die Amerikanerin längst „Mama Fisi“ nennen: Hyänenmutter. „Fisi“ ist das Swahili-Wort für Hyäne.
So erkennt sie auch, was wirklich gespielt wird an diesem Morgen: Das erlegte Gnu muss von einem benachbarten Clan zuvor in das Revier gehetzt worden sein. Denn die Gruppe, die sich zuerst über den Kadaver hergemacht hat, kann ihn unmöglich in so kurzer Zeit kahl gefressen haben. Vermutlich haben die Tiere die Eindringlinge nach den ersten paar Bissen in die Flucht geschlagen. Das erklärt auch, weshalb fünf von ihnen gleich nach der Mahlzeit noch einmal losgelaufen sind, um ihre Reviergrenze zu „befestigen“.
Der stolze Hüter des Gnu-Beins: Das ist Fozzy, ein zwölfjähriges Männchen aus dem Clan der Rocksänger. Gegen alle Regeln hat er seine Sippe nie verlassen. Er ist allein, niemand will sich mit ihm paaren, was ihn jedoch offenbar nicht stört – Leslie hat beobachtet, wie er oral masturbiert. Sie nennt ihn den „unheimlichen Onkel“.
Und die geschlagene Navajo muss Opfer eines Putsches geworden sein. Zusammen mit ihrer Tochter Carter – die meisten anderen Präsidententöchter sind von Löwen gefressen worden – wird sie seit ein paar Tagen schon vom gesamten Clan gemobbt. Die niederrangigen Tiere haben offenbar eine günstige Gelegenheit genutzt, die Indianerin und ihre Tochter in der Rangfolge zu drücken – ein völlig außergewöhnliches Verhalten. „Navajo“, sagt Kay Holekamp seltsam bewegt, „hat in ihrem Leben viel Pech gehabt.“
Es sind Hunderte solcher Episoden, aus denen die Forscherin nach und nach ein immerhin modifiziertes Bild der verrufenen Spezies gepuzzelt hat. Sechs Generationen Tüpfelhyänen hat sie bereits in der Maasai Mara aufwachsen sehen. Vor 30 Jahren kam sie nach Kenia – als Touristin. Und erlebte, wie eine Tüpfelhyäne eine Antilope riss. Da staunte sie zum ersten Mal. Denn auch sie hing dem weitverbreiteten Glauben an, Hyänen seien reine Aasfresser.
Holekamp bemerkt bald, dass ihre Beobachtungen auch sonst den etablierten Volksmeinungen über Hyänen mehr oder weniger deutlich widersprechen. 1988 siedelt sie in die Mara über, um das „Fisi-Camp“ zu gründen. Sie nähert sich den Tieren wie eine Soziologin; protokolliert systematisch, wie sie miteinander umgehen, nach welchen Regeln sie gemeinsam jagen, fressen oder sich paaren, wer wen dominiert, attackiert oder umwirbt.
Sie bemerkt, dass diese Hyänen einander durch Rufe, Aussehen und am Geruch erkennen; dass sie nicht nur die Struktur der eigenen Verwandtschaft wie ein Organigramm im Kopf haben, sondern auch fremde Familien überblicken – von der Großtante bis zum jüngsten Neffen.
Holekamp beobachtet, dass Männchen stets versuchen, möglichst hochrangige Weibchen zu bespringen, wobei es die Weibchen sind, die bei der Paarung Regie führen – und unerwünschte Verehrer wie lästige Fliegen abschütteln. Sucht ein Tier einen Verbündeten, etwa zum gemeinsamen Jagen, wählt es meist einen Artgenossen, der knapp über der eigenen Clan-Position rangiert – das erhöht die Chance, dass die Offerte akzeptiert wird. Und wenn eine Hyäne Zeuge eines Streits außerhalb der eigenen Familie wird, schlägt sie sich grundsätzlich auf die Seite der Höherrangigen, auch wenn diese körperlich schwächer sind.
Es ist bald klar, dass Holekamps Feldstudien an ein grundsätzlicheres Problem rühren: Was ist eigentlich Intelligenz, und unter welchen Bedingungen entsteht sie?
Über diese Frage wird damals, Ende der 1980er Jahre, lebhaft diskutiert, vor allem unter Primatenforschern. Bis dahin galt die Lehrmeinung, der gelegentliche Mangel an Nahrung sei der Schaden gewesen, aus dem Menschenaffen mit der Zeit klug geworden seien. Der Hunger hätte zum Beispiel Schimpansen gelehrt, Termiten mit Stöckchen aus ihren Bauten zu angeln und sich zu merken, wann welcher Baum schmackhafte Früchte trägt. Das Gehirn sei an seinen Aufgaben gewachsen.
Neue Feldstudien an wild lebenden Primaten legen eine andere Theorie nahe: Danach ist es eher die Komplexität einer sozialen Umgebung, die das Gehirn herausfordert: Die Gefährten in einer Gruppe ändern sich ständig; Jungtiere werden geboren, Fremde wandern zu; der eine ist ein Heißsporn, immer auf Ärger aus, der andere ein entspannter, kooperativer Typ. Wer seine Stellung im Clan behaupten und seine Gene weitergeben will, so die Schlussfolgerung, muss lernen, sich in seine Gefährten „hineinzudenken“, um je nach Situation flexibel reagieren zu können.
Die Geburt der höheren Intelligenz aus dem Geiste des geselligen Miteinanders – das ist eine sympathische und bald auch allgemein akzeptierte Theorie. Und für Kay Holekamp, die täglich zweimal ihre Soap-Opera-Darsteller besucht, ist zu diesem Zeitpunkt der revolutionäre Schluss kaum noch zu vermeiden: Hyänen müssen genauso schlau sein wie Affen.
Denn auf ihren Beobachtungstouren entdeckt die Forscherin immer neue Facetten der Hyänen-Intelligenz.
Da bringt eine Hyänendame namens Cochise ihre Beutestücke immer wieder zum Forscher-Jeep. „Sie hatte keine Angst vor uns“, sagt Holekamp. „Die anderen Hyänen, selbst höherrangige, schon. Und das wusste Cochise genau.“ Die korrekte Schlussfolgerung der Hyänendame: Nur in der Nähe des Wagens kann sie einer Thomson-Gazelle in Ruhe zuerst die lästigen Hörner abbrechen, um dann den Schädel auszuschlürfen.
Oder: Da schlägt beim Geraufe um Beute eine niederrangige Hyäne, die keinen Bissen abbekommt, plötzlich Alarm, mit einem hohen Meckern, das Gefahr ankündigt. In Panik laufen die Konkurrenten davon; die Ruferin bleibt – und schlägt sich in aller Ruhe den Bauch voll.
Da entdeckt ein untergeordnetes Männchen beim Streifzug mit dem Rudel einen im Gras versteckten Leoparden, der an einem Gnu kaut. Als hätte es nichts gesehen, folgt das Männchen den Gefährten, bis diese hinter einer Hügelkuppe verschwunden sind. Dann kehrt es um und stiehlt dem Leoparden die Beute.
Wer täuscht, muss eine Idee von der Zukunft haben, ist Holekamp sicher. Und wer plant, kann nicht dumm sein.
Jedes neue Beispiel scheint die These der Forscherin zu stärken. Ihre Hyänen, glaubt sie bald, können es mit jedem Affen aufnehmen. Nur: Eines Tages wird dieser Glaube um eine grausige Variante ergänzt. Da erfährt Kay Holekamp, wozu Hyänen tatsächlich fähig sind. Und wozu nicht.
Juli 2000. In einem Safari-Lager in Botswana zerrt eine Hyäne einen elfjährigen Jungen nachts aus dem Zelt; er hatte allein geschlafen. Die Mutter und ein Führer folgen einer Blutspur ins Gebüsch und finden das Kind mit tödlichen Wunden.
Eine erste Untersuchung zeigt: Der Eingang zum Schlafplatz des Jungen ist erstaunlicherweise unversehrt. Die Familie will das Safari-Unternehmen verklagen – man habe verschwiegen, dass Hyänen in der Lage seien, den Reißverschluss eines Zeltes zu öffnen. Kay Holekamp soll den Fall untersuchen.
Nie wieder, sagt sie heute, sei sie von solch widerstreitenden Gefühlen zerrissen worden. Auf der einen Seite habe sie natürlich unendliches Mitleid mit der Mutter empfunden. Auf der anderen Seite keimt in ihrer Forscherseele eine verwegene Hoffnung: Sollte eine Hyäne imstande sein, Funktion und Mechanismus eines Reißverschlusses zu durchschauen? Und wäre das nicht der ultimative Beleg für die bislang dramatisch unterschätzte Intelligenz der Tiere?
Die Antwort liefert ein entsetzliches Tondokument. Das Kind hatte kurz vor seinem Tod ein Aufnahmegerät eingeschaltet, darauf ist weder ein geschicktes noch ein gewaltsames Öffnen der Eingangsplane zu hören. Holekamp kommt zu dem Schluss, der Junge habe offenbar selbst die Plane zurückgeschlagen, um in der Dämmerung Fotos und Tonaufnahmen von Hyänen zu machen.
In den Wochen nach dem Unfall wird Holekamp von Albträumen geplagt. Es ist nicht nur der Gedanke an das tote Kind; sie beginnt sich auch zu fragen, ob sie ihre Forschungsobjekte nicht zu sehr idealisiert.
Die Forscherin beschließt, die Intelligenz der Hyänen nun nicht mehr nur episodisch, sondern systematisch zu messen. Mit einer Kollegin startet sie eine Testreihe, in der ein klassisches Requisit der Verhaltensforschung zum Einsatz kommt: ein eiserner Käfig, mit einem Köder bestückt. Um an diesen zu gelangen, müssen die Versuchstiere einen Riegel beiseiteschieben – eine Aufgabe, die Neugier, Ausdauer und die Fähigkeit erfordert, unterschiedliche Lösungswege auszuprobieren. Eben das, was man bei Menschen wie Tieren als Beleg für Intelligenz bezeichnet.
Affen bestehen diesen Test. Doch bei den Tüpfelhyänen der Maasai Mara fällt das Ergebnis enttäuschend aus: Von 58 Tieren, die sich in der Nähe des Fisi-Camps von Ziegenfleischködern anlocken lassen, schaffen es ganze neun, den Riegel zu öffnen. Viele stecken nur die Schnauze durch die Gitterstäbe. Nicht einmal das Beobachten geschickterer Artgenossen bringt sie auf den Trick. Eine Ernüchterung für Holekamp.
Seither verfolgt sie auch die tägliche „Soap-Opera“ in der Savanne kritischer. So fällt ihr auf, dass Tüpfelhyänen beim Jagen in der Gruppe nicht strategisch vorgehen: Verfolgen sie eine Herde Zebras, kreisen sie diese nicht ein, sondern rennen ihnen hinterher, jedes Tier für sich allein. „Sie tauschen keine Ideen aus“, sagt Holekamp, „da ist nichts Koordiniertes.“
Ihr nunmehr unbarmherziges Fazit, das sie trotz vieler zweifelloser Strategieleistungen der Hyänen fällt: „Im Vergleich zu Primaten sind Hyänen doch dumm.“
Wenn eine Forscherin das Bild korrigieren muss, das sie sich von ihren Studienobjekten gemacht hat, dann ist das an sich nichts Ungewöhnliches. Doch Kay Holekamps Erkenntnisse über Tüpfelhyänen zwingen immerhin dazu, auch die alte Grundsatzfrage vom Ursprung der Intelligenz neu zu stellen.
Denn wenn das Denkvermögen dieser Hyänen, bei genauerer Betrachtung, doch begrenzter ist als vermutet – dann müsste dies auch an der Struktur ihrer Gehirne abzulesen sein. Holekamps Untersuchungen zeigen jedoch: Das „soziale Areal“ ist bei Tüpfelhyänen und Primaten, gemessen am Gesamtvolumen des Gehirns, besonders stark ausgeprägt.
Und so bestätigt sich zumindest ein Teil der alten Hypothese: Von den Hyänen können wir tatsächlich einiges über die Wurzeln unserer eigenen, der menschlichen Intelligenz lernen. Nämlich: Soziale Kompetenz kann eben doch nicht die Wurzel all unserer Schlauheit sein. Sonst müssten Tüpfelhyänen ebenso imstande sein, eine verschlossene Tür oder ein Zelt zu öffnen, wie Affen es können. Es muss also, vermutet Holekamp, in der Stammesgeschichte der Primaten etwas passiert sein, was diese klüger gemacht hat, als Raubtiere je sein werden. Aber was?
„Keine Ahnung“, sagt die Forscherin. Vielleicht bilde ja das äffische Leben in den Bäumen den Geist aus. Wer sich durch eine dreidimensionale Welt schwinge, sei womöglich ebenso fähig, sich durch eine komplexe Gesellschaft zu hangeln – und für Probleme Lösungen aus verschiedenen Richtungen zu entwickeln.
Holekamp klickt auf ihrem Laptop herum, zeigt bunte Koordinatensysteme und Hirnscans von Tüpfel-, Streifen-, Schabrackenhyäne und Erdwolf. Sie hat sie verglichen mit denen von Hunden, Katzen, Mardern und Waschbären. Sie will in Zukunft noch genauer und umfassender untersuchen, welche Zusammenhänge es wohl zwischen Hirnstruktur und Sozialverhalten gibt.
Ja, gibt Holekamp zu, sie sei schon etwas enttäuscht. „Andererseits …“ Sie lächelt und ruft zwei Fotos auf, die sie neuerdings am Ende von Vorträgen präsentiert. Eines zeigt eine aufrecht stehende Hyäne, die in ein Auto glotzt, in dem ein Menschenbaby sitzt. Auf dem anderen Bild entriegelt ein Pavian den Türgriff eines Autos.
„Eigentlich bin ich froh“, sagt Holekamp, „dass ein Wesen mit solchen Waffen im Maul und der Fähigkeit, mich in fünf Minuten aufzufressen, nicht ganz so clever ist.“
Aus GEO Nr. 10/2010
Löwen
Das Herrscher-Kollektiv
Er ist der oberste Jäger der Savanne. Aber auch dies: ein Rudel-Demokrat, der keinen Gruppenzwang kennt, dafür ein Freiheitsgebot. „Fast zu edelmütig, um wahr zu sein“, sagt Craig Packer. Er ist Löwenforscher, Löwenbewunderer seit Jahrzehnten. Er muss es wissen
Von Uta Henschel
Punkt 22 Uhr gehen über Peter Morkels Veranda die Sterne an. So millionenfach, so diamanten wie nirgendwo sonst. Einen Moment zuvor hat sich der Generator abgeschaltet. Die Rotoren rumpeln eine letzte Runde, dann ist das Haus am Rand des Ngorongorokraters ohne Strom. Schlagartig erlöschen alle Lampen. Und als hätte sie auf diesen Moment gelauert, stürzt die äquatoriale Finsternis durch die Fenster herein wie ein hungriges Raubtier und verschlingt Wände, Türen, Möbel – die gesamte Feldstation des Nashornexperten Morkel. Sekundenlang ist die samtene Schwärze total, ist die Erde unsichtbar geworden. Nur aus dem Weltraum funkeln die kosmischen Feuer.
Nach einer Weile haben sich die Augen an das Sternenlicht gewöhnt und erkennen Umrisse, geisterhafte Bäume, Büsche und ein paar grasende Büffel dicht neben der Veranda. Ihr Schnauben ist durch die Scheiben zu hören, sogar das Reißen der Halmbüschel, die sie sich in die Mäuler schaufeln und schmatzend zermalmen. In der Ferne trommeln fliehende Hufe. Dann herrscht Stille, eine Stille, der nicht zu trauen ist.
Sie ist ein Hinterhalt, aus dem plötzlich ein ohrenbetäubender Schall-Angriff dröhnt: ein Röhren, Ächzen, Grunzen aus rauen Kehlen. Drei männliche Löwen schleudern ihre tönende Eigenwerbung in den mächtigen Trichter des Kraters hinab. Das Kampfteam eines Rudels, die Verteidiger eines gemeinsamen Territoriums, demonstrieren akustisch ihre Dominanz. Mit einer Serie von Stakkato-Rülpsern beginnt ein grollender Bass. Etwas höher setzt der Bariton ein und rutscht die Tonleiter hinauf und hinunter wie eine Sirene. Dann folgt ein greller Tenor. Mit jeder Stimme im Brüll-Kanon wächst die Lautstärke. Die einzelnen Lagen verschmelzen zu einem dissonanten Dreiklang. So prahlt der Männerchor minutenlang mit seiner Mordskraft.
Was die Raubtierlungen hergeben, ist mehr als heiße Luft: Im Umkreis von acht Kilometern wird umherstreifenden Konkurrenten kundgetan, wie viele wilde Kerle nur darauf lauern, jeden Eindringling mit Pranken und Zähnen zu zerlegen.
Wahrscheinlich ist der Auftritt des Trios ein allabendlich wiederkehrendes Programm im Krater. Denn die Büffel haben zu Beginn des Spektakels nur die Köpfe gehoben. Doch als von links drei Schemen aus dem Schatten der Büsche heranpreschen, die Mähnen sternengrau beleuchtet, die Schwanzquasten erhoben wie Wimpel, stürmen die Huftiere davon.
„Die drei kenne ich gut“, sagt Craig Packer am nächsten Morgen, als er erfährt, was mich auf dem Gästesofa in der Veranda wach gehalten hat. Packer wird hier in Tansania Mr. Lion genannt. Der internationalen Fachwelt gilt er als der Löwenexperte schlechthin. Nicht zuletzt, weil der Forscher es versteht, seine Neuigkeiten plakativ zuzuspitzen und deren Bedeutung auch für Laien eingängig zu machen. Durch ihn sind Afrikas Löwen so prominent geworden wie sonst nur Primaten.
Dabei ist der Professor aus Minnesota natürlich nicht der Erste, der die tansanischen Großkatzen studiert. Dass die Raubtiere in Großfamilien leben, dass Löwenbrüder Koalitionen schmieden, weibliche Harems erobern und Babys morden, ehe sie eigene zeugen, gehörte schon vor Packer zum Grundwissen von Biologen. Dennoch sind die Erkenntnisse zum Löwen-Verhalten Stückwerk geblieben, eine Mischung aus bizarren und überraschungsarmen Episoden, wie man sie aus dem Repertoire anderer Säugetiere bereits kannte. Löwen schienen als Spezies nur ein weiteres Exempel für den verbreiteten Glauben an den „genetischen Egoismus“: nur Marionetten der Evolution.
Zu entdecken, wie sehr man die Rudelgesellschaft unterschätzt hat, ist Packer vorbehalten geblieben. Seine Langzeitstudien entwerfen das Bild von einem Katzenkollektiv, das nicht nur genetisch geleitet, sondern ausgesprochen kopfgesteuert wirkt. Sogar beim todernsten Geschäft der Jagd kennen die Teams keinen Gruppenzwang, wie es lange für sicher gehalten wurde. Mitzumachen ist eine persönliche Entscheidung jedes Individuums.
Der Zoologe Packer (Fächer: Ökologie, Evolution, Verhalten) entdeckte: Rudelgenossen packen nur dann mit an, wenn Hilfe ihrer Meinung nach nötig ist oder wenn die Aussicht auf Völlerei das Risiko aufwiegt, im Kampf verletzt zu werden. Formidable Büffel oder auskeilende Zebras werden meist von mehreren Löwen niedergerungen. Dagegen traut die Truppe jedem Mitglied zu, ein Gnu oder Warzenschwein allein zur Strecke zu bringen, und wartet gelassen ab, bis angerichtet ist.
Zum Fressen wiederum finden sich alle ein. Großzügig wird der Fang geteilt, fand Packer heraus. Womit abermals eine frühere These hinfällig wurde: nämlich, dass Löwinnen sich deswegen zu Jagd-Rudeln zusammenschließen, weil sie als Team mehr Beute machen. Die nunmehr aufgezeigte Gegenbilanz: Jede für sich allein sorgende Jägerin heimst um 90 Prozent mehr Nahrung ein – es muss also andere Gründe für die Gruppenjagd geben.
Mit dem Geländewagen verlassen wir den rund 500 Meter über der Umgebung gelegenen Rand des Ngorongoro, jenes erloschenen Vulkans, den seit den Zeiten Bernhard Grzimeks alle Welt kennt. Berühmt ist die 25.000 Hektar große, wildtierreiche Ebene im Kraterinneren. Aber nicht dorthin wollen wir, sondern außen am Berg herunter durch das Gebiet der umliegenden Ngorongoro Conservation Area, die an den Serengeti-Nationalpark grenzt. Unser Ziel ist Seronera, eine Ansammlung von Touristenunterkünften mitten im Nationalpark und Sitz von dessen Hauptquartier.
Kaum haben wir das Areal erreicht, bringt Packer den Wagen plötzlich zum Stehen, denn er hält eine Demonstration für angebracht: Wie gut er sich nach über 30 Jahren Feldforschung unter Löwen auskennt. Ein Blick durchs Teleobjektiv – und wo sonst niemand etwas sieht, erkennt Mr. Lion hinter einem Akaziengestrüpp „eine der ‚Lost Girls‘ “. Die „Verlorenen“ sind Schwestern, die gemeinsam das Rudel verlassen haben, in dem sie geboren wurden. Weit seien sie nicht von zu Hause fortgezogen, erzählt Packer, nur ein Stück beiseite. Dort hätten sie eine Parzelle vom mütterlichen Territorium abgetrennt und eine neue Frauenkommune gegründet.
Grundbesitz in bester Lage sichert jedem Löwenkollektiv seinen Lebensunterhalt. Aber was ist für die tierische Oberschicht der Serengeti eine gute Adresse? Als Jäger aus dem Hinterhalt bevorzugen Löwen keineswegs Gebiete mit hoher Beutedichte. Wohl wissend, dass viele Augen auch viel sehen, achten die Beutegreifer mehr auf Deckung. Um wenig beweidete Büsche, Bodenwellen, Felsbuckel und Erosionsnarben wächst grüneres Gras – und das lockt Beutetiere besonders verlässlich in die Falle.
Erste Wahl für die trägen Räuber aber sind Liegenschaften mit Wasserlöchern. Dort findet ihr Hang zum Nichtstun ideale Bedingungen. In der Nähe einer Tränke versteckt, lungern die Räuber herum, bis die nächste Mahlzeit zu ihnen findet. Sie haben begriffen: Huftiere müssen regelmäßig ihren Durst löschen – selbst dort, wo der Tod auf sie lauert.
Was allerdings Löwen biologisch so besonders macht und was Packer durch Studie um Studie immer deutlicher herausarbeitet, ist das erstaunliche Talent der großen Landraubtiere, mal ihre individuellen, mal die kollektiven Stärken auszuspielen. Die Wahl zwischen den beiden Möglichkeiten zeichnet die Spezies unter allen sozialen Beutegreifern aus.
Unter den etwa vier bis 15 Löwinnen, die den Kern jedes Rudels bilden, gibt es keine Hierarchie. Anders als zum Beispiel im Verband von Zwergmungos oder Erdmännchen, wo die ranghöchste Alpha-Frau ihr Gebärprivileg despotisch durchsetzt, die Fortpflanzung anderer Weibchen unterdrückt und sie zur Helferkaste herunterstuft.
Die Königin der Tiere hingegen ist Demokratin. Jedes weibliche Rudelmitglied hat gleiches Recht auf Mutterglück. Löwinnen derselben Großfamilie synchronisieren die Geburten ihrer Jungen und teilen sich die Arbeit beim Säugen, Babyhüten und Jagen. So stärkt die von ihnen praktizierte Kooperation nicht nur die Gruppe. Sondern sie nützt auch jeder einzelnen Löwin: Alle ziehen im Lauf ihres Lebens etwa gleich viel Nachwuchs groß.
Von dem, was der US-Biologe beschreibt, ist beim Blick aus dem Geländewagen so gut wie nichts zu sehen. Im Holpertakt der Schlaglöcher und Spurrillen rechts und links der Straße schwanken ein paar der charismatischen Großkatzen vorüber mitsamt der Landschaftsausstattung, die sie bewohnen, und nichts ist ihnen anzumerken von all dem, was über sie berichtet wird. Doch je länger die Fahrt dauert, desto lebhafter bevölkert sich die Serengeti mit ihren Abenteuern, Kämpfen, Kindern, Beutezügen, Fressorgien, Wanderungen, Leidenschaften, Intrigen. Die Fantasie kann aus der Savanne einen Schauplatz dramatischer Seifenopern machen.
Dazu gehören die Geschichten von jenen Frauenclans, die fauchend Front gegen fremde Mähnenträger machen. Notfalls unterstützen Löwinnen sogar ihre männlichen Rudelchefs. Etwa wenn diese sich gegen eine Übermacht männlicher Gangs behaupten müssen, die ihnen den weiblichen Harem samt Territorium und Paschamonopol abjagen wollen. Aber machen alle mit im Bandenkrieg?
Auf Beweise von Gemeinsinn oder Eigennutz haben Packer und seine Studenten nicht geduldig gewartet. Sie haben Gelegenheiten geschaffen und systematisch Konflikte inszeniert, um Territoriumsbesitzer aus der Reserve zu locken. Etwa indem die Wissenschaftler Tonbandaufnahmen von Brüllchören abspielten und lebensgroße Plüschlöwen mit mächtigen Mähnen strategisch auf Rudelland platzierten. Die Antwort auf diese Provokation lief stets nach demselben Schema ab: Clanmitglieder eilten herbei, um als Gang gegen die vermeintlichen Herausforderer vorzurücken. Doch gab es auch Drückeberger: Manche bummelten auf dem Weg zum Kampf, rafften sich aber auf, wenn ihre Hilfe vonnöten schien. Andere sahen nur zu. Dennoch wurden sie für ihre mangelnde Solidarität nicht „bestraft“.
Das Bündnis der Raubtiere ist, wie Packer hinter dem Lenkrad mehr irritiert als bewundernd bemerkt, nicht nur stark, sondern auch tolerant. Rudelgenossen müssen sich nicht konform verhalten, um dazuzugehören. „Fast zu edelmütig, um wahr zu sein“, scheint es unter Löwen zuzugehen. Als würden, meint Packer, „die Regeln der genetischen Selbstsucht ausgerechnet bei Afrikas stärksten Beutegreifern nicht gelten“.
Fest steht: Das Rätsel Rudel lässt sich nicht ruck, zuck „in zwei bis drei Jahren“ lösen, wie Packer es sich zu Beginn seiner Serengeti-Arbeit zugetraut hatte. Eines führt zum anderen. Das Thema, auf das der Forscher sich nur kurz einlassen wollte, zieht immer neue Untersuchungen nach sich. Es verschlingt Jahrzehnte seines Lebens.
Alle Arbeitsthesen, so überzeugend sie erscheinen, müssen im Einzelnen belegt werden. Ursachenforschung ist unerlässlich, um wissenschaftlich plausibel zu machen, dass der soziale Kitt einer Löwenkommune jedem einzelnen Mitglied auch konkret etwas einbringt, jedenfalls langfristig. So fahnden Packer und sein Team nach Beweisen für Überlebensgewinn. Was bedeutet, dass beinahe alles beobachtet, gemessen, gezählt und in die Evolutionsgleichung eingetragen werden muss, was Löwenrudel Tag für Tag und Nacht für Nacht tun. Und so hat sich Packer im Lauf der Jahre daran gewöhnt, nicht nur alles über Löwen, sondern vieles über sie auch besser zu wissen.
Anlass für unseren nächsten Halt ist eindeutig „Zeus“, ein strammer Mähnenträger, der von dem höchsten Buckel eines Felsens aus die Musterung gelassen erwidert. Er ist einer der Götter im „Vumbi-Rudel“, Mitglied einer Allianz dominierender Zeuger. Sie sorgt nicht nur auf eigenem Grund und Boden eifrig für Nachwuchs. Auch die Löwinnen zweier weiterer Gruppen profitieren, laut Packer, von der göttlichen Potenz.





























