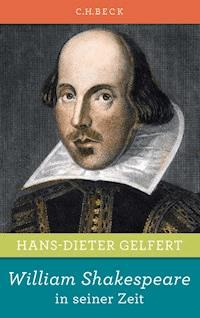
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Hans-Dieter Gelfert zeigt Leben, Werk und Zeit des größten englischen Dichters in neuem Licht. In Shakespeares Dramen erscheint der Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit als eine Bruchzone. Einerseits drückt sich in Shakespeares Person und in seinen Werken bereits beispielhaft das frühneuzeitliche Bewusstsein der heraufziehenden bürgerlichen Gesellschaft aus, zum andern macht es die bis heute andauernde Aktualität dieses Dichters aus, dass er in seinen Werken den modernen Menschen noch quasi in statu nascendi zeigt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
WILLIAMSHAKESPEARE
in seiner Zeit
Hans-Dieter Gelfert
C.H.Beck
Zum Buch
Hans-Dieter Gelfert zeigt Leben, Werk und Zeit des größten englischen Dichters in neuem Licht. In Shakespeares Dramen erscheint der Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit als eine Bruchzone. Einerseits drückt sich in Shakespeares Person und in seinen Werken bereits beispielhaft das frühneuzeitliche Bewusstsein der heraufziehenden bürgerlichen Gesellschaft aus, zum andern macht es die bis heute andauernde Aktualität dieses Dichters aus, dass er in seinen Werken den modernen Menschen noch quasi in statu nascendi zeigt.
Über den Autor
Hans-Dieter Gelfert war bis zu seiner Emeritierung Professor für englische Literatur an der Freien Universität Berlin und ist seither freier Autor kulturwissenschaftlicher Werke und Übersetzer englischer Gedichte. Bei C.H.Beck ist von ihm zuletzt erschienen: Edgar Allan Poe. Am Rande des Malstroms (2008) und Charles Dickens der Unnachahmliche (2012).
Inhalt
Vorwort
Wer schuf Shakespeares Werke?
I SHAKESPEARES ENGLAND
Verspätete Renaissance
Aufstieg der Gentry
Reformation
Wirtschaft
Inflation, Missernten und Pest
Kriminalität und Strafrecht
England wird Seemacht
Elisabeth I.
Jakob I.
II KULTUR DER SHAKESPEAREZEIT
Kulturelle Aufholjagd
Wissenschaft und Aberglaube
Copyright und Zensur
Intimisierung und Melancholie
Frauenverehrung und Misogynie
Der Sonettkult
Shakespeares London
Das Theater
Die Lust am Tragischen
Das elisabethanische Weltbild
III DER MANN AUS STRATFORD
Kindheit und Jugend in Stratford
Karriere in London
Lebensabend in Stratford
Porträts
Ein Schlüssel zu Shakespeares Herz
Shakespeares Weltsicht
Genie und Bürger
IV DIE DRAMEN
Die Erste Folio-Ausgabe
Die Historien
Heinrich VI.
Richard III.
König Johann
Richard II.
Heinrich IV.
Heinrich V.
Falstaff
Heinrich VIII.
Die frühen Komödien
Zwei Herren aus Verona
Der Widerspenstigen Zähmung
Komödie der Irrungen
Verlorene Liebesmüh
Ein Sommernachtstraum
Der Kaufmann von Venedig
Die lustigen Weiber von Windsor
Die frühen Tragödien
Titus Andronicus
Romeo und Julia
Julius Caesar
Die romantischen Komödien
Viel Lärm um nichts
Wie es euch gefällt
Was ihr wollt
Die Sonderstellung des Hamlet
Die Problemstücke
Troilus und Cressida
Maß für Maß
Ende gut, alles gut
Die späten Tragödien
Othello
Timon von Athen
König Lear
Macbeth
Antonius und Cleopatra
Coriolan
Die Romanzen
Perikles
Das Wintermärchen
Cymbeline
Der Sturm
Die beiden edlen Vettern
V WILLIAM SHAKESPEARE SUPERSTAR
Vergötterung in England
Vergötzung in Deutschland
Shakespeares Kunst
Shakespeares Größe
ANHANG
Stammtafel der Familie Shakespeares
Shakespeares Werke
Zeittafel
Quellenverzeichnis
Literatur
Personenregister
Vorwort
Wozu braucht Shakespeares würdiges Gebein
Ein Denkmal, kunstvoll aufgetürmt aus Stein?
Will man, dass eine Pyramidenspitze
Den großen Namen in den Himmel ritze?
Du teurer Erbe hohen Dichtertums,
Brauchst du so schwaches Zeugnis deines Ruhms?
Im Staunen eines jeden, der dich kennt,
Erschufst du dir dein eignes Monument.
Wenn deiner Verse müheloser Fluss
Gequälten Reim beschämt und der Genuss
Des tiefen Sinns in deinem großen Buch
Den Geist zu Marmor macht wie Delphis Spruch,
Dann liegst du dort in einem Sarg der Ehre,
Für den ein König gern gestorben wäre.
Dies schrieb John Milton, der als der zweitgrößte englische Dichter gilt, über den größten als anonymen Beitrag für die zweite Folio-Ausgabe von dessen Dramen, die 1632 herauskam.
Schon der ersten Ausgabe waren rühmende Verse von Dichterkollegen beigegeben, und die Verehrung nahm danach weiter zu. Im englischen Sprachraum gilt Shakespeare als der Dichter schlechthin, the bard, so dass für seine Vergötterung das Wort bardolatry geprägt wurde. Seit über zwei Jahrhunderten ist er der meistbeforschte Dichter aller Zeiten; und dennoch weiß man über ihn so wenig, dass selbst seine Autorschaft angezweifelt wird. An biographischen Quellen ist seit dem Erscheinen von E. K. Chambers’ zweibändigem Standardwerk William Shakespeare. A Study of Facts and Problems (1930) wenig Relevantes hinzugekommen, und für das Wenige musste die Forschung immer größere Abraumhalden anhäufen. Wer nur nach gesicherten Fakten sucht, findet fast alles schon in F. E. Hallidays Shakespeare Companion 1564–1964 (1964) und auf neuestem Stand im Oxford Companion to Shakespeare, den Michael Dobson und Stanley Wells 2005 herausbrachten. Was die beiden Lexika alphabetisch auflisten, bietet auf Deutsch in ausführlicher Sachbuchform das von Ina Schabert herausgegebene Shakespeare-Handbuch. Die Zeit – Der Mensch – Das Werk – Die Nachwelt, von dem 2009 die fünfte Auflage erschien.
Das vorliegende Buch liefert weder neue biographische Erkenntnisse noch stürzt es sich ins Getümmel der mit Theorie überfrachteten kritischen Auseinandersetzung mit Shakespeares Werken. Sein Ziel ist vielmehr, literarisch interessierte Leser, die sich durch ebendiese Theorieüberfrachtung abgeschreckt fühlen, wieder an den Dichter heranzuführen. Dabei geht es nicht um eine schöngeistige Betrachtung des Allgemeinmenschlichen in Shakespeares Werken, sondern um den Versuch, seine Dichtung formal und inhaltlich aus seiner Zeit heraus verständlich zu machen und zu zeigen, wie dieser große Dichter als Seismograph die bewusstseinsgeschichtlichen Erschütterungen der frühen Neuzeit anzeigt. Anders als Miltons Sonett nahelegt, ruht Shakespeare nicht in «einem Sarg der Ehre» bei den Goldschnittklassikern, vielmehr ist er noch immer der meistgespielte Dramatiker. Nur werden seine Stücke meist so gewaltsam modernisiert, dass vom Original wenig übrigbleibt. Während bei klassischer Musik das Credo der Werktreue gilt, werden klassische Theaterstücke oft bis zur Unkenntlichkeit entstellt unter dem Vorwand, ihre Aktualität freizulegen. Doch die zeigt sich viel deutlicher, wenn man die Werke an ihrem Ursprung aufsucht.
Ein Buch über Shakespeare schrieb der Verfasser bereits im Jahr 2000 für die Beck’sche Reihe «Wissen». Dort ging es vor allem um sachliche Information. Jetzt steht der Blick ins Innere des Dichters im Mittelpunkt, eingebettet in die Kultur seiner Zeit. Zu diesem Zweck kommt der Dichter in großem Umfang selber zu Wort, wobei der Verfasser, um sich die Qual der Wahl zwischen den vorhandenen Übersetzungen zu ersparen, alle zitierten Texte selber ins Deutsche übertrug. Dass er der im Anhang aufgeführten Sekundärliteratur unzählige Einsichten verdankt, versteht sich von selbst. Ebenso selbstverständlich ist aber auch, dass eine Auseinandersetzung mit ihr den Rahmen dieses Buches gesprengt hätte.
Wer schuf Shakespeares Werke?
Shakespeare (Will), ein englischer Dramaticus, geb. zu
Stratford 1564, ward schlecht auferzogen und verstand
kein Latein, jedoch brachte er es in der Poesie sehr
hoch. Er hatte ein scherzhaftes Gemüthe, kunte aber auch
sehr ernsthaft sein und excellierte in Tragödien.
Dieser Eintrag in Menckens Gelehrten-Lexikon von 1715 hatte nicht erwarten lassen, dass 44 Jahre später der kluge Lessing den Dramaticus mit dem scherzhaften Gemüte zum Vorbild für die dramenschreibenden Zeitgenossen erklären und die deutschen Klassiker und Romantiker ihn bald darauf wie einen Gott verehren würden. Seitdem strahlt sein Stern mit unverminderter Helligkeit am literarischen Himmel der Deutschen, und er ist noch immer der meistgespielte Autor auf unseren Bühnen. In England war und ist es nicht anders, nur dass dort die Verehrung gleich nach dem Tod des Dichters eingesetzt hatte, wie das Sonett John Miltons beweist. Seitdem hat sich die kritische Beschäftigung mit ihm zu einer wahren Industrie entwickelt, an der die Deutschen beträchtlichen Anteil hatten.
Hierzulande widmet die 1865 gegründete mitgliederstarke Shakespeare-Gesellschaft dem Dichter noch heute alljährliche Tagungen mit Abhandlungen, die in einem Jahrbuch gesammelt herauskommen. Das alles machte den Elisabethaner schon im 19. Jahrhundert zum besterforschten unter den älteren Dichtern der Weltliteratur. Da ist schwer zu begreifen, dass 1857 die Amerikanerin Delia Bacon glaubte beweisen zu können, dass die Werke Shakespeares nicht von dem in Stratford geborenen Schauspieler dieses Namens stammen, sondern von einem zu seiner Zeit berühmteren Zeitgenossen, dem Philosophen und Lordkanzler Francis Bacon, was vor ihr, nach einer mündlichen Überlieferung, bereits 1785 der Pfarrer James Wilmot vermutet haben soll. Ihre verworrene Beweisführung wurde ein Jahr später von William Henry Smith sehr viel schlüssiger fortgeführt. Bei Delia Bacon, die später im Irrenhaus endete, konnte man noch annehmen, dass ihr eigener Name sie zu der Theorie verführte. Doch danach wurden immer neue Kandidaten als Autoren vorgeschlagen, und berühmte Geister reihten sich unter die Zweifler ein, die nicht glauben wollten, dass die gedankenreichsten Dramen der Weltliteratur von einem Schauspieler aus der Provinzstadt Stratford stammen sollten. Inzwischen ist die Liste der vermeintlich «wahren» Verfasser von Shakespeares Werken auf über sechzig angewachsen, und es kommen weiter neue Kandidaten hinzu. So hob die Literaturwissenschaftlerin Brenda James zusammen mit dem Historiker William D. Rubinstein in ihrem Buch The Truth Will Out. Unmasking the Real Shakespeare (2005) den bis dahin nahezu unbekannten Henry Neville auf den Schild. Drei Jahre später glaubte Brenda James, ihre Theorie im Alleingang durch die Aufdeckung eines vermeintlichen Geheimcodes in der Widmung zur Erstausgabe von Shakespeares Sonetten untermauern zu können. Noch jüngeren Datums ist Dennis MacCarthys 2011 publizierte Theorie, wonach Sir Thomas North, den man bis dahin nur als den Übersetzer Plutarchs kannte, der wahre Shakespeare sei.
Bereits 1922 hatte sich ein Shakespeare Authorship Trust gegründet, der dieser Debatte bis heute ein Forum bietet. Bisher haben nur zwei Kandidaten breitere Fürsprache gefunden: Christopher Marlowe und Edward de Vere, der 17. Graf Oxford. Für Marlowe plädierte erst kürzlich der deutsche Medizinprofessor Bastian Conrad in seinem 704 Seiten starken Buch Christopher Marlowe: Der wahre Shakespeare (2011). Da dieser Dichter nach damaliger Aktenlage am 30. Mai 1593 bei einem Streit um eine Wirtshausrechnung erstochen wurde, musste erst einmal erklärt werden, weshalb er danach unter einem Pseudonym weiterlebte. Angesichts lückenhafter Daten gibt es für Spekulationen natürlich immer Anhaltspunkte; und Conrad ist nicht der Erste, der eine Lanze für Marlowe bricht, er tut es nur mit mehr Aufwand als seine Vorgänger. Soweit sich seine Detektivarbeit auf Zeitgeschichtliches bezieht, klingt manches plausibel, doch sobald man die unter Shakespeares Namen kursierenden Werke mit denen vergleicht, die zu Marlowes Lebzeiten unter dessen Namen erschienen waren, bricht die Verschwörungstheorie wie ein Kartenhaus zusammen. Stilistisch liegen die beiden so weit auseinander wie Michelangelo und Leonardo in der Malerei, wie Beethoven und Mozart in der Musik und wie Schiller und Goethe in der deutschen Dichtung. An Sprachkraft stand Marlowe Shakespeare nicht nach, doch ihm fehlte alles, was diesen darüber hinaus auszeichnet. Nirgendwo in Marlowes Werk gibt es einen Anflug von Humor, während Shakespeare mit Falstaff und seinen Komödien zu den Großen auf diesem Felde zählt. Auch bei den Frauengestalten findet man bei Marlowe nichts, was den Vergleich mit Shakespeare aushält. Marlowe mag als Absolvent der Universität Cambridge gebildeter gewesen sein, und seine an Machiavelli orientierten Bühnenhelden lassen ihn moderner erscheinen, doch das menschliche Spektrum seiner Figuren ist viel begrenzter als das des shakespeareschen Personals. Nur eine kunstblinde Betrachtungsweise kann in Shakespeares Werken die Handschrift Marlowes entdecken.
Die größte Anhängerschaft von allen Shakespeare-Kandidaten hat Edward de Vere, der 17. Graf Oxford. Seine Fürsprecher geben sogar eine eigene Zeitschrift heraus, in der sie ihre «Forschungsergebnisse» austauschen. Auch hierzu hat ein Deutscher, der Germanist Kurt Kreiler, erst kürzlich ein mit großer Gelehrsamkeit recherchiertes Buch mit dem Titel Der Mann, der Shakespeare erfand: Edward de Vere, Earl of Oxford (2009) beigesteuert. Den Anfang hatte Thomas J. Looney mit seinem Buch ‹Shakespeare› Identified (1920) gemacht. Es wäre zu erwarten gewesen, dass schon Looneys Nachname, der ‹Spinner› bedeutet, seine Theorie der Lächerlichkeit preisgeben würde. Doch sie fand danach so zahlreiche Anhänger, dass diese sich zu einer Organisation zusammenschlossen, gefördert vom Grafen Burford aus der Familie de Vere. Zu den Hauptvertretern der Theorie zählen der Amerikaner Joseph Sobran mit seinem Buch Genannt Shakespeare. Die Lösung des größten literarischen Rätsels (2002; englische Ausgabe 1997) und der Deutsche Walter Klier mit dem Essay Das Shakespeare-Komplott (1994), den er 2004 in erweiterter Form unter dem Titel Der Fall Shakespeare. Die Autorschaftsdebatte und der 17. Graf von Oxford als der wahre Shakespeare herausbrachte. Aus der Feder des Grafen Oxford sind unter seinem richtigen Namen nur einige Gedichte erschienen, so dass der stilistische Vergleich schwerer als bei Marlowe zu führen ist. In einer zeitgenössischen Quelle werden ihm auch Komödien zugeschrieben, doch ist von keiner ein Text überliefert. De Vere war ein hochgebildeter Mann, und seine Verse sind von achtbarer Qualität, doch nichts darin verrät auch nur einen Funken von Originalität und Genie. Im Übrigen starb er bereits 1604, bevor nach breitem Konsens der Wissenschaft Shakespeares gewichtigste Tragödien überhaupt geschrieben wurden. Das zwingt die Zweifler dazu, die gesamte, von einer zweihundertjährigen Forschungstätigkeit immer wieder überprüfte Chronologie der Werke über den Haufen zu werfen.
Vom Grafen Oxford ist übrigens eine pikante Anekdote überliefert. Der Büchersammler John Aubrey (1626–97) hatte unter seinen Papieren über 400 auf Hörensagen beruhende biographische Skizzen über Personen des 16. und 17. Jahrhunderts hinterlassen, die 1898 als Aubrey’s Brief Lives herausgegeben wurden. Dort ist zu lesen, dass dem Grafen Oxford, als er sich vor Königin Elisabeth verbeugte, ein Furz entfahren sei, worauf er sich aus Scham sieben Jahre lang vom Hofe fernhielt. Als er dann wieder erschien, habe die Königin ihn mit dem Satz begrüßt: «Den Furz hatte ich bereits vergessen.» Es ist eine Anekdote, die wie alle Anekdoten auf schwachen Füßen steht. Doch immerhin wurde sie weitererzählt, während es keinerlei Zeugnis über Oxfords Autorschaft der Shakespeareschen Dramen gibt.
Wer einen anderen «wahren» Shakespeare vorstellt, muss erst einmal zwingende Gründe nennen, weshalb der Schauspieler aus Stratford es nicht sein kann. Dessen Lebensstationen sind, mit Ausnahme der sogenannten «verlorenen Jahre» von 1585 bis 1592, Jahr für Jahr zuverlässig belegt. Von seinen Stücken kam zwar nur die Hälfte, zum Teil in nicht autorisierten Raubdrucken, zu seinen Lebzeiten unter seinem Namen auf den Buchmarkt, doch sieben Jahre nach seinem Tod erschien eine einbändige Gesamtausgabe, die von den beiden Schauspielern John Heminges und Henry Condell besorgt wurde und zu der berühmte Zeitgenossen wie Ben Jonson überschwängliche Gedichte zum Lob des Verfassers beisteuerten. In einer dieser Lobeshymnen wird ausdrücklich auf Shakespeares Grabmonument in Stratford verwiesen, woraus hervorgeht, dass die Herausgeber, die ja mit dem Dichter befreundet waren, an dessen Autorschaft keinen Zweifel hegten. Eindeutig von Shakespeare selber in Druck gegeben wurden nur seine beiden Versepen aus den Jahren 1593 und 1594, die er dem Grafen Southampton widmete. Hätte der Graf wohl die Widmung akzeptiert, wenn Shakespeare nur der Strohmann eines anderen Verfassers gewesen wäre? Ob die 1609 erschienene Ausgabe seiner Sonette von ihm selber autorisiert wurde, ist nicht gesichert, aber dass die Gedichte von einem William stammen, beweisen die Sonette, in denen der Dichter mit dem Namen Will absichtsvoll spielt. Alles in allem gibt es für Shakespeares Leben und Werk mehr zuverlässig belegte Daten als für die meisten seiner schreibenden Zeitgenossen. Wer seine Autorschaft bestreitet, muss deshalb erklären können, warum er es nicht sein kann, und weshalb ein anderer sich seines Namens bediente.
Der Ausgangspunkt für den Zweifel an der Autorschaft ist das, was der oben zitierte Eintrag aus dem Gelehrten-Lexikon nahelegt: Wie konnte ein «schlecht auferzogner» Schauspieler aus der Provinz, der kein Latein sprach und nur über ein «scherzhaftes Gemüt» verfügte, so kunstvolle und gedankenreiche Werke schaffen? Abgesehen davon, dass der Zweifel akademische Arroganz ausdrückt, beruht er auf drei großen Irrtümern. Der erste ist die Unterschätzung von Shakespeares Schulbildung. In Stratford gab es eine Lateinschule, die er mit hoher Wahrscheinlichkeit besucht hat, auch wenn es dazu kein Dokument gibt. Dort, wie an allen guten Grammar Schools jener Zeit, erwarb man erheblich bessere Lateinkenntnisse als an heutigen deutschen Gymnasien. Gute Schüler, die mit 15 Jahren die Schule verließen, konnten sich auf Latein unterhalten und hatten nicht selten in lateinischen Komödien von Plautus oder Terenz mitgespielt. Da die Naturwissenschaften wenig entwickelt waren, beschränkte sich der Lehrstoff weitgehend auf das, was man klassische Bildung nennt; und da in den Schulen ganztägig unterrichtet wurde, konnte ein beträchtliches Lernpensum bewältigt werden.
Der zweite Irrtum ist die Annahme, dass nur der Besuch einer Universität Shakespeare das große Bildungswissen vermittelt haben kann, das aus seinen Werken spricht. In seinem Fall gilt eher das Gegenteil. Diejenigen seiner Konkurrenten, die ein Universitätsstudium hinter sich hatten und die schon damals als university wits bezeichnet wurden, waren teils durch die klassischen Vorbilder, teils durch tradierte Geschmacksnormen in Stil und Darstellungsweise viel stärker auf Konventionen fixiert als ein Autor, der sich ausschließlich an der Wirkung auf das Publikum orientierte. Im Übrigen brauchte Shakespeare keine Universität, weil er in einer Stadt lebte, die schon von seinen Zeitgenossen als «dritte Universität Englands» bezeichnet wurde. Hier gab es nicht nur die vier bedeutendsten Rechtsschulen des Landes, sondern darüber hinaus Bildungseinrichtungen für fast alle Bereiche. Die Stadt war ein Schmelztiegel der intellektuellen Moderne, bereichert durch Immigranten vom Kontinent, die vor dem Druck der Gegenreformation und der physischen Bedrohung durch die spanische Besatzungsmacht aus den Niederlanden geflohen waren. Hier war ein freierer Austausch von Ideen möglich als an den Universitäten von Oxford und Cambridge, die unter kirchlicher Kontrolle standen. Wer glaubt, dass ein Schauspieler nicht fähig gewesen sein soll, sich selber geistig auszubilden, der sollte sich fragen, wie der schlesische Schuhmacher Jakob Böhme Gedanken niederschreiben konnte, die ihn zu einem Großen der deutschen Philosophie machten, und wie der Amsterdamer Linsenschleifer Benedictus de Spinoza eine rationalistische Philosophie entwickeln konnte, die ihn ebenbürtig neben Descartes und Leibniz stehen lässt. Dabei wäre bei diesen beiden eine akademische Schulung viel eher nötig gewesen als bei einem Dichter, dessen Kreativität auf angeborenem Genie beruht. Ein Autodidakt war auch Thomas Mann, der in seinem «anstößigen Lebenslauf» ironisch zerknirscht bekennt, nicht einmal das Abitur geschafft zu haben. Im Vergleich mit seinen Altersgenossen hatte er wahrscheinlich eine schlechtere Schulbildung als Shakespeare.
Der dritte Irrtum beruht auf der stillschweigenden Annahme, dass ein Schauspieler nur das reproduktive Medium für Texte sei, die von kreativeren Köpfen außerhalb der Bühne produziert wurden. Das entspricht der späteren Praxis, doch für Shakespeare gilt es ebenso wenig wie für die großen Dramatiker des antiken Athen. Man stelle sich einmal vor, Schiller wäre ein begabter Schauspieler gewesen und hätte damit seinen Lebensunterhalt verdient. Spricht nicht alles dafür, dass seine Stücke dann reicher, bunter und psychologisch glaubwürdiger geworden wären? Er hätte seinen Charakteren dann nicht nur die eigenen Ideen in den Mund gelegt, sondern wäre in ihre Rollen geschlüpft und hätte sie das sagen lassen, was ihrem Charakter entsprach. Genau das tat Shakespeare, und eben das zeichnet ihn vor Marlowe und den anderen aus. Als Schauspieler konnte er sich in edelmütige Helden wie in Schurken, in Weise wie in Narren, in von Vernunft geleitete Denker wie in leidenschaftliche Täter hineinversetzen, und er konnte sich sogar wie kein anderer in Frauen einfühlen, die damals auf der Bühne von Knaben gespielt wurden. An dichterischer Sprachkraft stand ihm Marlowe nicht nach, doch der war kein Schauspieler, dafür aber geistig auf der Höhe der Zeit und kannte seinen Machiavelli. Deshalb spricht aus seinen Haupthelden nur der Machiavellist. Aus Shakespeares Bühnenpersonal spricht ein vielstimmiger Chor, in dem fast alle menschlichen Regungen und alte wie neue Weltsichten hörbar werden.
Im Fall des Kandidaten Oxford kommt ein vierter Irrtum hinzu, nämlich die Annahme, dass es für einen Aristokraten ehrenrührig gewesen wäre, Dramen zu schreiben, weshalb er es unter einem Pseudonym habe tun müssen. Nun weiß man zwar, dass beim Hochadel Gedichte und Versepen in Buchform höher geschätzt wurden als Dramen, die vor einem buntgemischten Publikum aufgeführt wurden, doch dass es standeswidrig gewesen sein soll, fürs Theater zu schreiben, geht an der elisabethanischen Wirklichkeit vorbei. Die Bühnen der Zeit wurden allesamt von Truppen bespielt, die die Livree eines aristokratischen Patrons trugen, der dafür viel Geld ausgab und stolz auf seine Truppe war. Weshalb sollte sich dann ein Aristokrat geschämt haben, eigene Stücke aufführen zu lassen? Der Graf Oxford hatte es ja mit Komödien versucht. Auch der Aristokrat Fulke Greville, der spätere Lord Brooke, schrieb Stücke. Doch da er keine Bühnenerfahrung hatte, blieben es Lesedramen. Aristokratischer Standesdünkel war in England weniger ausgeprägt als auf dem Kontinent, was vor allem damit zusammenhängt, dass die jüngeren Söhne des Hochadels den Status von Bürgerlichen hatten und den Titel, wenn überhaupt, erst spät und nur durch Zufall erbten. Wenn der Graf Oxford, der sich nicht scheute, unter seinem richtigen Namen Verse von durchschnittlicher Qualität zu publizieren, das Dramenschreiben für nicht standesgemäß hielt, hätte er zumindest die beiden Versepen Venus und Adonis und Die Schändung der Lukrezia, die 1593 bzw. 1594 unter Shakespeares Namen erschienen, unter seinem eigenen herausgebracht, denn auf diese Art von Dichtung wäre damals jeder Aristokrat stolz gewesen. Stammen die beiden Werke aber von dem Schauspieler William Shakespeare, der just zu der Zeit arbeitslos war, weil die Theater wegen der Pest geschlossen waren, dann gibt es keinen Grund, an seiner geistigen Potenz zu zweifeln, denn in diesen Werken hat er außer seinem sprachlichen Genie auch noch klassische Bildung bewiesen.
Der wahre Grund des Zweifels an Shakespeare ist aber gar nicht seine vermeintlich fehlende Bildung, sondern das weit verbreitete Interesse an Verschwörungstheorien. Es scheint in der Natur des Menschen zu liegen, dass er einem Glauben mehr vertraut als wissenschaftlich gesichertem Wissen, denn das Wesen der Wissenschaft besteht darin, eine Erkenntnis immer nur unter dem Vorbehalt ihrer möglichen Falsifizierung für wahr zu halten, während ein Glaube keinen Zweifel zulässt. Hat man sich erst einmal zu ihm bekehrt, ist er durch nichts zu widerlegen. Das ist der Grund, weshalb alle Glaubenssysteme immun gegen den Zweifel sind. Wird der Glaube nur von einer kleinen Gruppe geteilt, kommt ein weiteres Moment hinzu: dann ist man ein Eingeweihter, was subjektiv als statuserhöhend erlebt wird. Immerhin haben selbst die abwegigsten Verschwörungstheorien oft positive Nebeneffekte. Was beispielsweise Kurt Kreiler und Bastian Conrad zugunsten ihres jeweiligen Favoriten ins Feld führen, mag wenig überzeugend sein, doch Anerkennung gebührt ihnen für das Verdienst, mit großem Forschungsaufwand in Nischen der elisabethanischen Gesellschaft und Kultur geleuchtet zu haben, die sonst wohl im Dunkel geblieben wären.
ISHAKESPEARESENGLAND
Eliza Triumphans. Kupferstich von William Roger (1589)
Verspätete Renaissance
In Literaturgeschichten wird die Shakespearezeit gewöhnlich als englische Renaissance bezeichnet. Das scheint dem kontinentalen Gebrauch dieser Epochenbezeichnung zu widersprechen, denn in Italien, dem Mutterland des rinascimento, war es das 15. Jahrhundert, das als quattrocento zum Inbegriff dieser «Wiedergeburt» der antiken Kultur aus dem Geist des neuzeitlichen Humanismus wurde. Als das Ende der italienischen Renaissance gilt allgemein das Jahr 1527, in dem die kaiserlichen Truppen Rom plünderten. Die Stilepoche nach diesem sacco di Roma wird in Kunstgeschichten meist als Manierismus bezeichnet. Insofern wäre die Shakespearezeit aus kontinentaleuropäischer Sicht eher dem Manierismus und in den letzten Jahren sogar dem frühen Barock zuzuordnen. Die Bezeichnung Renaissance ist dennoch berechtigt, denn auch England erlebte eine kulturelle Wiedergeburt, allerdings mit Verspätung: Das quattrocento hatte es bis zum Jahr 1453 mit der zweiten Hälfte des Hundertjährigen Kriegs gegen Frankreich verbracht. Nach nur zwei Friedensjahren folgten die 30 Jahre währenden Rosenkriege, in denen die beiden Zweige aus dem Königshaus der Plantagenets – das Haus Lancaster mit der roten Rose und das Haus York mit der weißen im Wappen – einen blutigen Kampf um die Thronfolge führten. Anders als beim Hundertjährigen Krieg wurden diese Kämpfe auf englischem Boden ausgetragen, was zum wirtschaftlichen Ausbluten des Landes und zu einer Dezimierung des Hochadels führte. Der letzte Plantagenet, Richard III. aus dem Haus York, der den Thron gewaltsam usurpiert hatte, wurde 1485 in der Schlacht von Bosworth von Henry Richmond aus dem Haus Tudor besiegt, der als Heinrich VII. den englischen Thron bestieg.
Dieser Sieg markiert den Beginn der englischen Renaissance, in deren Verlauf das Land drei Aufgaben zu bewältigen hatte. Politisch musste die neue Dynastie, die ihren Thronanspruch nur über eine weibliche Linie geltend machen konnte, ihre Legitimität sichern. Ökonomisch ging es um die Wiederbelebung der Wirtschaft, und kulturell musste ein Rückstand von fast hundert Jahren aufgeholt werden. Doch politisch und gesellschaftlich war England dem Kontinent weit voraus; denn es befand sich bereits auf dem Weg zu einer horizontaleren Ordnung, in der die Mittelschicht zunehmendes Gewicht erlangte.
Die mittelalterliche Feudalgesellschaft war im Weltlichen wie im Kirchlichen streng hierarchisch geordnet und blieb es auf dem Kontinent, wo der Feudalismus in den Absolutismus überging, noch für lange Zeit. In England aber hatte das vertikale System in der Mitte des 14. Jahrhunderts einen Schlag bekommen, der eine unaufhaltsame Horizontalisierung einleitete. Der Auslöser war die große Pest der Jahre 1348/49. Diese Epidemie hatte über ein Drittel der Bevölkerung hinweggerafft und ganze Teile des Landes entvölkert. Das hatte weitreichende Folgen. Als erstes entspannte sich die bis dahin prekäre Ernährungslage. Die sinkende Nachfrage nach Brotgetreide bewirkte, dass früheres Ackerland in Schafweide umgewandelt und damit die Wollproduktion mit den nachgeordneten Gewerbezweigen angekurbelt wurde. Zugleich entspannte sich auch der Arbeitsmarkt, denn die Fronarbeit der Leibeigenen war nun für die Grundherren nicht mehr so wichtig. Es war ökonomischer, je nach Bedarf Tagelöhner einzustellen. Damit begann sich das alte System der Grundherrschaft aufzulösen. Aus Leibeigenen wurden freie Pächter, Tagelöhner und Arbeiter in kleinen Manufakturen, eine Entwicklung, die auf dem Kontinent erst im 19. Jahrhundert zum Abschluss kam.
Die Auflösung der Feudalordnung, die sich als gesellschaftliches Phänomen in dem von Wat Tyler angeführten Bauernaufstand von 1381 ankündigte, fand ihre ideologische Entsprechung in der um die gleiche Zeit von Wiclif ausgehenden religiösen Reformbewegung. Wiclifs Anhänger, die sogenannten Lollarden, waren eine Hefe, die in England ein Jahrhundert vor Luther den Boden für die Reformation bereitete. Allerdings bewirkten sie zunächst das Gegenteil, denn als Unruhestifter wurden sie lange Zeit verfolgt und dienten der Legitimation von harten Repressionsmaßnahmen. Auch wenn sie wegen dieser Unterdrückung so gut wie nichts zur späteren Reformation beitrugen, sind sie ein Symptom für den beschriebenen Horizontalisierungsschub. Einer von Wiclifs Anhängern wurde unter anderem Namen durch Shakespeare unsterblich. Es ist Sir John Oldcastle, das historische Vorbild für Falstaff, der bis zur Reformation als Staatsfeind galt und dann als erster Märtyrer der Reformation angesehen wurde. Während Wiclifs Reformanstoß in England erst einmal zum Stillstand kam, sorgte ein Zufall dafür, dass der Bazillus auf den Kontinent übersprang. Als nämlich 1294 Anna von Böhmen, die Gemahlin Richards II., starb, kehrte der Tross böhmischer Geistlicher, der mit ihr nach England gekommen war, in die Heimat zurück und trug dort mit Wiclifs Ideen zu einer Bewegung bei, die in Jan Hus ihren Anführer fand.
Bis zur Entdeckung Amerikas war England ein Staat an der Peripherie Europas. Zur See dominierte die deutsche Hanse, und zu Lande war England zu weit entfernt von den europäischen Handelszentren, als dass es mit der aufblühenden Stadtkultur des Kontinents hätte Schritt halten können. Auch kulturell hatte es ein Handicap wettzumachen, denn nach der normannischen Eroberung hatte es für gut ein Jahrhundert seine Sprache verloren und musste sich eine neue durch die Verschmelzung des Angelsächsischen mit dem Französischen schaffen. Das alles, zusammen mit den genannten politischen Ereignissen, erklärt Englands Rückstand. Auf der anderen Seite war die Insel aber auch weit entfernt von Rom, so dass sich hier das aufklärerische Denken viel früher von der kirchlichen Bevormundung emanzipieren konnte. Zudem war England seit der normannischen Eroberung von 1066 dank der klugen Realpolitik Wilhelms des Eroberers ein Zentralstaat; und dank der ebenso weitsichtigen Politik Eduards I. hatte es seit 1295 ein Parlament, in dem bereits alle Stände – Hochadel, Klerus, niederer Adel und Städte – repräsentiert waren. Das wiederum erklärt, wie schnell die Briten den Rückstand aufholten und unter Elisabeth I. zum Sprung an die Spitze ansetzten.
Aufstieg der Gentry
Die Rosenkriege hatten den Hochadel so stark dezimiert, dass im ersten Parlament Heinrichs VII. von den 53 Peers, die zu Beginn der Kriege im Oberhaus saßen, nur noch 18 übrig waren. Das ebnete den Weg für den Aufstieg des Unterhauses. Es ist eine Besonderheit der Geschichte Englands, dass sich der als Gentry bezeichnete niedere Adel und die Vertreter der Städte schon früh zu einer Interessenallianz zusammengeschlossen hatten. Bereits im model parliament von 1295, das Eduard I. einberief, waren beide Gruppen vertreten. Im Verlauf des 14. Jahrhunderts wurde es Brauch, dass sie sich in einem eigenen Haus, dem house of commons, trafen. Hier repräsentierten Mitglieder der Gentry als Abgesandte der Grafschaften die Fläche, während die Vertreter der Städte das ökonomische Gewicht der reichen Bürger einbrachten. In den ersten Jahrhunderten, in denen England noch ein ausgeprägtes Agrarland war, hatten die Vertreter der Grafschaften das Sagen. Doch mit zunehmender Bedeutung von Handel und Gewerbe stieg auch das politische Gewicht der Städte, die sich anfangs noch oft durch Angehörige des niederen Adels vertreten ließen, denn Mitglieder des Parlaments erhielten keine Diäten, so dass es für Kaufleute ökonomisch von Nachteil war, ihre Arbeitszeit in die Politik zu investieren, wohingegen die Landadligen ohne eigene Arbeit von den Pachterträgen ihrer Ländereien lebten.
Welche Bedeutung das Unterhaus unter Elisabeth erlangt hatte, lässt sich daran ablesen, dass die Königin ihre wichtigsten Berater nicht aus dem Hochadel, sondern aus der Gentry holte. Unter ihrem Vater Heinrich VIII. hatte sich der aus einfachen Verhältnissen zum Ersten Sekretär des Staates aufgestiegene Thomas Cromwell noch den Hass des Hochadels zugezogen, was seinen Sturz mit anschließender Exekution zur Folge hatte. Demgegenüber hatte der aus der Gentry stammende William Cecil, Elisabeths engster Berater und vierzig Jahre lang ihr informeller Regierungschef, trotz zeitweiliger Anfeindungen einen gesicherten Stand. Er wurde 1571 als Lord Burghley in den Adelsstand erhoben und blieb bis zu seinem Tod im Amt, das 1598 auf seinen zweiten Sohn Robert überging, den Jakob I. 1605 zum Viscount Salisbury adelte. Auch Elisabeths zweiter Staatssekretär, Sir Francis Walsingham, der als Organisator eines gut funktionierenden Geheimdienstes große Macht hatte, kam aus der Gentry, ebenso Christopher Hatton, der in den kritischen Jahren 1587 bis 1591, in denen mit der Hinrichtung Maria Stuarts und dem Angriff der Spanischen Armada viel auf dem Spiel stand, das Amt des Lordkanzlers innehatte. Weitere einflussreiche Vertreter des niederen Adels waren Sir Thomas Gresham, der Gründer der Royal Exchange und zeitweilig der heimliche Finanzminister des Landes, sowie zwei der drei Hauptverantwortlichen für den Sieg über die Armada, Sir John Hawkins und Sir Francis Drake, die nur noch den aus dem Hochadel stammenden Admiral Charles Howard, Graf Nottingham, über sich hatten.
Elisabeth in ihrem Parlament. Zeitgenössischer Stich (Ausschnitt)
William Cecil. Porträt von oder nach Arnold van Brounckhorst (ca. 1560–1570)
Elisabeth ließ den niederen Adel zwar deutlich spüren, dass er unter ihr stand und dass sie nur mit Hochadligen auf Augenhöhe verkehrte, doch sie benutzte ihn geschickt als Gegengewicht zu den mächtigen Lords. Im Übrigen war sie aber bestrebt, möglichst ohne Parlament auszukommen. In ihren 45 Regierungsjahren berief sie es nur 13mal ein, und die gesamte Sitzungsdauer aller 13 Parlamente belief sich auf weniger als zweieinhalb Jahre. Dennoch gewann unter ihr das Unterhaus die politische Initiative. Wenn es um Steuererhebungen ging, war die Krone auf die Zustimmung der Commons angewiesen; und in Rechtsfragen machte sich das Unterhaus zum Sachwalter des Common Law gegenüber dem Billigkeitsrecht (equity), das im Namen der Krone vom Lordkanzler ausgeübt wurde. Für Kontinentaleuropäer ist diese Konkurrenz zweier Rechtssysteme schwer zu verstehen. Sie hatte sich schon im Hochmittelalter ausgebildet und wurde erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts aufgehoben, als Common Law und Equity ohne inhaltliche Änderungen unter einem gemeinsamen Dach vereint wurden. Hier mag die Feststellung genügen, dass das Parlament in dem ungeschriebenen Gewohnheitsrecht des Common Law die Interessen des Volkes vertreten sah, während das am Römischen Recht und dem Kirchenrecht orientierte Billigkeitsrecht des königlichen Kanzleigerichtshofs vom Lordkanzler abhing, der der Krone direkt unterstand. Der Jurist John Selden (1584–1654) prägte den vielzitierten Satz, dass das Maß für ein Billigkeitsurteil «die Fußlänge des Lordkanzlers» sei.
Reformation
Als Elisabeth den Thron bestieg und gleich darauf die Rückkehr zum Protestantismus anordnete, bedeutete das für die englische Bevölkerung den dritten Religionswechsel in einem Vierteljahrhundert. 1534 hatte ihr Vater Heinrich VIII. den Bruch mit Rom vollzogen und sich mit der Suprematsakte zum Oberhaupt der englischen Staatskirche gemacht. Auf theologischem Gebiet beschränkte er sich auf geringfügige Änderungen. Heinrich hasste Martin Luther und veränderte deshalb an der kirchlichen Liturgie wenig. Er schaffte eine Reihe von Feiertagen ab, die mit Reliquienverehrung zu tun hatten, und verbot den Verkauf von Ablassbriefen und Totenmessen, ließ aber den größten Teil des religiösen Rituals beim Alten. Die von ihm erlassenen sechs Glaubensartikel, von den Calvinisten als «sechsschwänzige Peitsche» bezeichnet, entsprachen weitgehend der römisch-katholischen Lehre. Der harte Kern der protestantischen Bewegung kam erst in den sechs Regierungsjahren von Heinrichs Sohn Eduard VI. zum Zuge, der als Neunjähriger den Thron bestieg. Eduard, der ab seinem 6. Lebensjahr von seinem Tutor Sir John Cheke und anderen Lehrern eine protestantische Erziehung genossen hatte, war als König ein Spielball in der Hand seines Onkels Edward Seymour, des Herzogs von Somerset, der das Amt des Reichsprotektors ausübte. In seiner Regierungszeit nahm die englische Staatskirche immer mehr protestantische Positionen auf, was sich in den 1553 verabschiedeten 42 Glaubensartikeln ausdrückt.
Im gleichen Jahr kam es zu einer abrupten Kehrtwende, als Eduard starb und – nachdem die vom protestantischen Lager auf den Thron gebrachte Urenkelin Heinrichs VII., Jane Grey, nach neun Tagen wieder abgesetzt und exekutiert worden war – Heinrichs VIII. katholische Tochter Maria auf den Thron folgte. Die von ihr betriebene Rekatholisierung des Landes nahm schon bald blutige Formen an und brachte rund 300 Menschen auf die Scheiterhaufen. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass sie mit dem Blut dieser Märtyrer den Boden für den Calvinismus in England düngte. Denn erst die vor ihr geflohenen Protestanten, die in Genf und anderen Zentren der Reformation Zuflucht gesucht hatten und dort mit den Lehren Calvins bekannt wurden, kehrten als radikale Puritaner zurück, als 1558 nach dem Tod von Bloody Mary ihre protestantische Halbschwester den Thron bestieg. Elisabeth erneuerte nach einigem Zögern 1559 die Suprematsakte, durch die sie Oberhaupt der Staatskirche wurde, und ebenso die Uniformitätsakte, die jedem Bürger das Bekenntnis zur anglikanischen Staatsreligion abverlangte. 1563 ersetzte sie aber die calvinistisch gefärbten 42 Artikel durch 39 moderatere und schloss damit ab, was in der späteren Geschichtsschreibung als Elizabethan Settlement bezeichnet wird.
In ländlichen Regionen – darunter auch die Grafschaft Warwickshire, aus der Shakespeare stammte – hatte der alte Katholizismus bis zum Ende des Jahrhunderts noch zahlreiche Anhänger, auch wenn die meisten ihren Glauben wegen der drohenden Strafen nicht offen bekannten. 1569 kam es im Norden, wo bereits unter Heinrich VIII. in den Jahren 1536 und 1537 eine pro-katholische Rebellion gewaltsam unterdrückt werden musste, zu einem Aufstand. Die Rebellen hofften auf die Unterstützung durch den spanischen Statthalter in den Niederlanden, doch sie wurden besiegt und 800 von ihnen wurden gehängt. Mit der Exekution Maria Stuarts im Jahre 1587, in der die Katholiken ihre rechtmäßige Königin sahen, verlor die antiprotestantische Bewegung buchstäblich ihren Kopf. Als im Jahr darauf der spanische König Philipp II., der verwitwete Ehemann Marias der Blutigen, seine Armada gegen England schickte, waren selbst die meisten Altgläubigen patriotisch genug, sich über den Sieg der eigenen Nation zu freuen.
Das Wort puritan, das auch bei Shakespeare auftaucht, ist im englischen Schrifttum erstmalig 1572 belegt. Es entstand als abwertende Bezeichnung für radikale Protestanten, denen die elisabethanische Kirchenreform nicht weit genug ging und die eine ‹Reinigung› (purification) der christlichen Lehre von allem forderten, was nicht durch die Bibel zu rechtfertigen sei. Dieses radikale Reformprogramm geht auf den Schweizer Reformator Calvin zurück, dem die moderate Reformation durch Luther zu halbherzig war. Der calvinistische Protestantismus unterschied sich von den verschiedenen Spielarten des lutherischen vor allem in drei Punkten: Er lehnte die hierarchische Struktur der Bischofskirche ab, er forderte die kirchliche Selbstverwaltung der Gemeinden und vertrat die sogenannte Prädestinationslehre. Die beiden ersten Punkte bewirkten, dass die Puritaner zur Speerspitze einer egalitären Bewegung wurden, die den Boden für die spätere Demokratie bereitete. Beim zweiten Punkt war der calvinistisch geprägte schottische Presbyterianismus, der dort zur Staatskirche wurde, moderater, da er eine Hierarchie von gewählten Kirchengremien vorsah, während die radikaleren englischen Puritaner auf der Priesterschaft aller Gläubigen beharrten und für jede Gemeinde (congregation) Autonomie forderten, weshalb sie auch als congregationalists bezeichnet werden.
Für Nicht-Puritaner am schwersten zu verstehen ist der Glaube an die Prädestination. Was bewog Menschen dazu zu glauben, dass Gott schon im Moment der Schöpfung vorherbestimmt hat, wen er für den Himmel erwählt und wen zur Hölle verdammt hat? Müsste solch ein Glaube nicht zu einem apathischen Fatalismus führen? Tatsächlich führte er aber zu einem höchst energischen Aktivismus, denn jeder Puritaner war bestrebt, schon im irdischen Leben Beweise für seine Erwähltheit zu finden. Als solche sah man neben einem moralisch makellosen Lebenswandel vor allem ökonomischen Erfolg an: Weshalb sollte Gott einen Menschen mit Erfolg segnen, den er für die Hölle bestimmt hat? Diese seltsam paradoxe Sicht hatte langfristig zwei folgenreiche Auswirkungen. Zum einen machte sie alle Menschen gleich, da jeder in der gleichen Ungewissheit bezüglich seiner Erwähltheit lebte, zum andern war sie ein Ansporn, sich durch Erfolg vor allen anderen auszuzeichnen. Es kann daher kaum verwundern, dass die Puritaner, die 1620 auf der Mayflower nach Amerika kamen und dort die erste Siedlergesellschaft aufbauten, die beiden charakteristischen Merkmale der amerikanischen Gesellschaft begründeten: das demokratische Insistieren auf absoluter Gleichheit und die tief verinnerlichte Wettbewerbsideologie.
Unter Elisabeth blieben die Puritaner eine Art Hefe, die den gesellschaftlichen Teig zur Gärung brachte, aber noch keine wirkliche Macht ausüben konnte. Unter Jakob I., der aus dem calvinistisch geprägten Schottland kam, spitzte sich der Konflikt zwischen den konservativ-hochkirchlichen und den fortschrittlich-puritanischen Kräften zu; unter Karl I. führte er schließlich zum Bürgerkrieg. Von einer solchen Bedrohung ahnte zu Shakespeares Zeiten kaum einer etwas, obgleich auch hier schon der Konflikt offen zu Tage trat. Vor allem die Theaterleute bekamen ihn zu spüren, denn die Puritaner, die schon früh in der Londoner Stadtverwaltung das Sagen hatten, duldeten innerhalb der Stadtmauern keine Theater, teils aus moralischen Gründen, teils weil sie darin Unruheherde sahen. Noch auf eine andere Weise wirkte sich der Puritanismus in der Kultur aus. Zwar missbilligten die Puritaner jede Art von Vergnügen um des Vergnügens willen und standen infolgedessen der ästhetischen Kultur, also den Künsten, eher ablehnend gegenüber. Da sie aber bei der Suche nach Erwähltheitsbeweisen nicht nur auf äußerliche Erfolge, sondern auch in ihre Seelen schauten, entwickelte sich unter ihrem Einfluss eine Tendenz zur Introspektion, die zu einer zunehmenden Psychologisierung vor allem der Literatur führte. In großem Stil machte sich das erst im 17. Jahrhundert bemerkbar, aus dem über 200 «spirituelle Autobiographien» überliefert sind, in denen die Verfasser sich Rechenschaft über ihren Seelenzustand ablegen. Doch die 14 autobiographischen Tagebücher aus dem 16. Jahrhundert lassen bereits die Tendenz erkennen und machen verständlich, weshalb die Elisabethaner so begierig auf das Theater waren: Dort konnte man den Charakteren in die Seele schauen.
Titelblatt der Great Bible (1539)
Titelblatt von John Foxes Actes and Monuments (1563)
Die Reformation hatte – auf dem Kontinent wie in England – zum ersten Mal das kirchliche Monopol auf Bibellektüre und -exegese gebrochen und dem Laienpublikum durch Bibelübersetzungen in die Volkssprache den Zugang zur Heiligen Schrift eröffnet. Was Luther für die Deutschen, taten William Tyndale und Miles Coverdale, anfangs noch gegen große Widerstände, für die Engländer. Auf der Basis ihrer Übersetzung, die sich beim Alten Testament auf die Luthersche stützte, entstand die erste, von Heinrich VIII. autorisierte Bibel, die 1539 herauskam und wegen ihrer Größe als Great Bible bezeichnet wurde. Sie blieb bis zum Erscheinen der Authorised Version von 1611 der von der Kirche anerkannte Text und übte dank der zunehmenden Lesefähigkeit der Bevölkerung nachhaltigen Einfluss auf Wortschatz, Denkformen und Inhalte der englischen Kultur aus. Noch stärkeren Einfluss sollte wenig später, nach dem Ende von Marias Rekatholisierungsversuch, John Foxes Buch Actes and Monuments haben, das 1559 auf Latein und 1563 auf Englisch erschien. Das Buch, das bald nur noch mit dem Titel Book of Martyrs bezeichnet wurde, erzählt das Martyrium der standhaften Protestanten, die unter Maria verbrannt worden waren.
Eine andere, folgenschwere Auswirkung der Reformation war die Auflösung der Klöster, mit der die größte Landtransaktion auf der Insel seit der normannischen Eroberung einherging. Heinrich VIII. brauchte Geld, um gegen einen möglichen Angriff der katholischen Kontinentalmächte gerüstet zu sein. Da er auf den Papst keine Rücksicht mehr nehmen musste, waren die Klöster für ihn eine leichte Beute. Beraten von seinem Kanzler Cromwell ließ er 1535 eine Bestandsaufnahme aller Klöster nach ihrer Wirtschaftskraft vornehmen. Im Jahr darauf konfiszierte er die Häuser mit Einkünften unter 200 Pfund. Vier Jahre später enteignete er auch die übrigen Klöster und warf ihre Ländereien auf den Markt. Das bot reich gewordenen Kaufleuten die Möglichkeit, Landbesitz zu erwerben und damit den sozialen Status der landed gentry zu erreichen, die bis dahin über ihnen stand. Dadurch gewann die im Unterhaus vertretene Gentry weiter an Macht. Auch im Oberhaus veränderten sich die Gewichte. Durch das Verschwinden der Äbte, die dort Sitz und Stimme hatten, waren jetzt die weltlichen Lords in der Mehrheit.
Neben der Stärkung der oberen Mittelschicht im Parlament bewirkte die Umverteilung des Landes eine ökonomischere Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen. Da die neuen Besitzer darin investiertes Kapital sahen, das Profit abwerfen sollte, kam es zu einem positiven Schub für das Bruttoinlandsprodukt. Für die Landbevölkerung hatte die Auflösung der Klöster dagegen eine verhängnisvolle Auswirkung, denn diese Häuser hatten bis dahin die Hauptlast der Armenfürsorge getragen. Jetzt mussten die Gemeinden diese Aufgabe übernehmen. Da sie dies teils nicht konnten, teils nur widerwillig taten, kam es zu ernsten Versorgungsproblemen. Um zu verhindern, dass Armutswanderungen das Gefüge der Gesellschaft erschütterten, wurde bereits 1536 ein Gesetz erlassen, das für arbeitsfähige Arme eine allgemeine Arbeitspflicht einführte. Weitere Armengesetze folgten in den Jahren 1552, 1563 und 1597, bis schließlich 1601 eine umfassende gesetzliche Regelung eingeführt wurde, die bis 1834 fortbestand. Das Gesetz zwang die Gemeinden, eine Armensteuer zu erheben und dafür zu sorgen, dass arbeitsfähige Arme Arbeit bekamen und Kranke und Gebrechliche versorgt wurden. Es war ein Sozialgesetz, das lange Zeit in Europa einzigartig war und zu den großen sozialpolitischen Leistungen des elisabethanischen Zeitalters gezählt werden muss. Sein Nachteil war allerdings, dass es die Armen an die für sie zuständige Heimatgemeinde band und damit verhinderte, dass sie sich dort Arbeit suchten, wo es welche gab, was später während der Industriellen Revolution zu einem gravierenden Problem wurde. Aber auch in der elisabethanischen Zeit konnte das Gesetz nicht verhindern, dass eine wachsende Zahl von Menschen die ländlichen Gemeinden verließ und sich Arbeit in den Städten suchte, was wiederum durch Gesetze gegen Landstreicherei eingedämmt werden musste. Die Landflucht verstärkte die soziale Mobilität und führte zu einer Aufweichung des Zunftzwangs und damit zu freierem Wettbewerb, was dem puritanischen Denken entgegenkam.
Auf kulturellem und religiösem Gebiet wirkte sich das Verschwinden der Klöster weit weniger stark aus. Die meisten Häuser waren bereits auf einen Bestand von weniger als zehn Mitglieder gesunken, und die größeren hatten ihr religiöses Ethos und ihre kulturelle Kreativität weitgehend verloren. Seit Erfindung des Buchdrucks waren auch die Schreibstuben überflüssig, so dass die Klöster kaum noch etwas zur Kultur beitrugen. Im Bewusstsein der Bevölkerung blieb aber das Mönchswesen präsent, allerdings weniger das klösterliche als das der Bettelmönche, der friars. Sie lebten nicht in abgelegenen Klöstern, sondern mitten in den Städten, wofür damals wie heute die Namen ihrer Kapellen und Unterkünfte Zeugnis ablegen. Auf dem Gelände der black friars (Dominikaner) in London entstand zu Shakespeares Zeiten das Blackfriars theatre, an dem er selber Anteile erwarb; und auf dem der white friars (Karmeliter) vor den Mauern der Stadt stand ebenfalls ein Theater. Da für die Gebäude und Ländereien der ehemaligen Klöster auch nach ihrer Auflösung die kirchliche Rechtshoheit fortbestand, lagen sie außerhalb der Jurisdiktion der Stadtverwaltung, so dass sie dem Zugriff der theaterfeindlichen puritanischen Stadtväter entzogen waren.
Wirtschaft
Dem Aufstieg Englands ging ein Jahrhundert voraus, in dem Spanien und Portugal nach der Entdeckung Amerikas den mittleren und südlichen Teil der Neuen Welt zuerst ausplünderten und bald darauf kolonisierten. Die Konquistadoren beider Nationen raubten unvorstellbare Mengen an Gold und Silber und brachten sie in ihre Länder, was für diese aber kein Segen war. Statt eine heimische Industrie aufzubauen, verließ man sich hier auf den ununterbrochenen Zustrom der Edelmetalle und benutzte sie als Zahlungsmittel für importierte Fertigwaren, mit der Folge, dass Spanien gegen Ende des 16. Jahrhunderts hoch verschuldet war. England war zu der Zeit ein vergleichsweise armes Land, doch es hatte ein Gold, das mit Zins und Zinseszins nachwuchs: die Wolle. Schafzucht hatte es hier bereits im Hochmittelalter gegeben, zum dominanten Wirtschaftsfaktor wurde sie aber erst nach der Großen Pest von 1348/49, als weite Landstriche entvölkert waren, so dass aus Mangel an Arbeitskräften und wegen fehlender Nachfrage nach Brotgetreide große Teile der Ackerflächen in Schafweide umgewandelt wurden. Anfangs exportierte England Rohwolle in die hochentwickelten Niederlande, wo sie gesponnen, gewebt und gefärbt wurde. Mit der Zeit wurde aber die Verarbeitung mehr und mehr von der heimischen Bevölkerung übernommen. Während das Spinnen in Heimarbeit erfolgte, wurde das Weben schon früh in fabrikähnlichen Manufakturen ausgeführt. Die kurze, feingekräuselte Wolle der Schafe auf den englischen Hügeln eignete sich vorzüglich dazu, die daraus gewebten Stoffe durch ein spezielles Walkverfahren in ein sehr strapazierfähiges Tuch zu verwandeln, das als broadcloth in ganz Europa begehrt war. Nur zum Färben wurden die Tuche noch für längere Zeit nach Flandern gebracht, bis schließlich auch das in England erfolgte.
Zu Shakespeares Lebzeiten gab es überall in England fabrikähnliche Manufakturen, in denen Stoffe gewebt und von Walkmühlen zu broadcloth verarbeitet wurden. An der Hierarchie der Zünfte lässt sich ablesen, welche Bedeutung die Textilwirtschaft damals hatte. Die Mercers, die seit dem Hochmittelalter für den Handel mit hochwertigen Tuchen aus Wolle und Seide zuständig waren, nahmen den höchsten Rang ein. Ihnen folgten die Grocers, die den Handel mit Gewürzen und importierten Nahrungsmitteln kontrollierten. An dritter Stelle standen die Drapers, die Wollfabrikanten. Es folgten Fischhändler, Goldschmiede, Lederhersteller, Schneider, Kurzwarenhändler, Salzhersteller, Eisenwarenerzeuger, Weinhändler und die Tuchbearbeiter. Diese Auflistung zeigt, wie differenziert das vorindustrielle Manufakturwesen in England bereits war. Während die dichter besiedelten Länder des Kontinents ihre landwirtschaftliche Nutzfläche für die Ernährung der Bevölkerung brauchten, konnte England einen Teil davon für den Rohstoff der Wollindustrie einsetzen.
Mit der ökonomischeren Nutzung der Agrarflächen kam das Problem der enclosures (‹Einhegungen›) auf, an dem sich bis ins 18. Jahrhundert der Volkszorn entzündete. Um seine Bedeutung zu verstehen, muss man wissen, wie Landwirtschaft unter dem Feudalsystem betrieben wurde. Dass ein Bauer sein eigenes Land bestellte, galt damals nur für die kleine Zahl der Freibauern, die als yeomen den höchsten Status gleich unterhalb des niederen Adels genossen. Die große Masse der Bauern bestand ursprünglich aus Leibeigenen, die zum manor, dem Grundbesitz eines Feudalherrn, gehörten. Die kleinste Wirtschaftseinheit eines Manors war das Dorf, das neben der Weidefläche, der Allmende, in der Regel drei große Felder besaß, von denen immer eines zur Erholung brachlag, während die beiden anderen für Wintersaat und Sommersaat genutzt wurden. Auf diesen Feldern war anfangs jedem Bauern ein Streifen zugeteilt, der durch eine Furche abgetrennt war. Da aber kein einzelner Bauer die sechs bis acht Ochsen halten konnte, die zum Pflügen nötig waren, mussten die Zugtiere aller Bauern zusammengespannt und die Felder kommunal bewirtschaftet werden. Das Anrecht auf die Streifen konnte verkauft und vererbt werden. Deshalb gab es mit der Zeit erfolgreiche Bauern, die größere Anteile an den Feldern hielten, während andere ihre Streifen verloren hatten, aber weiterhin die Allmende und die Stoppelfelder nach der Ernte für ihr Vieh nutzen durften. Eigentümer des Landes war aber der Grundherr. Als sich nach der Großen Pest die alte Feudalordnung aufzulösen begann, wurden aus den Leibeigenen Pächter, wobei die Rechtstitel für die von ihnen genutzten Streifen sehr unterschiedlich sein konnten. Je nachdem, was in den Dokumenten des Manors festgelegt war, hatten einige einen unbefristeten Anspruch, andere eine Pacht für eine bestimmte Anzahl von Jahren oder einen jederzeit kündbaren Vertrag.
Das große Manko der sogenannten «offenen Felder» war, dass alle Bauern gezwungen waren, die gleiche Frucht anzubauen, so dass sie ihre Streifen nicht marktgerecht nutzen konnten. Nach der Großen Pest versuchten die Grundbesitzer deshalb, ihr Land einzuzäunen und mit Schafzucht zu bewirtschaften. Allerdings erforderte dieser Eingriff in die alte Feudalstruktur in jedem einzelnen Fall eine Genehmigung durch das Parlament. Da das Einhegen außerdem wegen des Baus von Zäunen und Hecken kostspielig war, konnten sich nur reiche Grundbesitzer die Investition leisten. Weil eingehegte Flächen der Dorfgemeinschaft entzogen wurden, verloren die ärmsten Bauern, die ihre Streifen bereits verkauft hatten, auch noch die Möglichkeit, nach der Ernte ihr Vieh auf dem offenen Stoppelfeld fressen zu lassen. Wo auch das nicht aufgeteilte Weideland der Dörfer, die Allmende, eingehegt wurde, blieb den Ärmsten nur der Ausweg, sich als Tagelöhner zu verdingen oder in den Städten Arbeit zu suchen. Damit drohten Armutswanderungen, die die Regierung mit harschen Gesetzen gegen Landstreicherei zu unterbinden versuchte.
So hart es für die Kleinbauern war, vom Land vertrieben zu werden, so förderlich war es für die Volkswirtschaft insgesamt. Da die Besitzer der eingehegten Flächen durch kluge Nutzung daraus größeren Profit ziehen konnten, kam dies auch der Allgemeinheit zugute. England hatte schon damals eine frühindustrielle Wirtschaft, in der die alte, auf Subsistenz basierende Landwirtschaft eine geringere Rolle spielte als auf dem Kontinent. Für eine weitergehende Entwicklung, wie sie im Zeitalter der Dampfmaschine eintrat, fehlten allerdings die Voraussetzungen. Zwar wurde bereits Kohle gefördert, doch die konnte nur zum Kochen und Heizen verwendet werden. Für die Eisenherstellung brauchte man den reinen Kohlenstoff der Holzkohle, die inzwischen knapp geworden war, da die Wälder größtenteils abgeholzt waren. Erst die Erfindung des Verkokungsverfahrens im 18. Jahrhundert ermöglichte eine Eisenund Stahlindustrie.
Inflation, Missernten und Pest
Das elisabethanische England trägt die Gloriole eines Goldenen Zeitalters. Doch obwohl das Land in dieser Zeit einen stetigen Aufstieg erlebte, lassen sich nur die Kultur und die höfische Selbstdarstellung als ‹golden› bezeichnen. In der Realität sah es oft nach eisernen Zwängen aus. Nicht nur die äußere Bedrohung durch Spanien und die nie gänzlich verschwindende Gefahr eines Aufstands der unterdrückten Katholiken schwebten wie Damoklesschwerter über dem Land. Auch ökonomisch gab es trotz der vergleichsweise fortschrittlichen Entwicklung schwerwiegende Probleme. Das ganze 16. Jahrhundert hindurch wurde Westeuropa und damit auch England von einer schleichenden Inflation geplagt, da die spanischen Importe von Edelmetallen und der in Deutschland florierende Silberbergbau zu einem Anstieg der umlaufenden Geldmenge geführt hatten. Während Gewerbetreibende und Händler den Inflationsdruck auf den Preis ihrer Waren abwälzen konnten, bekam die große Mehrheit der Landbevölkerung, deren Löhne durch Gesetze niedrig gehalten wurden, die volle Wucht des Preisanstiegs zu spüren. Selbst die Großgrundbesitzer blieben nicht verschont. Da sie ihr Land nicht selbst bewirtschafteten, waren sie auf Pachtzahlungen angewiesen, die oft vor langer Zeit zu einem niedrigen Zins festgeschrieben worden waren. Am besten ging es den Freibauern, den yeomen, die ihr Land selbst bestellten und beim Verkauf ihrer Erzeugnisse mit der Inflation Schritt halten konnten. Verstärkt wurde der Inflationsdruck noch durch eine Reihe von Missernten, die den Preis für Nahrungsmittel in die Höhe trieben. Die schlimmsten Hungerjahre fielen in die Zeit von 1593 bis 1600. Im europäischen Vergleich gehörten die Engländer trotzdem zu den bestgenährten Völkern, was vor allem daher rührte, dass der hohe Anteil der Viehzucht und das große Angebot an Fisch für eiweißreiche Kost sorgten. Austern galten als Arme-Leute-Essen, und Lachs gab es in solcher Fülle, dass Gefängnisinsassen sich beschwerten, wenn sie mehr als zweimal pro Woche davon bekamen. Doch auch die gute Ernährung hatte ihre Schattenseiten, denn die fleischreiche Kost begünstigte offenbar die Anfälligkeit für Gicht, die noch heute in England häufiger auftritt als bei anderen Völkern.
Als wären Inflation und Missernten nicht schon schlimm genug, kamen auch noch mehrfach wiederkehrende Pestepidemien hinzu. Da die Beulenpest durch einen Rattenfloh auf Menschen übertragen wird, ging ihr Auftreten meist mit Missernten Hand in Hand, denn wo Menschen wenig Brotgetreide haben, fehlt dieses auch den Ratten, so dass sie es dann in nächster Nähe der Menschen suchen. 1563 gab es einen schlimmen Ausbruch der Seuche mit ca. 20.000 Toten. Danach kam es eine Zeitlang nur zu gelegentlichem Aufflackern. Doch in den Jahren 1592 und 1593 folgte erneut eine Epidemie, bei der die Todesrate auf über 10.000 anstieg. Nach vorübergehendem Abflauen folgte 1603 ein noch schlimmerer Ausbruch, dem vermutlich bis zu 30.000 Menschen zum Opfer fielen. In den Jahren zwischen 1606 und 1610 bewegte sich die Todesrate zwischen 2000 und über 4000 pro Jahr. Die genannten Zahlen gelten für London; über die Opfer unter der Landbevölkerung gibt es keine verlässlichen Daten.
Bei Theaterleuten wie Shakespeare bedrohte die Pest nicht nur das Leben, sondern die ökonomische Existenz, denn sobald die Zahl der Todesfälle ein gewisses Maß überschritt, ordnete die Londoner Stadtverwaltung die Schließung der Theater an. Das war in den Jahren 1592 und 1593 der Fall, weshalb Shakespeare sich in dieser Zeit eine neue Erwerbsquelle suchen musste und seine beiden Verserzählungen schrieb. In den Jahren 1603 bis 1613 blieben die Theater insgesamt für 78 Monate geschlossen, d.h. für mehr als die Hälfte der Zeit. In solchen Fällen versuchten die Theatertruppen die Einnahmeausfälle durch Tourneen wettzumachen, was aber mit Kosten und Risiken verbunden war.
Ein äußerst seltenes und vergleichsweise harmloses Unglück traf die Londoner zu Ostern 1580, als ein Erdbeben mit dem Epizentrum in der Mitte des Ärmelkanals die Stadt erschütterte. Der materielle Schaden war gering, doch psychologisch verstärkte das Ereignis die angstvolle Grundstimmung, die durch das Aufdecken einer von Jesuiten betriebenen Mission in England bereits angeheizt war. Nimmt man die wachsende Besorgnis hinzu, die sich in der Bevölkerung wegen des Ausbleibens eines Thronerben breitmachte, zeigt sich das Goldene Zeitalter Elisabeths in sehr viel dunkleren Farben; und das ihres Nachfolgers sollte noch düsterer werden. Bereits in Elisabeths Todesjahr 1603 kam es zu dem erwähnten Pestausbruch mit bis zu 30.000 Toten, dem weitere folgten. Nimmt man die blutigen Kriege hinzu, die gegen Spanien zur See und in Irland zu Lande geführt wurden, wirkt es geradezu makaber, wenn «Shakespeares ruhelose Welt», wie Neil MacGregor sie im Titel seines Buches von 2013 treffend bezeichnet, mit Adjektiven wie ‹exuberant› beschrieben wird. Und doch zeichnet gerade diese Eigenschaft die Epoche aus, in der alles im Aufbruch war, und das im doppelten Sinn; denn England war nicht nur auf dem Weg zur Gründung seines ersten Weltreichs, sondern brach auch die letzten Verkrustungen seines überkommenen politischen und sozialen Systems auf: ein Prozess, der im Bürgerkrieg von 1642 bis 1649 zum Abschluss kam. Wie einst die Große Pest von 1348/49 das Ende des Feudalismus einläutete, so trugen auch jetzt die Pestausbrüche, zusammen mit Missernten und der schleichenden Inflation, dazu bei, den sozialen Umbruch zu beschleunigen und den Weg zur ersten konstitutionellen Monarchie zu ebnen, die am Ende des 17. Jahrhunderts erreicht wurde.
Kriminalität und Strafrecht
Das dunkelste Kapitel in der Geschichte der Shakespearezeit ist das Strafrecht. Das Anwachsen der Städte und die beginnende Landflucht infolge der Einhegungen bewirkten einen schleichenden Prozess sozialer Entwurzelung, der ein Ansteigen der Kriminalität zur Folge hatte. Da es weder eine Polizei noch einen organisierten Strafvollzug gab, konnte sich der Staat nur durch extrem harte Strafen gegen das Verbrechen wehren. Gefängnisse gab es nur für die Untersuchungshaft und im Privatrecht zur Inhaftierung von Schuldnern. Im Strafrecht bekamen allenfalls hochgestellte Personen längere Haftstrafen im Tower. Die meisten Verurteilten wurden mit drakonischen Körperstrafen bis hin zur Exekution bestraft. Die mildeste Strafe war der Pranger, bei dem der Verurteilte allerdings möglichen Steinwürfen durch Mitbürger ausgesetzt war. Zänkische Frauen, die ihre Ehemänner und Nachbarn durch fortgesetztes Keifen belästigten, wurden zum ducking-stool, dem Tauchstuhl verurteilt, einer großen Wippe, an deren einem Ende sie an einen Stuhl gehängt und mehrfach ins Wasser getaucht wurden. Die nächsthärteren Strafen waren das Einbrennen von Brandmalen, das Annageln und teilweise oder gänzliche Abschneiden der Ohren, das Zerquetschen von Gliedmaßen und schließlich die Exekution durch Hängen, Verbrennen oder Vierteilen bei lebendigem Leib. Schwerer Diebstahl reichte oft schon für ein Todesurteil aus; für Raub, Vergewaltigung, Fahnenflucht, Totschlag und Mord war es die Regel. Auch auf Homosexualität unter Männern stand die Todesstrafe, doch das Delikt scheint nicht allzu streng verfolgt worden zu sein. Als Verbrechen galt auch der Selbstmord, was übrigens erst 1961 aus dem englischen Strafrecht verschwand. Da bei diesem Delikt der Täter bereits tot war, wurde die Strafe nicht selten an seinem Leichnam vollzogen, indem man ihn öffentlich schändete. Auch alle übrigen Bestrafungen einschließlich der Exekutionen fanden öffentlich statt und wurden vom Volk als Spektakel genossen.
Der Tauchstuhl. Zeitgenössischer Stich
Die Folter galt als legitimes Mittel, ein Geständnis zu erzwingen. Nach einem solchen fiel der gesamte Besitz des Verurteilten an die Krone. Wohlhabende Personen, die wegen Hochverrats angeklagt wurden, hatten nur eine Möglichkeit, ihren Besitz für die Familie zu retten: Sie mussten die Aussage verweigern und sich für ein Verfahren entscheiden, das als peine forte et dure bezeichnet wurde. Dabei wurden sie unter ein Brett gelegt, auf das nach und nach immer mehr Steine gehäuft wurden, bis sie endlich davon erdrückt wurden oder vor Hunger und Durst starben. Man schätzt, dass damals in London jährlich etwa 300 Todesurteile gefällt wurden, die nicht von einem amtlichen Henker, sondern einem dafür angeheuerten Metzger vollstreckt wurden. Die Prozedur war außerordentlich grausam. Der Verurteilte wurde am Strick hochgezogen, so dass er nicht an einem Genickbruch starb, sondern langsam erstickte. Ein Landesverräter wurde noch lebend wieder abgeschnitten und vom Henker aufgeschlitzt, um ihm das noch schlagende Herz herauszunehmen und vors Gesicht zu halten. Danach wurde der Kopf abgeschnitten, der Körper gevierteilt und die Teile zur Abschreckung durch die Straßen geschleift, bis zuletzt der Kopf auf der London Bridge aufgespießt wurde. Adligen gewährte man das Privileg eines schnellen Todes durch Enthauptung. Nur in der Stadt Halifax im Norden Englands galt ein ähnliches Privileg für gewöhnliche Mörder. Dort wurde bis zum Jahr 1650 ein Fallbeil eingesetzt, das ähnlich wie die Guillotine funktionierte.
Eine Besonderheit des englischen Rechts war das benefit of the clergy, das Angehörigen des Klerus das Recht einräumte, von einem kirchlichen Gerichtshof verurteilt zu werden, dessen Strafen gewöhnlich milder ausfielen. Diese aus dem Mittelalter stammende Regelung galt auch nach der Reformation weiter. Da früher nur Kleriker Latein beherrschten und lesen und schreiben konnten, genügte es, wenn ein Angeklagter das Vaterunser auf Latein hersagen oder seine Schreib- und Lesefähigkeit demonstrieren konnte, worauf er dann an ein kirchliches Gericht überstellt wurde. Dieser Regelung verdankte z.B. der Dichter Ben Jonson sein Leben, das er nach dem weltlichen Common Law verwirkt hatte, als er im Duell seinen Gegner tötete. Dank seiner klassischen Bildung fiel es ihm nicht schwer, auf benefit of the clergy zu plädieren, worauf er freigesprochen wurde. Frauen konnten einen Aufschub der Hinrichtung erwirken, wenn sie sich für schwanger erklärten, was ihnen Zeit für ein Gnadengesuch gab.
Öffentliche Hinrichtungen. Zeitgenössischer Stich
Um Shakespeares Werke zu verstehen, muss man sich vergegenwärtigen, dass er und seine Zeitgenossen in einer Welt lebten, in der Gewalt alltäglich war. Wenn allein in London jährlich 300 Todesurteile auf grausame Weise öffentlich vollstreckt wurden, ist davon auszugehen, dass fast jeder Bürger schon einmal Zeuge dieses makabren Spektakels war, von den geringeren Grausamkeiten des Prangers und der sonstigen Körperstrafen ganz abgesehen. Aus Zeugnissen nicht nur jener Zeit, sondern bis weit ins 19. Jahrhundert hinein weiß man, dass öffentliche Hinrichtungen ein großes, sensationshungriges Publikum anlockten. Da kann es kaum verwundern, dass das Theater die so angeheizte Sensationslust mit gleichen Grausamkeiten zu befriedigen suchte. Das begann auf der untersten Ebene mit Bärenhatz und setzte sich fort bis auf die höchste Ebene von Tragödien, in denen Menschen erstochen, vergiftet, geschlachtet und zu Pasteten verarbeitet werden. Selbst Shakespeares Hamlet, dessen Titelfigur als intellektuellster Held des elisabethanischen Theaters gilt, endet mit vier Leichen auf der Bühne und der Nachricht, dass zwei weitere Personen exekutiert worden sind. Erst nach der Aufklärung, die auch vom Staat moralisches Handeln verlangte, bekam der blutige Tod durch Gewalt in Literatur und Oper Konkurrenz durch sentimentalere Formen des Sterbens, vor allem durch Schwindsucht oder Selbstmord à la Werther.





























