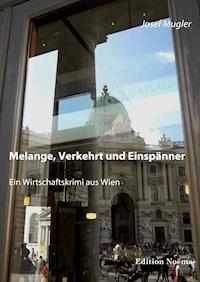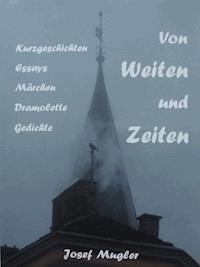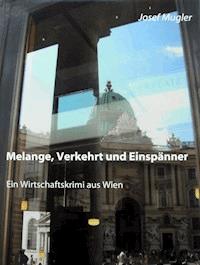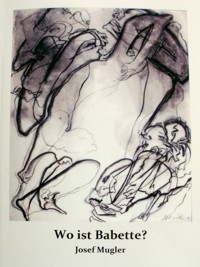
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Mädchen in der Bubenklasse eines Gymnasiums! Das war vor fünfzig Jahren noch ein Aufreger, für Georg sogar ein Erdbeben, das seine jugendliche Gefühlswelt durcheinander wirbelt. Doch wie er es auch anstellt, er kommt nicht an diese Babette heran. Kaum in ihrer Nähe, entschwindet sie immer wie ein Phantom – und erscheint wieder unerwartet wie ein Phantom. Georg erzählt uns von seiner Jagd nach diesem Phantom, die sich über mehrere Lebensphasen erstreckt. Seine Erlebnisse handeln von seltsamen Träumen, von unheimlichen Begegnungen, von Experimenten mit Drogen, vom Zauber der romantischen Musik, vom Wiedersehen mit Schulkameraden und von Reisen, die ihn ganz nahe ans Ziel zu führen scheinen. Wo ist dieses Ziel? Begleiten Sie Georg auf seinen Wegen und erleben Sie mit ihm spannende Abenteuer und tiefe Gefühle!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Josef Mugler
Wo ist Babette?
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
Frühzeit
Mittzeit
Spätzeit
Epilog
Impressum neobooks
Prolog
Ich erzähle dir die Geschichte von einem Phantom. Es ist mein Phantom, nur mein Phantom. Ich teile es mit niemandem. Trotzdem gehört es nicht immer mir. Denn Phantome sind flatterhaft und nicht an Zeit und Raum gebunden. Sie können auftauchen, wann und wo sie wollen. Sie tun das besonders gern, wenn sie nicht erwartet werden. Und sie verschwinden, wenn du sie festhalten willst.
Phantome können verschiedene Gestalt annehmen. Deshalb kannst du dir nie ganz sicher sein, ob du es immer mit ein und demselben Phantom zu tun hast oder ob es manchmal ein anderes ist. Weißt du, was ein Phantomschmerz ist? Ich weiß es. Es ist nichts da, aber es tut weh. Du glaubst dennoch, dass etwas da ist, das dir weh tut.
Ich bin mit meinem Phantom nicht allein. Ich kenne viele Phantomgeschichten – von meinen Freunden. Die sind zwar schon lange tot, aber ihre Geschichten leben noch.
Ernst Theodor, der zu seinen beiden Vornamen gerne auch Amadeus hinzufügte, hatte ein besonders anhängliches Phantom. Es tauchte – wie nicht weiter verwunderlich – immer wieder in anderer Gestalt auf, zum Beispiel als Aurelie, Julia oder Undine. Er verliebte sich jedes Mal Hals über Kopf, sobald es ihm wieder in neuer Gestalt erschien. Jacques erzählte mir davon:
„Ja, erst die Gestalt und diese Züge… / Doch ihre Züge – welch‘ ein Reiz! / Ich seh sie vor mir so schön / Wie ein Maientag. / Ich folgte ihren Spuren…“
(Jacques Offenbach, Jules Barbier, Michel Carré: Hoffmanns Erzählungen (revidierte deutsche Fassung Wilhelm Zentner), Vorspiel, Dritter Auftritt)
Alle Beziehungen zu seinem Phantom, mag es ihm nun, wie in Jacques‘ Erzählungen, als Olympia oder Antonia oder Giulietta erschienen sein, endeten für Ernst Theodor Amadeus in Katastrophen. Wenn ihn nicht immer wieder seine Muse herausgeholt hätte, wer weiß, wüssten wir davon.
Auch Franz, das ruhelose Genie, rang mit seinem Phantom. Es erschien ihm zuerst als Therese, später als Caroline, dann noch als Josephine. Aber nie konnte er es festhalten. Franz war immer auf Wanderschaft, auf der Suche nach seinem Phantom. Vom Wasser hatte er‘s gelernt:
„Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht, / ist stets auf Wanderschaft bedacht, / das Wasser.“
(Franz Schubert, Wilhelm Müller: Die schöne Müllerin, Opus 25, D. 795, Nr. 1 Das Wandern)
Eines Tages glaubte er, das Bächlein, dem er gefolgt war, habe ihn an die richtige Stelle geführt:
„Hat sie dich geschickt? / Oder hast mich berückt? / Das möcht' ich noch wissen, / Ob sie dich geschickt.“
(Franz Schubert, Wilhelm Müller: Die schöne Müllerin, Opus 25, D. 795, Nr. 4 Danksagung an den Bach)
Wohl schon den Tod vor Augen blickte Franz nochmals auf seine bewahrten Sehnsüchte und verlorenen Hoffnungen zurück, als er seine Gefühle in ein „Notturno“ für nicht mehr als drei Instrumente hineinlegte. Das wurde erst von der Nachwelt entdeckt.
(Franz Schubert: Adagio Es-Dur, Opus posth. 148, D 897)
Bei Robert tauchten Liddy und Nanni, Christine und Charitas auf und verschwanden wieder. Ob sie nur wechselnde Gestalten seines Phantoms waren, das mit seinen Gefühlen spielte? Robert lernte jedenfalls daraus, mit Musik zu verzaubern, was andere, zum Beispiel Heinrich, mit Worten versucht hatten:
„Im wunderschönen Monat Mai, / als alle Knospen sprangen, / da ist in meinem Herzen / die Liebe aufgegangen.“
(Robert Schumann, Heinrich Heine: Dichterliebe, Opus 48, Nr. 1 Im wunderschönen Monat Mai)
Was für Ernst Theodor Amadeus die Muse war, das war für Robert Clara. Sie führte ihn und verließ ihn auch in den dunkelsten Stunden nicht, als sie schon – gegen ihren Willen, wie das eben so ist – eines anderen Phantom geworden war: Johannes setzte alles daran, die dreizehn Jahre ältere Clara festzuhalten. Vergeblich! Und so schrie er seine unstillbare Sehnsucht ohne Worte in die Welt hinaus (Klavierquintett in f-Moll, Opus 34). Das sagt mehr als tausend davon.
Und erst Richard! Wie mühte der sich mit seinem Phantom ab! In seiner Wirklichkeit begleiteten ihn Minna, Mathilde und Cosima – und wahrscheinlich auch noch andere – auf wichtigen Stationen seines Weges. Für sein Phantom ließ ihn die Muse immer wieder neue Gestalten formen: zum Beispiel jenes Mädchen, das von der Idee besessen war, einem verfluchten Seefahrer die verheißene Erlösung zu bringen:
„Preis deinen Engel und sein Gebot! / Hier steh ich treu dir bis zum Tod!“
(Richard Wagner: Der fliegende Holländer, Dritter Aufzug, Schluss)
Ihm entstand auch jenes andere Mädchen, das geheime Wünsche erraten und erfüllen konnte. Als es gegen den Befehl, aber im Einklang mit dem heimlichen Wunsch seines Gottes handelte, war dieser gezwungen, es zu verstoßen, setzte es aber auf einem Felsen, umgeben von einem Feuerring, aus. Er dachte wohl, sein Phantom auf diese Weise für sich festhalten zu können:
„Wer meines Speeres Spitze fürchtet, / durchschreite das Feuer nie!“
(Richard Wagner: Der Ring des Nibelungen, 1. Abend: Die Walküre, Dritter Aufzug, Schluss)
Eines Tages kam doch ein Furchtloser, der sich die göttliche Braut gewann.
Am leidenschaftlichsten gestaltete Richard sein Phantom aber wohl in der Gestalt jener irischen Maid, einer Königstochter, der zusammen mit ihrem Entführer ein Liebestrank statt des gewünschten Todestranks eingeflößt wurde. Die daraus entbrannte Liebe steigerte Richard unendlich in
„unbewusst – / höchste Lust“.
(Richard Wagner: Tristan und Isolde, Dritter Aufzug, Schluss)
Was blieb Richard von seinem Phantom? Auch er konnte es nie in seiner Wirklichkeit festhalten.
So war das! Auch mein Phantom konnte ich nie festhalten. Wenn ich mir wieder einmal das Scheitern meiner Mühen eingestehen musste, tröstete ich mich mit den Geschichten meiner alten Freunde. Wie ihnen entglitt mir auch mein Phantom immer wieder. Aber gerade weil ich es nicht festhalten konnte, lebte es immer wieder auf. Es ging nicht in der Gefangenschaft, nicht im Käfig meiner Wirklichkeit zugrunde. Leben als Körper bringt auch tot sein als Körper. Aus diesem Dilemma hätte es keinen Ausweg gegeben.
Wäre mir daher nur ein einziger Versuch gelungen, mein Phantom festzuhalten, könnte ich dir diese Geschichte nicht erzählen. Dabei war mir mein Phantom mehrmals zum Greifen nahe. Doch ich begriff es immer zu spät und ergriff es nie. Es war in den Momenten dieser Begegnungen in ein gewöhnliches Wesen aus Fleisch und Blut verwandelt. Solange es in meiner Wirklichkeit weilte, erschien es mir unnahbar. Erst wenn es wieder verschwunden war, fühlte ich es nahe. So muss es auch Freund Marcel ergangen sein, der mir erzählte:
„Manchmal entstand in meinem Schlaf aus einer falschen Lage wie Eva aus der Rippe Adams eine Frau. Während sie aus der Lust hervorgegangen war, die ich erlebte, bildete ich mir ein, dass diese mir erst durch sie zuteil geworden sei. Mein Leib verspürte in dem ihren seine eigene Wärme und drängte zu ihr, ich wachte auf. Die übrige Menschheit war mir dann ferngerückt im Vergleich zu dieser Frau, die ich vor Sekunden erst verlassen hatte; meine Wange war noch warm von ihrem Kuss, mein Leib von ihrem Gewicht zerschlagen. Wenn sie, wie es bisweilen vorkam, die Züge einer Frau trug, die ich im Leben getroffen hatte, setzte ich alles daran, ihr wieder zu begegnen; es ging mir wie denen, die sich auf die Reise begeben, um mit eignen Augen eine Stadt ihrer Sehnsucht zu schauen, und sich einbilden, man könne der Wirklichkeit den Zauber abgewinnen, den die Phantasie uns gewährt. Allmählich verblasste dann ihr Bild, ich vergaß das Geschöpf meiner Träume.“
(Marcel Proust (Übersetzung: Eva Rechel-Mertens): Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Band 1: In Swanns Welt, Teil 1: Combray. Suhrkamp Taschenbuch 644, Frankfurt am Main 1981, S. 11)
Sobald ich mein Phantom erkannt hatte, verbiss ich mich in den Gedanken, wie ich es in meiner Wirklichkeit festhalten, ihm den Rückweg daraus versperren könnte. So wie es auch Ernst Theodor Amadeus, Franz, Robert, Richard und viele, viele andere versucht hatten. Aber die Hoffnung, dass es doch eines Tages in meiner Welt gefangen sein, sich in meiner Welt verfangen würde und sich nicht mehr losreißen könnte, gab ich nie auf – jedenfalls solange ich denken und mich erinnern konnte. Doch verschwand mein Phantom immer wieder rechtzeitig, bevor die Zerstörung seiner habhaft werden konnte. Es verschwand, um zu leben. Ich gab ihm den Namen Babette.
Später, nach vielen Jahren der vergeblichen Jagd, blieb mir nichts als dieser Name. An diesen Namen erinnere ich mich. Von allem anderen weiß ich nicht mehr, ob es so gewesen ist oder ob es so gewesen sein könnte. Aber ich tröste mich. So war es auch dem greisen Adson ergangen, von dem mir Freund Umberto erzählte. Ich lese dir hier nur den letzten Satz seiner Aufzeichnungen vor, die er als Mönch im Stift Melk zu Papier brachte:
„Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus.”
(Umberto Eco: Der Name der Rose (Übersetzung: Burkhart Kroeber) Deutscher Taschenbuch Verlag, 3. Aufl. München 1986, S. 635)
Nur der Name blieb übrig von der Rose von einst, nur die nackten Namen halten wir fest, können wir festhalten.
Doch lass mich von Anfang an erzählen!
Frühzeit
September. Schulanfang. Ein neues Schuljahr beginnt. Was jetzt kommt, ist durchaus nicht ganz fremd und neu. Aber diesmal doch anders: Ich trete in die Oberstufe des Gymnasiums ein.
Der erste Schultag beginnt mit einer Schulmesse in der Pfarrkirche unseres kleinen Schulstädtchens. Nach und nach trifft man die alten Kollegen und Freunde wieder. Einige fehlen. Werden sie noch kommen? Oder sind sie längst woanders gelandet. Von Hannes weiß ich es. Ein Freund weniger in der neuen Klasse. Was haben wir gelacht! Werden wir je wieder mit derselben Lust lachen können, wenn ein Keil unsere Wege gespalten haben wird?
Man sieht sich um: Viele neue Gesichter im Klassenzimmer, davon einige flüchtig bekannt: einige von den gemeinsamen Fahrten in der Straßenbahn – die damals einfach Straßenbahn, alltägliche, lustige und lästige, notwendige, selbstverständliche Straßenbahn war – und noch nicht die liebe alte Straßenbahn; andere waren als Rivalen in den Wettkämpfen der jährlichen Schulsportfeste in Erinnerung. Man merkte sich die Gegner, wenn es um die Ehre der Klasse ging. Man kannte sie, die entweder Sieger oder Verlierer gewesen waren.
Die Neuen sitzen auf der rechten Seite, die Alten, die mit mir aus der Unterstufe aufgestiegen sind, auf der linken Seite, der Fensterseite. Beim Betreten der Klasse hatte es eine Enttäuschung gegeben: Die Wunschplätze hatten die Neuen schon eingenommen. Was nehmen die sich heraus!? Aber sie saßen fest. Man musste sich damit begnügen, was übrig war.
Dann auch noch die neuen Lehrer, an die man sich erst gewöhnen musste! Sie kannten noch nicht die guten Schüler, zu welchen auch ich bisher gehört hatte. Und sie redeten uns Jungen per „Sie“ an. Waren wir denn Erwachsene? Die alten Lehrer blieben großteils beim „Du“. Die uns seit der ersten Klasse begleitet hatten, sahen in uns „ihre Kinder“, nicht anonyme Objekte ihrer Arbeit. Alle, Schüler wie Lehrer rangen um die richtige Einstellung zueinander. Die Positionen wurden neu vergeben, mussten neu erkämpft werden und die Neuen begannen kräftig mitzumischen.
Am dritten Schultag erschien zum ersten Mal Babette. Ganz links vorne, in der ersten Sitzreihe, leuchteten eines Morgens unendlich lange goldene Haare. Wir alle, die wir dahinter saßen, mussten einfach immer wieder hinsehen. Wir wussten noch nicht, dass wir erwachsen wurden und was wir zu fühlen begannen.
Keiner von uns getraute sich anfangs, diesem Wesen nahe zu kommen. Vier Jahre lang war kein Mädchen in der Klasse gewesen, geschweige denn so etwas. Mit Argusaugen beobachtete jeder, was die anderen taten. Ich konnte alles beobachten, denn ich saß ganz hinten, in der letzten Reihe. Ich saß immer in der letzten Reihe, denn ich liebte es, alles zu beobachten, ohne selbst dabei beobachtet zu werden. So war ich ganz weit weg von dieser neuen Erscheinung, am Endpunkt der Diagonale, der längsten geraden Strecke durch den Raum. Daran änderte sich auch später nichts, als Babette rechts vorne und ich links hinten saß. Immer war die längste Strecke zwischen uns.
Dann die erste Annäherung, so aus dem Nichts heraus, mich völlig unvorbereitet treffend: Wie in Trance versteinert stand ich dicht hinter ihr und saugte die Luft aus der Fülle ihrer goldenen Haare tief in mich hinein. Der Duft verzauberte mich. Ich stand regungslos wie das Kaninchen vor der Schlange. Nur meinen Atem spürte ich und sog diese Luft an, wie wenn ich das ganze Wesen in mich hineinsaugen wollte. Der Lehrer bemerkte bald die Versteinerung des Schülers – und dann deren Ursache. Sein Blick traf den meinen und ich ergriff die Flucht. Das Erlebnis nahm ich mit. Das Feuer des goldenen Haars blieb in meiner Netzhaut eingebrannt. Sein Duft blieb der vertraute Begleiter meiner Atemzüge.
Babette hatte Sommersprossen. Einer wusste zu erzählen, dass sie in Italien, am Meer, damals noch für viele von uns ein Traumziel, gewesen war. Ich hatte das Meer noch nicht gesehen – außer im Kino natürlich. Ich stellte mir vor: Meer, Sand, Wärme, Himmel – und mitten drin Babette! Und wo war ich? Wir waren alle in einer miefigen Schulklasse. Der Regen von draußen würzte die dicke Luft zum Gestank. Und wir sollten nicht träumen, sondern rechnen und übersetzen und die Geschichte lernen und so weiter.
Neben Babette gab es eine Zeitlang auch noch Jana. Sie wurde einige Wochen später in unsere Klasse gebracht. Jana hatte pechschwarzes Haar und wurde neben die goldblonde Babette gesetzt. Jana war ganz anders als Babette: Sie war – für ihr „zartes“ Alter ziemlich stark geschminkt, mit schwarz umrandeten Augen und rotem Lippenstift. Das war damals auffällig, außerhalb der Norm sozusagen. Wir wurden noch nicht mit den Kunstgestalten der Fernsehwerbung bombardiert.
Was wollte sie damit ausdrücken: Wollte sie aus ihrer Wirklichkeit flüchten? Oder wollte sie uns imponieren? Erkannte sie nicht die Gefahr, in die sie hineinschlitterte? Für die meisten von uns war ihr Andersaussehen Provokation. Die wurde mit Spott, sogar mit Aggression, nicht mit Bewunderung – oder höchstens unbewusst – beantwortet.
Jana gefiel mir. Nicht so sehr wegen der Schminke, jedenfalls nicht hauptsächlich oder vielleicht auch gar nicht bewusst, jedenfalls nicht gleich. Was war es dann? Heute denke ich, es war die Melancholie, die sie mit sich trug. Sie trug hinter ihrer Schminke etwas Schwärmerisches, eine Hoffnung auf irgendetwas und eine Resignation, weil sie es nicht erreicht, noch nicht erreicht hatte. Natürlich wusste ich nicht, was das war, was sie ersehnte. Und im Kreis der Schulkollegen, in unserer Lust- und Spaßgesellschaft konnte sie damit auch nicht herausrücken. Sie musste sich anpassen und das misslang jämmerlich. Jana war jedenfalls ganz anders als Babette. Babette war unbekümmert, fröhlich, ungeschminkt, angepasst. In der ersten Zeit jedenfalls war sie das.
Ich traf Jana bald nach ihrem ersten Erscheinen einmal in unserer lieben alten Straßenbahn, die wenig später eingestellt werden sollte. Sie fuhr eine kurze Strecke, stieg also wenige Stationen vor der Endstation zu oder aus.
Zwischen sieben und acht Uhr früh wurde in der Straßenbahn hart gearbeitet: Es wurden vergessene Hausübungen nachgeholt oder gar abgeschrieben, Prüfungen vorbereitet, die Inhalte der Schultaschen überprüft, obwohl es dann schon zu spät war. Aber man wusste wenigstens, was fehlte, und konnte für den Bedarfsfall über Ausreden nachdenken. Unzählige Kartenpartien liefen auf den Rücken der Schultaschen ab, die auf den Knien balanciert wurden. Mancher hatte auch noch das Frühstück nachzuholen. Die Straßenbahn war ein fahrendes Wohnzimmer.
Sie war auch eine erste Kontaktbörse zwischen den Geschlechtern, ein Probebetrieb für Gefallen und Gefallen-lassen. Die Jungen schauten sich die Mädchen an, und umgekehrt, manchmal unbemerkt, manchmal offensichtlich. Jede auch nicht verbale Kommunikation wurde registriert. Wer traute sich nicht nur hinzuschauen, sondern auch zu sprechen? Aber was? Und mit welchen Folgen? Aber man gewöhnte sich aneinander. Wer fehlte, ging ab. Später entwickelten sich Freundschaften, sogar bis hin zu ersten Partnerschaften.
Ich weiß nicht mehr, ob ich darauf abzielte oder ob es sich zufällig ergab, dass ich Jana eines Tages in unserer Straßenbahn traf. Ich wusste, wo sie gewöhnlich einstieg, nämlich ganz vorne. Meine Freunde und ich waren dagegen meist im letzten Waggon. Nun befand ich mich also eines Tages auf der vorderen Plattform und richtig, da stieg sie ein und spendete mir ein Lächeln. Ich war mit ihr allein, allein für wenige Stationen, für wenige Minuten. Das wiederholte sich einige Tage.
Jana erzählte mir bei diesen wenigen Gelegenheiten, dass sie zu ihrem Vater übersiedelt sei, der hier eine Gastwirtschaft übernommen habe. Ihre Eltern lebten getrennt. Sie sei, da der Vater im Gasthaus zu tun habe, viel sich selbst überlassen, vor allem am Abend, wenn der Betrieb am stärksten war. Sie habe hier noch keine neuen Freundinnen gefunden. Mit uns Jungen komme sie bisher nicht zurecht. Sie wisse aber nicht, warum sie überall auf Ablehnung stoße. Und Babette? Na ja. Die sei auch anders als die Freundinnen in ihrer früheren Schule. Aber mit ihr ginge es so einigermaßen.
Kein Wunder, dass mich das rührte! In mir regte sich der Wille, ihr zu helfen, sie in Schutz zu nehmen. Ich war in diesen Tagen ganz erfüllt davon. Ich hatte eine Mission. Aber ich scheiterte kläglich. Trotz meines Eifers blieb ich in der Ausführung halbherzig. Meine Versuche, die Jungen in der Klasse Jana gegenüber freundlich zu stimmen, wurden mit Spott und Hohn beantwortet. Dem hielt ich nicht stand.
Ich getraute mich daraufhin auch nicht mehr, Jana in der Straßenbahn abzupassen. Einerseits stand ich unter ständiger Beobachtung meiner Freunde. Andererseits schämte ich mich, dass ich keinen Stimmungswandel ihr gegenüber zustande gebracht hatte. Sie hätte sicher von mir wissen wollen, was da lief. Sie hatte sicher meine Gefühle für sie gespürt. Und dann wieder meine Zurückhaltung. Vielleicht zerbrach etwas in ihr. Vielleicht hatte ich etwas zerbrochen. Ich hätte ihr nichts erklären können.
Für die großen Gefühle der Pubertät ließen die klassischen Bildungsfächer wenig Raum: Was konnten Mathematik, Physik, Naturkunde, Latein und Co. in uns bewegen? Nichts! Das war alles fürs Gehirn und rein gar nichts war fürs Herz. Aber irgendwo musste diese gewaltige Energie doch durchbrechen! Der Druck war spürbar, manchmal unerträglich, aber wir wussten es nicht. Wir waren noch „Trommelknaben“, die nichts von Liebe wissen und nicht, wie Scheiden tut, wie es in einem bekannten Volkslied heißt. Wir hatten das Liedchen in der Unterstufe ahnungslos geträllert.
Was Vertiefung des Gefühlslebens versprach, waren die sogenannten musischen Fächer und der Wettkampf im Sport. Leider musste man sich damals in der Oberstufe entweder für Musik oder für Zeichnen, das später einmal bildnerische Erziehung heißen sollte, entscheiden. Eines von beiden kam zu kurz. Ich wählte Zeichnen, nicht zuletzt wegen eines prominenten Lehrers, der damals an unsere Schule gekommen war. Ich hatte schon in der Unterstufe Erfolge mit Graphiken, vor allem Radierungen und Federzeichnungen.
Dieser Zeichenlehrer war damals berühmt durch seine „imaginären Porträts“ von bedeutenden Persönlichkeiten der Geschichte, welchen er nie selbst begegnet war. Er ließ uns mit Vorliebe dramatische Ereignisse mit Tusche und Feder gestalten, zum Beispiel „Die Flucht der Tiere“ oder „Eine Katastrophe“ oder „Das Ende“. Aber einmal gelang es uns, ihn von einem Thema zu überzeugen, das in unsere Gefühlswelt eingedrungen war. Das war in jener Zeit, als Herbert von Karajan an der Wiener Staatsoper eine Neuinszenierung von „La Boheme“ herausbrachte. Für Regie und Bühnenbilder war Franco Zeffirelli verantwortlich. Es handelte sich um die Übernahme einer Produktion von der Mailänder Scala. Vor der Premiere gab es einen Riesenwirbel, weil der Maestro einen „Maestro Suggeritore“, eine Art Subdirigenten oder mitdirigierenden Souffleur von der Scala einsetzte, gegen den die Gewerkschaft protestierte. Die Premiere musste deshalb sogar verschoben werden. Doch der Erfolg war dann überwältigend. Auch wer sich noch nicht für Oper interessierte, wurde aufmerksam. Die Berichte derer, die eine der ersten Vorstellungen miterlebt hatten, motivierten andere. Es war wie eine Kettenreaktion. Babette erlebte eine der ersten Vorstellungen, ich war etwas später dran. Schließlich bestürmten wir unseren prominenten Zeichenlehrer, Bühnenbilder zur „Boheme“ entwerfen zu dürfen. Die meisten malten ungefähr das, was sie in der Oper gesehen hatten: nicht sehr originell, aber ein Zeichen für die tiefen Spuren, die dieses Erlebnis in uns eingraviert hatte.
Auch mir eröffnete diese „Boheme“ eine neue Dimension des Fühlens. Ich fühlte viel, aber verstand wenig. Der Text des Gesungenen war mir unbekannt. Eine Inhaltsangabe im Programmheft war die einzige Informationsquelle. Ich kannte nicht die Bedeutung der Passage
„O soave fanciulla, o dolce viso / di mite circonfuso alba lunar / in te, vivo ravviso / il sogno ch'io vorrei sempre sognar!”
(„Du entzückendes Mädchen, reizendes Antlitz, / umflossen von des Mondes mildem Licht, / in dir erleb ich ein lange schon ersehntes Traumgesicht!“)
(Giacomo Puccini, Giuseppe Giacosa, Luigi Illica (Übersetzung: Hans Swarowsky: La Bohème, Erstes Bild)
Ohne Verstehen konnte ich fühlen, durch und durch drang mir diese Musik direkt ins Herz, wie wenn sie keinen Umweg über das Gehirn gemacht hätte. Das Sehen und vor allem das Hören waren genug, um mich eine Geschichte, die Geschichte, die sich mir eröffnete, miterleben zu lassen.
In der Wiener Staatsoper gab es immer auch um die fünfhundert Stehplätze. Die waren sehr preiswert. Das Stehplatzpublikum bestand aus einem festen Stamm und gelegentlichen Besuchern. Kein Wunder, dass das Stammpublikum, in dem es nicht wenige gab, die fast täglich die abendliche Vorstellung besuchten, über beides: besonderes Wissen und besonderes Gespür verfügte. Ich war nur gelegentlich dabei. Aber die Faszination des „Gesamtkunstwerks Oper“ hatte mich ergriffen, ohne dass ich über „Wissen“ verfügte. Einmal hörte ich ein paar Worte einer jungen Frau mit, die eindeutig dem Stammpublikum zuzurechnen war:
„…Da geht der Mann hin zu ihm und sagt: ‚Sie sind sicher der Karajan. Ich wohn' da gegenüber und hör' die ganze Zeit die Musik. Ich versteh' zwar gar nix davon. Aber ich muss Ihnen sagen, das ist sooo schön.‘ Und der Maestro schaut ihn an und sagt: ‚Sie müssen gar nichts von Musik verstehen, Hauptsache, Sie spüren sie. Sie haben mir jetzt eine große Freude gemacht‘…“
(http://members.chello.at/hedda.hoyer/Saisons/Erinnerung_2008.htm)
Musik spüren! Das war es. Ich hatte mich nicht zum Musikunterricht gemeldet, weil ich dort nicht Musik zu spüren bekommen hätte – das wusste ich aus dem Musikunterricht der Unterstufe des Gymnasiums – , sondern die Musik zerlegt worden wäre: in Atome, in Systeme, in Strukturen.
Statt Musik verstehen zu lernen, versuchte ich, selbst Musik zu „machen“. Meine Versuche reichten vom Klavier über die Blockflöte, die in der Schule allen Kindern nahegelegt worden war, bis zur Klarinette. Mit Freunden gründete ich sogar eine Band, die kurioserweise sowohl ländliche Musik als auch Popmusik spielte. Wir spielten einige Male zum Tanz auf.
Es kostete mir große Mühe, um einigermaßen solche Töne hervorzubringen, die mir selbst gefielen. Meist aber gefiel mir gar nicht, was ich mit meinem Instrument anstellte. Unten, vor dem Podium, auf dem wir uns ins Zeug legten, tanzten sie. Sie tanzten steife Volkstänze. Oder sie tanzten eng umschlungen. Babette und andere Mädchen aus dem Schulstädtchen tanzten mit meinen nicht musizierenden Schulkollegen. Und ich stand oben auf dem Podium und produzierte grässliche Töne dazu. Es war nicht auszuhalten. Ich ertrug es nicht. Eines Tages machte ich Schluss damit.
Aber nicht mit dem Musik-Hören! Da war noch ein weites Land zu erschließen! Lieder ohne Worte erzählten mir aufwühlende und rührende Schicksale, nicht etwa nur dieses Opus (Felix Mendelssohn Bartholdy: Lieder ohne Worte, acht Hefte mit Klavierstücken; der Titel wurde übrigens u.a. auch verwendet von Peter Iljitsch Tschaikowski und Arnold Schönberg), sondern auch viele andere: von den Geschichten des Ludwig, Franz, Frederic, des anderen Franz und Robert am Klavier bis zu den großen Orchesterwerken des Felix, Peter Iljitsch, Johannes, Anton, Antonin, Gustav, Jean, des anderen Richard und vieler, deren Entdeckung damals noch vor mir lag.
Später im Schuljahr mussten die beiden Mädchen, Babette und Jana, im Zeichenunterricht für uns Modell sitzen. Jana sollte bloß mit Bleistiften gezeichnet werden. Das war leichter als gleich mit Wasserfarben loszulegen. Sie besaß markantere Gesichtszüge als Babette, was wohl auch durch die Schminke bedingt war. Im Profil sah man bei ihr den Anflug eines Doppelkinns. Sie futterte offenbar zu viel!? Aus Kummer? Wie immer auch: Jana zu porträtieren erschien im Bereich unserer Möglichkeiten. Wie unglücklich muss sie aber gewesen sein, als sie – ohnehin über ihre Wirkung verunsichert – die Ergebnisse der Bemühungen, sie lebensecht zu treffen, sah! Was zur Verbesserung des Klimas zwischen Jana und den anderen hätte beitragen können, ging „nach hinten los“. Jana fühlte sich ungerecht behandelt: Sie versuchte verzweifelt zu gefallen und erntete nur Schmach.
Babette sollte mit Wasserfarben gemalt werden. Das stellte sich als weit schwieriger als mit dem Bleistift heraus. Ich bekam das Gesicht von Babette überhaupt nicht hin, so sehr ich mich auch abmühte. Alle mühten sich ab, es war ein brutaler Wettbewerb um den Sieg. Wer brachte die schönste, die beste Babette zustande!? Aber die Gesichter, die auf dem geduldigen Papier landeten, ähnelten besserenfalls Karikaturen, schlimmerenfalls Missgeburten. Die Mühe wurde zur Qual, die Qual zur Verzweiflung. Ob es Mitleid oder Herausforderung war, was der Lehrer dabei empfand? Jedenfalls malte er in viele der missratenen Fratzen selbst hinein und schaffte es schließlich tatsächlich, Ähnlichkeiten mit dem Modell auf unsere Papiere zu bringen. Babette saß da, mit einem aufgespannten Sonnenschirm, wie auf einem Urlaubsfoto, lächelte unbekümmert, vielleicht ein wenig unsicher ob ihrer Zurschaustellung, später gelangweilt, weil es so lange dauerte, aber sie schien nicht im Geringsten zu ahnen, was sich um sie herum an Tragödien abspielte.
Im selben Jahr schickte man uns im Spätwinter, es war schon mehr Frühjahr, auf Schikurs. Wir fürchteten uns vor der Lawinengefahr, übrigens auch einige der Lehrer. Die Witterung war warm und die Sonne setzte der Schneelandschaft mit jedem Tag mehr zu. Im sulzigen Schnee war es schwierig zu fahren, besonders für die weniger Geübten. Mir widerfuhr es, mit Babette in dieselbe Gruppe eingeteilt zu werden. Wir gehörten zu den schwachen Schiläufern, nicht ganz Anfänger, aber auch nicht viel besser. Ich war weit von jenem Können entfernt, das zum Imponieren getaugt hätte. Bert und Albin taten sich da leichter. Die meisten meiner Schulkollegen waren, wenn es ums Imponieren ging, viel weiter als ich.
Babette war – wie so oft – das einzige Mädchen in der Gruppe. Jana war nicht mit dabei, aus welchem Grund immer. Sie sah ja damals mit ihrem Übergewicht auch nicht sportlich aus. Im Gegensatz zu Babette. Babette war sportlich, aber hatte keine Übung im Schifahren. Sie sah so tollpatschig aus! Babette wurde begafft, bewundert, bedauert, gelobt. Alles drehte sich um sie. Ein Wirbelwind der Gefühle. Wie sollte sie damit zurechtkommen, sich auskennen, was das alles bedeutete!? Das setzte sich am Abend fort: bei den Hüttenspielen mit Theater, Musik und Tanz; Volkstanz natürlich – die Lehrer stammten noch aus der Generation, die nationale Traditionen pflegte. Jede Annäherung an Babette hätten alle bemerkt. Daher entstand so etwas wie Quarantäne. Es war unmöglich, mit ihr unverkrampft zu reden. Die Meute starrte unaufhörlich und verdarb die Stimmung.
Die Nacht verbrachten wir im Massenquartier: ungefähr zwanzig pro Schlafraum. Babette war getrennt, abgeschirmt, behütet – von den Lehrern. War sie das wirklich? Da war auch weibliches „Personal“. Dort war sie untergebracht. Die Fenster ihres Zimmers mussten genau gegenüber sein. Finstere Vierecke in der schwach von Laternen erhellten Fassade. Rundherum noch dunklere Nacht. Die letzten Biere, im Gitarrenkoffer aufs Zimmer „geschmuggelt“, werden geleert. Endlich Ruhe. Licht aus! Und gute Nacht. Und noch ein Witz. Und wieder grölendes Lachen. Man war müde, aber wollte oder konnte nicht schlafen. Eine Stimme vom Fenster her durchschneidet die fragile Stille: „Die Babette zieht sich aus!“ Alles auf zu den Fenstern! Es geht um den besten Platz. Da stehen wir in unseren Nachtgewändern. Die Langsamen auf den hinteren Plätzen strecken ihre Zehenspitzen wie Ballerinen. Einige behaupten am nächsten Morgen, sie tatsächlich gesehen zu haben. Wie ein Phantom. Die nichts gesehen haben, werden ihr Leben lang kein Phantom zu sehen kriegen. Einer glaubt nicht an Phantome. Er wird in seiner Welt immer Spaß haben.
Weder als Maler noch als Schifahrer konnte ich Babette imponieren. Das waren nicht meine Stärken. Aber gab es da nicht auch für mich ein Atout? Ich war Kapitän unseres Handballteams. Meine kräftige Statur half mir in diesem Sport zu Erfolgen. Im hautnahen Kampf Mann gegen Mann konnte ich mich durchsetzen. Ja! Ja, das könnte gelingen! Ja! Das musste gelingen! Ich lud Babette zum nächsten Match ein. Sie sollte uns Glück bringen. Babette fühlte sich geschmeichelt und sagte zu. Ich jubelte über meinen Coup und bestand darauf, sie von zu Hause, einem alten Häuschen in einem großen Park, abzuholen. Auf dem Weg fiel mir nicht viel ein, ihre Welt entpuppte sich für mich als fremd, eine Mädchenwelt, die Kommunikation kam nicht so recht in Schwung.
In meiner verzweifelten Sprachlosigkeit fragte ich sie, wie sie denn zu ihrem Namen gekommen sei. Der klinge so modern. Und ich kenne eigentlich keine Heilige, nach der sie getauft sein könnte.
Sie antwortete: „Komisch! Ich dachte immer, es sei mein eigener, mein Name. Und nicht der einer anderen.“
Nach einer Pause, die entstanden war, weil mir auf ihre Antwort absolut nichts eingefallen war, fügte sie noch hinzu: „Ich habe zwei Schwestern, die heißen Annette und Carlette. Und ich bin dazwischen eben Babette, B zwischen A und C. Carlette ist übrigens meine Zwillingsschwester.“
„Und da tretet ihr gar nicht gemeinsam auf?“, entsprang es meinem Mund. Ich ahnte aber gleichzeitig, dass so ein klischeehafter Kommentar nicht gut ankommen würde.
„Müssen denn Zwillinge immer gemeinsam auftreten? – Obwohl: Irgendwie hast du recht: Wir haben miteinander viel Unfug getrieben. Wahrscheinlich hat man uns deshalb in verschiedene Schulen geschickt.“
„Carlette ist sehr begabt“, ergänzte Babette nach einer Weile. „Sie singt. Ich kann nicht singen. Und sie spielt wahnsinnig gerne Theater. Und sehr gut. Sie kann sich unheimlich gut verstellen. Ich kann das nicht. Das unterscheidet uns. Deswegen heißt sie auch Carlette. Eigentlich heißt sie Charlotte. Aber Mutter nannte sie eines Tages Carlette, nach einer Opernsängerin, die mit Vornamen Carla heißt. Aber ich glaube, die singt nicht mehr. Stell dir vor, ihr Sohn ist von der Gartenmauer gefallen und war tot. Seither singt sie nicht mehr.“
„Ich glaube, ich habe ihn gekannt. Er ist mit mir in die Volksschule gegangen. Hieß er nicht Boris?“
„Keine Ahnung! – Also Carlette wird sicher einmal Sängerin.“
Und wieder nach einer Pause setzte sie etwas hinzu, was mich erst recht sprachlos machte:
„Ich glaub‘, ich tauge zu nichts. In meinem Kopf schwirren die Gedanken nur wild herum, aber ich bringe nichts Gescheites heraus.“
Ich hätte darauf wohl dringend etwas Erbauliches sagen sollen, brachte es aber nicht zuwege. Bevor ich wieder etwas Klischeehaftes ausspie, zog ich es vor, nur stumm neben Babette herzugehen. Ich schaute sie von Zeit zu Zeit verstohlen von der Seite an. Sie lähmte mich: Ich wollte so viel und konnte doch so wenig. Ob sie es merkte? Natürlich musste sie es merken.
Dann fügte sie noch hinzu: „Mutter sagt immer zu mir: Du bist eine kleine Hexe. Darum heißt du Babette. Die Baba Jaga ist eine Hexe in einem Märchen. Und sie kommt auch in einem Musikstück vor. Aber sie kann auch eine gute Fee sein. Es kommt darauf an, wie man zu ihr ist.“
Wir kamen auf dem Schulsportplatz an. Meine Arena, hier lag sie vor mir! Ich brachte Babette zu einem Platz mit guter Sicht auf das Spielfeld – und ab ging es mit mir in die Kabine zu meiner Mannschaft. Jetzt begannen mich die Erwartungen zu umschnüren, zu würgen. Würde ich heute gut sein, ihr imponieren können? – Wenig später konnte ich registrieren: Der Wettkampf nahm den erwarteten Verlauf. Wir steuerten einem Sieg zu, den Sportreporter eindrucksvoll hätten ausschmücken können.
Das Spiel dauerte zwar nicht länger als sonst, schien sich aber unnötig in die Länge zu ziehen. Auch für mich. Ging es doch diesmal eigentlich um etwas anderes. Da war diesmal noch eine andere Hauptsache!
Auch für Zuschauer mit mäßigem Interesse an diesem Sport kann ein Handballspiel langweilig werden, vor allem wenn sie nicht gezielt betreut werden. Und außerdem lauerten unter den Zuschauern Haie. Die begannen den kleinen Fisch, Babette, zu umkreisen. Dann bissen sie zu und entführten sie schließlich. Noch bevor unser Wettkampf zu Ende ging, war ihr Platz leer. Dass sie wiederkommen würde, war ein trüber Hoffnungsschimmer zum Anklammern. Es blieb bei der Hoffnung.
Der sportliche Wettkampf war sofort bedeutungslos, der Sieg wertlos. Meine Gedanken suchten Trost und wanderten zur letzten Theatervorstellung in unserem Festsaal. Es war die Zeit, als ein bekannter Schauspieler mit Einpersonen-Stücken von Schule zu Schule zog. Bei uns führte er den „kleinen Prinzen“ und den „alten Mann und das Meer“ auf. Freund Ernest ließ mir durch ihn ausrichten:
„‚Fresst das, galanos. Und träumt, dass ihr einen Mann getötet habt.‘ Er wusste, dass er jetzt endgültig und unwiderruflich geschlagen war, und er ging ins Heck zurück und fand, dass das zersplitterte Ende der Pinne in die schmale Öffnung des Steuerruders gut hineinpasste, um damit zu steuern… Er segelte jetzt unbeschwert, und er hatte weder Gedanken noch Gefühle irgendwelcher Art.“
(Ernest Hemmingway: Der alte Mann und das Meer (Übersetzung: Annemarie Horschitz-Horst) Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg 1959, S. 116)
Bis ich das Ufer erreicht hatte, so meinte ich in jenen Augenblicken, war der größte Fisch, den ich je an meiner Angel gehabt hatte, von den Haien zerfleischt, aufgefressen, verloren.
Das Schuljahr neigte sich dem Ende zu. Das Klima in unserer Klasse trübte sich in jenen Tagen zusehends ein. Es bildeten sich Cliquen heraus – mit verschiedenen Interessen, Talenten, gar Weltanschauungen. Die prallten fallweise aufeinander wie losgetretene Felsbrocken. Es gab Streit bis hin zu Prügeleien. Oft wusste man nachher nicht mehr den Anlass. Allein anders zu denken, anders zu sein genügte. Man suchte geradezu Abgrenzungen: Hier wir, dort die anderen. Diese anderen zu ärgern oder einzuschüchtern oder einfach dumm aussehen zu lassen, wurde zur Würze des Schulalltags. Die Hauptsache war, selbst „groß“ da zu stehen. Zwischen diesen Sticheleien oder sogar Feindschaften steckten die beiden Mädchen fest. Was auch immer losgetreten wurde, sollte ihnen imponieren oder, wenn sie ahnungslos Partei ergriffen, sie wenigstens ärgern. Es ging um ihre Aufmerksamkeit, Regung, Erlegung.
Babette und Jana waren in diesem Ringen Verbündete und Gegnerinnen, Freundinnen und Feindinnen, Gejagte und Jägerinnen. Wer immer sich einer von ihnen oder beiden zuwandte, musste damit rechnen, angefeindet zu werden. Auch die Lehrer waren dem sich ausbreitenden Chaos nicht gewachsen, im Gegenteil, sie gerieten selbst in den Strudel der Auseinandersetzungen. Die Alten verhielten sich entweder autoritär oder mitfühlend, übten Druck aus oder resignierten. Aufbäumen, Auflehnung, Ablehnung brachen sich da und dort Bahn. Erstmals wurden auch Lehrer zu Feinden erklärt. Die meisten machten da aber nicht mit.
Was wir als Schüler in unserem wohl bewachten und behüteten „Reservat“ nicht oder nur beiläufig mitbekamen, waren die ersten Protestbewegungen „draußen in der Welt“. Es schien, als stünde die Jugend landauf landab gegen die Elterngeneration, die auch die Lehrergeneration war, auf: gegen jene Generation, die den Wiederaufbau nach dem großen Krieg, eigentlich den Aufbau einer vorher unbekannten oder nur für wenige Privilegierte zugänglichen Güterwelt zustandegebracht hatte. Der Wohlstand verdeckte eine geistige Entleerung – oder eher eine Einseitigkeit: Denn auch die Ideologie der Ideologieabstinenz ist letztlich Ideologie. Die Bildung war auf alles, was Klassik genannt werden konnte, gerichtet. Und die Beziehungen basierten auf der Logik von Maschinen: Befehle, egal ob ausgesprochen oder in Erwartungen versteckt, prägten das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, Lehrern und Schülern, Chefs und Lehrlingen.
Da stand eines Tages auf der Tafel zu lesen:
„Ritze ratze, ritze ratze, hinaus mit der schwarzen Katze!“
So steht es dort. Wir stehen da und warten. Einigen ist es gleichgültig. Andere finden es dumm oder verletzend, haben aber nicht den Mut, etwas dagegen zu unternehmen. Sie wird es schon hinunterschlucken. Das Leben ist hart. Was geht das mich an?
Die Glocke läutet. Es klingt wie Alarm – diesmal. Die Pause ist zu Ende. Gleich werden sie hereinkommen: die zwei Mädchen, Jana, die pechschwarze und Babette, die goldblonde. Der Schwarzhaarigen gilt offensichtlich der Spruch an der Tafel. Die meisten schauen hin, mit gespielter Gleichgültigkeit die einen, mit offener Neugier die anderen, auf das Mädchen, auf die Tafel, wieder auf das Mädchen.
„Tu nicht so, als ob du es nicht sehen würdest! Lies doch endlich!“ Es bleibt nicht viel Zeit, bis der Lehrer hereinkommen wird. Sie wird es doch nicht ignorieren!?
Jana setzt sich und verbirgt ihr Gesicht in den Händen. Weint sie? Ja, sie weint! Also Volltreffer! Der Schreiber der Zeilen fühlt sich als Held. Etwas Spektakuläres ist gelungen. Das hat bisher keiner zustandegebracht.
Während sich Babette abwechselnd tröstend an Jana und schimpfend an die anderen wendet, betritt der Lehrer den Raum. Schnell hat noch einer aus der ersten Sitzreihe den Tafelflügel zugeklappt, sodass der Text nach innen gekehrt und nicht sichtbar ist. Es ist außergewöhnlich still im Raum. Jana versucht ihr Weinen zu unterdrücken. Aber die schwarze Schminke rinnt von einem Auge auf die Wange herunter. Es ist nicht zu übersehen. Sie sieht jämmerlich aus.
Der Lehrer merkt, dass etwas nicht stimmt.
„Sehen Sie, was auf der Tafel steht – auf der Innenseite“, sagt Babette.
Der Lehrer sieht nach und liest. Alle Augen sind auf ihn gebannt. Wie wird er reagieren? Er setzt sich.
„Lösch das weg!“ Er deutet auf einen Schüler in der ersten Reihe. Der Lehrer ist im ersten Schock – ja, es muss für ihn ein Schock gewesen sein – kurz angebunden. Sein Reflex: Das Unangenehme schnell aus der Welt schaffen! Überhaupt wenn es so einfach ist wie mit Kreidestrichen. Das gewährt ein paar Augenblicke Zeit fürs Nachdenken, wie er reagieren soll.
Die Klasse erwartet, dass er fragt, wer das geschrieben habe. So ist es doch immer. Der Täter muss her. Der wird bestraft. Damit er es sich merke und die anderen auch.
Aber der Lehrer sagt: „Ihr seid alle dieser Meinung? Oder hat einer versucht, etwas dagegen zu unternehmen?“
Hat natürlich keiner. Ging ja auch viel zu schnell. Die ersten, die es gesehen haben, fanden Spaß dabei. Die anderen stutzten beim Lesen, versuchten zu verstehen, was es bedeutet, oder abzuwägen, ob man sich dazu äußern soll. Ein flaues Gefühl war da wie dort dabei. Was war es denn schon? Ein Aufreger mehr, eine Abwechslung, Unterhaltung für zwischendurch, an einem anstrengenden Tag. Wie hätte man so schnell erfassen sollen, dass eine Wunde schlägt, was da passiert!? Ein Stück Wild, Freiwild, ist erlegt worden. Was sonst? Weidmannsheil!
„Ihr seid also alle dieser Meinung? Wollt euch einen anderen Menschen vom Hals schaffen? Ihr prügelt euch untereinander mit Fäusten. Ein Mädchen prügelt ihr so!?“
Der Schreiber der Zeilen fühlt Erleichterung. Was jetzt abläuft, trifft nicht ihn allein. Es geht alle an. Er war die Stimme des „Volkes“. Die hat er geprägt. Hinter ihr kann er sich auch verstecken. Es kann also nicht so schlimm werden, wenn er auffliegen sollte.
Aber eben war er doch noch der Held, der sich was getraut hat! Der diese Truppe aus der Trägheit des Alltags herausgeführt hat. Soll er jetzt vom Anführer zum Rädchen im Kollektiv abstürzen? Das gemeine Volk, das es geschehen ließ, soll ihm den Rang ablaufen?
Jetzt hält es Jana nicht mehr aus. Sie stürzt hinaus auf den Gang. Das ist es eigentlich, was der Text auf der Tafel vorschlug. Also doch ein Sieg? Aber für wen?
Jana kehrte am nächsten Tag in die Schulklasse zurück, aber vieles war zerbrochen.
Babette und Jana waren seit diesem hässlichen Vorfall verändert. Sie wirkten abgestumpft, desinteressiert. Niemand kam mehr an sie heran. Das war nicht verwunderlich. Aber allmählich, so dachten wohl die meisten, hätte man diese Sache doch vergessen können, noch dazu, wo diesem Eklat nichts Ähnliches mehr gefolgt war.
Doch dann kündigte sich Neues an. Ich wollte mit Albin darüber reden, aber ohne mir gleich anmerken zu lassen, worum es ging. Albin war als scharfer Beobachter bekannt. Doch in diesem Fall enttäuschte er mich.
„Lass ihnen doch ihre Launen“, hatte Albin gemeint. „Da ist nichts weiter dran! Die Mädchen sind einfach anders! Das ist normal, sag ich dir.“
„Aber warum ignorieren sie uns denn so demonstrativ? Die haben doch etwas mit uns vor! Es riecht doch schon nach Ärger. Wollen sie sich rächen?“
„Sie bereiten gewiss etwas vor.“
„Aber was? Hast du eine Ahnung?“
„Noch nicht“, meinte Albin. Er hatte also offenbar auch keine Anhaltspunkte. Gleichzeitig ließ er damit durchblicken, dass er das bald herausgefunden haben würde.
Eines Morgens fehlte Babette. Alle dachten, Jana würde den Grund wissen und dem Lehrer für eine entsprechende Eintragung ins Klassenbuch bekanntgeben. Aber Jana war oder stellte sich unwissend. Ich glaubte das nicht. Sie musste mehr wissen, da die beiden zuletzt, seit dem widrigen Vorfall, ziemlich gut miteinander harmonierten und ihre gesteigerte Freundschaft auch gegenüber dem Rest der Klasse demonstrierten. Warum rückte sie nicht mit der Sprache heraus? Um zehn Uhr, also zwei Stunden nach Unterrichtsbeginn, tauchte Babette auf. Sie gab Kopfschmerzen für ihr Fernbleiben in den ersten beiden Schulstunden an.
„Siehst du, wie leer ihr Blick ist?“, sagte ich zu Bert.
„Das Herumtreiben in der Nacht wird ihr nicht gut bekommen“, antwortete dieser mit gezielt gleichgültiger – heute würde man sagen: cooler – Stimme.
„Weißt du das sicher, dass sie in der Nacht unterwegs ist?“
„So sicher wie das Amen im Gebet!“
„So hast du sie gesehen“, bohrte ich weiter.
„Hab ich nicht. Aber was ich jetzt sehe, genügt mir. So sehen sie alle aus am nächsten Tag, wenn sie die Nacht im Soho verbracht haben.“
Das Soho war eines der beiden Nachtcafes in dem Schulstädtchen. Für Schüler war der Besuch dort verboten, daher umso attraktiver: ein hochwertiger Erfolg für den, der sich dorthin traute. Wer sich dort herumtrieb, war erwachsen. Wen die dort hineinließen, der sah auch erwachsen aus, war die logische Schlussfolgerung und allgemeine Meinung. Und alle, die nicht hineinkamen oder sich nicht trauten, und auch die, welche dort waren, wussten Gerüchte zu verbreiten, wie es dort zuginge, wer dort verkehrte, was man dort angeboten bekäme. Dass das noch keinen Ärger mit den Behörden gegeben hatte! Also, eine Razzia habe es schon einmal gegeben, hieß es. Und neulich haben sie einen abgeführt. Wahrscheinlich wegen Drogen. Nein, der hat einen niedergestochen, wusste ein anderer. Also in diesem Soho verkehrte jetzt Babette!?
„Die schauen dann so aus“, gab sich Bert erfahren wie ein routinierter Psychologe.
Ich war überzeugt, dass Bert sich hier bloß aufspielte. Trotzdem ließ mich der Gedanke nicht los: War das möglich? Oder war es nur dem Geltungstrieb eines Angebers entsprungen? Sie sah tatsächlich blass aus. Hatte sie nicht auch dunkle Schatten um die Augen? Unregelmäßig. Von schlecht entfernter Schminke? Oder war sie krank?
Das Klima in der Klasse ließ nicht zu, dass man einfach jemandem nach seinem Befinden fragte. Und Babette fragte man erst recht nicht. Denn Mitgefühl verdiente sie nicht, gewiss nicht. Daher nur keine Worte, die alle anderen wieder als Anbiederung verstehen würden!
Ich bemerkte, dass auch Albin Babette nach ihrem verspäteten Eintreffen aufmerksam beobachtete. Vielleicht wusste Albin doch mehr, als er mir sagen wollte? Daher machte ich mich in der nächsten Pause an ihn heran. Er stand mit Helmut und Martin beisammen. Die beiden mochte ich ganz gut leiden und fühlte mich stark genug, das Gespräch auf Babette zu bringen. Sie hatten aber kein sonderliches Interesse daran. Bis Stefan dazu stieß. Der platzte gleich heraus:
„Habt ihr sie auch gesehen? – Alle haben sie doch gesehen!“
„Ich habe sie auch gesehen“, setzte Albin lakonisch hinzu.
„Du? – Weißt du wirklich, wovon ich rede?“ – Stefan wollte offenbar sicher gehen, dass er nicht kostbare Zeit mit ahnungslosen Wichtigtuern vergeuden würde.
„Wird wohl was mit Babette zu tun haben“, stocherte Albin vorsichtig in diesem Wörterbrei herum, um sich nur ja nicht zu blamieren. Stefan wusste nicht, wie er dran war. Konnte er hier mit einer Neuigkeit brillieren oder würde man ihn gleich belächeln, weil er etwas zum Besten gab, was ohnehin schon alle wussten. Daher begann er vorsichtig, erneut seine Ware, deren Wert ihm nicht ganz klar war, anzupreisen:
„Der Freger hat mir was Schlimmes erzählt.“
Freger war ein zugleich geachteter und gefürchteter Mitschüler aus einer höheren Klasse, dem damaligen Maturajahrgang. Er war ein guter Schüler. Aber er kannte sich nicht nur in den Schulbüchern aus. Er hatte den Ruf, seine Fühler nach Dingen auszustrecken, die jüngeren Mitschülern noch verborgen waren. Das machte ihn interessant. Was er erzählte, wurde geglaubt, jedenfalls von den meisten, jedenfalls das meiste. Wenn sich jemand erdreistete, eine seiner Behauptungen anzuzweifeln, konnte er auch ungemütlich werden. Dann musste man sich in Acht nehmen. Wenn er etwas in Umlauf brachte, was den Ruf gefährdete, stand der Betroffene am „Pranger“. Viele Schüler waren im Zweifel nicht für, sondern gegen einen Angeklagten. Denn es stellte sich immer heraus, dass Freger gut informiert war und keine haltlosen Gerüchte verbreitete.
„Wenn es der Freger sagt, muss was Wahres dran sein“, bestätigte Martin daher fast erwartungsgemäß schon im Voraus Stefans Andeutung.