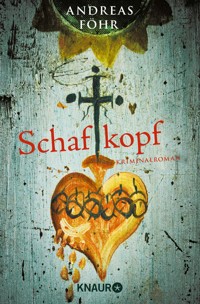Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: argon
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Wallner & Kreuthner Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein weiterer Wallner & Kreuthner-Regionalkrimi von Bestseller-Autor Andreas Föhr: Die Kripo Miesbach unter Leitung von Kommissar Clemens Wallner ermittelt in gleich zwei mysteriösen Fällen, die im beschaulichen Bayern die Gemüter erhitzen. Ein Bestattungsunternehmer versinkt mitsamt seinem Leichenwagen in der Mangfall, während gleichzeitig eine junge Frau aus Warngau verschwindet. Ihr Wagen wird kurz darauf in der abgelegenen Wolfsschlucht gefunden – aufgespießt von einem Maibaum. Im Lauf der Ermittlungen stellt sich heraus, dass beide Ereignisse auf eigenartige Weise zusammenhängen – und dass bei beiden Wallners anarcho-bayerischer Kollege Leonhardt Kreuthner seine Finger im Spiel hat, dem ein scheinbar genialer Plan aus dem Ruder gelaufen ist. Hat Kreuthner es diesmal zu weit getrieben? Und was hat das Verschwinden von Bianca Stein damit zu tun? Andreas Föhr, der auch Drehbücher für "Der Bulle von Tölz" schreibt, lässt die eigenwilligen Protagonisten seiner Regionalkrimi-Reihe aus Bayern zu Höchstform auflaufen: ein spannender Fall, dem wie gewohnt der trockene Humor nicht fehlt. Föhr ist ein versierter Erfinder abgedrehter Plots, und Humor beweisen seine stimmigen Dialoge auch. Wer gerne Regionalkrimis liest, wird hier gut bedient. Süddeutsche Zeitung Wer den Bayernkrimi mag, für den ist dieses Buch eine Pflichtlektüre! Artikeldienst-online.de Andreas Föhr hat wieder ein Buch geschrieben, das die Herzen von Regionalkrimi-Fans höherschlagen lässt. Spannend und humorvoll. FREUNDIN Lesenswert, auch für Nicht-Bayern! Freizeit Revue Alle Bände der Wallner & Kreuthner-Regionalkrimis aus Bayern: Band 1: Prinzessinnenmörder Band 2: Schafkopf Band 3: Karwoche Band 4: Schwarze Piste Band 5: Totensonntag Band 6: Wolfsschlucht Band 7: Schwarzwasser Band 8: Tote Hand
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Andreas Föhr
Wolfsschlucht
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Die Kripo Miesbach unter Leitung von Kommissar Wallner ermittelt in gleich zwei mysteriösen Fällen: Ein Bestattungsunternehmer versinkt mitsamt seinem Leichenwagen in der Mangfall, während gleichzeitig eine junge Frau verschwindet. Ihr Wagen wird kurz darauf in der abgelegenen Wolfsschlucht gefunden, aufgespießt von einem Maibaum. Im Lauf der Ermittlungen stellt sich heraus, dass beide Ereignisse auf eigenartige Weise zusammenhängen – und dass bei beiden Wallners anarcho-bayerischer Kollege Leonhardt Kreuthner seine Finger im Spiel hat, dem ein scheinbar genialer Plan aus dem Ruder gelaufen ist.
Inhaltsübersicht
Widmung
1. Kapitel
Holzkirchen
Einige Kilometer entfernt
Holzkirchen
2. Kapitel
Mangfalltal
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
Fünf Tage vorher
70. Kapitel
Danksagung
Für Bärbel und Klaus
1
Holzkirchen
Die Alpen waren nah an diesem Abend. Auf Wallberg und Hirschberg lagen Schneereste, die Zweitausender dahinter leuchteten weiß. Der April war mild in diesem Jahr. Bianca Stein saß auf der Terrasse ihres Hauses und betrachtete die Alpenkette, ohne sich an dem Anblick zu erfreuen. Im Whisky bildeten sich zitternde kleine Wellen, als sie das Glas zum Mund führte. Die malzige Hitze, die sich in ihren Eingeweiden ausbreitete, beruhigte sie, und als sie das Glas absetzte, blieb die Flüssigkeit ruhig. Sie schloss die Augen. Das Pochen der Schläfenadern verursachte einen stechenden Schmerz oberhalb ihrer linken Braue.
Sie war mit dem Kopf gegen die Schreibtischkante geprallt, und der helle Teppichboden in ihrem Büro hatte rote Flecke bekommen. Er muss schnellstmöglich ausgewechselt werden, dachte sie, während sie das Glas noch einmal an die Lippen hob. Platzwunden auf der Stirn seien sehr ergiebig, hatte man ihr im Krankenhaus versichert. Vier Stiche musste der Assistenzarzt in der Notaufnahme setzen. Er hatte sie skeptisch angesehen, als sie sagte, sie sei gestolpert. Das war ihr egal. Mehr Sorge hatte ihr bereitet, dass der Assistenzarzt jung war und unerfahren. Begriff er überhaupt, was eine Narbe im Gesicht für eine Frau bedeutete? Wie viele Platzwunden hatte er schon genäht?
Das Telefon klingelte. Es war Isabell, ihre Mutter.
»In der Arbeit haben sie gesagt, du musstest ins Krankenhaus? Um Himmels willen – was ist passiert?«
Bianca erzählte es.
»Mein Gott! Auf die Schreibtischkante! Das kommt davon, wenn man am Wochenende ins Büro geht.« Es folgte eine Pause, in der Isabell etwas trank, Wein vermutlich. Bianca konnte es ihr kaum vorhalten mit einem Glas Whisky in der Hand. »Wie geht es dir jetzt?«
»Schlecht.«
»Ja, ich weiß. Narben sind was Fürchterliches.«
»Mitten im Gesicht! Ich hätte auch mit dem Hinterkopf draufknallen können. Aber nein!« Bianca schniefte und kämpfte mit den Tränen.
»Vielleicht wächst die Augenbraue ein bisschen drüber. Man muss ja nicht immer so dünn zupfen.«
»Ich will aber nicht aussehen wie Breschnew! Was redest du da?«
»Tut mir leid, Spatz. War nur ein Vorschlag.« Es folgte eine weitere Getränkepause. »Um was ging es denn bei dem Streit?«
Bianca überlegte kurz, ob sie ihre Mutter einweihen sollte. Aber das war noch zu früh. Sie wollte erst Gewissheit haben. Außerdem war sie sich nicht sicher, inwieweit sie ihrer Mutter trauen konnte. Vielleicht wusste sie es schon seit Jahren. »Das Übliche. Ich hab ihm gesagt, dass wir bald pleite sind, wenn er so weitermacht. Das hört er nicht gern.«
»Ah ja?«
Isabell war fern aller Lebenswirklichkeit und Alkoholikerin. Umso mehr staunte Bianca über das feine Gespür ihrer Mutter. Kein Zweifel – sie ahnte, dass es diesmal um mehr gegangen war. Bianca schwieg.
»Kann ich dir irgendwie helfen?«
»Im Augenblick nicht. Aber es kann sein, dass ich dich bald brauche. Es wäre schön, wenn du dann wirklich da wärst.«
»Ich … ich bin da.« Isabell machte eine weitere Pause, aber es schien Bianca, dass sie diesmal nicht trank. »Du machst mir Angst. Aber ich bin da, okay?«
»Ich melde mich. Ciao.«
Bianca legte auf. Sie hatte Angst. Angst vor dem Kampf, der ihr bevorstand. Vor der Auseinandersetzung und dass sie sich vielleicht auf lange Zeit mit anderen Menschen zerstreiten würde. Diese Furcht war normal und vernünftig. Aber dann saß da noch die andere Angst in ihrem Bauch. Eine naive, abgrundtiefe Angst, wie sie Kinder hatten oder vielleicht Menschen im Mittelalter. Bianca war weder Kind noch im Mittelalter verhaftet. Sie war Anfang dreißig, hatte ein Studium absolviert und arbeitete erfolgreich als Marketingmanagerin einer Privatklinik. Und dennoch hatte sie eine ganz und gar irrationale Angst. Angst vor einer Frau mit roten Haaren und stechend grünen Augen. Angst vor einer Hexe …
Einige Kilometer entfernt
Es war fast dunkel, und die Temperaturen zogen an. Windlichter brannten im Kreis um den Kraftort über dem Erdstall – fünfzig Schritte vom Bauernhaus, zwölf von der Esche. In der Mitte des Kreises ein paar Damenhandschuhe aus Schweinsleder, teuer und wenig getragen. Unter den Handschuhen ein Pentagramm, das Stefanie Lauberhalm oben an der Ätherspitze beginnend zunächst nach links unten gezogen hatte, wo sich die Spitze befand, die das Prinzip der Erde symbolisierte. Die Reihenfolge der übrigen vier Striche ergab sich von selbst: Wasser, Luft und Feuer. Der letzte Strich zurück zum Äther vollendete den Drudenfuß.
Stefanie war sechsunddreißig Jahre alt, ihr Haar rot und kurz geschnitten, das Gesicht länglich mit einem energischen Kinn (es erinnerte entfernt an die Nofretete) und einem Mund, der die meiste Zeit, so hatten viele Mitmenschen den Eindruck, spöttisch lächelte. Waren ihre Augen nicht wie jetzt geschlossen, strahlten sie in einem Grün, das man sonst nur von Gletscherbächen kennt: eisig und hell. Stefanie war in eine Decke gehüllt und wiegte ihren Körper vor und zurück, die Lippen bewegten sich lautlos.
Es war still in dieser kühlen Frühlingsnacht. Nur vom nahen Bach gingen glucksende Geräusche aus. In dieser Stille hörte sie die Schritte, als sie noch beim Haus waren. Die Füße strichen über die ungemähte Frühlingswiese und zerknickten hin und wieder einen trockenen Zweig, der vom Winter übrig war.
»Was tust du?« Ansgar stellte sich an den Rand des Lichterkreises.
»Ich meditiere«, antwortete sie.
»Über Handschuhe?«
»Über Handschuhe.«
»Es sind die Handschuhe, die sie neulich vergessen hat, nicht wahr?«
Stefanie schwieg und wartete, dass er gehen würde. Er blieb.
»Warum machst du das?«
»Meditieren?«
»Schwarze Magie.«
»Was kümmert’s dich? Du glaubst doch sowieso nicht dran.«
»Schwarze Magie vergiftet die Seele. Die Seele desjenigen, der sie betreibt. Und sie fällt dreifach auf dich zurück.«
»Willst du mir Vorträge über Magie halten?«
»Das sind deine eigenen Worte. Und ich glaube, das siehst du ganz richtig. Es stimmt, unabhängig davon, ob der Hokuspokus funktioniert oder nicht.«
»Wir hatten doch vereinbart«, sie drehte sich zu Ansgar und richtete ihre grünen Augen auf ihn, »dass du nicht abfällig über meine Kunst redest.«
»Tut mir leid.« Er betrachtete das Arrangement um Stefanie herum, hatte die Hände in den Hosentaschen und schien unschlüssig, was er tun sollte.
»Warum bist du gekommen?«
»Weil ich mir Sorgen mache um dich.«
»Das musst du nicht. Schwarze Magie ist in Ordnung, wenn sie für ein gutes Ziel eingesetzt wird. Mein Seelenheil ist also nicht in Gefahr.«
Ein gequälter Ausdruck legte sich auf sein Gesicht. »Zu behalten, was man durch schwarze Magie gewonnen hat? Ist das ein gutes Ziel?«
Stefanie wandte ihren Blick wieder nach vorn. »Lass mich noch ein bisschen meine Seele vergiften. Du könntest inzwischen das Spaghettiwasser aufsetzen.«
Als er durch die nächtliche Frühlingswiese zurück zum Haus stapfte, ärgerte sich Ansgar. Stefanie gab ihm das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Es hätte umgekehrt sein müssen. Sie war diejenige, die an okkulte Kräfte glaubte, an Magie und allen möglichen anderen Unfug, nicht er. Er war der Erwachsene in dieser Beziehung, der sich mit mildem Spott über den Aberglauben und das kindliche Gemüt seiner Frau hätte erheben müssen. Aber irgendwie hatte er in gewissen Momenten das Gefühl, die Welt funktioniere doch anders herum, als sei Hexenzauber Realität und seine Zweifel daran naiv. Ja, manchmal überkam ihn so ein Gefühl – manchmal. Er warf einen letzten Blick zurück auf Stefanie, die sich unter der Wolldecke im Kreis der Windlichter vor- und zurückwiegte, und ihm wurde unbehaglich. Als er das Haus betrat, lag da ein Volleyball neben der Eingangstür. Seit ein paar Tagen spielte niemand mehr damit. Ansgar trat ihn wütend in die Nacht.
Holzkirchen
Die Nachricht war unscheinbar. Die Werbemail einer Autovermietung mit Namen CrimsonRent, in der als Frühlingsspecial Cabrios zu Sonderkonditionen angeboten wurden. Wer immer Biancas E-Mail-Account ausspionierte, würde dieser Mail keine weitere Aufmerksamkeit widmen. Es sei denn, er wüsste, dass eine Autovermietung dieses Namens nicht existierte. Aber wer wusste das schon. Auch dem Inhalt der Nachricht konnte man nichts entnehmen. Aus dem einfachen Grund, dass sie nach außen keinen Inhalt hatte, der über das Angebot der fiktiven Autovermietung hinausging. Für Bianca Stein aber hielt sie eine interessante Information bereit: In ihrem toten Briefkasten war Post angekommen. Manchmal kam ihr das ein bisschen albern vor und sie vermutete, dass sich ihr Auftragnehmer darin gefiel, Geheimdienst zu spielen. Andererseits – vielleicht hatte er recht. In diesen Zeiten konnte man nicht vorsichtig genug sein, vor allem was die elektronische Kommunikation betraf.
Ob sie heute Abend noch nach Warngau fahren sollte? Sie hatte getrunken und fühlte sich schwindlig. Andererseits – es war womöglich die alles entscheidende Information, auf die sie wartete. Bianca Stein zog eine Lederjacke an, nahm ihre Autoschlüssel aus der Schale vor dem Spiegel im Flur und verließ die Wohnung.
Der Wagen stand am Straßenrand vor dem Haus. Heute war sie zu bequem gewesen, um auszusteigen und das Einfahrtstor aufzumachen, in das Dennis immer noch keinen Elektromotor hatte einbauen lassen. Alles war ruhig, als sie sich dem Wagen näherte. Die Nachbarn waren zu Hause und saßen vor ihren Fernsehgeräten. Das Ploppen der Türknöpfe hallte durch die Nacht, als Bianca die Fernbedienung drückte. Aus einem Grund, den sie nicht benennen konnte, hatte sie das Gefühl, als sei noch jemand in der Straße. Sie sah an den geparkten Autos entlang. Aber da war niemand.
Bianca verließ Holzkirchen in südlicher Richtung, fuhr auf der B 318 bis Oberwarngau, bog von der Bundesstraße in östlicher Richtung ab und gelangte drei Minuten später nach Osterwarngau. Schon in Holzkirchen, bald nach Fahrtbeginn, hatte sie den Eindruck, dass ihr ein Auto folgte. Allerdings war die B 318 um diese Zeit noch stark befahren. Deshalb konnte sie nicht mit Gewissheit sagen, ob eines der vielen Scheinwerferpaare schon länger hinter ihr war. Als sie in Oberwarngau Richtung Osten abgebogen war, tauchte alsbald wieder ein Wagen hinter ihr auf, bog jedoch kurz darauf in eine Seitenstraße ab. In Osterwarngau bemerkte sie erneut einen Wagen, der im Abstand von etwa hundert Metern hinter ihr fuhr. Kurz vor dem Ortsende bog Bianca Stein nach links ab und wartete ab, was passieren würde. Ein paar Sekunden später kam der andere Wagen vorbei, fuhr jedoch auf der Hauptstraße weiter. Bianca atmete durch.
Sie fuhr den Wagen in eine Parkbucht und stellte ihn ab. Es war kein anderes Auto zu sehen. Sie stieg aus und ging zu Fuß auf dem kleinen Weg zum Friedhof mit der alten Pfarrkirche von Osterwarngau. In einem der Gräber lag Biancas Großvater. Jemand hatte ein Totenlicht auf das Grab gestellt. Bianca nahm den roten Plastikbecher, in dem die Kerze stand, tastete mit den Fingern die Unterseite ab und förderte einen kleinen USB-Stick zutage.
Als sie zum Parkplatz zurückkam, stand dort ein weiterer Wagen. Bianca sah sich um. Etwas stimmte hier nicht. Ihr Herz schlug schneller. Sie versuchte, in der Dunkelheit zu erkennen, ob jemand am Steuer saß. Doch der Wagen war leer. Der Fahrer musste vor kurzem ausgestiegen und irgendwohin gegangen sein. Und in dem Moment, als sie das dachte, fiel ihr auf, dass sie kein Licht gesehen hatte. Irgendein Licht hätte sie sehen müssen, denn die Scheinwerfer des Wagens deuteten in Richtung Friedhof. Auch erinnerte sie sich, ein Motorengeräusch gehört zu haben, als sie am Grab kniete. Das konnte nur bedeuten, dass der Fahrer die Scheinwerfer ausgeschaltet hatte. Bianca wurde heiß, Schweiß brach ihr am ganzen Körper aus, und ihr Herz begann zu rasen. Sie ging mit wackeligen Knien auf ihren Wagen zu, der hinter dem anderen Fahrzeug stand. Aus dem Augenwinkel sah sie, dass sich etwas auf der anderen Straßenseite bewegte. Doch sie hatte nicht den Mut, hinzusehen. Stattdessen ging sie schneller und riss den Wagenschlüssel aus der Jackentasche. Sie tat es so hektisch, dass der Schlüssel auf den Boden fiel. Auf den Knien tastete sie im Schatten ihres Wagens danach. Gleichzeitig spielte sich etwas in ihrem Rücken ab. Sie spürte es mehr, als dass sie es sah: Jemand war aus dem Dunkel des gegenüberliegenden Gebäudes herausgetreten und kam mit schnellen Schritten auf sie zu. Biancas Finger ergriffen einen klirrenden Gegenstand, der Wagenschlüssel blitzte silbern. Sie sprang auf, ohne sich umzudrehen, drückte auf die Fernbedienung, die Türknöpfe gingen nach oben, sie riss die Tür auf.
In diesem Augenblick legte sich von hinten eine Hand auf ihr Gesicht, darin ein weißes Tuch. Der chemische Geruch kam Bianca bekannt vor. Chloroform, schoss es ihr durch den Kopf. Sie versuchte, die Hand wegzudrücken, und duckte sich nach unten. Als sie auf allen vieren davonkriechen wollte, wurde sie an den Haaren gepackt und hochgerissen, sie griff nach der Hand an ihren Haaren, verlor das Gleichgewicht und schlug heftig mit dem Kopf auf.
2
Mangfalltal
Die Christl meint immer, an Zinksarg bräucht’s net. Ja klar is der teuer, und dann steht er vielleicht jahrelang im Laden umeinand. Aber jetz stell dir vor, da kummt einer und sagt, er möcht seine Oma, also die sollt praktisch in die Familiengruft. Und ob er mal an Sarg anschauen kannt.« Florian Scheffler trank, durstig von seinem Vortrag, einen ordentlichen Schluck Bier und wischte sich den Schaum vom Mund. Seine Zunge ging schwer, es war die neunte Halbe. »Und dann hast du keinen Zinksarg. Den braucht’s halt für a Gruftbesch… schattung. So was musst du anbieten können. Sonst bist du nicht … konkurrenzfähig.« Für den Schluss des Satzes brauchte Scheffler mehrere Anläufe. »Ja gut, ob des jetzt einer mit Fenster sein muss, da kann man drüber reden, net? Aber ha… haben musst du einen!«
Der in Zivil anwesende Polizeiobermeister Leonhardt Kreuthner gähnte heftig, und als er damit fertig war, sagte er: »Jetzt hör endlich mit dem Scheißzinksarg auf. Was is ’n mit dera G’schicht, wo du vorhin so halb ang’fangen hast? Wo mir uns wundern täten, was es alles gibt beim Beerdigen?«
»Die? Ja des is ja, des fällt ja praktisch unter meine Verschwiegenheitspflicht.« Auch für dieses Wort musste Scheffler mehrfach ansetzen. »Da kann ich gar nix erzählen. Aber um noch amal auf den Zinksarg zurückzumkommen: Des is nämlich so …«
»Na, Flori«, unterbrach ihn Kreuthner. »Es reicht. Und weißt was? Heut bist fällig!«
Was dann folgte, war die erste Gerichtsverhandlung, die je in den Mauern des Wirtshauses Zur Mangfallmühle abgehalten wurde. Und dass man überhaupt dort zu Gericht saß, hatte etwas ganz Eigenes.
Die Mangfallmühle galt zu Zeiten, als Peter Zimbeck die Geschäfte führte, als das am übelsten beleumundete Lokal im ganzen Landkreis. Das heruntergekommene Wirtshaus im Flusstal zog Gesindel an wie ein Kuhfladen die Fliegen. Nach Zimbecks unerwartetem Tod vor fünf Jahren war das Haus eine Zeitlang leer gestanden, bis Harry Lintinger, Schrottplatzbesitzerssohn und Kleinkrimineller, die Wirtschaft vor drei Jahren pachtete und es fertigbrachte, innerhalb kürzester Zeit den alten Ruf wiederherzustellen. Kreuthner war schon in der Zimbeckschen Mangfallmühle Stammgast gewesen und war es jetzt wieder.
Mit Harry Lintinger verbanden Kreuthner unter anderem gemeinsame Geschäftsinteressen. Ebenfalls vor drei Jahren war nämlich Kreuthners Onkel Simon gestorben und hatte seinem Neffen eine alteingesessene Schwarzbrennerei hinterlassen. Da hatte es sich zwanglos ergeben, dass Kreuthner die Mangfallmühle mit den Erzeugnissen seines Nebengewerbes versorgte, erdigen Destillaten, die ihre Geschmacksnote einem gediegenen Anteil an Fettsäureestern, Terpenen, Aldehyden und einigen anderen Substanzen verdankten, die gewöhnlich unter dem Begriff Fuselöl zusammengefasst wurden. Man könnte nun mit einigem Recht sagen, dass es Kreuthners Bränden an Finesse mangelte. Andererseits hatte das auch sein Gutes. Kreuthner füllte nämlich seinen aus diversen Obstsorten verschnittenen Einheitsbrand in die leeren Schnapsflaschen, die ihm Harry Lintinger aus der Mangfallmühle mitgab. Vor dem Abfüllen spülte Kreuthner die Schnapsreste sehr behutsam aus, so dass die alten Etiketten (ebenso wie die den Flaschen anhaftenden Keime) unversehrt blieben. Infolgedessen lag es ganz im Walten des Zufalls, ob aus Kreuthners Brand eine Williams Birne, ein Zwetschgenwasser oder ein Schlehengeist wurde. Dank des rauhen Geschmacks war es unmöglich, festzustellen, dass etwas anderes in der Flasche war, als das Etikett vorgab, und in drei Jahren hatte es nicht eine Beschwerde von Lintingers Gästen gegeben.
Florian Scheffler übte den Beruf des Bestattungsunternehmers aus. Seine Zechkumpane in der Mangfallmühle waren sicher, dass die Branche so manche pikante oder deftige Geschichte hergab. Florian Scheffler jedoch machte allenfalls Andeutungen, berief sich im Weiteren aber auf seine berufliche Schweigepflicht. Stattdessen erzählte er öde Dinge über unterschiedliche Sargformen und dass die Stadt Tegernsee den Ausweis eines zusätzlichen Parkplatzes vor seinem Geschäft verlangte. Den Streit mit seiner Frau über das Thema Zinksarg etwa hatte er schon mehrfach zum Besten gegeben, und die Geschichte war nach allgemeiner Ansicht nicht nur langweilig, sondern das Langweiligste, was Florian Scheffler je erzählt hatte. Hinzu kam, dass man ihn schon mehrfach ermahnt hatte, keine langweiligen Geschichten zu erzählen. Objektiv betrachtet, mochte die Zinksargepisode nicht die allerlangweiligste seiner Geschichten gewesen sein. Aber an diesem Abend hatte Florian Scheffler den Bogen einfach überspannt.
Daher forderte Kreuthner eine harte Bestrafung, damit die Mangfallmühle künftig von Schefflers langweiligen Geschichten verschont bleibe. Der Vorschlag wurde per Akklamation johlend angenommen. Allerdings meldete sich ein gewisser Schinkinger-Joe zu Wort und gab zu bedenken, dass man einen Mann, wie abscheulich seine Taten auch sein mochten, nicht ohne ordentliches Gerichtsverfahren bestrafen dürfe. Mit Strafprozessen hatten viele der Wirtshausgäste Erfahrung, wenn auch meist keine guten. Dennoch wurde dem Vorschlag zugestimmt, versprach er doch ein grandioses Spektakel. Schinkinger-Joe (seinen wahren Namen kannte allenfalls die Polizei) hatte in jungen Jahren ein paar Semester Jura studiert und sich damals etwas voreilig eine schwarze Anwaltsrobe gekauft, die er jetzt aus dem Wagen holte und anlegte. Er nahm am Ende eines langen Tisches Platz und erklärte sich zum Richter in der Causa Scheffler. Den Ankläger gab Kreuthner, dem es auch oblag, den Straftatbestand zu formulieren. Die Anklage lautete, Freunde, andere Anwesende und überhaupt jeden mit faden Geschichten zu Tode gelangweilt zu haben – ein schwerwiegender Vorwurf in einem Wirtshaus. Kreuthner war sich sicher, eine lückenlose Beweiskette präsentieren zu können. Sein Kollege und Freund Sennleitner wurde zum Verteidiger bestimmt und nahm das Amt gegen jede innere Überzeugung an. Zu viert schleiften sie den Angeklagten an den Richtertisch – nicht weil er widersetzlich war, sondern so betrunken, dass er die fünf Meter nicht mehr aus eigener Kraft zurücklegen konnte.
Im Laufe der Verhandlung bot Kreuthner mehrere Zeugen auf, die versicherten, kein Mensch auf Erden habe sie jemals so gelangweilt wie der Angeklagte. Auch Harry Lintinger, der Wirt, wurde in den Zeugenstand berufen und erinnerte an die Geschichte, wie Scheffler einmal einen Strafzettel bekommen hatte. Ein leidvolles Stöhnen ging durch die Zuschauer, und selbst der Vorsitzende Richter vergaß für einen Moment die Würde seines Amtes und verbarg sein schmerzverzerrtes Gesicht in den Händen. Die Bemühungen der Verteidigung erschienen nach dieser für den Angeklagten desaströsen Beweiserhebung als nachgerade sinnlos. Doch Sennleitner packte der Ehrgeiz, und er holte aus ferner Vergangenheit einen Abend hervor, an dem der Angeklagte eine Geschichte erzählt und tatsächlich jemand gelacht hatte. Zwar konnten sich einige der Anwesenden an dieses denkwürdige Vorkommnis erinnern, doch stellte sich heraus, dass der Lacher ein norddeutscher, des Bairischen unkundiger Gast war, der aus nicht nachvollziehbaren Gründen gedacht hatte, Scheffler habe einen Witz erzählt. Somit blieb Sennleitner nur, anzuführen, dass der Angeklagte so gut wie jeden Abend in der Mangfallmühle verkehre und nie unter zehn Halben die Heimfahrt antrete, sich folglich um den Erhalt des als Gerichtsstätte dienenden Gasthauses enorme Verdienste erworben habe, was bei der Strafzumessung nicht unberücksichtigt bleiben dürfe.
Der Zwischenruf »Das Maul soll er halten!« veranlasste den Vorsitzenden Schinkinger-Joe mit einem Hammer auf den Wirtshaustisch zu hauen. Dann fragte er den Angeklagten, der dem Prozess bislang mit stoischer Miene beigewohnt hatte, ob er noch etwas zu sagen wünsche. Der nickte mit glasigem Blick, und der Vorsitzende forderte ihn auf, sich kurz zu fassen. Hier handelte es sich freilich um ein Missverständnis. Florian Scheffler hatte nicht genickt, sondern der Kopf war ihm auf die Brust gefallen, wie jetzt, da er seitlich vom Stuhl sackte, offenbar wurde. Und so kam es, dass der Angeklagte die Urteilsverkündung nicht bei Bewusstsein erlebte.
Das Strafmaß wurde ausgiebig diskutiert. Dabei war zu berücksichtigen, dass der Angeklagte sich seiner Bestrafung im Augenblick durch Ohnmacht entzogen hatte. Kreuthner plädierte dafür, die Strafe bei Wiedererwachen zu vollstrecken. Aber da keiner Lust hatte, so lange zu warten, beschloss man, Scheffler mitsamt seinem Leichenwagen in die Mangfall zu stellen. Kreuthner kannte ganz in der Nähe eine Stelle vor einer Wasserstufe, an der der Fluss nur knöcheltief war. Wenn man den Wagen mit der Fahrertür ganz nah an den Rand der Wasserstufe stellte, standen die Chancen gut, dass der verkaterte Scheffler morgens beim Aussteigen zwei Meter nach unten flog und im tiefen Wasser landete. Anschließend müsste er seinen Wagenschlüssel auslösen; über den Preis könnten sie in der Zwischenzeit beraten. Schefflers schlaffer Körper wurde unter Beteiligung fast aller Gäste hinausgetragen und in seinen Wagen gesetzt. Ein junger Mann, der stets mit Laptop in der Wirtschaft saß und allgemein als der Dude bekannt war, erbot sich, das Ganze ins Internet zu stellen. Die anderen Gäste erboten sich, dem Dude sämtliche Knochen zu brechen, falls er das tun sollte.
Die Nacht war dunkel. Nur eine dünne Mondsichel warf Licht auf den Leichenwagen, der schwarz und würdevoll im Fluss stand, am Rande eines kleinen Wasserfalls. Im Dunkel der Ufervegetation leuchteten rote Punkte. Das waren keine Glühwürmchen, das waren die Zigaretten der Männer, die den Wagen samt Fahrer in den Fluss geschafft hatten. Es war nicht so einfach gewesen, wie sie gedacht hatten, sondern mühevoll und schweißtreibend. Umso zufriedener blickten sie auf ihr Werk.
3
Montag früh, acht Uhr zwanzig, feuchtkalte Aprilwitterung in Tegernsee. Kreuthner und Sennleitner standen in Uniform an dem einzigen Stehtisch vor einem Kiosk. Einer schwarzen Tafel war zu entnehmen, dass man hier Coffee to go kaufen konnte, darunter in etwas kleinerer Schrift: auch zum Mitnehmen. Am Straßenrand der Streifenwagen. Der Dienst hatte gerade begonnen, doch fühlten sich die beiden Beamten nach der anstrengenden Nacht noch nicht auf der Höhe ihrer Schaffenskraft. Kreuthner trank seinen Kaffee morgens ohne Milch und Zucker. Nicht dass er ihm so schmeckte. Aber er war überzeugt, dass er nur pur und schwarz seine volle Wirkung entfaltete. Und ein Hauch von Selbstkasteiung war auch dabei. Andere duschten morgens kalt. Aber so weit wollte Kreuthner dann doch nicht gehen. Schwarzer Kaffee musste genügen.
»Und?«, fragte Sennleiter mit halb geschlossenen Augen. »Ziehst es durch morgen, die …«, er senkte seine Stimme, »… Maibaumg’schicht?«
Kreuthner blickte sich um, ob jemand sie hören konnte. Dann nickte er mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen.
»Und den … weißt schon.« Jetzt blickte sich Sennleitner um. Niemand war in der Nähe. Dennoch wagte er nicht, Klartext zu reden. »Den kriegst?«
»Logisch«, nuschelte Kreuthner mit geschlossenen Zähnen. »Vitamin B. B wie Bergwacht. Verstehst, was ich mein?«
»Du Sauhund!« Sennleitner lachte anerkennend. Aus dem Streifenwagen meldete sich der Funk.
Die Zentrale bat die beiden Polizisten, zu einer Christiane Scheffler zu fahren, wohnhaft in Tegernsee. Die wolle ihren Mann als vermisst melden. Sennleitner sagte, das gehe klar, sie seien eh gerade vor Ort.
»Hockt der immer noch in der Mangfall?«, wunderte sich Kreuthner.
Christiane Scheffler hatte ein Hämatom unterm linken Auge und sah auch sonst äußerst besorgt aus, als sie Kreuthner und Sennleitner die Tür öffnete.
»Servus, Christl. Was is ’n los?«
»Stell dir vor: Heut Morgen, wie ich aufwach, is der Flori net da. Und ans Handy geht er auch net.« Christl versagte kurz die Stimme, und sie musste weinen. »Ich hab gesagt, sie sollen euch schicken. Weil ihr seid’s doch so oft in der Mangfallmühle.«
»Ja … so ab und zu mal.«
»Wisst’s ihr, ob der Flori gestern da war?«
Kreuthner sah zu Sennleitner, zuckte mit den Schultern und versuchte, ein ratloses Gesicht zu ziehen. Sie wollten Christl nicht direkt anlügen. Die Sache mit der Gerichtsverhandlung musste sie aber auch nicht unbedingt wissen. »Mir fahren mal zur Mangfallmühle und schauen, ob mir ihn finden. Der is gewiss noch da.«
»Glaubst? Ich mach mir arg Sorgen, dass ihm was passiert is.«
»Dem is nix passiert«, sagte Sennleitner.
»Du Christl …« Kreuthner blickte auf das Hämatom unter Christls Auge. »Ich möcht ja nix sagen, aber … bist wirklich scharf drauf, dass er wieder heimkommt?«
»Das?« Christl fasste an die Stelle. »Na, da bin ich versehentlich gegen an Türstock gelaufen. Hab einfach kurz net aufpasst.«
Kreuthner grunzte einen in seiner Bedeutung unklaren Laut, zuckte innerlich die Schultern und wandte sich zum Gehen. »Mir rufen dich an.«
Auf dem Weg zum Wagen hatte Kreuthner eine selbstlose Idee: Sie mussten ja noch eine Auslöse für Florian Schefflers Wagenschlüssel festlegen. Wie wäre es, wenn er die Christl einen Monat lang nicht verprügeln dürfe? Sennleitner hielt das im Prinzip für eine noble Idee, gab aber zu bedenken, ob ein ganzer Monat nicht zu hart wäre. Sie einigten sich auf zwei Wochen und bekamen ein bisschen feuchte Augen bei dem Gedanken, was für anständige Kerle sie waren.
»Ich fahr mit!«, sagte Christl, die plötzlich neben dem Streifenwagen stand.
»Des geht net. Des is versicherungstechnisch … is des schwierig. Wenn was passiert und so«, erklärte Sennleitner.
»Red keinen Schmarrn. Sonst lasst’s ja auch an jeden b’suffanen Deppen mitfahren.« Mit diesen Worten öffnete Christl die Hintertür und nahm im Fond des Wagens Platz.
»Wieso willst denn unbedingt mitfahren?«
»Ich trau euch net. Ich seh des, wenn jemand a schlechts Gewissen hat. Irgendwas war da gestern Abend.«
»Blödsinn«, sagte Kreuthner und fuhr los.
Die Mangfallmühle lag verschlafen im Morgennebel, als sie den Streifenwagen vor dem Wirtshaus parkten. Harry Lintinger kam mit Weißbier und Zigarette vor die Tür und machte einen stark übernächtigten Eindruck.
»Servus, Harry«, sagte Kreuthner. Und dann mit einer Grimasse, die Lintinger zur Vorsicht mahnen sollte: »Des is die Scheffler Christl.« Lintinger nickte verschlafen. Dann fragte Kreuthner, immer noch grimassierend: »Kannt des sein, dass der Flori hier bei dir is?«
»Der Flori? Na, des weißt doch, den hamma doch …«
»Weil die Christl sagt …«, fiel ihm Kreuthner laut ins Wort, »der Flori wär heut Nacht net heimkommen.«
Harry Lintinger sortierte seine Gedanken, schaute erst Kreuthner an, dann Christl Scheffler. »Ah, du bist die Christl … wo, wo …«
»Die Frau vom Flori. Richtig. Also der Flori is net da, oder?«
»Na, hier is er net.«
»Ja wo könnt er denn bloß sein?«, fragte Sennleitner mit erbärmlich gespielter Ratlosigkeit.
»Am End is der in der Mangfall«, schlug Lintinger vor.
Christl Scheffler starrte den Wirt irritiert an. »In der Mangfall? Wie kommst jetzt da drauf?«
»Mei – vielleicht is er mitm Auto neig’fahren. So was passiert. Wennst an Weg schlecht siechst. Nachts … zum Beispiel.«
»Was er meint«, sprang Kreuthner ihm bei, »is, dass der Flori gern amal zur Mangfall fahrt. Einfach zum Schauen, verstehst? Der Flori, der is … der is regelrecht vernarrt in den Fluss, oder?« Aufmunternder Blick zu Sennleitner.
»Ja, ja.« Sennleitner gefiel sich langsam in der Rolle des Volksschauspielers. »Die Mangfall, des is ja sein Ein und Alles. Da lasst er nix drauf kommen.«
»Ich könnt mir sogar vorstellen, wo er steckt. Der hat doch so a Lieblingsplatzerl, net weit von hier.«
»Ach, du meinst diesen Platz an dem Wasserfall! Da hast du recht. Da ist er ganz gewiss.«
Nachdem inzwischen auch Sennleitners Mimik und Gestik beim Schmierentheater angekommen waren, beschloss Kreuthner, die Sache abzuschließen. »Pass auf, Christl: Du bleibst hier beim Harry. Der macht dir an guten Kaffee. Und mir zwei«, er deutete auf Sennleitner und sich selbst, »schauen amal zur Mangfall.«
»Ich will keinen Kaffee. Ich komm mit.«
Kreuthner überlegte kurz, wie er Christl vom Mitkommen abbringen könnte. Aber es war klar, dass sie nicht mit sich reden lassen würde. Letztlich war’s egal. Dann sollte sie halt den Wagen im Wasser sehen mitsamt ihrem Mann drin, der wahrscheinlich immer noch seinen Rausch ausschlief. Er würde sich ohnehin nicht erinnern können, wie er da hingekommen war.
Der Weg zum Ufer war von Gestrüpp gesäumt, in dem freilich noch die Schneise sichtbar war, die Florian Schefflers Wagen gestern Nacht hinterlassen hatte. Kreuthner wies Christl auf die abgeknickten Zweige hin und meinte, man sei vermutlich auf der richtigen Spur. Wie sie dann am Ufer standen, war es doch etwas anders als erwartet. Da, wo gestern in mondbeschienener Dunkelheit Florian Schefflers Leichenwagen vor der Wasserstufe gestanden hatte, war jetzt – nichts. Kreuthner nahm die Dienstmütze ab und kratzte sich am Kopf. Auch Sennleitner musste sich kratzen. Es hatte inzwischen geregnet, und der Wasserstand war um einiges höher als gestern Nacht. Ein unbehagliches Gefühl überkam Kreuthner.
»Wo is er denn jetzt?«, fragte Christl ängstlich, denn es war mit Händen zu greifen, dass hier etwas nicht stimmte.
Kreuthner zuckte hilflos mit den Schultern und ging das Ufer entlang flussabwärts. Der Anblick, der ihn hinter der Wasserstufe erwartete, war bemerkenswert. Räder, Auspuff und der untere Wagenteil bis zur Stoßstange ragten aus dem Wasser. Fahrerkabine und Frachtraum lagen vollständig darunter.
4
Clemens Wallner, Leiter der Kripo Miesbach, saß morgens bei Kaffee und Bienenstich in seinem Büro und hatte Zeit gefunden, seiner Frau Vera eine Mail zu schreiben. Viel war im Augenblick nicht los im Landkreis. Für ein bisschen Aufregung sorgte lediglich ein Wolf in den Bergen, der eine Hirschkuh gerissen hatte und nachts von einer Überwachungskamera in Rottach gefilmt worden war. Wallners Mail an Vera betraf die Übergabe der gemeinsamen Tochter Katja am übernächsten Wochenende. Das Paar hatte sich getrennt, und Vera war mit Katja nach Würzburg gezogen. Jedes zweite Wochenende kam Katja zu ihrem Vater nach Miesbach. Wallner litt darunter, dass er keine ganze Familie mehr hatte, und das Haus, in dem er jetzt alleine mit seinem Großvater Manfred lebte, kam ihm oft gespenstisch leer vor, wenn kein Kinderlachen die Stille füllte.
»Servus, Clemens«, sagte Mike am Telefon. Mike Hanke, Wallners engster Mitarbeiter, nahm im Gegensatz zu seinem Chef das Leben meist von der lockeren Seite. Aber in diesem Augenblick klang er angespannt.
»Was ist denn los?«
»Nix is los. Also nix Ernstes. Der … der Manfred is grad da.«
»Hier? Auf der Polizeistation?«
»Äh … ja. Ich weiß auch net, was genau passiert is. Aber die Kollegen haben seine Personalien aufgenommen.«
»Die haben meinen Großvater festgenommen? Was um Himmels willen soll er denn gemacht haben?«
Wallner begab sich in die Eingangshalle der Polizeistation. Manfred saß auf einer Besucherbank an der Wand, den Gehstock mit beiden Händen umklammert, um den Hals ein Fernglas. Er war schon Mitte achtzig, aber noch leidlich mobil. Als Wallner seinen Großvater von weitem sah, gab es ihm einen Stich ins Herz. Er sah traurig und einsam aus und gar nicht nach dem, was man ihm vorwarf.
»Ja was machst denn du für Sachen?«, sagte Wallner, als er an Manfreds Bank herantrat. Er bemühte sich um einen heiteren Tonfall.
»Des war a Irrtum. Hat sich aber aufgeklärt.«
»Es hat geheißen, du … na ja, du hättest dich verirrt.«
»Hilf mir mal.« Wallner zog seinen Großvater am Oberarm von der Bank hoch. »Des war a ganz blöde G’schicht«, sagte Manfred ächzend und begann, sich mit kleinen Schritten Richtung Ausgang zu bewegen. »Mir is mein Stock in a Gebüsch gefallen. Und ich hab ihn nimmer g’funden.«
»Wie fällt denn ein Stock in ein Gebüsch?«
Manfred grunzte und ließ sich Zeit mit der Antwort. »Durch die Luft. Wie soll er sonst fallen?«
»Wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, Stöcke fallen senkrecht nach unten. Wenn du neben einem Gebüsch stehst, dann müsste der Stock ja waagerecht fallen, damit er im Gebüsch landet.«
»Nicht, wenn ich im Gebüsch steh. Wenn er mir da runterfällt, fällt er ins Gebüsch.«
»Was hast du in einem Gebüsch zu suchen?«
»Mei – was hab ich hier zu suchen? Was hab ich auf der Straß zu suchen? Was ham alte Leut überhaupts noch auf der Welt zu suchen? Entschuldige, dass ich mich noch net in Luft aufgelöst hab.«
»Jetzt wirst gerade ein bissl unsachlich.« Wallner öffnete Manfred die Tür nach draußen. »Ich wollte doch nur wissen, warum du in einen Busch gegangen bist. Ist doch ziemlich ungewöhnlich, oder?«
»Hab ich doch g’sagt: Mir is mein Stock reingefallen, und ich hab ihn suchen müssen.«
»So wie ich dich verstanden habe, bist du zuerst in das Gebüsch gegangen und dann ist dir dein Stock runtergefallen. Also kannst du eigentlich nicht reingegangen sein, um den Stock zu suchen.«
»Was weiß ich, ob er mir vorher oder nachher runtergefallen is. Wenn ich g’wusst hätt, dass ich an Bericht abliefern muss, hätt ich’s mir aufgeschrieben. Du bringst mich völlig durcheinand mit deiner Fragerei.«
»Tut mir leid. Das war nicht meine Absicht.« Wallner suchte seinen Wagen auf dem Parkplatz. »Wozu hattest du eigentlich das Fernglas dabei?«
»Fernglas? Ach so, das Fernglas.« Manfred nahm das Fernglas, das um seinen Hals hing, in die Hand und betrachtete es, als fiele es ihm zum ersten Mal auf. »Meine Augen werden halt immer schlechter. Es is a Elend, wennst alt wirst.«
Sie waren bei Wallners Wagen angekommen, doch er sperrte ihn noch nicht auf. »Okay, hören wir auf, um den heißen Brei herumzureden. Auf der anderen Seite von dem Gebüsch ist eine Grundschule. Ich denke, das weißt du.«
»Und?«
»Was glaubst du, denken die Leute, wenn du da mit einem Fernglas im Gebüsch sitzt?«
»Da is a alter Mann, werden s’ denken. Wahrscheinlich hat er was verloren im Gebüsch.«
»Nein, das denken die nicht. Die denken: Ja da schau her! Das alte Ferkel beobachtet die Kinder mit dem Fernglas! Das denken die.«
Manfred lachte kurz auf und schüttelte scheinbar fassungslos den Kopf. »Ich? Mit dem Fernglas? Wieso sollt ich denn Kinder beobachten?«
Das Gespräch war jetzt an einem Punkt angelangt, der Wallner Angst machte. »Ich weiß es nicht«, sagte er und blickte um Aufklärung bittend zu Manfred.
»Ich hab meinen Stock g’sucht und zufällig das Fernglas dabeig’habt. Wie oft muss ich’s denn noch sagen?«
Manfreds grobe Arbeiterhände spielten nervös mit dem Griff des Stocks. Seine Unruhe verriet Schuldbewusstsein. Da konnte er Wallner nichts vormachen. Herauszufinden, wer log und wer die Wahrheit sagte, war Wallners Beruf. Doch er war nicht sicher, was hinter Manfreds schlechtem Gewissen steckte. Dass sein Großvater pädophile Neigungen hatte, konnte sich Wallner beim besten Willen nicht vorstellen, auch wenn er gerne jungen Frauen hinterhersah. Aber richtigen Frauen eben, keinen Kindern.
»Ich weiß ja, dass du Kinder magst«, versuchte es Wallner vorsichtig. »Seit die Katja nur noch alle zwei Wochen kommt, geht dir vielleicht was ab.«
»Die Katja geht mir ab«, sagte Manfred und sah seinem Enkel in die Augen. »Glaubst, das wird besser, wenn ich andere Kinder anschau?«
»Nein«, sagte Wallner und schämte sich für die hässlichen und diffusen Gedanken, die in seinem Kopf herumgeisterten. Nein, Manfred war nicht abseitig veranlagt. Trotzdem war an der Sache etwas faul.
In diesem Augenblick kam ein alter Opel-Kombi auf den Parkplatz gefahren, bog in die Gasse ein, in der Wallner und Manfred standen, und blieb neben den beiden stehen. Das Fenster wurde heruntergelassen. Als Erstes fielen Wallner die kurzen, roten Haare auf, dann die hellgrünen Augen im bleichen, aber ansprechenden Gesicht der Frau. »Hallo, Manfred«, sagte sie. »Jemand hat gesagt, die haben dich verhaftet?«
»Is nix weiter passiert«, sagte Manfred. Die Frau sah jetzt Wallner an. »Des is mein Enkel. Der Clemens.«
»Sehr erfreut«, sagte Wallner. »Und Sie sind?«
»Stefanie Lauberhalm. Sie sind der Kommissar?«
»Ja …« Wallner war irritiert, obwohl es ihn nicht wundern sollte, dass sein Großvater Bekanntschaft mit einer deutlich jüngeren Frau pflegte. »Manfred und Sie kennen sich woher?«
»Vom Klosterfest letztes Jahr.« Das Klosterfest war ein Mittelaltermarkt, den Manfred für sich entdeckt hatte.
»Die Stefanie is a Hex«, erklärte Manfred.
»Ah ja.« Wallner zog die Augenbrauen hoch. »Hexe!«
»Jetzt schauen Sie nicht so.« Stefanie Lauberhalm stieg aus ihrem Wagen. »Das ist heute nicht mehr strafbar.«
»Stimmt. Hab davon gehört. Und Sie … hexen also?«
»Ja. Natürlich. Ich kann zaubern. Nichts wo Kaninchen vorkommen oder Zylinder. Aber so Hexenzauber – das hab ich drauf.«
»Faszinierend. Ich bin ja selber so ein kleiner Hobbyzauberer.« Wallner schleuderte mit einer magischen Handbewegung Zauberkräfte auf sein Auto, und die Verriegelungsknöpfe sprangen hoch.
»Sie glauben mir nicht.«
»Doch, doch, wenn Sie’s sagen.«
»Ich beweis es Ihnen. Ich kann zum Beispiel – Gedanken lesen.«
»Hören Sie …« Wallner sah auf seine Uhr.
»Ach kommen Sie, die Minute haben wir.« Sie nahm seine linke Hand zwischen ihre Hände. »Passen Sie auf.« Sie schloss die Augen und hielt weiterhin Wallners Hand. »Ihre Gedanken – sie liegen vor mir wie ein offenes Buch.«
»Dann lesen Sie wahrscheinlich Folgendes: Wie komme ich hier weg, ohne unhöflich zu werden?«
»Das sehe ich schon an Ihrem Gesicht. Aber ich sehe auch schlechte Gedanken über einen anderen Menschen.«
»Ja, ich hab manchmal schlechte Gedanken über andere. Aber dafür wollen Sie keinen Zauberorden, oder?«
»Die schlechten Gedanken beziehen sich auf Manfred. Und Sie schämen sich für Ihre schlechten Gedanken.«
»Tut mir leid, aber da liegen Sie ziemlich daneben. Wir müssen auch langsam.« Wallner entzog Stefanie seine Hand.
»Was denken Sie denn sonst darüber, dass Manfred in einem Busch sitzt und Kinder beobachtet?«
Wallner sah verwundert zu Manfred, der den Blick gesenkt hielt und sich an seinem Stock festklammerte. Wieso wusste diese Frau, was vorgefallen war? »Sie, das wird mir jetzt ein bisschen sehr privat. Ich denke nicht, dass Sie diese Sache was angeht.«
»Das sehe ich anders.« Sie lächelte Wallner auf merkwürdige Art an, und ihre grünen Augen hatten einen Moment lang etwas Unheimliches, als würde sich ihre Besitzerin in der nächsten Sekunde in ein anderes Wesen verwandeln. Das tat sie zu Wallner Erleichterung aber nicht. »Ich verstehe, dass Sie beunruhigt sind. Aber dazu gibt es nicht den geringsten Grund. Manfred ist ein großartiger Mensch und kein Spanner.« Sie wandte sich Manfred zu. »Steigst du ein?«
Manfred schlurfte zur Beifahrertür von Stefanies Wagen.
»Nein, nein. Ich fahr Manfred schon.«
Manfred hielt kurz an. »Ich fahr mit ihr.«
»Und wieso?«
»Sie is hübscher und netter wie du.« Manfred setzte sich in den alten Wagen.
»Er meint es nicht so.« Stefanie streichelte kurz Wallners Arm und stieg ebenfalls ein.
»Kleinen Moment. Kann mir mal irgendwer irgendwas erklären …«
»Bis bald«, sagte Stefanie, schloss die Wagentür und fuhr ab. Wallner sah dem wegfahrenden Wagen mit zusammengezogenen Augenbrauen und fassungsloser Geste hinterher. Die Sache wurde interessant. Erst hockte Manfred in einem Busch und beobachtete heimlich Kinder. Dann kam eine Hexe ins Spiel, die über Manfreds Eskapaden anscheinend gut unterrichtet war. Wallner würde der Sache auf den Grund gehen müssen.
»He – wie wär’s mal wieder mit Arbeiten?«, sagte eine Stimme von hinten. Es war Mike. »Wir vermissen dich.«
»Ihr habt mich noch nie vermisst«
»Stimmt. Späßle g’macht. Es gibt einen Toten in der Mangfall.«
»So tot, dass es die Kripo was angeht?«
»Wissen wir noch nicht. Aber wenn der Leo eine Leiche entdeckt, dann …«
»Sollten wir hinfahren.« Wallner nickte und ging seine Daunenjacke holen.
5
Der Leichenwagen sah aus wie ein riesiger urzeitlicher Käfer, als man ihn, die Räder nach oben, mit einer Seilwinde aus der Mangfall zog. Als das Dach über den Kies knirschte, quoll Wasser aus den Ritzen der Fahrgastzelle. Wallner stand in seiner Daunenjacke in einiger Entfernung am Ufer der Mangfall, die hier (von der Wasserstufe abgesehen) durch naturbelassenes Gelände floss. Direkt am Fundort einer Leiche hatte er nichts zu schaffen. Der war zunächst der Spurensicherung vorbehalten, die in dem Fall Probleme genug haben würde, denn durch das Bergungsfahrzeug waren schon etliche Verwüstungen entstanden.
Kreuthner, ehemals Taucher und aktives Mitglied der Wasserwacht, war am Fahrzeugwrack gleich nach seiner Entdeckung hinabgetaucht und hatte die schreckliche Gewissheit mit nach oben gebracht, dass sich Florian Scheffler noch im Wagen befand, und daraufhin die Kollegen von der Kripo verständigt. Nicht weil er von Mord ausging, sondern weil die Todesursache unklar war und daher die Todesermittler in Aktion treten mussten, wie bei jedem ungeklärten Todesfall. Wallner wäre unter normalen Umständen nicht mitgekommen. Aber die Sache erschien ihm gar zu merkwürdig. Allein, dass Kreuthner die Leiche entdeckt hatte, ließ aufhorchen. Er hatte einen mysteriösen Instinkt für das Auffinden von Mordopfern, eine Gabe, die ihm polizeiintern den Spitznamen Leichen-Leo eingetragen hatte. Auch der Umstand, dass der Wagen auf ungeklärte Weise in die Mangfall geraten war, sprach für die Besonderheit des Falles. Und drittens lag der Fundort in unmittelbarer Nähe zum berüchtigten Wirtshaus Mangfallmühle.
Die Fahrertür des Wagens, der jetzt wieder auf den Rädern stand, wurde geöffnet, und ein Schwall Wasser ergoss sich vor die Füße der Spurensicherer. Unmittelbar darauf kippte der Leichnam aus dem Wagen.
»Ich hab mit dem Einsatzleiter von der Feuerwehr gesprochen.« Mike kam durch den Uferkies gestakst und war bemüht, seine teuren Halbschuhe nicht mehr als nötig zu verschmutzen. »So wie’s aussieht, ist der Wagen ursprünglich da oben auf der Wasserstufe gestanden. Dann hat’s heut Nacht geregnet, und der Wasserpegel ist gestiegen. Net dramatisch. Aber so weit, dass es den Wagen ein Stück hochgehoben und über die Kante geschwemmt hat.«
»Wie kommt der Wagen dahin? Ich meine, nach dem, was die Feuerwehr sagt, muss er ja eine Weile da gestanden sein. Und warum ist der Fahrer dringeblieben?«
»Der hat wahrscheinlich seinen Rausch ausgeschlafen«, mischte sich Kreuthner, der gerade dazugekommen war, in das Gespräch. Hinter ihm trottete Sennleitner mit hängendem Kopf. Beide sahen ungewöhnlich bedrückt aus.
»Servus Leo«, sagte Wallner und nickte auch Sennleitner zu, dessen Vornamen niemand kannte.
»Servus.« Kreuthner sah zerknirscht zu dem geborgenen Fahrzeugwrack. »Wahrscheinlich is er angetrunken von der Mangfallmühle hergefahren … also von der Straße abgekommen. Und dann is er da im Fluss irgendwie stehen geblieben und im Wagen eingeschlafen.«
»Da musst du erst mal durch das ganze Dickicht fahren. Ich meine, selbst wenn ich betrunken bin – das merk ich doch, dass da keine Straße ist.«
»Mei – ich schätz, der war strack wie a Haubitz’n«, sagte Sennleitner. »Wer ma ja sehen, wenn ma die Blutwerte ham.«
»Wer ist der Tote?«
»Florian Scheffler hat er geheißen.«
An der Leiche machten sich jetzt zwei in weiße Schutzanzüge gekleidete Beamte zu schaffen. Es waren Oliver und Tina vom K3. Sie würden eine medizinische Voruntersuchung anstellen und entscheiden, ob man einen Staatsanwalt aus München anfordern musste.
Wallner fiel die ungewohnt zusammengesunkene Haltung der Kollegen Kreuthner und Sennleitner auf. »Das scheint euch ziemlich mitgenommen zu haben?«
»Mir ham ihn halt gekannt. Und seine Frau. Die Christl. Die beiden ham a Bestattungsunternehmen in Tegernsee.«
»Die Frau hat bei der Polizei angerufen?«
Kreuthner nickte und berichtete anschließend, wie sie den havarierten Wagen gefunden hatten.
»Wo ist die Frau jetzt?«
»In der Mangfallmühle. Eine Helferin vom KID is bei ihr.«
»Wart ihr beide gestern in der Mangfallmühle?«, fragte Wallner.
»Wie kommst da drauf?«
»Na ja, ihr seid doch öfter da, oder nicht?«
»Ab und zu. In letzter Zeit … eher selten.« Kreuthner sah nervös zu Sennleitner. Der stand wie paralysiert in der Landschaft, war bleich und schwitzte. »Oder?«
Sennleitner antwortete nicht, nahm nur seine Dienstmütze ab und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
»Geht’s dir nicht gut?«, fragte Wallner.
Sennleitner schien ihn gar nicht zu hören. Wie in Trance stierte er zu der Leiche hinüber und murmelte: »So a verdammter Scheiß das hat doch keiner ahnen können das hat doch keiner g’wollt so a elender Scheiß so a verdammter …«
Kreuthner nahm Sennleitner am Arm und versuchte, ihn wegzuziehen. »Komm, mir trinken jetzt an Kaffee. Dann geht des schon wieder.«
»Was hat er denn?« Mike war sichtlich verwirrt von Sennleitners Verhalten.
»Nix. Er is a bissl durch ’n Wind«, versuchte Kreuthner das Verhalten seines Kollegen zu erläutern. »Mei – wennst jemanden kennst, der grad …«
»Ich bin ja gar net schuld«, wurde er von Sennleitner unterbrochen, den offenbar ein hoffnungsvoller Gedanke gestreift hatte. »Ich hab ’n doch noch verteidigt. Ihr … ihr habt’s des g’wollt! Den habt’s ihr aufm Gewissen, net ich!« Sennleitner schwitzte und rollte mit den Augen und schien dem Wahnsinn nahe.
»Jetzt hör auf, Zefix! Es is eh schon schlimm genug!«
Kreuthner versuchte Sennleitner aus der Schusslinie zu ziehen. Aber Wallner hielt ihn auf. »He, he, nicht so schnell! Was ist hier eigentlich los, verdammt noch mal?« Kreuthner schwieg. Sennleitner fing leise an zu weinen. »Habt ihr was damit zu tun?«
»Des is a Verkettung von unglücklichen Umständen. A tragischer Unfall, wo kein Mensch vorhersehen hat können.«
Kreuthner starrte auf den Boden und nahm jetzt ebenfalls die Dienstmütze ab, um den Schweiß abzuwischen, der ihm in Sturzbächen in die Augen floss. Wallner und Mike hatten noch keine Worte gefunden. Was um alles in der Welt hatten Sennleitner und Kreuthner da verbrochen?
»Wir müssen in München Bescheid sagen.« Eine Gestalt im weißen Schutzanzug kam auf die Vierergruppe zu. Es war Oliver, der jetzt die Kapuze seines Overalls vom Kopf streifte.
Wallner drehte sich um. »Aha? Wie sieht’s aus?«
»Ertrunken ist er mit ziemlicher Sicherheit nicht.«
»Sondern?«
»Er hat drei Einschüsse in der Brust. Einer davon hat wohl das Herz erwischt. Als der Wagen über die Wasserstufe gespült wurde, war er schon tot.«
»Des gibt’s ja net!«, kam es mit einem Mal von hinten. Kreuthner machte die Beckerfaust in Richtung Sennleitner, der wieder zum Leben erwachte und die Augen freudig aufriss. »Hast des g’hört? Erschossen ham s’ ihn! Erschossen!!«
»Gott sei Dank!« Sennleitner fasste sich erleichtert an die Brust und schüttelte lachend den Kopf, und dann schrie er: »Des is ja der Wahnsinn!«
Die beiden Uniformierten lachten, umarmten sich und verfielen ganz generell in einen für Außenstehende kaum erklärbaren Freudentaumel. »Erschossen!«, rief Kreuthner noch einmal, und sie gaben sich High Fives.
Überrascht blickte Oliver zu Wallner. Aber der fragte sich gerade selbst, was er von dem absonderlichen Schauspiel halten sollte.
6
Bianca sah die Hebamme. Im Halbdunkel schimmerte ihr schuldbewusstes Gesicht. Der Jutesack auf ihrem Arm war blutig und schrie. Eine Naht platzte auf, und ein Goldstück quoll hervor, wurde aus der Jute gepresst, bis es am rotbesudelten Stoff nach unten glitt. Die Hebamme versuchte den Fall aufzuhalten. Doch die Münze prallte an der weißen Sandale ab, hüpfte auf dem Parkettboden wie toll und unberechenbar umher, rollte dann geradeaus, legte sich schließlich auf die Seite, einen Kreis beschreibend, immer enger, zuletzt sich nur noch um sich selbst drehend. Bianca stürzte herbei, um wenigstens dieses eine Goldstück zu retten. Doch jemand trat mit einem weißen Schuh darauf. Es war der Arzt. In seiner Hand bemerkte Bianca eine Maschinenpistole, deren Lauf sich zu ihr herabsenkte. Angst schoss ihr in die Eingeweide, ein letzter Blick zur Hebamme. Immer noch umklammerte die den blutenden Sack, und ihr Gesicht bat um Verständnis. Doch hatte das keine Bedeutung mehr. Bianca musste laufen, denn schon machte es tack-tack-tack, Kugeln pfiffen durch die Luft und schossen Bianca seitlich durchs Haar. Eine Vitrine wurde getroffen, Glas fiel in sich zusammen. Sie rannte und rannte durch die Scherben aus dem Raum, doch das Tack-tack-tack hörte nicht auf. Immer weiter ging das hohle Hämmern und hallte durchs Haus. Am Ende des Flures, den sie entlangrannte, öffnete sich wie von Zauberhand die Tür. Licht flutete ihr entgegen …
Ihr Herz raste, als sie die Augen öffnete – und gleich wieder schloss, denn ein Lichtstrahl, der durchs Fenster fiel, blendete sie. Immer noch machte es tack-tack-tack. Irgendwo da draußen hämmerte ein Specht.
Sie öffnete erneut die Augen, wich dem Lichtstrahl aus und versuchte, sich aufzurichten. Doch etwas zog sie an den Haaren zurück auf das Bett, auf dem sie lag. Es war das Kopfkissen. Ihre Haare klebten daran. Als sie versuchte, das Kissen zu greifen, wurde ihre linke Hand zurückgehalten. Sie steckte in einer Handschelle, die wiederum hing an dem eisernen Bettgestell. Bianca starrte die Handschelle an und versuchte, ihre Gedanken zu ordnen und zu ergründen, was sich hier abspielte. Doch es gelang ihr nicht. Auch hatte sie heftige Kopfschmerzen. Wut stieg in ihr hoch, und sie setzte sich mit Gewalt auf. Haarbüschel rissen aus, als sich das Kissen von ihrem Kopf löste.
Sie saß auf dem Bettrand und hielt ihre freie Hand an die dröhnende Stirn. Der Anblick des Kopfkissens machte ihr Angst. Die ausgerissenen Haare und der schwarze Fleck, in dem sie klebten. Getrocknetes Blut. Blut aus ihrem Kopf. Wieso war es auf dem Bett?
Sie trug Lederjacke, Jeans und Joggingschuhe. An Jeans und Jacke klebte Blut. Sie konnte sich nicht erinnern, wie es dort hingekommen war. Wie war sie selbst hierhergekommen? Was war das für ein Ort? Jemand hielt sie gefangen. Doch wer war das, warum, und, vor allem, was hatte man mit ihr vor? Tränen stiegen ihr in die Augen. Nachdem sie eine Weile geschluchzt und geweint hatte, bemerkte sie durch den Tränenschleier hindurch, dass auf dem Nachttisch neben dem Bett ihre Handtasche lag. Bianca fand darin ein Papiertaschentuch, mit dem sie ihre Tränen trocknete und sich die Nase putzte. Sie zog den Schminkspiegel heraus und blickte in ein hübsches, aber verzweifeltes Frauengesicht, voller zerlaufener Schminke und Eyeliner, entdeckte blaue Flecken am Jochbein und ein Pflaster auf der Stirn über der Augenbraue. Bianca berührte es vorsichtig. Es schmerzte darunter. Nicht dumpf wie die Kopfschmerzen, sondern scharf wie ein Schnitt.
Sie drehte vorsichtig den Kopf. Sie befand sich in einer Hütte. Der Raum war schlicht und mit alten Möbeln eingerichtet. Keine teuren Antiquitäten. Billig alt. Die Tapete hing an manchen Stellen in Fetzen herunter. Es roch nach Moder. Bianca wurde übel. Teils von dem Geruch, teils durch die Kopfschmerzen, teils vor Entsetzen über ihre Lage. Sie machte sich erneut daran, ihre Handtasche zu erforschen. Neben Schminkutensilien fanden sich ein iPod nebst Ohrstöpseln, mehrere Kugelschreiber und ein Füllfederhalter, USB-Sticks, eine Modezeitschrift und eine Haarspange. Sie spürte erneut, dass etwas in ihrem Inneren vorhatte, ihre Augen zu fluten. Aber sie wollte nicht weinen. Sie musste nachdenken und dieser schrecklichen Situation entkommen.