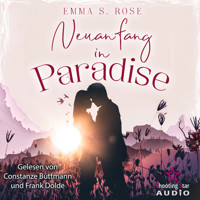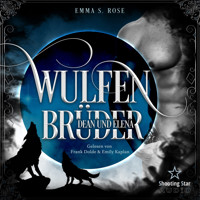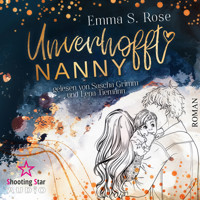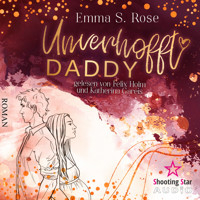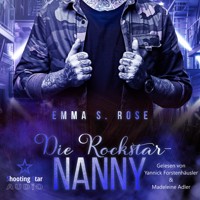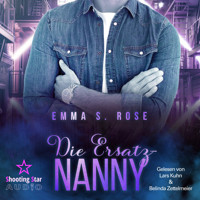3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn dein Leben auseinanderbricht – kannst du jemals wieder vertrauen? Eine lange geplante Flucht, ein drohender Schneesturm – und ein Autounfall. All das ist zu viel für Ella Sinclair. So wollte sie sicher nicht in Paradise ankommen, und doch landet sie ausgerechnet bei dem zurückgezogen lebenden Aiden Brenner, Tierarzt der kleinen Stadt. Obwohl Aiden normalerweise die Gesellschaft von Tieren bevorzugt, stellt er schnell fest, dass Ella tief traumatisiert ist. Was als spontane Notlösung beginnt, wird langsam mehr. Doch gerade, als Ella anfängt, sich langsam zu öffnen, holt ihre Vergangenheit sie wieder ein. Und das sorgt für ordentlich Trubel im sonst so beschaulichen Paradise …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Zarte Hoffnung in Paradise
EMMA S. ROSE
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Epilog
Danksagung
Newsletter
Über den Autor
Für jeden, der sich die Zeit nimmt, zuzuhören.
Man kann Weinenden nicht die Tränen abwischen, ohne sich die Hände nass zu machen.
AUS SÜDAFRIKA
Zarte Hoffnung in Paradise
1. Auflage
Januar 2023
© Emma S. Rose
Rogue Books, Inh. Carolin Veiland, Franz – Mehring – Str. 70, 08058 Zwickau
Buchcoverdesign: Sarah Buhr / www.covermanufaktur.de unter Verwendung von Stockmaterial von Johnstocker; greens87; VVadi4ka / Adobe Stock sowie VicW / Shutterstock
Alle Rechte sind der Autorin vorbehalten.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung und Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist nur mit der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung der Autorin gestattet.
Alle Rechte, auch die der Übersetzung des Werkes in andere Sprachen, liegen allein bei der Autorin. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu entsprechendem Schadensersatz.
Sämtliche Figuren und Orte in der Geschichte sind fiktiv. Ähnlichkeiten mit bestehenden Personen und Orten entspringen dem Zufall und sind nicht von der Autorin beabsichtigt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek.
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Die Schneeflocken fielen immer dichter vom Himmel.
Ich umklammerte das Lenkrad des alten Hondas, den ich vor zwei Tagen bar bei einem eher zwielichtig wirkenden Gebrauchtwagenhändler gekauft hatte. Das Loch, das er in mein Budget gerissen hatte, war viel größer als geplant, doch am Ende war es das wert gewesen. Immerhin stellte der Wagen mein Ticket in die Freiheit dar. Natürlich hätte er ein bisschen komfortabler sein können, aber am Ende sollte er mich einfach nur möglichst weit weg von jenem Ort bringen, den ich viel zu lange als mein Zuhause betrachtet hatte. Die Mindestansprüche – vier Räder und ein Dach – erfüllte er allemal. Klar, eine Sitzheizung wäre jetzt nicht verkehrt gewesen, doch am Ende hätte es die knochentiefe Erschöpfung nur verstärkt, die sich bereits in mir eingenistet hatte. Gott, ich war so müde. So verdammt müde – und das nicht nur auf körperlicher Ebene. Jede weitere Meile, die ich hinter mich brachte, hätte mich erleichtern müssen, doch die Anspannung wollte nicht weichen. Und jetzt wuchs auch noch die Befürchtung, dass Sammy, wie ich mein Ticket in die Freiheit nannte, den Gezeiten nicht mehr lange standhalten würde.
Und dann? Was, wenn das Auto einfach so den Geist aufgab? Mitten im Nirgendwo? Meine Kopfhaut prickelte, ich rutschte noch ein Stückchen weiter nach vorne. Als würde es Sammy helfen, wenn ich noch konzentrierter auf die Straße starrte. Von außen betrachtet musste ich wirklich ein witziges Bild abgeben.
»Komm schon«, murmelte ich rau. »Es ist nicht mehr weit. Das schaffen wir schon, oder nicht? Nach allem, was wir bereits durchgemacht haben …«
So viel Understatement in einem einzigen Satz. Wow. Wäre ich nicht derart angespannt gewesen, vielleicht hätte ich gelacht.
Obwohl ich das Lenkrad eigentlich nicht loslassen wollte, startete ich schnell das Radio. Ich hatte es in den vergangenen Stunden nicht allzu oft angehabt, weil ich mir eingeredet hatte, dass jede weitere Energiequelle meinen Verbrauch zu sehr vergrößern würde. Doch die Anspannung wurde unerträglich, ich brauchte etwas Ablenkung. Ein bisschen gute Musik und Radiomoderatoren, die in gewohnt flapsiger Art über alles Mögliche und Unmögliche sprachen. Während ein Song von Harry Styles ertönte, konzentrierte ich mich wieder darauf, das Lenkrad zu umklammern.
»Und nun zu einer weiteren Eilmeldung: Mittlerweile hat der Schneesturm den Norden der Bundesstaaten New York und Vermont erreicht. In weiten Teilen Kanadas hat er Teile der Bevölkerung lahmgelegt. Viele Städte südlich von Quebec sind noch ohne Strom. Wenn ihr also könnt, solltet ihr unbedingt zuhause bleiben. Wir vermuten, dass uns eine harte Nacht bevorsteht …«
Verdammt! Eilig schnippte ich das Radio wieder aus. Ich brauchte keine Nachrichten, um zu wissen, dass dieser Schneesturm nicht ohne war. Noch viel weniger brauchte ich die zusätzliche Panikmache. Es schneite. Es war verdammt anstrengend, unterwegs zu sein. Doch ändern konnte ich es nicht. Ich lachte auf, es klang hysterisch. Wenn ich diese Fahrt überlebte, wäre sie nur eine weitere Kerbe auf der langen Liste der schrecklichen Dinge, die mein Leben zuletzt ausgemacht hatten. Ich würde es schaffen, würde mein Ziel erreichen. Ein letztes Mal brauchte ich all meine Kräfte, um nicht zu zerbrechen …
Also immer weiter. Meile um Meile durch das dichte Schneegestöber, das nicht einmal versuchte, zauberhaft zu sein. Eigentlich hätte ich noch mal einen Blick auf meine Notizen werfen müssen, doch ich wagte es nicht, anzuhalten. Zum einen, weil ich immer müder wurde, zum anderen, weil ich fürchtete, dass ich sonst nicht mehr vom Fleck käme. Immer weiter. Einfach immer weiter fahren.
»Nicht mehr lange«, murmelte ich mir zu. Ich musste die Erschöpfung in meiner Stimme nicht hören, um zu wissen, wie fertig ich war. Selbst unter guten Bedingungen wäre es eine Mammutfahrt von Washington bis hoch zum Lake Champlain gewesen. Mehr als neun Stunden – eine Strecke, die ich mir unter anderen Umständen niemals zugetraut hätte. Doch mein Zeitfenster war zu knapp, um mir Zwischenstopps zu erlauben, und wann immer ich gehalten hatte, um zu tanken, war mir das Herz in die Hose gerutscht. Je mehr Pausen ich einlegte, desto mehr Schwachstellen bekam der Plan, weshalb ich auch nicht in Erwägung gezogen hatte, eine Übernachtung einzuschieben, als die Wolken immer dichter geworden waren. Im Radio hatten sie bereits vor Stunden von dem anstehenden Sturm berichtet. Ich hätte mir in den Hintern beißen können. Bei meiner Planung hatte ich alles in Erwägung gezogen, alles genauestens ins Auge gefasst – nur das Wetter in Vermont, das hatte ich nicht zusätzlich recherchiert. Ich meine – es war Januar. Ich hatte mit widrigen Umständen gerechnet.
Nicht jedoch mit einem derart heftigen Schneesturm, von dem spätestens jetzt sicherlich auch in anderen Staaten berichtet wurde.
Zu spät.
Alles war zu spät. Und es spielte genau genommen auch keine Rolle. Klar, es wäre schon eine verdammte Ironie, wenn ich es nach all der Zeit endlich rausgeschafft hätte, nur um elendig am Straßenrand zu erfrieren, doch dieses Risiko musste ich eingehen. Am Ende wäre das immer noch besser als alles andere …
Mir entkam ein leises Schluchzen. Eine Mischung aus Erleichterung und Anspannung. Wenn ich ehrlich zu mir selbst war, hatte ich trotz allem eine Scheißangst. Ich war fix und fertig. Und ich wollte einfach nur noch schlafen. Hundert Jahre lang.
Zitternd verstärkte ich den Griff am Lenkrad so sehr, dass meine Knöchel weiß hervortraten, während ich gleichzeitig etwas langsamer wurde. Mittlerweile konnte ich nur noch wenige Meter weit sehen; die Lichter von Sammy wurden von dichten Schneeflocken reflektiert, die sich wirbelnd und tanzend vor mir zu Boden bewegten. Wie eine weiße Wand.
Ich würde mich davon nicht unterkriegen lassen, nein! Dafür hatte ich viel zu lange auf diesen Moment hingearbeitet. Hatte viel zu lange geplant. Viel zu lange all das akribisch vorbereitet. Jeder Rückschritt wäre ein Scheitern. Wäre ein Sieg für ihn. Und das konnte ich einfach nicht zulassen …
Lichter tauchten vor mir auf. Tränen der Erleichterung stiegen mir in die Augen, als ich erkannte, dass ich soeben Rouses Point erreicht hatte.
Endlich.
Von hier aus würde es nur noch ein Katzensprung sein. Ich brauchte keinen Halt mehr, um auf meine Notizen zu blicken. Hier führte eine schmale Brücke rüber auf eine der Inseln, die sich im Lake Champlain tummelten, und von dort aus wäre es nicht mehr weit bis Paradise.
Paradise.
Keine Ahnung, wieso ich mich ausgerechnet hierfür entschieden hatte. Für diese kleine Insel-Stadt direkt an der Grenze zu Kanada. Vielleicht, weil ich das Gefühl hatte, nicht viel weiter weg sein zu können, ohne die Grenzen der USA zu übertreten. Weil ich mir einredete, mich zur Not nach Kanada retten zu können. Neues Land, neue Regeln. Vielleicht aber auch einfach nur, weil mir die Abgeschiedenheit so gefiel.
Und ganz vielleicht, weil der Name mir wie ein Zeichen vorkam, wie ein Silberstreif am Horizont. Wie die dringend benötigte Hoffnung, die ich brauchte, um irgendwie wieder auf die Beine zu kommen.
Erneut schwoll ein Schluchzen in meiner Brust an, doch ich schluckte es mühsam hinunter.
Nicht jetzt.
Nicht hier.
Nicht, wenn ich nur noch wenige Meilen vor mir hatte. Ich hoffte sehr, mein Zimmer in der Pension würde noch auf mich warten, auch wenn ich ein paar Stunden später dran war als geplant. Der Schneesturm war bestimmt Begründung genug. Und vermutlich war die Pension sowieso alles andere als ausgebucht. Zumindest hatte ich bei meinen Recherchen nicht gerade den Eindruck gehabt, als würde es sich bei Paradise um einen Urlaubsort handeln. Eher einer von der Art, wo Menschen nur hinkamen, wenn sie ein bestimmtes Ziel hatten.
Und mein Ziel war Freiheit.
Rouses Point lag völlig verlassen da. Mir kam kein Auto entgegen, keine Menschenseele war unterwegs. Wahrscheinlich war ich die einzige Verrückte, die noch durch die Gegend fuhr. Nun, nicht mehr lange. Ich sammelte all die verbliebenen Reste meiner Kraft zusammen, um diesen Endspurt zu schaffen. Mein Bett schrie schon nach mir, ich hörte es überdeutlich. Großer Gott, ich konnte es wirklich kaum erwarten, anzukommen und mich ein paar Tage lang nur noch zusammenzurollen …
Mir entfuhr ein leiser Schrei, als ich ins Schlittern geriet, weil ich etwas zu schnell auf die verdammte Brücke bog. Und mit schnell meinte ich etwas mehr als Schrittgeschwindigkeit. Atemlos drosselte ich mein Tempo noch weiter, bis ich quasi nur noch schlich. Wahrscheinlich war es keine gute Idee, bei solchen Witterungsverhältnissen über den See zu fahren, doch mir blieb keine andere Wahl. Ich würde keine Nacht hier in Rouses Point verbringen. Mein Bargeld war für die Pension verplant, für sieben Nächte. Keine weiteren Verzögerungen mehr.
Im Schneckentempo passierte ich die schmale Landbrücke. Es war bereits auf den breiten Straßen gruselig gewesen, bei diesen schlechten Sichtverhältnissen zu fahren, doch das hier, in dem Wissen, dass sich unter mir der Lake Champlain ausbreitete, war so viel schrecklicher. Obwohl mir kalt war, rollten Schweißperlen über meine Stirn, und als ich endlich wieder Land erreichte, schluchzte ich auf.
Eine weitere Hürde – gemeistert.
Es war schon erstaunlich, wie viel ich noch schaffen konnte, wenn nichts mehr danach aussah.
Also gut. Nun musste ich nur noch ein gutes Stück gen Süden fahren. Ein weiteres Mal über eine Brücke. Dann hätte ich es endlich geschafft. Wäre ich erst einmal in Paradise, würde ich die Pension schon finden … zur Not zu Fuß. Alles machbar. Irgendwie.
Falls möglich, wurden die verdammten Flocken noch dichter. Meine Scheinwerfer streiften etwas, das wie Bäume aussah. Ich erinnerte mich daran, dass sich rund um Paradise langgezogene Waldflächen befanden. Ein weiterer Grund, wieso mir der Ort so sicher vorgekommen war, so abgeschieden. Ich fühlte mich wie der einzige Mensch auf der Insel, auf der ganzen, verdammten Welt. Eigentlich gar keine so schlechte Vorstellung. Innerlich betend, dass ich nicht die falsche Richtung eingeschlagen hatte, kämpfte ich mich langsam vorwärts. Vom Gefühl her fuhr ich in die Richtung, aus der ich gekommen war – nur eben auf einer der Inseln, die sich im Lake Champlain befanden. Ich musste nur noch …
Ein Gähnen kämpfte sich an die Oberfläche. Ich wurde noch langsamer – vermutlich wäre ich zu Fuß schneller –, presste eine Hand vor meinen Mund und blinzelte.
Bett. Den nagenden Hunger hatte ich längst hinter mir gelassen. Was ich am dringendsten brauchte, war ein Bett …
Wie aus dem Nichts nahm ich eine flüchtige Bewegung gerade am Ende des Kegels meiner Scheinwerfer wahr – also nicht sonderlich weit von meinem Auto entfernt.
Ich schrie auf, gefangen in einem schrecklichen Dämmerzustand aus Aufgeriebenheit, Erschöpfung und Schock. Es war ein paar Jahre her, dass ich meinen Führerschein gemacht hatte. Dennoch wusste ich, was ich tun sollte und was nicht.
Nicht tun sollte ich: Abrupt bremsen. Selbst bei diesem Tempo. Auf glatten, rutschigen Straßen wäre das unvorhersehbar gefährlich.
Was machte ich also?
Richtig. Ich trat so richtig in die Eisen.
Natürlich geriet ich ins Schlingern. Sammy tat alles, um auf der Straße zu bleiben, doch auch er war am Ende seiner Kräfte angekommen. Ich machte einen scharfen Schlenker, versuchte, gegenzulenken, doch das half mir nicht weiter. Im Gegenteil. Elf Stunden Fahrt. Elf Stunden voller Anspannung, Hoffnung, Verzweiflung und Angst. Bis kurz vorm Ziel hatte ich durchgehalten, hatte mich eisern durch diesen Sturm gekämpft. Doch ich scheiterte, ehe ich die Pension erreicht hatte.
Verfluchte Ironie.
Das Letzte, was ich dachte, als direkt vor mir ein Baum auftauchte, war: Fuck.
Ein heftiger Ruck durchfuhr mich, und weil ich sowieso die ganze Zeit so nahe am Lenkrad gekauert hatte, knallte ich mit der Stirn dagegen.
Endstation. Die Rutschpartie war vorbei.
Mir wurde schwarz vor Augen.
»Verdammt noch mal, Nala!«
Frustriert folgte ich der Hündin, die gerade an mir vorbei ins Schneegestöber geflitzt war. Ich kapierte es nicht. Wir waren bis eben draußen gewesen. Ich hatte Nala quasi dazu zwingen müssen, mitzukommen. Und kaum waren wir zurück, kaum löste ich die Leine von ihrem Halsband, lief sie wieder nach draußen?
Ausgerechnet heute!
Es war nicht das erste Mal, dass Nala ausbüxte, aber definitiv das ungünstigste. Ungehalten fluchte ich vor mich hin, während ich ihrem dunklen Schatten hinterherrannte. Sie lief Richtung Straße. Fuck! Zum Glück war kein normal denkender Mensch noch unterwegs … dachte ich zumindest. Bis plötzlich Scheinwerfer das dichte Gestöber durchschnitten. Schnee sorgte immer für Stille. Für eine dumpfe, schwere Stille, die der Welt den Mund verbot. Diese wurde jedoch schlagartig von einem gedämpften Knirschen durchbrochen, dicht gefolgt von einem quietschenden Geräusch, das in einer Art Knall endete. Mein Herz rutschte geradewegs in die Hose, während ich zusah, wie ein großer Schemen direkt vor mir in den Bäumen erstarrte.
Das Adrenalin in meinem Körper verzehnfachte sich. Ich kämpfte mich die letzten Meter durch den Schnee, der in den vergangenen Stunden gefallen war und jeden Schritt erschwerte. Was meine Anspannung zusätzlich anfachte: Ich folgte geradewegs der Spur eines Hundes. Direkt auf jenen Ort zu, wo gerade eine Katastrophe in irgendeiner Form geschehen war … Bitte, bitte nicht!
»Nala!«
Schlitternd erreichte ich den Unfallort. Wie bereits befürchtet, war ein Auto von der Straße abgekommen und gegen eine der alten Douglasien, die mein Grundstück säumten, geschlittert. Adrenalin pumpte durch meine Adern, während ich blitzschnell die Szene analysierte, maßgeblich durch den dichten Schneefall erschwert, der hier, direkt bei den Bäumen, nicht an Intensität eingebüßt hatte. Die ganze Szene war so verdammt surreal, dass ein Teil von mir noch nicht begriffen hatte, was wirklich geschehen war. Zum Glück übernahm der Arzt in mir die Kontrolle und ich switchte in den Notfallmodus.
Oberste Regel: Einen klaren Kopf bewahren.
Dann: Einen Überblick verschaffen.
Und schließlich: Handeln.
Mühsam konzentrierte ich mich auf die Fakten, da das alles war, was mich funktionieren ließ. Im ersten Moment wirkte das Auto nicht furchtbar demoliert. Wahrscheinlich war es sehr langsam unterwegs gewesen, als es von der Straße gerutscht war. Erfahrungsgemäß hatte das nicht unbedingt etwas zu bedeuten, war für den ersten Moment aber beruhigend. Schnee peitschte mir ins Gesicht und in den Kragen meines Mantels, während ich nähertrat und nach weiteren verdächtigen Hinweisen Ausschau hielt, die auf eine andere Katastrophe hinwiesen. Blut zum Beispiel, ein leises Fiepen, Pfoten, die unter dem Wagen hervorlugten. Doch nichts. Von Nala keine Spur.
Kein Hinweis darauf, dass sie von dem Auto erwischt worden war … verdammt, wo steckte sie? Die Angst um sie verschlang mich. Obwohl sie erst seit ein paar Monaten bei mir lebte, war sie mir ans Herz gewachsen. Sehr sogar. Allein die Vorstellung, dass sie durch diesen eisigen Sturm irrte, machte mich bereits fertig.
Doch jetzt musste ich mich erst mal um etwas anderes kümmern. Schwer schluckend riss ich die Fahrertür des verunglückten Wagens auf.
Und erstarrte.
Eine Person saß zusammengekauert am Lenkrad, eine Frau. Im ersten Moment fürchtete ich, dass sie bewusstlos war. Nun entdeckte ich doch Blut, es blitzte zwischen ihren Haaren an der Stirn auf.
»Fuck!«
Das Adrenalin in meinen Adern kochte. Vorsichtig tippte ich die Fremde an, doch im ersten Moment reagierte sie nicht.
Das war nicht gut. Gar nicht gut.
»Miss? Ist alles in Ordnung?«
Ich berührte sie ein weiteres Mal vorsichtig an der Schulter – und dieses Mal reagierte sie, zuckte schreiend vor mir zurück, nur um dann tief aufzustöhnen.
Ihr Anblick durchfuhr mich heftig. Panik flackerte in ihren Augen auf, während sie mich orientierungslos anstarrte. Sie hatte eine kleine Platzwunde an der Stirn, vermutlich nichts Dramatisches, doch womöglich hatte sie eine Gehirnerschütterung davongetragen, das ließ sich nicht einfach so feststellen. Ihr Blick wirkte unfokussiert, während er zwischen mir und dem Lenkrad hin und her zuckte. Sie stöhnte ein weiteres Mal auf.
Ich erschauderte, und das nicht nur, weil der verfluchte Wind wirklich durch jede Ritze zog. Ein verdammt beschissenes Timing für einen Unfall. »Miss? Wie geht es Ihnen? Können Sie aufstehen?« Ich machte Anstalten, erneut nach ihr zu greifen, doch sie zuckte ein weiteres Mal zurück wie ein scheues Tier, also hielt ich in meiner Bewegung inne.
Ihre Brust hob und senkte sich hektisch, sie wirkte völlig neben der Spur. Kein Wunder. Ich atmete tief durch, ließ mich völlig von diesem ganz bestimmten Modus leiten, in den ich switchte, sobald ich ein schwer verletztes Tier vor mir sah. Meine Züge entspannten sich, meine Stimme wurde tiefer, ruhiger. »Hören Sie, alles ist gut. Sie hatten gerade einen Unfall. Sind von der Straße abgekommen, aber jetzt …«
»Da war etwas«, fiel sie mir krächzend ins Wort. Ihre Stimme klang, als hätte sie sie ewig nicht mehr benutzt. »Ich habe etwas gesehen …«
Nala. Etwas von der Anspannung kehrte zurück, ich hinderte mich mühsam daran, die offenkundig verletzte Frau zurückzulassen, um nach der Hündin zu suchen. Doch so wichtig sie mir in den vergangenen Monaten auch geworden war, die Frau war wichtiger. Vorerst. Ich räusperte mich. »Meine Hündin ist ausgebüxt.«
»Ich habe gebremst«, brachte die Frau erstickt hervor. »Ich hoffe, ich habe sie nicht erwischt …«
»Machen Sie sich keine Sorgen.« Obwohl ich die Frau nicht kannte und die ganze Situation alles andere als normal war, spürte ich eine Welle der Zuneigung, weil diese Fremde sich offenkundig Sorgen machte, Nala verletzt zu haben – nachdem sie selbst Bekanntschaft mit einem Baum gemacht hatte.
Ich teilte Menschen relativ schlicht in zwei Gruppen ein: jene, die Tiere mochten, und jene, die sie nicht mochten. Welche Gruppe mir lieber war, musste ich wohl nicht betonen. Seufzend starrte ich auf ihre Stirn. Viel Blut lief nicht aus der Wunde, aber der Arzt in mir wollte sich dennoch darum kümmern. »Wir müssen Sie erst einmal aus der Kälte schaffen. Womöglich haben Sie einen Schock. Es ist verdammt eisig, der Sturm wird so schnell nicht nachlassen. Eigentlich gehören Sie ins Krankenhaus …«
»Nein!«, fiel sie mir erstaunlich heftig ins Wort. »Kein Krankenhaus, ich …« Sie stöhnte leise auf, als wäre diese Reaktion bereits zu viel gewesen, und plötzlich fielen mir die tiefen Schatten unter ihren Augen auf. Sie starrte mich an; es war, als würde sie es eigentlich gar nicht wollen, sich aber dazu zwingen. In ihrer Miene lag ein Flehen. »Bitte. Ich brauche kein Krankenhaus, wirklich nicht. Hören Sie, eigentlich muss ich nur noch bis Paradise kommen. Ich habe ein Zimmer in der Pension gebucht …«
Etwas an ihrer Reaktion machte mich stutzig.
Mehr als stutzig.
Gleichzeitig spürte ich, wie mein Instinkt reagierte. In den meisten Fällen handelte ich nach Bauchgefühl, so auch jetzt. »Bis zur Pension sind es nur noch ein paar Meilen, allerdings ist das Gebäude bereits alt, und wahrscheinlich gehört es zu den Ersten, wo der Strom ausfällt – und damit auch die Heizung. Unter den gegebenen Umständen ist es womöglich nicht der beste Ort für Sie. Also gut, hören Sie …« Ich zuckte zusammen, als ich eine Berührung an meiner Hüfte spürte. Mein Blick wanderte hinab, und mit großer Erleichterung stellte ich fest, dass Nala neben mir stand. »Gott sei Dank. Was hast du dir nur gedacht?« Langsam schob ich meine Hand nach hinten, um die Leine aus der Hosentasche zu zerren – entschied mich im letzten Moment jedoch dagegen. Die Chancen standen nicht schlecht, dass sie sofort wieder abhauen würde, wenn sie die Leine bemerkte. Vorsichtig hielt ich ihr meine Hand entgegen und ließ sie sachte daran schnuppern. »Braves Mädchen. Gut, dass du zurückgekommen bist.« Ich seufzte leise auf. »Sieh nur, was passiert ist. Diese Frau wollte dich nicht erwischen …« Mein Blick wanderte zur Fremden, die nach wie vor auf dem Fahrersitz saß und mich zurückhaltend, beinahe scheu musterte. Panik flackerte immer noch tief in ihren Augen. Sie erinnerte mich mehr denn je an ein verschrecktes Tier. »Also gut, das ist mein Vorschlag: Kommen Sie mit mir. Ich habe genug Platz für alle und einen Holzofen. Selbst wenn es auch uns erwischt, was gar nicht so unwahrscheinlich ist, wird uns zumindest nicht kalt. Außerdem bin ich Tierarzt. Auch wenn Menschen nicht gerade mein Metier sind, kann ich mich um Ihre Wunde kümmern. Sobald der Sturm nachlässt, rufe ich John an, er wird Ihr Auto abschleppen und Sie zur Pension bringen.«
Ihre Lippen teilten sich. Lippen, die etwas asymmetrisch waren, die untere voller als die obere. In ihren Augen tobte ein klarer Kampf, gleichzeitig sah ich, wie eine neue Regung die Überhand gewann: Erschöpfung. Diese Frau, woher auch immer sie kam, wirkte am Boden zerstört. Ich war nicht gerade dafür bekannt, ein Menschenkenner zu sein, bevorzugte für gewöhnlich die Gesellschaft von Tieren, doch in diesem Moment war absolut klar, was ich tun musste. Langsam streckte ich meine Hand aus, spürte, wie der beißende Wind an meinem Arm zerrte. »Kommen Sie. Bis zu meinem Haus sind es nur ein paar Meter. Schaffen Sie das?«
Die Frau schnaubte leise auf. Selbst das klang erschöpft. »Natürlich.« Ihre Lider flatterten, und für einen Moment fürchtete ich, dass sie nun doch ihr Bewusstsein verlöre, doch dann hörte ich ein leises Klicken. Kurz darauf kletterte sie wackelig aus dem Auto. Meine Hand ignorierte sie. Sobald sie dem Sturm vollends ausgesetzt war, geriet sie ins Schwanken.
»Also gut«, murmelte ich, unsicher, ob das hier richtig war oder ein Fehler. »Haben Sie Gepäck im Kofferraum? Einen Mantel?«
Sie starrte mich wenige Sekunden an, ehe sie mit einer Schulter zuckte. Ich fasste das als ein »Ja« auf.
* * *
Nala folgte uns zum Glück bereitwillig. Vermutlich hatte auch sie festgestellt, dass das Wetter nicht gerade prädestiniert für ein Abenteuer war. Ich behielt die Fremde im Auge, während ich ihren Koffer durch den Schnee zurück zum Haus trug. Neben ihm hatte sich tatsächlich ein Mantel im Kofferraum befunden, in den sie eilig geschlüpft war. Er wirkte drei Nummern zu groß, doch für diese Wetterverhältnisse war er genau richtig. Nicht, dass sie nach hier draußen gehörte. Das tat aktuell niemand. Die Frau machte kleine, unsichere Schritte. Genau genommen war sie insgesamt winzig. Reichte mir maximal bis zum Oberarm. War, abgesehen von ihrem Mantel, viel zu dünn angezogen. Selbst ihre Schuhe, die so taten, als seien sie warme Boots, waren absolut fehl am Platz. Das Rot ihrer Platzwunde hob sich grotesk von ihrem ansonsten blassen Gesicht ab.
Sie gehört ins Krankenhaus, verdammt. Das hier ist nicht deine Aufgabe, Brenner.
Doch ihre Reaktion war eindeutig gewesen. Und um ehrlich zu sein, war das hier kein Grund, um einen Rettungswagen zu rufen, schon gar nicht in diesem Sturm. Ich war jedoch auch nicht sonderlich scharf drauf, bei diesen Wetterverhältnissen rüber nach Swanton zu fahren. Wenn ich sie nicht einfach ihrem Schicksal überlassen wollte, waren meine Möglichkeiten also mehr als begrenzt.
»Da sind wir schon.« Anstatt zur Haustür zu gehen, steuerte ich den Nebeneingang an, der direkt in meine kleine Praxis führte. Ich zog den Schlüssel aus der Hosentasche und sperrte die Tür auf, in der Hoffnung, dass weder die Frau noch Nala einen Rückzieher machten. Zum Glück huschte die Hündin noch vor mir in den Anbau. Das Klicken ihrer Krallen entfernte sich eilig. Wahrscheinlich raste sie direkt zu ihrer Höhle, in die sie sich die meiste Zeit über zurückzog, wenn wir hier drüben waren, und hinterließ dabei eine feuchte Spur. Seufzend machte ich mir eine gedankliche Notiz, sie später genauer zu untersuchen. Nicht, dass sie doch irgendeine Verletzung davongetragen hatte.
Kaum war auch die Frau in den Anbau getreten, schloss ich die Tür hinter uns, sperrte die Kälte aus und erschauderte. Die Praxis war nicht so beheizt wie das Haupthaus, weil sie gerade sowieso geschlossen war, doch sie war immer noch wesentlich wärmer als der Sturm draußen. Ich stellte den Koffer ab und zog meinen Mantel aus. Schnee rieselte von dem groben Wollstoff. Meine Finger brannten, eine Reaktion auf den Temperaturunterschied, und ich rieb sie aneinander, um die Durchblutung anzuregen. Die Frau schlüpfte etwas unbeholfen aus dem schweren Mantel. Ich nahm ihn ihr ab und hängte ihn neben meinen an die kleine Garderobe. »Kommen Sie, ich kümmere mich um Ihre Wunde, dann sehen wir weiter.« Ein Seitenblick offenbarte mir, dass sie zumindest etwas Farbe im Gesicht bekam. Mein Herz verkrampfte sich, ohne dass ich wusste, wieso. Sie sagte kein Wort, doch ihr Blick zuckte unruhig hin und her. Wieder dachte ich an ein verschrecktes Tier.
Wieder sprang dieser Instinkt in mir ein, der einfach nur helfen wollte.
Vorsichtig hob ich beide Hände. »Hören Sie, das hier ist wirklich keine Falle. Wie vorhin bereits erwähnt: Ich bin Tierarzt und wir befinden uns in meiner Praxis. Zu meiner Rechten ist das Behandlungszimmer. Dort würde ich gerne mit Ihnen reingehen, um Ihre Wunde zu untersuchen. Ist das in Ordnung für Sie?«
Ich ließ ihr Zeit, um zu antworten. Sie wirkte, als könnte sie jeden Moment zusammenbrechen. Neugierde flackerte in mir auf. Normalerweise interessierte ich mich nicht für die Geschichten Fremder, ich konzentrierte mich auf mich und mein Leben und auf meine Aufgabe, Tieren zu helfen. Alles andere spielte keine Rolle. Doch diese Fremde triggerte etwas in mir. Wahrscheinlich lag es daran, dass sie diesen Unfall nur gebaut hatte, weil Nala mir ausgebüxt war. Ich fühlte mich für sie verantwortlich, selbst wenn das völliger Quatsch war.
Die Sekunden zogen sich in die Länge. Ich fuhr mir durchs Haar, das vom Schnee ganz feucht geworden war, und blickte den Flur hinab. Der Wind heulte laut um das Haus. Um ehrlich zu sein, begann ich, mir ernsthaft Sorgen zu machen. Ich gab uns und dem Stromnetz nicht mehr allzu lange. Hier oben war das Wetter häufiger mal extrem, Stürme waren uns durchaus bekannt. Doch ein solches Schneechaos hatten selbst wir schon eine ganze Weile nicht mehr erlebt. Gott sei Dank hatte ich den Kamin – und genug Holz für einige Tage. Die Kanister mit Wasser, die ich für den Notfall bereithielt, waren ebenfalls gut gefüllt.
Eine Bewegung lenkte meine Aufmerksamkeit zurück zu der Frau. Sie machte einen vorsichtigen Schritt auf den Behandlungsraum zu. Mir wurde bewusst, dass sie bisher kaum einen Satz mit mir gesprochen hatte. Ob sie doch unter Schock stand? Ich folgte ihr stumm und mit Abstand in den Raum, der von einer großen Liege dominiert wurde, auf der normalerweise tierische Gäste ihren Platz fanden. Nun bedeutete ich ihr, sich hinzusetzen. Wie üblich war die Liege weit nach unten gefahren. Ich verzichtete darauf, die Position zu verändern, trat an die Schränke neben der Tür und sammelte alles zusammen, was ich brauchte, um die Wunde zu versorgen: sterile Kompressen und Kochsalzlösung, um sie zu reinigen, außerdem Klemmpflaster. Diese verdammte Unordnung. Ich musste unbedingt mein Zeug sortieren.
»Also gut. Ich bin Aidan«, erklärte ich ruhig, während ich zu ihr zurückkehrte. »Aidan Brenner. Der hiesige Tierarzt, aber so viel haben Sie ja bereits mitbekommen. Und Sie sind …«
»Ella«, murmelte sie leise, ohne mir dabei in die Augen zu blicken. »Und nur auf der Durchreise.«
Paradise war nicht gerade ein Ort zur Durchreise, doch diesen Kommentar verkniff ich mir wohlweislich. Stattdessen lächelte ich sie an. »Das könnte jetzt vielleicht wehtun, Ella auf der Durchreise. Ich werde die Wunde reinigen und anschließend kleben. Wahrscheinlich haben Sie Glück – am Ende wird nicht einmal eine Narbe zurückbleiben.«
Ella nickte lediglich, blickte stoisch geradeaus und rührte sich nicht einen Millimeter, während ich vorsichtig das Blut abtupfte. Von nahem erkannte ich, dass ihre Augen tiefblau waren. So in etwa stellte ich mir das Meer in den Tiefen des Ozeans vor. Sie blickte starr geradeaus, regte sich nicht einen Millimeter. Ihre Pupillen waren gleich groß, was schon mal ein gutes Zeichen war. Ich bezweifelte, dass sie so stark mit der Stirn aufgeschlagen war, dass der Aufprall eine Hirnblutung nach sich gezogen hatte. Eine leichte Gehirnerschütterung – ja, gut möglich. Ich würde sie beobachten müssen. Doch was mich wirklich beunruhigte, hatte einen anderen Ursprung. Einen, den ich nicht genau benennen konnte, der mir aber ein seltsames Gefühl bescherte.
»Haben Sie Kopfschmerzen? Andere Verletzungen, die man nicht sieht? Tut Ihnen sonst noch etwas weh?«
»Ein wenig Kopfweh, ja. Vor allem aber bin ich einfach nur müde«, antwortete Ella leise. Etwas an ihrem Tonfall ließ mich stutzen.
»Hier in der Praxis gibt es natürlich nur Medikamente für Tiere, aber nebenan habe ich Tylenol.« Vorsichtig klebte ich zwei von den Klammerpflastern über die Wunde – fertig. Nun, da das Blut entfernt war, sah es wirklich halb so wild aus. Ich hatte nicht gelogen, am Ende würde man wahrscheinlich nichts mehr von diesem kleinen Unfall sehen. Ob ich die Entscheidung gegen ein Krankenhaus bereuen würde oder nicht, konnte ich jedoch nicht abschließend beantworten. Nachdenklich hob ich meine Hand. »Wie viele Finger?«
Etwas, das vielleicht ein Grinsen hätte sein können, umspielte kurz ihre Lippen. Flüchtig sah sie mir in die Augen, ehe sie ihren Blick wieder senkte. »Zwei.«
Ich veränderte die Anzahl der Finger. »Und jetzt?«
»Vier.«
»Jetzt?«
»Keiner.«
Zufrieden nickte ich. »In Ordnung. Sie sollten es trotzdem ruhig angehen lassen. Sicher ist sicher. Sollte Ihnen übel werden, sagen Sie bitte sofort Bescheid. Auch bei Schwindel …«
»Schon klar«, murmelte sie defensiv. »Mir geht es gut …« Als wollte ihr Körper ihrer Worte Lügen strafen, gähnte sie herzhaft los.
Etwas in mir geschah schon wieder, verkrampfte sich, ehe es sich wieder löste. Aufgewühlt fuhr ich mir über das Gesicht. »Also gut. Wie gesagt, Sie können erst mal hier bleiben, bis der Sturm abflaut. Wir haben den Höhepunkt noch nicht erreicht, wenn wir dem Wetterdienst Glauben schenken sollen, und wahrscheinlich wird es noch richtig ungemütlich. Tut mir wirklich leid, dass Sie es nicht bis zur Pension geschafft haben. Kommen Sie, schaffen wir Ihr Zeug rüber ins Haus. Dort ist es wärmer.« Ich grinste schwach. »Und sicherlich auch gemütlicher.«
Ihr Blick zuckte Richtung Eingang, und ich sah, wie sie zögerte.
Ich lachte leise auf. »Keine Sorge, wir müssen nicht noch mal raus. Es gibt eine Verbindungstür …« Einem Impuls folgend, ging ich auf Abstand und trat vor ihr in den Flur. Ella wirkte durcheinander. Ich hoffte ebenso, dass es einzig vom Unfall herrührte, wie ich mich davor fürchtete. Die Option »Gehirnerschütterung« war nach wie vor nicht vom Tisch. Zum Glück schien sie sonst keine Verletzungen davongetragen zu haben. In der Hoffnung, dass sie mir folgen würde, nahm ich ihren Koffer und lief den Flur hinab, vorbei an drei weiteren Türen, die zu einer kleinen Toilette, einem Abstellraum und in einen weiteren Behandlungsraum führten, den ich für operative Eingriffe nutzte.
Am Ende des Flurs befand sich die schwere Verbindungstür, die das Haupthaus von meinen Praxisräumen trennte. Direkt daneben stand die Gitterbox, in der Nala für gewöhnlich Rückzug suchte, wenn wir hier waren. Auch jetzt lag sie darin, den Kopf auf die Vorderpfoten gelegt, und blickte mich aus dunklen Augen an, so als wollte sie zugeben, dass sie Mist gebaut hatte.
»Richtig so«, murmelte ich, ohne wirklich böse auf sie zu sein. Das konnte ich einfach nicht. Egal, was geschah. »Kommst du mit?« Nala hob ihren Kopf und sah mich an. Sie war eine kluge, aufmerksame Hundedame. Nach all den Monaten hatte ich endlich einen Draht zu ihr gefunden. Wahrscheinlich sorgte Ellas Anwesenheit erst einmal für Rückschritte, doch zumindest heute Nacht würden wir uns irgendwie arrangieren. Wir mussten es.
Zum Glück war das Haus groß genug für uns alle.
Ich schloss die schwere Tür auf und ließ Nala durch den Spalt schlüpfen, ehe ich mich umwandte. Ella war mir gefolgt, Gott sei Dank. Zögerlich nur, ich sah die Unruhe in ihren Augen, doch sie stand da.
Erneut versuchte ich, so viel Wärme und Zuversicht wie nur möglich in mein Lächeln zu legen. »Ich tue Ihnen nichts, Ella. Versprochen.«
Sie starrte mich an, verschränkte die Arme vor der Brust, offenkundig aufgewühlt. Nun, kein Wunder. Sie befand sich im Haus eines fremden Mannes, hatte einen Unfall hinter sich und ganz bestimmt eine anstrengende Autofahrt.
»Wissen Sie was? Ich gehe schon mal vor, sehe nach dem Ofen und setze Wasser für Tee auf. Oder hätten Sie lieber einen Kaffee?«
Erneut wirkte die Frau so, als wüsste sie nicht, wo sie hinsehen sollte. Kurz zuckte ihr Blick zu mir, dann zu ihren Händen, zu Boden, dann an mir vorbei durch den Türrahmen. Sie sah zerbrechlich aus. Völlig erschöpft. Die Platzwunde hob sich deutlich von ihrer Haut ab; abgesehen von kreisrunden, roten Flecken auf ihren Wangen war sie nach wie vor sehr bleich.
Wieder regte sich etwas in mir. Ich kannte dieses Gefühl nicht. Nicht im Zusammenhang mit Menschen. Es hätte mich mehr überraschen sollen, doch stattdessen nahm ich es einfach hin.
»Kaffee …«, sagte sie schließlich leise. »Wenn, dann Kaffee. Tee trinke ich nur, wenn ich krank bin.«
Ich lachte leise auf. »Alles klar, das kann ich verstehen. Dann kümmere ich mich mal um Kaffee. Kommen Sie nach, wenn Sie so weit sind.« Ich schob einen Keil in die Tür, damit sie offenblieb, und ging vor. Ella brauchte einen Moment. Sie musste mir das nicht erst sagen, damit ich es spürte.
Und wenn ich eines hatte, dann war es Zeit. Insbesondere nun, da wir alle in Sicherheit waren.
Vorerst.
Was zum Teufel tat ich hier eigentlich?
Mein Herz hämmerte kräftig in meiner Brust. Ich starrte dem Fremden hinterher, der durch die Tür und schnell aus meinem Sichtfeld verschwand. Meine Atmung wurde hektischer, ich presste meine Handflächen zusammen und versuchte, die Fakten zu sortieren.
Ich hatte einen Unfall gebaut, kurz vor meinem Ziel. Die Situation draußen spitzte sich zunehmend zu. Ich hörte den Wind machtvoll ums Haus heulen. Beinahe hatte ich den Hund dieses Fremden angefahren. Eines Fremden, der zufälligerweise Tierarzt war – und damit wie durch ein Wunder in der Lage, meine Verletzung zu versorgen.
Und er hatte mir bislang nicht das Gefühl gegeben, ein Arschloch zu sein.
Andererseits wusste ich, dass ich meiner Menschenkenntnis nicht allzu sehr trauen konnte.
Zögerlich drehte ich mich im Kreis. Neben der Tür befand sich ein Fenster. Seit Stunden war es nicht mehr richtig hell geworden, nun hatte auch noch die Dämmerung eingesetzt. Trotzdem erkannte ich den dichten Schnee, der draußen herumtänzelte. Winterwonderland? Auf gar keinen Fall.
Ich atmete tief durch. Wenn ich mich nicht warm einpacken und den Rest des Weges zu Fuß gehen wollte, blieb mir faktisch nur die Option, hierzubleiben. Mir stockte der Atem. Ich lauschte, hörte jedoch keinerlei verdächtige Geräusche. Das Wetzen von Messern zum Beispiel, das Entsichern einer Waffe. Ein manisches Lachen. Was man eben so im Haus eines Psychos erwartete.
Ach, verdammt. Ich hatte wirklich nicht geplant, Kontakte zu Einheimischen zu knüpfen, doch dieser Mann hatte sich um mich gekümmert.
Und er hatte einen Hund.
Das sprach zumindest vorläufig für ihn …
Wenn ich den Sturm nicht in diesen kühlen Praxisräumen ausharren und auf einer unbequemen Untersuchungsliege schlafen wollte, musste ich eine Entscheidung treffen.
Zögerlich setzte ich mich in Bewegung. Es fiel mir schwer, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Nicht nur, weil mich die Situation ängstigte; auch, weil ich mittlerweile so fertig war, dass ich im Stehen hätte einschlafen können.
Wäre ich nicht im Haus eines fremden Mannes gewesen, wäre mir das auch glatt passiert.
Unsicher, ob ich das tun sollte oder nicht, löste ich den Keil an der Tür und ließ sie hinter mir ins Schloss fallen. Ich stand in einer großen, weitläufigen Diele. Ein paar Lampen an der Wand verbreiteten indirektes Licht. Eine Treppe führte hinauf in den ersten Stock, doch hier unten gab es mindestens drei weitere Türen. Ob eine von ihnen ein Badezimmer verbarg?
Ein Geräusch neben mir ertönte, ich zuckte heftig zusammen. Leider verschreckte ich damit auch den Verursacher des leisen Kratzens – den Hund, der mir vorhin beinahe vor das Auto gesprungen war. Er sprang ein gutes Stück zurück und kauerte sich regelrecht zu Boden.
Mein Herz verkrampfte sich schmerzvoll. »Tut mir leid«, murmelte ich leise. »Ich wollte dich nicht erschrecken.« Langsam ging ich in die Hocke und streckte meine Hand aus. Sie zitterte merklich. Ich sah, wie der Hund mich genauestens beäugte, ohne etwas von seiner Anspannung zu verlieren. Irgendwie erinnerte er mich an mich selbst. In die Enge getrieben. Niedergeschlagen ließ ich meine Hand sinken, blieb jedoch an Ort und Stelle. »Ich wollte dir keine Angst einjagen. Weder jetzt noch vorhin. Zum Glück ist dir nichts passiert.« Ich musterte den Hund. Er war mittelgroß und hatte weißbraun-geflecktes Fell. Ich kannte mich nicht allzu gut mit Hunderassen aus, vermutete aber, dass es sich hierbei um einen Mischling handelte. Einen verängstigten Mischling. Was war seine Geschichte?
Gerade als ich beschloss, ihn in Ruhe zu lassen, ertönte eine Stimme hinter mir.
»Sie ist sehr vorsichtig Fremden gegenüber.«
Ich schluckte den Schrei hinunter, der meine Kehle emporgekrochen kam, und wandte mich um. Aidan Brenner lehnte in einem der Türrahmen, die Arme vor der Brust verschränkt. Wieder traf mich sein Anblick wie ein Schlag. Sein rechter Mundwinkel zuckte in die Höhe. Er stieß sich vom Rahmen ab und kam langsam näher, ging neben mir zu Boden und setzte sich in den Schneidersitz. Zögerlich tat ich es ihm gleich.
»Komm schon her, Nala. Alles ist gut. Das hier ist Ella, sie wird den Sturm über bei uns bleiben. Sie tut dir nichts. Schau, sie ist lieber vor einen Baum gefahren, als dich zu erwischen.«
Es geschah das Unfassbare: Der Hund – oder genauer gesagt, die Hündin – setzte sich langsam in Bewegung. Ihre Ohren hingen hinab, ihre gesamte Haltung wirkte immer noch geduckt, doch sie kam näher, trottete langsam auf Aidan zu, der seine Hand ausstreckte, um über ihren Rücken zu fahren.
»So ist’s gut.« Er warf mir einen Seitenblick zu. »Sie war schwer verletzt, als ich sie in den Wäldern gefunden habe. Verletzt und stark unterernährt. Ohne Chip oder irgendeinen Hinweis darauf, wem sie gehören könnte.«
»Also haben Sie sie aufgenommen«, murmelte ich leise.
»Natürlich. Ich habe sie versorgt und nach ihren Besitzern gesucht. Da sich niemand gefunden hat, ist sie geblieben.«
Ich versank in seinem Blick. Zum ersten Mal, seit er plötzlich neben meinem Auto aufgetaucht war, ließ ich zu, dass er mir länger in die Augen sah als wenige Sekundenbruchteile. Mein Herz quetschte sich vor Angst zusammen, doch dieses Mal spürte ich noch etwas anderes. Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür, dass es Menschen wie ihn gab, die gestrandete Tiere aufnahmen und sich um sie kümmerten … mein Mund wurde trocken, als ich unwillkürlich eine Parallele zu mir zog.
»Versuchen Sie es«, murmelte er leise. Seine Stimme hatte einen anderen Tonfall angenommen. Für einen Moment wusste ich nicht, was er meinte, doch dann wurde mir bewusst, dass er nicht länger mich ansah, sondern Nala.
Ich atmete flach, während ich erneut meine Hand ausstreckte. »Gutes Mädchen«, murmelte ich leise, kam mir dabei total dämlich vor. Wie ein Trottel, der gar nicht wusste, was er tat. Doch ich machte weiter. »Ich tue dir nichts.«
Nalas Ohren zuckten kurz, hingen jedoch weiter hinab. Ich hielt die Luft an, bis sie schließlich ihren Kopf ein wenig in meine Richtung streckte. Gerade weit genug, um vorsichtig an meinen Fingerspitzen schnuppern zu können. Ehe ich jedoch Anstalten machen konnte, sie zu berühren, zog sie sich wieder zurück, und ich wusste nicht, ob ich deshalb erleichtert oder enttäuscht sein sollte.
»Das war schon ziemlich gut«, stellte Aidan sanft fest. »Bis wir so weit waren, hat es eine ganze Weile gedauert.«
Ich sackte in mich zusammen und sah zu, wie Nala wieder davon trottete. Unter der Treppe befand sich ein ähnlicher Käfig wie nebenan in der Praxis.
»Sperren Sie sie dort ein?«, fragte ich mit rauer Stimme, während ich zusah, wie sie durch die kleine Öffnung stieg und sich darin einrollte.
»Nein, auf keinen Fall.« Aidan warf mir einen nahezu empörten Blick zu. »Die Tür bleibt immer offen. Es gibt Hunde, die brauchen diese Sicherheit. Das da vorne ist ihr Rückzugsort. Ihre sichere Höhle. Ich würde Sie daher auch bitten, sie in Ruhe zu lassen, wenn sie dort drin ist.«
Ich nickte. Diese Vorstellung war absolut nachvollziehbar. In der Vergangenheit hätte ich wohl alles darum gegeben, einen ähnlichen Rückzugsort zu haben, an dem mich jeder in Ruhe ließ …
Aidan erhob sich, und ich tat es ihm gleich.