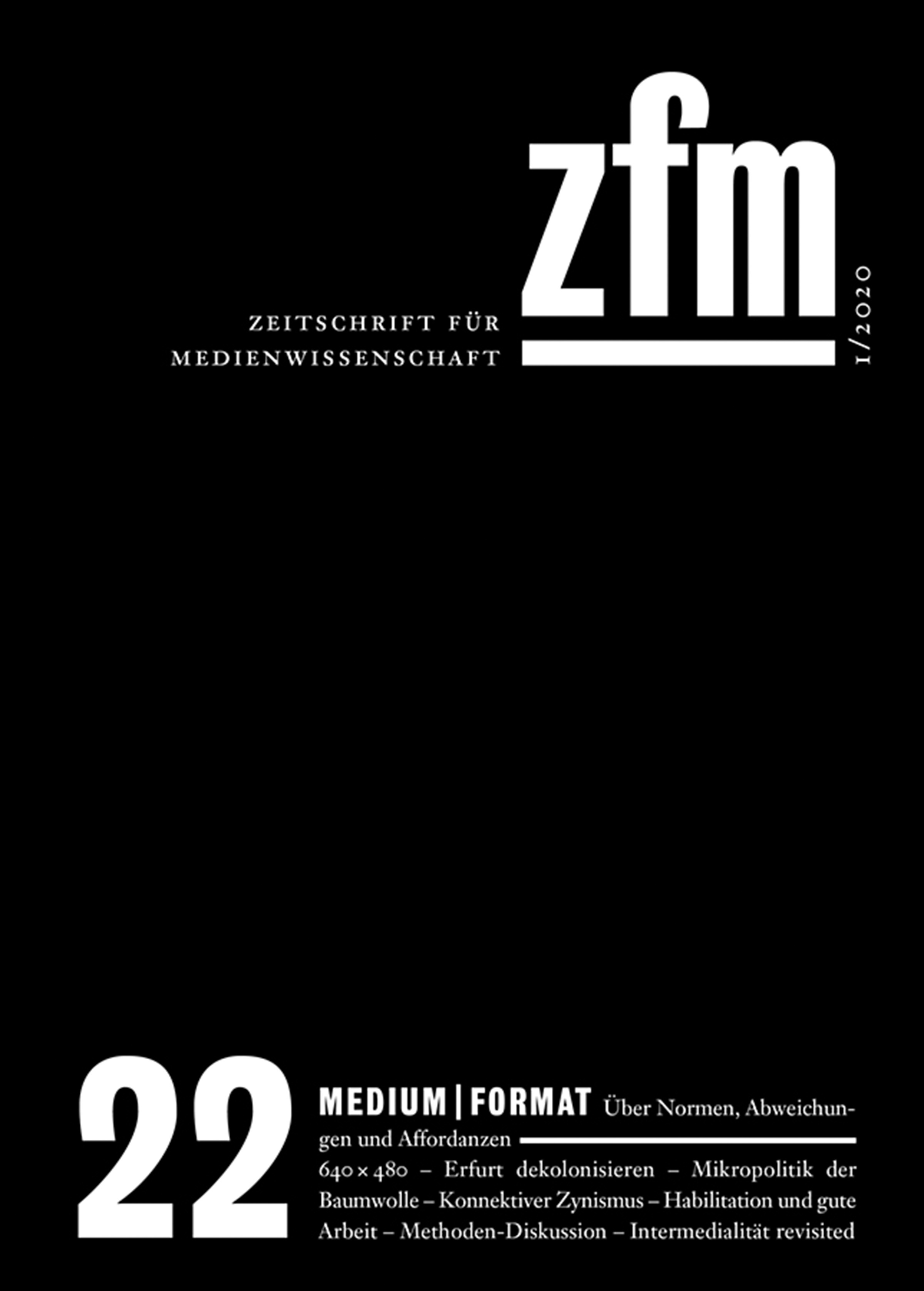
Zeitschrift für Medienwissenschaft 22 E-Book
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: transcript Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: ZfM - Zeitschrift für Medienwissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Zeitschrift für Medienwissenschaft steht für eine kulturwissenschaftlich orientierte Medienwissenschaft, die Untersuchungen zu Einzelmedien aufgreift und durchquert, um nach politischen Kräften und epistemischen Konstellationen zu fragen. Sie stellt Verbindungen zu internationaler Forschung ebenso her wie zu verschiedenen Disziplinen und bringt unterschiedliche Schreibweisen und Textformate, Bilder und Gespräche zusammen, um der Vielfalt, mit der geschrieben, nachgedacht und experimentiert werden kann, Raum zu geben.
Heft 22 thematisiert den Formatbegriff als film- und medienwissenschaftliche Herausforderung. Formate sind technische Maßeinheiten zur Normierung und Verwaltung medialer Anwendungen und Apparaturen, sie beeinflussen die Art und Weise, wie ein Medium erscheint, operiert und erfahrbar wird. Das gibt Anlass für eine Reflexion der Bezüge zwischen Medien, wiederkehrenden Techniken und ihren historischen (Dis-)Kontinuitäten. Welche theoretischen Potenziale eröffnet das Format und wo liegen seine Grenzen für das Verständnis medialer Phänomene? Stellt es unter der Maßgabe des Digitalen gar eine Alternative zum Medienbegriff dar? Und welchen Einfluss haben institutionelle oder ökonomische »Formatpolitiken« auf das Leben und Nachleben medialer Objekte?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
1/2020
GESELLSCHAFT FÜR MEDIENWISSENSCHAFT (HG.)
—
EDITORIAL
Medienwissenschaft zu betreiben bedeutet immer auch, sich zu fragen, was die Voraussetzungen und Bedingungen der eigenen Forschung sind. Die Medialität von Dingen und Ereignissen wird häufig erst in der Beschäftigung mit ihrer Theorie und Geschichte, ihrer Technik und Ästhetik freigelegt. In diesem Sinne betreibt die ZfM eine kulturwissenschaftlich orientierte Medienwissenschaft, die Untersuchungen zu Einzelmedien aufgreift und durchquert, um nach politischen Kräften und epistemischen Konstellationen zu fragen.
Unter dieser Prämisse sind Verbindungen zu internationaler Forschung ebenso wichtig wie die Präsenz von Wissenschaftler_innen verschiedener disziplinärer Herkunft. Die ZfM bringt zudem verschiedene Schreibweisen und Textformate, Bilder und Gespräche zusammen, um der Vielfalt, mit der geschrieben, nachgedacht und experimentiert werden kann, Raum zu geben.
Jedes Heft eröffnet mit einem SCHWERPUNKTTHEMA, das von einer Gastredaktion konzipiert wird. Unter EXTRA erscheinen aktuelle Aufsätze, die nicht auf das Schwerpunktthema bezogen sind. DEBATTE bietet Platz für theoretische und/oder (wissenschafts-)politische Stellungnahmen. Die Kolumne WERKZEUGE reflektiert die Soft- und Hardware, die Tools und Apps, die an unserem Forschen und Lehren mitarbeiten. In den BESPRECHUNGEN werden aktuelle Veröffentlichungen thematisch in Sammelrezensionen diskutiert. Die LABORGESPRÄCHE setzen sich mit wissenschaftlichen oder künstlerischen Forschungslaboratorien und Praxisfeldern auseinander. Von Gebrauch, Ort und Struktur visueller Archive handelt die BILDSTRECKE. Aus gegebenen Anlässen konzipiert die Redaktion ein INSERT.
Getragen wird die ZfM von den Mitgliedern der Gesellschaft für Medienwissenschaft, aus der sich auch die Redaktion (immer wieder neu) zusammensetzt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich an der ZfM zu beteiligen: (1) die Entwicklung und redaktionelle Betreuung eines Schwerpunktthemas, (2) die Einreichung von Aufsätzen und Reviewessays für das Heft und (3) von Buchrezensionen und Tagungsberichten für die Website. Die Veröffentlichung der Aufsätze erfolgt nach einem Peer-Review-Verfahren. Alle Beiträge sind im Open Access verfügbar. Auf www.zfmedienwissenschaft.de befinden sich das Heftarchiv, aktuelle Besprechungen und Beiträge in den Web-Extras, der Gender-und der Open-Media-Studies-Blog sowie genauere Hinweise zu Einreichungen.
—
DANIELESCHKÖTTER, MAJAFIGGE, MARENHAFFKE, JANAMANGOLD, FLORIANSPRENGER, STEPHANTRINKAUS, THOMASWAITZ, BRIGITTEWEINGART, SERJOSCHAWIEMER
—
INHALT
Editorial
MEDIUM|FORMAT
O. FAHLE/M. JANCOVIC/E. LINSEISEN/A. SCHNEIDER
Medium|Format Einleitung in den Schwerpunkt
AXEL VOLMAR
Das Format als medienindustriell motivierte Form Überlegungen zu einem medienkulturwissenschaftlichen Formatbegriff
FABIAN WINTER
Pharmakon und Formation: Aby Warburgs Ordnungsformate der Psyche
DANIELA WENTZ
Das GIF Geschichte und Geltung eines Formats aus dem Geist des Tanzes
ANJA SCHÜRMANN
InDesign als Methode? Wahrnehmungstheoretische Überlegungen zu analogen und digitalen Displaykulturen der Fotografie
LAURA WALDE
Der Kurzfilm als (kleines) Format
THOMAS VEIGL
Formate und User_innen als Akteur_innen der Innovation
ENRICO CAMPORESI
Super 8 ausstellen Notizen zur Obsoleszenz eines Formats
BILDSTRECKE
OLIA LIALINA vorgestellt von MAREK JANCOVIC und ELISA LINSEISEN
The Only Thing We Know About Cyberspace Is That It’s 640x480
LABORGESPRÄCH
V. M. WILMOT/M. ELOMDA/C. STEHRENBERGER und U. LINDNER im Gespräch mit N. GRAMLICH und J. MANGOLD
Erfurt dekolonisieren
EXTRA
ULRIKE BERGERMANN
Baumwolle: Gefüge mit Gewalt
FABIAN SCHÄFER/PETER MÜHLEDER
Konnektiver Zynismus und Neue Rechte Das Beispiel des YouTubers Adlersson
DEBATTEN
Für gute Arbeit in der Wissenschaft Teil VI
TOBIAS CONRADI/GUIDO KIRSTEN/MAIKE S. REINERTH Die Habilitation in Frage stellen
STEPHAN PACKARD Gute wissenschaftliche Arbeit nach der Promotion ist keine Frage der Habilitation
Methoden der Medienwissenschaft Teil III
TOBIAS MATZNER Wege und Ziele. Überlegungen zum (inter-)disziplinären Selbstverständnis der Medienwissenschaft
SEBASTIAN GIESSMANN Hätte, hätte, Drittmittelkette. Über neue Wege und Ziele der Medienforschung
ANNA TUSCHLING Methoden sind politisch
JULIA BEE/JENNIFER EICKELMANN/KATRIN KÖPPERT Diffraktion, Individuation, Spekulation
WERKZEUGE
MAREN HAFFKE
Cancel-Culture Über Noise-Cancelling-Kopfhörer
MICHAEL DOMINIK HAGEL
Wo bleibt der Katalog?
BESPRECHUNGEN
CHRISTIANE HEIBACH Intermedialität revisited. Neue Perspektiven auf die Medienkunst
VERA MADER Morgen, das 22. Jahrhundert. Neue, alte und Andere Zukünfte
WANDA STRAUVEN
Medienarchäologie nach Thomas Elsaesser Von der «Hermeneutik des Erstaunens» zu «imaginierten Zukünften»
AUTOR_INNEN
BILDNACHWEISE
IMPRESSUM
—
MEDIUM|FORMAT
Annette Kelm: Red Stripes, 2018Fotografie (Orig. in Farbe)
MEDIUM|FORMAT
—
Einleitung in den Schwerpunkt
Spätestens seit Jonathan Sternes programmatischem Aufruf zur Entwicklung einer «format theory»1 lässt sich die Relevanz der Auseinandersetzung mit Formaten für eine medienwissenschaftliche Theoriebildung ermessen. Denn Sterne fordert eine solche «Formattheorie» als Bedingung von Medientheorie.2 Der Blick aufs Format würde der Möglichkeit zur ‹Maßstabsänderung› von Medienanalysen zuarbeiten und Medialität als skalierbare ‹Größe› in Bezug auf verschiedene Zeit- und Raumebenen ergründbar machen. Damit einher gehe der Anspruch an eine medienwissenschaftliche Auseinandersetzung, die sich nicht an generalisierende, subsumierende oder klassifizierende Überbegriffe, an die semiotischen wie die physischen ‹Schubladen› oder an die «boxes our media come in»,3 richtet.
Der vorliegende Schwerpunkt folgt Sternes Anwartschaft auf eine ‹Skalierung› der Betrachtung von Medialität, wie man es nennen könnte, die mit der Untersuchung von Formaten angesprochen ist. Den vom Format gebotenen Einsatz – das analytische Miteinbeziehen mikro- und makromedialer Register – möchten wir in einen Zusammenhang mit aktuellen Theorien medienwissenschaftlichen Forschens und Fragens stellen. Denn Formate sind in verschiedenste medien- und kulturwissenschaftliche Problemstellungen eingeschrieben, wie diese Einleitung beispielhaft anhand von drei für die Medienwissenschaft zentralen Konzepten – Transformation, Performativität und Information – explizieren möchte.
Transformation
Rosa Menkmans A Vernacular of File Formats (2010) kann als Bildatlas digitaler Prozessualität gelesen werden. Die niederländische Künstlerin trägt in Form eines Nachschlagewerks Kompressionsartefakte verschiedener digitaler Bildformate, z.B. unkomprimierter RAW-, BMP-, verlustfreier GIF- oder TIFF-Dateien, zusammen. Menkmans Screenshot-Sammlung ist eine Antwort auf die massenmediale Standardisierung der ‹Störfallästhetik›, die ja ursprünglich konventionelle Bild- und Sehanordnungen kritisch befragen sollte. Durch die Kategorisierung von Übertragungsfehlern und Kompressionsdefekten entwickelt Menkman eine Repräsentationskritik, die das Paradox der berechneten Fehlerhaftigkeit adressiert. Glitches, nicht vorhersehbare und daher schwer fassbare ‹Signalstörungen›, besitzen für die Künstlerin gerade in ihrer prozessualen Widerständigkeit expressive Qualitäten. Menkmans Kritik richtet sich nun gegen die schnelle und einfache Konsumierbarkeit von glitches, wenn diese als Filterästhetik benutzt und über Digitalbilder gelegt werden. Diese wertnormative Transformation mache Formatfehler kommerzialisierbar. Glitches fänden als «coffee table book» Eingang in die hyperkapitalistische «world of latte drinking designers and […] Kanye West».4 Ihre Kritik bringt Menkman nun nicht etwa in der Verwerfung der mit den glitches benannten Logik kultureller und ästhetischer Auf- und Abwertungsprozesse vor, sondern in deren Überstrapazieren. A Vernacular of File Formats gibt sich exzessiv der unkontrollierten und deswegen auch nicht vor Kontexten der schnellen Konsumierbarkeit haltmachenden Prozessualität digitaler Formate hin. Die künstlerische Arbeit bereitet den Dialekt einer Digitalkultur verständlich auf. Digitale Mundart ist, als vermeintlich herkömmliches Zeichensystem, dann immer schon ein Spektrum zwischen Inkommensurabilität und Kommunizierbarkeit, Slang und Jargon, Abweichung und Standardisierung.
Menkmans Arbeit ruft Charakteristiken auf, die sich bei der Beschäftigung mit Formaten ergeben. Formate materialisieren kulturelle, wertbezogene, aber auch zeitliche und räumliche Transformationsprozesse. Sie modifizieren Medien über den Gegensatz von Regelbruch und Normierung – philosophisch zugespitzt: von Chaos und Ordnung. Über die Kontexte, Wirkungen und Bedeutungen, die Formate in Medienkulturen zugesprochen bekommen, können Entscheidungsprozesse, die mit Formaten Ordnungen und Regeln festlegen, eine explosive, widerstreitende Dimension erreichen: ‹Formatkriege› stehen nicht nur auf der medienökonomischen Tagesordnung. Diese ‹Brennpunkte› zeigen ihr politisches Ausmaß auch jenseits von Betamax und VHS, dem in der westlichen Medienkulturgeschichte wohl bekanntesten Standardisierungskampf. Das soll im Folgenden anhand des Verhältnisses von Format und Performativität verdeutlicht werden. Zwei weitere Eckpunkte des medialen Spielfelds von Formaten werden hier manifest: Neben der Offenheit und Normierung umspielen Formate die Grenzen von repressiven Ein- und Ausschlüssen.
Was sich für eine Formattheorie zunächst festhalten lässt, ist ein Kurzschluss aus Formatierungsprozessen und medialen Transformationsprozessen, durch die beschriebene Oszillation zwischen Regel und Abweichung. Denn mediale Transformationserscheinungen werden durch eine Analyse von Formaten auf mikro- und makromedialer Ebene bestimmbar. Zu nennen sind hier z.B. die codierte Berechnung und Übertragung digitaler Inhalte oder deren softwarebasierte (Fehl-)Interpretationen, aber etwa auch Farbbeschichtungen von Zelluloidstreifen oder deren Granularität. Mikromediale Fragen, die medienarchäologisch motiviert sind oder dem New Materialism zugeschrieben werden können,5 lassen Medialität über die Entwicklungsstufen und Generationen von Formaten als feinabgestuftes Spektrum fassbar werden. Durch Formate können mediale Transformationen auch makromedial als Strukturmerkmal adressiert werden. Formate stehen dann für eine Sondierung relationaler Gefüge technischer Infrastrukturen oder medialer Ökologien und agieren z.B. über Papier-, Rahmen- oder Bildschirmgrößen, über IP-Pakete oder adaptive Bitraten an den Schnittstellen fluider Netzwerke oder atmosphärischer Medienumgebungen. Zu verstehen als «Grenzobjekte»,6 wie sie die Akteur-Netzwerk-Theorie oder die Science and Technology Studies interessieren, referieren Formate auf die Standards und Protokolle, die die Zirkulation von Wissen und Erfahrung ermöglichen, gleichzeitig aber auch reglementieren.
Performativität
Formate verweisen wie kein anderes mediales Phänomen auf ihre befragbare, ersetzbare und auch zu verwerfende oder herausfordernde Gemachtheit. Sie sind hervorgebrachte, meist unter funktionalen oder ökonomischen Vorgaben getroffene Entscheidungen, Absprachen oder Bestimmungen. Formate sind alles andere als neutral und widersprechen einer essenzialistischen bzw. ontologischen Vorstellung von Medialität und Technik. Ihre Rigidität verweist auf Prinzipien des Ein- und Ausschlusses; die mit Formaten verbundenen Praktiken und Ästhetiken stellen Kondensationen kultureller Aushandlungsprozesse – kultureller Performativitäten – dar.
Lorna Roth verfolgt das Verhältnis von soziokultureller Performanz und Formatierungsfragen z.B. anhand der sogenannten Shirley cards: Testbilder aus den 1940er und 50er Jahren, die film- und fernsehindustrielle Farbfilmemulsionen und Helligkeitsabstufungen von Kameratechnik formatieren. Davon ausgehend zeichnet Roth eine Entwicklung nach, a «socio-technical journey, which is not yet complete»,7 bei der die medientechnische und -historische Genese des Farbfilms an Kategorien von Gender und race gekoppelt ist. Die Shirley cards sind benannt nach dem weißen, weiblichen Modell, das sie abbilden, und dem festgeschriebenen, hartnäckigen «standard for most North American analogue photo labs».8 In ihrer Forschung legt Roth die Voreingenommenheit aller Medientechnologien über deren Formatierungen als internationale Standards offen. Fotolabortechniken, Farbbalanceverfahren und Filmentwicklungschemie haben dabei nicht nur die generalisierende Präferenz einer whiteness eingeschrieben, die als Barometer jede andere Hautfarbe zur verschlechternden Abweichung von der vorherrschenden Norm degradiert.9 In Interviews mit den formatkonzipierenden Techniker_innen und Wissenschaftler_innen stößt Roth zudem auf einen Technikessenzialismus, der die Rassismen über eine mediale bzw. (natur-)wissenschaftliche Neutralität und Unbefangenheit begründet: «[P]hysics was physics, chemistry was chemistry, and science was based on reasoned decisions without consideration of cultural or racial subtleties».10
Damit aufgerufen ist eine grundsätzliche Unbefangenheit gegenüber medientechnischen Standardvorgaben, die Ulrike Bergermann im Anschluss an die Shirley cards auch für Digitalformate und «rassistische Algorithmen» ausmacht.11 Digitaltechnische Möglichkeitsbedingungen, die z.B. in Hinblick auf Belichtungsstufen andere Spielräume und weniger Voreinstellungen offerieren als photochemische Emulsionswerte, produzieren gleichermaßen normative Automatismen. Bergermann verweist auf Filtertechniken von Foto-Sharing-Plattformen wie Instagram, die whitewashing betreiben, wenn nicht-weiße Hauttöne ungefragt aufgehellt und so vermeintlich ‹verschönert› werden.
Jedem Format sind somit Vorstellungen über Körperlichkeit eingeschrieben. Formate antizipieren – sowohl durch explizite Normierungen wie auch durch unabsichtliche Affordanzen – immer ganz spezifische und selektive Formen von Gebrauch, ganz konkrete Adressat_innen und eindeutig bestimmbare Rezeptionssituationen. Wie Sterne argumentiert, enkodiert das MP3-Format nicht nur eine_n idealtypische_n Zuhörer_in mit theoretisch exakt kalkulierbaren Wahrnehmungsfähigkeiten und Wahrnehmungseinschränkungen, sondern ganze Kulturen der Audition und Praktiken des Musikhörens und -teilens. Gerade deshalb eignen sich Formate, so Meredith McGill, ganz besonders gut dafür, den medienwissenschaftlich und -historisch immer noch vernachlässigten Mittelraum zwischen Produktion und Rezeption, nämlich die Zirkulation, zu untersuchen.12 Das Abspielen einer MP3-Datei, einer CD oder die Nutzung eines Musikstreamingdienstes (bei dem das Dateiformat vor den User_innen nur versteckt, aber nicht minder wichtig ist) ruft performativ jeweils ganz unterschiedliche zuhörende Subjekte ins Leben.
In der Beschäftigung mit der Gemachtheit und der dezidierten Hervorbringung von Formaten kann also gleichsam die Gesetztheit und Verhandlung von soziokulturellen Ein- und Ausschlüssen korreliert werden. Die Performativität kultureller Normierung ist auf die Performativität von Formaten, auf eine Performativität, rückschließbar. So können im Speziellen die politischen Implikationen von Medientechniken, deren Setzung, nicht hinterfragte Anerkennung und Handhabung, zum Vorschein gebracht werden.
Information
Formatierende Praktiken und Ästhetiken können also auch als Kultivierungs- bzw. «Kultur-ordnende Vorgaben», als Kulturtechniken,13 identifiziert werden. So gesehen agieren Formate als Schwellen der Erfahr- und Wahrnehmbarkeit und als Regelsets der Aufbereitung von Wissen und der Herstellung soziokultureller Wirklichkeiten. Ganz ähnlich beschreibt z.B. auch Michael Niehaus Formate anhand der systemtheoretischen Generalunterscheidung von Struktur und Nicht-Struktur oder, mit Niklas Luhmann gesprochen, anhand der Differenz von möglichkeitsgesättigtem, noch unbestimmtem «Medium» und einer «Form», die gestaltprägend Möglichkeiten aktualisiert.14 Das Format könne dabei weder als Medium noch als Form identifiziert werden, sondern platziere sich als Grenze zwischen beiden: «Es macht das Medium zum Medium, indem es die Elemente so anordnet, dass es ‹aufnahmefähig› wird […]. Das Format präpariert ein Medium, macht es kompatibel».15 Formate seien daher «In-Formierung[en]» von Medien, «Voraussetzung für die Aufnahme von Informationen».16 Jeder medialen Vermittlung, Herstellung oder Verarbeitung von Information steht eine In-Form-Bringung durch Formate, eine Information, voran.
Für McGill, wie Niehaus übrigens Literaturwissenschaftler_in, bedeutet dies etwa, in wenig erprobten analytischen Kategorien zu denken. An die Stelle des Textes oder der Seite als zentraler Organisations- und Untersuchungseinheit eines Buchs lenkt das Format den Blick eher auf den Papierbogen oder die Faltung. In Erscheinung treten dadurch jene volumetrischen, haptischen und sensorischen Eigenschaften von Medien, die aus disziplinärer Gewohnheit gerne vergessen werden: Als Beispiel nennt McGill den Buchrücken, der, nicht nur schwer digitalisierbar, gerade dann Information über ein Buch vermittelt, wenn es nicht gelesen wird.17
Umgekehrt stellt sich die medienphilosophische Frage, inwiefern Formate einem ‹epistemischen Entzug› oder einer produktiven Verschließung von Wirklichkeit assistieren, inwiefern sie im Widerspruch zu einer Kultivierung und dem informierenden Kommensurabel-Machen von Wirklichkeit stehen. Diese Perspektive scheint sich auf den mit Formaten immer schon aufgerufenen – wie oben gesehen durchaus politischen – Ein- und Ausschluss von Informationen und dezidiert auf den Informationsverlust zu beziehen. Weniger von Verlust oder Ausschluss und mehr von einer notwendigen erkenntnisspendenden Opazität von Wirklichkeit sprechen Alexander Galloway und Jason LaRivière in Rückgriff auf Sternes Überlegungen zum MP3-Format, konkreter: auf die mit der digitalen Audiodatei aufgerufene Kompression. Kompression macht «Sound kleiner».18 Die geltenden De- und Enkodierungsvorgaben tilgen redundante Informationen, die vermeintlich über oder unter perzeptuellen Schwellen verharren. Der MP3-Codec ist für Sterne Teil einer universelleren Mediengeschichte der Reduktion und Verdichtung. Diese steht einer Innovationsgeschichte entgegen, welche nach einem repräsentatorischen Ideal bestmöglicher – im besten Fall verlustfreier – Formen und Selektionsprozesse strebt, um eine Wiedergabetreue der repräsentierten Wirklichkeit zu garantieren. Vielleicht kann der paradigmatische Charakter von Sternes Formatanalyse auf diesen Gegensatz von Repräsentation und Kompression zurückgeführt werden. Jedenfalls liegt für Galloway und LaRivière nun gerade hier die Möglichkeit einer alternativen philosophischen Ausrichtung, und zwar durch die Abwendung von metaphysischen Kategorien. Kompression kann gegen eine ontologische Lesart von Medialität (im Sinne einer Medien-Essenz oder Medien-Substanz) gewendet werden, wenn die Informationsreduktion nicht als Verlust, sondern als positive Indifferenz bewertet wird. Mit Formaten lässt sich Medialität dann immer auch zu einem gewissen Grad als ‹un-kultiviert› oder unzugänglich ausweisen, als das Agamben’sche «potential-not-to».19
Ein formattheoretischer Blick «unter, über oder hinter»20 Medien kann dann auch von einer hermeneutischen Lesart abrücken, die davon ausgeht, dass bestimmte Repräsentationsvorgaben abgebaut und hinter oder unter ihnen vermeintlich sinnhaftere Phänomene zum Vorschein kommen. Die Überlegung, mit Formaten gerade auf mediale Indifferenzen, auf die Möglichkeit des Brachliegens und der produktiven Verweigerung von und durch Medien zu verweisen, scheint dieselben auch zu einem gewissen Grad von einer normativen Rigidität zu befreien. Im Falle der Kompression beharren Formate auf eine Opazität von Wirklichkeit, in der Daten und Information schrumpfen und verschwinden, anstatt explorativ zum Ausdruck zu kommen. Gerade in Zeiten von Big Data ließe sich aber auch auf ein «potential-not-to» in Bezug auf informationsbezogene Überdeterminationen eingehen. Pixelstarke HD-Bilder können z.B. das Versprechen auf Hyperdarstellbarkeit von Wirklichkeit («Schärfer als die Realität») aufgeben, wenn die gebotene Informationsdichte nicht einem vermeintlichen Formideal gleichkommt. Datendichte Bilder sind übervoll mit Differenzen. Bannt man diese Potenziale nicht normativ auf eine vermeintlich eindeutige oder «richtige» Ansicht, sondern versteht viele Bildinformationen in notwendiger Abhängigkeit zur Bildprozessierung, dann tendieren auch HD-Bilder zur Widerständigkeit. Über Vorgänge des Um- und Re-Formatierens kommt es zu Widersprüchen, Überlagerungen und Potenzierungen und die Informationsfülle wird in gegenseitiger Bezugnahme gleichsam zur epistemischen Verweigerung.21
Zu den Beiträgen dieses Schwerpunkts
AXELVOLMAR eröffnet die Ausgabe mit einer Bestandsaufnahme von Formatbegriffen. Ein Blick quer durch mediale Industrien, medienwissenschaftliche Traditionen und Praktiken des Formatierens wird zur Ausmessung der heterogenen Nutzungskontexte genutzt, in denen Formatbegriffe operativ werden. Diese Annäherung an den Kern des Formatbegriffs ist weniger im Sinne einer Begriffsbestimmung (und somit Begriffseinengung) zu verstehen, sondern entfaltet ihre Wirkung im Versuch, Formate grundlegend aus ihrer Verschiedenartigkeit heraus zu denken. Dadurch entsteht eine Sicht auf Formate, die ihre historischen und situationsabhängigen Spezifika nicht aus dem Blick verliert, sie aber abstrahierend und medienübergreifend als industrielle Strategien zur «Etablierung, Steuerung und Stabilisierung von Kooperationsverhältnissen» auffasst. Volmars Beitrag offeriert damit die Formatforschung als einen programmatischen Entwurf für die medienkulturwissenschaftliche Forschung.
Wie Schreib- und Organisationstechniken nicht nur Wissen strukturieren, sondern auch das menschliche Denken selbst formatieren, und zwar in einer exzessiven Unverhältnismäßigkeit, zeigt FABIANWINTER in seinem Beitrag zu Aby Warburg. Die ‹Denkformate› Warburgs haben existenziellen Charakter, denn sie wechseln immer wieder ihren Status in Bezug auf die geistige Gesundheit des Gelehrten. Das «Formate-Schaffen» fungiert in Hinblick auf Warburgs psychische Erkrankung zugleich als Symptom und Heilmittel, im selben Maße, wie es sein produktives Forschen bestimmt. Der Beitrag von Winter korreliert Krankheitsgeschichte mit Wissenschaftsmethode – ein bekannter Parallelismus, der im Beitrag nun aber explizit anhand der jeweiligen Schreib- und Ordnungsprozesse und der verbundenen Medien (Zettelkasten, Bildatlas, Briefkopierbuch, Bibliothekstagebuch, Schreibtisch) auf die Skizzierung einer «Medientheorie des Formate-Schaffens» zwischen «Formation und Pharmakon» hinausläuft.
«Aus dem Geist des Tanzes» untersucht DANIELAWENTZ das Animated-GIF-Format, seine Geschichte und die mit ihm verflochtenen Bildpraktiken. Mit dem Herausschneiden aus Filmen und Serien und damit auch einer Loslösung vom narrativen Fluss findet eine Dekontextualisierungsleistung statt, so Wentz, die das GIF im Modus einer performativen Geste verankert. Entgegen dem kulturellen Primat des Textes in der computerbasierten Kommunikation führe das GIF eine non-verbale Form der Kommunikation ein, die es nicht nur zum Schlüsselformat der webbasierten Bildkultur machte, sondern auch als ein Element der Philosophie des Tanzes wirksam werden lässt. In diesem gestischen Potenzial liege überhaupt die Sozialität der Netzkultur begründet.
ANJASCHÜRMANN untersucht in ihrem Beitrag das Fotobuch als Display. Während das Installationsfoto die Wand als Rahmen, als Hintergrund akzentuiert, ist es im Fotobuch der Weißraum der Seite, der gleichermaßen als Display akzeptiert wird: als Fläche, die sowohl in der Höhe als auch in der Breite variabel bespielbar ist und tendenziell unendlich gedacht wird. Die Konditionen des Kubus werden im Buch auf die Doppelseite projiziert, die nun den neuen Rahmen, eine neue Wand darstellt. Dass diese Wand in vielen Layoutvorlagen gerastert ist und die auf ihr platzierten Rechtecke, die wieder nur aus Rechtecken bestehen, sich diesem Raster beugen müssen, tangiert die Bildevidenz und die mit ihr verbundene Sequenz. Auch findet eine multimediale Transformation statt: die Layout- und Satzsoftware InDesign macht es möglich, den Weißraum der Seite völlig flexibel und variabel zu gestalten. Am Beispiel der Fotograf_innen Susanne Brügger, Volker Heinze und Roe Ethridge zeigt der Beitrag, wie das Buch als kulturelles Dispositiv von Layoutsoftware im Fotobuch digital herausgefordert wird.
LAURAWALDE widmet sich in ihrem Beitrag dem marginalisierten Filmformat Kurzfilm. Der «Kürze-Imperativ» der Filme, so Walde, lasse nun von werkästhetischen, technischen oder narrativen Fragen abrücken. Denn im Fokus stehe gerade durch diesen Abweichungscharakter vielmehr das Format selbst, das nach dem Verständnis von David Joselit verstärkt die Distribution und Präsentation von künstlerischen Werken problematisierbar werden lasse. Vor allem impliziert wären hier die wertnormativen Transformationserscheinungen, die mit Joselit gerade dann zum Vorschein kommen, wenn Werke nach den Bedingungen, Anforderungen und Wirkungen ihrer Zirkulation in heterogenen Kontexten beurteilt werden. Der Kurzfilm als «kleines Format» zeichne sich nun als Analysekategorie für jene filmischen Zirkulationserscheinungen durch eine höhere Flexibilität und Passbarkeit in Bezug auf unterschiedliche Auswertungskanäle aus. Walde verdeutlicht dies anhand des Kurzfilms B-Roll with Andre (2015) von James N. Kienitz Wilkins, der sich medienreflexiv und künstlerisch mit den Normalisierungen und Standardvorgaben bei der Herstellung und Präsentation von Film auseinandersetzt.
Das für Formate so spezifische Oszillieren zwischen Normierung und Experiment zeichnet THOMASVEIGL in seinem Beitrag anhand des Spiele-Hackings der 1990er Jahre nach. Über sogenannte Machinimas, computeranimierte Filme, die in den Echtzeit-3D-Umgebungen der Computerspiele produziert wurden und so z.B. ein Spielgeschehen dokumentieren, werden kreative, User_innen-bezogene Zweckentfremdungen und Appropriationen der kommerziellen Spielesoftware nachvollziehbar. Im Zentrum der Adaptionen durch Computerspieler_innen steht dabei das Speicherformat für diese Spieldemos, das DEM-Format. Veigl macht nun in Rückgriff auf die Akteur-Netzwerk-Theorie deutlich, dass die besprochenen Machinima-Filme als technisch-menschliche Netzwerke mit verteilter agency verstanden werden müssen und nicht etwa die künstlerische Intention der User_innen in den Vordergrund gestellt werden kann. Hier hat das DEM-Format eine zentrale Rolle, vor allem auch wenn die innovativen Entwicklungstendenzen von Medientechnologien unter diesen «vernetzten Voraussetzungen» in den Blick geraten.
Die Verknüpfung von Formaten und ihren spezifischen Wirkungskontexten zeigt sich z.B. am äußerst produktiven Einsatz des Super-8-Formats im Bereich des Kunst- oder Experimentalfilms. Diese Eintracht basiert nun aber gerade auf einer Widerspenstigkeit, auf die ENRICOCAMPORESI in seinem Text zum Einsatz des Super-8-Formats bei den Experimentalfilmemacher_innen Carolee Schneemann, Luther Price und Ericka Beckman eingeht. Denn das Super-8-Format wirke entgegen einer innovationsgläubigen Entwicklungsgeschichte aufgrund seiner «technischen Obsoleszenz», und das nun gerade in der Distanznahme experimenteller Kontexte zu solchen Teleologien. Das Format falle hier nun aber nicht der Antiquiertheit zum Opfer, sondern, so Camporesi, wird aufgrund seines obsoleten Status besonders produktiv und «überlebensfähig». Super 8 wäre als ein wendiges und anpassungsfähiges «Migrationsformat» zu identifizieren, vor allem in Bezug auf seine Verwendungs- und Übertragungsmöglichkeiten. So kann nach Camporesi Super 8 auch als «selbstbewusstes» Format identifiziert werden, welches seinen eigenen ontologischen Status immer schon mitreflektiert und ausstellt.
Medium|Format
Formate sind medienwissenschaftliche Phänomene, welche Maßstäbe und Proportionen medienwissenschaftlicher Analysen – Boxen, Grenzen oder Normen – aufzeigen. Dadurch obliegt ihnen ein reflexives Potenzial, nämlich gleichsam auch die Praktiken, Operationen und Methoden der Medienwissenschaft selbst in der Herstellung von medienwissenschaftlichem Wissen zu befragen. Für die Medienwissenschaft könnten so eigene disziplinäre Schwachstellen offengelegt werden. Jeder Medienbegriff, egal ob textuell, codebasiert, körperlich, bildlich, tonal etc. unterliegt Formatierungsvorgaben: Mit Michel Serres ließe sich sagen, dass Medien Formate passieren lassen müssen und umgekehrt. Der Senkrechtstrich, der im Titel dieses Schwerpunkts Medium und Format zueinander in Beziehung stellt, wird häufig in der Programmiersprache verwendet und dort auch als pipe bezeichnet. Das Satzzeichen kann somit als ein Rohr oder eine Leitung verstanden werden, die das eine durch das andere hindurchführt.
—
OLIVERFAHLE, MAREKJANCOVIC, ELISALINSEISEN, ALEXANDRASCHNEIDER
1 Jonathan Sterne: MP3. The Meaning of a Format, Durham, London 2012, 7.
2 Der bekannte Satz lautet: «If there is such a thing as media theory, there should also be a format theory», ebd., 7.
3 Ebd., 11.
4 Rosa Menkman: A Vernacular of File Formats, Amsterdam 2010, 2. Siehe auch die Website der Künstlerin, beyondresolution.info/A-Vernacular-of-File-Formats (20.1.2020).
5 Liam Cole Young: Cultural Techniques and Logistical Media. Tuning German and Anglo-American Media Studies, in: M/C Journal, Bd. 18, Nr. 2, 2015, journal.media-culture.org.au/index.php/mcjournal/article/view/961 (20.1.2020).
6 Susan Leigh Star: Grenzobjekte und Medienforschung, hg. v. Sebastian Gießmann und Nadine Taha, Bielefeld 2017.
7 Lorna Roth: Looking at Shirley, the Ultimate Norm. Colour Balance, Image Technologies, and Cognitive Equity, in: Canadian Journal of Communication, Jg. 34, Nr. 1, 2009, 111–136, hier 115.
8 Ebd., 112.
9 Ebd., 117.
10 Ebd., 118.
11 Ulrike Bergermann: «INSTAGRAM RACISM»? Über die neue alte Shirley Card, in: Gender-Blog, 1.10.2015, www.zfmedienwissenschaft.de/online/blog/%C2%ABinstagram-racism%C2%BB (20.1.2020).
12 Meredith L. McGill: Format, in: Early American Studies. An Interdisciplinary Journal, Bd. 16, Nr. 4, 2018, 671–677, hier 674.
13 Vgl. Marek Jancovic: Fold, Format, Fault. On Reformatting and Loss, in: ders., Axel Volmar, Alexandra Schneider (Hg.): Format Matters. Standards, Practices, and Politics in Media Cultures, Lüneburg 2020, 192–218.
14 Michael Niehaus: Was ist ein Format?, Hannover 2018, 42f. Niklas Luhmann: Das Medium der Kunst, in ders.: Aufsätze und Reden, Stuttgart 2011, 198–217, hier 198.
15 Ebd., 43.
16 Ebd., 42.
17 McGill: Format, 676.
18 Alexander R. Galloway, Jason R. LaRivière: Compression in Philosophy, in: boundary 2, Bd. 44, Nr. 1, 2017, 125–147, hier 125.
19 Vgl. ebd.
20 Sterne: MP3, 11.
21 Elisa Linseisen: High/Definition/Bilder/Denken/Digital. Medienphilosophisches Image Processing, Bochum 2019 [Dissertationsschrift].
AXEL VOLMAR
DAS FORMAT ALS MEDIENINDUSTRIELL MOTIVIERTE FORM
—
Überlegungen zu einem medienkulturwissenschaftlichen Formatbegriff
Die geistes- und kulturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit Formaten hat im vergangenen Jahrzehnt eine bemerkenswerte Konjunktur erfahren. Den Ankerpunkt dieser Entwicklung bildet auf internationaler Ebene nicht zuletzt Jonathan Sternes 2012 erschienene Monografie MP3. The Meaning of a Format, in der er die wissenschaftshistorischen Voraussetzungen, die technische Entwicklung und Standardisierung sowie die medienkulturellen Auswirkungen komprimierter Musikspeicherung im digitalen MP3-Format aufzeigt.1 Seitdem ist der Formatbegriff auch von den Nachbardisziplinen der Medienwissenschaft als theoretisch-methodisches Werkzeug mobilisiert worden. So bedient sich David Joselit des Begriffs zur Beschreibung des internationalen Kunstsystems, während Haidee Wasson wiederum dafür geworben hat, Filmgeschichte mit dem Blick auf verschiedene, geografisch und historisch verteilte Produktions- und Nutzungskulturen als vergleichende Formatgeschichte neu zu denken.2 In den letzten Jahren haben auch die deutschsprachigen Geistes- und Kulturwissenschaften das Format als Phänomen und Forschungsobjekt für sich entdeckt, darunter neben der Medienwissenschaft wiederum die Kunstgeschichte, insbesondere aber auch die Literaturwissenschaft.3
In der Medienwissenschaft hatte das Format als Gegenstand selbstredend schon immer einen angestammten Platz, denn wo immer Medien sind, gibt es auch Formate und Formatierungen. Formate konfigurieren, spezifizieren und standardisieren Medien, treten dabei allerdings auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen in Erscheinung – etwa als geometrische Bestimmungen von Zuschnitten und Seitenverhältnissen, als dramaturgische Elemente von Rundfunksendungen bzw. thematische Zuspitzungen ganzer Sender oder als technische Spezifikationen digitaler Dateiformate. Formate bestimmen die ästhetischen Qualitäten von Medien ebenso entscheidend mit wie praktische, wirtschaftliche und juristische Aspekte ihrer Produktion, Distribution und Rezeption. Nicht ohne Grund konstatiert daher Jonathan Sterne: «Wenn es so etwas wie Medientheorie gibt, sollte es auch Formattheorie geben.»4 Trotz ihrer Allgegenwart sind Formate jedoch, insbesondere in medientheoretischer Hinsicht, bisher nur verhältnismäßig selten behandelt worden. Im Rahmen der fächerübergreifenden, eher lose verbundenen Formatforschung, die sich in den letzten Jahren konstituiert hat, sind bisher primär Einzelanalysen vorgelegt worden.5 Und auch Sterne selbst hat seine Überlegungen zu der von ihm geforderten Formattheorie nicht systematisch verfolgt, sondern lediglich einige – wenn auch äußerst produktive – Anstöße zur Theoretisierung von Formaten gegeben.6 Auf dieses Desiderat weist auch Susanne Müller 2014 in einem sehr lesenswerten Beitrag zum Formatieren als medialer Praxis hin, in welchem sie das Format als einen Schlüsselbegriff der Medienwissenschaft herausstellt, dem es jedoch an einer grundlegenden Theoretisierung fehle: «Eine Theorie des medialen Formats, die das Phänomen mit all seinen Facetten in der Medienwissenschaft platziert, wäre ebenso zu schreiben wie eine Medienkulturgeschichte, die Format und Formatieren historisch verortet.»7
Eine Theorie des Formats wird zugegebenermaßen auch dieser Beitrag nicht liefern können. Er unternimmt stattdessen den Versuch einer grundlegenden Begriffsbestimmung, da bisher in der Medienwissenschaft kein einheitlicher Formatbegriff existiert, sondern stattdessen eine Vielzahl unterschiedlicher Definitionen im Umlauf sind, die sich jeweils auf bestimmte Medien oder medienpraktische Anwendungsbereiche beziehen. In der publizistisch ausgerichteten Medienkommunikationswissenschaft ist der Formatbegriff beispielsweise aufgrund methodischer Überlegungen sehr eng und explizit in einer scharfen Abgrenzung zu mitunter im Alltag weit verbreiteten Verwendungsweisen des Konzepts definiert worden. So schlagen die Herausgeber des 2010 erschienenen Sammelbands Neue Medien – neue Formate ein dreiteiliges Ordnungsschema von Massenmedien vor, in dem Formate als kommunikationswissenschaftliche Analyseeinheiten auf der Mesoebene zwischen übergeordneten «Mediengattungen» (Printmedien, Hörfunk, Fernsehen, Film, Internet etc.) und spezifischen «Kommunikations- oder Darstellungsformen» bzw. Textsorten (Bericht, Magazingeschichte, Porträt, Kommentar etc.) fungieren. Als «Formate» gelten dieser Auffassung zufolge ausschließlich Subgruppen von Mediengattungen, wie z.B. Tageszeitungen, Wochenmagazine, Fachzeitschriften, Tabloids, Weblogs, Podcasts oder Chats.8
Formatbegriffe stellen jedoch in erster Linie Akteurskategorien dar, die sich historisch jeweils in sehr unterschiedlichen Kontexten entwickelt haben und daher mit je anderen Bedeutungszusammenhängen verbunden sind. Dem Begriff des Formats eignet zudem eine gewisse Unschärfe, die sich dadurch auszeichnet, dass er sich oft nur schwer von verwandten Begriffen, wie etwa Form, Genre, Formation, Medium, Protokoll, Codec oder Interface, abgrenzen lässt.9 Aus diesem Grund bildet Heterogenität ein grundsätzliches Charakteristikum von Formaten, und zwar sowohl in Bezug auf die vielfältigen Erscheinungsweisen als auch auf gängige Begriffsbildungen. Daher stellt sich die Frage, wie ein medienwissenschaftlicher bzw. näherhin medienkulturwissenschaftlicher Formatbegriff beschaffen sein müsste, der die historisch gewachsene Vielfalt des Phänomens nicht als Problem betrachten und durch Verengung oder methodischen Ausschluss eliminieren, sondern vielmehr in seiner Faktizität ernst nehmen und theoretisch produktiv machen würde. Dazu soll im Folgenden untersucht werden, ob es Aspekte gibt, durch die sich, soweit möglich, alle Formate trotz ihrer phänomenalen wie begrifflichen Heterogenität grundsätzlich auszeichnen. Dabei geht es indes nicht allein um eine Begriffsbestimmung, sondern um den Versuch, durch diese zu einem besseren Verständnis darüber zu gelangen, was Formate im Kern ausmacht und welche Phänomene und Beziehungsgefüge ein solches grundlegendes bzw. verallgemeinertes Formatverständnis in den medienwissenschaftlichen Blick rücken würde.
I.Begriffliche Annäherungen
Ein erster Blick auf die Etymologie des Begriffs lehrt, dass das Wort ‹Format› eine Entlehnung aus dem lateinischen formatum bildet, das als substantiviertes zweites Partizip des Verbs formare (für ‹formen› oder auch ‹ordnen›) das Geformte, In-Form-Gebrachte sowie etwas weiter gefasst auch das Geordnete oder Genormte bedeutet. Der Begriff ist daher zunächst dem der ‹Formation› ähnlich, mit dem ein strukturiertes Gebilde bzw. etwas Herausgebildetes benannt ist: So kann mit einer Formation beispielsweise eine militärische Aufstellung, eine erdgeschichtliche Periode mit einer charakteristischen geologischen Schichtenbildung oder – in der Bedeutung des französischen Wortes formation – schlicht das Durchlaufen und den Abschluss einer Ausbildung gemeint sein. Während der Begriff der Formation mit sowohl intentionalen als auch mit aus sich selbst heraus stattfindenden Bildungsprozessen und den Strukturen ihrer Resultate verbunden ist, verweist der Formatbegriff stärker auf Akte der Formgebung, speziell auch im Hinblick auf gezielte Ordnungs- oder Normierungsbestrebungen.
Was unterscheidet den Begriff des Formats dann jedoch von dem der Form selbst? Die Abgrenzung zum Formbegriff ist in der Tat nicht unproblematisch, denn obwohl es Formen natürlichen Ursprungs gibt, können sie selbstverständlich ebenso gut auf menschliche Kreation bzw. Einwirkung zurückgehen und damit geformte Form sein. Der Artefaktcharakter des Formats würde daher als Alleinstellungsmerkmal kaum ausreichen. Möglich wäre, das Verständnis des Formatbegriffs an den Aspekt der Zweckgebundenheit zu koppeln, worauf auch die erweiterte Wortbedeutung als das Geordnete oder Genormte verweist. Eine trennscharfe Unterscheidung der Begriffe Form und Format würde dennoch nach einer tiefergehenden Begriffsdiskussion verlangen, die ich hier jedoch zugunsten einer Engführung auf die medienwissenschaftliche Verwendung des Formbegriffs umgehen möchte. Es scheint eine ebenso zufällige wie interessante Koinzidenz zu sein, dass im Jahr 2010, dem Publikationsjahr des Bandes Neue Medien – Neue Formate, auch Rainer Leschkes programmatisches Buch Medien und Formen. Eine Morphologie der Medien erschien.10 In diesem argumentiert Leschke, dass der Medienbegriff aufgrund der Auflösungstendenzen von (Einzel-)Medien infolge der fortschreitenden Digitalisierung seine grundsätzliche Unterscheidungsfunktion und Operationalisierbarkeit als theoretisches Konzept zunehmend einbüße. Als eine Möglichkeit, diesem Problem zu begegnen, schlägt er vor, zukünftig nicht mehr Medien, sondern mediale ‹Formen› zu untersuchen, und zwar im Rahmen «einer vergleichenden medienübergreifenden Strukturanalyse von Formprozessen».11 Als medienmorphologisch interessante Formen werden u.a. dramaturgische Exposition, Projektions- und Montageformen, Levelstrukturen, Splitscreen, Schuss-Gegenschuss-Verfahren, Schnappschuss und Lichtblitz angeführt.12 Sven Grampp konstatiert dazu:
So heterogen diese Beispiele auch sein mögen, gemeinsam ist ihnen: Sie allesamt sind Anschauungs- und Darstellungsmittel, die in ‹medialen› Kontexten konventionalisiert wurden und dort Ordnungs- wie Orientierungsleistungen erbringen. Ein Medienmorphologe beschäftigt sich also vornehmlich mit Formen, die in Medien zu finden sind, also mit medialen Formen.13
Obwohl mediale Formen somit ebenso wie Formate Ordnungsfunktionen erfüllen können, unterscheiden sie sich von Letzteren also möglicherweise dadurch, dass sie als Mittel zur Strukturierung medialer Anschauung und Darstellung Formen in Medien darstellen und Formate demgegenüber tendenziell eher als Formierungen von Medien verstanden werden könnten.
Die medienpraktische Verwendung des Formatbegriffs in Rundfunkmedien zur Kategorisierung von Sendungen und Programmen rückt ihn wiederum in die Nähe ‹künstlerischer Formen› wie literarischer Gattungen oder filmischer Genres, die sich durch gemeinsame formale Strukturen, Themen, Motive etc. auszeichnen bzw. voneinander unterscheiden. Ähnlich wie im Vergleich zur ‹Formation› scheint ein wesentlicher Unterschied zum Format darin zu bestehen, dass künstlerische Formen zumeist überindividuelle Emergenzphänomene darstellen, die sich über längere Zeiträume hinweg herausbilden und erst post factum als solche bestimmt und benannt werden. Formatbegriffe stellen dagegen in der Regel die Objekte und Ergebnisse intentionaler Setzungen dar, die von den Akteur_innen selbst als solche definiert und spezifiziert werden. Formate sind demgegenüber weniger ‹Gattung› im Sinne historisch gewachsener Summen, Gruppen oder Muster individueller Werke, sondern strukturierte Vorgaben in Form von Modellen, Standards oder Regelwerken. Durch diesen präfigurativen bzw. präskriptiven Charakter unterscheiden sich Formate zudem von künstlerischen ‹Stilen›, die zwar laut Duden ebenfalls die «charakteristisch ausgeprägte Erscheinungsform» von Werken bezeichnen, sich jedoch weniger auf dessen Form im strukturellen Sinne, sondern auf die «Art und Weise der Ausführung» beziehen – nicht zuletzt leitet sich der Begriff Stil vom Schreibgerät (lat. stilus) ab und damit von kreativen Schreib- bzw. Schaffensprozessen und buchstäblich individuellen Handschriften.
II.Strategien der Formatierung und Praktiken des Formatierens
Während die Etymologie des Formatbegriffs auf einige charakteristische Eigenschaften – darunter insbesondere die Aspekte der Setzung, der ordnenden Strukturierung und der Zweckorientierung – hindeutet, lässt sich die mangelnde Trennschärfe zu Nachbarbegriffen offenbar aus der Wortbedeutung allein kaum auflösen. Ein tieferes Verständnis des Formatbegriffs lässt sich jedoch durch einen historischen Vergleich konkreter Entstehungs- und Nutzungskontexte von Formatbegriffen gewinnen.
Seine erste breitere Verwendung fand der Ausdruck ‹Format› im frühneuzeitlichen Druckwesen.14 Frühe Buchformate korrelierten grob mit bestimmten geometrischen Abmessungen und bildeten in ihrer Gesamtheit eine Reihe von Größenabstufungen. Ihre Bezeichnungen stellten jedoch nur indirekt Größenangaben dar, sondern bezogen sich auf die Anzahl der bedruckbaren Blätter (mit je Vorder- und Rückseite), die man aus einem einzelnen Pergamentbogen durch einfaches oder mehrfaches Falten bzw. Falzen erhielt. So bezeichnet das Folioformat ein Buch, das aus einfach gefalzten Bögen mit zwei Blättern (bzw. vier Druckseiten) besteht. Bücher im etwa halb so großen Quartformat basieren auf zweifach gefalzten Bögen mit vier Blättern (bzw. acht Druckseiten) und solche im nochmals kleineren Oktavformat auf einer dreifachen Falzung mit acht Blättern (bzw. 16 Druckseiten) usw.15 Jedes Buchformat erforderte eine je eigene Vorbereitung der Druckformen – eine Tätigkeit, die bis heute im Layout als Formatieren bezeichnet wird. In der Buchdruckersprache bezeichnete der Formatbegriff nicht zufällig auch den aus Eisenstegen (den sogenannten Formatstegen) gebildeten Rahmen, der beim Schließen einer Buchdruckform die korrekte Platzierung der einzelnen Schriftkolumnen sowie einen gleichmäßigen Abstand zwischen diesen auf dem Druckbogen sicherte. Zur Praxis des Formatierens, die einen wesentlichen Teil der Arbeit des Druckens bzw. Setzens ausmachte, gehörte neben der korrekten Rahmung insbesondere das formatspezifische Anordnen der einzelnen Schriftkolumnen auf dem Setzbrett (das sog. Ausschießen), damit sich nach dem Falzen des Bogens die korrekte Reihenfolge und Ausrichtung der einzelnen Buchseiten ergab. Zu weiteren Arbeitsschritten zählten u.a. die angemessene Auswahl von Schriftgrößen sowie der richtige Umgang mit verschiedenen Schriften und Alphabeten. Dieses handwerkliche Wissen der Buchdruckerkunst war aufgrund der relativ großen Anzahl an gebräuchlichen Buchformaten recht komplex und wurde ab dem frühen 17. Jahrhundert in sogenannten ‹Formatbüchern› zusammengestellt.16 In diesen wurde u.a. mithilfe schematischer Darstellungen Unterricht darüber «ertheilet, wie man Formate ausschiesen [soll]. Insgemein sind auch die Orientalischen Alphabete angehänget, und sonsten allerhand, was ein Buchdrucker zu wissen nöthig hat».17
Wie sich zeigt, war die Einrichtung von Buchformaten im Wesentlichen ökonomisch motiviert und auf außertextuelle Zwecke gerichtet. Denn da für kleinere Formate mehr Seiten pro Druckbogen gefertigt, üblicherweise auch kleinere Schrifttypen gewählt wurden und dadurch weniger Papier für die Herstellung benötigt wurde, ermöglichte die Formatierung von Büchern eine Staffelung der Material- bzw. Stückkosten, was wiederum Handlungsspielraum im Hinblick auf die Kalkulation von Auflagenzahl und Verkaufspreis bot. Aufgrund dieser Kostenstaffelung kam Formaten zudem eine gewisse Steuerungsfunktion hinsichtlich der jeweiligen Verteilungs- bzw. Gebrauchskontexte zu: Großformatige Publikationen zu Repräsentationszwecken erscheinen (bis heute) in aller Regel in einer gehobenen Qualität bei kleineren Auflagen, während die Wahl kleinerer Formate größere Auflagen ermöglicht und damit eine potenziell größere Reichweite bietet.
Hieraus ergibt sich – im Gegensatz etwa zu künstlerischen Formen, Gattungen oder Genres – zunächst ein fundamentaler Zusammenhang zwischen Formaten und den umgebenden finanziellen wie materiellen Bedingungen der Medienproduktion (wie etwa der Größe einer Druckerpresse oder der verfügbaren Papierbögen), aber auch der Distribution und der Rezeption. Man kann daher sagen, dass die Entstehung von Formaten auf Strategien der Formatierung von Medienprodukten zurückgeht, die nicht primär auf die Binnenstrukturierung medialer Texte zielen, sondern durch die Festlegung elementarer Parameter, etwa im Hinblick auf Größe oder materielle Qualität, außerhalb der jeweiligen medialen Texte liegenden Zwecken dienen. Werden Formatspezifikationen im Rahmen der Medienpraxis aufgegriffen, zieht dies zudem spezifische Praktiken des Formatierens nach sich, die sich wiederum auf eine bestimmte Formgebung bzw. konkrete Gestaltung von Medien und medialen Texten – und damit nach innen – richten. So war mit dem breiten Angebot von Buchformaten stets auch die Notwendigkeit bzw. Aufforderung verbunden, die Inhalte bzw. deren Darstellung individuell an die Bedingungen des jeweils gewählten Formats anzupassen, woraus erst das Formatieren als praktische, «so nöthig als nützliche Buchdruckerkunst»18 hervorging. Anders ausgedrückt: Formate machen Arbeit und stehen deshalb in einer engen Wechselbeziehung zu Arbeitspraktiken und Fertigungstechniken der Medienproduktion.
Auf die Bedeutung von Außen- und Binnenstrukturen für das Verständnis von Formaten hat auch die kommunikationswissenschaftliche Formatforschung in Bezug auf massenmediale Medienformate hingewiesen. Bucher u.a. fassen Formate in Anlehnung an den Begriff der ‹kommunikativen Gattung› mit Thomas Luckmann als «mehr oder minder wirksame und verbindliche ‹Lösungen› von spezifischen kommunikativen ‹Problemen›» auf.19 Abhängig davon, welche «kommunikativen Funktionen» – hier verstanden als die «Grundaufgaben öffentlicher Mediensysteme» – etwa erfüllt werden sollen, lösen Medienformate «diese übergeordneten Aufgaben des Informierens, Unterhaltens, Bildens oder Kontaktherstellens auf jeweils unterschiedliche Art und Weise».20 Tatsächlich bildet das Verhältnis zwischen Außen- und Binnenbezügen nicht nur für die Analyse kommunikativer Gattungen einen fundamentalen Bezugspunkt, sondern auch für das Verständnis von Formaten im Allgemeinen, lassen sich doch die mit Formaten einhergehenden Binnenstrukturierungen von Medien primär als Folgen von mit Außenbezügen – und damit mit äußeren Zwecken – in Verbindung stehenden Entscheidungen auffassen. Medienformate lösen allerdings, wie bereits das Beispiel der Buchherstellung zeigt, nicht nur Kommunikations-, sondern insbesondere auch Kooperationsprobleme. So ging es etwa bei der Herstellung und Vermarktung von Büchern nie ausschließlich um kommunikative Aspekte, sondern um Profite – oder mindestens um das wirtschaftliche Überleben von Verlagen – und damit im weiteren Sinne um die Tragfähigkeit von Geschäftsmodellen bzw. das Gelingen von Kooperationen zwischen Verlagen und Käufer_innen.
Ein eindrückliches Beispiel für die Lösung kooperativer Probleme durch Formate stellen auch die um 1900 unternommenen Anstrengungen zur Konzeption und Etablierung einheitlicher Papierformate dar, wie sie Markus Krajewski in Restlosigkeit nachgezeichnet hat. Diese gingen im späten 19. Jahrhundert einerseits auf staatliche, andererseits auf wirtschaftliche Akteure wie etwa den Verein deutscher Papierfabrikanten zurück, der 1883 einheitliche Bogengrößen und zwölf auf diese bezogene Normalformate festlegte.21 Die Strategien dieser Formatierungsbestrebungen zielten insbesondere darauf ab, bürokratische Abläufe in Wirtschaft und Verwaltung durch die Normierung aller möglichen Schriftmedien zu optimieren. Dabei ging es nicht allein um die Vereinheitlichung von Drucksachen wie Briefpapieren, Formularen oder Karteikarten, sondern auch darum, diese mit den sie umgebenden, aus Umschlägen, Heftern, Ordnern, Karteikästen, Aktenschränken und anderen Aufbewahrungsmedien bestehenden Medienökologien ‹restlos› kompatibel zu machen. Den Außenbezug des Formats bildeten hier also ausgedehnte Systeme wie staatliche Bürokratien oder Volkswirtschaften, inklusive ihrer Verflechtungen auf internationaler bzw. globaler Ebene, in denen standardisierte Größen eine komplexitätsreduzierende und dadurch Ordnung stiftende Wirkung entfalten und dadurch eine ökonomischere Herstellung und Zirkulation von Schriftstücken sowie eine effizientere Organisation von Repositorien ermöglichen sollten.
Die Normierung von Papiermedien zielte also auf die Lösung von Kooperationsproblemen in heterogenen, translokalen Zusammenhängen. Der Einführung einheitlicher Formate stand jedoch noch eine weitere Kooperationsproblematik entgegen, die ihre allgemeine Durchsetzung bzw. Akzeptanz betraf. Diese Problematik zeigte sich vor allem an der Tatsache, dass im Grunde alle um die Jahrhundertwende angestrengten Standardisierungsvorhaben nur von mäßigem bzw. regionalem Erfolg gekrönt waren. Formate können sich nur dann durchsetzen, wenn es gelingt, eine kritische Masse aller beteiligten Akteur_innen auf einen allgemeingültigen Standard hin auszurichten und mithin zum standardkonformen Formatieren ihrer eigenen Produkte zu bewegen.22 Oder, wie es Krajewski mit Blick auf die gescheiterte Lancierung des von Wilhelm Ostwald vorgeschlagenen «Weltformats» formuliert hat: «Kein Weltformat funktioniert ohne eine Welt, die sich dessen annimmt.»23
Dieser Umstand rückt für die Formatforschung insbesondere die Prozesse der Entwicklung, Aushandlung und Etablierung von Standards in den Blick. Zur Akzeptanz eines Standards müssen der ‹Welt› verständlicherweise die richtigen Anreize gegeben sein. Daher ist es nur folgerichtig, dass die erste Festlegung und erfolgreiche Etablierung einer einheitlichen Formatreihe für Papier nicht aus einem amtlichen Erlass resultierte, sondern erst dem 1917 gegründeten Normenausschuß der deutschen Industrie (NDI), dem Vorläufer des Deutschen Instituts für Normung (DIN), mit seiner im Jahr 1921 festgelegten und aus den vier Formatreihen A, B, C und D bestehenden Deutschen Industrie-Norm DIN476 gelang. Denn die hauptsächliche Motivation für den NDI, sich als Stellvertreter der Welt der Schaffung einer prinzipiell weltweit gültigen Formatserie zu verpflichten, dürfte vor allem auf eigene Kooperationsprobleme zurückgegangen sein, die primär Fragen einer ökonomischeren Gestaltung von Produktions- und Verwaltungsprozessen innerhalb von Industrie und Wirtschaft selbst betrafen. Mit der Einführung einheitlicher Papierformate als Industrienorm wurde das Formatieren der Industrie als Gebot der Vernunft in freiwilliger Selbstverpflichtung überantwortet und damit von der Benutzer_innen- auf die Produzent_innenseite verlagert. Die Vereinheitlichung von Papiermedien und ihrer Containermedien betraf und transformierte jedoch zugleich die gesamte sie umgebende mediale Ökologie bürokratischer Zirkulation. So entfaltete die Formatreihe nach dem Ersten Weltkrieg eine durchschlagende Wirkung «nicht nur in den Behörden und Planungsbüros der Industrie, sondern mithin im gesamten Geschäftsleben der Weimarer Republik».24
Im Grunde waren und sind die Adressat_innen von Formatierungsstrategien stets industrielle Kontexte und mit diesen verbundene Kooperationsbeziehungen im Rahmen des ökonomischen Wettbewerbs. Medienformate sollten daher prinzipiell – wenn auch nicht zwingend in jedem Einzelfall – als industriebezogen gedacht werden.25 Diese Industriebezogenheit von Formaten tritt spätestens mit dem Aufkommen technischer Medien und den sich mit deren Verbreitung formierenden neuen Medienökonomien in aller Deutlichkeit zutage. Im Fall analoger Speichermedien bildete Formatierung zunächst schlicht eine technische Notwendigkeit, um ein funktionierendes Zusammenspiel zwischen den transportablen Informationsträgern bzw. Trägermedien einerseits und den Aufzeichnungs- und Wiedergabegeräten andererseits zu gewährleisten.26 Michael Niehaus stellt in diesem Zusammenhang mit Verweis auf Niklas Luhmanns Medium/Form-Unterscheidung fest, dass erst Formate Formen und Medien füreinander aufnahmefähig machen: «Erst das formatierte Speichermedium ist als Speichermedium erkennbar und verwendbar.»27
Hersteller technischer Apparate entwickelten Formatspezifikationen daher in der Regel zunächst für den Hausgebrauch, d.h. vor allem zur Stabilisierung ihrer eigenen Produkte und interner Produktionsabläufe, darüber hinaus aber auch zur Organisation und Koordination der Zusammenarbeit mit Zulieferern und anderen Geschäftspartnern. Das gleichzeitige Auftreten unterschiedlicher Formate ist daher nicht zuletzt ein Indiz für konkurrierende technische Verfahren, die wiederum mit dem Besitz oder der Lizenzierung bestimmter Patente verbunden sind. So wurden akustische Schwingungen auf Schellackplatten der Berliner Gramophone Company im horizontalen Seitenschrift-Verfahren aufgezeichnet, während die im Jahr 1911 von der Edison Company eingeführte Diamond Disc die ursprünglich für den Phonographen entwickelte Vertikal- bzw. Tiefenschrift verwendete. Im Kampf um Marktanteile und die ökonomische Vorherrschaft über eine mediale Technologie kommt es bis heute immer wieder zu regelrechten ‹Formatkriegen›, nicht zuletzt weil die erfolgreiche Etablierung eines Formatstandards in der Regel mit hohen Lizenzeinnahmen verbunden ist.
Inkompatible Formate wie die Schellackplatte und die Diamond Disc können zwar bis zu einem gewissen Grad kundenbindend wirken, da sich Käufer_innen mit dem Erwerb eines bestimmten Fabrikats auf die im Format ihres Geräts vorhandenen Inhalte festlegen. Umgekehrt gaben jedoch die aus solchen Umständen resultierenden Frustrationen (nicht nur auf Konsument_innenseite) im Laufe des 20. Jahrhunderts immer wieder Anlass zu Vorstößen, einheitliche, industrieübergreifende Formatstandards zu etablieren. Diese wurden zunehmend von Industriekonsortien global agierender Unternehmen oder nationalen bzw. transnationalen Standardisierungsinstitutionen ausgearbeitet.28 Die Standardisierung und Lizenzierung von Medienformaten dient so einerseits der Herstellung von Interoperabilität zwischen den Geräten und Trägermedien verschiedener Hersteller, d.h. von apparativer und wirtschaftlicher Ko-Operation im Sinne einer Integration voneinander unabhängig ablaufender Prozesse; andererseits bildete die Erarbeitung einheitlicher und verbindlicher Formatstandards jedoch auch eine wesentliche Voraussetzung für die Internationalisierung von Verwertungsketten und damit für die Etablierung translokaler Mediensysteme und Märkte, wie beispielsweise des internationalen Filmhandels. Weil Formate einen obligatorischen Passagepunkt für die Zirkulation medialer Objekte bilden, gingen Strategien der Formatierung primär von industriellen Akteuren aus, wenn auch Medienschaffende sich immer wieder mit Vorschlägen für die konkrete Aus- und Umgestaltung von Formaten einbrachten.29
Weitere Formatbegriffe entstehen im Laufe des 20. Jahrhunderts im Zuge der Verbreitung und insbesondere der Kommerzialisierung des Rundfunks bzw. Fernsehens, und zwar einerseits in Form von Sendeformaten, die serielle, sich wiederholende Sendungen auf in der Regel festen Programmplätzen bezeichnen, und andererseits als Formatradio bzw. Formatfernsehen, d.h. als Sender, deren Programm vor dem Hintergrund privatwirtschaftlichen Wettbewerbs konsequent auf eine bestimmte Programmsparte (wie z.B. eine bestimmte Musikrichtung) bzw. Zielgruppe ausgerichtet ist.30 In den USA entstand Formatradio bereits in den 1920er Jahren, in Deutschland (und anderen europäischen Ländern) dagegen erst mit der Verbreitung von Privatsendern in den 1980er Jahren. Die Formatierung von Radiosendern basiert auf einer strategischen Verengung der Programmvielfalt und dient auch in diesem Fall einem äußeren Zweck, nämlich der möglichst gezielten Sortierung bzw. Filterung des Hörer_innenpublikums in trennscharfe Zielgruppen zur Maximierung von Werbeeinnahmen. Den Hintergrund für die mittels Formatierung vorgenommene Umfunktionierung des Mediums Radio zum demografischen Filter bildete auch hier wieder die Lösung eines kooperativen Problems, das in der Frage kumulierte, wie die Zusammenarbeit zwischen kommerziellen Sendern und der Werbewirtschaft möglichst optimal gestaltet werden könnte.
Der Entwurf spezifischer Sendeformate dient in vielen Fällen dem gleichen Zweck. In seiner «programmstrategischen Verwendungsweise», fassen etwa Bucher u.a. zusammen,
wird mit Format eine marktorientierte, kommerzielle Gestaltungsweise von Medienangeboten verstanden, die eine effektive und Zielgruppen-orientierte Produktion durch deren Serialisierung sicherstellen soll […]. Format bezieht sich hier auf die unveränderlichen, strukturellen Elemente einer seriellen Produktion wie Moderation, Dramaturgie, Kennungen, Logos, Sendungsdesign, optische und akustische Signale, Sendeplatz etc., die sicherstellen sollen, dass einzelne Sendungen als Episoden einer Serie erkennbar werden.31
Die Formatierung von Sendungen auf der Grundlage unveränderlicher und damit für das Publikum regelmäßig wiederkehrender struktureller Elemente zielt also vor allem auf das Erreichen eines hohen Wiedererkennungswerts und einer hohen Zielgruppenkonformität. Knut Hickethier versteht das Format – als spezifische Gestaltungsaufgabe – «auch als ein medienindustriell optimiertes Genre», da es alle Formtraditionen negiere, «sofern diese sich nicht in berechenbaren Zuschauererwartungen und damit in Einschaltquoten manifestieren». Die von den Medienschaffenden zu erbringende Formatierungsarbeit fasst Hickethier wiederum als die «spezifisch kommerzielle Ausgestaltung und lizenzgebundene Festlegung von Formen von (zumeist seriell hergestellten und gesendeten) Produktionen».32 Die Formatierung von Sendekonzepten bildet die wesentliche Grundlage für ihre Warenförmigkeit und Handelbarkeit. So beruht der internationale Formathandel, der neben Eigen- und Auftragsproduktionen sowie Sendungsimporten mittlerweile eine tragende Säule der TV-Angebotsentwicklung bildet, gerade darauf, «dass ein in den Strukturen gleichbleibendes Sendegefäß mit länder- und kulturspezifischen Inhalten gefüllt werden kann – wie das beispielsweise beim Einsatz des Formats Wetten dass … in der VR China oder der nahezu globalen Verbreitung des Formats Wer wird Millionär? der Fall ist».33 Auch in diesem Fall löst die Formatierung wieder ein mehr die Kooperation denn die Kommunikation betreffendes Übertragungsproblem.
III.Formatbegriff und medienwissenschaftliche Formatforschung
Formate und Formatbegriffe stehen Medien und Medienbegriffen an Heterogenität in nichts nach. Trotz dieser Vielgestaltigkeit sind die grundlegenden Eigenschaften von Formaten jedoch weit weniger beliebig, als man vielleicht erwarten würde. Allgemein dienen Formate in konzeptueller Hinsicht als Vorgaben für die Form und Beschaffenheit von Medien bzw. medialen Texten und bilden die Resultate intentionaler und mithin strategischer Setzungen. In praktischer Hinsicht erscheinen Formate schließlich als durch menschliche Arbeit oder industrielle Fertigung gemäß diesen Vorgaben in Form zu bringende bzw. in Form gebrachte Trägermedien oder Medienprodukte. Obwohl die Konzeption von Formaten die Binnenstrukturierung und damit die Ästhetik von Medien entscheidend mitbeeinflusst, folgt diese in der Regel mit externen Strukturen und primär ökonomischen Kontexten verbundenen Zielen – wie beispielsweise der Optimierung bürokratischer Abläufe, der Interoperabilität von Apparaten, der Ansprache bestimmter Zielgruppen oder der Handelbarkeit von Sendekonzepten. Formatspezifikationen können dabei auf Bedingungen und Prozesse sowohl der Produktion als auch der Distribution und Rezeption von Medien bezogen sein. Die Binnenstrukturen von Formaten lassen sich so, im Gegensatz etwa zu denen künstlerischer Formen oder Genres, auch als Spuren begreifen, welche die sie umgebenden medienindustriellen Umwelten – einschließlich der in diesen vorherrschenden Kooperationsverhältnisse – in Medien und medialen Texten hinterlassen. Umgekehrt lassen Analysen dieser Spuren jedoch auch weitreichende Rückschlüsse in Bezug auf die sie umgebende Medienkultur zu, wie Jonathan Sterne etwa am Beispiel des Zusammenhangs zwischen dem MP3-Format und der Filesharing-Kultur gezeigt hat. Ein Format kann daher als medienindustriell motivierte Form bestimmt werden, die durch auf äußere Zwecke zielende Strategien der Formatierung hervorgebracht wird und als Formatierungsanweisung die spezifische Formgebung und Binnenstrukturierung von Medien und Medienprodukten in Form von Arbeit bzw. Praktiken des Formatierens nach sich zieht. Der Zusammenhang zwischen normativer Konzeption und praktischer Konkretion sowie zwischen Außenbezügen und Binnenstrukturen ist aufgrund ihrer kausalen Verschränkung für das Verständnis von Formaten zentral – selbst wenn er im Laufe der Nutzung eines Formats, etwa durch unvorhergesehene Zweckentfremdungen, historische Entwicklungen oder illegitime Praktiken, unterlaufen oder aufgebrochen wird.
Aufgrund ihrer Industriebezogenheit werden sich der Untersuchung von Formaten notwendig medienökonomische Bezüge aufdrängen. Strategien der Formatierung richten sich auf die Lösung kommunikativer, hauptsächlich aber kooperativer Probleme, weshalb Formate als Mittel zur Etablierung, Steuerung und Stabilisierung von Kooperationsverhältnissen und mithin – mit Erhard Schüttpelz – als «Medien der Kooperation» verstanden werden können.34 Das bedeutet jedoch nicht, dass Formate die gewünschten Kooperationsverhältnisse gleichsam automatisch herstellen. Wie Unternehmungen zur Vereinheitlichung von Formaten zeigen, sind Formate auf allgemeine Akzeptanz angewiesen, was wiederum Prozesse der kooperativen, d.h. gemeinsamen bzw. wechselseitigen Verfertigung und Durchsetzung von Formatstandards zu einem Gegenstand von Formatforschung macht. Sowohl Nutzer_innen als auch Medienschaffenden werden Formate allerdings oftmals auch schlicht ungefragt vorgesetzt. Dieser die alltägliche Medienerfahrung prägende Umstand macht deutlich, dass Formate nicht nur Kooperationsbeziehungen im positiven Sinne realisieren, sondern auch erzwingen können. Formate können daher – mit Susan Leigh Star gesprochen – als «Grenzobjekte» verstanden werden, die unterschiedliche Akteure bzw. Akteursgruppen aufeinander beziehen und zu spezifischem Handeln bewegen können, zur Not auch unbemerkt oder ungewollt in Form einer «Kooperation ohne Konsens».35 So trägt das vor etwas mehr als zehn Jahren festgelegte Format dieser Zeitschrift, nach dem ich mich als Autor zu richten habe, die Notwendigkeit zum Formatieren an mich heran und realisiert auf diese Weise implizit eine Delegation von Arbeit. Es könnte daher lohnenswert sein, im Rahmen von Formatstudien insbesondere (Arbeits-)Praktiken und den Versuchen zu ihrer Steuerung bzw. Verschiebung eine erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken.
Dank ihrer Fähigkeit, Kooperationen zwischen potenziell sehr heterogenen, unabhängig voneinander operierenden und lokal verteilten Akteursgruppen zu ermöglichen bzw. in Form einer Kooperation ohne Konsens zu erzwingen, stellen Formate zudem eine entscheidende Möglichkeitsbedingung weitreichender Industrialisierungs- und insbesondere Skalierungsprozesse dar. Formate haben daher einen entscheidenden Anteil daran, dass lokale mediale Konstellationen zu translokalen Mediensystemen, -industrien und -infrastrukturen mit nationalen, transnationalen oder gar globalen Vermarktungsketten expandieren können. Eine medienkulturwissenschaftliche Formatforschung wird daher einerseits Beiträge zum Verständnis der Entwicklung und Transformation von Medienindustrien und -infrastrukturen liefern, andererseits aber auch aktuelle medienindustrielle Tendenzen analysieren und kritisch kommentieren können, wenn sie ihre Aufmerksamkeit insbesondere gegenwärtigen Strategien zur Formatierung von Medien und damit den im Rahmen von Formatbildungen in Industriekonsortien oder Standardisierungsorganisationen stattfindenden Aushandlungsprozessen zuwendet.36
—
1 Jonathan Sterne: MP3: The Meaning of a Format, Durham, London 2012.
2 David Joselit: After Art, Princeton u.a. 2013; Haidee Wasson: Formatting Film Studies, in: Film Studies, Bd. 12, Nr. 1, 2015, 57–61.
3 Vgl. u.a. Marek Jancovic, Axel Volmar, Alexandra Schneider (Hg.): Format Matters. Standards, Practices, and Politics in Media Cultures, Lüneburg 2020; Michael Niehaus: Was ist ein Format?, Hannover 2018; Carlos Spoerhase: Das Format der Literatur: Praktiken materieller Textualität zwischen 1740 und 1830, Göttingen 2018; Stefanie Stallschus: Format, in: Jörn Schafaff, Nina Schallenberg, Tobias Vogt (Hg.): Kunst-Begriffe der Gegenwart. Von Allegorie bis Zip, Köln 2013, 73– 77.
4 Sterne: MP3, 2 (Übers. AV).
5 Eine Ausnahme bildet die formattheoretische Monografie von Michael Niehaus, die an der Schnittstelle zwischen Literatur- und Medienwissenschaft angesiedelt ist. Vgl. ders.: Was ist ein Format?.
6 Sterne: MP3, 1–17.
7 Susanne Müller: Formatieren, in: Heiko Christians, Matthias Bickenbach, Nikolaus Wegmann (Hg.): Historisches Wörterbuch des Mediengebrauchs, Köln u.a. 2014, 253–267, hier 265 (Herv. i. Orig.).
8 Hans-Jürgen Bucher, Thomas Gloning, Katrin Lehnen: Neue Medien – neue Formate. Ausdifferenzierung und Konvergenz in der Medienkommunikation, Frankfurt/M. u.a. 2010, 19. Niehaus kritisiert jedoch zu Recht, dass es sich hierbei nur um eine terminologische Festlegung, nicht jedoch um einen Bestimmungsversuch handelt. Vgl. Niehaus: Was ist ein Format?, 53.
9 Axel Volmar, Marek Jancovic, Alexandra Schneider: Format Matters. An Introduction to Format Studies, in: Jancovic, Volmar, Schneider (Hg.): Format Matters, 7–22, hier 8f.
10 Rainer Leschke: Medien und Formen. Eine Morphologie der Medien, Konstanz 2010.
11 Unter medialen Formen versteht Leschke dabei im Anschluss an Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen «kulturelle, historisch wandelbare und variabel relationierbare Darstellungs- und Anschauungsmittel». Sven Grampp: Medienmorphologie, in: Jens Schröter (Hg.): Handbuch Medienwissenschaft, Stuttgart 2014, 166–169, hier 166f.
12 Leschke: Medien und Formen, 15, 32, 83, 161.
13 Grampp: Medienmorphologie, 167.
14 Der Begriff ist seit dem frühen 17. Jahrhundert bekundet, entstand jedoch vermutlich bereits im 16. Jahrhundert. Vgl. Müller: Formatieren, 257.
15 Philip Gaskell: A New Introduction to Bibliography, Oxford 1972, 80f. Zum Zusammenhang zwischen Format und Falte siehe auch Marek Jancovic: Fold, Format, Fault. On Reformatting and Loss, in: Jancovic, Volmar, Schneider (Hg.): Format Matters, 195–217.
16 Müller: Formatieren, 258; Martin Boghardt: Formatbücher und Buchformat. Georg Wolffgers Format-Büchlein, in: ders.: Archäologie des gedruckten Buches, hg. v. Paul Needham, Wiesbaden 2008, 78–101.
17 Heinrich Klenz: Die deutsche Druckersprache: Scheltenwörterbuch, Neudruck mit einem Nachwort und einer Bibliographie von Heidrun Kämper-Jensen, Berlin, New York 1991 [1900], 43.
18 Christian Friedrich Geßner: Die so nöthig als nützliche Buchdruckerkunst und Schriftgiesserey, mit ihren Schriften, Formaten und allen dazu gehörigen Instrumenten, Leipzig 1740.
19 Thomas Luckmann: Grundformen der gesellschaftlichen Vermittlung des Wissens: kommunikative Gattungen, in: Friedhelm Neidhardt, Rainer M. Lepsius, Johannes Weiss (Hg.): Kultur und Gesellschaft, Opladen 1986 (Sonderheft der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Nr. 27), 191–211, hier 202.
20 Bucher u.a.: Neue Medien – neue Formate, 22f.
21 Vgl. Markus Krajewski: Restlosigkeit. Weltprojekte um 1900, Frankfurt/M. 2006, 103.
22 Zur orientierenden bzw. ausrichtenden Funktion von Standards vgl. Florian Sprenger: Standards und Standarten, in: Martin Müller, Christoph Neubert (Hg.): Normen und Standards, Paderborn 2018, 21–45.
23 Krajewski: Restlosigkeit, 107.
24 Ebd., 127.
25 Einige digitale Dateiformate mögen Ausnahmen bilden, weil Digitalcomputer notwendig die Beschreibung von Formaten bedingen.
26 Weniger vielleicht in experimentellen Kontexten, aber dennoch angesichts industrieller Massenproduktion.
27 Niehaus: Was ist ein Format?, 42f.
28 Zur Geschichte von Normgebungsverfahren in der Industrie vgl. JoAnne Yates, Craig N. Murphy: Engineering Rules. Global Standard Setting since 1880, Baltimore 2019.
29 Vgl. etwa Antonio Somaini: The Screen as ‹Battleground›. Eisenstein’s ‹Dynamic Square› and the Plasticity of the Projection Format, in: Jancovic, Volmar, Schneider (Hg.): Format Matters, 219–235.
30





























