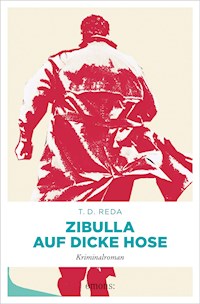
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein schräger, rasanter und ehrlicher Krimi aus dem Ruhrgebiet. Er ist groß. Er ist stark. Er ist cool. Privatdetektiv Tibor Zibulla misst fast zwei Meter, ist Ex-Profiwrestler und ehemaliger Türsteher, trägt Maßanzüge und liebt nur eines mehr als die Musik von James Brown: seine Freundin Anna. Die Erpressung eines schwulen Fußballstars führt Zibulla in die abgründigsten Gegenden Ruhrstadts, wo er Wettbetrügern, Drogenhändlern und schließlich auch Mördern auf die Spur kommt. Dabei hat er zu Hause eigentlich schon genug Probleme.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
T. D. Reda ist ein echtes Kind des Ruhrpotts. In Essen geboren, auf Zollverein ausgebildet und an der Uni Essen studiert, lebt und arbeitet er heute noch dort. Seit 2007 konzentriert er sich hauptsächlich aufs Schreiben.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2021 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Roy Bishop/Arcangel.com
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Lothar Strüh
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-812-2
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Für meine Mutter, Waltraud »Wallu« Reda
You don’t have to be black to have soul.
Aretha Franklin
1
Und das mir! Ausgerechnet mir! Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so tief sinken würde. Die Anzeichen waren da. Ich hatte sie alle ignoriert. Es gibt halt Wahrheiten, die will man nicht hören und nicht sehen, man verdrängt sie, verbuddelt sie tief unten in der eigenen Wahrnehmung, so lange, bis dann irgendwann ein Impuls von außen die Erde wieder lockert und die ganze verdammte Wahrheit wieder ans Tageslicht kommt. Bei mir war Anna der Impuls. Eines Morgens, ich kam gerade aus der Dusche, sie stand vor dem Spiegel und schminkte sich, als sie mir durch den Spiegel diesen Blick zuwarf und sich nicht verkneifen konnte, mir die Augen zu öffnen:
»Hey, T-Bone, das sind doch inzwischen locker zehn Kilo, die du dir angefuttert hast, seitdem wir zusammenwohnen. Das ist echt nicht sexy!«
Ich war empört. Zunächst. Dann beleidigt. Ich suchte nach einer passenden Antwort, einer Replik, wie es Anna nennen würde, aber ich brauchte zu lange. Wenn Anna so vor mir stand, in Slip und BH auf Zehenspitzen über das Waschbecken gebeugt, den Hals zum Spiegel gestreckt, und mit echt sexy Mundakrobatik ihre Lippen kirschrot anmalte, dann tendierten meine Gedanken immer in dieselbe Richtung. Kurzum, ich war nicht lange beleidigt. Meine Traumfrau bemerkte das sofort, als ich mich nackt von hinten an ihr rieb und sie durch den Spiegel wollüstig angrinste.
»Ich mein es ernst, Tibor!«, erwiderte sie dem Grinsemann im Spiegel. »Ich weiß, du bist jetzt wieder spitz wie Nachbars Lumpi, aber schmink dir das ab. Erstens habe ich keine Zeit. Und zweitens vögeln wir erst wieder, wenn du mindestens fünf Kilo abgespeckt hast.«
Mit dem Runterklappen des Unterkiefers verschwand auch das wollüstige Grinsen aus meinem Gesicht. Wenn sie mich Tibor nannte, dann war es immer ernst. Das Einzige, was mir nach so einer Ansage noch blieb, war Ehrenrettung. Oder anders gesagt, ich nahm das Maul ziemlich voll. »Fünf Kilo, Baby? Kein Thema! Gib mir ein paar Tage. Bin gespannt, ob du es so lange ohne ein Tänzchen mit T-Bone – The Sex Machine – Brown aushältst.«
Sie machte ein recht zuversichtliches Gesicht. Ich winkte ihr im Spiegel mit meinem Gemächt, gab ihr einen Klaps und ging erhobenen Hauptes aus dem Bad. Aber schneller, als mir lieb war, wurde mir eine Sache immer klarer: Jetzt hatte ich den Salat!
Zu der Zeit, es war gerade Sommer in Ruhrstadt, hatte meine Detektei so was wie eine kleine Flaute. So war das im Sommer immer. Die Hälfte der Bewohner war im Urlaub, die anderen zwei Komma fünf Millionen schoben eine ruhige Kugel. Ich war einer von den Letzteren. Anna musste knechten, deshalb konnten wir nicht mit dem Treck gen Süden aufbrechen. Mir war es egal, ich fand, der Sommer in Ruhrstadt hatte auch was. Wegen der beruflichen Flaute brauchte ich mir keine Sorgen zu machen. Der Winter und der Frühling hatten mein Firmenkonto prall gefüllt. Finanziell war alles im grünen Bereich. Privat lief auch alles bestens. Seit einem halben Jahr lebte ich nun endlich mit meiner superheißen Traumsahneschnitte zusammen. Anna war mein Ein und Alles. Weniger Arbeit bedeutete mehr Zeit mit ihr. Und leider aber auch genug Zeit, um an den Speckröllchen zu arbeiten.
Mein Arbeitstag sah so aus, dass ich hauptsächlich ungeduldig darauf wartete, dass Anna Feierabend hatte, und wir den Abend, so wie jeden Abend, gemeinsam verbringen konnten. Es gab also keine Ausreden, um nicht schon vormittags in mein altes Dojo oben im fünften Bezirk zu fahren und mich in Form zu bringen. Wenn mein alter Trainer mich unter seine Fittiche nehmen würde, wären fünf Kilo schnell runter.
Bad Bastard, so sein Kampfname, war der härteste Schweinehund im ganzen Wrestlingzirkus. Er war deutlich über zwei Meter, mit ’nem Kreuz wie ein Raubritter und einem Gesicht, das nur eine Mutter lieben konnte. In seiner Glanzzeit hatte er es bis nach Amerika geschafft und in der WWF gekämpft. Seinen richtigen Namen wussten nur seine Eltern, die dem Vernehmen nach beide noch größere Bastarde waren als Bad Bastard selbst. Inzwischen war er über fünfzig und leitete seit fast zwanzig Jahren das WAD, das einzige Wrestler-Gym in Ruhrstadt. Damals, Anfang der nuller Jahre, als ich für kurze Zeit Profiwrestler gewesen war, hatte ich bei ihm gelernt. Bad Bastard hatte mir beigebracht, wie man durch bloße Präsenz sein Gegenüber in Angst und Schrecken versetzen konnte, und mich ganz nebenbei zu einem recht passablen Wrestler geformt. Unter seinen Schülern hatte Bad Bastard einen Spitznamen, weil »Bad Bastard« seinen Trainingsstil nicht mal annähernd beschrieb. Wir nannten ihn Kotztüte. Natürlich nur heimlich, aber ich denke, er wusste es. Wir haben im Training alle so oft wegen totaler Überanstrengung gekotzt, dass der Name sich förmlich aufgedrängt hatte.
Morgens hatte ich Anna zum Abschied noch siegesgewiss in ihren prallen Po gekniffen. Ich wusste zwar, dass harte Zeiten auf mich zukamen, Zeiten mit viel Grünfutter und schweißgebadeten Ringertrikots, aber genauso war ich auch davon überzeugt, dass Anna es niemals länger als bis zum Wochenende aushielt, ohne von mir zu naschen, und ich ihr außerdem beweisen würde, dass Tibor Zibulla bereit war, alles zu tun, was nötig war, um seiner Liebsten zu gefallen. Verdammt, wenn das nicht wahre Liebe war.
Bei strahlend blauem Himmel nahm ich den Emscherschnellweg Richtung Osten. Im fünften Bezirk angekommen, fuhr ich noch einen kleinen Schlenker über Königsborn, meine alte Heimat. Ich nutzte immer die Gelegenheit für einen kleinen Nostalgietrip, wenn ich schon mal in der Ecke war. Mit James Brown im Player und Nostalgie im Herzen sah ich mir im Vorbeifahren die windschiefen Häuser an, stoppte kurz an meiner alten Hauptschule, dachte schmunzelnd daran, wie ich früher über den Schulhof stolziert war und jeder, der mich blöd ansah, sofort eins in die Fresse gekriegt hatte. Dann fuhr ich weiter zum Lippeufer, wo sich immer noch das Volk bei schönem Wetter vergnügte, dachte noch kurz an Claudia, als ich am Königsborner Campingplatz vorbeikam, wo sie mich entjungfert hatte, und fuhr dann am Bahnhof Monopol vorbei direkt zum Wrestling-Ausbildungs-Dojo. Wenn Kotztüte sich freute, mich zu sehen, dann gelang es ihm gut, das zu verbergen.
Seine ersten Worte an mich waren: »T-Bone – The Sex Machine – Brown! Lange nicht gesehen. Fett und rund bisse geworden. Aber stolzierst immer noch rum wie Graf Rotz. Ab inne Umkleide mit dir, raus aussem Zwirn und rein innet Trikot. Ich bring dich schon wieder auf Vordermann.«
»Ich freu mich auch, dich zu sehen, Bad Bastard.«
Zehn Minuten später machte ich nackt abwechselnd Sit-ups und Liegestütze bei über achtzig Grad in der Sauna. Das war das übliche Aufwärmprogramm. Wie viele Übungen man jeweils machen musste, wurde ausgeknobelt. Ein Würfelbecher, drei Würfel. Nach dem etwa einstündigen Anschwitzen ging es in kurzen Hosen zum Hanteltraining. Danach in den Ring, um zu bouncen.
Bouncen, das war das Schlimmste. Mit aller Wucht rein in die Seile, den Schwung nutzen, nur um in der Ringmitte von Bad Bastards Schwinger gegen den Brustkorb niedergestreckt zu werden. Es war wichtig, dass man beim Sturz auf den Schultern landete. Die Beine in der Luft und den Nacken gespannt, damit man nicht mit dem Schädel auf den Boden knallte. Waren nicht die Schultern zuerst am Boden, hieß das zehn Strafbouncer. Natürlich durfte man keine Sekunde liegen bleiben. Wagte man es, auch nur einen Atemzug auszuruhen, warf sich Bad Bastard sofort mit ’nem Bodyslam auf einen. Und man wollte keinen Bodyslam von Bad Bastard verpasst bekommen. Der Drecksack hatte den übelsten Slam drauf, den die Welt je gesehen hat. Man brachte also seinen Wanst besser schnell wieder auf die Beine, auch nachdem man zum x-ten Mal gebounct wurde und einem langsam die Ohren dröhnten.
Danach, um ein bisschen zu regenerieren, war profanes Abhärten angesagt. Dabei stand man nur rum und ließ sich verprügeln. Kotztüte hatte noch ordentlich Wumms für sein Alter. Immer wieder schlug er mir mit dem Handrücken auf den nackten, verschwitzten Oberkörper, bis meine Brust so rot war wie der Arsch eines Pavians. Dabei kamen wir ins Plaudern.
»Wat treibse denn so?«, fragte er zwischen zwei Hieben.
»Bin Privatdetektiv«, antwortete ich zwischen den nächsten beiden.
Bad Bastard war echt hässlich. Aknenarben, schlechte Zähne, seine Augen dunkel wie die Nacht. Körperpflege gehörte auch nicht gerade zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Wenn er noch einen Tacken ungepflegter gewesen wäre, dann hätte man ihn für einen Obdachlosen halten können. Sein Leben war Wrestling. Auf alles andere schiss er. Zumindest dachte ich das immer. Nach einer Reihe besonders heftiger Hiebe auf meine Speckröllchen hörte er plötzlich auf, mich zu schlagen, und brummte: »Komm ma in mein Büro.«
Sein Büro musste man gesehen haben. Ich triefte vor Schweiß, meine Muskeln zitterten, und mein nackter Oberkörper glänzte wie eine mürbe geklopfte Schweineschwarte. Und dennoch war ich nicht das Ekligste in diesem Raum. Was Bad Bastard sein Büro nannte, war eine schäbige Rumpelkammer mit der exquisiten Duftnote: kerniger Männerschweiß, gepaart mit vermoderndem Mobiliar. Ich war nicht beleidigt, weil er mir keinen Platz anbot. Ich war sogar froh darüber, dass ich mich nicht, nur in Ringerhose, auf diese Schmottercouch setzen musste.
Er kam gleich zur Sache: »Ich kenn da einen, der hat ein Problem. Der is schwul.«
Ich hatte keine Ahnung, was ich dazu sagen sollte, deshalb zuckte ich nur fragend mit den Schultern.
»Er wird erpresst.«
»Womit?«
»Na, mit dem Schwulsein. Er ist, na, sagen wir, kein Unbekannter.«
»Verstehe! Was haben die Erpresser gegen ihn in der Hand?«
»Ein Video.«
»Was ihn dabei zeigt, wie er einem anderen Kerl die Eier krault.«
Bad Bastard nickte nur. Seine schwarzen Augen funkelten wütend, als er sagte: »Dat Video darf auf keinen Fall an die Öffentlichkeit. Auf gar keinen Fall!«
»Warum schnappst du dir nicht ein paar von den Jungs hier und erledigst die ganze Sache auf deine Weise?«
»Wenn et so einfach wär.«
»Weiß die Polizei Bescheid?«
»Ey, hörst du mir nich zu? Keine Öffentlichkeit!«
»Na schön! Wie viel Kohle wollen die Erpresser?«
Bad Bastard setzte seine schiefste Grimasse auf, die er im Repertoire hatte. Es war sein Verarsch-mich-besser-nicht-Gesicht. Er zeigte mir seine gelben Zähne, und seine schwarzen Augen wurden zu Schlitzen.
»Wenn du plauderst«, zischte er, »dann mach ich dich platt. Es geht nicht um Geld. Die wollen einen Gefallen.«
Bad Bastard haderte noch damit, mir mehr über den Schwulen zu erzählen. Offensichtlich war es ihm sehr wichtig, seinen Bekannten zu schützen.
Deshalb beruhigte ich ihn: »Hör zu, Bad. Du kennst mich. Ich bin keine Plaudertasche. Und nur deshalb stehen wir hier, weil du weißt, dass man mir vertrauen kann. Wenn ich dir helfen soll, muss ich wissen, was die Erpresser wollen und wer erpresst wird.«
Er wusste selbst, dass seine Drohung, mich plattzumachen, unnötig war. Trotzdem behielt er seinen finsteren Gesichtsausdruck noch ein Weilchen bei. Ich schwitzte immer noch wie ein Ackergaul, aber meine Muskeln hatten aufgehört zu zucken, und mein Oberkörper nahm langsam wieder seine natürliche Hautfarbe an. Ohne Zweifel war Bad Bastard ein Meister seines Fachs. Beim Ringen und beim Einschüchtern war er eine Klasse für sich. Seine Physis, kombiniert mit seiner noch zusätzlich verzerrten Hässlichkeit, beeindruckte. Auch mich. Als er damit fertig war, mich durch bloße Präsenz vor jedem erdenklichen Fehler zu warnen, spuckte er den Namen aus. »Finn Berger.«
»Der Fußballer?«
»Yep!«
2
Fußball war in Ruhrstadt das, was Schwarzgeld für Luxemburg oder das Beten für den Vatikan war. Eine Religion, ein Mammon. Als geborener Ruhrstädter musste man sich schon früh entscheiden, zu welchem Club man den Rest seines Lebens hielt. Das war eine Frage, die den Unterschied zwischen Akzeptanz im Umfeld und permanentem Nasenbluten ausmachen konnte. Es gab vier große Vereine in Ruhrstadt, die in der ersten Liga mitspielten. Dazu noch sieben weitere, die irgendwann mal was gewonnen hatten, inzwischen aber in untere Ligen abgerutscht waren. Alle hatten sie Tradition ohne Ende und Fans, die sich für ihre Mannschaft bereitwillig die Köppe einprügelten. Wenn Derby war, was gefühlt alle drei Wochen vorkam, war der Bezirk, in dem es stattfand, ein Hochrisikogebiet. Die Bullen stapelten sich dann da und fuhren großes Geschütz auf. Ein Heidenspaß, wenn man jung war.
Die einzige Ruhrstädter Mannschaft, die aktuell um die Deutsche Meisterschaft mitspielte, waren die 97er aus Mechtenberg. Sie hatten einen mit Topspielern gespickten Kader, scheffelten in jeder Saison Millionen in der Champions League, was sie zum unangefochtenen Krösus unter den Clubs hier machte, und galten ganz allgemein als arroganter Kackhaufen. Zugegeben, sie hatten viele Fans, das größte Stadion und internationales Renommee, aber auch keine andere Mannschaft in Ruhrstadt wurde inniger gehasst als die 97er. Ein Spiel gegen die war immer zuallererst ein Klassenkampf.
Aus eigener Erfahrung wusste ich nur zu gut, wie geil es war, die zu hassen. Ich war noch keine fünfzehn, da hatte ich schon über hundert Schals von denen erbeutet, und deren Träger waren allesamt nicht gut dabei weggekommen. Als eingeborener Königsborner war ich natürlich Fan des Königsborner SV. Ein Team, das seit den Achtzigern in der dritten Liga kickte und kaum eine Chance hatte, jemals da unten wieder rauszukommen. Ja, okay, es war Neid, klar, aber ich hatte es als meine Pflicht angesehen, den reichen, erfolgsverwöhnten Schnöseln von Mechtenberg 97 in den Arsch zu treten, wann immer mir einer von denen über den Weg lief. Aber das war lange her. Inzwischen war ich erwachsen geworden, und der Neid war verflogen. Hin und wieder sah ich mir sogar ein Spiel von denen im Fernsehen an, wenn nix anderes lief. Der Star der 97er hieß übrigens Finn Berger. Jungnationalspieler. Angeblich fünfzig Millionen Wert. Der Bengel war gerade erst zwanzig geworden.
Nachdem Bad Bastard mich noch zwei Stunden durch sein Dojo gejagt hatte, robbte ich auf dem Zahnfleisch aus der Umkleide und verfluchte im Auto ausgiebig die Porreestangen, die ich mir zur Stärkung auf dem Weg zum Hotel Sheraton einverleibte. Bad hatte dort einen Termin mit Finn Bergers Berater, der gerade in der Stadt war, für mich klargemacht. Er wollte mich sofort kennenlernen und sehen, ob man mir vertrauen konnte. Das Hotel lag eh auf dem Weg zu meinem Büro, und ich hatte Bad Bastard versprochen, mich der Sache anzunehmen, obwohl ich nicht gerade vor Lust auf Arbeit überschäumte. Wie denn auch, wenn man nur an verschissenen Porreestangen lutschte, nachdem Kotztüte einen fertiggemacht hatte.
Konrad Krude war nervös. Wir saßen an der Hotelbar, er trank einen Fruchtsmoothie, ich ein stilles Wasser. Auf den ersten Blick hätte man nicht sagen können, wer von uns beiden besser angezogen war. Sein Boss-Anzug war nicht so viel schlechter als mein maßgeschneiderter Cerruti. Aber es fehlte ihm an Überzeugung, die man braucht, um einen richtig guten Anzug auszufüllen. Jede halbe Minute sah er sich um und scannte die Umgebung mit hektischem Blick. Krude wollte, dass ich ihm was von mir erzähle. Er wollte wissen, mit wem er es zu tun hatte. Ich rasselte höflich meine Standardreferenzen runter, während ich mich fragte, warum er sich jede halbe Minute umblickte.
Schließlich fragte ich ihn einfach: »Erwarten Sie noch jemanden?«
»Was? Nein! Es ist nur, die Presse weiß, dass ich in der Stadt bin. Die wollen genau wissen, mit wem ich mich treffe. Könnte ja der Sportdirektor von irgendeinem Verein sein, mit dem ich über Finns sportliche Zukunft spreche.«
»Die verfolgen Sie?«
»Rund um die Uhr. Die Transferperiode läuft noch bis Ende August. Danach verschwinden diese Schmeißfliegen wieder. Bis zur Winterpause, dann geht’s von vorne los.«
»Hört sich lästig an.«
Krude zog eine Schnute und nickte mit hochgezogenen Augenbrauen. Dann sah er sich wieder um, nippte an seinem Smoothie und schlug einen verschwörerischen Ton an. »Sie wissen, worum es geht?«, fragte er flüsternd.
»Ich bin im Bilde«, antwortete ich in normaler Stimmlage.
Er wollte weiterflüstern, aber ich unterbrach ihn mit einer Handbewegung und dem dazu passenden Kopfschütteln. Was die Geheimhaltung der Erpressung anging, so war eine Hotelbar an sich schon kein guter Ort, um über Details zu reden. Noch dazu mit einer Pressemeute am Hacken, die womöglich mit Richtmikrofonen und sonstigem Spielzeug auf der Lauer lagen, war es Harakiri. Krude sah mich fragend an, mit nur einem Finger erklärte ich es ihm: Hier? Nein!
Dann redete ich laut genug für alle Mikrofone, die vielleicht oder vielleicht auch nicht auf uns gerichtet waren: »Die Sicherheitslage für Prominente wird hierzulande immer unüberschaubarer. Und ich rede hier nicht von aufdringlichen Paparazzi oder von Fans, die keine Hemmungen kennen. Wir leben in einem Land, in dem Neid großgeschrieben wird. Das ist traurig, ist aber so! Es ist nur klug, sich um die Sicherheit eines Stars Gedanken zu machen. Ich kann Ihnen nur dringend empfehlen, einen persönlichen Sicherheitscheck für Ihren Schützling durchzuführen. Gefahren lauern oft dort, wo man sie am wenigsten erwartet. Ich hab da meine Erfahrungen. Prävention ist das Zauberwort.«
Krude nickte. Er hatte kapiert, worauf ich hinauswollte. Ein professioneller Check war ein guter Deckmantel für das, was eigentlich anstand.
Er spielte mit. »Und Sie können garantieren, dass Sie Risiken, soweit welche existieren, aufspüren und eliminieren?«
Jetzt war ich es, der nickte. Auch wenn er versuchte, seinen ersten Eindruck von mir als Detektiv zu überspielen, sah ich ihm dennoch an, dass er jetzt schon nur noch wenig Zweifel daran hatte, dass ich der Richtige für den Job war. Ich gab ihm meine Visitenkarte und sagte laut und deutlich zu ihm: »Wenn Sie, Herr Krude, Interesse haben, einen persönlichen Sicherheitscheck bei mir in Auftrag zu geben, dann kommen Sie bitte morgen Vormittag in mein Büro. Da können wir dann über Details sprechen.«
Ich trank mein Wasser aus, gab ihm artig die Hand und korrigierte den Sitz meiner Krawatte im Spiegelbild hinter der Bar. Noch sah ich nicht schlanker aus. Dafür aber machte sich langsam der erste Muskelkater bemerkbar. Er zog langsam von den Schulterblättern runter in die Fersen. Das war aber noch nichts, verglichen mit den Fragen, die mein Verdauungstrakt mir knurrend stellte. Er konnte nicht glauben, dass nach der Energieleistung am Morgen nix als Porreestangen nachgeladen worden waren. Aber ich war guter Dinge. Was mich betraf, ich hatte keinen Zweifel, dass Konrad Krude am nächsten Tag in meinem Büro aufkreuzen würde.
3
Ich hatte mir kürzlich was gegönnt. Bei eBay hatte ein Typ eine lebensgroße James-Brown-Skulptur versteigert. Es ist die Nachstellung seines legendären Auftritts im Apollo Theater vom März 68. Der Gottvater in schwarzer Hose, schwarzem Hemd, heller Weste, spitzen Lackschuhen, rubinrotem Umhang und mit ’ner brettharten Föhnwelle. Dafür habe ich keine dreihundert Euro gelatzt. Echt ein Schnäppchen. Nur hatte ich die Rechnung ohne Anna gemacht. Sie wollte den Gottvater des Soul nicht in der Wohnung rumstehen haben. Er mache ihr Angst, meinte sie, mit seinen kalten Augen und seinem verzerrten Gesicht. Dabei war sein Gesicht nur verzerrt, weil er mit Inbrunst ins Mikrofon sang, was übrigens auch mit zum Lieferumfang gehörte und keinen Cent extra gekostet hatte. Ich hatte versucht, sie zu überreden. Die Vorstellung, James Brown an meinem Bett stehen zu haben, fand ich einfach genial. Er wäre das Zweite und das Vorletzte, was ich jeden Tag zu sehen bekäme. Schließlich lief es aber darauf hinaus, dass ich wählen durfte. Entweder einen kleinen schwarzen Mann neben dem Bett oder meine weiche, kuschelige Anna darin. Beides ging nicht. James landete also in meiner Detektei in der Faktorei 21, wo er mir nun jeden Morgen beim obligatorischen Fensterblick über den Innenhafen Gesellschaft leistete.
Es war Mittwoch, der 17. Juli, kurz vor elf. Ich wartete auf Konrad Krude, der sich telefonisch angemeldet hatte und jeden Moment auf der Matte stehen musste. Meine körperliche Verfassung könnte man allgemein mit »den Umständen entsprechend« bezeichnen. Muskelkater vom Scheitel bis zur Sohle, Heißhunger auf alles, was nicht pflanzlich war, und ernsthafte Gedanken an eine Fettabsaugung. Gestern Abend hatte ich nur ’ne halbe Portion Couscous gehabt, heute Morgen einen Apfel und ein paar Streifen rohen Kohlrabi zum Frühstück. Dazu Kaffee ohne Zucker. War das etwa die Ernährung eines Mannes? Sicher nicht. Die Abkürzung namens Fettabsaugung kam mir schon sehr verlockend vor. Aber der erste Höllentag auf Diät hatte mir auch eins Komma fünf Kilo gebracht. Bei dem Schnitt hätte ich auch ohne Absaugung spätestens am Wochenende wieder Sex. Letzte Nacht hatte mir Anna übrigens noch mal deutlich gemacht, wie ernst es ihr war. Selbst meine patentierte James-Brown-Soul-Schmuseshow war nur ein peinlicher Rohrkrepierer gewesen. Sie bestand auf die fünf Kilo, und ich hoffte inständig, dass ich bei dem lausigen Futter bis Samstag nicht aus den Latschen kippte.
Konrad Krude hatte sich für elf angekündigt, und er kam pünktlich wie die Maurer. Sein Outfit war tadellos, das kurze graue Haar modisch gegelt. Er war um die fünfzig, groß, etwas hängende Schultern, was sein Schneider nicht wirklich kaschieren konnte. Glatt rasiert und dezent nach Acqua di Giò duftend, besah er sich mein Büro. Krude lächelte, als er die Skulptur von James Brown erkannte. Dann nahm er auf meinem Chesterfield-Sofa Platz.
»Den find ich auch gut«, gestand er. »Leider schon tot, oder?«
»Leider ja. Am fünfundzwanzigsten Dezember null sechs. Ein trauriges Weihnachten.«
Konrad Krude checkte mich ab. Mein schickes Büro in exponierter Lage schien ihm bereits ausreichend Gewissheit gegeben zu haben, dass ich bei solchen fixen Kosten keine Bratwurst in meinem Job sein konnte. Jetzt sammelte er Informationen, getarnt als Small Talk. Er war halt ein Geschäftsmann, und ein guter Geschäftsmann erkannte krumme Eier schnell, wenn er nur genug Fakten hatte.
»Hat Ihre Frau James Brown hierher verbannt?«, fragte er mich.
»Gewissermaßen«, antwortete ich.
»Wäre doch ein nettes Spielzeug für die Kinder.«
»Hören Sie, Herr Krude. Sie sind ein beschäftigter Mann. Ich bin ein beschäftigter Mann. Reden wir doch einfach Klartext. Ich bin sechsunddreißig Jahre alt, lebe mit meiner Freundin kinderlos zusammen, bin seit neun Jahren im Detektivgeschäft, und alles, was Sie über meinen Charakter erfahren können, kann Ihnen Bad Bastard detailliert erzählen. Woher kennen Sie ihn eigentlich?«
»Ich kenne ihn gar nicht. Nur seinen Namen schon ziemlich lange. Aber ich kenne jemanden, der ihm sehr vertraut.«
»Finn Berger.«
Krude schwieg. Noch immer war er nicht restlos überzeugt, dass er in meinem Büro frei reden konnte. Ich musste ihm noch ein wenig auf die Sprünge helfen.
»Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen! Nichts von dem, was hier besprochen wird, gelangt jemals nach außen. Zumindest nicht durch mich. Ich verarsche meine Klienten nicht! Und außerdem weiß ich doch schon längst, wo das Problem liegt. Lassen Sie sich helfen.«
Ich machte ihm einen Cappuccino und mir selbst einen doppelten Espresso ohne Zucker, während er mir die ganze Geschichte erzählte. Finn Berger hatte schon gewusst, dass er schwul war, da konnte er sich seine Fußballschuhe noch nicht selber binden. Als Kind spielte er lieber mit Puppen anstatt mit Matchbox-Autos, und in der Pubertät musste seine Mutter ihr Make-up vor ihm verstecken. Mit vierzehn verliebte er sich zum ersten Mal in einen Jungen. Da spielte er bereits für die U16-Nationalmannschaft. Es war einer aus seiner Schule, ein Jahr älter als Finn. Mit ihm hatte er zum ersten Mal Sex. Ihre Beziehung hielten sie geheim, hauptsächlich, weil Finn sich nicht outen wollte.
Die Teenagerliebe endete nach zwei Jahren, als Finn seinen ersten Profivertrag unterschrieb. Auf Anraten von Konrad Krude hatte Finn seine Jugendliebe für die Karriere eiskalt abserviert. Der Name des verschmähten Liebhabers lautete Tom Radler. Er soll es damals mit Fassung getragen haben. Keine Szenen, keine Drohungen, nur ein paar Tränchen zum Abschied. Fast vier Jahre hatte Finn Berger nichts mehr von Tom gehört. Bis vor vier Tagen. Da fand er eine CD-ROM in seiner Post, darauf ein Videofile, auf dem er mit seinem Ex die Schwerter kreuzt. Es war die alte Leier. Sie waren jung und doof und verliebt bis über beide Ohren, also hatten sie sich dabei gefilmt, wie sie sich gegenseitig die Rosetten polierten. Das Filmchen musste laut Krude eine ausgesprochen hohe technische Qualität haben. Auch wenn Finn Berger da gerade erst sechzehn Jahre alt gewesen war, gab es wohl keinen Zweifel, dass es sich bei einem der Rammler im Video um den Fußballstar handelte. Interessant war die Forderung der Erpresser. Sie wollten kein Geld von ihm. Sie wollten, dass er Spiele verschob. Der Kern der Sache lag im Wettbetrug.
Nachdem mir Konrad Krude die ganze Geschichte erzählt hatte, schien er ein wenig erleichtert zu sein, obwohl seine Paranoia immer noch akut war. »Das darf niemals an die Öffentlichkeit!«, warnte er eindringlich. »Das wäre das Ende seiner Karriere.«
»Geht es um ein bestimmtes Spiel?«, fragte ich ihn.
»Das haben die Erpresser noch nicht spezifiziert. Im Moment steckt Finn mitten in der Saisonvorbereitung. Ich glaube, dass es um eines der Testspiele gehen wird, die am Wochenende anfangen.«
»Testspiele? Wäre es nicht sinnvoller, den Bundesligastart abzuwarten?«
»Nein. Die Spiele werden viel zu gut kontrolliert. Wenn da ungewöhnlich hohe Summen gesetzt werden, wird sofort nachgeforscht. Die kleinen Spiele sind für Wettbetrüger viel interessanter. Zumal die Beteiligten dabei meist nicht viel Geld verdienen und deshalb leichter zu bestechen sind.«
»Aber Finn wird nicht dafür sorgen können, dass zum Beispiel die 97er gegen eine Kreisauswahl verlieren.«
»Natürlich nicht, aber wenn irgendjemand in Singapur, sagen wir, zehntausend Euro darauf wettet, dass Finn im Spiel gegen einen Kreisligisten kein Tor schießt, lohnt sich das. Und ganz sicher geht es auch nicht nur um ein Spiel. Wenn wir uns einmal darauf einlassen, wird es hundertprozentig immer so weitergehen.«
»Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Finn könnte sich outen.«
»Ein schwuler Fußballprofi? Das Dogma, dass es keine schwulen Fußballer gibt, kommt nicht von ungefähr. Haben Sie eine Ahnung, was für ein Spießrutenlauf derjenige durchleben würde? Besonders Auswärtsspiele wären die Hölle. Und dann sind da noch die Schwulengemeinden. Sie würden ihn als Helden feiern und ihn vor ihren Karren spannen wollen. Die Medien würden ihn nur noch auf sein Schwulsein reduzieren. Finn Berger steht kurz vor seinem internationalen Durchbruch, er muss sich auf seinen Sport konzentrieren. Alles, was ihn davon ablenkt, gilt es zu vermeiden.«
»Verstehe. Was haben Sie unternommen, seitdem Sie von dem Video wissen?«
»Optionen sondiert und versucht, Tom Radler ausfindig zu machen. Bisher leider erfolglos. Der Kerl ist wie vom Erdboden verschluckt.«
»Welche Optionen sind übrig geblieben?«
»Nur Sie!«
Ich nickte Konrad Krude zu, als wäre es mein tägliches Brot, der letzte Ausweg zu sein. Es war klar, dass ich den Fall übernehmen würde. Was für ein mieser Geschäftsmann wäre ich denn gewesen, wenn ich so einen Auftrag abgelehnt hätte. Der notgeile Gockel in mir meinte zwar, ich sollte es besser sein lassen, weiter trainieren gehen und die lauen Sommerabende mit Anna verbringen, anstatt einem Schwulenporno hinterherzujagen. Aber Krude hatte mir schon gestanden, dass ich seine letzte Hoffnung war, noch bevor er meine Preise kannte. Für professionelle Hilfe bei der Lösung seines Problems war er bereit, tief in die Tasche zu greifen. Und Krudes Taschen waren sicher tief genug, um mich für die entgangenen Wonnen zu entschädigen.
Aus der Schublade holte ich einen Standardvertrag für Personenschutzdienstleistungen. Mit dem Gesicht eines Geschäftsmannes, der mit allen Wassern gewaschen war, legte ich das Ding vor ihm auf den Tisch. »Der Personenschutz ist wie gesagt nur Tarnung«, erinnerte ich ihn. »Unterschreiben sie, und ich mache mich sofort an die Arbeit.«
Der Fußballmanager Konrad Krude las sich den Vertrag gründlich durch. Dann unterschrieb er ihn, ohne mit der Wimper zu zucken. Damit war meine Sommerflaute Geschichte. Aber nicht nur das, Krude hatte noch ’ne kleine Überraschung auf Lager.
»Damit Sie sehen, wie ernst die Lage für uns ist«, sagte er und sah mir dabei direkt in die Augen, »lege ich noch einen Bonus von zehntausend Euro obendrauf, wenn Sie es schaffen, das Problem bis Samstag aus dem Weg zu räumen. Und meinetwegen muss die Extrazahlung nicht extra belegt werden. Sie verstehen?«
Oh ja, das hatte ich verstanden. Zehn Mille schwarz auf die Kralle. Ich fühlte mich auch gleich motivierter, also verlor ich keine Zeit. »Wo hält sich Finn im Moment auf?«
»In Österreich im Trainingslager.«
»Was haben Sie bisher über Tom Radler in Erfahrung gebracht?«
Krude reichte mir einen Zettel mit mehreren Adressen und Telefonnummern. Dazu ein aktuelles Foto von Radler. »Das Foto ist aus Facebook und die oberste Nummer auf der Liste ist seine«, erklärte er mir. »Sein Handy ist seit Tagen ausgeschaltet. Die anderen Nummern sind seine Eltern, der zwei Jahre ältere Bruder Björn und noch ein Bruder namens Michael, der ist schon über dreißig. Dann noch ein paar Leute, mit denen er, soweit Finn sich erinnern kann, befreundet war. Ich habe sie alle abtelefoniert. Seine Familie hat ihn nach seinem Coming-out verbannt. Sie schämen sich für ihn. Und alle anderen sagen, sie hätten seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt. Ob Letzteres stimmt, kann ich nicht sagen, aber seine Eltern und seine Brüder habe ich persönlich aufgesucht; das sind vielleicht alles homophobe Arschlöcher. Sein Vater hat mich nur gefragt, ob die verdammte Schwuchtel immer noch nicht an Aids krepiert ist, und einer seiner Brüder, Björn Radler, schwor, die Tunte totzuschlagen, sollte er ihm noch mal begegnen. Nett, oder?«
»Was ist mit seiner Mutter? Mütter sind meistens verständnisvoller.«
»Keine Chance, mit ihr zu reden. Der Alte schirmt sie ab.«
»Was ist mit seiner Wohnung? Sie waren doch sicher schon dort?«
»Persönlich nicht. Wegen der Presse. Ich will da keine schlafenden Hunde wecken. Im Nachhinein finde ich, es war schon zu riskant, Radlers Eltern zu besuchen. Aber er kriegt in meinem Auftrag jeden Tag fünfmal Fast Food geliefert. Von dem bisher keines angenommen wurde. Er ist nie da. Er hat auch kein Festnetz. Und wir haben noch drei Tage bis zum ersten Testspiel.«
»Das mit dem Fast Food war keine schlechte Idee. Das können Sie jetzt wieder sein lassen. Glaubt Finn, dass Tom ihn erpresst?«
»Er kann es sich nicht vorstellen. Wissen Sie, was? Er macht sich Sorgen um ihn. Finn glaubt, dass Tom irgendwie an die falschen Typen geraten ist. Er beschreibt ihn als naiv, als einen Träumer, der niemandem etwas Böses will.«
»Aber er hat ihn seit vier Jahren weder gesehen noch gesprochen.«
Krudes Gesichtsausdruck reichte aus, um meinen Einwand zu bestätigen. Tom Radler in drei Tagen zu finden war durchaus im Bereich des Möglichen. Auf Krudes Liste gab es ausreichend Ansprechpartner für mich, die mir gegenüber mit Sicherheit aufgeschlossener sein würden. Auch wenn sich dann herausstellen sollte, dass Tom Radler doch nicht der Erpresser war, würde seine gründliche Befragung meine Nachforschungen ganz sicher ordentlich vorantreiben. Je schneller ich ihn fand, desto näher kam ich dem Extrabonus. Die Zeit war knapp, deshalb versuchte ich, welche zu gewinnen.
»Und wenn Finn sich im Training verletzen würde? Oder vom Coach nicht aufgestellt würde? Um den Star zu schonen?«
»Sehen Sie sich das Video an. Da finden Sie die Antwort auf Ihre Frage.«
4
Zum Mittag hatte ich einen kleinen grünen Salat mit Essig und Öl, dazu einen trockenen Vollkorntoast und einen Schwulenporno. Ich aß in meinem Büro. Krude hatte mir die CD-ROM übergeben unter der Bedingung, keine Kopien davon irgendwo zu speichern. Es war dieselbe CD, die Finn Berger letzte Woche in seinem Briefkasten gefunden hatte. Das Kuvert trug einen Poststempel aus Ruhrstadt. Bisher schien das die einzige Kopie im Umlauf zu sein. Ich musste Krude meinen Safe zeigen und ihm das Sicherheitssystem in meiner Detektei vorführen, sonst hätte er sie mir nicht überlassen.
Finn Berger war darauf in Höchstform, Tom Radler eher der passive Part. Im Großen und Ganzen war es stinknormaler Blümchensex in einem Jugendzimmer, den ich da geboten bekam. Viel Knutschen, Lecken, Streicheln. Nach dem Orgasmus kuschelten sie miteinander.
Während des Akts war am unteren Bildrand auf einer Endlosschleife zu lesen: »… Neueste Schlagzeile! Finn Berger beim Arschficken gefilmt … Wenn er nicht tut, was wir wollen, wird das auf YouTube hochgeladen … Ab sofort steuern wir ihn auf dem Platz … wie eine Playstation-Figur … Nicht spielen wegen Verletzung oder angeblichem Formtief wird als Täuschung angesehen und bestraft … weitere Anweisungen folgen …«
Der Film dauerte nur knapp acht Minuten. Am Ende hatte ich den Salat verdrückt und den Gedanken, durch eine vorgetäuschte Verletzung Zeit zu gewinnen, noch nicht vollends aufgegeben. Ich glaubte nicht, dass die Erpresser ihr einziges Druckmittel sofort aufgeben würden, wenn Finn Berger ein Mal nicht spielte. Das Video war für sie nur so lange wertvoll, wie kein anderer davon Wind bekam. Das nahm mir etwas den Druck von den Schultern. Sollte ich es nicht schaffen, bis Samstag den Erpresser aufzuspüren, wäre zwar mein Bonus futsch, nicht aber Finn Bergers Karriere. Trotzdem verlor ich natürlich keine Zeit.
Ich griff zum Telefon und wählte Radlers Nummer. Sein Handy war offline. Dann rief ich Bruce Lee an.
»Was geht, mein Großer?«, meldete er sich.
»Immer derselbe Käse. Kennst das doch. Und bei dir? Alles lotrecht?«
»Wie immer! Was brauchste?«
Ich hatte keine Ahnung, wie er wirklich hieß. Bruce Lee war sein Künstlername. Ich wusste auch nicht, wie er aussah. Ich hatte ihn noch nie gesehen. Er mich schon. Bevor er einverstanden gewesen war, mir gelegentlich bei der Umgehung von Datenschutzrichtlinien im Internet unter die Arme zu greifen, hatte er mich gründlich gecheckt. Dafür musste er nicht mal von seiner Couch aufstehen. Es gab keine Firewall, die vor Bruce Lee sicher war. Computer zu hacken war sein Kung-Fu. Und er war mindestens ebenso grandios darin wie der kleine Chinese im Verkloppen von hüftsteifen Muskelpaketen.
Woher ich ihn kannte? Nun, sagen wir, er ist mir an einem Tag, als mein Karma heller leuchtete als jeder Heiligenschein, zufällig in den Schoß gefallen. Mein Soulbruder Salman hatte dabei auch seine Finger im Spiel gehabt. Noch ehrlicher gesagt: Der Kontakt zu Bruce Lee kam über die russische Mafia zustande. Seine Telefonnummer war ein kleines Dankeschön für einen Gefallen, den ich unseren osteuropäischen Mitbürgern vor zwei Jahren getan hatte. Irgendwas mit einer ermordeten Pornoqueen und einer Horde Naziterrorristen. Man konnte über die Russen denken, was man wollte, aber die wissen, wie man sich bedankt.
Die Anfragen, die Bruce Lee von mir bekam, waren für ihn nur Kinkerlitzchen. Zumindest gab er sich große Mühe, mir den Eindruck zu vermitteln. Aber er freute sich über solche Aufträge. Schnell erledigt und gut abkassiert. Bruce Lee ließ sich sein Kung-Fu verdammt gut bezahlen.
»Ich schick dir gleich einen Namen und eine Mobilnummer. Das Handy zu der Nummer ist im Moment ausgeschaltet, deshalb wird man es nicht orten können. Aber ich brauche das dazugehörige Bewegungsprofil der letzten achtundvierzig Stunden und alle geführten Gespräche im selben Zeitraum. Dazu alle Internetportale, auf denen der Name auftaucht, natürlich samt Username und Passwörtern.«
»Bis wann?«
»Bis gestern.«
»Soll ich ihm ’nen Tracker aufs Handy schicken?«
»Logisch.«
»Gib mir zwei Stunden. Ach, übrigens, Sex-Machine-Brown, ich bin schon wieder teurer geworden.«
»Na klar. Und warum diesmal? Sind die Strompreise gestiegen? Oder die WLAN-Tarife von der Telekom? Nein, jetzt weiß ich’s. Die GEZ-Gebühren machen dir zu schaffen.«
»Telekom? GEZ? Du Scherzkeks! Nein, Mann, alles nur wegen der gestiegenen Nachfrage nach meinem Kung-Fu. Der Markt boomt, mein Freund.«
»Wie viel?«
»Inklusive Tracker fünfhundert Schleifen.«
Der Tracker machte den Braten nicht wirklich fett. Das Ding war nur so was wie ein Melder. Ein Programm, das Bescheid gab, ob und wo das Handy wieder eingeschaltet würde. Bruce hatte einen Hunderter draufgeschlagen auf seinen üblichen Tarif. Das waren immerhin satte fünfundzwanzig Prozent. Aber er war zweifelsohne sein Geld wert.
Ich meckerte mehr aus Spaß, als ich zu ihm sagte: »Du solltest dich was schämen. Der echte Bruce Lee rotiert bestimmt in seinem Grab bei so viel Gier. Aber gut, Bezahlung wie immer?«
»Yep!«
»Mach’s gut, Bruce.«
»Du auch, Sex Machine.«
Ich ging sofort online und überwies fünfhundert Euro auf meinen Pokeraccount bei straight-flush.de. Von dort aus konnte Bruce Lee frei über das Geld verfügen. Ich war kein Spieler. Ich hatte Glück in der Liebe. Meine Mitgliedschaft dort diente nur der Bezahlung.
In zwei Stunden, wenn Bruce mir seine Fünfhundert-Euro-Erkenntnisse aufs Smartphone schickte, wollte ich auch mit Radlers Wohnung durch sein. Danach hätte ich ganz sicher ein ziemlich gutes Bild von meiner Zehntausend-Euro-Beute. Wenn ich ihn erst gefunden hatte, wäre es ein Leichtes, den hübschen, passiven, nur etwa sechzig Kilo wiegenden Tom Radler in die Mangel zu nehmen. Wenn er der Erpresser war, würde ich es aus ihm rausquetschen, wenn nicht, dann eben die Namen aller, die Zugang zu dem Video hatten. Ohne weitere Zeit zu verplempern, machte ich mich auf die Socken zu Radlers Wohnung. Er wohnte in der Nähe der Ruhr-Uni, in Mansfeld. In der Holtestraße 17, ganz hinten im sechsten Bezirk.
5
In der Ferienzeit kam man auf dem Ruhrschnellweg trotz der üblichen Sommerbaustellen gut durch. Hier merkte man am deutlichsten, dass die Hälfte der Bewohner weg war. In nur zwanzig Minuten fuhr ich vom Innenhafen bis nach Mansfeld. Tom Radler wohnte in einem stinknormalen Wohnhaus, mit vier Etagen, grau gekalkt und mit Multikulti-Belegschaft. An den acht Schellen standen Namen wie Woyzeck, Namir, Gönül, dann noch ein Winkler, ein Marquez, zwei unaussprechliche Namen fast ohne Vokale und Radler. Für Ruhrstadt war das ein völlig normaler Mietparteienmix. Wie erwartet, rührte sich nichts, als ich bei Radler schellte. Die beiden ohne Vokale ließ ich mir als letzten Strohhalm, falls sonst keiner die Tür aufmachte. Beim vierten Versuch, bei Marquez, brummte der Türöffner.
Radlers Briefkasten quoll über vor Werbung. Da hatte schon ’ne Weile keiner mehr nach der Post gesehen. Ich riss das Ding auf, sah alles flüchtig durch, fand aber nichts als Wurfsendungen. Am Treppenabsatz im ersten Stock erwartete mich ein kleiner, dicker Latino. Er war keine Zierde für sein Volk, dazu war er mit seiner Wampe zu weit vom Latin Lover entfernt. Seine Laune lag irgendwo zwischen zu Tode gelangweilt und ziemlich angepisst. Wahrscheinlich störte ich seine Langeweile. Das Angepisstsein legte sich aber, als ich die Treppe heraufkam und immer größer und größer wurde. Mit seinen knappen eins sechzig reichte er mir gerade bis zum Brustkorb. Er checkte mich ab, wusste nicht so recht, was er von mir halten sollte, und machte zur Sicherheit einen Schritt zurück in seine Wohnung. Aus seiner Sicht hätte ich alles sein können, vom Versicherungsvertreter bis zum Serienkiller. Ich wollte ihn nicht noch weiter verschrecken, deshalb hielt ich Abstand und fuhr die freundliche Tour.
»Guten Tag, Herr Marquez. Mein Name ist Schumann, Franz Schumann. Ich bin vom Gesundheitsamt. Ihr Nachbar Tom Radler, wann haben Sie den das letzte Mal gesehen?«
Er sah mich überrascht an. Damit hatte er nicht gerechnet. Immerhin war klar, dass er mich verstanden hatte. Sprachlich würden wir also kein Problem haben. Der Latino brauchte noch einen Moment, um mein Aussehen mit meiner Aussage zu verbinden. Es gelang ihm offenbar nicht, deshalb fragte er nach: »Gesundheitsamt?«
»Herr Radler ist auffällig geworden. Wir müssen mit ihm reden.«
»Auffällig geworden? Womit?«
»Glauben Sie mir, das wollen Sie nicht wissen. Und außerdem darf ich es Ihnen nicht sagen. Privatsphäre, Sie verstehen.«
Das verstand er. Ein letzter abschätzender Blick, dann legte er los.
»Ich hab ihn seit Tagen nicht mehr gesehen. Bestimmt schon über ’ne Woche. Oder, besser gesagt, gehört habe ich ihn nicht. Normalerweise kommt er alle zwei, drei Tage nachts nach Hause mit irgendwelchen Fummeltrinen. Die tucken dann durchs Treppenhaus, machen Lärm, reden, kichern, albern rum. Heididei, Sie verstehen? Denen ist egal, wenn hier einer pennen will. Allerdings ist mir aufgefallen, dass er seit dem Wochenende sehr viel Essen geliefert bekommt. Pizza, China, alles Mögliche. Ich hab das Schellen gehört und die Autos draußen stehen sehen.«
»Aber sonst war in der letzten Woche alles ruhig?«
»Yep.«
»Wissen Sie zufällig, wo er sich üblicherweise aufhält?«
»Ich weiß nur, dass die alle mittwochabends in den Club David zum Schwuchtelball gehen. Das habe ich mal mitbekommen. Sonst weiß ich nichts. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ja klar, das war letzte Woche Mittwoch, mitten in der Nacht, da habe ich ihn das letzte Mal gehört.«
»Was war denn da?«
»Es war frühmorgens, so gegen vier. Da war ein Poltern im Treppenhaus. Nicht sehr laut. Also aufgewacht wäre ich davon nicht. Ich war eh wach, weil ich pissen musste. Da habe ich es gehört. Ich dachte, Radlers Fickbekanntschaft verdünnisiert sich. Sie waren gegen ein Uhr zusammen in seine Wohnung gegangen. Da hab ich Radlers tuckiges Gekicher im Treppenhaus gehört.«
»Haben Sie gesehen, mit wem er zusammen war?«
»Nein!«
»Vielleicht eine Stimme gehört?«
»Nein!«
»Woher wissen Sie dann, dass er nicht alleine war?«
»Er hat mit jemandem geredet. Er war ganz aufgedreht und hat Witzchen gemacht. Er hat aber jemanden angesprochen, ganz sicher. Radler ist schwul, nicht geistesgestört.«
»Also, was war das für ein Poltern morgens um vier? Wie hat es sich angehört?«
»Puh, schwer zu sagen. Als wenn ihm etwas runtergefallen wäre, etwas Schweres, aber nicht so ruckartig, eher, als wenn es ihm aus den Händen geglitten wäre. Eigentlich kann man schon sagen, dafür, dass die Schwulette beim Raufgehen so leise war, hat sie beim Abhauen doch relativ viel Rabatz gemacht.«
»Könnte es auch Radler selbst gewesen sein, der morgens um vier durchs Treppenhaus gepoltert ist?«
»Ja, klar.«
»Dieser Club David – wo ist das?«
»Woher soll ich das wissen? Ich geh da mit Sicherheit nicht hin.«
»Okay! Ich muss Sie nun bitten, wieder in Ihre Wohnung zu gehen. Danke für Ihre Mitarbeit, Herr Marquez. Ich werde das lobend in meinem Bericht erwähnen.«
»Warten Sie mal! Was ist hier los? Gesundheitsamt! Was soll das heißen? Sind wir in Gefahr? Hat der Homo irgendwelche Krankheiten hier angeschleppt?«
»Gut möglich. Schon mal was von multiresistenten Analfisteln gehört? Machen Sie lieber die Tür zu und waschen Sie sich die Hände. Das Gesundheitsamt kümmert sich drum.«
Analfisteln gefielen dem Latino nicht. Ich hätte nicht sagen können, ob er Spanier oder Südamerikaner war. Auf jeden Fall war er aber Macho genug, um nix mit Analfisteln am Hut haben zu wollen. Er schloss angewidert die Tür. Wahrscheinlich fing er nach dem Händewaschen sofort an, seinen Umzug zu planen.
Ich stieg weiter die Treppe hinauf, bis unters Dach. Die linke Wohnung war Radlers. Seine Wohnungstür machte mir keine größeren Schwierigkeiten. Dass es immer noch Leute gab, die ihr Heim nur mit einem ABUS-EC550-Nullachtfünfzehn-Schloss sicherten, löste bei mir unweigerlich Kopfschütteln aus. Genauso gut könnten sie die Tür offen lassen und ein Schild hinstellen mit der Aufschrift: »Bitte draußen bleiben!« Zusätzlich zum Kopfschütteln zuckte ich noch mit den Schultern. Es war ja nicht so, dass ich mich darüber beschwerte, mir so leicht Zutritt verschaffen zu können.
Nie zuvor in meinem Leben war ich in einer schwuleren Wohnung gewesen als in der von Tom Radler. Die Bude hatte alles in allem vielleicht fünfzig Quadratmeter, wobei die Dachschrägen noch viel Platz wegnahmen. Schon in der Diele hingen zwei Poster von nackten Männern an der Wand. Nur die Körper, keine Gesichter und mit Mördergehänge. Die Küche war ausgestattet mit Bistrotischchen und zwei Bistrostühlchen, auf deren rote Sitzpolster kleine weiße Pimmel gedruckt waren. Dazu, allen Ernstes, ’ne Einbauküche in Zartrosa. Die Schrägen im Wohnzimmer waren pink gestrichen, weißer Teppich, dazu eine Fototapete hinterm dunklen Sofa, auf der ein lang gezogener Strand bei Sonnenuntergang zu sehen war. Fernseher, Blu-ray-Player, Stereoanlage, alles im Regal gegenüber der Couch verstaut. Dazu noch ein paar Bücher, Filme und CDs.
In der ganzen Wohnung stand Nippes aus Porzellan rum. Schalen, Tassen, Teller, Kerzenständer, all so ’n Zeug. Dazu jede Menge kleiner Figürchen mit dicken Eiern in lüsterner Pose. Im Bad roch es nach süßem Parfum, und es standen mehr Cremetuben und Lotionflaschen und Make-up-Döschen über dem Waschbecken als im Pausenraum von ’nem Stripclub. Die Bude war auffallend aufgeräumt, nix schien da zu stehen, wo es nicht hingehörte. Keine Klamotten lagen herum, kein schmutziges Geschirr in der Küche. Nicht mal ’ne versiffte Gabel in der Spüle. Die dicke Staubschicht, die sich überall fein säuberlich angehäuft hatte, bewies, dass seit Tagen niemand mehr in der Wohnung gewesen war. Interessant wurde es im Schlafzimmer.
Das Bett war richtig schlecht gemacht. Das Laken schlug Falten, die Decken waren ohne jede Sorgfalt zusammengeklappt und die Kissen nicht mal aufgeschüttelt. Das konnte ich sogar besser. Das passte nicht zu einem, der allem Anschein nach einen amtlichen Ordnungsfimmel hatte. Am Fußende des Futons waren die Fussel des weißen Teppichs auffallend platt gedrückt. Als wenn da lange Zeit etwas Rundes drübergelegen hätte. Ziemlich genau über dem Zentrum des Kreises, der ungefähr einen Durchmesser von eins fünfzig hatte, hing ein Haken an der Decke. Mein erster Gedanke beim Anblick der Halterung war, dass da mal ein Boxsack gehangen hatte. Mein zweiter war aber wohl realistischer. In Anbetracht der schmächtigen Gestalt von Radler war Boxen eher nicht sein Ding. Und warum sollte er den Sack ausgerechnet im Schlafzimmer aufhängen? Dank des riesigen, fünftürigen Kleiderschranks war eh nicht viel Platz im Zimmer. Ich tippte auf Liebesschaukel.
Das passte auch besser zu den Dildos, die wie die Orgelpfeifen neben dem Bett standen. Wahrscheinlich war dann ein runder Teppich als Spritzschutz unter die Schaukel gelegt worden. Da spritzt bestimmt einiges auf so ’nem Ding. Etwas war auch danebengegangen. Ich fand überall dunkle Flecken auf dem weißen Teppich, der Wand, dem Bett und am Kleiderschrank. Kleine Spritzer nur, die sich aber gut im Raum verteilt hatten. Es sah nicht nach Sperma aus, dafür waren sie zu dunkel. Blieb noch Scheiße oder Blut. Oder ’ne explodierte Gulaschsuppe. Wenn es Blut war, dann hatte sich da aber einer richtig fies wehgetan. Ich wollte mir gar nicht ausmalen, wie besudelt der verschwundene runde Spritzschutz erst war. Vorsichtig schnitt ich eine Probe aus den Flusen, krallte mir noch eine Haarbürste aus dem Bad und fing an, die ganze Bude richtig auf den Kopf zu stellen.
Laut seinen Unterlagen studierte Tom Radler im dritten Semester Architektur an der Ruhr-Uni. Da aber weder Fachliteratur noch Studienmaterial noch sonst irgendwas bei ihm zu Hause zu finden war, was ihn als architekturinteressierten Studenten hätte ausweisen können, war das Studium wohl mehr provisorischer Natur. Es gab nicht mal einen Computer in der Wohnung und leider auch keine CD-Rohlinge von derselben Marke wie die mit dem Schwulenporno drauf. Kontoauszüge suchte ich vergebens. Sparbücher und Policen für Sozialversicherungen ebenfalls. Ein Fahrzeug besaß er auch nicht. Tom Radler hatte keinen offiziellen Job, kriegte keine Stütze vom Amt, und nach allem, was mir Krude über seine Familie erzählt hatte, unterstützten die ihn auf gar keinen Fall. Sein Mietvertrag sagte, vierhundert warm im Monat. Strom kam auf einen knappen Hunni alle zwei Monate. Auf den Fotos, die ich fand, sah man ihn oft in Schickimickiclubs feiern, immer ein Sektchen zur Hand und einen Schönling am Hals. Urlaub machte er auch gerne, besonders auf Ibiza. Und sein Kleiderschrank platzte aus allen Nähten, obwohl das Monster fünf Türen hatte. Alles erste Ware, keine Aldi-Jeans und keine Unterbuxen von KiK. Grob geschätzt waren das gut und gerne fünfzehntausend Euro, die dadrin perfekt zusammengefaltet lagen.
Mit Papiere hatte er zum letzten Mal vor zwei Jahren gearbeitet. Für ein Jahr war er vor dem Studium nach Kroatien gegangen, um dort soziale Arbeit in einem Altenheim zu verrichten. Dafür bekam er monatlich zweihundertsiebzig Euro, plus freie Kost und Logis. Seitdem beliefen sich Tom Radlers offizielle Einkünfte auf genau null Komma null Euro.
Ich vermutete, dass der kleine Tommy eine Hure war. Aus dem naiven Träumer war vielleicht ein Stricher geworden. Konnte doch sein. Er wäre sicher nicht die erste Schlafmütze, die zu spät aufwacht. Ich sah mich schon auf dem Schwulenstrich ermitteln, eine Aussicht, die mich nicht gerade entzückte. Aber bis es so weit war, gab es noch andere mögliche Spuren, die ich in seiner Wohnung gefunden hatte. Merkwürdig kam mir die Visitenkarte einer Seniorenresidenz hier in Mansfeld vor, die ich gut versteckt zwischen seinen CDs fand. Nur die Karte, sonst keine weiteren Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen einem Anfang Zwanzigjährigen und einem Altenheim. Allerdings bimmelten beim Namen auf der Karte so einige Glöckchen in meiner Rübe. Ljubica Kovacic; Pflegedirektion. Das sah doch schwer nach einer geheim gehaltenen Kroatien-Connection aus. Ein ganz mieses Gefühl hatte ich auch bei den Flecken im Schlafzimmer. In der ganzen Wohnung hatte ich nichts gefunden, was man an dem Haken im Schlafzimmer hätte aufhängen können. Keine Schaukel, keinen Boxsack, nix, nicht mal ’ne selbst gestrickte Blumenampel. Es war nur ein Gefühl, aber ich hatte es im Urin, dass es Tom Radlers Blut war, das dort reichlich vergossen wurde. Wenn das stimmte, sah es nicht gut für ihn aus.
6
Bevor ich Tom Radlers Hütte verließ, installierte ich in seiner Diele noch einen Bewegungsmelder und eine Minicam, die für mich auf die Wohnungstür aufpassten. Sollte irgendjemand die Wohnung betreten, würde der Bewegungsmelder sofort die Kamera aktivieren und das Bild, das sie von demjenigen aufzeichnete, auf mein Smartphone schicken. Geil, oder? Wer braucht da noch Assistenten? Noch während ich die Webcam programmierte, klingelte mein schlaues Telefon. Bruce Lee schickte mir seine Erkenntnisse.
Er schrieb: »Was für ein Flittchen!«
Den Rest lud ich runter. Radlers Telefon war am Samstag, dem 13. Juli, um zehn Uhr fünfzehn das letzte Mal benutzt worden. Allerdings wurde es nur kurz eingeschaltet, um eine Kurznachricht an mehrere Empfänger zu verschicken, und sofort wieder ausgeschaltet. Das Ganze passierte am Flughafen Weeze. Davor war es zwei Tage ausgeschaltet gewesen. Von Donnerstag, dem 11. Juli, um ein Uhr sieben in der Nacht bis zu jenem Samstag. Zu dem Zeitpunkt befand sich das Telefon in der Holtestraße 17, also in Radlers Wohnung. Davor wiederum war das Teil nie ausgeschaltet gewesen. Vom Zeitpunkt des Kaufes im Media Markt in Mansfeld bis zum letzten Mittwoch, insgesamt neun Monate, drei Wochen, fünf Tage und etwas über siebzehn Stunden, war Radler rund um die Uhr immer erreichbar gewesen.
Das passte zeitlich zu dem, was Señor Marquez mir erzählt hatte. Gegen ein Uhr war Radler mit jemandem im Schlepptau nach Hause gekommen. Um kurz nach eins hatte dieser Jemand es geschafft, dass Radler sein Telefon ausmachte. Zum ersten Mal überhaupt. Da war wohl jemand sehr überzeugend gewesen.
Um kurz nach Mitternacht hatte Radler die letzte SMS erhalten. Die Nachricht kam aus Kevelaer, von einem Prepaidhandy. Empfangen hatte Radler sie im ersten Bezirk, in der Nähe vom Gildehof. Bruce Lee konnte es sich nicht verkneifen, mich per Notiz darauf hinzuweisen, dass sich dort der Club David befand und es allseits bekannt war, dass nur Homos da Zutritt hatten. Er schickte mir drei Smileys und wünschte mir einen schönen Abend dort. Allem Anschein nach war also während seines Clubaufenthalts eine SMS auf Tom Radlers Handy erschienen, die ihn echt in die Bredouille brachte.
Es folgte noch eine Liste von Gesprächen, Nachrichten, E-Mails, Postings, einfach allem, was Radler in den zwei Tagen vor seinem Verschwinden mit seinem Handy angestellt hatte. Dann noch jede Menge Sendestandorte, die ich mir später genauer ansehen wollte. Und zum Abschluss eine schier endlose Liste von Internetportalen, auf denen Radler angemeldet war. Beim ersten Überfliegen schien es sich hauptsächlich um Sites zu handeln, auf denen Gleichgesinnte andere Gleichgesinnte für die schnelle, bedeutungslose Nummer suchten. Auch das würde ich mir später in aller Ruhe zu Gemüte führen. Bruce Lee hatte zu jedem Portal Radlers Usernamen und die Passwörter mitgeschickt. Der Kerl war sein Geld echt wert.
Wo ich gerade schon in Mansfeld war, fuhr ich von Radlers Wohnung direkt zur Ruhr-Uni. An der dortigen Fakultät für Biologie lehrte Prof. Dr. Dr. Benjamin Robertz Molekularbiologie. Er war eigentlich ein kluger Mann, der aber vor ein paar Monaten dummerweise versucht hatte, seine Versicherung zu bescheißen. Ich war ihm damals auf die Schliche gekommen und hatte dann ein Geständnis aus ihm rausgepresst. Das fand er nicht gut. Der Blödmann hatte mich doch tatsächlich wegen Körperverletzung angezeigt. Aber das konnte ich ihm wieder ausreden. Er wollte mich halt nicht für den Rest seines Lebens fürchten. Dennoch hatte ich ihm deutlich erklärt, dass er mir allein für den Versuch, mich ans Messer zu liefern, noch etwas schuldete. Und heute war der Tag, an dem er sich freikaufen konnte.
Robertz war ein Nerd, wie er im Buche stand. Hornbrille, schütteres Haar und schlaff wie ein nasses Hemd. Die Stärke in seinem steifen weißen Kittel half ihm wahrscheinlich dabei, den Oberkörper aufrecht zu halten. Er zuckte sichtlich zusammen, als ich so plötzlich und unerwartet in seinem Labor auftauchte. Robertz war allein und freute sich nicht die Bohne, mich wiederzusehen. Dabei waren seine Verletzungen inzwischen alle recht gut verheilt. Die Nase war noch ein bisschen krumm, aber sonst war der Professor wieder gut in Schuss.
Ich baute mich vor ihm auf und flüsterte ihm zu: »Der Tag der Abrechnung ist gekommen, Prof. Dr. Dr. Versicherungsbescheißer! Und du hast Riesenglück. Mit einem kleinen Gefallen kannst du hier und jetzt deine Schuld bei mir ein für alle Mal tilgen.«
Er brauchte einen Moment, um zu realisieren, dass ich ihn gar nicht vermöbeln wollte, sondern ihm ein Angebot unterbreitete. Für einen so klugen Mann wie ihn dauerte das sogar ziemlich lange. Erst als sich seine Schockstarre etwas gelockert hatte und wieder klare Gedanken in seinem Hirn geformt werden konnten, fiel der Groschen. Und schlau, wie er war, nutzte er seine Chance.
»Gefallen?«, fragte er vorsichtig.
Ich drückte ihm das Tütchen mit der Teppichprobe in die Hand und erklärte ihm den Deal: »Ich muss wissen, was das für Spritzer dadrauf sind. Jetzt!«
Er stutzte, besah sich die Probe und zögerte. Ich packte ihn am Arm und schob ihn rüber zu einem Mikroskop.
»Es eilt!«, erklärte ich ihm.





























