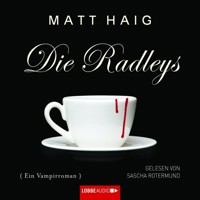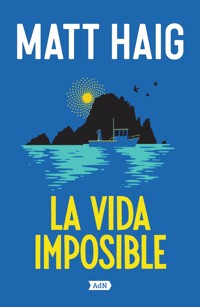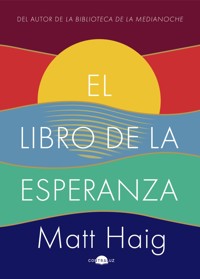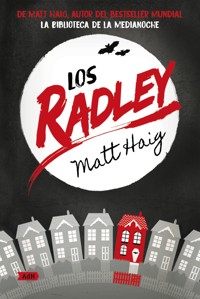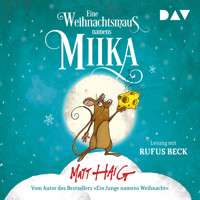9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Authentisch und anrührend Ein Buch, das es eigentlich gar nicht geben dürfte. Denn mit 24 Jahren wird Matt Haig von einer lebensbedrohlichen Krankheit überfallen, von der er bis dahin kaum etwas wusste: einer Depression. Es geschieht auf eine physisch dramatische Art und Weise, die ihn buchstäblich an den Abgrund bringt. Dieses Buch beschreibt, wie er allmählich die zerstörerische Krankheit besiegt und ins Leben zurückfindet. Eine bewegende, witzige und mitreißende Hymne an das Leben und das Menschsein – ebenso unterhaltsam wie berührend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Matt Haig
Ziemlich gute Gründe, am Leben zu bleiben
Deutsch von Sophie Zeitz
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für Andrea
Dieses Buch ist unmöglich
Vor dreizehn Jahren wusste ich, dass dieses Buch gar nicht möglich war.
Ich würde vorher sterben. Oder den Verstand verlieren.
Auf jeden Fall wäre ich nicht mehr hier. Manchmal hatte ich Zweifel, ob ich die nächsten zehn Minuten überstehen würde. Die Idee, es könnte mir irgendwann wieder so gut gehen, dass ich das Selbstvertrauen hätte, ein Buch darüber zu schreiben, war vollkommen unglaubhaft.
Eins der wesentlichen Symptome der Depression ist, keine Hoffnung zu haben. Keine Zukunft zu sehen. Da ist kein Licht am Ende des Tunnels, denn der Tunnel ist an beiden Enden zu, und du bist drin. Hätte ich in die Zukunft blicken können, hätte ich gewusst, dass sie heller ist als alles, was ich bisher kannte, dann hätte dieses Wissen das Ende des Tunnels weggesprengt und ich hätte Licht sehen können. Die Existenz dieses Buchs ist der Beweis, dass die Depression lügt. Die Depression spiegelt dir falsche Tatsachen vor.
Aber die Depression selbst ist keine Lüge. Depression ist an Echtheit kaum zu überbieten. Auch wenn sie unsichtbar ist.
Andere Leute bekommen oft nichts davon mit. Dein Kopf brennt lichterloh, und niemand sieht die Flammen. Deswegen – weil Depression überwiegend unsichtbar und undurchsichtig ist – hält sich ihr Stigma so hartnäckig. Und das ist besonders grausam für Depressive, weil das Stigma sich negativ auf die Gedanken auswirkt und Depression eine Krankheit der Gedanken ist.
Wenn du depressiv bist, fühlst du dich allein, und du hast das Gefühl, niemand hat je erlebt, was du gerade erlebst. Du hast solche Angst, in irgendeiner Form verrückt zu wirken, dass du alles in deinem Inneren verbirgst; du hast solche Angst, die Menschen würden dich weiter ausgrenzen, dass du dich verschließt und nicht darüber sprichst. Was fatal ist, denn darüber zu sprechen würde helfen. Worte – gesprochene, geschriebene – sind unsere Verbindung zur Welt. Mit anderen über solche Dinge zu sprechen oder darüber zu schreiben, verbindet uns miteinander und mit unserem wahren Ich.
Ja, ich weiß. Wir sind Menschen. Wir reden nicht gern über unsere Gefühle. Im Gegensatz zu anderen Tieren bedecken wir uns mit Kleidung und gehen unserer Fortpflanzung hinter geschlossenen Türen nach. Wir schämen uns, wenn wir nicht richtig funktionieren. Aber wir sind in der Lage, uns weiterzuentwickeln, zum Beispiel, indem wir darüber sprechen. Und vielleicht auch, indem wir darüber lesen und schreiben.
Daran glaube ich fest. Denn es war auch das Lesen und das Schreiben, was mich aus dem Dunkel gerettet hat. Seit ich weiß, dass die Depression mich über die Zukunft angelogen hat, wollte ich ein Buch über meine Erfahrungen schreiben, in dem ich mir Depression und Angst vorknöpfe. Ich hatte also zwei Ziele mit diesem Buch. Gegen die Stigmatisierung zu kämpfen und – vielleicht die größere Herausforderung – andere Menschen davon zu überzeugen, dass wir am tiefsten Punkt des Tals einfach nicht die klarste Aussicht haben. Ich habe dieses Buch geschrieben, weil letztendlich doch etwas dran ist an den uralten Klischees. Die Zeit heilt alle Wunden. Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels, selbst wenn wir es im Moment nicht sehen können. Nach dem Regen kommt Sonnenschein. Und manchmal können Worte einen Menschen tatsächlich befreien.
Eine Anmerkung noch, bevor es losgeht
Jedes Gehirn ist einzigartig. Und auch die Fehlfunktionen jedes Gehirns sind einzigartig. Die Abwege meines Gehirns waren anders als die Abwege anderer Gehirne. Unsere Erfahrungen ähneln denen anderer Leute, doch es sind nie ganz genau die gleichen Erfahrungen.
Oberbegriffe wie »Depression« (und »Angststörung« und »Panikstörung« und »Zwangsneurose«) sind nützlich, aber nur, wenn wir uns klarmachen, dass die Menschen diese Dinge nie genau gleich erleben.
Depression sieht für jeden anders aus. Schmerz wird unterschiedlich empfunden, in unterschiedlicher Intensität, und löst unterschiedliche Reaktionen aus. Aber um nützlich zu sein, muss ein Buch nicht exakt unsere eigene Erfahrung der Welt beschreiben, sonst wären die einzigen Bücher, die es sich zu lesen lohnt, die Bücher, die wir selbst geschrieben hätten.
Es gibt keine richtige oder falsche Art, Depressionen zu haben, oder Panikattacken, oder Selbstmordgedanken. Diese Dinge sind, wie sie sind. Leid ist – wie Yoga – kein Leistungssport. Doch ich habe über die Jahre herausgefunden, dass es mich tröstet, von anderen Menschen zu lesen, die Verzweiflung erlitten, überlebt und überwunden haben. Es hat mir Hoffnung gegeben. Und ich hoffe, dieses Buch kann das Gleiche bewirken.
1.FALLEN
Am Ende braucht man mehr Mut, um zu leben, als um sich umzubringen.
Albert Camus, Der glückliche Tod
Der Tag, an dem ich starb
Ich erinnere mich gut an den Tag, an dem mein altes Ich starb.
Es begann mit einem Gedanken. Irgendwas stimmt nicht. Das war der Anfang. Bevor ich wusste, was es war, das nicht stimmte. Und dann, vielleicht eine Sekunde später, hatte ich eine seltsame Empfindung im Kopf, es war wie eine Aktivität im hinteren Teil meines Schädels, nicht weit über dem Nacken. Das Kleinhirn. Ein pulsierendes, intensives Flackern, als wäre ein Schmetterling darin gefangen, kombiniert mit einem kribbelnden Gefühl. Ich wusste noch nichts von den seltsamen körperlichen Symptomen, die mit Depression und Angststörungen einhergehen. Ich dachte einfach, ich würde sterben. Und dann rutschte mein Herzschlag weg. Und dann rutschte ich weg. Ich fiel, immer schneller, stürzte in eine neue klaustrophobische, erstickende Realität. Es sollte weit über ein Jahr dauern, bis ich mich wieder auch nur halbwegs normal fühlen würde.
Bis dahin hatte ich kein wirkliches Bewusstsein davon gehabt, was Depression bedeutet, ich wusste nur, dass meine Mutter nach meiner Geburt eine kurze Zeit lang daran gelitten hatte und dass meine Urgroßmutter väterlicherseits Selbstmord begangen hatte. Es scheint also eine familiäre Belastung da gewesen zu sein, über die ich mir allerdings nie irgendwelche Gedanken gemacht hatte.
Wie dem auch sei, ich war vierundzwanzig. Ich lebte auf Ibiza, in einer der ruhigeren, schönen Ecken der Insel. Es war September. In vierzehn Tagen musste ich nach London zurückkehren, in den Ernst des Lebens. Nach sechs Jahren Studentenleben und Sommerjobs. Ich hatte das Erwachsenwerden so lange wie möglich aufgeschoben, aber es hing finster über mir wie eine schwarze Wolke. Eine Wolke, die jetzt ihre Schleusen öffnete und auf mich herabregnete.
Das Merkwürdige am menschlichen Gehirn ist, es können die extremsten Dinge darin vorgehen, ohne dass irgendjemand etwas davon mitbekommt. Die Welt zuckt einfach mit den Schultern. Vielleicht sind deine Pupillen erweitert. Vielleicht redest du unzusammenhängendes Zeug. Deine Haut glänzt schweißfeucht. Und doch konnte niemand, der mich in der Villa auf der Insel sah, ahnen, was ich fühlte, niemand konnte nachvollziehen, welch groteske Hölle ich erlebte, oder warum mir der Tod wie eine so phänomenal gute Idee vorkam.
Ich blieb drei Tage im Bett. Aber ich schlief nicht. Meine Freundin Andrea kam regelmäßig herein und brachte mir Wasser oder Obst, das ich kaum essen konnte.
Das Fenster stand offen, um frische Luft hereinzulassen, doch im Zimmer war es still und heiß. Ich erinnere mich, wie erstaunt ich war, noch am Leben zu sein. Ich weiß, das klingt melodramatisch, aber Depression und Panik geben dir melodramatische Gedanken ein. Es war mir jedenfalls keine Erleichterung. Ich wollte tot sein. Nein. Das stimmt nicht ganz. Ich wollte nicht tot sein, ich wollte nur nicht am Leben sein. Der Tod machte mir Angst. Außerdem passierte der Tod nur Menschen, die gelebt hatten. Es gab unendlich viel mehr Menschen, die nie gelebt hatten. Und zu denen wollte ich gehören. Der klassische Wunsch. Nie geboren worden zu sein. Eins der dreihundert Millionen Spermien gewesen zu sein, die es nicht schafften.
(Was für ein Geschenk es war, normal zu sein! Wir alle balancieren auf einem unsichtbaren Drahtseil und könnten jeden Moment abrutschen, um dann dem existenziellen Grauen ausgeliefert zu sein, das in unserer Psyche lauert.)
Das Zimmer war leer. Es gab nur ein Bett mit einer weißen ungemusterten Decke. Die Wände waren weiß. Vielleicht hing ein Bild an der Wand, aber ich glaube nicht. Jedenfalls erinnere ich mich an keines. Neben dem Bett lag ein Buch. Einmal nahm ich es in die Hand und legte es wieder hin. Ich konnte mich nicht eine Sekunde darauf konzentrieren. Es war mir unmöglich, meine Erfahrung in Worte zu fassen, weil sie weit jenseits aller Worte war. Ich konnte buchstäblich nicht darüber sprechen. Worte schienen zu banal neben dieser Art von Schmerz.
Ich erinnere mich, dass ich mir Sorgen um meine kleine Schwester Phoebe machte. Sie war in Australien. Ich hatte Angst, dass sie, der Mensch, der mir genetisch am ähnlichsten war, auch so etwas erleben könnte. Ich wollte mit ihr sprechen, aber ich wusste, ich konnte nicht. Zu Hause in Nottinghamshire hatten wir, als wir klein waren, einen Klopfcode entwickelt, um uns durch die Wand zwischen unseren Zimmern zu verständigen. Jetzt klopfte ich auf die Matratze und stellte mir vor, dass sie mich auf der anderen Seite der Erdkugel hören könnte.
Klopf. Klopf. Klopf.
Ich hatte keine Begriffe wie »Depression« oder »Panikstörung« im Kopf. In meiner lachhaften Naivität glaubte ich, dass noch nie ein Mensch durchgemacht hatte, was ich erlebte. Weil es mir so unfassbar fremd war, dachte ich, es müsste meiner ganzen Spezies fremd sein.
»Andrea, ich habe Angst.«
»Alles wird gut. Es wird wieder gut. Es wird wieder gut.«
»Was passiert mit mir?«
»Ich weiß es nicht. Aber es wird wieder gut.«
»Ich verstehe nicht, wie es so etwas geben kann.«
Am dritten Tag verließ ich das Zimmer, und ich verließ das Haus. Ich ging hinaus, um mich umzubringen.
Warum Depression so schwer zu verstehen ist
Sie ist unsichtbar.
Sie ist nicht »ein bisschen niedergeschlagen sein«.
Sie ist das falsche Wort. Das Wort Depression erinnert an einen platten Reifen, an etwas, das ein Loch hat und sich nicht bewegt. Vielleicht fühlt sich Depression ohne Angststörung so an, aber Depression mit Angst gemischt ist alles andere als platt oder reglos. (Die Dichterin Melissa Broder twitterte einmal: »welcher idiot hat es ›depression‹ genannt und nicht ›in meiner brust leben fledermäuse und nehmen viel raum ein, ps ich sehe einen schatten‹?«) Wenn es am schlimmsten ist, wünschst du dir verzweifelt irgendein anderes Leiden, irgendwelche körperlichen Schmerzen, weil die Psyche unendlich ist und ihre Qualen genauso unendlich sein können.
Man kann depressiv und glücklich sein, genau wie man ein trockener Alkoholiker sein kann.
Sie hat nicht immer einen erkennbaren Grund.
Sie trifft Menschen – Millionäre, Menschen mit tollem Haar, glücklich verheiratete Menschen, frisch beförderte Menschen, Menschen, die Gitarre spielen, steppen oder Kartentricks können, Menschen, die in ihrem Leben noch keinen Pickel hatten, Menschen, deren Status-Updates überschwänglich glücklich klingen –, die von außen betrachtet keinen Grund zum Traurigsein haben.
Sie ist selbst für die rätselhaft, die daran leiden.
Schöne Aussicht
Die Sonne brannte. Es duftete nach Pinien und nach Meer. Das Meer war gleich da unten, am Fuß der Klippe. Der Klippenrand war nur ein paar Schritte entfernt. Nicht mehr als zwanzig, würde ich sagen. Der einzige Plan, den ich hatte, war, einundzwanzig Schritte zu gehen.
»Ich will sterben.«
Da war eine Eidechse, ganz nah bei meinen Füßen. Eine lebendige Eidechse. Ich hatte das Gefühl, sie verurteilte mich. Eidechsen bringen sich nicht um. Eidechsen sind Überlebenskünstler. Man reißt ihnen den Schwanz ab, und sie lassen sich einen neuen nachwachsen. Sie heulen nicht rum. Sie haben keine Depressionen. Sie machen einfach weiter, egal wie rau und unwirtlich die Landschaft ist. Mehr als alles andere wollte ich diese Eidechse sein.
Die Villa lag hinter mir. Der schönste Ort, an dem ich je gelebt hatte. Mir bot sich die herrlichste Aussicht, die ich je gesehen hatte. Das glitzernde Mittelmeer sah aus wie eine türkisgrüne, mit Diamanten übersäte Tischdecke, gesäumt von einer dramatischen Kalksteinküste und kleinen, fast weißen menschenleeren Stränden. Die Aussicht passte zu fast jeder Definition von schön. Und doch, selbst die schönste Aussicht der Welt konnte mich nicht davon abhalten, mich umbringen zu wollen.
Vor etwas über einem Jahr hatte ich für meine Magisterarbeit viel Foucault gelesen. Viel Wahnsinn und Gesellschaft. Die Idee, man solle dem Wahnsinn erlauben, Wahnsinn zu sein. Dass eine ängstliche, repressive Gesellschaft jeden als krank ausgrenzt, der anders ist. Aber das hier war eine Krankheit. Es war kein verrückter Gedanke. Es war nicht ein bisschen bekloppt sein. Es war nicht Borges lesen und Captain Beefheart hören oder einen Joint rauchen und einen riesigen Mars-Riegel halluzinieren. Das hier war purer Schmerz. Mir war es gut gegangen, und dann plötzlich nicht mehr. Es ging mir nicht gut. Also war ich krank. Es spielte keine Rolle, ob die Gesellschaft oder die Wissenschaft schuld war. Ich hielt es nicht aus – konnte es nicht aushalten –, mich auch nur eine Sekunde länger so zu fühlen. Ich musste mich beenden.
Und das würde ich auch tun. Während meine Freundin nichtsahnend im Haus war und dachte, ich schnappte frische Luft.
Ich ging los, zählte meine Schritte, dann verzählte ich mich und kam völlig durcheinander.
»Mach jetzt keinen Rückzieher«, sagte ich zu mir. Ich glaube zumindest, dass ich das zu mir sagte. »Mach jetzt keinen Rückzieher.«
Ich erreichte den Rand der Klippe. Ich konnte das unerträgliche Gefühl beenden, indem ich einfach noch einen Schritt machte. Es war so lächerlich einfach – ein einziger Schritt – im Vergleich zu dem Schmerz, am Leben zu sein.
Achtung. Wer glaubt, ein depressiver Mensch wolle glücklich sein, irrt sich gewaltig. Depressive Menschen haben nicht das geringste Interesse am Luxus des Glücklichseins. Sie wollen einfach nur keinen Schmerz mehr spüren. Ihrem Gehirn entfliehen, das in Flammen steht, in dem die Gedanken lodern und qualmen wie alte Besitztümer bei einem Wohnungsbrand. Normal sein. Oder, da Normalsein unmöglich ist, leer sein. Und der einzige Weg für mich, leer zu sein, war, aufzuhören zu leben. Eins minus eins ist null.
Doch die Wirklichkeit war nicht so einfach. Das Seltsame an der Depression ist, auch wenn man Selbstmordgedanken hat, bleibt die Angst vor dem Tod dieselbe. Der Unterschied ist nur, dass das Leben plötzlich extrem schmerzhaft geworden ist. Wenn man von einem Selbstmord hört, sollte man also nicht vergessen, dass die betreffende Person nicht weniger Angst vor dem Tod hatte. Es war keine »Wahl« im moralischen Sinn. Wer Selbstmord moralisch bewertet, hat ihn missverstanden.
Ich stand eine Weile da. Auf der Suche nach dem Mut zu sterben, und dann auf der Suche nach dem Mut zu leben. Zu sein. Nicht zu sein. In diesem Moment war ich dem Tod so nah. Ein Gramm mehr Grauen, und das Zünglein an der Waage hätte in die andere Richtung ausgeschlagen. Vielleicht gibt es ein Universum, in dem ich den Schritt getan habe, aber nicht in diesem.
Ich hatte eine Mutter und einen Vater und eine Schwester und eine Freundin. Das waren vier Menschen, die mich liebten. In diesem Moment wünschte ich, ich hätte niemanden. Keine einzige Seele. Liebe hielt mich hier gefangen. Dabei wusste keiner von ihnen, wie es sich anfühlte, wie es in meinem Kopf aussah. Hätten sie sich auch nur zehn Minuten in meinem Kopf aufhalten können, hätten sie vielleicht gesagt: »Oh, ja, okay. Spring. Es geht nicht, dass du solchen Schmerz ertragen musst. Lauf los und spring und mach die Augen zu und tu es einfach. Ich meine, würdest du brennen, könnte ich eine Decke über dich werfen, aber diese Flammen sind unsichtbar. Wir können nichts für dich tun. Also spring. Oder gib mir eine Pistole und ich erschieße dich. Sterbehilfe.«
Aber so funktioniert es nicht. Wenn du Depressionen hast, ist der Schmerz unsichtbar.
Wenn ich ehrlich bin, hatte ich auch einfach Angst. Was, wenn ich nicht starb? Wenn ich nur gelähmt wäre und dann für immer bewegungsunfähig in diesem seelischen Zustand gefangen?
Ich glaube, wenn wir genau hinhören, bietet das Leben immer Gründe, nicht zu sterben.
Die Gründe können aus der Vergangenheit kommen – Menschen, die uns großgezogen haben vielleicht, oder Freunde oder Geliebte – oder aus der Zukunft: die Möglichkeiten, die wir ausschalten würden.
Also lebte ich weiter. Ich wandte mich wieder zum Haus zurück und musste mich vor lauter Stress übergeben.
Ferngespräch in die Vergangenheit – Teil eins
Damaliges Ich: Ich will sterben.
Heutiges Ich: Das wirst du aber nicht.
Damaliges Ich: Das ist schrecklich.
Heutiges Ich: Nein, es ist wunderbar. Vertrau mir.
Damaliges Ich: Ich halte den Schmerz nicht aus.
Heutiges Ich: Ich weiß. Aber du musst. Es lohnt sich.
Damaliges Ich: Warum? Ist in der Zukunft alles perfekt?
Heutiges Ich: Nein. Natürlich nicht. Das Leben ist nie perfekt. Und ich habe immer noch ab und zu eine depressive Phase. Aber der Schmerz ist nicht mehr so schlimm. Ich habe meinen Platz gefunden. Ich habe herausgefunden, wer ich bin. Ich bin glücklich. In diesem Moment bin ich glücklich. Der Sturm zieht vorüber. Glaub mir.
Damaliges Ich: Ich kann dir nicht glauben.
Heutiges Ich: Warum nicht?
Damaliges Ich: Du bist aus der Zukunft, und ich habe keine Zukunft.
Heutiges Ich: Ich hab dir doch gerade gesagt …
Pillen
Ich hatte tagelang nichts Richtiges gegessen. Ich hatte den Hunger nicht gespürt, weil in meinem Körper und Gehirn so viele andere, verrückte Dinge passierten. Andrea sagte, ich müsse essen. Sie holte einen Karton Don-Simon-Gazpacho aus dem Kühlschrank (die in Spanien wie Fruchtsaft im Supermarkt verkauft wird).
»Trink.« Sie schraubte den Deckel ab und reichte mir den Karton.
Ich trank einen Schluck. Dabei merkte ich, wie hungrig ich war, und trank mehr. Wahrscheinlich trank ich den halben Karton aus, dann ging ich raus und übergab mich wieder. Zugegeben, wenn man sich von Don-Simon-Gazpacho erbrechen muss, ist das nicht unbedingt ein Krankheitszeichen, aber Andrea wollte kein Risiko eingehen.
»O Gott«, sagte sie. »Wir gehen jetzt.«
»Wohin?«, fragte ich.
»Ins Krankenhaus.«
»Die geben mir bloß Pillen«, sagte ich. »Ich will keine Pillen nehmen.«
»Matt. Du brauchst Pillen. In deinem Zustand hast du nicht mehr die Wahl. Wir gehen, okay?«
Ich habe hier ein Fragezeichen gesetzt, aber in meiner Erinnerung war es keine Frage. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe, aber ich weiß, dass wir ins Krankenhaus fuhren. Und dass ich Pillen bekam.
Der Arzt sah meine Hände an. Sie zitterten. »Wie lange hat die Panik gedauert?«
»Sie hat gar nicht richtig aufgehört. Mein Herz klopft immer noch zu schnell. Ich fühle mich merkwürdig.« Merkwürdig erfasste es nicht annähernd. Aber mehr sagte ich, glaube ich, nicht. Sprechen war eine unglaubliche Anstrengung.
»Das ist das Adrenalin. Was ist mit Ihrer Atmung? Haben Sie hyperventiliert?«
»Nein. Es ist nur mein Herz. Ich meine, meine Atmung fühlt sich … merkwürdig an … aber eigentlich fühlt sich alles merkwürdig an.«
Er fühlte meinen Herzschlag. Mit der Hand. Er legte zwei Finger auf meine Brust. Dann hörte er auf zu lächeln. »Sind Sie auf Drogen?«
»Nein!«
»Nehmen Sie Drogen?«
»Ich habe in meinem Leben schon mal Drogen genommen, ja. Aber nicht diese Woche. Ich habe nur viel Alkohol getrunken.«
»Vale, vale, vale«, sagte er. »Sie brauchen Diazepam. Die Höchstdosis. So viel, wie ich Ihnen verschreiben kann.« In einem Land, wo Diazepam frei verkäuflich ist wie Paracetamol und Ibuprofen, war das eine deutliche Ansage. »Das wird Ihnen helfen. Versprochen.«
Ich lag da und stellte mir vor, dass die Medikamente halfen. Einen Moment lang flaute die Panik zu einem Gefühl schwerer Beklemmung ab. Doch diese kurzfristige Entspannung löste plötzlich neue Panik aus. Und diesmal kam sie wie eine Flut. Ich hatte das Gefühl, alles zöge sich vor mir zurück, wie in der Szene in Der weiße Hai, als Brody am Strand sitzt und denkt, er sieht den Hai. Ich lag auf dem Sofa, aber ich spürte einen körperlichen Sog. Als zöge mich etwas noch weiter weg aus der Realität.
Tödlich
Mit über einem Prozent ist Selbstmord unter anderem in Großbritannien, den USA und auch in Deutschland eine der häufigsten Todesursachen. Laut den Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO sterben mehr Menschen durch Selbstmord als an Magenkrebs, Leberzirrhose, Darmkrebs, Brustkrebs und Alzheimer. Da die meisten Menschen, die sich umbringen, depressiv sind, ist Depression also eine der tödlichsten Krankheiten auf unserem Planeten. In unseren Breiten töten Depressionen mehr Menschen als die meisten anderen Formen von Gewalt zusammengenommen – Krieg, Terrorismus, häusliche Gewalt, tätliche Übergriffe.
Depression ist eine so schwere Krankheit, dass sich ihretwegen mehr Menschen das Leben nehmen als wegen irgendeiner anderen Krankheit. Trotzdem scheinen viele Leute immer noch zu denken, Depressionen seien eigentlich nicht so schlimm. Sonst würden sie die Dinge nicht sagen, die sie sagen.
Was Leute zu Depressiven sagen, was sie in anderen lebensbedrohlichen Situationen nie sagen würden
»Komm schon. Ich weiß, du hast Tuberkulose, aber es könnte schlimmer sein. Es ist ja nicht so, als wäre jemand gestorben!«
»Was glaubst du, warum hast du denn Magenkrebs?«
»Ja, ich weiß, Darmkrebs ist schlimm, aber mit jemandem zusammenzuleben, der Darmkrebs hat, ist auch nicht einfach. Puh. Ein Alptraum.«
»Ach, du hast Alzheimer? Wem sagst du das. So geht’s mir auch ständig.«
»Oh, Meningitis. Na ja, eigentlich ist es doch eine Willensfrage.«
»Ja, ja, dein Bein steht in Flammen, aber ständig darüber zu reden, hilft auch nicht, oder?«
»Okay. Schon gut. Dein Fallschirm ist nicht aufgegangen. Aber du darfst dich von so was nicht unterkriegen lassen.«
Negatives Placebo
Die Medikamente haben mir nicht geholfen. Wahrscheinlich war ich zum Teil selbst daran schuld.
In seinem Buch Bad Science erklärt Ben Goldacre: »Wir sind Placebo-Responder. Unser Geist trickst unseren Körper aus. Wir können uns selbst nicht trauen.« Das stimmt, und es funktioniert in beide Richtungen. Während meiner allerschlimmsten Zeit, als die Depression von einer ausgewachsenen, nie nachlassenden Panikstörung begleitet wurde, hatte ich Angst vor allem. Ich hatte buchstäblich Angst vor meinem eigenen Schatten. Wenn ich einen Gegenstand lange genug ansah – ein Paar Schuhe, ein Kissen, eine Wolke –, entdeckte ich eine Böswilligkeit darin, eine Art negative Kraft, die ich in einem früheren, abergläubischeren Jahrhundert vielleicht als den Teufel interpretiert hätte. Doch am meisten Angst hatte ich vor Drogen und allem, was meinen Bewusstseinszustand verändern könnte (Alkohol, Schlafmangel, plötzliche Neuigkeiten, selbst eine Massage).
Später, in weniger schlimmen Phasen, überließ ich mich dem Alkohol oft zu sehr. Dieses weiche, warme Abfedern der Existenz kann so angenehm sein, dass man immer wieder den Kater vergisst, der unweigerlich kommt. Nach wichtigen Meetings landete ich manchmal allein in einer Bar, verbrachte den ganzen Nachmittag dort und verpasste fast den letzten Zug nach Hause. Doch 1999 war ich noch Jahre entfernt von dieser relativ normalen Form von Dysfunktionalität.