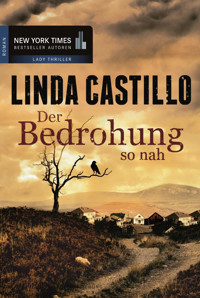9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kate Burkholder ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein Herz, so dunkel, dass es alles um sich herum vergiftet Polizeichefin Kate Burkholder steckt mitten in den Vorbereitungen für ihre Hochzeit, als sie zum Schauplatz eines ungewöhnlichen Verbrechens gerufen wird: Der junge Amische Aden Karn wurde mit einer Armbrust brutal ermordet. Die Familie des allseits beliebten jungen Mannes ist am Boden zerstört, und Kate ist fest entschlossen, den Fall zu lösen. Das Opfer war gerade in seiner Rumspringa, einer Zeit, in der junge Amische das Leben außerhalb ihrer Glaubensgemeinschaft kennenlernen. Was ist während dieser Zeit geschehen, dass Aden sterben musste? Bei ihren Ermittlungen stößt Kate auf ein düsteres Geheimnis, das auch sie selbst in große Gefahr bringt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Linda Castillo
Zorniges Herz
Thriller
Über dieses Buch
Ein Herz, so dunkel, dass es alles um sich herum vergiftet …
Polizeichefin Kate Burkholder befindet sich inmitten der Vorbereitungen für ihre Hochzeit mit John Tomasetti, als sie zum Schauplatz eines ungewöhnlichen Verbrechens gerufen wird: Der allseits beliebte 21-jährige Amische Aden Karn wird auf seinem Arbeitsweg tot aufgefunden – erschossen mit Pfeil und Bogen. Die Verletzungen an seinem Körper deuten auf ein persönliches, von Emotionen getriebenes Motiv hin.
Die amische Gemeinde ist am Boden zerstört, nicht zuletzt Adens Verlobte Emily. Was ist geschehen, dass der Sohn einer angesehenen Familie auf so grausame Weise sterben musste?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Linda Castillo wuchs in Dayton im US-Bundesstaat Ohio auf, schrieb bereits in ihrer Jugend ihren ersten Roman und arbeitete viele Jahre als Finanzmanagerin, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Der internationale Durchbruch gelang ihr mit »Die Zahlen der Toten« (2010), dem ersten Kriminalroman mit Polizeichefin Kate Burkholder. Linda Castillo kennt die Welt der Amischen seit ihrer Kindheit und ist regelmäßig zu Gast bei amischen Gemeinden. Die Autorin lebt heute mit ihrem Mann und zwei Pferden auf einer Ranch in Texas.
Helga Augustin hat in Frankfurt am Main Neue Philologie studiert. Von 1986 - 1991 studierte sie an der City University of New York und schloss ihr Studium mit einem Magister in Liberal Studies mit dem Schwerpunkt ›Translations‹ ab. Die Übersetzerin lebt in Frankfurt am Main.
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
DANK
Dieses Buch ist meinen Leserinnen und Lesern gewidmet. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung über all die Jahre, in deren Verlauf ich vierzehn Bücher veröffentlicht habe. Danke für Ihre E-Mails und Briefe, für die Kommentare in den sozialen Medien und dass Sie zu meinen Lesungen (und den manchmal nicht ganz so fesselnden Vorträgen) gekommen sind. Aber vor allem danke ich Ihnen, dass Sie mich an das erinnern, was wirklich wichtig ist. Ich schätze jeden Einzelnen von Ihnen sehr!
DIE BOSHEIT DER FREVLER FINDE EIN ENDE.
Psalm 7,10
Prolog
Der Himmel über den Baumkronen leuchtete orange und rosarot, als Aden Karn in den Schuppen ging, die Lunchbox in den Lenkerkorb seines Fahrrads warf und es hinaus auf die Straße schob. Dort schwang er das Bein über den Sattel und trat kräftig in die Pedale. Die Fahrt zum Treffpunkt, wo er von seinem englischen Arbeitskollegen eingesammelt wurde, dauerte normalerweise zwanzig Minuten, und heute war er ausnahmsweise früh dran. Das freute ihn, denn in dieser Gegend von Ohio hatte der Herbst schon sanft Einzug gehalten und die Ahorn- und Walnussbäume entlang der Straße bunt gefärbt. Noch eine Woche, und die Landschaft würde in ein Meer aus Farben getaucht sein. Seine Mamm sagte, es wären die Farben Gottes, und heute Morgen musste er ihr recht geben.
Als er an der Hangscheune vorbei mit summenden Reifen um die Kurve flitzte, war sein Hemd schweißnass. Seine englischen Kollegen frotzelten über ihn, weil er mit dem Rad kam, doch es war freundlich gemeint, und Aden nahm es ihnen nicht krumm. Er konnte ein Buggy-Pferd ja nicht den ganzen Tag, während er arbeitete, am Treffpunkt angebunden stehen lassen. Ab und zu war er zwar nass geworden, aber das Problem löste jetzt die Regenjacke, die er für alle Fälle dabeihatte. Hier in Holmes County fuhren einige der Amischen auch mit Motorrollern, aber das war nichts für Aden. Er mochte die Stille auf dem Fahrrad und die körperliche Anstrengung, die Geschwindigkeit und die Freiheit. Irgendwie fühlte er sich so auch der Erde näher – Gott näher –, und der Reichtum, mit dem Er Seine Kinder beschenkte, machte ihn glücklich.
Auf der Fahrt entlang der Landstraße ließ er sich Zeit. Er kam an Mr. Younts Weide mit dem moosgesäumten Teich vorbei, auf dem die Enten über die Wasseroberfläche glitten, ihre Köpfe senkten, um am Laichkraut zu knabbern, und mit ihren Flügeln schlugen. Als er über die Brücke fuhr, kam er an den Schafen vorbei, die das üppige Obstgartengras in der Senke abweideten. Er hatte beobachtet, wie die Lämmer im Laufe des Sommers gewachsen waren. Er passierte Mr. Dunlops Feld, wo der Futtermais zum Trocknen stehengeblieben war und erreichte die County Line Road, die er sich stehend und mit aller Kraft in die Pedale tretend bergauf kämpfte. Bergab fuhr er ein bisschen zu schnell, genoss den Fahrtwind und bog schwungvoll in die Hansbarger Road ab.
Aden war so in Gedanken versunken, dass er die Gestalt im Straßengraben erst registrierte, als er schon an ihr vorbeigefahren war. Überrascht fragte er sich, ob es womöglich ein Problem gab. Er bremste hart ab, setzte einen Fuß auf den Boden und kam so abrupt zum Stehen, dass das Hinterrad seitlich wegrutschte.
Mit beiden Füßen am Boden, drehte er sich um und blickte über die Schulter. Komischerweise war nirgends ein Fahrzeug zu sehen, nur diese Gestalt im Straßengraben, die zu ihm herübersah.
»Ist alles in Ordnung?«, rief er.
In dem Moment sah er die Waffe. Zuerst glaubte er, es sei ein Gewehr, was aber außerhalb der Jagdsaison seltsam wäre. Er sah genauer hin und erkannte an der Form – der Spreizung der Wurfarme, dem Nockpunkt links und dem Spannbügel vorn –, dass es eine Armbrust war. Ungläubig sah er zu, wie die Waffe auf ihn gerichtet wurde, die Gestalt den Kopf neigte und ein Auge ans Visier drückte.
Vor Schreck ließ er den Fahrradlenker los und hob beide Hände. »He! Was machen Sie –«
Zosch!
Eine unsichtbare Faust schlug ihm die Luft aus den Lungen. Ein plötzlicher Schmerz in der Brust, ein Brennen im Rücken. Fassungslos blickte Aden auf den Pfeil in seiner Brust. Seine Knie gaben nach, das Fahrrad fiel zur Seite, und der Lenker knallte auf den Asphalt. Sekunden später schlug er mit der Schulter am Boden auf, dann mit der Schläfe, und die Welt um ihn herum verstummte. Er lag still da, blinzelnd und verwirrt, die Fahrbahn war warm an seiner Wange und der Schmerz pochte von der Brust bis zum Becken.
Um zu begreifen, was gerade passiert war, bewegte er sein Bein und rollte sich auf den Rücken. Ein höllischer Schmerz durchfuhr seine Wirbelsäule, kurz wurde ihm schwarz vor Augen. Dann blickte er stöhnend auf den Pfeil in seiner Brust und stellte fest, dass er glatt durch ihn durchgegangen war und an seinem Rücken wieder herausragte.
Gott im Himmel …
Seine Blase entleerte sich, warmer Urin lief über seine Schenkel, durchnässte seine Hose. Aber der Schmerz war zu schlimm, als dass ihn das kümmerte, und die Angst zu groß, denn plötzlich wurde ihm das ganze Ausmaß seiner Verletzung bewusst. Panik erfasste ihn, er öffnete den Mund, um Luft zu schnappen, und ein grässlicher Laut kam aus ihm heraus.
Dann hörte er Schritte auf Schotter knirschen und blickte auf, versuchte zu sprechen, hob die Hand, die Finger gespreizt. »Hilf mir.«
Aus einem teilnahmslosen Gesicht starrten eiskalte Augen entschlossen auf ihn herab. Behandschuhte Hände umfassten seine Schultern, kamen – scheinbar ohne persönliches Interesse – einer unangenehmen, aber notwendigen Pflicht nach.
Er wimmerte. »Nein, nicht.«
Schmerzen wie Stromschläge, als er auf den Boden gedrückt wurde, die Pfeilspitze von hinten zurück in den Rücken drang und er wieder auf den Bauch gedreht wurde. Sein Stöhnen war ein Gurgeln, jeder Atemzug eine Höllenqual.
Als der Pfeil dann aus seinem Körper gerissen wurde, zuckten seine Arme und Beine unkontrolliert. Dunkelheit senkte sich auf ihn herab. Aden spürte wieder eine Hand an der Schulter, Finger gruben sich in seinen Arm, drehten ihn zurück auf den Rücken.
Hilflos und gelähmt vor Angst lag er da, atmete stoßweise, mit jedem Schlag seines Herzens pulsierte der Schmerz durch seinen Körper. Vage nahm er wahr, wie die Armbrust auf den Boden gestellt und die Spitze eines Stiefels in den Fußbügel geschoben wurde, er hörte das Quietschen der Bogensehne beim Spannen und das Einrasten der Sehne in den Abzugsmechanismus.
Bitte nicht …
Während sich die gespannte Armbrust auf ihn herabsenkte, grub sich ein emotionsloser Blick in seine Augen. »Ich ertrage nicht, was du tust,« sagte der Schütze.
Aden wusste, was nun folgte, und schon das Wissen rief blankes Entsetzen hervor, durchströmte jeden Muskel seines Körpers. Er versuchte, sich zu bewegen, wollte weglaufen oder auch kriechen, hob das Bein – das gleich wieder nach unten sackte. Beim Griff nach dem Knöchel des Schützen bekam er den Stoff des Hosenbeins zu fassen.
»Bitte nicht«, bettelte er.
Mit quälender Behutsamkeit wurde die Pfeilspitze auf seinen Mund gedrückt, schlitzte seine Lippen auf und schob sich zwischen die Zähne. Stahl klackte an Schmelz, der salzige Geschmack von Blut. Dann war die Spitze im Mund, drückte seine Zunge nieder, drang tiefer und tiefer ein. Mit weit aufgerissenen Augen würgte Aden, einmal, zweimal, wollte sprechen, doch er brachte nur ein Krächzen hervor.
Jetzt spürte er einen Stiefel auf seiner Schulter, der ihn niederdrückte, ihn am Boden fixierte. Die Augen weit aufgerissen, sah er zu, wie der Finger sich um den Abzug der Armbrust legte. Der Pfeil drang bis hinten in den Rachen, sein Mund füllte sich mit Blut, Aden hustete, würgte, seine Kehle krampfte. Seine Hand riss am Hosenbein, zuckte.
Bitte.
Zosch!
Aden blickte zum Himmel hinauf, doch die Sonne konnte er nicht mehr sehen.
1. Kapitel
Meine Mamm hatte für die kleinen Unannehmlichkeiten des Lebens immer einen Spruch parat.
Vann es shmatza, hayva da shmatz un bayda es dutt naett letsht zu lang. Wenn es weh tut, akzeptiere den Schmerz und bete, dass er bald vergeht. Heute Morgen denke ich viel an meine Mutter, und zum ersten Mal seit langer Zeit fehlt sie mir.
Ich stehe auf einem alten Holzschemel im Schlafzimmer meiner Schwester. Meine Polizeiuniform hängt über dem Fußende des Bettes, meine Stiefel stehen davor am Boden, mein Ausrüstungsgürtel und meine Dienstwaffe sehen auf dem grau-weißen Hochzeitsquilt obszön fehl am Platz aus.
»Meine Güte, Katie, du zappelst ja schon wieder«, sagt Sarah. »Halt still, damit ich das Kleid fertig abstecken kann, ohne dich zu stechen.«
»’tschuldigung«, murmele ich.
Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal ein Kleid getragen habe. Und speziell dieses Kleid hat eine Geschichte. Vor elf Jahren hat es meine Schwester zur Hochzeit angehabt, auch meine Mamm hatte es getragen, und meine Großmutter hatte es genäht. Als meine Schwester mich bat, es mir im Hinblick auf meine bevorstehende Hochzeit anzusehen, hatte ich keinerlei Bedenken. Doch wo ich jetzt hier bin und es anprobiere, wird mir klar, dass es keine gute Idee ist.
Ich bin seit achtzehn Jahren nicht mehr amisch. Ein schlichtes Kleid mit dem traditionellen Halsduch zu tragen, das mit Schmucknadeln statt mit Knöpfen oder Druckknöpfen geschlossen wird, kommt mir scheinheilig vor. Als würde ich versuchen, etwas zu sein, das ich nicht bin, um einer Gemeinschaft zu gefallen, deren Wohlwollen ich nicht bekommen werde.
Meine Schwester sieht das natürlich nicht so. Sie ist Traditionalistin, Friedensstifterin und Optimistin in einer Person. Schlimmer noch, sie weiß mit Nadel und Faden umzugehen und ist überzeugt, dieses Kleid trotz meines Widerwillens so anpassen zu können, dass es wie für mich gemacht aussieht und irgendwie allen gefallen wird.
»Dieses Kleid ist ein Stück Familiengeschichte, Katie«, sagt sie. »Mamm hätte es sehr gefallen, dich darin zu sehen, auch wenn du nicht mehr amisch bist.«
»Wahrscheinlich wäre sie schon froh gewesen, dass ich überhaupt heirate.«
Sie verzieht den Mund. »Das auch.«
Ich blicke an mir hinunter, fahre mit den Händen über den etwas knittrigen Stoff und gebe mir Mühe, nicht zu stöhnen. Es ist himmelblau, und der wadenlange Rock ist ein bisschen zu ausladend. »Findest du nicht, dass es etwas zu lang ist?«, frage ich.
»Ich kann den Saum umnähen«, sagt sie. »Das ist leicht gemacht.«
»Oben herum passt es auch nicht so richtig.«
Immer diplomatisch, schiebt Sarah sich eine Stecknadel zwischen die Lippen, hebt den Saum und steckt ihn um. »In der Taille mache ich es etwas enger, das betont die Schultern.«
Das eigentliche Problem hat natürlich nichts mit der Länge oder dem Oberteil zu tun. Seit zwanzig Minuten reden wir um den heißen Brei herum, denn Sarah ist zu nett, um das Thema anzusprechen.
»Wenn dir das Kleid nicht gefällt, ist das okay«, murmelt sie. »Ich nähe dir ein anderes, wenn du willst. Oder du kaufst dir eins.«
»Es ist nicht das Kleid … genaugenommen«, sage ich.
Sie legt den Kopf schief, sieht mir in die Augen. »Was dann?«
Ich hole tief Luft, gehe das Risiko ein. »Das Problem ist, dass es ein amisches Kleid ist und ich keine amische Frau bin. Daran lässt sich nichts ändern.«
Meine Schwester senkt die Hände, sieht mich über den Rand ihrer Lesebrille hinweg an und seufzt. So hat sie mich seit meiner Rückkehr nach Painters Mill schon Hunderte Male angesehen, wenn ich sie verärgert oder enttäuscht habe, was beides zu oft geschieht.
»Du bist Anabaptistin. Das zählt.« Sie nickt entschlossen und wendet sich wieder der Arbeit an dem Kleid zu. »Das Halsduch können wir weglassen.«
Sie meint das dreieckige Cape oder »Brusttuch«, das mit der Spitze nach hinten über den Kopf gestreift und vorne gerafft und mit Nadeln festgesteckt wird. Es ist eines der symbolträchtigsten weiblichen Kleidungsstücke der Amischen, und es würde als unaufrichtig empfunden werden, wenn ich es trüge.
»Das würde helfen«, sage ich, signalisiere Kompromissbereitschaft. Ich schaue auf das Kleid an mir herunter. »Vielleicht passt eine Schärpe oder ein Gürtel dazu?«
»Hmm«, murmelt sie zurückhaltend, nimmt eine Stecknadel aus dem Mund und nutzt sie für den Saum. »An englischen Hochzeitskleidern habe ich schon Rosetten an den Gürteln gesehen, an mennonitischen auch.«
Zum ersten Mal, seit ich hier angekommen bin, verspüre ich einen Anflug von Enthusiasmus. Als ob das mit dem Kleid doch noch funktionieren könnte. »Mir gefällt die Idee mit dem Rosettengürtel.«
Sie lächelt zwar nicht, aber sie nickt, scheint sich mit der Vorstellung anzufreunden. »Hast du dich schon für eine Kopfbedeckung entschieden?«, fragt sie.
»Ich überlege, einfach einen Schleier zu tragen.«
Sie blickt mich mit hochgezogenen Augenbrauen an. Amische Frauen tragen keinen Schleier, nur eine Kopfbedeckung oder eine Kapp.
»Wie die Mennonitinnen«, sage ich, was bedeutet, dass der Schleier damit nur ein kleines, rundes, fünfundzwanzig oder dreißig Zentimeter breites Stück Spitze sein wird, das ich am Hinterkopf festgesteckt tragen werde.
»Das scheint mir ein guter Kompromiss zu sein«, sagt sie schließlich. »Nicht gerade amisch, aber …«
»Anabaptistisch«, vollende ich den Satz.
Wir grinsen uns an, ein seltener Moment schwesterlicher Solidarität, und mir wird warm ums Herz. Fortschritt, denke ich.
Als Kinder standen Sarah und ich uns sehr nahe. Wir arbeiteten und spielten zusammen, hielten den Stürmen des Erwachsenwerdens stand. Sie war für mich da, als mir im Alter von vierzehn Jahren an einem Sommertag ein Nachbarjunge in unserem Haus Gewalt angetan hat, wodurch sich mein Leben grundlegend veränderte und auch das aller anderen Familienmitglieder auf den Kopf gestellt wurde. Auch die Beziehung zu meiner Schwester blieb davon nicht verschont. Das lag aber nicht an ihr, sondern an mir – an dem, was passiert war und was ich danach getan hatte. Wir entfernten uns voneinander, und die Kluft zwischen uns wurde noch größer, als ich vier Jahre später die Amischgemeinde verließ. Ich lief so weit wie möglich weg von meiner Familie und meinen amischen Wurzeln und wurde – so unwahrscheinlich es damals schien – Polizistin in Columbus. Doch meine Wurzeln konnte ich trotz der Bemühungen, alles hinter mir zu lassen, was mir einmal lieb und teuer war, nicht kappen. Und ebenso wenig gelang es mir, die Liebe zu meiner Familie noch länger zu verleugnen. Etwa zwölf Jahre später, als meine Mamm starb, kehrte ich zurück nach Painters Mill. Aber nicht als das rebellische und unbeholfene amische Mädchen, das ich einmal gewesen war, sondern als erwachsene Frau, der die Stelle als Polizeichefin angeboten worden war. Ich ging auf meine beiden Geschwister zu, und nach einer etwas ungelenken Anlaufphase – und einigen Unebenheiten auf dem Weg – machten wir uns daran, unsere Beziehungen wiederzubeleben. Wir sind noch mittendrin, aber wir haben auch schon einiges geschafft: Wir haben uns neu kennengelernt, haben einige Male miteinander gelacht, oft gestritten und ein paar Tränen vergossen.
Die Anprobe heute Morgen ist ein großer Schritt in eine andere Richtung und zu einer neuen Nähe, die sich noch nicht so recht behaglich anfühlt, aber hoffnungsvoll und gut.
Sarah fasst den Stoff an meiner Taille mit einer Stecknadel zusammen. »Falls es dich tröstet, Katie, ich mag deinen Freund. Und William mag ihn auch«, sagt sie und meint ihren Mann. »Das will was heißen.«
»Er heißt übrigens Tomasetti.« Ich lächele sie an. »Und ich mag ihn auch.«
Kichernd schüttelt sie den Kopf.
Das Zwitschern meines Handys unterbricht uns. Sarah hebt den Finger. »Warte, noch eine.« Sie befestigt die letzte Stecknadel am Saum. »Fertig.«
Ich streiche das Kleid glatt, steige vom Hocker und nehme das Telefon, melde mich mit »Burkholder«.
»Chief.« Es ist Lois, die morgens in der Telefonzentrale arbeitet. »Gerade hab ich einen Anruf von einer Autofahrerin entgegengenommen. Sie sagt, mitten auf der Hansbarger Road liegt ein TK.« TK ist Polizeisprech für »toter Körper«; wir benutzen solche Abkürzungen, falls jemand den Polizeifunk abhört.
»Wer ist die MP?«, frage ich und nutze dabei die Abkürzung für »meldende Person«.
»Julie Falknor. Wohnt in Painters Mill. Ich hab sie in der anderen Leitung. Chief, sie ist noch vor Ort und schreit sich die Seele aus dem Leib. Sagt, es gäbe eine Menge Blut und dass sie ihre Kinder dabeihat.«
Lois hat schon in unserem Revier gearbeitet, bevor ich Chief wurde. Sie ist erfahren und bleibt selbst dann cool, wenn alles brennt. Aber heute Morgen spricht sie etwas zu schnell, ihre Stimme überschlägt sich.
»Schicken Sie einen Krankenwagen hin.« Ich streife mir das Kleid von den Schultern, lasse es auf den Boden fallen und greife nach meiner Uniformbluse. »Wer hat Dienst?«
»Glock ist schon auf dem Weg«, sagt sie und meint Rupert »Glock« Maddox, einen meiner erfahrensten Officers. Wenn einer die Situation unter Kontrolle halten kann, dann er.
»Das County soll auch jemanden schicken.« Die Hansbarger Road ist eine ruhige Nebenstraße ein paar Meilen außerhalb von Painters Mill. Sie gehört zwar zu dem Bereich, in dem wir Streife fahren, aber je nach Situation und verfügbaren Arbeitskräften überschneidet sich meine Zuständigkeit mit der des Sheriff’s Departments.
»Sagen Sie der MP, sie soll sich nicht von der Stelle rühren. Ich bin unterwegs.«
Ich nehme meine Hose vom Bett, ziehe sie an, schnalle den Ausrüstungsgürtel um, und als ich in die Stiefel steige, sehe ich meine Schwester an. »Tut mir leid, den Kaffee müssen wir auf nächstes Mal verschieben.«
»Natürlich.« Sie legt den Kopf schief. »Ist etwas passiert?«
»Wahrscheinlich ein Verkehrsunfall.« Ich weiß nicht, ob das der Fall ist, aber da ich keine Ahnung habe, was mich erwartet, formuliere ich es vage. »Danke, dass du mein Gezappel ertragen hast.«
»Immer gerne.« Sie grinst. »Ich wette, dein Zukünftiger kommt auch schon ins Schwitzen.«
»Tatsächlich und im übertragenen Sinn.« Lächelnd umarme ich sie kurz, schnappe mir meine Dienstwaffe vom Bett und gehe zur Tür.
Die wenig befahrene Hansbarger Road führt zwischen einer Weide und einem Maisfeld hindurch und schlängelt sich dann nach Norden in Richtung Millersburg. Ich nehme die Kurve, holpere mit meinem Ford Explorer über welligen Asphalt und Schlaglöcher, Schotter spritzt gegen das Fahrgestell. Weiter vorn sehe ich die blinkenden Lichter von Glocks Streifenwagen, ein silberner SUV parkt schräg, mit der Schnauze nach unten im flachen Straßengraben, die Fahrertür steht weit offen. Der Krankenwagen ist noch nicht eingetroffen, und vom Sheriff’s Department ist auch noch niemand da.
Ich schalte mein Blaulicht ein, parke hinter Glocks Wagen und drücke beim Aussteigen aufs Ansteckmikro. »Zehn-dreiundzwanzig«, sage ich, um die Zentrale wissen zu lassen, dass ich am Einsatzort angekommen bin. Neben Abkürzungen benutzen wir in Painters Mill aus Sicherheitsgründen auch das Zehner-Code-System.
Auf dem Weg zur vermeintlichen Unfallstelle fallen mir gleichzeitig mehrere Dinge auf. Glock steht zwischen dem SUV und seinem Wagen und schreibt etwas in sein Notizbuch. Etwa einen Meter von ihm entfernt liegt eine Person auf der Straße, vermutlich das Opfer, und ein paar Meter weiter weg ein Fahrrad mit verdrehtem Lenker. Eine mir unbekannte Frau steht neben dem Seitenstreifen im Gras, die Hände auf die Knie gestützt. Durch das Fenster des SUV erkenne ich auf dem Rücksitz die Umrisse von Kindern.
»Was ist passiert?«, frage ich Glock, als ich auf ihn zugehe.
Er zeigt auf das Opfer. »Er ist tot«, sagt er und, den Daumen auf die Frau gerichtet: »Sie sagt, dass sie ihn so gefunden hat. Eventuell Fahrerflucht, aber eher unwahrscheinlich.«
Etwas in seiner Stimme macht mich stutzig. Glock mag ein Kleinstadtpolizist sein, aber er besitzt das Urteilsvermögen eines langjährigen Mordermittlers.
»Haben Sie sich das Opfer schon genauer angesehen?«
»Gerade nur so genau, um zu wissen, dass er tot ist.«
Ich nicke ihm zu, gehe weiter, den Blick auf das Opfer gerichtet. Der Mann liegt auf dem Rücken, sein Kopf ist zur Seite gedreht und sein Mund offen. Auf dem Asphalt darunter ist eine Unmenge Blut. Innere Verletzungen, denke ich. Er hat dunkle Hosen mit Hosenträgern an, ein blaues Arbeitshemd, das vorne auch voller Blut ist; unter ihm ragt die Krempe eines Strohhutes hervor. Ein Amischer.
»Hat sie irgendetwas gesehen?«, frage ich mit Blick auf die Frau.
»Nein.«
Ich trete an den Toten heran, betrachte ihn zum ersten Mal aus der Nähe, und ein ungutes Gefühl überkommt mich. Sein Gesicht hat schon die verräterische weiß-blaue Farbe des Todes angenommen. Ein Auge ist offen, noch nicht trüb, sein Blick leer. Das andere Auge ist halb geschlossen. Die blutige Zunge hängt seitlich aus dem Mund.
Mehrere Sekunden stehe ich da, nehme Einzelheiten wahr und versuche zu begreifen, was passiert sein könnte. Sechs Meter entfernt liegt eine offene altmodische Lunchbox aus Blech, daneben ein in Wachspapier gewickeltes Sandwich. So wie es aussieht, ist er von einem Fahrzeug angefahren worden und der Fahrer ist offensichtlich geflüchtet, ohne erste Hilfe zu leisten oder die Polizei zu rufen.
Ich zwinge meinen Blick zurück zum Opfer und auf die tellergroße Blutlache unter dem Mund. Der Blutfleck vorn auf dem Shirt ist zu weit unten, um von Nasenbluten oder einer Zahnverletzung im Mund herzurühren. Etwas stimmt hier nicht.
Ich sehe Glock an. »Haben Sie irgendeine Verletzung am Unterleib bemerkt?«
Er kommt näher, zieht die Augenbrauen zusammen. »Im Stoff ist ein Loch«, sagt er leise.
Mir stellen sich die Nackenhaare auf, und ich merke, wie mein Blick über die hundert Meter entfernten Bäume wandert. Glock ist ein ehemaliger Marine mit zwei Einsätzen in Afghanistan. Wir haben beide ein Training als Rettungssanitäter absolviert, und seinem Gesicht nach zu urteilen, hat er genauso ein ungutes Gefühl wie ich.
Ich blicke hinüber zur SUV-Fahrerin, die noch immer vornübergebeugt dasteht, Erbrochenes vor sich im Gras. Sie kommt mir bekannt vor, ich bin ihr sicher schon in der Stadt begegnet, im Supermarkt, Coffeeshop oder an der Tankstelle.
Ich sehe Glock an. »Haben Sie schon mit ihr geredet?«
»Noch nicht tiefergehend. Ihr Name ist Julie Falknor. Sie sagt, sie wäre auf dem Weg, ihre Kinder in die Schule zu bringen, und spät dran gewesen. Der Mann hätte schon am Boden gelegen, um ein Haar wäre sie über ihn drübergefahren. Sie ist ziemlich durcheinander, deshalb hab ich erst einmal nicht weiter gefragt.«
Als Polizist sollte man niemals voreilige Schlüsse ziehen, schon gar nicht, wenn man gerade an einem potenziellen Tatort eingetroffen ist und sich Dutzende Szenarien abgespielt haben könnten. Es ist nicht immer alles so, wie es im ersten Moment scheint. Ungewöhnliche Unfälle passieren häufiger, als man denkt.
»Zehn-neunundsiebzig«, gebe ich übers Ansteckmikro an die Zentrale durch, fordere so den Leichenbeschauer an.
Ich lasse den Blick über das Feld wandern, den Wald, und wieder macht sich das seltsame Gefühl breit. »Dieses Loch im Hemd«, sage ich und schaue Glock an. »Eine Schusswunde?«
»Hab ich auch gedacht«, sagt er. »Sieht jedenfalls nicht wie eine Verletzung durch den Zusammenprall mit einem Auto aus.«
Einerseits kann ich keinesfalls riskieren, eventuelle Beweise zu kontaminieren. Andererseits kann ich nicht auf den Leichenbeschauer oder die Spurensicherung warten, wenn hier eine Schießerei stattgefunden hat oder ein Schütze noch frei herumläuft.
»Sehen wir ihn uns genauer an«, sage ich, und beide ziehen wir Latexhandschuhe aus den Taschen unserer Ausrüstungsgürtel heraus.
»Achten Sie auf Beweismaterial.« Das tut er zwar sowieso, ich sage es ihm aber trotzdem.
Gemeinsam beugen wir uns über den Toten. Trotz des leichten Windes rieche ich das Blut, das zusammen mit den anderen Ausdünstungen den einzigartigen, unangenehmen Leichengeruch ausmacht. Das Opfer liegt mit seitlich verdrehtem Kopf auf dem Rücken, das rechte Bein ist im Knie gebeugt, beide Arme sind über den Kopf gestreckt.
Ich gehe in die Hocke, wobei ich die vertraute Abscheu beim Anblick eines gewaltsamen Todes spüre. Dieser Mann hier war jung, höchstens um die zwanzig Jahre alt, sein Mund ist voll dunklem Blut, und wieder frage ich mich, ob er innere Verletzungen hat.
»Abgebrochener Vorderzahn.« Mit zusammengekniffenen Augen zeigt Glock auf den Mund. »Aufgeschlitzte Lippe.«
»Könnte das von einer Schlägerei stammen?«, frage ich.
»Die Verletzungen am Mund könnten vom Sturz vom Fahrrad stammen«, sagt er. »Das Loch im Hemd sieht eher nicht so aus.«
Der Mann hat keinen Bart, was bedeutet, dass er unverheiratet war. Ich muss an seine Familie denken, seine Eltern, und der Knoten in meinem Magen zieht sich noch fester zusammen.
Mit behandschuhten Händen ziehe ich das Hemd des Toten so weit aus dem Hosenbund, dass sein Unterleib zu sehen ist: weißes Fleisch und dunkle Haare, die an der Stelle, wo der Stoff auf der Haut lag, mit einer dünnen Schicht Blut überzogen sind. Mein Blick bleibt an einer seltsam gezackten Wunde ein paar Zentimeter über dem Nabel hängen.
»Die Wunde hier«, höre ich mich sagen. »Komische Form.«
»Messer?«, fragt Glock sich laut.
»Möglich.« Doch selbst das ist weit hergeholt. Bislang ist nur sicher, dass es sich hier nicht um einen einfachen Unfall mit Fahrerflucht handelt. Ich lasse das Hemd los, es fällt zurück auf den Körper.
Nach einem tödlichen Unfall oder Verbrechen gehört es zu den dringendsten Aufgaben der Polizei, das Opfer zu identifizieren, um die Angehörigen benachrichtigen zu können. Normalerweise würde ich auf den Leichenbeschauer warten, aber da ich schon einmal hier bin, beschließe ich, jetzt nachzusehen.
»Lassen Sie uns nach seinem Ausweis suchen.« Ich beuge mich vor, greife in die linke vordere Hosentasche und ziehe ein Klappmesser und ein paar Münzen heraus; in der rechten ist nur ein Taschentuch.
Ich blicke Glock an. »Helfen Sie mir, ihn auf die Seite zu drehen, damit ich die Gesäßtaschen checken kann.«
»Okay.«
So vorsichtig wie möglich bewegen wir den Toten nur so viel, dass ich an die hinteren Taschen komme. Ich ziehe eine ramponierte lederne Geldbörse heraus, in der hinter dem Plastikfenster ein fotoloser Führerschein steckt, ausgestellt von der Kfz-Behörde in Ohio. Solche Ausweise werden von Amischen benutzt, die sich aus religiösen Gründen nicht fotografieren lassen.
»Aden Karn«, sage ich langsam, denn irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. »Einundzwanzig Jahre alt.«
»Verdammt jung.« Glock schüttelt den Kopf, sieht mich an. »Kennen Sie ihn? Oder seine Familie?«
»Ich kenne seine Eltern.« Ich komme aus der Hocke hoch, bin unerwartet erschüttert und hoffe, man sieht es mir nicht an. »Nicht sehr gut, aber als Teenager habe ich für sie gearbeitet.«
»Wohnt er noch zu Hause?«, fragt Glock.
Ich blicke auf den Führerschein und schüttele den Kopf. »Die Karns wohnen in der Stadt nicht weit von ihrem Laden. Dieser junge Mann lebt laut Ausweis ein paar Meilen von hier entfernt.«
Ich brauche einen Moment, um mich zu sammeln, lasse den Blick über das Feld schweifen und den Schwarm Krähen, die in den Bäumen krächzen, spüre Glocks Blick auf mir. Seit ich in Painters Mill Polizeichefin bin, haben wir fast jeden Tag zusammengearbeitet. Wir sind zwar keine Freunde im herkömmlichen Sinn, aber uns verbindet etwas, das tiefer geht als Freundschaft, ein großes Vertrauen, eine Art Seelenverwandtschaft, der wir beide verpflichtet sind. Wir sprechen nicht darüber, aber sie ist trotzdem da, und in diesem Moment bin ich dankbar dafür, denn allein schon Glocks Anwesenheit nimmt etwas von der Last, die ich auf meinen Schultern spüre.
Vorsichtig entfernen wir uns von dem Toten, versuchen, so gut es geht, auf unseren alten Fußstapfen zurückzugehen.
»Rufen Sie das Department an, sie sollen ein paar Deputys schicken«, sage ich und streife die Handschuhe ab. »Das ganze Gebiet hier muss mit Absperrband gesichert und die Straße gesperrt werden.«
»Ich kümmere mich drum.«
In der Ferne ertönen Sirenen. Ich blicke zu dem SUV, die Kinder darin scheinen noch ziemlich klein zu sein und werden vermutlich bereits unruhig. Sie können den Toten sehen, aber ich kann ihn nicht zudecken, ohne zu riskieren, mögliche Spuren zu kontaminieren.
»Ich spreche mit der Zeugin«, sage ich.
Glock nickt und geht zum Streifenwagen.
Ich nähere mich der Frau. Inzwischen hat sie sich aufgerichtet, aber ihr Gesicht ist kreidebleich.
»Ma’am?«, sage ich. »Sind Sie okay?«
»O mein Gott«, sagt sie mit zittriger Stimme. »Tut mir leid, dass ich mich nicht besser im Griff hab. Der arme Kerl, ist er tot?«
»Ich fürchte ja«, sage ich.
Sie ist etwa Mitte dreißig und ungeschminkt, hat das braune Haar zum Pferdeschwanz zusammengebunden und trägt ein rosa Sweatshirt, eine Yogahose und Flip-Flops.
»Können Sie mir sagen, was passiert ist?«, frage ich.
Sie wirft einen Blick zu dem toten Mann, dann sieht sie mich an, hat wieder Tränen in den Augen. »Ich war wie immer mit den Kindern unterwegs zur Schule, ich fahre gern hier entlang, weil die Gegend so schön ist. Die Kids lieben die Enten in dem Teich dort drüben und haben schon allen einen Namen gegeben.« Sie wischt sich mit dem Taschentuch, das sie in der Hand hält, die Tränen von den Wangen. »Wir fahren also die Straße entlang, als meine Siebenjährige ruft: ›Guck mal, Mommy, der Mann hatte einen Fahrradunfall.‹«
»Mein Gott, ich hätte ihn fast überfahren.« Sie schluchzt auf. »Ich konnte gerade noch rechtzeitig bremsen und an den Rand fahren, und … da lag er. Und dann das viele Blut.«
Da sie das Ganze zunehmend aufregt, muss ich mich beeilen. »Haben Sie sonst noch jemanden in der Gegend gesehen? Oder andere Autos, einen Buggy?«
»Nein.« Sie schüttelt den Kopf »Auf dieser Straße fährt so gut wie nie jemand, deshalb nehme ich sie ja. Kein Verkehr.«
Ich sehe an ihr vorbei zu dem Krankenwagen, der jetzt gleichzeitig mit einem Streifenwagen vom Holmes County Sheriff’s Department hinter meinem Explorer hält. Am liebsten würde ich sofort hingehen. Doch in der Hoffnung, dass ihr weitere Details einfallen, stelle ich ihr noch ein paar Minuten lang die gleichen Fragen auf unterschiedliche Weise, aber sie sagt immer dasselbe.
Ich ziehe meine Visitenkarte aus der Gürteltasche, schreibe meine private Handynummer auf die Rückseite und reiche sie ihr. »Wenn Ihnen noch irgendetwas einfällt, selbst wenn es Ihnen unwichtig erscheint, rufen Sie mich bitte an.«
»Mache ich«, versichert sie mir.
Ich gehe zu den beiden Sanitätern und dem Deputy, die einige Meter von dem Toten entfernt stehen. Den Deputy kenne ich, wir hatten in den letzten Jahren ein paarmal miteinander zu tun. Für einen Anfänger hat er eine ziemlich große Klappe, ist aber generell zuverlässig. Letzten Sommer haben wir bei einer Benefizveranstaltung der örtlichen Bibliothek einen ganzen Nachmittag lang gemeinsam Bratwürste und Burger für die Kinder gebraten.
»Chief Burkholder.«
»Hi, Matt.« Während wir uns mit Handschlag begrüßen, fährt hinter mir die Frau weg, und Glock nähert sich uns.
»Der Typ ist mausetot«, sagt der Deputy. »Was ist denn passiert? Unfall mit Fahrerflucht? Und wo kommt das ganze Blut her?«
»Vermutlich wurde er erschossen«, sage ich, »oder erstochen. Aber das ist noch nicht bestätigt.«
»Heilige Scheiße.« Er wirft Glock einen Blick zu, als würde er meiner Einschätzung nicht ganz trauen.
Glock starrt ihn mit ausdrucksloser Miene an.
»Sperren Sie bitte die Zufahrtsstraßen ab«, sage ich, an den Deputy gewandt, »niemand darf rein oder raus, außer der Leichenbeschauer und die Polizei.«
»Ähm … klar.« Sichtlich verärgert, dass er zu einer Anfängeraufgabe verdonnert wurde, geht er zu seinem Streifenwagen.
Glock schenkt mir ein Gut-gemacht-Lächeln.
»Hier in der Gegend gibt es nicht viele Häuser, aber wir sollten uns trotzdem umhören. Rufen Sie Pickles an, er soll Ihnen helfen.« Roland »Pickles« Shumaker ist mein einziger Officer in Teilzeit. »Gehen Sie zu jeder Farm, halten Sie sämtliche Fahrzeuge an, auch Fußgänger, reden Sie mit allen, die gerade auf ihren Feldern arbeiten. Finden Sie heraus, ob irgendwer irgendwas gesehen oder gehört hat, lassen Sie sich Namen und Kontaktinfos geben.«
»Mach ich«, sagt Glock und geht zum Streifenwagen.
Ich nehme mein Handy und mache aus einigem Abstand mehrere Fotos von dem Toten aus unterschiedlichen Perspektiven. Zum Schluss gehe ich noch einmal langsam um ihn herum, zoome den Blutfleck vorn im Hemd heran, wobei ich mich besonders auf das Loch im Stoff konzentriere, und entdecke zwei weitere Details, auf die ich vorher nicht geachtet hatte. Aus der Gesäßtasche der typisch amischen Hose hängen lederne Arbeitshandschuhe heraus, er war also vermutlich auf dem Weg zur Arbeit. Unter ihm liegt ein zerknitterter Strohhut, auf den er wohl draufgefallen ist.
Während ich mir die Details am Tatort anschaue, kommen mir folgende Fragen: War Karn ein Zufallsopfer? Oder hatte es jemand auf ihn abgesehen? War er mit dem Fahrrad unterwegs zur Arbeit, und jemand ist vorbeigefahren und hat ihn erschossen? Hat ein Fahrzeug angehalten, und es ist zu einer Auseinandersetzung gekommen? Oder war das einer dieser ungewöhnlichen, absolut merkwürdigen Unfälle? Zum jetzigen Zeitpunkt ist nur eines sicher, nämlich dass die verantwortliche Person eine Gefahr für die Gemeinschaft darstellt und es meine Aufgabe ist, sie zu finden, bevor sie noch mehr Unheil anrichtet.
2. Kapitel
Während ich auf den Leichenbeschauer warte, mache ich in einem Radius von fünfzehn Metern um den Toten Aufnahmen von der Umgebung – dem Fahrrad, der Lunchbox, dem Strohhut, den Reifenspuren auf dem Schotterstreifen und sogar von der Bierflasche im Straßengraben und dem Papierfetzen im Gras. Als dann der Cadillac Escalade des Leichenbeschauers vor dem Absperrband anhält, bin ich erleichtert.
Ich kenne Doc Coblentz, seit ich Polizeichefin in Painters Mill bin. Als Kinderarzt mit einer gutgehenden Praxis und einem exzellenten Ruf ist er einer von fünf Ärzten im Ort und eine Art Ikone. Er ist eine starke Persönlichkeit, und die Kinder, die er behandelt, lieben ihn ebenso sehr wie deren Eltern. Zudem ist er Stammgast im LaDonna’s Diner, und es heißt, dass er an den Wochenenden auf dem Bauernmarkt einen Stand betreibt und Kochunterricht gibt. Er und seine Frau nehmen rege am gesellschaftlichen Leben in der Stadt teil und sind großzügige Unterstützer der örtlichen Bibliothek und des Tierheims. Trotz seiner Arbeit als Leichenbeschauer ist er einer der optimistischsten Menschen, die ich kenne.
»Guten Morgen, Chief.« Mit der Arzttasche in der Hand, duckt er sich unter dem Absperrband hindurch.
»Gut, dass Sie da sind, Doc.«
»Hat mich davor bewahrt, die Pancakes zu essen, die ich gerade im Diner bestellt hatte.« Er streicht sich über den runden Bauch. »Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie meiner Frau nicht verraten, dass ich dort war.«
»Meine Lippen sind versiegelt.«
Doc Coblentz ist ein korpulenter Mann. Er trägt wie immer Khakis, ein Button-down-Shirt, dessen Knöpfe über seinem stattlichen Bauch spannen, und eine der hässlichsten Krawatten, die ich je gesehen habe.
Er bleibt vor mir stehen. »Fahrerflucht?«, fragt er, während wir uns noch die Hand schütteln und sein Blick zum Opfer wandert, um sich einen ersten Eindruck von der Position der Leiche und der Menge an Blut zu verschaffen. Ich berichte ihm das wenige, was ich weiß. »Am Unterleib ist eine Wunde wie von einer Kugel oder einem Messerstich, nur dass der Rand seltsam ausgefranst ist.«
Er zieht die Augenbrauen hoch, nicht vor Überraschung, sondern aus Neugier. Wir sind beide schon lange genug dabei, um auf Überraschungen aller Art gefasst zu sein. »Dann wollen wir mal sehen, was uns das Opfer zu erzählen hat.«
Er stellt die Arzttasche auf den Boden, nimmt zwei eingeschweißte Packungen Schutzkleidung mit Einweganzug, Haarhaube, Plastiküberzügen für Schuhe und Latexhandschuhen heraus und reicht mir eine davon. Dieser Tatort ist zwar im Freien und den Elementen ausgesetzt, trotzdem sollte er möglichst nicht noch zusätzlich kontaminiert werden. Wir ziehen die Sachen über, er nimmt die Tasche, und wir nähern uns dem Opfer.
»Große Mengen Blut aus dem Mund«, murmelt er.
Ich erzähle ihm von dem abgebrochenen Zahn, den Glock bemerkt hat. »Innere Verletzungen?«
»Möglich, falls er angefahren wurde. Vielleicht hat er sich auch beim Sturz auf die Zunge gebissen. Oder eine gebrochene Rippe hat seine Lunge durchstochen, etwas in der Art.«
Als wir den Toten erreichen, stellt Doc Coblentz die Tasche ab und kniet neben ihm nieder. »Ich muss ja nicht extra betonen, dass alles, was ich jetzt sage, vorläufig und inoffiziell ist.« Er sieht mich über den Rand seiner Brille hinweg streng an. »Ich denke nur deshalb laut, weil es Ihnen möglicherweise hilft, sofort mit den Ermittlungen zu beginnen, falls hier ein Verbrechen vorliegt. Ich werde also nur benennen, was ich sehe. Eine abschließende Beurteilung gibt es nach der Autopsie.«
»Verstanden.«
Er wendet sich dem Toten zu, hebt mit einer behandschuhten Hand den Saum seines Hemdes an und legt die Wunde offen, die ich zuvor schon gesehen habe. Wir beugen uns gleichzeitig vor, und diesmal betrachte ich sie mir genauer. Die Verletzung ist nicht rund wie bei einer Schusswunde, sondern hat die Form eines Kreuzes – zweieinhalb Zentimeter lange Linien, die sich in der Mitte kreuzen – und etwa den Durchmesser eines Vierteldollars.
»Haben Sie eine Idee, was das sein könnte?«, frage ich leise.
Der Doktor beugt sich noch näher heran, kneift die Augen zusammen. »Eine Art Stichwunde.«
Ich starre auf die Verletzung und versuche, mir einen Verkehrsunfall vorzustellen, der so eine Wunde verursacht haben könnte. Ein T-Pfosten, der über die Ladefläche eines Pick-ups hinausragt? Das Opfer rast mit hoher Geschwindigkeit hinein und spießt sich selbst auf? Der Fahrer bekommt Panik und verlässt fluchtartig den Unfallort?
Aber dann fällt mein Blick auf den abgebrochenen Zahn und die aufgeschlitzte Lippe. »Vielleicht hat es einen Streit oder ein Handgemenge gegeben, und er wurde niedergestochen?«, sage ich.
Doc Coblentz verzieht das Gesicht, schaut mich nachdenklich an. »So eine Verletzung habe ich in all meinen Berufsjahren nur ein einziges Mal gesehen, und das war bei einem Jagdunfall vor acht oder neun Jahren. Da hatte sich ein junger Mann mit einer Armbrust in den Fuß geschossen.« Er zeigt mit dem Kopf in Richtung Wunde. »Das Einschussloch sah genauso aus wie das hier.«
Ich starre ihn fassungslos an. Die Vorstellung lässt mich so sehr frösteln, dass ich eine Gänsehaut an den Armen bekomme. Ich blicke hinab auf den toten Mann, und eine Menge übler Szenarien drängen sich mir auf. »Dann wurde er mit einem Pfeil getötet?«
»Die genaue Bezeichnung lautet Bolzen. Es sieht so aus, als ob dieser Bolzen hier mit einer sogenannten Jagdspitze mit vier Klingen bestückt war.« Er zeigt auf die Wunde. »Die sind scharf wie Rasiermesser und richten einen enormen Schaden an.«
»Kann es trotzdem ein Unfall gewesen sein?«, frage ich.
»Möglich schon.« Er zuckt mit den Schultern, wirkt skeptisch. »Wenn gerade jemand Schießübungen oder Zielschießen gemacht hat. Aber wie groß die Reichweite einer Armbrust ist, weiß ich nicht.«
Ich habe noch nie eine Armbrust benutzt und war auch nur als Zuschauerin dabei, wenn damit geschossen wurde. Doch ich kenne Jäger, die damit jagen, Amische eingeschlossen. Es ist eine enorm leistungsfähige Waffe, leicht zu handhaben, präzise und ausgesprochen tödlich. Mein Kopf tut sich mit der Vorstellung schwer, dass dieser Mann damit getötet worden ist.
Ich blicke mich um. »Wenn er mit einer Armbrust erschossen wurde, wo ist dann der Bolzen?«
»Ich bin kein Experte, Kate, aber ich weiß, dass ein Bolzen, der von einer leistungsstarken Armbrust abgefeuert wird, sich mit so hoher Geschwindigkeit fortbewegt, dass er den Körper durchdringen und weiterfliegen kann.«
Trotz der wärmenden Sonne läuft es mir kalt den Rücken hinunter. Ich ziehe vorsichtig mein Handy aus der Jackentasche und mache vier Nahaufnahmen der Wunde, wobei mein Verstand die Bedeutung dessen zu verarbeiten versucht, was ich gerade erfahren habe.
»Doc«, sage ich langsam, »wenn der Bolzen durchgegangen ist, muss es eine Austrittswunde geben, richtig?«
Er nickt. »Ja.«
»Können wir nachsehen?«
»Wir rollen ihn vorsichtig auf die Seite. Ich packe ihn bei der Schulter, Sie bei der Hüfte. Wenn er stabil liegt, hebe ich den Hemdzipfel hoch, und wir sehen schnell nach.«
Der Doktor umfasst die Schulter des Toten, nickt mir zu. Als ich die Hände unter seine Hüfte schiebe, wird mir leicht mulmig. Der junge Mann ist noch warm, was mich brutal daran erinnert, dass er vor kurzem noch gelebt hat, eine Zukunft voller Hoffnungen und Träume hatte und es Menschen gibt, die ihn lieben. Dann nickt Doc Coblentz wieder, ich verbanne die Gedanken aus meinem Kopf, und wir rollen den Toten auf die Seite. Das Hemd löst sich mit einem schmatzenden Geräusch vom Asphalt. Eine Hand weiter an der Schulter, zieht Coblentz den Hemdzipfel mit der anderen hoch bis zu den Schulterblättern.
Und wirklich, links neben dem Rückgrat kommt eine etwas kleinere kreuzförmige Wunde zum Vorschein.
»Das scheint die Austrittswunde zu sein«, sagt der Doc.
»Wenn der Bolzen also glatt durchging«, sage ich, »müsste er doch hier irgendwo sein.«
»Klingt logisch.«
Was unser erster physischer Beweis einer Verletzung durch eine Armbrust wäre.
Ich drücke aufs Ansteckmikro am Revers und kontaktiere mein Revier. »Rufen Sie Skid zu Hause an«, sage ich. Chuck »Skid« Skidmore ist der Officer, der die zweite Schicht übernimmt. »Sagen Sie ihm, wir brauchen ihn auf der Hansbarger.«
»Verstanden.«
Ich blicke mich suchend nach dem Deputy um, den ich dazu verdonnert hatte, die Straßensperren einzurichten. »Einen Moment, Doc«, sage ich, als ich ihn entdecke, und gehe zu ihm hin.
»Matt?«
»Yeah, Chief?«
»Doc Coblentz vermutet, dass der Mann mit einer Armbrust umgebracht wurde«, sage ich.
»Ach du Scheiße.«
»Das ist zwar noch unbestätigt, aber da es eine Eintritts- und Austrittswunde gibt, kann der Bolzen glatt durchgegangen sein.«
»Sie wollen, dass ich mich danach umsehe?«, fragt er.
Ich nicke und blicke zum Fahrrad, frage mich, in welche Richtung das Opfer gefahren sein könnte. »Schwer zu sagen, wo er hinwollte, deshalb fangen Sie am besten mit dem Waldstück östlich der Straße an.«
»Ich lege gleich los.«
»Einer meiner Officer ist unterwegs und hilft Ihnen.«
»Alles klar.«
Ich danke ihm und gehe zurück zu Doc Coblentz. »Können Sie schon sagen, wie lange er ungefähr tot ist?«
»Nicht lange«, sagt er. »Es gibt keine Leichenflecke, und die Totenstarre hat auch noch nicht eingesetzt. Beides beginnt etwa zwei Stunden nach Eintritt des Todes.«
»Dann ist es also gerade erst passiert«, murmele ich.
Der Doktor betrachtet sich eingehend die tellergroße Blutlache, zieht dann eines der Augenlider hoch und seufzt. »Schätzungsweise vor ein oder zwei Stunden, Kate. Natürlich gibt es noch eine Menge Variablen, der Zeitrahmen ist also nicht in Stein gemeißelt. Ich kann Ihnen mehr sagen, sobald ich seine Körpertemperatur gemessen habe.«
Ich blicke hinab auf den Toten und spüre, wie sich eine dumpfe Angst in mir ausbreitet. Die Position der Leiche, das Fahrrad, die Lunchbox, das viele Blut vor seinem Mund. In dem Moment bemerke ich auf dem Asphalt hinter seinem Kopf den münzgroßen Blutfleck.
»Doc?« Ich zeige auf den Fleck. »Ist am Hinterkopf auch eine Wunde?«
Coblentz beugt sich etwas vor und bewegt leicht den Kopf. Tatsächlich ist hinten ein Haarbüschel blutgetränkt. Mit den Fingerspitzen teilt er die Haare, so dass die Kopfhaut zu sehen ist. »Sieht wie eine Platzwunde aus.«
»Kann er sich die beim Sturz zugezogen haben?« Aber noch als ich die Frage stelle, wird mir klar, dass das keine Stelle ist, auf die er gefallen sein kann.
»Wohl kaum, sieht auch aus wie eine Stichwunde«, sagt er.
Ich sehe ihn verwirrt an – und erinnere mich an einen Selbstmord, den ich vor mehreren Jahren untersucht habe. Ein Mann hatte sich die Mündung seines Revolvers in den Mund gesteckt und abgedrückt. Ich habe die schlimme Kopfverletzung vor Augen, die Flugbahn der Patrone, aber am wichtigsten, die Stelle der Austrittswunde.
»Doc, kann es sein, dass es noch eine Verletzung gibt … in seinem Mund?«
»Das würde das viele Blut erklären.« Er verzieht das Gesicht, als wüsste er, was ich mir gerade vorstelle, und blickt auf den Toten. »Kate, wenn dieser Mann mit dem Bolzen einer Armbrust getötet wurde, wie wir vermuten, kann man mit einiger Sicherheit sagen, dass er sich das nicht selbst zugefügt hat.«
»Selbst wenn es sich um einen bizarren Unfall handelte, müsste jemand mit einer Armbrust geschossen haben.«
»Das Ganze ist ein echtes Rätsel.« Doc Coblentz setzt sich zurück auf die Fersen, einen perplexen Ausdruck im Gesicht. »Ich kann das alles hier erst erklären, wenn ich ihn auf dem Seziertisch habe.«
»Wir müssen seine Hände in Plastiktüten packen«, sage ich.
»Ja.«
Während der Doktor sich an die Arbeit macht, lasse ich den Blick über die Umgebung des Tatorts schweifen. Inzwischen ist ein zweiter Deputy des Sheriff’s Department angekommen und hämmert Stahlstäbe in den Boden, um einen letzten offenen Bereich mit Absperrband sichern zu können. Ich entdecke Skid, der mit einem weiteren Deputy den Wald nach dem Bolzen einer Armbrust zu durchforsten scheint. Mein Blick wandert weiter über das offene Feld, den Teich mit der flügelschlagenden Entenfamilie und über die Silhouette der Bäume, die entlang des Zauns wachsen. Obwohl die Umgebung dieses Straßenabschnitts ausgesprochen idyllisch anmutet, hielt jemand diesen Ort für geeignet, mit einer Armbrust auf einen jungen amischen Mann zu schießen – und das vielleicht sogar zweimal. Jemand, der die Kaltblütigkeit besessen hat, den Bolzen zu entfernen und mitzunehmen.
Ich hole mein Handy hervor und rufe im Revier an.
Lois nimmt nach dem ersten Klingeln ab. »Hey, Chief. Irgendwas Neues über diesen TK?«
»Ich möchte, dass Sie Aden Karn durch LEADS laufen lassen«, sage ich. LEADS ist das Akronym für die Datenbank der Strafverfolgungsbehörden. Ich buchstabiere Vor- und Zuname. »Checken Sie, ob ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt, ob er in Schwierigkeiten steckt oder ob die Polizei schon öfter mit ihm zu tun hatte.« Ich nenne ihr die Adresse aus seinem Ausweis. »Finden Sie heraus, wem die Immobilie gehört und ob dort sonst noch jemand wohnt.«
»Wird erledigt.«
Ich lege auf, schiebe das Handy zurück in die Tasche und blicke zu Doc Coblentz. »Können Sie schon sagen, wann Sie die Autopsie machen können?«, frage ich.
»Morgen.« Er erhebt sich langsam aus der Hocke, sieht mich an. »Benachrichtigen Sie die Angehörigen?«
»Ja.«
Wir starren uns etwas zu lange an, kommunizieren stumm das Unbehagen, das diese Pflicht mit sich bringen wird. Doch ich weiß, dass auch er schon in meiner Haut gesteckt hat. Er ist Kinderarzt, und manchmal nützt selbst alles medizinische Wissen dieser Welt nichts, um Eltern diese eine schlimme Nachricht ersparen zu können. Dennoch ist die emotionale Last, die mit dieser Pflicht einhergeht, nichts im Vergleich zu dem Schmerz, den das Schicksal den Empfängern der Nachricht antut.
Dann macht der Doktor einen Schritt auf mich zu, legt mir die Hand auf die Schulter und drückt sie. »Ich melde mich bei Ihnen, sobald ich mehr weiß.«
3. Kapitel
Angela und Lester Karn wohnen mitten in Painters Mill, zwei Blocks entfernt von ihrem Schuhgeschäft The Gentle Cobbler. In meinem letzten Sommer in Painters Mill – ich war siebzehn Jahre alt, unzufrieden und oft in Schwierigkeiten – hatte ich kurz für sie gearbeitet, denn meine Eltern glaubten, eine zusätzliche Aufgabe wäre gut für mich. Immerhin waren die Besitzer von The Gentle Cobbler Amische, was jedoch nicht dazu führte, dass ich eine gute Angestellte wurde, sondern die meiste Zeit Mist gebaut habe. Schließlich wurde ich dabei erwischt, dass ich heimlich Riemchensandalen aus dem Laden mitgenommen und bei einer großen Outdoor-Party getragen hatte. Am nächsten Tag wollte ich sie zurück ins Regal stellen, aber einer der hohen Absätze war abgebrochen. Lester warf mich raus, was mich aus meinem Elend erlöste und das Ende meiner Karriere im Einzelhandel bedeutete.
Als Erwachsene habe ich in ihrem Geschäft häufiger etwas gekauft. Erst letzten Winter hatte Tomasetti ein Paar Arbeitsstiefel erstanden, und wir hatten uns eine Weile mit den Karns unterhalten. Lester und Angela sind ein nettes Paar und außer sonntags jeden Tag im Laden. Zufällig weiß ich, dass sie erst um zehn Uhr morgens öffnen, was in zwanzig Minuten ist, also mache ich mich gleich auf den Weg.
Ich bin so in Gedanken bei der vor mir liegenden Aufgabe, dass ich beim Einbiegen in die Main Street die altmodischen Straßenlaternen und Parkuhren kaum wahrnehme. Ich parke auf dem Platz gleich vor dem Laden, bleibe für einen Moment im Auto sitzen und wünsche nichts mehr, als dass Aden Karn noch leben würde und ich nicht gleich das Leben seiner Eltern zerstören müsste. Obwohl in der Tür noch das GESCHLOSSEN-Schild hängt, brennt schon Licht im Laden, und ich kann die Silhouette von jemandem sehen, der sich bewegt.
Meine Beklemmung wächst, als ich den Bürgersteig überquere und zum Eingang gehe. Durch das Schaufenster sehe ich Angela Karn, die hinter dem Tresen mit der Kasse zugange ist. Lester steht auf einem Tritthocker und sortiert Schuhkisten ins Regal. Ich klopfe an die Scheibe.
Der amische Mann dreht sich um und macht große Augen. Dann lächelt er erfreut, was mich zusätzlich schmerzt. Ich warte, bis er vom Tritthocker steigt und forschen Schritts zur Tür kommt. Lester ist jetzt Mitte fünfzig, hat einen beträchtlichen Bauch und einen graumelierten Vollbart, so wie es bei verheirateten amischen Männern üblich ist. Er trägt ein weißes Hemd, graue Hosen mit Hosenträgern, und da er in der Öffentlichkeit arbeitet, hat er anstelle des typischen flachkrempigen Strohhuts einen schwarzen Filzhut auf.
Ich atme tief durch, und dann geht auch schon die Tür auf. Ich nehme kaum das Klingeln der Türglocke wahr, kaum den Duft von Leder, Schuhcreme und Eukalyptus, der mir entgegenweht.
»Guder mariye, Katie«, sagt er und hält mir die Hand hin. Guten Morgen. »Kumma inseid.« Komm herein.
»Hallo, Lester.« Wir schütteln uns die Hand, und ich folge ihm in den Laden.
»Wir haben die Stiefel noch nicht verkauft, die du anprobiert hast.« Er geht zurück zum Tritthocker, muss noch einiges erledigen, bevor er den Laden aufschließt. »Der Sale beginnt morgen, falls du interessiert bist. Zwanzig Prozent Rabatt und kostenloses Weiten, wenn es nötig ist.«
Ich antworte nicht, sondern blicke zu seiner Frau, die noch immer hinterm Tresen steht und mich ansieht, als ahne sie, dass ich nicht hier bin, um Schuhe zu kaufen.
»Ich fürchte, ich habe schlimme Nachrichten«, höre ich mich sagen.
Lester bleibt abrupt stehen, dreht sich um und sieht mich an.
»Heute Morgen ist etwas passiert«, sage ich. »Aden ist tot. Es tut mir sehr leid.«
Lester stößt einen Laut aus, halb nach Luft schnappend, halb lachend, als wäre er unsicher, ob ich vielleicht scherze. Er sieht mich zweifelnd an. »Was? Aden? Aber … wie kann das sein?«
Angela kommt hinter dem Tresen hervor, eilt zu ihrem Mann, Misstrauen und Entsetzen im Gesicht. »Was redest du da? Meine Güte, wie kannst du so etwas Verrücktes sagen? Vor ein paar Tagen haben wir ihn erst gesehen. Es ging ihm gut.«
Bevor mir klarwird, was ich tue, nehme ich die Hand der Frau in meine und drücke sie sanft. »Es ist heute Morgen passiert, auf der Hansbarger Road. Ich glaube, er war auf dem Weg zur Arbeit.«