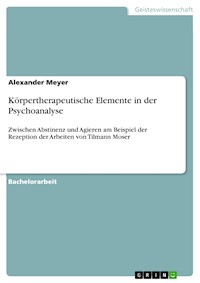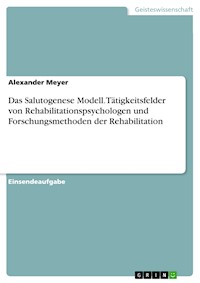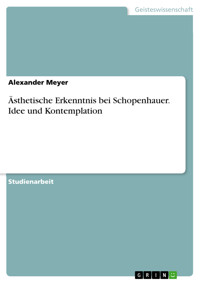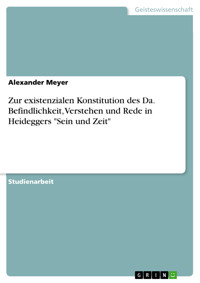
Zur existenzialen Konstitution des Da. Befindlichkeit, Verstehen und Rede in Heideggers "Sein und Zeit" E-Book
Alexander Meyer
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Philosophie - Philosophie des 20. Jahrhunderts, Note: 1,0, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Philosophisches Seminar), Veranstaltung: Interpretationskurs: Heidegger, "Sein und Zeit", Sprache: Deutsch, Abstract: „Das Dasein ist seine Erschlossenheit.“ Mit dieser Bestimmung von Dasein eröffnet Heidegger in seinem frühen Hauptwerk "Sein und Zeit" (1927) einen aufgeschlossenen Möglichkeitshorizont von Dasein. Dabei stellt sich aber bereits die Frage, was er damit genau im Einzelnen meint. Was meint Heidegger, wenn er von Erschlossenheit spricht? Wie ist diese strukturiert? Um diese Fragen der von Heidegger aufgezeigten Formen der Erschlossenheit soll es im Folgenden gehen, also um die Befindlichkeit, das Verstehen und die Rede als existenziale Strukturen des Daseins, durch welche sich dieses in seiner Erschlossenheit zeigt. Da diese drei Strukturen nur zusammen die unmittelbare Erfahrung des eigenen Seins ausmachen, d.h. sie sind nicht als eigenständige Strukturen zu betrachten, werden sie auch hier nur zusammengehörig zur Sprache gebracht. Zunächst soll also die Befindlichkeit im Sinne Heideggers betrachtet und anschließend anhand der Furcht deutlicher herausgestellt werden. Anschließend soll aufgezeigt werden, was Heidegger als Verstehen bezeichnet und inwiefern sich dieses Moment der Erschlossenheit auf die Befindlichkeit beziehen lässt. Daraufhin soll diese zweite Struktur der Erschlossenheit anhand der Auslegung und der Aussage vertieft demonstriert werden. – Es ist also bereits deutlich zu erkennen, dass diese vorliegende Arbeit dem strukturellen Aufbau Heideggers in "Sein und Zeit" folgt und folglich dessen Denkweg hinsichtlich der drei Formen der Erschlossenheit versucht nachzuvollziehen oder besser: mitzuvollziehen. Durch diese zweite Form der Erschlossenheit des Daseins, d.h. durch das Verstehen, wird deutlich werden, worauf sich das Dasein versteht, nämlich auf sein eigenstes Sein im Sinne eines entwerfenden Seinsvollzugs. Als drittes Moment der Erschlossenheit wird anschließend die Rede thematisiert werden. Dadurch wird sich zeigen, dass das Dasein durch die Rede hindurch die beiden zuerst untersuchten Erschlossenheitsstrukturen artikuliert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
I. Erstes Strukturmoment der Erschlossenheit: die Befindlichkeit
1. Da-sein als Befindlichkeit
2. Ein Modus der Befindlichkeit: die Furcht
II. Zweites Strukturmoment der Erschlossenheit: das Verstehen
1. Da-sein als Verstehen
2. Auslegung
3. Ein Modus der Auslegung: die Aussage
III. Drittes Strukturmoment der Erschlossenheit: die Rede
1. Rede und Sprache
Schluss: Befindlichkeit, Verstehen und Rede – ein Dreigespann?
Literaturverzeichnis
Primärliteratur:
Sekundärliteratur:
Einleitung
„Das Dasein ist seine Erschlossenheit.“[1]
Mit dieser Bestimmung von Dasein eröffnet Heidegger in seinem frühen Hauptwerk Sein und Zeit (1927 erschienen) einen aufgeschlossenen Möglichkeitshorizont von Dasein. Dabei stellt sich aber bereits die Frage, was er damit genau im Einzelnen meint. Was meint Heidegger, wenn er von Erschlossenheit spricht? Wie ist diese strukturiert?
Um diese Fragen der von Heidegger aufgezeigten Formen der Erschlossenheit soll es im Folgenden gehen, also um die Befindlichkeit, das Verstehen und die Rede als existenziale Strukturen des Daseins, durch welche sich dieses in seiner Erschlossenheit zeigt. Da diese drei Strukturen nur zusammen die „unmittelbare Erfahrung des eigenen Seins ausmachen“[2], d.h. sie sind nicht als eigenständige Strukturen zu betrachten, werden sie auch hier nur zusammengehörig zur Sprache gebracht.
Zunächst soll also die Befindlichkeit im Sinne Heideggers betrachtet und anschließend anhand der Furcht deutlicher herausgestellt werden. Dabei wird sich zeigen, dass sich das Dasein je schon als Befindliches seine Welt und sein eigenstes Sein auf vor-strukturelle Weise erschlossen hat.
Anschließend soll aufgezeigt werden, was Heidegger als Verstehen bezeichnet und inwiefern sich dieses Moment der Erschlossenheit auf die Befindlichkeit beziehen lässt. Daraufhin soll diese zweite Struktur der Erschlossenheit anhand der Auslegung und der Aussage vertieft demonstriert werden. – Es ist also bereits deutlich zu erkennen, dass diese vorliegende Arbeit dem strukturellen Aufbau Heideggers in Sein und Zeit folgt und folglich dessen Denkweg hinsichtlich der drei Formen der Erschlossenheit versucht nachzuvollziehen oder besser: mitzuvollziehen.
Durch diese zweite Form der Erschlossenheit des Daseins, d.h. durch das Verstehen, wird deutlich werden, worauf sich das Dasein versteht, nämlich auf sein eigenstes Sein im Sinne eines entwerfenden Seinsvollzugs.
Als drittes Moment der Erschlossenheit wird anschließend die Rede thematisiert werden. Dadurch wird sich zeigen, dass das Dasein durch die Rede hindurch die beiden zuerst untersuchten Erschlossenheitsstrukturen artikuliert.
Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass in dieser Arbeit zunächst der aufzeigende Versuch unternommen werden soll, was Heidegger unter eigentlicher Erschlossenheit[3] versteht, durch welche das Dasein sein Da konstituiert, und inwiefern es sich hierbei um ein Dreigespann aus Befindlichkeit, Verstehen und Rede handelt.
I. Erstes Strukturmoment der Erschlossenheit: die Befindlichkeit
1. Da-sein als Befindlichkeit
Was ontisch als Stimmung erfahren wird, sei es eine gehobene oder eine getrübte Stimmung, bezeichnet Heidegger in ontologischer Inblicknahme als Befindlichkeit[4]. Diese ist nicht im Sinne einer Eigenschaft zu verstehen, die einem Menschen zukommt oder nicht zukommt; auch ist sie nicht als ein explizit verständliches Gefühl zu verstehen[5], sondern es gilt sie allein als eine Grundbestimmung des Daseins zu fassen[6], weshalb Heidegger dieses Phänomen des Daseins auch als ein „fundamentales Existenzial“[7] verstanden sehen möchte. Aber was heißt das nun genau? Wie lässt sich Befindlichkeit charakterisieren und inwiefern ist das Da von Dasein in der existenzialen Befindlichkeit erschlossen?
Zunächst ist abermals zu vergegenwärtigen, wie bereits eingangs erwähnt, dass es sich bei der Befindlichkeit nicht um ein spezielles Gefühl oder Gefühle im Allgemeinen handelt. Schließlich zeichnen sich diese vor allem dadurch aus, dass sie sich wesentlich auf konkretes innerweltliches Seiendes richten[8]. Anders verhält es sich jedoch mit der existenzialen Befindlichkeit. Schon Heideggers Definition der Befindlichkeit, dass es sich bei ihr um eine existenziale Struktur von Dasein handelt, legt den Schluss nahe, dass sich das Dasein je schon gestimmt in der Welt befindet[9]. Hieraus lassen sich bereits folglich zwei entscheidende Erkenntnisse zur existenzialen Befindlichkeit ableiten. Erstens muss die Welt je schon vom Dasein aus einer Stimmung heraus als Ganzes erschlossen worden sein[10]. Zweitens lässt sich aus dem Je-schon-Gestimmtsein des Daseins nachvollziehbar ableiten, dass es im Grunde des Daseins keine „Nicht-Gestimmtheit“[11] geben kann. Durch Letzteres wird ersichtlich, dass es Stimmungslosigkeit im alltäglich verstandenen Sinne für das Dasein nicht geben kann. Auch die „fahle Ungestimmtheit“[12] ist für Heidegger eine Stimmung, sogar eine vor allen anderen Stimmungen besonders ausgezeichnete, schließlich erfährt das Dasein in diesem indifferenten Zustand, wenn es sich „selbst überdrüssig“[13] ist und vor der durch die jeweilige Stimmung erschlossenen Welt ausweicht, den „Lastcharakter“[14] seines Seins im Da. Dadurch wird dem Dasein deutlich, dass es faktisch ist und sein Sein in der Welt zu vollziehen hat[15].