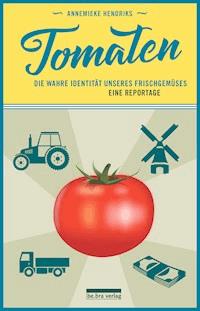Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Eulenspiegel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Ehemann einer niederländischen Publizistin in Berlin ist gestorben. Sie hat ihn auf einem kleinen Friedhof in der Nähe ihrer Wohnung begraben. In dem Jahr, das folgt, verbringt sie viel Zeit auf dieser Insel mitten im hektischen Ostberliner Kiez. "Insel"? Der Friedhof offenbart sich als ein Mikrokosmos der Großstadt. Er wird zum Schauplatz spannender, heiterer und bisweilen auch schwer erträglicher Ereignisse, interessanter Begegnungen und tiefgreifender Überlegungen über Liebe und Tod wie auch über die eigene Sterblichkeit. Sie staunt zudem über die Unterschiede zwischen Deutschland und den Niederlanden im Umgang mit dem Tod, den Ritualen des Begrabens und den Gepflogenheiten auf dem Friedhof. Sie entdeckt allmählich aber auch, wie sie, parallel zu ihrer Trauerverarbeitung, Neugier und gar Freude aus den Geschichten der Lebenden und der Toten schöpft. Sogar neue Freundschaften entstehen. Der kleine Friedhof wird zu einem Ort voll lustiger, ärgerlicher und ergreifender Geschichten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist nicht gestattet,
dieses Werk oder Teile daraus auf fotomechanischem Weg zu vervielfältigen oder in Datenbanken aufzunehmen.
Eulenspiegel Verlag – eine Marke der
Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage
Alle Rechte der Verbreitung vorbehalten.
ISBN E-Book 978-3-359-50096-4
ISBN Print 978-3-359-03015-7
© 2021 Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung: Oliver Weiss
www.eulenspiegel.com
Fotos: Annemieke Hendriks
»O du gräbst und ich grab, und ich grab mich dir zu,
und am Finger erwacht uns der Ring.«
Paul Celan, Es war Erde in ihnen (1959)
»Da gibt’s kein Fromms und keine Pille, in der Stille …«
Nina Hagen Band, Auf’m Friedhof (1978)
Inhalt
Herbst
Bis zum letzten Atemzug
Erstes Staunen
Zweites Grab, halber Preis
Eines Sonntagnachmittags
Winter
Tante Beps Asche
Schneemänner und Widerstandskämpfer
Wer wartet schon auf Bilder und Briefe eines Lebens ...
Frühling
Friedhofswitwen aus dem Kiez
Unheilsbotschaften
Der Himmel hat zwei Engel mehr
Aktion Walpurgisnacht
Rosmarin hält das Böse fern
Mahlzeit!
Die Selbsthilfe und das Spitzeln
Unmögliche Trauerrede über Mutterliebe und Sinnlosigkeit
Über Verbote und Geduldetes
Sommer
Ein peinlicher Irrtum
Der Totenkopf
Gequälte Seelen
Männer an einem heißen Donnerstag
Gequälte Seelen II
Die Zeltler
Die Selbstmörder
Seifenblasen für Antoine
Schwäbische Denkanstöße
Auf dem Spielplatz
Der gute Tod
Preußischer Anstand
Wieder Herbst
Frau links, Mann rechts
Und was, wenn ich morgen sterben würde?
Strahlendweiße Zähne im Dunkeln
Die Lebenden und ihre Toten
Epilog
Verantwortung und Dank
Herbst
Die Blätter treiben. Aber sie dürfen nicht. Die Lebenden wollen die Blätter, die ihre Toten so schön und farbenfroh zudecken, beseitigt haben. Also machen sich der nette Gärtner-Verwalter und sein junger Gehilfe an diese Sisyphusarbeit, über Wochen, immer wieder von vorne. »Dabei schützen die Blätter doch die Anpflanzung und die Insekten«, seufzt der Gärtner. »Aber ich bin öfters angerufen worden: Herr Gärtner, die Blätter müssen weg! Nicht nur die Angehörigen beklagen sich, sondern auch die Anwohner.«
Die Anwohner? Die können sich doch glücklich schätzen mit der schönen Landschaft zwischen den Wohnblöcken, mitten in der Stadt. Gratis und umsonst dürfen sie fast jede Woche ein neues Naturschauspiel anschauen, vorm eigenen Fenster und vom Balkon. »Sie wollen sogar den Efeu von der Friedhofsmauer weg haben«, fährt der Gärtner fort. »Na ja, solange man meckert, sag ick mal, lebt man noch.«
Ich befürchte schon schnurgerade Pfade zwischen den Gräbern, sage ich. Aber da machen Sie natürlich nicht mit? Er zögert. »So sind die Deutschen nun mal. So sind wir Preußen, ha ha.«
Der Gärtner-Verwalter liebt Pflanzen. Er versucht hier etwas Schönes zu gestalten, lavierend zwischen der wohl deutschen Neigung zu Chaosbekämpfung und seinem Wunsch, auch die Natur zu bedienen. Dazu bringt er selbst Stecklinge aus seinem Privatgarten mit, wie zum Beispiel Rhododendren.
Den Gärtner-Verwalter, in seiner Latzhose schon eine imposante Gestalt, könnte man auch den Gärtner-Bestatter oder Gärtner-Tischler nennen, und noch so einiges. Er macht eigentlich alles auf dem Friedhof. Der kleine, überschaubare Ort ist sein Palastgarten. »Gärtner-Berater« wäre auch nicht verkehrt. Denn nicht nur pflanzen- und insektenfreundlich ist er, sondern auch menschenfreundlich. Immer hat er ein nettes Wort, eine kleine Geschichte oder einen Witz parat. Gute Laune bringen, das ist eine wirksame Art von Trost – jedenfalls für mich.
Nun sind, wie erwähnt, nicht umgekehrt auch alle Menschen friedhofsfreundlich. Man hört sie als drumherum Wohnende manchmal laut auf ihren Balkonen feiern oder als Besucher hier unten auf den Bänkchen in ihre Handys kreischen. Na ja, ich bin da wohl überempfindlich. Mein Antoine ist erst vor kurzem begraben worden. Zugegeben, meist ist es hier angenehm still, so mitten in der Großstadt.
Gerade sieht der Gärtner-Verwalter – nennen wir ihn ab jetzt einfach »unser Gärtner« – sehr ernst aus. Nur wenig von unserem Doppelgrab entfernt trägt er würdevoll eine Urne vor sich her. Er steckt in einem dunklen Kostüm, das irgendwie fremd an ihm aussieht, und in seinem Kielwasser folgt ein Handvoll Trauernder.
Nachher kommt er zum Plaudern vorbei. Wir streiten uns darüber, ob es regnen wird. Der Radar sagt nein, und er sagt, es werde gleich losprasseln. Danach sieht es gar nicht aus, aber stimmen wird es trotzdem. Er kann die Natur lesen. Mit einem Augenzwinkern: »Ich habe immer recht.« Aus den Bewegungen der roten Käfer kann er sogar vorhersagen, ob Frost kommen wird.
Beigesetzt wird hier auf der kleinen Begräbnisstätte nicht viel, monatlich einige Feuerbestattungen und kaum eine Erdbestattung. Offenbar bringen viele ihre Toten lieber eingeäschert zum grünen Stadtrand, als sie hier zwischen den Häusern langsam vergehen zu lassen. Antoine und ich waren sofort begeistert, als wir den kleinen, etwas versteckt gelegenen Friedhof entdeckt haben – erst nach über zehn Jahren im Kiez. Hier möchten wir irgendwann begraben werden. Das »irgendwann« ist dann für meine bessere Hälfte überraschend schnell gekommen.
Bis zum letzen Atemzug
Antoine und ich lebten, obwohl schon verheiratet, in Amsterdam fünf Jahre lang weiterhin in unseren zwei kleinen Singlewohnungen, wo wir schon gewohnt hatten, bevor wir uns liebten. Wir haben unsere Selbstständigkeit gerne gepflegt, und eine erschwingliche Wohnung für zwei hätte es eh nicht gegeben. Damals war ich Mitarbeiterin der Linksliberalen Wochenzeitung, bei der er stellvertretender Chefredakteur war.
Ich war 39, er 45, und beide waren wir mit unseren »Junggesellenexistenzen« sehr zufrieden. Aber plötzlich hat es zwischen uns gefunkt. Für immer, wussten wir beide sofort. Heute würde Antoine von der #MeToo-Bewegung dafür bestimmt geächtet werden: Er war schließlich mein Auftraggeber. Wäre ihm scheißegal gewesen, und mir ebenso. Die Liebe lässt sich von politisch korrekten Geboten nicht strangulieren.
Dann kreuzte 2001 Berlin unseren Weg, die Traumstadt, die wir beide unabhängig voneinander, als Studenten und später durch unsere journalistische Arbeit, schon gut kannten: West-Berlin seit Ende der Siebziger, Ost-Berlin so richtig erst seit dem Mauerfall. Von Berlin aus konnten wir außerdem das sich so bewegende Mittel- und Osteuropa hervorragend entdecken: eine tolle Herausforderung.
»Die beste Entscheidung meines Lebens, mit Annemieke nach Berlin zu ziehen«, hat Antoine damals einer guten Freundin geschrieben. Amsterdam ist vor allem angelsächsisch orientiert, eine Welt, die uns beide intellektuell weit weniger gefesselt hat. Und, nicht unwichtig: in Berlin würden wir uns zum ersten Mal eine Wohnung teilen.
»Bis zum letzten Atemzug werden wir beieinander sein«, schrieb Antoine mir kurz vor unserem Umzug nach Berlin – auf Deutsch!
Das wenigstens hat geklappt, sage ich mir an seinem Grab. In diesen fünfzehn gemeinsamen Berliner Jahren stand er immer wieder mal in unserem Wohnzimmer, quasi wie ein Besucher, und rief dann laut: »Aber hier möchte ich leben!«
Das Sterben erschien uns weit weg – wie vermutlich allen in derart glücklichen Umständen. Antoine und ich haben uns lediglich ab und zu gesagt: Wenn’s ans Sterben geht, ziehen wir ja in die Niederlande.
Antoines Grab ist noch so kahl, die Blumensträuße sind schon verdorrt, so dass ich mich über die gelbe Blätterpracht freue, die ihn jetzt zudeckt. Offiziell muss man die Sträuße von der Beerdigung nach so vielen Wochen wieder entfernt haben. Das habe ich erst viel später gelesen. Zum Glück ist unser Gärtner da nicht so streng.
Auch um Antoine herum ist die Wiese gelb von Blättern. Aber nicht mehr lange. Der Gärtner und sein Gehilfe sind wieder im Anmarsch. Sie sammeln die Blätter abermals auf, fangen von vorne an. Auch von den Gräbern, die sie teilweise gegen Bezahlung versorgen, entfernen sie das Laub. Aber bei meinem Antoine, ermahne ich mit gespielter Strenge, lassen Sie den Käfern und Spinnen doch sicherlich Winterschutz und Futter? »Na gern«, antwortet der Gärtner. »Von Ihrem Grab bleibe ich fern!«
Erstes Staunen
Der Gärtner hat mir noch vor Antoines Beerdigung etwas Komisches erzählt. Etwas, über das ich selbst in diesem Augenblick noch lachen konnte: Ab jetzt werde den Gräbern, in der Länge, mehr Platz eingeräumt. Denn die anderthalb Meter Länge seien nicht mehr zeitgemäß. Ja, das hatte ich schon bemerkt: Sie muten merkwürdig an, diese Kindergräber für Erwachsene. Mein Ehemann und ich sind beide 1.80 lang. Aber so klein waren die DDR-Bürger doch auch wieder nicht, wenngleich mit weniger gutem Käse ernährt als wir? Hatten sie denn Gräber verdient, in denen man den Nachfahren wie ein Rollmops vorkommt?
Ich muss an die Beerdigung meines Vaters in den Niederlanden denken. Die konnte nicht vollzogen werden. Mein Vater hatte nämlich nicht in den Sarg gepasst, der war zu kurz ausgefallen. In Friesland war das, wo wohlgemerkt so ziemlich die längsten Niederländer – die Friesen – leben.
Wir stammen zwar nicht aus den Norden des Landes, sondern aus dem Westen an der Nordsee, nichtsdestotrotz war mein Vater über 1,85 lang. Wie auch mein Onkel Jan, des Vaters jüngerer Brüder. Der hatte am notgedrungenermaßen erst mal leer gebliebenen Grab meines Vaters gegrinst und gerufen: »Ein typischer Hendriks-Streich, um als Sozialist noch gegen diese christlichen Beerdigungssitten querzuschießen!«
Was mich weiterhin sofort gewundert hat: Die wenigsten der Hinterbliebenen haben für winterfeste oder samentragende Pflanzen auf dem Grab ihrer Verstorbenen gesorgt. Stattdessen wird jedes Jahr kurzzeitiges Grün herbeigeschafft. Und wenn doch, findet man die mehrjährigen Pflanzen, einmal verblüht, in diesen Herbsttagen massenhaft in den offenen Containern wieder. So werden die Jahreszeiten verspottet.
Zum Glück kommen regelmäßig junge Kiezbewohner vorbei, um diese Pflanzen aus dem Müll zu retten. Wie dieses Pärchen, sie hochschwanger, er mit etwas Silbernem in der Lippe montiert, das begeistert über jede Menge Stiefmütterchen sich ihrer erbarmt. »Schau, das schmeißt man einfach so weg!«, rufen sie mir zu. »Wir bestücken immer wieder unseren Balkon mit den Friedhofspflanzen. Magst du auch welche?«
Ich habe auf meinem Balkon noch Geranien meiner Mutter, die ich seit meiner Kindheit, als ich sie ihr mal zum Muttertag geschenkt habe, immer mit neuen Ablegern am Leben gehalten habe. Sie selbst hatte ihre Balkongeranien im Herbst entsorgt – das war mir ein Gräuel.
Pflanzen kauft man nicht, die vermehrt man aus anderen. Ableger klauen ist eine legale Handlung. Aus Freude habe ich den Daumen zu den beiden aufgerichtet und die geretteten Stiefmütterchen zwischen Balkon und Grab aufgeteilt.
Die schönste Grabbepflanzung, das sind für mich die naturbelassenen, eigenwillig wachsenden Pflanzen auf manchen Gräbern. Das ist wohl dem traurigen Umstand zu verdanken, dass die Hinterbliebenen selbst schon verstorben sind oder weit weg wohnen, was der Natur guttut.
Ich dagegen wohne sehr nah, bin mit dem Rad in fünf Minuten am Friedhof. Deswegen werde ich versuchen, einen quasi-wilden Grabgarten zu gestalten und zu pflegen und freue mich schon auf einen solchen trostreichen Ort.
Zwar kann dieser Plan erst ab Frühling losgehen. Denn die frische, graue Erde auf Antoines Grab soll sich zunächst absenken, hat mir der Gärtner erzählt. Und dann, wenn Antoine und ich auf Augenhöhe liegen – allerdings noch ohne mich, im materiellen Sinne –, werde ich nach und nach einen Garten voller winterfester Pflanzen gestalten. Daran sollen auch Zwiebelpflanzen wie Tulpen und Narzissen, die viele Jahre blühen werden, ihren Anteil haben.
Die Grünen, die ihr Kiezbüro hier gleich gegenüber auf der anderen Straßenseite haben, möchten mein Experiment am Friedhof gerne verfolgen. Dazu haben sie mich mit Säckchen voller bienenfreundlicher Samen beliefert.
Zweites Grab, halber Preis
Mein Grab, angrenzend an das von Antoine, habe ich gleichzeitig mit seinem ergattert. Damit mir kein anderer diese Stelle wegnehmen kann. Allein die Vorstellung, dass ein Fremder, oder auch eine hartnäckig in Antoine Verliebte, das Grab neben ihm erobern könnte! Solche Sachen passieren, das würde ich bald erfahren.
Es gab zum Thema allerdings einige Sprachverwirrungen, die, wie ich meine, eher wenig mit der Tatsache zu tun hatten, dass mein Deutsch ein wenig mangelhaft bleibt. Der Gärtner hatte mir dies geraten: sofort auch meine Grabstelle nebenan zu reservieren, oder halt obendrauf.
Wenigstens hatte ich das so verstanden. Wurde nicht noch vor einem Jahrhundert in den billigsten Familiengräbern »fünf-tief« beigesetzt? Das Wörtchen »bei-« verrät es schon: der nächste Verwandte kam einfach obendrauf. Wenn das Grundwasser es überhaupt zuließ, was bekanntlich in Holland nicht überall der Fall ist.
Denn im Wasser sollte kein Sarg liegen. Ich vermute, dass die Hygieneregeln schon damals auf dem besten wissenschaftlichen Stand waren. Die reicheren Familien konnten dieses Problem in ihren Gruften lösen: mit horizontalen Betonwänden, und mit viel herbeigeschlepptem Sand zwischen den aufgehäuften Angehörigen.
Wär das nicht super, dachte ich, irgendwann oben auf meinem Antoine eingebettet zu werden, ein ewiges Liebespaar! Zudem wäre diese Option deutlich billiger. Aber das war angeblich so gemeint, dass dann meine Urne in Antoines Erdgrab eingebuddelt werden würde. Das ginge nun wirklich nicht: meine Asche, in Keramik verpackt, auf Antoines Sarg, und keine Verschmelzung im Tode noch möglich ...
Zum Glück ist die zuständige Hauptverwaltung des Evangelischen Friedhofsverbandes mit einem tollen Angebot gekommen. Mein Antoine ist drei Tage tot, als ich zum Friedhofsverwaltungsbüro muss. Ein wenig Anteilnahme erwarte ich dort, weit weg von der Wärme am Grab. Aber ich sitze dort mindestens eine Stunde lang hilflos herum, völlig mir selbst überlassen. Vor meinen Augen und Ohren wird herumgeschrien, es herrschen Hektik und Unruhe. Ich kann nicht weg aus diesem Nervenkrieg, höchstens fünf Minuten zum Rauchen. Denn Antoines Beerdigung muss unbedingt heute amtlich geregelt werden.
Als ich endlich dran bin, kann die am lautesten herumschreiende Frau Antoines geplante Grabstelle nicht finden. Denn sie kann den Grundriss nicht lesen. Vermutlich ist sie eine Quereinsteigerin im humanen Todesbetrieb. Hat sie vor der Wende etwa in einer LPG Schweine gezüchtet?
Meine Stelle, fügt sie dann noch hinzu, sei schon vergeben worden. Wie? Antoine und ich würden auseinandergetrieben werden? Aber unser Gärtner hat mir diese beiden Stellen doch vorgeschlagen? In einer schönen, leeren Ecke, wo Antoine halb im Baumschatten, halb in der Sonne verweilen kann – er war ja nie ein aufrechter Badestrandanbeter – und ich genug von der Sonne abbekommen werde. Und gleich nebenan, an der Friedhofsmauer, steht außerdem ein Bänkchen: meins, bis zum Tode!
Nun bloß die Panik bekämpfen, die hier im Verwaltungsbüro in mir aufsteigt, zusätzlich zu meiner bedrückten Gemütslage. Diese Frau war nie vor Ort. Das sagt sie selbst, anstatt sich vor Scham zu verkriechen. Sie weist bei der Grabnummer schlicht die falsche Stelle an, platziert mich an Antoines anderer Seite, die zwar noch leer, aber offenbar schon vergeben worden ist.
»Möge Gottes Segen mit dieser Arbeit sein«, lese ich in einer Broschüre des Friedhofsverbands, mit der ich mir die lange, unruhige Wartezeit zu vertreiben versuche. Als das Problem im Evangelischen Verwaltungsbüro endlich gelöst ist, kommen keine Entschuldigungen. Dagegen macht sie mir ein finanzielles Angebot: »Zweites Grab, halber Preis!« Ich dachte hinterher, ich hätte, in meinem Stress, wohl nicht richtig zugehört: ein christliches Schnäppchengeschäft mit dem Tod? Freilich sind mir als holländischer Atheistin die deutsch-evangelischen Sitten weniger bekannt.
Aber genauso hatte sie es formuliert. Auf dem Friedhof werde ich nämlich mehrmals von Hinterbliebenen erfahren, dass sie das gleiche Angebot bekommen haben. Zu spät für mich. Als es einige Tage darauf ums Bezahlen geht, wird dort im Büro eisern abgestritten, mir jemals ein solches Angebot gemacht zu haben. »Sie lügen!«, wird der Trauernden, also mir, ins Gesicht geschrien. Ich bezahle den vollen Preis für zwei Gräber. Bitte, nur noch Seelenruhe.
Der evangelische Geschäftsführer schreibt in einem Prospekt: »Wir hoffen, mit unserer Arbeit der Verdrängung des Todes aus dem Leben entgegenzuwirken.« Ja, das gelingt bestens.
Eines Sonntagnachmittags
Eine junge Frau, trendy-berlinerisch – blaues Haar, teilweise in Hoodie gesteckt, mit zusätzlicher Mütze obendrauf bei 18 Grad, die ausgerechnet im Winter dann ausgezogen wird – spaziert auf der Allee mit den Kastanien, die den Friedhof in der Länge durchzieht. Ihr folgt ein junger Mann mit chinesischen Gesichtszügen. Er trägt einen Vogelkäfig. Beide gucken nach oben, in die Bäume. Sie girrt einen Lockruf, der klingt wie »bäh, bäh«. Schon nach einem Viertelstündchen kehren sie unverrichteter Dinge um.
Es war an diesem ganz gewöhnlichen Sonntagfrühnachmittag so angenehm ruhig. Aber plötzlich ist der Friedhofsfrieden dahin. An jedem Sonntag ist es, so werde ich erfahren, für einige Stunden mit der Ruhe vorbei.
Der Grund sind keine Touristen oder Kieztrinkgelage. Es ist eine Mutter, die mit ihrem Sohn die Familiengrabstelle pflegt. Dabei hat sie das Kommando und er gehorcht. Die Mutter muss ihm, jede Woche aufs Neue, viele laute Anweisungen geben, denn es gibt viel zu tun.
Ihre Familiengrabstelle liegt am mittleren Pfad, im Schatten der Bäume, und ist mit eigenen Sträuchern noch düsterer gemacht. Das Hauptansinnen ist, so scheint es, nicht nur die Grabstelle von unerwünschten Samen im Keim zu befreien – die sich allerdings dort im Dunkeln eh nicht ansiedeln möchten –, sondern auch einen breiten Gürtel grauer Erde um die Grabstelle herum von jedem Anflug einer Bedrohung, wie zum Beispiel Fußspuren. Lange wird dazu im öffentlichen Raum herumgeharkt, bis alles Grün um die Grabstätte zu grauer Erde geworden ist. Und am nächsten Sonntag wieder.
Zu den »Bedrohungen« gehört zweifellos auch Florian. Er sitzt auf seinem festen Platz, einer Bank unweit unserer Grabstätte, den Schlafsack neben sich zusammengerollt. Aber die Stimme der Mutter reicht weit. Sogar die Vögel in den Bäumen fliegen ängstlich auf. In manch solchen Augenblicken tauschen Florian und ich einen vielsagenden Blick aus.
Ziemlich schnell wurde mir klar, dass ich selbst Vorurteile abzulegen hatte. Anfangs fühlte ich mich, nur eine Bank von Florians Stammplatz an der Friedhofsmauer entfernt, von ihm beobachtet – wie er sich, umgekehrt, wahrscheinlich auch von mir.
Wir hatten schon vorher angefangen, uns aus der Ferne zu grüßen. Ich wusste nicht, aus welchem Land er stammt und wie er heißt. Dann bin ich einmal auf ihn zu gegangen, in die Offensive, um wechselseitiges Ungemach aus der Welt zu schaffen. Es stellte sich heraus, dass er, den ich irgendwo zwischen fünfzig und siebzig schätze, ein wunderschönes, fast altmodisches Deutsch spricht, wie ich das nur aus den Schriftstücken alter Autoren und Philosophen kenne. Und so angenehm leise haben seine Worte geklungen.
Sehr viel gesprochen hat Florian nicht. Es hat ausgereicht, um ihn nicht als Bedrohung, sondern eher als Schutzengel unserer Grabstelle wahrzunehmen. Wenn er auf seiner Bank ruht, wird dort nichts Schlimmes passieren, dachte ich.
Ein Mann geht, das Fahrrad an der Hand, zum hinteren Teil des Friedhofs. Ich folge ihm, einfach so, weil sein Gruß mir einladend geklungen hat und er etwas über Bienen sagte. Bienen? Gewiss, da sind die Kisten schon, fast an der hinteren Mauer, die hier allerdings keine richtige Friedhofsmauer ist, sondern die graue Hinterseite eines kolossalen Häuserblocks.
Bei Kälte, wie nach diesem plötzlich starken Nachtfrost, füttert er sie mal mit ein wenig Zucker, erklärt er, oder eben auch mit Honig. Bienen, die mit Honig gefüttert werden? Klingt wie verkehrte Welt. Aber ich bin ein unwissendes Stadtmädchen. Vielleicht bekommen Kühe auch mal ein Milchsupplement.
Sie werden nicht sterben, fährt er fort. Aber sie sollen ja Honig produzieren. Deswegen füttert er sie bei, mit Zucker, das ist billiger, oder wo nötig halt mit Honig. Und dass sich dies finanziell, selbstverständlich, gar nicht lohne.
»Lohnen!« Wir haben also einen Betrieb in Bienenzucht auf dem Friedhof. So abwegig ist das allerdings nicht, denn dieser hintere Teil der Begräbnisstätte wurde schon ab der Eröffnung 1867 an den damaligen Gärtnermeister und an eine Holzhandlung verpachtet. Auf dem aktuellen Lageplan heißt dieser Abschnitt des Friedhofs noch immer »Betriebshof«.
Bei der hohen, grauen Häuserwand liegt ein Berg Erde, der für den Betrieb mit den Gräbern benutzt wird. Dort treffe ich auf einen Mann, der im Berg etwas Wurzel- oder Knollenmäßiges eingräbt. »Topinambur«, erklärt er mir, der Neugierigen, »lecker und gesund«. Die Knollen werden sich, sagt er, ordentlich vermehren.
Auf einem anderen Friedhof, erzählt er, war seine Lieblingsstelle für die Topinamburzucht mal ein uraltes Art Deco-Gittergrab. Inmitten der schmiedeeisernen Umzäunung hätten die Knollen sich sauwohl gefühlt. Aber heute lebt er in unserem Kiez, und außerdem wachsen hier am äußersten Ende des Friedhofs jede Menge schöne Kräuter, ganz von alleine. Vielleicht wachsen sie dort schon seit 1867, denke ich.
An der Friedhofsmauer steht, gleich neben unserem Doppelgrab, eine Reihe alter Grabsteine und -Platten. Manche sind von um 1900, einer gar aus dem Jahr 1870. Sie bieten einen schönen Anblick, diese Grabmale, die wie umfallende Dominosteine zusammengestoßen scheinen. Der alte Tod, der von lange her, ist hier bei uns als ein ewiger Weggefährte anwesend. Er ist nicht aus dem Leben verdrängt worden.
So hat der evangelische Geschäftsführer es im Prospekt wohl gemeint, mit seinen Worten »der Verdrängung des Todes aus dem Leben entgegenzuwirken«. Aber nein, doch eher nicht. Ich erfahre, dass die Steine demnächst entsorgt werden sollen.
Warum denn sollen sie, mit den alten Gräbern insgesamt, weggeschafft werden? Es gibt hier so viel Platz, sie liegen keinem im Weg. Bestand Umfallgefahr für die Grabsteine? Höchstens für einen Teil davon, und die wertvolleren könnte man auch neu befestigen. Wird für die Liegerechte nicht mehr gezahlt? Aber dann bestimmt schon ein Jahrhundert lang nicht.