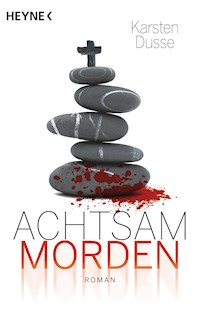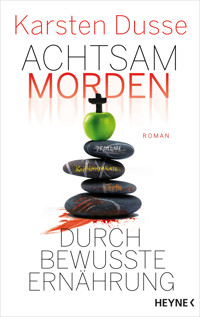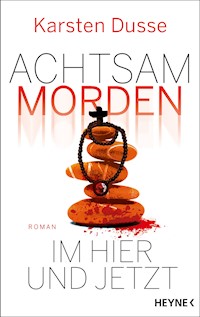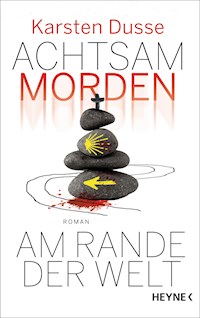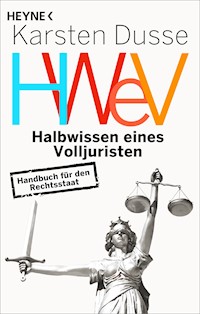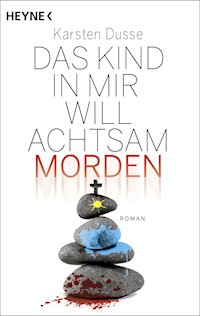
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Achtsam morden-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Björn Diemel ist zurück – und mordet ganzheitlicher als je zuvor
Björn Diemel hat die Prinzipien der Achtsamkeit erlernt, und mit ihrer Hilfe sein Leben verbessert. Er hat den stressigen Job gekündigt und sich selbstständig gemacht. Er verbringt mehr Zeit mit seiner Tochter und streitet sich in der Regel liebevoller mit seiner Frau. Ach ja, und nebenbei führt er noch ganz entspannt zwei Mafia-Clans, weil er den Chef des einen ermordet und den des anderen im Keller eines Kindergartens eingekerkert hat. Warum nur kann Björn das alles nicht genießen? Warum verliert er ständig die Beherrschung? Hat er das Morden einfach satt? Ganz so einfach ist es nicht. Sein Therapeut Joschka Breitner bringt ihn endlich auf die richtige Spur: Es liegt an Björns innerem Kind!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 413
Ähnliche
Das Buch
Die Beschäftigung mit meinem inneren Kind stellte sich für mich als die ideale Methode heraus, um die Ursachen der Probleme zu beseitigen, deren Folgen ich täglich mit Achtsamkeit minderte.
In meiner Kindheit gab es noch keine »Siri« und »Alexa«. Die Typen, die zu Hause das Licht an- und ausmachten, die Stereoanlage bedienten und jede noch so dumme Frage falsch beantworteten, hießen »Mama« und »Papa«. Wenn also etwas in meiner Kindheit verkorkst worden ist, dann von diesen beiden.
Das war insofern beruhigend, als ich mit dieser Erkenntnis im Hinterkopf bequem meinen Eltern die Schuld für meine Eheprobleme, meine Zukunftsangst, für meine generelle Gereiztheit und für mehrere Morde in die Schuhe schieben konnte.
Der Autor
Karsten Dusse ist Rechtsanwalt und seit Jahren als Autor für Fernsehformate tätig. Seine Arbeit wurde mit dem Deutschen Fernsehpreis und mehrfach mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet sowie für den Grimme-Preis nominiert. 2019 wurde sein Debütroman Achtsam morden zum Bestseller.
KARSTEN DUSSE
DAS KIND
IN MIR
WILL
ACHTSAM
MORDEN
ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2020 by Karsten Dusse
Copyright © 2020 by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarker Str. 28, 81673 München
Redaktion: Heiko Arntz
Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München,
unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock
(STILLFX, Gumenyuk Dmitriy, Julia Lemba, MILKXT2)
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN: 978-3-641-26163-4V010
www.heyne.de
Für Lina.
Und Rosa.
INHALT
PROLOG
1 DAS INNERE KIND
2 URLAUB
3 ANDERE MENSCHEN
4 SELBSTVORWÜRFE
5 KINDERBILDER
6 KINDHEITSERINNERUNGEN
7 URVERTRAUEN
8 REALITÄT
9 GEDANKENWANDERUNG
10 KREATIVITÄT
11 BAD BANK
12 MINIMALISMUS
13 KINDLICH UND KINDISCH
14 ZEITREISEN
15 ELTERN
16 GLAUBENSSÄTZE
17 RÜSTUNG
18 KINDHEITSWÜNSCHE
19 ÜBERSCHREIBEN
20 INNERE UND EIGENE KINDER
21 FEHLENDE INFORMATIONEN
22 GEFAHREN
23 ZEITKAPSEL
24 FÜHRUNG
25 WISSEN
26 GEFÜHLE
27 ZUFÄLLE
28 IRREALES UND REALES
29 ZWEIFEL
30 IRRITATIONEN
31 ABARBEITEN
32 DIALOG
33 VERSCHWIEGENHEIT
34 ENERGIE
35 AUTORITÄT
36 VERGANGENHEIT
37 WEISHEIT
38 VERSTEHEN
39 MONOTONIE
40 MORAL
41 FEHLER
42 GESCHENK
43 ABLENKUNG
44 UMWEGE
45 ÜBERRASCHUNGEN
46 IDENTITÄT
47 KINDHEIT
48 UNTERSTÜTZUNG
49 ZERSTÖRUNG
50 SPUREN
DANK
PROLOG
»Es ist nie zu spät für eine unglückliche Kindheit.
Es ist auch nie zu spät für eine glückliche Kindheit.
Ihre Kindheit ist aber vor allem eins: Vergangenheit.
Ob und wie die Vergangenheit Ihre Gegenwart beeinflussen soll, entscheiden allein Sie.«
Joschka Breitner,
»Das innere Wunschkind«
Der massige Russe wirkte fast wie ein verschrecktes Kind, als er in den Kofferraum seines eigenen Wagens kletterte.
»Und gleich sehe ich Dragan?«, fragte mich Boris.
»Gleich siehst du Dragan«, beruhigte ich ihn.
Im Einklang mit mir selbst schloss ich den Kofferraum. Wertungsfrei und liebevoll. Achtsam eben.
Ich setzte mich hinter das Steuer von Boris’ Auto und startete den Motor. Ich war zufrieden. Auch wenn ich gelogen hatte. Boris würde Dragan nie wiedersehen. Jedenfalls nicht in diesem Leben. Denn Dragan war seit einer Woche tot.
Boris allerdings würde nicht sterben. Ich hatte das Morden satt. Irgendwann musste auch mal gut sein. Für Boris hatte ich mir mit Sascha eine andere Lösung ausgedacht.
Ich fuhr mit Boris im Kofferraum vom Autobahnparkplatz. Nachts um halb vier war kaum Verkehr. Eine Viertelstunde bewegten wir uns durch die mich wohlig umschließende Dunkelheit. Dann rief ich Sascha an.
»Folgt uns jemand?«, wollte ich wissen. Der drahtige Bulgare war mir in einigem Abstand hinterhergefahren, um genau das heraus zu finden.
»Niemand. Es haben dich alle überholt.«
»Das ist gut.« Ich atmete erleichtert aus.
»Keine Toten mehr?«, wollte Sascha wissen.
»Keine Toten mehr.«
Ich hörte, wie Sascha erleichtert ausatmete.
»Wir treffen uns am Kindergarten«, bestätigte ich unseren Plan.
»Die Kellertür ist offen«, verabschiedete sich Sascha.
Ich legte auf.
1 DAS INNERE KIND
»Unsere Seele ist aufgebaut wie eine russische Matrjoschka-Puppe. Wenn es in unserer Erwachsenen-Seelen-Puppe rappelt, ist das in Wahrheit das Geräusch der verletzten Kinder-Seelen-Puppe innen drin.«
Joschka Breitner,
»Das innere Wunschkind«
Zwei Dinge sind in meiner Kindheit ganz offensichtlich schiefgelaufen: mein Vater und meine Mutter. Das jedenfalls erfuhr ich vierzig Jahre nach meiner Kindheit, als ich mich auf Druck meiner Frau zum ersten Mal mit meinem inneren Kind beschäftigte.
Wäre ich nicht durch meine sehr positiven Erfahrungen mit dem Thema Achtsamkeit für psychologische Themen sensibilisiert gewesen, hätte ich das mit dem inneren Kind wahrscheinlich zunächst einmal für kompletten Humbug gehalten. Alles, was bei einer Vorsorgeuntersuchung vom Proktologen nicht entdeckt werden kann, steckt auch nicht in uns. Das war früher meine Meinung.
Noch vor einem Jahr hätte ich ein Buch über das innere Kind deshalb schlicht für Schwangerschaftsliteratur gehalten. Eines der Bücher, die einem Mann zwar jede Menge Informationen über die biologischen Vorgänge innerhalb seiner Partnerin vermittelten, die aber als Erklärung für sein eigenes Seelenleben ansonsten eher bedeutungslos waren.
Inzwischen weiß ich, dass der psychologische Ansatz des »inneren Kindes« mit Geburtsvorbereitung nicht das Geringste zu tun hat. Er spielt komplett auf der anderen Seite der Gebärmutter. Für beide Geschlechter. Nach der Lehre vom »inneren Kind« sind wir emotional aufgebaut wie eine russische Matrjoschka-Puppe. Wenn es in unserer Erwachsenen-Seelen-Puppe rappelt, ist das in Wahrheit das Geräusch der verletzten Kinder-Seelen-Puppe innen drin.
Nicht wir stehen unserem Glück im Wege. Unser inneres Kind tut das. Weil es mit allen Verletzungen aus unserer Kindheit ein Teil von uns ist. Wollen wir das Rappeln stoppen, müssen wir das innere Kind heilen.
Die Beschäftigung mit meinem inneren Kind stellte sich für mich als die ideale Methode heraus, um die Ursachen der Probleme zu beseitigen, deren Folgen ich täglich mit Achtsamkeit minderte.
In meiner Kindheit gab es noch keine »Siri« und »Alexa«. Die Typen, die zu Hause das Licht an- und ausmachten, die Stereoanlage bedienten und jede noch so dumme Frage falsch beantworteten, hießen »Mama« und »Papa«. Wenn also etwas in meiner Kindheit verkorkst worden ist, dann von diesen beiden.
Das war insofern beruhigend, als ich mit dieser Erkenntnis im Hinterkopf bequem meinen Eltern die Schuld für meine Eheprobleme, meine Zukunftsangst, für meine generelle Gereiztheit und für mehrere Morde in die Schuhe schieben konnte.
Dass ich erst im Alter von dreiundvierzig Jahren Vater meines inneren Kindes wurde, lag unter anderem daran, dass ich ohne Verhütung mit meiner von mir getrennt lebenden Ehefrau gestritten hatte. Katharina hatte schon immer eine sehr effektive Herangehensweise, um Probleme zu lösen. Für die Lösung ihrer Probleme war immer derjenige verantwortlich, ohne den sie diese Probleme nicht hätte. Für das Verhüten von Streitigkeiten in unserer sich dem Ende zuneigenden Ehe war somit ich verantwortlich.
Und genau das hatte ich im letzten gemeinsamen Sommerurlaub leider vergeigt. Weil ich mich gegen ihren ausdrücklichen Willen in den Alpen mit einem Hüttenkellner angelegt hatte. Das allein reichte ihr als Anlass, von mir zu verlangen, mich endlich mal therapeutisch mit meinen ständigen Stimmungsschwankungen auseinanderzusetzen. Dass der Kellner aufgrund eines kleinen Nachtretens meinerseits im Anschluss unglücklicherweise gestorben war, hatte sie da noch gar nicht mitbekommen.
Als guter Ehemann und Vater, der ich war, vereinbarte ich noch in den Alpen einen Termin mit meinem Achtsamkeitscoach für die Woche nach dem Urlaub. Die Tatsache, dass Katharina umgehend mit unserer gemeinsamen Tochter Emily abgereist wäre, wenn ich das nicht getan hätte, war auch nicht ganz unbedeutend.
Völlig unabhängig von den Befindlichkeiten meiner Frau war mir zu diesem Zeitpunkt jedoch selbst längst klar, dass ich an mir arbeiten musste. Irgendetwas in mir hinderte mich immer wieder daran, das Leben einfach nur zu genießen. Wären Sorgen eine Flüssigkeit, so hatte ich das Gefühl, als würden die Sorgen im Fass meiner Seele dank Achtsamkeit zwar keine großen Wellen schlagen, aber das Fass war dennoch immer randvoll. Und manchmal, wenn eine überflüssige Sorge dazu kam, schwappte eben doch etwas über den Rand. Und ließ mich wegen Dingen, die für andere Menschen nach Kleinigkeiten aussahen, ausrasten.
Meine Ausraster waren bislang Petitessen:
Ich warf nachts Eiswürfel nach grölenden Assis im Park gegenüber von meiner Wohnung.
Ich beriet Mandanten, die mich nervten, als Anwalt absichtlich falsch.
Ich brachte dem Gefangenen in meinem Keller das Essen einfach mal zwei Stunden zu spät.
Alles Dinge, die in der gleichen Situation jeder machen würde, wenn er genervt ist. Und solange er nicht erwischt wird.
Dass ich einen Hüttenkellner in eine Schlucht stürzen ließ, hatte da allerdings schon eine andere Qualität.
Ich wollte diese Eskalation nicht.
Und so stand ich an einem regnerischen Abend Anfang September wieder vor der Tür von Joschka Breitner. Eine Woche nach meinem Urlaub. Knapp ein halbes Jahr nach meinem letzten Achtsamkeits-Coaching.
Bevor ich die Türklingel betätigte, stellte ich mich zunächst einmal einfach nur so vor seine Tür und spürte in mich hinein. In den letzten sechs Monaten hatte sich viel verändert.
Damals war es Frühling. Der Sommer stand vor der Tür.
Jetzt war es Herbst. Der Winter nahte.
Vor einem halben Jahr hatte ich die Praxis von Herrn Breitner voller neuer Energie bei Tageslicht verlassen. Ich strömte förmlich mit meinen neuen Erkenntnissen über eine achtsame Lebensführung hinaus in eine aufblühende Welt.
Jetzt war ich von der Flut des Lebens wieder zurückgespült worden. Es war bereits dunkel, und zwischen meinen Füßen raschelten die ersten vergilbten Blätter.
Dabei hätte mein Leben eigentlich rundum glücklich sein sollen. Ich hatte mir im letzten halben Jahr mein berufliches und privates Umfeld mit viel Liebe und Achtsamkeit so umgestaltet, wie ich es mir immer erträumt hatte:
Ich hatte eine lähmende Festanstellung in einer Großkanzlei gegen eine finanziell solide abgesicherte Freiberuflichkeit als Einzelanwalt ausgetauscht.
Katharina und ich hatten aus der Sackgasse einer gestressten Alltagsehe zwei parallel verlaufende Lebenswege getrennt wohnender Eltern geformt.
Unsere Tochter Emily genoss ihren von mir hart erkämpften Kindergartenplatz und war ein fröhliches, lebensbejahendes Mitglied der Nemo-Gruppe.
Ich hatte im wunderschönen Altbau des Kindergartens nicht nur meine Kanzlei, sondern obendrein auch meine eigene Wohnung. Das ganze Haus wurde von mir verwaltet. Für meinen Hauptmandanten – Dragan, den abgängigen Chef eines Mafia-Clans.
All diese Veränderungen der letzten Monate hatten viel damit zu tun, dass ich Dragan vor einem halben Jahr getötet hatte. Die Tatsache, dass das niemand wusste, war für mein Glück nicht ganz unbedeutend. Und damit auch in Zukunft niemand davon erfuhr, blieb mir gar nichts anderes übrig, als dessen verbrecherisches Firmenkonsortium in seinem, Dragans, Namen weiterlaufen zu lassen. Und gegenüber Dragans Clan so zu tun, als würde sein Boss noch leben.
Das fiel mir als Anwalt theoretisch nicht schwer. Ich hatte den legalen Deckmantel für Dragans Drogen-, Prostitutions- und Waffengeschäfte schließlich selber gestrickt und jahrelang als Berater de facto geführt. Und genau das spielte ich auch weiterhin allen vor. Mehr nicht.
Aber ein einziger Fauxpas, ein unbedachter Ausraster, ein kritischer Blick von außen zu viel auf mein Leben – und dieses ganze von mir konstruierte Lügengebilde würde in sich zusammenstürzen.
Ich musste in allem, was ich tat, unter dem Radar von Mafia und Polizei bleiben. Das versehentliche Töten eines Kellners war da eher kontraproduktiv. Nicht nur für mein Seelenleben. Sondern für mein Leben überhaupt.
Der Fehler an meinem Leben war, dass mir kein einziger Fehler unterlaufen durfte.
Meine Gegenwart mochte schöner sein als meine Vergangenheit. Aber ich hatte eine ungeheure Angst vor der Zukunft.
Das war Stress. Diesen Stress konnte ich mit Achtsamkeit unter Kontrolle halten. Aber ich wurde seine Ursachen nicht los. Achtsamkeit verlangsamte zwar mein Hamsterrad. Aber ich kam irgendwie nicht raus. Deswegen stand ich jetzt wieder hier, vor der Tür von Joschka Breitner. Das Ordnen meiner Gedanken brachte bereits ein wenig Klarheit in die aufgewühlten Schwebeteilchen meiner Seele. Dennoch zögerte ich zu klingeln. Unter anderem auch, weil ich mir noch nicht ganz sicher war, wie viel ich Herrn Breitner von meinen Problemen überhaupt erzählen konnte.
Von den schnippischen Bemerkungen Katharinas, die mir immer wieder klarmachten, wie fragil und ungeklärt unsere Beziehung im Grunde sei, würde ich ihm sicherlich erzählen können.
Von meinen Schuldgefühlen gegenüber Emily, weil wir mit unserer Ehe gescheitert waren, würde ich reden.
Von meinem Wunsch, neben Familie und Mandanten einfach auch mal Zeit für mich selber zu haben, wollte ich sprechen.
Von meinen kleinen Ausrastern würde ich berichten, auch wenn sie mir peinlich waren.
All das würde ich zur Sprache bringen. Und bei alldem würde mir Herr Breitner mit Sicherheit helfen können.
Aber über die Dinge, die mich massiv belasteten, würde ich nicht reden können.
Über die Morde, die ich im letzten Frühjahr begangen hatte, würde ich kein Wort verlieren.
Über das Doppelleben, das ich seitdem führte, würde ich schweigen.
Und ganz sicher würde ich nicht über Boris sprechen.
Boris, den russischen Mafioso, den ich im Keller des Kindergartens gefangen hielt. Boris, den einzigen Menschen, der bereits jetzt sowohl das Wissen als auch das Interesse hatte, meine ganze Heile-Welt-Blase platzen zu lassen.
Boris, den ich vor einem halben Jahr entführt hatte, um mein Leben und das Leben meiner Tochter zu retten.
Boris, den ich nicht töten wollte, weil ich das Morden leid war. Der für mich der lebende Beweis war, dass ich zum Morden auch »nein« sagen konnte. Den ich aber weder lebenslang gefangen halten konnte, noch jemals frei lassen durfte. Für dessen Zukunft ich schlicht noch immer keine Lösung gefunden hatte.
Boris, dessen Tod mich genauso belasten würde, wie es sein Leben bereits tat.
Über Boris würde ich nicht sprechen können.
Ich würde Herrn Breitner also nicht alles erzählen. Ich würde einfach so tun, als wäre ich für ein ganz normales Anschluss-Coaching da. Als wollte ich nach einem halben Jahr lediglich mal mit ihm gemeinsam schauen, was sich in meinem Leben Neues ergeben hatte. Ein paar Stellschrauben justieren. Wir hatten ja auch so genug zu besprechen, wenn ich ihm ehrlich erzählte, wie ich aus vielen kleinen Alltagsmücken gedanklich große emotionale Elefanten machte. Die durch den Porzellanladen meiner ansonsten gut gelaunten Seele marschierten. Ich würde offen zugeben, dass ich jedes einzelne dieser Probleme mit einer Achtsamkeitsübung wieder relativ zügig auf seinen tatsächlichen Kern zusammenschmelzen lassen konnte. Aber dass nach einem kurzen Moment der Ruhe und Zufriedenheit sich immer wieder eine grundsätzliche Unruhe, Unsicherheit und Kälte in mir einstellte.
Ich würde offen zugeben, dass ich zwar verstanden hatte, wie ich mit Achtsamkeit so gut wie jedes meiner Probleme in den Griff bekam. Aber dass mir nicht klar war, warum überhaupt immer wieder die gleichen Probleme auftauchten.
Das war der Teil der Wahrheit, den es zu besprechen galt. Deswegen stand ich nun wieder vor der Tür von Joschka Breitner. Und klingelte.
Ich hörte, wie im Inneren des Hauses Scharniere quietschten und Holz über Fliesen glitt. Das Licht im Flur ging an und erleuchtete warm das bunte Milchglasfenster der massiven Holztür. Ruhige, gelassene Schritte näherten sich. Wenige Momente später öffnete sich die Tür. Joschka Breitner stand vor mir. Er begrüßte mich mit einer Vertrautheit, als wäre ich nicht vor einem halben Jahr, sondern erst vor zwei Minuten aus der Tür gegangen.
»Herr Diemel! Schön, dass Sie wieder da sind. Kommen Sie rein.«
»Danke, dass Sie Zeit für mich haben.«
Wir gaben uns die Hand. Er trat zur Seite und ließ mir den Vortritt. Ich ging durch den langen Flur in sein Besprechungszimmer. Nichts hatte sich am Ende dieses Weges verändert. Zwei Stühle, ein Tisch, ein Regal mit Büchern, ein Beistelltisch mit einer gläsernen Teekanne. Herr Breitner trug die gleiche legere Kleidung wie immer. Ausgewaschene Jeans, Baumwollhemd, grobe Strickjacke. Seine nackten Füße in Filzpantoffeln.
Er vermittelte dabei nicht den Eindruck, als wäre die Zeit spurlos an ihm vorübergegangen. Er vermittelte den Eindruck, als sei er selbst die Zeit, und die Welt wäre spurlos an ihm vorübergegangen.
Während ich meine Jacke auszog, musterte mich Herr Breitner interessiert.
»Sie sehen verändert aus«, bemerkte er wertungsfrei.
Ich schaute an mir herunter. Vor einem halben Jahr hatte ich noch Maßanzüge und Designerkleidung getragen. Heute trug auch ich Jeans, dazu T-Shirt, Pullover und Sneaker.
»Ja …«, sagte ich mit einem Lächeln und zuckte mit den Schultern. Es war beruhigend, zunächst mal mit den positiven Veränderungen anfangen zu können. »Ich habe jetzt weniger Kleidungszwänge.«
Aber das war nicht die Veränderung, die Joschka Breitner aufgefallen war.
»Ich meine Ihre Augen. Als wir uns das letzte Mal sahen, war da ein Strahlen. Jetzt haben Sie Ringe unter den Augen«, stellte Herr Breitner liebevoll ehrlich fest.
Liebevolle Ehrlichkeit kann brutal sein. Ich war noch keine zwanzig Sekunden bei ihm, und mir wurde bewusst, dass dies eben kein dahinplätschernder Anschlusstermin werden würde. Sondern eine anstrengende Beschäftigung mit mir selbst. Herrn Breitner war dies offensichtlich bereits klar gewesen, als ich ihn um den Termin gebeten hatte. Das war schließlich sein Job. Er zeigte auf einen der bequemen, mit Kord bespannten Chromrohrstühle. Ich hängte meine Jacke über die Lehne und setzte mich, während Herr Breitner mir aus seiner Glaskanne grünen Tee einschenkte. Mein Schweigen auf seine Feststellung war Bestätigung genug.
»Wir haben uns lange nicht gesehen. Was haben Sie in der Zwischenzeit erlebt?«, fragte er.
Ich trank einen Schluck des lauwarmen Tees und überlegte. Ich hatte vier Menschen ermordet, meine ehemaligen Arbeitgeber erpresst, die früheren Betreiber des Kindergartens gezwungen ihre Anteile zu verkaufen, damit meine Tochter einen Platz bekam, und einen russischen Mafioso entführt. Nichts davon würde Gegenstand dieses Gespräches werden können. Und dass sich im Urlaub ein Kellner wegen mir das Genick gebrochen hatte, würde ich auch nicht explizit erwähnen.
»Ich habe mich beruflich verändert. Ich habe gekündigt und bin jetzt freiberuflich tätig. Meine Tochter ist im Kindergarten. Und wir waren im Urlaub«, druckste ich stattdessen herum.
»Dann zunächst einmal meinen herzlichen Glückwunsch zu der beruflichen Entscheidung.« Herr Breitner wusste, wie sehr ich in der Mühle der Großkanzlei gelitten hatte. »Das erklärt Ihren neuen Kleidungsstil. Was ist der Grund für die Traurigkeit um Ihre Augen?«
Ich sagte nichts. Ich wollte, aber ich konnte nicht. Stattdessen spürte ich, wie sich die Traurigkeit um meine Augen in meinen Augen zu Tränen verflüssigte. Allein schon die Frage überwältigte mich. Wann hatte das letzte Mal ein Mensch festgestellt, dass ich traurig war? Ohne der Grund dafür zu sein? Ich brauchte zwei Atemzüge, um mich zu fassen.
»Ich … Es ist …« Ich suchte nach Worten, die, wenn sie schon nicht die Wahrheit waren, dieser zumindest nicht widersprachen.
Herr Breitner half mir. »Es ist alles gut. Sie sind hier. Verraten Sie mir einfach, warum?«
»Nun, meine Frau meint, dass …«
»Das war nicht meine Frage«, sagte er sanft.
»Bitte?« Ich war irritiert.
»Ich wollte nicht wissen, was Ihre Frau meint«, erklärte mir Joschka Breitner und lächelte sanft. »Würde mich das interessieren, würde ich Ihre Frau fragen. Nicht Sie. Ich wollte wissen, warum Sie hier sind.«
»Weil … nun … weil …« Ich streckte die Waffen. Nicht vor Herrn Breitner. Sondern vor mir selber. Ich war nicht der erfolgreiche, selbstständige Anwalt, der alle Probleme seines Lebens geregelt hatte und jetzt ein kleines Achtsamkeits-Update haben wollte. Das konnte ich weder Herrn Breitner noch mir selber vormachen. Ich war hier, weil ich Angst hatte, dass mir mein ganzes Leben in naher Zukunft um die Ohren fliegen würde. Ich brach so ehrlich wie möglich zusammen.
»Weil ich keine Ahnung habe, wie es mit meinem Leben weitergehen soll … mit meiner Ehe, mit meinem … beruflichen Umfeld … mit dem, was noch kommt. Ich habe keine Zeit für mich in der Gegenwart und Angst vor der Zukunft … Und ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll.«
Herr Breitner schaute mich beruhigend an. Nicht bemitleidend.
»Wissen Sie was? Es wird ja einen Auslöser gegeben haben, der dazu geführt hat, dass Sie bei mir angerufen und um diesen Termin gebeten haben, richtig?«
»Richtig.« Der Vorfall mit dem Hüttenkellner.
Und so begann ich von dem unbeabsichtigten Auslöser für diesen Termin zu erzählen. Nicht ahnend, dass dies der Einstieg werden würde zu einer sehr intensiven Beschäftigung mit meinem inneren Kind. Einem Wesen, das innerhalb kürzester Zeit mit einer unbefangenen Leichtigkeit das fortsetzen würde, womit ich vor knapp sechs Monaten erleichtert aufgehört hatte: das achtsame Morden.
2 URLAUB
»Der Sinn des Urlaubs ist das Abschalten. Je konsequenter Sie die Reize abschalten, die Sie im Alltag negativ beeinflussen, desto größer die Entspannung. Abschalten bedeutet nicht Isolation. Ersetzen Sie die Push-Nachricht auf dem Handy einfach durch ein Gespräch mit einer Urlaubsbekanntschaft.«
Joschka Breitner,
»Entschleunigt auf der Überholspur –
Achtsamkeit für Führungskräfte«
Von meinem vergangenen Urlaub zu erzählen war sicheres Terrain für mich. Hier gab es nicht zu viel zu verschweigen. Sicherlich würde ich ein paar Dinge kreativ umschreiben müssen. Zum Beispiel den mich belastenden Tod des Kellners. Aber der sollte die lediglich für mich sichtbare Spitze des Eisberges bleiben, auf den das Schiff meines Lebens gerade zusteuerte. Herr Breitner würde die Kollisionsgefahr als Profi sicherlich auch so erkennen.
»Wir waren letzte Woche für ein paar Tage in den Alpen«, begann ich.
»Wer ist wir?«
»Meine Frau Katharina, meine Tochter Emily und ich.«
»Sie wohnen weiterhin getrennt?« Joschka Breitner hatte vor einem halben Jahr die Idee ins Spiel gebracht, dass wir uns räumlich trennen, um achtsamer mit uns und unseren Eheproblemen umgehen zu können. Und das hatte in der Tat das Verhältnis zwischen Katharina und mir verbessert.
»Ja – und das funktioniert gut.«
»So gut, dass Sie trotz räumlicher Trennung gemeinsam in Urlaub fahren?«
»Nun, wir haben gemeinsam einem wunderbaren Kind das Leben geschenkt. Und unseren zwei getrennten Leben ein wunderbares gemeinsames Kind. Der Teil des anderen, der in Emily steckt, wird für immer in Liebe ein Teil des Lebens des anderen sein. Auf der Basis kann man durchaus gut gemeinsam in den Urlaub fahren.«
»Haben Sie und Ihre Frau Sex?«, wollte Herr Breitner unvermittelt wissen.
»Ich kann nicht für meine Frau sprechen, aber wenn Sie mich fragen …«
»Ich meine Sie gemeinsam. Sie sind verheiratet und fahren gemeinsam in Urlaub. Haben Sie ein gemeinsames Sexleben?«
Ich überlegte, wie ich das formulieren sollte. Wir hatten ein sehr fantasievolles Sexleben. Insofern, als Sex nur noch in unserer Fantasie stattfand. Zumindest in meiner. Ich hätte jederzeit gern mit Katharina geschlafen. Im Bett hatten wir uns immer gut verstanden. Aber mit unserer räumlichen Trennung, die uns guttat, war auch eine körperliche Trennung zwischen uns eingetreten. Die ich bedauerte. Ich drückte es so aus: »Im Urlaub haben wir uns zwar ein Zimmer geteilt. Aber ›miteinander schlafen‹ hieß da maximal ›Rücken-an-Rücken‹.«
Herr Breitner nickte verständnisvoll. »Verstehe. Eine Stellung, die im Kamasutra nicht erwähnt wird. Haben Sie mal offen mit Ihrer Frau über Ihr fehlendes Sexleben gesprochen?«
»Meine Frau verwendet eine Schlafbrille und Ohropax, wenn sie neben mir im Bett liegt. Da sind auch die Gespräche sehr einseitig. Aber ehrlich gesagt, ist mein fehlendes Sexleben nicht der Grund, weshalb ich hier bin.«
»Vor zwei Minuten konnten Sie den Grund, warum Sie hier sind, noch nicht formulieren. Deswegen wollten wir erst einmal über den Anlass Ihres Anrufes reden. Den Gründen, warum Sie hier sind, nähern wir uns erst noch«, erläuterte mir Herr Breitner. »Aber ich will Sie nicht länger unterbrechen. Sie hatten also einen gemeinsamen Familienurlaub. Erzählen Sie bitte weiter.«
»Den Zeitpunkt des Urlaubs hatten wir ganz bewusst gewählt. Katharina will zum ersten Oktober wieder halbtags ihre alte Stelle als Abteilungsleiterin bei einer Versicherung übernehmen. Emily ist jetzt ein gut eingewöhntes Kindergartenkind. Im September sind die Schulferien vorbei, der größte Touristen-Ansturm ist vorüber. Es war der ideale Zeitpunkt, vorher noch einmal gemeinsam in Urlaub zu fahren.«
»Und warum die Alpen?«
Dass wir schlicht und ergreifend keine Lust hatten, den ersten und vor allem den letzten Urlaubstag einer Mallorca-Reise mit einer Dreijährigen inmitten von betrunkenen Pauschalurlaubern auf einem Flughafen zu verbringen, klang mir zu profan.
»Wir hatten Lust auf Berge.«
Und ab dem Moment, wo wir uns für die Berge entschieden hatten, stimmte das auch. Wir hatten vom Allgäuer Tourismusbüro einen kleinen Familienbauernhof für einen entschleunigten Urlaub empfohlen bekommen. Und diese Empfehlung erwies sich als goldrichtig. An unserem Zielort passte einfach alles. Der Hof lag idyllisch in einer Senke zwischen zwei Dörfern. Mitten in einem vielversprechenden Funkloch. Digital Detox war hier noch keine Modeerscheinung, sondern jahrhundertealte Tradition. Der Dieselmotor wurde noch bestimmungsgemäß dazu genutzt, Distanzen zwischen Menschen zu überbrücken – nicht, sie zu schaffen. Kühe galten hier seit Jahrtausenden als natürliche Existenzgrundlage – nicht als Klimakiller. Nachts hörte man bei offenem Fenster nur das Rauschen der Bäume – und keine Menschen im Vollrausch. Elektrobatterien wurden zum Einzäunen von Rindviechern benutzt – nicht zu deren Fortbewegung auf Kinderrollern.
Kurz: Hier war die Welt noch wie früher – in Ordnung.
»Und eigentlich war der Urlaub auch perfekt. Bis wir diese Hüttenwanderung machten.«
Katharina, Emily und ich hatten nach einer zweistündigen Wanderung verschwitzt, durstig und hungrig die Terrasse einer wunderschönen Berghütte erreicht. Die Hütte schmiegte sich oberhalb der Baumgrenze auf einem kleinen Plateau an die Nordseite der Allgäuer Voralpen. Es war kurz vor Mittag, und die Sonne beschien trotz der Nordseitenlage die ganze Terrasse. Das Plateau fiel zu einer Seite steil in eine kleine Schlucht ab, an der die Hütte über eine Lastenseilbahn zu erreichen war. Ansonsten war die Hütte rundherum von Almwiesen umgeben. Das Läuten der Kuhglocken hatte den gleichen Effekt wie Meeresrauschen an der Küste: Ein entspannender Klangteppich legte sich über die Sorgen des Alltags. Exakt so, wie von mir erhofft.
Ich trug seit anderthalb Stunden Emily auf den Schultern. Es war eine Freude gewesen, durch die Augen meiner Tochter noch einmal einen Berggipfel, eine Seilbahn, eine Kuhweide entdecken zu dürfen. Katharina war ausgeglichen wie lange nicht mehr. Kein Lästern über andere. Sie schien unter dem Eindruck der Natur und der körperlichen Anstrengung tatsächlich in sich selbst zu ruhen. Es war noch nicht ganz Mittagszeit, und auf der Alm waren fast alle der zehn langen Holztische mit rustikalen Bänken frei und luden uns ein, an ihnen Platz zu nehmen. Nur an zwei Tischen saßen andere Wanderer und tranken still und zufrieden ihre Getränke. Das Wetter war fantastisch, und jeder einzelne Platz bot einen fast einhundert Kilometer weiten Blick auf die malerischen Landschaftswellen des Allgäus.
»Als ich Emily von den Schultern und den Rucksack vom Rücken genommen hatte, fehlte mir zu meinem Glück nur noch ein dampfender Teller mit von Puderzucker bedecktem Kaiserschmarrn, eine eisgekühlte Flasche Almdudler und ein auf Hochglanz polierter Landjäger. Und ein Klo.«
»Warum?«, fragte Herr Breitner.
»Ich musste mal.«
»Nein, ich meine, warum ausgerechnet diese Essenskombination? Dampfender Teller. Puderzuckerbedeckter Kaiserschmarrn. Eisgekühlter Almdudler. Auf Hochglanz polierter Landjäger. Das sind alles sehr konkrete, sehr bildliche Beschreibungen.«
»Weil das Bilder aus meiner Kindheit waren. Kindheitserlebnisse, die ich an Emily weitergeben wollte. Ein Kaiserschmarrn mit meiner Tochter. Erschöpft, hungrig und glücklich. Nach einer tollen Bergwanderung. Das hatte ich mir für diesen Tag vorgenommen.«
»Sie waren als Kind oft in den Alpen?«
Ich überlegte. Ich hatte eigentlich nur ein einziges Mal mit meinen Eltern Urlaub in den Alpen gemacht.
»Nein … nicht so oft.«
»Aber Sie haben damals auf den Hütten regelmäßig Kaiserschmarrn, Almdudler und Landjäger bekommen?«
Ich überlegte und spürte, wie mir bei dem Thema selbst hier bei Herrn Breitner aus dem Nichts heraus unwohl wurde. »Ist das wichtig?«
»Vielleicht. Aber erzählen Sie weiter.«
Herr Breitners Einwand irritierte mich kurz. Aber ich fuhr fort.
»Jedenfalls – Katharina setzte sich in die Sonne, Emily rannte zur nächsten Kuh auf der Weide neben der Hütte, ich zur Toilette.«
Auf meinem Weg zu den sanitären Anlagen im Inneren der Hütte traf ich Nils. Er stand neben dem Hütteneingang, trank eine Flasche Almdudler und checkte auf seinem Handy irgendeinen Social-Media-Account. Anhand seines elektronischen Bestellblocks, den er in einer Tasche am Gürtel stecken hatte, war er als Kellner der Hütte zu erkennen. Und an seinem Namensschild.
Ich fragte Nils freundlich, ob ich drinnen meine Wünsche äußern solle, oder ob wir gleich draußen am Tisch bestellen könnten. Ein genervtes »Ja, ja. Komme gleich« war alles, was er mir ohne aufzublicken zuraunte. Das war weder eine Antwort auf meine Frage noch das entgegenkommende Verhalten, das ich mir als Gast auf einer Almhütte wünschte.
»Ich wollte Sie nur höflich fragen, ob …«, versuchte ich den Teil meines Urlaubs, den ich zwangsläufig mit ihm auf dieser Hütte verbringen musste, harmonisch zu gestalten.
»Hab grad Pause.« Komme-gleich-Nils drehte sich von mir weg, offensichtlich in seine Pause hinein, und bediente dort ausschließlich sein Handy.
Ich schaute mir den Teil von ihm, den ich noch sah, ein wenig genauer an.
Nils war zwar maximal Ende zwanzig, wirkte aber wie jemand, den das Leben seit minimal vierzig Jahren zu Tode langweilt. Seine Gäste trugen Wanderschuhe, Wanderhosen, durchschwitzte Oberteile und hatten eine gesunde Bräune im Gesicht. Nils war leichenblass und trug lilafarbene Wildleder-Sneakers, eine schwarze Skinny-Jeans und ein zu großes, dunkelgrünes V-Neck-T-Shirt mit Glitzer-Camouflage-Pailletten. Die Pailletten bildeten den schönen Schriftzug »Save the planet«. Nils hätte genauso gut Barista-Imitator im Prenzlauer Berg seien können. In die Alpen passte er wie Heidi ins Berghain.
Mit seinen zirka eins fünfundsiebzig wirkte er für sein Gewicht fast einen halben Meter zu groß. Seine Frisur war das Einzige, was in die Landschaft passte. Sie sah aus, wie von einer Kuh in Form geleckt. Sein flaumiger Oberlippenbart wiederum passte weder in die Alpen noch in sein Gesicht. Nils war exakt der Typ von Mensch, dessentwegen man Urlaub in den Alpen macht: um ihm wenigstens für eine Woche mal nicht zu begegnen.
Um sein »Komme-gleich« nicht an logistischen Hürden scheitern zu lassen, versorgte ich ihn vor meinem Weitergang zur Toilette noch mit allen zu unserem Auffinden notwendigen Informationen.
»Gut – also wir sitzen am dritten Tisch vom Eingang. Aber das sehen Sie ja dann, nach der Pause. Ist ja eh noch fast alles leer draußen.«
»Ja, ja«, erwiderte Nils, erneut ohne aufzublicken.
Es wäre für alle Beteiligten besser gewesen, wenn Nils und ich uns nie getroffen hätten.
3 ANDERE MENSCHEN
»Achtsamkeit beseitigt den Stress, den Sie sich wegen anderer Menschen machen.
Achtsamkeit beseitigt nicht die anderen Menschen.
Aber vor allem: Achtsamkeit beseitigt nicht die Ursachen dafür, dass Sie sich immer wieder von anderen Menschen triggern lassen.
Diese Ursachen liegen in Ihnen. Nur Sie können sie entdecken und beheben.«
Joschka Breitner,
»Das innere Wunschkind.«
Eigentlich hätte ich nach der schönen Wanderung erschöpft in mir selbst ruhen sollen. Aber aus irgendeinem Grund gingen mir Nils der Kellner und sein ablehnendes Verhalten nicht aus dem Kopf. Das stand in direktem Gegensatz zu der Atmosphäre, die ich mir für unsere Wanderpause auf der Alm vorgestellt hatte. Aber als achtsamer Mensch hatte ich das Handwerkszeug gelernt, solchem Kleinigkeiten-Ärger mit Gelassenheit zu begegnen. Ich machte noch in der Toilettenkabine eine kleine Steh-Meditation. Ich hatte Urlaub. Ich war mit Frau und Tochter in den Bergen. Bei bestem Wetter. Mir fehlten nur noch die eisgekühlte Flasche Almdudler sowie der Kaiserschmarrn und ein paar Landjäger zum perfekten Tag.
Auf der Terrasse setzte ich mich zu Katharina und Emily, deren Interesse an Kühen zwischenzeitlich einem Interesse an elterlicher Nähe gewichen war. Die Terrasse füllte sich nach und nach mit weiteren Wanderern, die offenbar ebenfalls ein Interesse an Nahrungsaufnahme hatten. Nur einer Person schien dieses geballte Interesse egal zu sein: Nils. Er glänzte die nächsten zehn Minuten durch Abwesenheit. Katharina und Emily nutzten derweil das majestätische Panorama als größtmögliches »Ich sehe was, was du nicht siehst«-Spielfeld. Emily genoss dabei ihr Lieblingsgetränk: ein von mir im Schweiße meines Angesichts im Rucksack auf den Berg geschlepptes »Fruchtquetschie«. Ich saß mit meinem Hunger und meinem Durst daneben und schaute mir die Terrasse an.
Bis auf einen waren nun alle Tische mit Gästen besetzt. Katharina fragte mich, ob ich nicht auch mitspielen wolle. Mir fehlte dazu aber die Muße. Ich konnte nicht gleichzeitig einen abwesenden Kellner beobachten und Dinge nicht sehen, die andere sahen. Multitasking hatte ich mir aus Achtsamkeitsgründen abgewöhnt. Dass der Kellner nicht kam, nervte mich.
»Ich sehe nicht, was du nicht siehst, und das ist Kellner«, merkte ich deswegen lakonisch an. Katharina, die meinen Humor oftmals nicht teilte, verzog erstmals an diesem Tag missbilligend das Gesicht.
Emily liebte meine Abwandlung des Spiels und fuhr begeistert fort: »Ich sehe nicht, was du nicht siehst, und das ist Einhorn!« Da meine Tochter noch keinen Kaiserschmarrn kannte, enttäuschte sie dessen kellnerbedingte Abwesenheit offensichtlich nicht in gleichem Maße wie mich.
Den letzten freien Tisch nahm dann eine Gruppe von fünf Bundeswehrsoldaten in Zivil ein, deren tarnfarbene Rucksäcke alles über ihren Beruf verrieten. Ich versuchte, mich nicht darüber aufzuregen, dass wir jetzt nur noch ein Tisch unter vielen waren und meine Kaiserschmarrn-Bestellung in immer weitere Ferne rückte. Ich versuchte stattdessen, achtsam den Augenblick zu genießen. Aber irgendwie fand ich den Augenblick vor zehn Minuten schöner. Als wir noch die einzigen neuen Gäste waren. Und voller Hoffnung auf eine schnelle Bedienung.
Der »Wir. Dienen. Deutschland.«-Slogan der Bundeswehr war mir bereits heute Morgen auf einem Bus an der Talstation aufgefallen. Der Slogan »Wir. Bedienen. Deutschland.« als Hüttenmotto wäre mir in diesem Moment wesentlich lieber gewesen.
»Björn, bestellst du uns bitte einen Kaiserschmarrn mit Apfelmus? Wir sind mal kurz für kleine Mädchen«, riss mich Katharina aus meinen trübseligen Gedanken und verschwand mit Emily in Richtung Toilette. Emily ließ ihren leeren Fruchtquetschie auf dem Tisch liegen.
Und da, endlich, kam Nils auf die Terrasse. Mit einem Stapel Speisekarten unter dem Arm. Er verteilte die Karten wahllos an den verschiedenen Tischen. Ohne jedes erkennbare System. Ich sah meine Chance, sein offensichtlich fehlendes Wissen über die Reihenfolge der Gäste durch eigene Schnelligkeit auszugleichen.
»Ich brauche keine Karte, ich kann sofort bestellen. Ich hätte gerne Kaiserschmarren, Almdudler und … haben Sie Landjäger?«
»Sind das diese Fleischdinger?«, war seine leicht angewiderte Gegenfrage. »Von mir aus sollte auf Hütten nur vegan gegessen werden. Aber bitte. Moment …«
Nils versuchte, seinen elektronischen Bestellblock auf den restlichen Speisekarten in der Hand zu lagern. Erfolglos. Ich versuchte zu verstehen, was Menschen, die sich völlig freiwillig dazu entschlossen hatten, andere Menschen gegen Geld zu bedienen, dazu brachte, diese Menschen kostenlos zu belehren. Ebenfalls erfolglos. Ich wagte einen weiteren Anlauf.
»Sie brauchen den Computer doch gar nicht. Ich möchte nur drei ganz einfache …«
»Moment, ich muss erst die Speisekarten verteilen«, unterbrach mich Nils, verschwand mit den Speisekarten an einen anderen Tisch und glänzte statt mit Leistung lediglich mit seinen »Save the Planet«-Glitzerpailletten. Den Anspruch, die Welt zu retten, hielt ich ein wenig gewagt für jemanden, der noch nicht einmal siebzig Quadratmeter Almterrasse im Griff hatte. Nils ließ mich sprachlos und mit aufkeimender Wut zurück.
In dem Moment kamen Katharina und Emily wieder. Emily setzte sich freudig auf meinen Schoß. Katharina setzte sich mir gegenüber, schaute irritiert über den nach wie vor leeren Tisch und fragte vorwurfsvoll: »Hast du etwa noch nicht bestellt?«
Fünf Minuten vorher war ich noch der Buhmann, weil ich mich über die Abwesenheit des Kellners beschwert hatte. Jetzt wurde mir offensichtlich ein persönlicher Vorwurf aus dem Verhalten des anwesenden Kellners gemacht. Zweieineinhalb Stunden erwanderter Entspannung waren verflogen. Ich fing an, mich innerlich aufzuregen. Vor allem darüber, dass ich mich innerlich aufregte. Und: War das nicht Kaiserschmarrn, was ich da gerade roch?
»Ich hätte ja gern bestellt. Aber das Einhorn, das Emily nicht gesehen hat, ist ein wenig organisierter als der Kellner, der noch nicht da war.«
»Reg dich nicht auf. Wir haben Urlaub.«
»Wir ja. Der Kellner aber nicht.«
Als Nils wieder an unserem Tisch vorbeikam, hatte er nicht nur bereits wieder vergessen, was ich bestellen, sondern dass ich überhaupt bestellen wollte. Er sah allerdings Emilys leeres Fruchtquetschie. Er nahm es mit spitzen Fingern an sich. Anstatt meine Bestellwünsche zu erfragen, äußerte er uns gegenüber seine Wünsche nach einer perfekten Welt:
»Wussten Sie, dass bei der Produktion einer einzigen Fruchtquetschie-Verpackung hundert Gramm CO2 frei werden? Wenn es nach mir ginge, dann wären die Alpen plastikfreie Zone.«
Ich bin ein Freund von umweltbewusstem Handeln. Und ich freue mich über jedes neue Wissen, das mir kostenlos vermittelt wird. Aber in diesem Moment war ich hungrig und hatte eines gründlich satt: ungefragte Belehrungen von Servicepersonal auf leeren Magen.
»Plastikfreie Zone hatte dein Vater ja offensichtlich schon untenrum bei deiner Zeugung. Das war ja wohl auch kein so erfolgreiches Konzept.«
Hatte ich das eben laut gesagt? Katharina legte mir entsetzt ihre Hand auf den Arm, mit dem ich gerade den Kellner zu mir ziehen wollte. Ich war selber ein wenig erstaunt darüber, dass ich spontan dazu in der Lage war, zwei völlig unzusammenhängende Sachverhalte zu einer gezielten Beleidigung zusammenzufassen. Eigentlich war das gar nicht meine Art. Zum Glück intervenierte in diesem Moment die Bundeswehr deeskalierend. Die Soldaten riefen laut nach Getränken. Nils floh ohne ein weiteres Wort einfach zum lautesten Tisch.
»Wo hatte der Vater von dem Mann denn plastikfreie Zone?«, wollte Emily wissen und bewahrte mich mit dieser Frage vor einer sofortigen Zurechtweisung durch Katharina.
»Der Papa hat nur einen Scherz gemacht, mein Schatz«, klärte Katharina Emily auf. Mit einem Blick zu mir, der verriet, dass sie absolut nicht zu Scherzen aufgelegt war. Aber wir hatten uns zum Prinzip gemacht, uns vor Emily nie offen zu streiten.
»Papa – ich hab Hunger«, unterbrach Emily mein Wegducken unter dem bösen Blick Katharinas. Das war der Punkt, an dem ein weiteres Warten für mich keine Option mehr darstellte. Mich und meine gastronomischen Kindheitserinnerungen konnte man meinetwegen mit Füßen treten. Aber die realen Kindheitsbedürfnisse meiner Tochter nach Nahrung und Getränken nicht.
Nils wollte gerade wieder an unserem Tisch vorbei wahllos zu anderen wartenden Gästen gehen, als ich zur Tat schritt. Ich hielt ihn am Saum seines Glitzer-T-Shirts fest und zog ihn zurück an unseren Tisch. Schon wieder war ich ein wenig verwundert, warum ich das tat. Ich verabscheute körperliche Auseinandersetzungen. Katharina guckte entsetzt.
»Halt! Wir sind jetzt dran.«
»Ich … will nur kurz …«, stotterte der Kellner.
»Man sagt nicht ›Ich will‹, sondern ›Ich möchte‹. Und ich möchte jetzt bestellen. Sofort!«, sagte ich mit zurückgenommener, aber sehr entschlossener Stimme.
Als Nils verstand, dass sich mein Griff um seinen T-Shirt-Zipfel nur lockern würde, wenn er hier und jetzt seinen Gastro-Computer hervorholte, war endlich der Weg frei für unsere Bestellung: zwei Kaiserschmarrn, eine eisgekühlte Flasche Almdudler und einen Landjäger zum Mitnehmen.
»Das war inakzeptabel und grob«, tadelte mich Katharina, als Nils kleinlaut von unserem Tisch verschwand.
»Wäre dir ein sanfterer Weg eingefallen?«, fragte ich zurück.
»Nein, aber du warst in den letzten Wochen so ein ausgeglichener Mensch. Auch in den Bergen kann man achtsam wandern.«
»Ich würde sogar achtsam bestellen. Dafür bedarf es aber eines aufmerksamen Kellners. Und nicht so einer Nulpe.«
»Zerstöre bitte nicht diesen schönen Tag mit deiner schlechten Laune. Unser Essen kommt ja sicher gleich.«
Nicht das Problem zerstört den schönen Tag, sondern derjenige, der auf das Problem hinweist. Das war Katharinas Lebenseinstellung.
Unser Essen kam. Allerdings weder gleich noch zu uns. Die ersten beiden Kaiserschmarrn bekam ein Tisch, der lange nach uns bestellt hatte. Meine eisgekühlte Flasche Almdudler bekam einer der Berufssoldaten, der sie zwischen zwei längst erhaltenen Hefeweizen wegzischte, weil Nils offensichtlich nicht mehr wusste, welche Nummer zu welchem Tisch gehörte. Katharina und ich nutzten die Zeit, um uns in der warmen Sonne mit einem eisigen Schweigen zu erfrischen. Nach zwanzig Minuten bekamen wir endlich unseren Kaiserschmarrn. Und eine lauwarme Flasche Almdudler. Mein Landjäger allerdings hatte die Küche immer noch nicht verlassen, als unsere Teller längst leer waren. Dafür hatte Emily unseren Tisch verlassen und spielte fröhlich und ausgelassen am Wassertrog vor der Hüttenterrasse mit dem eiskalten, glasklaren Wasser, das ich auch sofort und umsonst hätte trinken können.
Und was tat ich? Ich kochte vor Wut. Katharina sah mir das an. Sie versuchte einen versöhnlichen Anlauf.
»Der Kaiserschmarrn war lecker!«, sagte sie zufrieden und beruhigend.
Ich sagte nichts.
»Was ist los?«, fragte sie schon wieder vorwurfsvoller.
»Der Idiot hat meinen Landjäger vergessen«, stellte ich fest.
»Dann frag halt noch mal nach, und lass deine Laune nicht an mir aus.«
»Darum geht’s doch überhaupt nicht«, brüllte ich fast. »Ich muss das ganze Jahr über funktionieren. Und im Urlaub soll ich mich dann Idioten unterordnen, die keinen Plan davon haben, was sie tun?«
»Aber du kannst dich doch nicht wegen einer fehlenden Wurst so …«
»Hier geht es nicht um die Wurst! Hier geht es …« Ich hatte ehrlich gesagt selber keine Ahnung, warum mich diese fehlende Wurst so unfassbar wütend machte oder worum es mir tatsächlich ging. Aber tief in meinem Inneren hatte ich das unglaublich klare Gefühl, unglaublich ungerecht behandelt worden zu sein. Sofort ein dampfender Teller Kaiserschmarrn, eine eisgekühlte Flasche Almdudler, ein auf Hochglanz polierter Landjäger – das waren drei selbstverständliche Kleinigkeiten. Mehr wollte ich gar nicht. Nichts davon hatte ich bekommen. In mir schrie eine kleine Stimme, laut und fast unhörbar hoch, gegen diese Ungerechtigkeit an. Katharina sah nur die fehlende Wurst. Für mich hatte der Kellner mein permanent randvolles Sorgenfass mit seiner Ignoranz zum Überlaufen gebracht.
»Hier geht es ausnahmsweise mal um mich! Kann vielleicht wenigstens einmal im Urlaub auch etwas so passieren, wie ich mir das wünsche?«
»Ach, mal wieder geht es nur um dich? Weißt du eigentlich, was du für ein selbstsüchtiger Egoist bist?«
»Solange ich egoistisch alles zahle, scheint dir das ziemlich egal zu sein.«
Nils stand vier Tische weiter und ignorierte auch jedes Zeichen von mir, dass ich zahlen wollte. Ich wollte aufstehen und zu ihm gehen. Katharina hielt mich zurück.
»Lass es. Das bringt doch nichts, wenn …«
Wurde ich gerade von meiner Frau wie ein Kind zurückgehalten? Nicht mit mir. Ich stand auf. Ging zu Nils. Stellte mich neben ihn.
»Zahlen.«
»Sofort, ich …«
»Jetzt. Da vorne.«
Ich stapfte zurück zu unserem Tisch. Die Gäste an den anderen Tischen schauten verständnisvoll. Im Nachhinein glaube ich allerdings, dass sie voller Verständnis für Katharina waren. Nicht für mich.
»Ich zahle«, bestimmte Katharina. »Du vertrittst dir bitte die Beine und kommst erst mal wieder runter.«
Ich wollte Katharina mein Portemonnaie geben, doch sie winkte ab. Zickig.
»Ich habe selber immer genügend Bargeld dabei. Seit mein Mann sein eigenes Leben lebt.«
Aha. Finanziell überflüssig war ich also auch. Und vielen Dank, Nils, dass du uns ausgerechnet im Urlaub wieder auf das Eis unserer Eheprobleme geschoben hast.
»So eine Hüttenscheiße hier«, sagte ich.
Der soll sich den Landjäger sonst wohin schieben, dachte ich.
»Vielen Dank für deine Unterstützung!« Wütend stampfte ich weg und ließ eine jetzt ebenfalls wütende Ehefrau zurück.
»Wofür machst du eigentlich dieses ganze Achtsamkeitsgedöns?«, hörte ich sie mir noch hinterherraunzen.
Ja, wofür? Ich erkannte mich selbst nicht wieder. Ich war nie ein Choleriker gewesen. Ganz im Gegenteil. Früher fraß ich Ärger eher in mich hinein. Bis ich die Achtsamkeit für mich entdeckte, dank der ich in den letzten Monaten wunderbar funktioniert hatte. Und jetzt brachte mich eine fehlende Rohwurst so aus dem Konzept? Aber vielleicht war es genau das. Vielleicht hatte ich es einfach satt, monatelang mit eiserner Disziplin an mir selbst zu arbeiten, wenn jeder dahergelaufene Kellner achtlos auf meinen Bedürfnissen rumtrampeln durfte. Und meine Frau mich wie ein Kind behandelte. Ich war stinksauer. Aber Katharina hatte in einem Punkt recht. Ich sollte mich selbst aus dieser Sackgasse befreien, statt gegenüber Nils noch eine weitere Szene zu veranstalten. Deshalb war ich aufgestanden. Deshalb suchte ich nach einem Ort, um mich zu beruhigen. Ich beschloss, eine Runde ums Haus zu gehen.
Ich hatte die Hütte zur Hälfte umrundet und stand auf einmal auf der Laderampe der Lastenseilbahn. Völlig allein. Von der Gästeterrasse aus war die Laderampe nicht sichtbar. Ich stand hier inmitten von zahlreichen leeren Kisten Almdudler, die auf den Abtransport ins Tal zu warten schienen. Die Rampe sah aus wie der Hinterhof einer Kneipe. Was sie im Grunde ja auch war. Es war angenehm kühl hier, weil die Hütte Schatten warf. Es war still, und die Luft war frisch.
»Um selber auch innerlich abzukühlen, stellte ich mich, die Füße schulterbreit auseinander, die Arme locker am Körper abfallend, ans Geländer, schaute ins Tal und spürte meinen Atem.« Diesen Teil der Geschichte konnte ich Herrn Breitner sogar voller Stolz erzählen. »Wie von Ihnen gelernt, beruhigte ich mich sehr schnell wieder. Alles halb so schlimm. Im Hier und Jetzt war ich satt. Ich hatte keinen Durst mehr. Meine Tochter genoss den Ausflug. Ich hatte Urlaub, und uns erwartete eine schöne Seilbahnfahrt zurück zur Talstation.«
»Sie haben sich aufgeregt. Das kommt bei den meisten Menschen vor. Sie haben sich selbst wieder abgeregt. Das kommt bei den wenigsten Menschen vor. Wo liegt das Problem?«, wollte Herr Breitner wissen.
»Das Problem liegt darin, dass sich die gleiche Stimme, die sich zuvor schon über die Ungerechtigkeit empört und mich auf hundertachtzig gebracht hat, wieder bei mir meldete.«
Ich erzählte also weiter: Dieselbe kindliche Stimme, die vorhin so hoch und laut und fast unhörbar in mir geschrien hatte, sagte mir nun, nachdem ich mich beruhigt hatte, ziemlich entrüstet, dass es das ja wohl noch nicht gewesen sein konnte. Nils hatte mir meinen Wunsch-Hütten-Tag versaut. Ich sollte ihm zumindest auch ein Stück weit den seinen versauen. Und egal woher diese innere Stimme kam – ich hatte das Gefühl, dass sie recht hatte. Ein ganz klein wenig Rache würde mir guttun.
Während ich meinen Blick über den kleinen Hinterhof gleiten ließ, kam mir eine Idee. Die Absperrung zur Lastenseilbahn bestand aus einem kleinen Tor, das mit zwei Riegeln verschlossen war. Die Almdudler-Kisten standen neben dem Tor. Wenn nun jemand die Almdudler-Kisten vor das Tor schieben, leicht kippen und die Riegel öffnen würde? Dann würde die nächste Kiste Leergut, die irgendein vertrottelter Kellner auf den Getränkekisten-Turm stellen würde, diesen zum Kippen bringen. Die Kisten würden gegen das Tor fallen. Das Tor würde sich öffnen und ein paar Dutzend Flaschen Leergut würden samt Kisten ins Tal stürzen. Zu wissen, dass Nils sich dafür aller Wahrscheinlichkeit nach Ärger einfangen würde, war mir Befriedigung genug.
Ich zog die drei übereinandergestapelten Kisten mit leeren Flaschen einen Meter weit nach links, vor das Tor der Lastenseilbahn. Ich kippte den kleinen Turm in Richtung Tor und klemmte einen flachen Stein unter die unterste Kiste. Der Turm neigte sich Richtung Tal, kippte aber noch nicht. Erst die nächste Kiste würde ihn zum Einsturz bringen. Ich entriegelte das Tor. Etwas in mir kicherte vergnügt. Ich ging mit kindlicher Vorfreude über das sichere Gelingen meines kleinen Streiches zurück zur Terrasse.
Katharina hatte gerade gezahlt. Und sich ebenfalls beruhigt. Ich legte ihr als Zeichen der Versöhnung wortlos die Hand auf die Schulter. Sie schob sie weg. Mit einem leidenden Gib-mir-Zeit-dein-Verhalten-zu-verarbeiten-bis-dahin-bin-ich-einfach-sehr-enttäuscht-von-dir-Blick. Vorwurfsvolles Schweigen fand ich noch entwürdigender als ausgesprochene Vorwürfe. Ich hatte schon für wesentlich weniger vorwurfsvolle Seufzer den jährlichen Geburtstags-Pflichtanruf bei meiner Mutter beendet.
Ich schulterte den Rucksack und folgte Emily, die bereits in Richtung Seilbahn vorausgelaufen war. Katharina trottete in zwanzig Meter Abstand schweigend hinter uns her.
Den Rettungshubschrauber der Bergwacht sahen wir, als wir dreißig Minuten später mit der Gondel zur Talstation hinunterfuhren.
4 SELBSTVORWÜRFE
»Selbstvorwürfe sind sinnlos. Sie lösen ein Problem nicht. Sie kopieren es lediglich aus der Realität in Ihre Gedanken. Und lassen es dort zu einer Größe anwachsen, die es in der Realität nie erreichen würde.«
Joschka Breitner,
»Entschleunigt auf der Überholspur –
Achtsamkeit für Führungskräfte«
Der Hubschrauber landete nicht auf der Almwiese vor der Hütte des Alpenvereins, sondern er schwebte über der Bergstation der Lastenseilbahn. Ein Rettungskorb und ein Bergretter wurden dort offensichtlich abgeseilt. Ich hatte das ungute Gefühl, dass das etwas mit ein paar wackeligen Getränkekisten und einem nicht ordnungsgemäß verschlossenen Tor zu tun haben könnte. Als wir im Tal angekommen waren, fragte ich am Kassenhäuschen mit rein touristischem Interesse in der Stimme, was denn da oben für eine Rettungsaktion laufen würde. Der Mann gehörte, wie alle Mitarbeiter der Bergbahn, zu den freiwilligen Bergrettern und war über Funk bestens über die Rettungsaktion informiert.
»Ganz üble Sache. Ein Kellner ist von der Terrasse abgestürzt.«
Ach. Du. Scheiße. Der Streich war wohl offensichtlich übers Ziel hinausgeschossen. Mir wurde eiskalt.
»Hat er … Ist es schlimm?«
»Keine Ahnung. Scheint zumindest nicht mehr allein hochklettern zu können. Die Kollegen sind auf dem Weg zu ihm.«
Also mindestens ein gebrochenes Bein. Verdammt. Das hatte ich nicht gewollt. Ein bisschen Ärgern wäre okay gewesen. Aber das war zu viel und tat mir bereits jetzt unendlich leid. Da ich allerdings weder von meiner Frau noch von mir selber wie ein Kind behandelt werden wollte, musste ich den Tatsachen erwachsen ins Auge sehen: Ich hatte großen Mist gebaut. Von meinen Selbstvorwürfen würde es Nils allerdings nicht besser gehen. Und von meinem Selbstmitleid schon mal gar nicht.
»Ganz armer Bua«, murmelte der Ticketverkäufer vor sich hin.
Katharina, der der Kellner im Gegensatz zu mir tatsächlich egal war, wollte schon weitergehen, aber irgendetwas in mir wollte mehr erfahren.
»Kennen Sie den Kellner?«
»Nein, aber mein Bruder. Der betreibt die Hütte. Der Kellner ist so ein Stadtmensch aus dem Norden. Wollte hier freiwillig irgendein Nachhaltigkeitspraktikum im Gastrobereich machen. Keine Ahnung, was das ist. Aber ist jetzt wohl vorbei.«
»Und wie ist er in die Schlucht gefallen?«, wollte Katharina nun doch wissen.
»Wollte anscheinend auf einer Getränkekiste kurz Pause machen, und irgendwie ist die dann ins Tal gestürzt. Hat wohl vergessen das Absperrgitter zu schließen.«
Der Mitarbeiter der Bergbahn musste den nächsten Touristen, die bereits am Schalter warteten, Tickets verkaufen. Unfälle in den Bergen gehörten für ihn zum Alltag.
Wir verließen die Seilbahnstation in Richtung Auto.
»Der arme Kellner. Und du hast dich noch so kindisch über ihn aufgeregt«, legte Katharina mir gegenüber leise nach.
Ich hatte keinerlei stichhaltige Argumente, um mich gegen diesen Vorwurf zu verteidigen. Ganz im Gegenteil. Zum Glück war Katharina der kindischste Teil – mein Rachestreich – gänzlich unbekannt. Ich konnte also nur ein wenig vor mich hin stammeln, um überhaupt was zu sagen. Was die Sache nicht besser machte.
»Ja … gut … Der hat sich aber auch idiotisch verhalten. Ich meine – wer macht schon ein Nachhaltigkeitsprakti…« Weiter kam ich nicht.
»Ich habe auf der Hütte nur einen einzigen Menschen mit idiotischem Verhalten bemerkt. Und das warst du. Ich bin deine ständigen Gefühlsschwankungen satt. Du versprichst mir hier und jetzt, dass du das in den Griff kriegst.«
»Wie stellst du dir das vor?«
»Das Achtsamkeitstraining hat doch bestens funktioniert. Du rufst noch heute Abend bei diesem Herrn Breitner an und machst einen Termin, um an dir zu arbeiten …«
»Sonst?«
»Sonst ist der Urlaub hiermit beendet.«
»Und dann habe ich Sie angerufen«, schloss ich meine Erzählung gegenüber Herrn Breitner.
»Und wie geht’s dem Kellner?«, wollte Herr Breitner wissen.
»Beinbruch.« Was nicht ganz falsch war. Das Bein war auch gebrochen.
Neben dem Genick.
Wie ich am Abend – nach dem Anruf bei Herrn Breitner – aus dem Internet erfuhr.
Zum Glück lagen Emily und Katharina da schon im Bett. Letztere mit Schlafbrille und Ohropax. Keine der beiden bekam meinen Zusammenbruch mit.