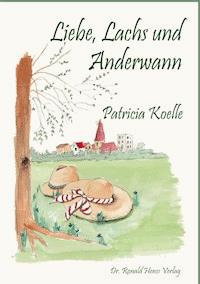6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ostsee-Trilogie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Nach »Das Meer in deinem Namen« der 2. Roman der OSTSEE-TRILOGIE von Patricia Koelle. DIE TIEFEN WELLEN DES MEERES. DIE LEISE STIMME DER SEHNSUCHT. DIE LANGSAME RÜCKKEHR ZU DIR. Tiryn wächst an der Küste Floridas auf. Ihre Mutter ist Sängerin und tingelt mit ihrer Band durch Kneipen und Bars. Doch ihre Tochter lässt sie dabei oft allein. Wenn Tiryn Kummer hat, lauscht sie am liebsten ihrem Großvater Nicholas, der von seiner Heimat erzählt, dem schmalen Land an der fernen Ostsee, in dem es im Winter sogar schneit. Er schenkt ihr ein Bernsteinschiff, in dem Erinnerungen geheimnisvoll bewahrt sind. Bald ist Tiryns größter Traum, an die Ostsee zu reisen. Doch ist es ihre eigene Sehnsucht oder die ihres Großvaters? Und wie wird man sie in Ahrenshoop empfangen, wo Nicholas als Verräter gilt? Das Meer selbst und ein Fremder mit hellen Augen, den sie am Strand trifft, führen sie zu einer Entscheidung…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 646
Ähnliche
Patricia Koelle
Das Licht in deiner Stimme
Roman
FISCHER E-Books
Inhalt
Für alle, die sich die Erfüllung eines Lebenstraums erkämpft haben.
Und für alle, auf die noch ein offener Traum wartet.
Prolog
1985
»Opa Nick? Wer ist die Frau in dem Boot? Ist das die auf deinen Bildern?«
Tiryn drehte das filigrane Segelschiff in ihren kleinen Händen hin und her und spähte in den honigfarbenen Bernstein.
Nicholas Ronning stutzte. Tiryn konnte das wahrnehmen? Seine Enkelin? Er selbst sah Hennys Gesicht schon lange nicht mehr in dem Bernsteinrumpf des Segelschiffs.
»Ja, Tallulah. Aber das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle sie dir, wenn du älter bist.« Er nannte sie gern bei ihrem indianischen Namen. Er passte so gut zu ihr. Hüpfendes Wasser. Wahrscheinlich war ihre Herkunft der Grund, dass sie Dinge sah, die andere nicht sahen. Ihr indianischer Vater war ein weiser Mann, auch wenn man ihn mit seinem Igelhaarschnitt und abgetragenen Jeans nicht auf den ersten Blick dafür hielt.
Oder hatte sie diese zweifelhafte Gabe von ihm?
»Wenn ich wie alt bin, Opa Nick?«
»Noch viele Sommerferien älter.«
»Dann erzähl mir von dem Hafen, in den das Schiff gehört. Von dem Hafen, wo weiße Sterne fallen, aus denen man Männer baut.« Sie kletterte auf seinen Schoß. »Erzähl mir von dem kalten Meer, auf dem man manchmal laufen kann.«
»Gut, Tallulah. Wenn du es dir wünschst.«
Er sah eine Weile auf die silbernen Segel, in denen ein zeitloser Wind wohnte und ihnen die Richtung wies, bevor er von dem fernen, zerbrechlichen Land zu sprechen begann, über dem der Himmel so weich leuchtete, wie er es seitdem nie wieder gesehen hatte.
Florida, USA,
2000
1 Tiryn
Tiryn lag bäuchlings auf dem Steg. Ein Splitter stach sie ins Knie, aber sie beachtete ihn nicht. Unter ihr erzählte sich das Wasser Geschichten. Schmatzend schlug es Tangfahnen an morsche Pfähle oder gluckerte geheimnisvoll an den Steinen. Das hohe Mittagslicht brach sich in den Wellen und zeichnete ein zitterndes Netz goldener Linien auf den Meeresboden. Tiryn kniff die Augen zusammen. Im nächsten Moment würden sich diese Linien zu einem Bild zusammenfügen. Verschwommen natürlich, aber sie würde es erkennen, so wie sie als kleines Mädchen in Opa Nicholas’ Bernsteinschiff Bilder gesehen hatte.
Sie wusste nicht, warum, aber sie war sich sicher, dass gerade dieses Bild im Sand wichtig wäre. Es zeigte bestimmt wieder die langhaarige Frau, die so unglücklich war. Aber diesmal würde Tiryn endlich ihr Gesicht sehen!
»Halito!« Ein Ruf riss sie aus ihrer Konzentration. Drei Stege weiter stand Kimoni auf dem Deck der Anhinga und winkte ihr zu.
Seine schlanke, karamellbraune Gestalt wirkte auf dem klobigen Kutter in der Ferne wie ein zarter Grashalm.
»Halito!« Sie winkte zurück. Der Gruß in Choctaw, der Sprache ihres Vaters, war zu einer lieben Gewohnheit zwischen ihnen geworden.
Kimoni bückte sich, um das Schleppnetz zu entwirren. Sie kannten sich seit Kinderzeiten, und immer noch genoss sie es, seinen Bewegungen zuzusehen, die so leicht wirkten, als sei er ein Vogel, der nur kurz auf der Erde gelandet war. Sie waren Sandkastenfreunde gewesen: Kimoni, seine Schwester Peri und Tiryn. Nur dass sie keinen Sandkasten brauchten, denn sie hatten den Strand, der geschwungen und breit war wie ein Lächeln der Erde und endlos für nackte Kinderfüße. So heiß, dass man sich die Sohlen daran verbrennen konnte. So hell, dass er blendete und nichts Dunkles zuließ. So weich, dass jeder Kummer darin versank.
Auch die Zeit versank darin, und manches änderte sich.
Anderes blieb erhalten.
Tiryn und Kimoni änderten sich und wurden in einer Frühlingsnacht voller Glühwürmchen mehr als nur Freunde. Ein paar Jahre später bekam Tiryn Angst und beendete die Beziehung, so dass sie wieder Freunde waren.
Kimoni, den Namen hatte ihm seine afrikanische Mutter gegeben. »Großer Mann« bedeutete er. Und Größe bewies Kimoni, denn mit ihm war es leicht, Liebe wieder in Freundschaft zurückzuverwandeln. Vielleicht weil er auch von seinem deutschen Vater einiges geerbt hatte, zum Beispiel eine besondere Gelassenheit, die Tiryn so wohltat, dass sie ohne Kimoni niemals zurechtgekommen wäre.
Genau deshalb hatte sie die Beziehung beendet. Sie wollte nicht, dass es am Ende zwischen ihnen wurde wie zwischen Opa Nick und seiner Bella. Bella liebte ihn ein Leben lang, doch er konnte Henny Badonin, diese andere, ihm verlorengegangene Frau auf der anderen Seite des Meeres, nicht loslassen. Oder Tiryns Eltern – wenn sie an deren Ehe dachte, spürte Tiryn ein Frösteln zwischen ihren Schulterblättern, trotz der unerbittlichen Sonne Floridas, die auf ihren Rücken brannte.
Tiryn überlegte, ob sie hinübergehen sollte, um Kimoni auf dem Kutter zu helfen. Doch ihre Zeit reichte nicht mehr aus. Sie spähte noch einmal über den Steg hinunter, in der Hoffnung, das geheimnisvolle Bild doch noch zu erwischen.
Aha, sie guckt wieder Meereskino, dachte Kimoni drüben bestimmt. Nur ihm hatte sie jemals von den Bildern erzählt, die sie schon seit ihrer Kindheit manchmal auf dem Meeresgrund sah. Bilder, die sich bewegten, wie kurze Filmschnipsel.
Gelegentlich zeigte der Hotelchef Nelson Sanborn den Kindern, die für ein paar Ferientage im Hotel wohnten, Filme auf einem uralten Projektor. Auch Tiryn hatte zuschauen dürfen, wie alle Kinder des Personals. Fasziniert sah sie, wie der Lichtstrahl aus dem Projektor das abgedunkelte Zimmer durchquert und die Bilder auf eine weiße Leinwand gezaubert hatte, obwohl in dem Lichtstrahl gar keine Bilder zu sehen waren, sondern nur der tanzende Staub. So ähnlich, dachte sie, muss das mit den Bildern auf dem Meeresgrund sein. Die Sonne wirft das Licht durch die Wellen auf den Boden, und von dort kommen sie in meinen Kopf. Man sieht sie vorher nicht, aber in meinem Kopf ist eine Leinwand, und dort kann ich sie erkennen. Nachdem sie sich das auf diese Weise selbst erklärt hatte, waren ihr die Bilder nicht mehr unheimlich. Schließlich war ihr Opa Maler. Er machte Bilder auf seine Weise und Tiryn eben auf eine andere. Sie konnte nicht malen, also schenkte ihr das Meer seine Bilder.
Doch als sie erwachsen wurde, waren ihr die Bilder manchmal überhaupt nicht geheuer. Sie stellte fest, dass einige die Wahrheit erzählten. Einmal sah sie ein Haus, das von einem Hurrikan zerstört wurde. Kurze Zeit später kam sie wirklich an der Ruine vorbei, die sie sofort wiedererkannte. Ein anderes Mal glaubte sie, Kimonis Vater zu sehen, mit einem riesigen Fisch, den er geangelt hatte. Zwar konnte sie sein Gesicht im Wasser nicht erkennen, aber seine Haltung mit der einen schiefen Schulter war ihr vertraut. Monate später zeigte er ihr ein Foto in seinem Album, das zehn Jahre alt war. Tiryn erkannte den Fisch und Kimonis Vater, wie sie ihn im Meer gesehen hatte. Wie sie sich das erklären sollte, wusste sie nicht. Kimoni hatte sie beruhigt, wie er es immer tat, egal, was Tiryn zustieß.
»Fürchte dich nicht vor den Bildern«, sagte Kimoni, »aber höre auf ihre Geschichten. Die Wahrheit liegt immer in den richtigen Geschichten, egal, wer oder was sie dir erzählt.«
Wenn das stimmte, was wollte ihr dann das Bild von der unglücklichen Frau erzählen, die an einem fremden Strand stand und weinte?
Die Sonne war tiefer gerutscht. Nun zeichnete sie ganz andere, harmlose Linien auf den Meeresboden. Sie wanderten über einen Seestern, dann über eine Muschelschale. Das Bild war verschwunden, ohne erkennbar geworden zu sein. Tiryn beobachtete den Seestern, bis sie etwas in die Wade zwickte.
»Au!« Hastig setzte sie sich auf. »Ach, du bist das, Colly!« Der Pelikan stupste sie mit dem Schnabel an der Schulter. Er war ganz jung gewesen, als sie ihn nach einem Hurrikan mit verletztem Flügel am Strand gefunden hatte. Sie hatte den Flügel geschient und ihm Fische gefangen, bis der Vogel nicht nur groß und gesund, sondern auch sehr zutraulich geworden war. Am liebsten begleitete er Tiryn, wenn sie mit Kimoni und Peri auf dem Kutter fuhr. Dort saß er gern ganz vorne auf dem Bug und blickte mit seinem weisen Gesichtsausdruck auf das Meer hinaus, als gäbe es dort im nächsten Moment eine große Entdeckung zu machen. Darum tauften sie ihn Columbus. Er futterte reichlich Beifang und war bald wieder flugfähig, doch er blieb sehr anhänglich.
»Heute musst du dir deine Fische selbst fangen, Colly. Meine Schicht im Hotel fängt gleich an. Oder flieg zu Kimoni, der hat bestimmt was für dich.«
Der Pelikan legte den Kopf schief, sah sie einen Moment lang an und breitete tatsächlich die Flügel aus. Tief über dem Wasser strich er zum Kutter hin. In der grellen Sonne schimmerte die rosa Haut seines Kehlsacks durchsichtig.
Tiryn freute sich auf die Kühle im Hotel. Heute drückte die Hitze besonders. Wie ein nasses Tuch lag sie auf der Küste und machte das Atmen schwer. Von den Mangrovensümpfen her roch es faulig und von den Kuttern her nach Fisch. Tiryn schloss die Augen, um sich für einen kostbaren Moment in Opa Nicks Land zu träumen. Das Land, in dem er aufgewachsen war und in dem die Bäume im Herbst rot und golden wurden. In dem Schnee den Strand weiß färbte und das Meer zufror, so dass man darauf laufen konnte.
Davon hatte ihr Opa Nick erzählt, als sie klein war. Für Tiryn war das ihr Traumland geworden, in das sie sich flüchtete, wenn sie wieder einmal irgendwo wartete und nicht wusste, wann ihre Mutter wiederkommen würde. Wenn überhaupt.
Später las sie über diesen schmalen Streifen Land, von dem Opa Nick sprach und den er immer wieder malte. Über die Halbinsel mit dem seltsamen Namen Darß, weit im Osten an einem anderen, kälteren Meer. Dort wollte sie einmal hin, die Sprache konnte sie ja. Opa Nick hatte ihr Deutsch beigebracht, und es war ihre Geheimsprache, die sie miteinander verband. Auch mit Kimoni und seinem deutschen Vater übte sie regelmäßig. Tiryn fing an zu sparen, steckte erst das seltene Taschengeld und dann die schwerverdienten Trinkgelder in ihre Sparbüchse – ein erstaunt aussehender Kugelfisch, den Kimoni ihr geschenkt hatte. Sie versteckte ihn gut vor ihrer Mutter, und als sie alt genug war, richtete sie sich ein Konto ein, das sie ihr »Ostseekonto« nannte. Schon oft hatte sie den Inhalt des Kugelfischbauchs inzwischen dort in Sicherheit gebracht, aber sie hatte das Konto auch manchmal in Notlagen wieder plündern müssen, und so wuchs es nur langsam. Jetzt war sie vierundzwanzig; bei diesem Tempo wäre sie wahrscheinlich ungefähr so alt wie Opa Nick jetzt, bis sie sich aufmachen konnte, das Land ihrer Sehnsucht zu erkunden. Dabei hatte sie sich vorgenommen, es spätestens bis zu ihrem fünfundzwanzigsten Geburtstag zu schaffen. Dann war sie ein Vierteljahrhundert alt! Erschreckend. Wenn es bis dahin nicht klappte, würde es sicher nie etwas werden. Aber die Zeit wurde knapp, und es sah nicht so aus, als ob sie hier fortkönnte. Dabei war das Geld nicht einmal ihre größte Sorge.
Sie drängte die schwüle Luft aus ihren Gedanken und stellte sich vor, wie weiche weiße Flocken sanft ihr Gesicht berührten. Wenn sie die Augen öffnete, würde eine zarte Spitzenborte aus Eis das Meer säumen, so wie es Opa Nick gemalt hatte. Der Wind war kalt, aber sie würde sich in eine dicke Jacke kuscheln und zusehen, wie ihr Atem kleine Wolken malte …
Knatternd fuhr ein Motorboot am Steg vorüber und schreckte sie aus ihren Gedanken hoch. Sie stand auf, strich ihren Rock glatt und suchte sich einen Weg durch die Ranken der Trichterwinden, die sich über den heißen Sand zogen. Sie liebte die himmelblauen tütenförmigen Blüten. Als Kind hatte sie auch schon immer genau darauf achtgegeben, keine zu zertreten. Sie stellte sich vor, dass der Himmel sein Blau in diese Trichter füllte, um Vorrat für den nächsten Tag zu haben. Und sie machte es dem Himmel nach und füllte ihre Träume hinein, denn die Blüten schlossen sich fest, wenn es dunkel wurde oder regnete, und schützten so ihr Innerstes.
Nun, da sie erwachsen war, übernahm das Ostseekonto diese Aufgabe, aber die Blüten mochte sie immer noch.
Die Touristen, die ihr zu dem Geld für ihren Traum verhalfen, würden das nicht verstehen. Sie hatten keinen Hurrikan erlebt, fanden die Zikaden und die Hitze noch romantisch. Sie waren alle hier, weil sie sich nach dem Süden gesehnt und dafür gespart hatten. Sie hungerten nach Wärme und nach frohen Farben, nach dem Türkisblau der warmen See, dem Rot der Hibiskusblüten und dem bunten Schimmern der Kolibris. Vom Schnee hatten sie die Nase voll. Wie Opa Nick, der auch jeden Sommer in seiner Heimat gefroren hatte, so sehr er sie auch liebte. Er hatte sich immer in den Süden gesehnt, erzählte er Tiryn.
Sie aber hatte das Gefühl, dass ihm auch nach Jahrzehnten in Florida nie wirklich warm geworden war. Wahrscheinlich wegen dieser Henny, der Frau, die ihn kurz vor der Hochzeit verlassen hatte. Die er trotzdem immer wieder malte – früher nur von hinten, doch inzwischen trug jede Frau in seinen Bildern ihre Züge. Und die daran schuld war, dass Nicholas es nie über sich brachte, seine Bella zu heiraten, die ihm bis zu ihrem Tod treu verbunden gewesen war.
Tiryn schüttelte unwillig den Kopf. Was nützte es, über die alten Geschichten zu grübeln?
Die Kühle umfing sie wohltuend, als sie in das Foyer der »Calusa Cottages« trat. Über ihr kreisten unermüdlich die riesigen Deckenventilatoren.
»Hi, Debbie! Hi, Mr. Sanborn!«, rief sie Richtung Rezeption, wo eine rundliche Frau mit einem sonnigen Lächeln im Gespräch mit dem Chef war.
Tiryn hatte auch gelegentlich Dienst an der Rezeption, aber heute steuerte sie auf die winzige Boutique »Easy Days« zu, für die sie zusammen mit Peri verantwortlich war. »Entspannte Tage«, so hatten sie den Laden genannt, weil es genau das war, was die Gäste hier suchten und was man ihnen geben musste, wenn sie wiederkommen sollten.
Ein älteres Pärchen wartete vor der Tür. Sie trugen eng anliegende einfarbige Polohemden und Sommerhosen in einem nichtssagenden Bürobeige. Tiryn begrüßte sie mit einem Lächeln und schloss die Tür auf.
»Was kann ich für Sie tun?«
»Wir wollten uns nur mal umsehen.«
»Gern! Lassen Sie sich Zeit.«
Tiryn wusste, was sie suchten, doch die beiden würden etwas länger brauchen, bis sie es merkten. Auf der Suche nach Farben waren sie und nach einem Stoff und Schnitt, der ihnen das Gefühl gab, frei zu sein.
»Meinen Sie, das hier würde mir stehen?«
Der Mann hielt ihr ein weites Hemd entgegen, auf dessen großzügiger Fläche Papageien und Schmetterlinge tobten.
»Bestimmt. Probieren Sie es doch an.«
Ermutigt von Tiryns strahlendem Lächeln verschwand er in der Kabine, gefolgt von seiner Frau mit einem trägerlosen Sommerkleid.
»Ihr zwei verkauft nur deshalb so viele Klamotten, weil ihr ausseht wie der Urlaub persönlich«, behauptete Nelson Sanborn, der Chef, gern.
Tatsächlich überzeugte der Anblick von Peris dunkler Haut und schneeweiß blitzendem Lächeln und von Tiryns kinnlangen, glatten schwarzen Haaren und dunklen Augen die Kunden davon, dass sie im exotischen Urlaubsparadies angekommen waren. Zudem vermittelte ihnen Tiryns rechte Augenbraue, die im Gegensatz zur geraden linken fragend schräg nach oben verlief, das Gefühl, dass sie ihnen gut zuhörte.
Beschwingt verließen die Neuankömmlinge bald die Boutique als andere Menschen, mit einem leichteren Schritt, aufrechteren Schultern und einem sommerlichen Lächeln. Mit den neuen bunten Kleidungsstücken hatten sie für zwei Wochen auch ein neues Leben übergestreift, ein Leben voller Abenteuer, Möglichkeiten und Träume.
»Tiryn?« Nelson kämpfte sich durch die schmale, von Kleiderständern fast zugestellte Tür. Er war ein großer, schwerer Mann, und das Bündel pastellfarbene Bettwäsche in seinen unbeholfenen Händen wirkte rührend. Tiryn konnte ein zärtliches Schmunzeln nicht unterdrücken.
Weil er ein Chef war, der sich nicht scheute, auch bei der Bettwäsche selbst mit anzupacken, wären die meisten seiner Angestellten für ihn durchs Feuer gegangen. Wenn sie von ihm sprachen, nannte sie ihn alle Nelson. Das wusste er, bestand aber der Autorität und Ordnung halber darauf, dass sie ihn offiziell mit Mr. Sanborn ansprachen.
Er kannte Tiryn seit ihrem siebten Lebensjahr. Seit dem Tag, an dem ihre Mutter mit ihr am Hoteltresen aufgetaucht war und nach Arbeit gefragt hatte. Tiryn hatte sich mit dem viel zu schweren Koffer in der Hand hinter einer Topfpalme versteckt. Dass es nie Sinn hatte, hinter ihrer Mutter Schutz zu suchen, wusste sie längst. Mr. Sanborn hatte sie dennoch sofort entdeckt, sich aus beeindruckender Höhe zu ihr heruntergebeugt, ihr den Koffer abgenommen und auf eine Tür gezeigt.
»Wenn du da langläufst, findest du die Küche. Dort wird man dir Ocean Lime Pie geben, während ich mich mit deiner Mutter unterhalte.«
Tiryn hatte gezögert. Normalerweise gab ihr niemand einfach etwas. Aber er machte ihr mit einem ermunternden und gleichzeitig bestimmten Schubs Mut, und sie machte sich auf die Suche.
Seitdem war Ocean Lime Pie, dieses Zauberwerk aus dem Saft der einheimischen Limette, Ei und Sahne auf einem Tortenboden für sie der Inbegriff vom Himmel auf Erden. Als sie irgendwann wieder die blitzsaubere, nach Kräutern und frischem Brot duftende Küche verließ, hatte ihre Mutter einen Arbeitsvertrag als Zimmermädchen und eine Unterkunft in einem der Personalwohnhäuser.
Obwohl Tiryn bald darauf ihren leiblichen Vater Sam und ihren Großvater Nicholas kennenlernte, blieb Nelson eine Art verlässliche Vaterfigur für sie. Er gehörte nicht zur Familie. Somit war er beruhigend frei von Rätseln, Geheimnissen und Geistern.
Es war Nelson, der Tiryn in die Schule scheuchte, wenn er sie beim Schwänzen erwischte, oder in die Küche, wenn sie nichts zu essen bekommen hatte. Nelson bezahlte sie für kleine Jobs. Sie verteilte Flyer an Gäste, half im Garten beim Jäten oder schälte Süßkartoffeln für die Küche. Sie war mit zu großen Gummihandschuhen, Besen und Schaufel unterwegs und kehrte den Waschbärendreck aus den offenen Treppenhäusern vor den Gästezimmern in einen Eimer. Das machte ihr Spaß, denn dabei hörte sie hinter den geschlossenen Türen die unterschiedlichsten Gespräche. Manche der Fremden stritten ebenso wie Tiryns Eltern. Andere waren dermaßen verliebt und schwärmten so sehr von dem warmen Meer, dem exotischen Essen und den sorglosen Tagen, dass das Glück in Tiryns Phantasie unter den Türen hindurchdrang.
Viel später, nachdem sie ihren Schulabschluss hatte, arbeitete Nelson sie am Empfang ein und machte ihr den Vorschlag mit der Boutique. Und so bauten sie gemeinsam den kleinen, aber feinen Verkaufsladen auf, bis schließlich auch noch Peri zu ihnen stieß.
Nelson war der geborene Patriarch, aber er behauptete, nicht genug Zeit für eine Beziehung zu haben. Seine Angestellten seien seine Familie. Das Hotel mit seinem Hauptgebäude und den vielen einzelnen kleinen Häusern drumherum hatte er nach den Calusa benannt, einem Indianervolk, das einst in der Gegend gelebt hatte. »Von den Menschen, die zuvor an einem Ort gelebt haben, bleibt immer etwas«, meinte Nelson. »Spuren von ihrer Energie und ihrem Wesen haften an der Erde, atmen in den Pflanzen, treiben im Wind. Sie sollen nicht vergessen werden. Es ist gut für die Lebenden, ihre Gegenwart anzuerkennen.« Im Laufe der Jahre machte er mit unermüdlichem Fleiß und Sorgfalt aus »Calusa Cottages« die beliebteste Ferienanlage in ganz Pelican’s Foot.
Jetzt packte er das Bündel Bettwäsche vor Tiryns Nase auf den Ladentisch.
»Die Näherin ist krank, und die hier haben Löcher. Kannst du dich bitte darum kümmern?«
»Natürlich. Gerne.«
Er klopfte ihr zerstreut auf die Schulter. »Danke, danke!«
Schon stürmte er hinaus, auf dem Weg zum nächsten Problem. Egal, wie klein es war, er betrachtete sie alle als seine. Sie sah ihm nach. Er wirkte, als wären ihm seine langen Beine immer einen Schritt voraus. In all den Jahren war ihm keine Spur seiner Energie verlorengegangen. Es war, als wäre er überhaupt nicht gealtert. So anders als Opa Nicholas! Schon als Tiryn ihren Großvater kennenlernte, waren Opa Nicks Schultern unter einer unsichtbaren Last gebeugt gewesen. Besonders im letzten Jahr schien sich dieser Druck verstärkt zu haben. Schmal war er auch geworden. Tiryn hatte eine Ahnung, dass nicht allein Opa Nicks Sehnsucht nach seiner Heimat der Grund dafür war. Und auch nicht die Tatsache, dass ihm vor einer Ewigkeit diese Frau namens Henny das Herz gebrochen hatte. Irgendetwas belastete seine Seele, und seit Oma Bella nicht mehr da war, um ihn vor seinen Geistern zu beschützen, wurde es stetig schlimmer. Tiryn musste dringend herausfinden, was es war.
Ocean Lime Pie
150 g Salzcracker
150 g weiche Butter
5 TL Zucker
165 ml Kondensmilch
4 Eigelb
4–5 EL Zucker
Saft von 5 Limetten
2 Becher süße Sahne
1/2–1 frische Ananas
Meersalz
Ofen auf 175 °C vorheizen. Die Salzcracker in einer Küchenmaschine zerbröseln, mit weicher Butter und Zucker vermischen, bis eine gleichmäßige Masse daraus geworden ist. 15 Minuten im Kühlschrank kaltstellen.
Springform einfetten und mit Semmelbröseln bestreuen. Die Cracker-Mischung auf dem Boden glattstreichen. 18 Minuten backen, bis der Boden goldbraun wird. Auskühlen lassen.
Währenddessen für die Füllung die Kondensmilch mit den 4 Eigelb verquirlen. Zucker und Limettensaft hinzufügen.
Mischung auf den ausgekühlten Boden geben. 16 Minuten weiterbacken, bis die Füllung fest wird. Erneut abkühlen lassen und in den Kühlschrank stellen.
Währenddessen Sahne schlagen und nach Wunsch süßen. Ananas in kleine Stücke schneiden und abtropfen lassen. Sahne auf den ausgekühlten Kuchen geben, Ananasstücke hinzufügen, auf Wunsch mit etwas Meersalz bestreuen. Servieren.
2 Die Brücke zum Mond
Die geflickte Bettwäsche lag in einem säuberlichen Stapel zur Abholung bereit. Im Foyer kamen und gingen noch Gäste, doch in die Boutique kam niemand mehr, denn die Ladenschlusszeit war vorüber. Tiryn zögerte. Sie hatte es nicht eilig, nach Hause zu kommen und herauszufinden, in welcher Verfassung ihre Mutter heute war. Sie drehte einen Kissenbezug hin und her, den sie nicht mehr hatte flicken können. Wenn man die ausgefransten Kanten abschnitt, bliebe genug weicher, pastellfarben gemusterter Stoff, um ein hübsches Oberteil daraus zu schneidern. Nelson sah es nicht gern, wenn sie selbstgenähte Kleidung verkaufte, weil es die Abrechnungen der Boutique durcheinanderbrachte. Dabei machte Tiryn die Abrechnung selbst, und ihr war noch nie ein Fehler unterlaufen. Sie konnte gut mit Zahlen umgehen. Zahlen waren so angenehm berechenbar! Sie bekamen keine Wutanfälle und sie brachen keine Versprechen. Tiryn half darum auch gelegentlich in der Buchhaltung der Zimmerverwaltung aus.
»Wenn du so weitermachst, vererbe ich dir eines Tages das Hotel«, hatte Nelson einmal nicht ganz scherzhaft gesagt, als sie das Kuddelmuddel einer Vertretung wieder in Ordnung gebracht hatte.
Vorerst hatte er ihr eine Vitrine im Foyer zur Verfügung gestellt, um den Schmuck zu verkaufen, den sie herstellte.
Tiryn genoss die Ruhe im Laden, schnitt zu und nähte und dachte dabei an einen Anhänger, den sie gestern in ihrer Kammer zurechtgeschliffen hatte. Der Schmuck, den sie verkaufte, war für ihr Ostseekonto die größte Einnahme.
Oma Nanaiya, die Mutter ihres indianischen Vaters Sam, hatte ihr die Schmuckherstellung beigebracht, wenn sie in den Wintermonaten zu Besuch war. Nanaiya war Choctaw durch und durch. Ihr Name bedeutete Friedensstifterin, aber auch sie konnte die Ehe von Tiryns Eltern nicht in Ordnung bringen. So lenkte sie Tiryn von ihrem Kummer ab, indem sie ihr indianisches Handwerk beibrachte. Zuerst unterrichtete sie sie im Korbflechten, dann zeigte sie ihr, wie man mit Schmuckdraht und Lederbändern umging, wie man Silber schneiden, biegen und hämmern konnte und wie man Perlen so anordnete, dass sie ein Ganzes ergaben.
»Die Farben müssen sich unterhalten, nicht streiten«, erklärte sie.
Zurzeit waren es mehr die Formen als die Farben, die Tiryn faszinierten. Sie hatte zwischen den Dünen einen Flusslauf entdeckt, in dem sich versteinerte Muscheln und Schneckenhäuser befanden. Man musste sehr genau hinsehen, denn sie waren mit Kalk, Salz und Schlamm verkrustet. Doch wenn man sie vorsichtig bürstete, kamen sie zum Vorschein und begannen zu glänzen. Gerade dadurch, dass sie zum Teil zerbrochen waren und man ihr uraltes Innerstes sah, hatten sie eine interessante schwarzweiße Struktur. In Silber gefasst sahen sie an einem geflochtenen Lederband oder einer Kette großartig, edel und geheimnisvoll aus. In die Vitrine im Foyer hatte Tiryn Sand gehäuft und ihren Schmuck darauf ausgestellt. Das wirkte natürlich und zog die Blicke der Gäste auf sich. Außerdem verlieh es dem Foyer eine gehobene Note.
Das Problem mit dem Flusslauf war, dass sich dort gern Klapperschlangen auf den heißen Steinen sonnten. Oft häuteten sie sich. Ihre durchsichtigen Hüllen mitsamt den Augenhäuten hinterließen sie am Ufer, und diese schuppigen Überbleibsel sahen so lebendig aus, dass Tiryn immer wieder darauf hereinfiel. Mit der Zeit aber wusste sie die lebendigen Schlangen von den leeren Hüllen zu unterscheiden und nahm sich nur noch in Acht, wenn es nötig war. Andererseits hatten die Schlangen den Vorteil, dass sich kaum jemand dorthin wagte und ihr Geheimnis gut aufgehoben war. Niemand machte Tiryn die Beute streitig.
Als das Oberteil fertig war, hatte sie eine Lösung gefunden, welche Fassung für den Anhänger die beste sein würde. Schöne Dinge machten Tiryn glücklich. Das hatte sie sofort bemerkt, damals, als Oma Nanaiya sie das Handwerk gelehrt hatte. Schöne Dinge machten leichter, dass manches um sie herum so hässlich war. Sie hatte es selbst in der Hand und fühlte sich nicht mehr so hilflos.
Jetzt zog sie noch ein Lederbändchen durch den Saum der Bluse und befestigte zwei Muscheln daran. Die Farbe würde Peri gut stehen. Tiryn faltete das Werk, verstaute es in ihrer Tasche und schloss den Laden ab.
»Tschüs, Tiryn!«, rief Debbie vom Tresen her.
Tiryn zog die Schuhe aus. Der abendkühle Sand war angenehm unter ihren Füßen. Sie lief unter den Häusern durch, die auf Stelzen gebaut waren, damit sie nicht geflutet wurden, wenn wieder einmal ein Sturm die hungrigen Zungen des Meeres über den Strand jagte. Früher hatte Tiryn hier gern in den großzügigen Schatten gespielt, während von den Balkons über ihr das Klimpern der Eiswürfel in den Cocktailgläsern der Gäste klang. Auch Schätze fanden sich unter den Häusern, von der Flut in die Strudellöcher um die Pfähle gespült: Treibholz und seltene Muscheln, Samen und Fischknochen ebenso wie verlorene Schlüssel, Sonnenbrillen und Kämme. Ein Tornado oder Hurrikan hob immer wieder das ausgebreitete Leben vom Strand wie ein schmutziges Tischtuch, warf es weg und breitete ein anderes darauf aus. Hinterher war alles neu sortiert, nur um schnell in alte Muster zu fallen, bis sich auf der Wetterkarte erneut die bedrohlichen Kreise näherten, mit deren Folgen man sich hier arrangiert hatte.
In der Ferne rutschte die Sonne unter einer grauen Wolkenbank hervor. Wie ein Echo warf der Sand ein unwirkliches rotes Licht zurück. Moskitos summten in Tiryns Ohren. Unwillig schlug sie nach ihnen und war so abgelenkt, dass sie an der nächsten Hausecke fast mit einer schlanken Gestalt zusammengeprallt wäre, die ihr singend und mit einer vollen Einkaufstüte im Arm entgegenkam.
»Tiryn! Gut, dass ich dich treffe!«
»Peri! Ja, das ist gut, ich hab was für dich!«
Doch Peri hörte nicht zu. Sie stellte die Tüte in den Sand, packte Tiryn an beiden Händen und drehte sich mit ihr im Kreis.
»Stell dir vor, was passiert ist! Du bist die Erste, die es erfährt!«
Hinter ihr fiel die Tüte um und streute Orangen zwischen vertrockneten Seetang. Der Geruch von Schokoladenmuffins stieg in Tiryns Nase. Ihr Magen knurrte vernehmlich.
»Kann ich einen Muffin haben?«, fragte sie.
»Muffin! Dies ist ein feierlicher Moment, und du denkst an Schokoladenmuffins! Stell dir vor, Joey und ich werden heiraten. Im September!«
»Herzlichen Glückwunsch.« Tiryn war nicht überrascht. Sie versuchte, sich für die Freundin zu freuen, aber bei dem Thema Heiraten stieg aus ihrem Magen grundsätzlich Unbehagen auf. Für Peri musste sie jetzt das Beste hoffen. Joey war ein fröhlicher, anständiger Kerl, den man einfach gern haben musste. Sicher würde alles gutgehen. »Ganz herzlichen Glückwunsch, Peri, alles, alles Gute!«, wiederholte Tiryn mit mehr Überzeugung und umarmte die Freundin fest.
»Ich weiß, was du vom Heiraten hältst. Aber für mich ist es richtig! Ich bin mir sicher.« Peri legte Tiryn die Hände auf die Schultern und sah sie ernst an. In ihren dunklen Augen lag ein tiefes, altes Wissen, das Tiryn dort nicht zum ersten Mal sah. Wie bei Oma Nanaiya. Das Wissen jener, die in ihrer Kultur und ihrem Land und in sich selbst ganz zu Hause sind.
Anders als sie selbst.
»Hier.« Tiryn kramte in ihrer Tasche. »Ein Verlobungsgeschenk! Wusste ich nur vorhin noch nicht.«
Während Peri sich strahlend das Oberteil anhielt und dabei wieder in Tanzschritte fiel, mopste Tiryn einen Muffin. Sie schmeckte der bittersüßen Schokolade nach und wünschte sich etwas von Peris Leichtigkeit. Peri war nach einer Blume benannt, nach den immergrünen Periwinkles mit den blauen Blüten, aber sie war eher ein Schmetterling, der sich in allen Lebenslagen von einem heiteren Aufwind tragen ließ.
»Du wirst doch meine Trauzeugin sein?« Peri blieb vor Tiryn stehen und griff sich auch einen Muffin. Tiryns Zögern entging ihr nicht. »Ja, ja, du hast eine Heiratsallergie«, sagte sie undeutlich um den Kuchen herum. »Aber für mich machst du es doch trotzdem, oder? Es wird alles gut. Ich verspreche es dir.«
Nun, versprechen konnte man so etwas nicht; und nicht alles würde gut werden, aber für Peri und Joey wahrscheinlich schon. Tiryn fühlte sich leichter. Ein unbeschwertes Fest würde allen guttun.
»Klar. Versprochen!«
Peri betrachtete das neue Oberteil. »Das ist sooo schön! Kannst du mir nicht einen passenden Rock nähen, dann habe ich gleich ein Hochzeitskleid?«
»Aus einem alten Bettbezug? Bist du verrückt?« Tiryn hockte sich hin und zeichnete in den Sand. »Ein Hochzeitskleid für dich müsste so aussehen … und so … Es müsste von Wind und Sonne und Sternen erzählen, vom Tanzen und vom Lachen – von dir eben.«
Den ganzen Weg nach Hause huschten Ideen zu dem Kleid durch ihren Kopf wie glänzende Kolibris. Ein sanftes, aber schimmerndes Gelb, eher irgendwo zwischen Gelb und Champagnerfarben – das würde zu Peris Persönlichkeit passen. Oder doch Apricot? Wadenlang und schwingend, aber schlicht. An den Ärmeln dezent gestickte traditionelle Muster, Symbole des Glücks, grün … und echte Blüten im Haar natürlich, Bougainvillea oder Frangipani? Nein, Orangenblüten, das passte besser!
Es war fast dunkel, als sie an den Häusern der Angestellten ankam. Sie lagen hinten, am weitesten weg vom Meer. In der Wohnung brannte kein Licht. Das war kein gutes Zeichen, aber auch nicht das schlechteste.
Sie öffnete leise die Tür.
»Lara?« Ihre Mutter hatte ihr nie erlaubt, sie anders als bei ihrem Namen zu nennen. Es störte Tiryn längst nicht mehr.
Keine Antwort. Tiryn schaltete das Licht an. Lara saß am Tisch und starrte auf einen unordentlichen Haufen geöffneter Briefe.
»Hallo.« Tiryn holte zwei Teller und Gabeln und nahm einen Behälter aus ihrer Tasche. Sie setzte sich zu Lara. »Die Köchin hat mir Reissalat mitgegeben. Magst du?« Sie füllte die Teller und schob Lara auffordernd einen zu. Ihre Mutter war viel zu dünn. Kein Wunder.
»Absagen. Alles Absagen. Keiner will mehr eine Liveband. Musik nur aus der Konserve. Die Leute haben keinen Stil mehr. Anrufe gab es auch nicht. Hast du die Flyer wirklich alle verteilt?«
»Ja. Peri hat mir geholfen. Wir haben alles abgeklappert. Vielleicht rufen sie vor dem Wochenende an. Montags haben viele zu.«
Das Wissen, dass der Wochentag nicht der Grund war, lag unsichtbar zwischen ihnen auf dem Tisch. Nur kein falsches Wort jetzt, das es sichtbar machte. Tiryn hatte nicht die Kraft, einen von Laras plötzlichen Wutanfällen abzufangen. Nicht heute. Da war das stille Selbstmitleid das kleinere Übel.
Es lag nicht am Montag. Es lag daran, dass der liebenswerte Glanz, der einmal über Lara und ihrer Band gelegen und die Zuhörer angezogen hatte wie Nektar die Mondmotten, mit jedem Glas Gin Tonic nachgelassen hatte. Daran, dass Verbitterung in Laras Augenwinkeln nistete, wo Lachfalten hätten sein sollen. Dass die Sonne ihrem künstlichen Platinblond einen giftgrünen Stich verliehen hatte. Früher hätte Lara darauf geachtet. Heute war es ihr egal.
»Iss was, bitte!« Tiryn schob den Teller näher. »Es schmeckt toll. Es sind sogar Wasserkastanien drin, die magst du doch.«
»Wasserkastanien! Wir sind abgeschrieben, und du kommst mir mit Wasserkastanien!« Mit einer heftigen Handbewegung schob Lara den Teller zur Seite. Er hüpfte klirrend auf der Tischplatte. Reiskörner flogen mit den Briefumschlägen auf den Boden.
Tiryn schlang ihren Salat herunter, stellte die Teller in die Küche und ging hinaus.
»Mach das Licht aus!«, rief Lara ihr nach. Tiryn ließ es an und schloss die Tür vernehmlich hinter sich.
Sie setzte sich auf die Stufen. Im Strandhafer schwoll schrill der pausenlose rhythmische Chor der Zikaden, und nach kurzer Zeit fielen die Ochsenfrösche ein. Warum gab es in diesem Land keine Stille? Die Touristen fanden die Zikaden romantisch. Für ein paar Wochen mochten sie das auch sein. Aber wenn es nie ein Entrinnen gab, konnte einem das Geräusch den letzten Nerv rauben.
Nun legte Lara drinnen auch noch eine Platte auf. Eine zwanzig Jahre alte Aufnahme von ihr selbst, auf der man mehr Kratzer als Töne hörte. Wenigstens war sie aus ihrer Lethargie erwacht.
Tiryn stützte den Kopf in die Hände, hielt sich die Ohren zu und schloss die Augen. Sie dachte an Opa Nicks Erzählungen vom Darß, der Halbinsel an der Ostsee, wo er geboren wurde.
»Dort gibt es Wiesen am Bodden, da ist die Stille so dick, dass du sie anfassen kannst. Es ist, als ob sie dich trägt. Dort kannst du dich selbst ganz spüren. Du könntest dich denken hören, aber in dieser Stille sind Worte unnötig, deshalb hört selbst das Denken auf. Ich war nie so glücklich wie dort …«
»Was ist das, der Bodden?«, hatte sie gefragt.
»Ein flaches Binnengewässer … still und blau. In Ahrenshoop siehst du vom Dachboden aus vorne das Meer und hinten den Bodden. So einen Ort gibt es kein zweites Mal.«
»Wessen Dachboden?«
»Von allen Dachböden.«
Aber sie wusste, dass er das Haus dieser Henny meinte, in dem er mit ihr nach der Hochzeit hatte leben und glücklich werden wollen. Bis sie ihn verlassen hatte.
Auf dem Bild, das er von den Boddenwiesen gemalt hatte, war diese Stille zu spüren. Sie hatte es so oft angesehen, dass sie sich jederzeit hineinträumen konnte. Das half ihr auch jetzt. Die falschen Töne und der schrille Zikadenchor verstummten. Irgendwann würde sie dort stehen, auf einer Wiese am fernen Bodden, und sich in die Stille fallen lassen …
Eine ungestüme Berührung riss sie aus ihrem Tagtraum. Feucht schob sich eine Schnauze unter ihren Ellenbogen.
»Shaui!«
Als Jungtier war die Waschbärin angefahren worden. Tiryn hatte ihr das Hinterbein verbunden, eine Hütte gebaut und sie gefüttert, bis sie sich allein versorgen konnte.
»Du und deine Tiere!«, hatte Lara geschimpft.
Shaui war das Choctaw-Wort für Waschbär. Tiryn hatte lange nach einem Namen gesucht, aber am Ende war es bei dem spontanen »Shaui« geblieben. Die Waschbärin hörte auf nichts anderes und auch darauf nicht immer. Geheilt war sie in ihr eigenes freies Leben in den Mangrovenwäldern und dem Gebüsch des Hotelgrundstücks zurückgekehrt, aber die Freundschaft zwischen Tiryn und Shaui war geblieben. Shaui tauchte auf, wenn sie Hunger auf Marshmallows hatte – aus irgendeinem Grund war sie verrückt nach gerade dieser ungesunden Süßigkeit. Ebenso spürte sie es oft, wenn Tiryn Trost brauchte. Wie jetzt. Die Berührung ihres Fells im Dunkel und ihr leises Brummen taten gut. Mit ihren geschickten, fast menschlichen Fingern tastete und zupfte Shaui an Tiryns Rock.
»Achukma hote, Shaui. Ich bin okay. Du hast recht. Hier sitzen und grübeln bringt nichts.« Sie stand auf, ließ ihre Schuhe auf der Treppe stehen und folgte Shaui, die auf den Trampelpfad durch das Gebüsch zulief. Er führte zum Strand.
Dort gellten die Zikaden nicht mehr so laut in ihren Ohren. Am Strand war es stiller, nur kleine Wellen ließen die angeschwemmten Muschelschalen leise klirren. Ein abnehmender Zweidrittelmond löschte die Hälfte der Milchstraße, warf eine Silberbrücke über das Wasser und erhellte den Sand, auf dem die Ranken der Trichterwinden mit den fest geschlossenen Blüten jetzt schwarz wirkten wie ein bizarres Spinnennetz. Tiryn beeilte sich, über die Tanghaufen am Flutsaum hinwegzuspringen. Dort lauerten die Sandflöhe, deren Stiche eine Ewigkeit gemein an den Knöcheln juckten. Am Wasser auf dem glatten feuchten Sand war man vor ihnen fast sicher.
Shaui hatte sich im Gebüsch niedergelassen.
»Yakoke! Danke!«, rief Tiryn in ihre Richtung.
Hier konnte sie durchatmen. Es war kühler, und die Schwere des Selbstmitleids ihrer Mutter war mit dem Zikadenlärm hinter den Dünen zurückgeblieben.
»Wofür dankst du mir?« Kimonis Stimme klang durch das Dunkel. Sie nahm seinen vertrauten Geruch wahr, bevor seine Silhouette auftauchte. Seinen Duft nach Krabben und Holz, Salz und Ingwerbonbons.
»Ausnahmsweise mal nicht dir. Was machst du hier?«
»Die Nacht ist zu schön, um sie bei künstlichem Licht zu verbringen. Ich wollte dem Mond was erzählen und lesen, was er auf die Wellen schreibt.«
»Und? Hast du?«
»Aber sicher.« Er strahlte sie an, seine Zähne und Augen in der Dunkelheit hell wie die Schaumkronen auf den Wellen.
»Was schreibt er?«
»Es war nur für mich. Jeder muss seine Geschichten selbst lesen. Was ist mit dem Meereskino? Haben dir die Wellen schon gezeigt, wer die traurige Frau ist?«
»Nein.« Tiryn zuckte mit den Schultern. »Zurzeit komme ich in keiner Sache weiter.« Weder hatte sie das Rätsel der Frau lösen können, noch wusste sie, was Opa Nick bedrückte, noch konnte sie ihrer Mutter helfen. Das Ostseekonto füllte sich auch nur langsam – und selbst, wenn sie morgen in der Lotterie gewänne, sie konnte Lara in diesem Zustand ohnehin nicht allein lassen.
»Wenn das Meer dir etwas sagen will, wird es das zum richtigen Zeitpunkt tun. Lass uns schwimmen gehen.«
Das Meer schwieg, aber es trug sie zuverlässig wie immer, machte alles Gewicht leichter, auch die Sorgen. In der Dunkelheit sah man den Horizont nicht, erkannte ihn nur daran, wo die silberne Mondspur auf dem Wasser begann. Es war, als ob man in diesem schwarzen Himmel schwamm, nur wenig tiefer als die Sterne. Die Hitze war mit dem Tag gewichen, doch sanfte Wärme war in Sand, Wasser und Luft geblieben, so dass kein Frösteln über ihre Haut lief.
Mit Kimoni konnte sie gut schweigen, sie kannten sich lang genug. Es gab nie Verlegenheit zwischen ihnen. Aber sie konnte auch nichts vor ihm verbergen. Er spürte ihre Traurigkeit.
»Komm her«, sagte er und nahm sie in den Arm. Zusammen standen sie im Wasser, das ihnen bis an die Schultern reichte, wie Seetang von den Wellen gewiegt.
Es könnte alles so einfach sein, dachte Tiryn. Wenn sie nur ebenso hierhergehören könnte wie Kimoni. Doch trotz Nelson Sanborn, Opa Nick und ihrem Vater Sam, trotz Kimoni und Peri, die sie damals alle aufgenommen hatten wie eine der Ihren – trotz Colly und Shaui und den blauen Trichterwinden und allem, was sie an diesem Land liebte –, mit den Jahren wurde das Gefühl, dass sie hier nicht zu Hause war, stärker.
Und Kimoni? Sie liebte ihn wie einen Freund, wie einen Bruder, aber nicht so wie Opa Nick seine Henny. Und auch er brauchte sie nicht.
Dies war nicht ihr Leben. Da war wie ein Schmerz die Sehnsucht nach dem fremden Strand, in ein weiches Licht gehüllt, der im Winter filigrane Spitzenränder aus Eis trug und von dem ihr Opa Nick Geschichten erzählt hatte, seit sie ihn kannte.
Nur – wie konnte das sein? Und war es wirklich ihre eigene Sehnsucht, oder hatte sie nur die von Opa Nick übernommen?
Auch die Gesichter, die sie manchmal flüchtig in seinem Bernsteinschiff sah, konnten ihr diese Frage nicht beantworten.
Sie würde es herausfinden müssen, und das ging nur, indem sie dorthin fuhr. Der Himmel wusste, wann das sein würde.
»Wenn du unbedingt Schnee kennenlernen möchtest, lass uns doch ein Wochenende nach Vermont oder Oregon oder wohin du willst fahren«, schlug Kimoni vor, der ihre Träume kannte. »Das kriegen wir hin, trotz Lara. Es muss nicht viel kosten.«
»Das würdest du tun?« Tiryn wusste, wie ungern er Florida verließ. Er war genau dort, wo er sein wollte.
»Für dich – natürlich! Außerdem sagt Peri, mir fehle Bildung.«
Tiryn musste lachen. »Ausgerechnet dir!«
»Sie hat recht. Ich habe auch noch nie Schnee gesehen.«
»Ich danke dir für das Angebot. Aber in der Hinsicht musst du dich ohne mich bilden. Den Schnee möchte ich an der Ostsee kennenlernen oder gar nicht. Ich möchte Opa Nicks Märchen in Wirklichkeit sehen, verstehst du? Lass mir den Traum.«
»In Ordnung«, sagte er. »Dann lass uns dem Mond noch bis zur Sandbank entgegenschwimmen, da er extra die Brücke für uns gemalt hat. Er versteht was von Träumen. Deinen kennt er nun auch und wird ihn für dich hüten, falls du ihn aus den Augen verlieren solltest.«
»Was hältst du von Peris Verlobung?«, fragte Tiryn.
»Es ist gut. Das ist allein Peris Geschichte, weißt du. Das hat nichts mit der Geschichte deiner Eltern und Großeltern zu tun. Du musst keine Angst für sie haben.«
Tiryn atmete tief durch. »Wenn du es gut findest, ist es gut. Komm, lass uns den Mond nicht enttäuschen.«
Die Sandbank hatte die Form eines riesigen Pelikanfußes. Nach ihr war der Ort benannt, Pelican’s Foot. Auch eine Muschelsorte gab es, die genau dieselbe Form hatte. Meist waren sie weiß, manchmal grau, und jede sah ein wenig anders aus. Manchmal waren sie fingernagelgroß, manchmal so lang wie ein ganzer Finger. Tiryn mochte sie besonders gern, und der Schmuck, den sie daraus fertigte, wurde von den Kunden am liebsten gekauft – als Andenken an den Urlaub in Pelican’s Foot.
Als sie schnaufend an der Sandbank ankamen und sich in der Bucht zwischen dem ersten und zweiten Zeh ausruhten, lachte Kimoni sie an.
»Besser?«
»Viel besser.« Sie fühlte sich leicht. Das Meer hatte wieder einmal die Schwere aus ihren Gedanken gelöst und das Dunkle aus ihren Gefühlen. Sie fragte sich, wo das blieb, was das Wasser ihr auf diese Art abnahm und fortspülte. Es löste sich, aber es verschwand nicht. Wo wurde es hingetragen oder angespült? Irgendwann, irgendwo würde sie wieder darüber stolpern. Aber nicht heute Nacht.
Im Sand lag etwas Helles. Kimoni hob es auf.
»Schau mal.«
Es war eine besonders schöne Pelikanfußmuschel, reinweiß, die Zehen deutlich ausgeprägt und gespreizt, wie ein Fuß, der sicher steht.
»Sie soll dich daran erinnern, dass du eines Tages den Platz finden wirst, an den du gehörst«, sagte Kimoni und steckte die Muschel unter den Träger ihres Bikinis. »Und nun lass uns zurückschwimmen, der Mond wird müde.«
Tatsächlich machte dieser Anstalten unterzugehen, und seine Brücke verblasste.
Hinter den Dünen sangen die Zikaden, aber ihr Lied war sanfter geworden. Ein anderes mischte sich hinein. Tiryn blieb still hinter den Seetraubenbäumen stehen, obwohl das trocknende Salzwasser auf ihrer Haut juckte und die Mücken sich auf sie stürzten.
Lara saß auf den Stufen und sang. Das Licht der Lampe an der Haustür warf einen warmen Glanz auf ihre Haare und nahm ihnen ihre erschöpfte Strohigkeit. Das Licht zeigte aber auch die Tränen auf Laras Wangen. Ihre Stimme klang heute Abend beinahe so klar wie früher, als es ihretwegen noch still wurde in überhitzten Lokalen, wenn die schwitzende Menge verhielt und lauschte. Laras Lieder waren wie ein frischer Wind in der Seele, weil in ihrer Stimme etwas von Nicholas’ nördlicher Kühle klang, ein Funkeln wie in seinen Erzählungen vom Schnee. Ein Funkeln, das auch in ihrem Lachen lag und in ihrer Persönlichkeit und das bewirkte, dass man ihr immer und immer wieder verzieh.
Tiryn wagte kaum zu atmen, um sich nicht zu verraten. Gern hätte sie sich neben ihre Mutter gesetzt und sie in den Arm genommen, aber sie wusste, dass Lara das nicht ertrug.
Wenn diese Henny nicht vor einer halben Ewigkeit Opa Nick verlassen hätte, wenn er nicht daraufhin so halbherzig mit Oma Bella zusammengekommen wäre – wäre Lara dann anders geworden? Müßige Frage. Dann gäbe es Lara gar nicht und sie selbst auch nicht. Trotzdem: Nicht zum ersten Mal wünschte sich Tiryn, diese Henny Badonin zur Rede stellen zu können.
Doch Henny war tot, und seit Nicholas in seine alte Heimat gereist war, um an ihrem Grab zu stehen, waren seine Schultern noch gebeugter.
Aber Lara – wenn sie noch so singen konnte, dann musste es doch möglich sein, wieder einen Glauben an sich und eine Zukunft in ihr zu wecken.
3 Meergeheimnisse
In der Morgenkühle war es noch angenehm, Fahrrad zu fahren. Tiryns erster Halt war Marianne’s Coffee Shop. Ihr eigentliches Ziel waren die drei Männer, die auf der Bank davor herumlungerten.
»Hi, Tiryn«, begrüßten sie sie höflich im Chor und tippten sich an ihre Hüte, die ebenso wie ihre Besitzer schon bessere Tage gesehen hatten. Lenny, Rick und Jem waren inzwischen um die siebzig. Für Tiryn waren sie so etwas wie Onkel; sie hatten sie halb mit aufgezogen und manches Mal beschützt, wenn Lara nicht in der Lage dazu war. Sie waren Laras »Band«, und sie spielten nicht schlecht. Nur nahmen sie die Angelegenheit längst nicht mehr ernst. Für sie waren die gelegentlichen Engagements in Kneipen oder bei Kleinstadtfesten nur noch ein Spiel, ein Zeitvertreib – und ein Gefallen, den sie Lara aus alter Freundschaft taten. Weil keiner von ihnen es übers Herz brachte, Lara klarzumachen, dass ihr Zauber verflogen war. Nicht, weil sie Mitte vierzig war, sondern weil Groll und Gin ihn aufgezehrt hatten.
»Hey, Jungs. Habt ihr nicht eine Idee, wie wir mal wieder einen Auftrag für euch an Land ziehen können?«
Jem klopfte gemächlich seine Pfeife an der Banklehne aus.
»›Lara und die Limpkins‹ sind nicht mehr gefragt. Ist ja auch kein Wunder.«
»Wir hätten die Band nicht nach diesem komischen Sumpfvogel nennen dürfen. Hat kein Glück gebracht.« Rick nahm seinen speckigen Hut ab und rieb sich mit einem Taschentuch die Glatze, als könnte er das angeschlagene Image der Band so aufpolieren.
»Am Sumpfvogel liegt es nicht, und das wissen wir alle«, sagte Lenny energisch. »Solange Lara sich nicht ändert, geht nichts, Tiryn. Wir haben alles versucht. Jetzt ist sie selbst dran.«
»Aber wenn sich nicht bald was ergibt, stürzt sie ganz ab. Bitte haltet trotzdem die Augen offen, ja?«
Die mangelnde Zuversicht der alten Gefährten überraschte Tiryn nicht. Ihr nächstes Ziel war die Oka Gallery im beschaulichen Zentrum von Pelican’s Foot.
Der Anblick des weißen Hauses unter der betagten Palme, die schief genug war, um darauf zu klettern, heiterte sie jedes Mal auf. »Oka« war das Choctaw-Wort für »Wasser«, denn ihr Vater Sam sammelte und verkaufte Bilder und Skulpturen, die mit dem Wasser zu tun hatten – auch im weiteren Sinne. Nicht nur Gemälde und Zeichnungen vom Meer und den endlosen Sümpfen Floridas, sondern zum Beispiel auch Specksteinfiguren von Wassertieren, geschnitzt von Eskimos. Diese liebte Tiryn besonders. Früher hatte sie mit den Seehunden, Adlern und Schildkröten gespielt, die so glatt und schwer waren und warm wurden in ihrer Hand, als wären sie auf geheime Art lebendig.
Anfangs war Sam auf indianische Kunst spezialisiert, die er mit Leidenschaft einem größeren Publikum nahebringen wollte. Dann tauchte an einem drückend heißen Tag Nicholas Ronning in Sams Laden auf mit einem Stapel seiner Bilder. Als Sam sie kritisch betrachtete, war ein erfrischender, neuer Wind in seinen Räumen spürbar. Die Aquarelle und Acrylbilder erzählten von einem anderen Wasser, mit weißen Rändern und eisigem Blau, mit krummen Kiefern, bizarren Steilküsten und geisterhaft verwitterten Baumskeletten. Mit den Gesprächen über die Bilder entstand eine Freundschaft zwischen den Männern.
Nicholas’ Werke verkauften sich gut. Nicht nur die frische Luft, auch eine fremdartige Melancholie haftete ihnen an, die die Leute in ihren Bann zog – vor allem jene Bilder, auf denen in der Ferne eine geheimnisvolle Frau mit langen, rotbraunen Locken zu sehen war.
So hatten Nicholas und Sam fortan häufig miteinander zu tun, und eines Tages brachte er Lara mit, seine blonde Tochter, deren Wesen nicht nur Sam wie Musik erschien. Nie würde Sam jenen Morgen vergessen, an dem er Laras Lachen zum ersten Mal hörte. Sie stand vor der Zeichnung eines indianischen Künstlers und gestikulierte. Es sah aus, als dirigierte sie ein unsichtbares Orchester zu einer Komposition, die nur sie wahrnahm. Doch als sie sich umdrehte und Sam anstrahlte, klang auch ihm die Melodie in den Ohren.
»Das ist wundervoll. Die Farben sind so leicht. Als ob man fliegen könnte, wenn man es nur ansieht. Was kostet es?«
Er hätte es ihr gern geschenkt, aber er kannte den Künstler und wusste, wie sehr der auf den Verdienst angewiesen war.
»Ja, was kostet es?«, fragte Nicholas, der dazugekommen war und Lara einen Arm um die Schultern legte. Lara machte einen Schritt zur Seite. Sam entging das nicht, aber er dachte damals nicht weiter darüber nach. Sie diskutierten eine Weile freundlich hin und her, und als sie schließlich einen Preis ausgehandelt hatten, war Sam Shikoba Carpenter so verliebt wie nie zuvor in seinen fünfundzwanzig Jahren. Wie ein frischer Frühlingswind stürmte Lara Porter in sein Leben. Als er sie wenig später auf ihre spontane Einladung hin zu einem Fest im Nachbarort begleitete und sie mit ihrer Gitarre auf der Bühne erlebte, dachte er, er würde alles tun, um sie für sich zu gewinnen. Der Gedanke, sie könnte wieder verschwinden, mit einem anderen Mann und womöglich auf die andere Seite des Kontinents, war ihm unerträglich.
Er rechnete sich keine große Chance aus. Lara war ein strahlender Stern, und er? Er war klein und schmal, weswegen sein indianischer Name Shikoba – Feder – lautete, und weder sein dunkler Bürstenhaarschnitt noch seine schlichte Brille machten ihn zu etwas Besonderem inmitten aller Männer, die von Laras Stimme und ihrer Art, die Gitarre zu berühren, verzaubert waren. Niemand war verblüffter als er, dass sie bald Tag für Tag bei ihm auftauchte, ihn zum Tanzen überredete oder zum Schwimmen und offenbar nicht genug von seiner Gesellschaft bekam.
»Du bist so unkompliziert und hast so eine Ruhe in dir«, sagte sie. Beides konnte man von ihr nicht behaupten. Natürlich bemerkte Sam, dass ihr Glanz neben seinem leisen, bescheidenen Auftreten umso mehr zur Geltung kam. Nie hätte sie sich mit einem Mann zusammengetan, der sie überragte oder sonst irgendwie von ihr ablenkte. Es machte ihm nichts aus. Er hatte kein Geltungsbewusstsein. Er wollte sie, wie sie war.
Lara war erst neunzehn, aber sie wollte auch etwas. Lara wollte heiraten. Es ging ihr nicht um Sam, es ging ihr um eine Ehe – und das so schnell wie möglich. Ihre Eltern Nicholas und Bella waren nicht verheiratet gewesen, und im amerikanischen Süden der späten fünfziger und frühen sechziger Jahre wurde darüber noch getuschelt. Man zeigte mit dem Finger auf Lara. Die anderen Kinder nannten sie einen Bastard und bewarfen sie mit Quallen, besonders, nachdem sie einige Gesangswettbewerbe gewonnen hatte. Das weckte Neid. Sie konnte es kaum erwarten, erwachsen zu werden. Eine Ehe war bestimmt die Lösung; wenn sie eine verheiratete Frau war, würde niemand mehr über sie lachen.
Sam wusste das alles noch nicht.
»Sammy, heiratest du mich?«, fragte Lara ihn an einem gewitterschwülen Augustsonntag ausgerechnet nach einer Beerdigung. Lara sah so kühl und so hinreißend und gleichzeitig so zerbrechlich aus, dass Sam absolut nichts einfiel, was gegen eine Heirat sprach. Hier auf dem Friedhof lagen so viele Menschen, denen etwas zugestoßen war. Lara durfte nie etwas passieren. Er wollte sie für immer beschützen. Sam war nicht die Sorte Mann, den es ärgerte, dass Lara ihn zuerst fragte. Nur tief in ihm begehrte der wache Instinkt seines Volkes auf, dass hier irgendetwas nicht so war, wie es sein sollte. Er hörte nicht zu. Stattdessen küsste er Lara und sagte: »Ja!«
So hatte Sam es Tiryn erzählt, als sie ihn gefragt hatte, wie es zu der Heirat ihrer Eltern gekommen war. Sie passten so wenig zusammen wie ein Pelikan und ein Flamingo, fand Tiryn. Aber sie hatte Verständnis für Sam. Was Lara wollte, nahm sie sich, ehe man es merkte.
Als Tiryn die Galerie betrat, sah sie Sam am Tresen stehen. Stirnrunzelnd brütete er über einem Bankauszug. Er war noch immer schmal und wirkte jung, nur seine stolze Hakennase, die von seiner Herkunft erzählte, war mit den Jahren etwas ausgeprägter geworden und seine Schläfen grau.
»Tiryn!« Seine Augen leuchteten auf, als er sie sah, und er umarmte sie fest. »Wie geht es dir, alles in Ordnung?«
»Achukma hote«, antworte sie in seiner Sprache. »Ich bin okay.« Seine Umarmung tat ihr gut. Dafür, dass er in ihren ersten Lebensjahren nicht für sie dagewesen war, konnte er nichts. Er hatte von ihrer Existenz nichts gewusst. Umso dankbarer war sie jetzt, dass es ihn gab.
»Tiryn?« Hinter einer hölzernen Skulptur kam eine lange, gebeugte Gestalt hervor. Weiße Haare standen unordentlich um einen schmalen Kopf. Wann waren sie so dünn geworden?
»Opa Nick!«
»Ich wollte mir die neue Skulptur von John Daniels ansehen. Beeindruckend, oder?«
Gemeinsam bewunderten sie die gewaltige Eule, die aus einem ganzen Baumstamm gesägt worden war. Ihr Gesicht war weise und beinahe menschlich, man konnte es lange betrachten.
»Und du? Kann ich etwas für dich tun?«, fragte Sam.
»Nein, nicht für mich. Wir müssen was für Lara tun! Wenn sie nicht bald wieder ein Engagement bekommt, wenigstens für einen Abend oder auf einem Fest … irgendetwas, wofür sie Applaus erhält …«
Die beiden Männer sahen sie hilflos an.
»Du weißt, dass ich der Letzte bin, von dem sie sich helfen lässt«, sagte Nicholas müde.
Lara war der festen Überzeugung, dass die Krebserkrankung ihrer Mutter Bella seelische Gründe gehabt hatte. Sie gab Nicholas die Schuld und sprach kein Wort mehr mit ihm. Seit Bellas Tod wurde Lara stetig schwieriger.
»Na, von mir ja wohl auch nicht.« Sam breitete ratlos die Arme aus.
»Ich weiß. Das letzte Mal, als du es versucht hast, hat sie einen Toaster nach dir geworfen«, erinnerte sich Tiryn.
Tatsächlich hatte Lara sich nicht einmal von Sam helfen lassen, als sie damals aus Mexiko zurückgekommen war. Er hatte ihr verziehen, wollte sich um seine unerwartete kleine Familie kümmern. Aber Lara wollte nicht bei ihm wohnen. Also zog er zu ihr. Nach kurzer Zeit schmiss sie ihn hinaus. Er hätte alles für sie getan. Aber Lara nahm von einer Hand, die man ihr reichte, kaum den kleinen Finger. Eher schlug sie drauf.
»Den Jähzorn hat sie von meinem Vater geerbt«, sagte Nicholas.
Überrascht sahen ihn die beiden anderen an. Er sprach nie von seinen Eltern, und auch jetzt schien er es schon wieder zu bereuen und wandte sich ab.
»Wenn sie gut genug wäre, hätte sie längst Aufträge«, sagte Sam.
»Gestern hat sie wunderschön gesungen. Sie wusste nicht, dass ich zuhöre«, verteidigte Tiryn ihre Mutter.
»Als ich sie das letzte Mal hörte, klang sie wie eine Kettensäge und konnte sich kaum aufrecht halten.«
»Sam, sie ist krank. Du weißt, was der Arzt gesagt hat.« Nick strich sich über die Stirn, wie um etwas wegzuwischen.
»Quartalstrinkerin. Ich weiß, ich weiß. Alkoholismus ist eine Krankheit. Aber anders als andere Kranke tut sie nichts dagegen. Sie lässt sich von niemandem helfen, das weißt du, Tiryn.«
»Sie hat seit Wochen nichts getrunken. Und wenn sie irgendwo auftreten könnte, wäre es ja nicht Hilfe von uns …« Tiryn zupfte sanft an einer weißen Locke über Nicholas’ Ohr. »Opa Nick, du musst zum Frisör!«
»Ja, ja, ich weiß«, sagte er zerstreut. »Bella hat mich immer daran erinnert …«
»Ja, und jetzt mache ich das. Soll ich einen Termin für dich vereinbaren?«
»Nein, nein, ich frage auf dem Heimweg nach. Vielleicht hat Hank gerade Zeit. Möglicherweise höre ich dort etwas wegen eines Auftritts für Lara. Da wird genug getratscht über Feierlichkeiten und dergleichen.«
»Schon gut, ich werde auch die Ohren offen halten. Morgen kommt ein Kunde, der hat ein Restaurant und bietet da Livemusik an, vielleicht kann ich ihn überzeugen.« Seufzend steckte Sam seinen Bankordner in die Schublade. »Nanaiya hat nach dir gefragt, Tiryn.«
»Ich werde sie anrufen. Diese Woche habe ich drei Anhänger verkauft, das wird sie freuen.«
Sie plauderten eine Weile, dann wandte sich Sam einem Kunden zu, Nick trollte sich langsam Richtung Frisör, und Tiryn radelte ins Hotel. Heute hatte sie eine Bootsfahrt zu betreuen, die das Hotel organisierte. Darauf freute sie sich jedes Mal. Das Boot mit dem durchsichtigen Boden, die Ibis, gehörte Kimoni. Nelson charterte die Ibis regelmäßig, wenn bei einer ausreichenden Anzahl von Gästen der Wunsch bestand. Kimoni steuerte, und Tiryn oder Peri kümmerten sich um die Passagiere.
Eine ganze Familie wartete schon am Hoteleingang, Großeltern, Eltern und zwei Kinder.
»Kommen Sie bitte!« Erwartungsvoll folgten sie ihr im Gänsemarsch den schmalen Sandpfad zum Steg, wo die Ibis auf flachen Wellen schaukelte.
»Willkommen an Bord!« Kimoni reichte den Älteren galant eine helfende Hand. Tiryn streifte allen eine Schwimmweste über und schnallte sie fest.
»Das brauch ich nicht, ich kann schon schwimmen!«, erklärte ihr der kleine Junge wichtig.
»Das glaube ich dir«, antwortete Tiryn ernst, »aber der Kapitän will das so, weißt du, und was der Kapitän sagt, muss die Mannschaft machen!«
»Unbedingt!«, bestätigte Kimoni und bemühte sich, streng zu gucken.
Tiryn verkniff sich ein Lächeln. Er konnte es nicht.
Aber der Junge fügte sich und setzte sich neben seine Schwester.
»Der Kapitän geht jetzt auf die Brücke«, verkündete Kimoni.
»Darf ich auch mal steuern?«, rief der Junge ihm nach.
»Später. Jetzt wollen wir erst sehen, ob wir einen dicken Fisch entdecken. Oder einen Kraken.«
»Einen Riesenkraken?«
Tiryn löste die Leine vom Poller. Der Motor brummte los. Fasziniert beobachteten die Kinder die geschwungene Straße aus Schaum, die im Kielwasser der Ibis entstand. Auch Tiryns Herz machte bei diesem Anblick immer noch einen Hüpfer. Frei auf dem Wasser, der Horizont offen, jedes Mal schien alles möglich. Hier draußen fühlte sich selbst das leicht an, was ihr schwer auf dem Herzen lag. Das Meer fing sie auf.
Die beiden Kinder lagen bäuchlings im Boot und drückten Nasen und Zeigefinger an den durchsichtigen Boden. Ihre Eltern saßen umschlungen im Heck, flüsterten sich Dinge ins Ohr und sahen sich tief in die Augen. Sie hätten statt in einer paradiesischen Landschaft auch mitten auf dem Times Square sitzen können, es hätte keinen Unterschied gemacht. Froh, dass die Kinder beschäftigt waren, genossen sie den Augenblick miteinander. Tiryn betrachtete sie halb bedauernd, halb zweifelnd. Wie gern hätte sie ihre Eltern einmal so gesehen – aber sie fand es schwer zu glauben, dass das Wirklichkeit war. Wahrscheinlich war dieses Paar im Alltag auch anders. Doch auch die Großeltern, die entspannt ins Blaue träumten, lehnten sich aneinander und hielten sich bei der Hand.
»Tiryn, guck! Was ist das?« Das Mädchen zeigte aufgeregt auf schwarze Flecken im Wasser.
»Kennst du Igel?«, fragte Tiryn.
»Ja, wir haben mal einen im Garten gefunden. Der hat mich gepiekt, obwohl er nur ein Baby war.«
»Da hat sie geheult«, sagte ihr Bruder.
»Das hat ja auch weh getan!«
»Also, das da unten sind Seeigel. Sie haben viel längere Stacheln, und wenn du beim Schwimmen einen siehst, fass ihn nicht an, sonst tut das auch weh«, erklärte Tiryn.
»Dann sind die nicht nett«, schmollte das Mädchen.
»Sie wollen nur nicht gefressen werden, weißt du. Sieh mal, da sind Fische, die sind so durchsichtig wie Glas. Sind die nicht schön?«
»Oooh! Sind die verzaubert?«
»Nein, die wollen auch nicht gefressen werden, deshalb machen sie sich unsichtbar.«
»Kann der Hai sie trotzdem sehen?«, wollte der Junge wissen.
»Der kann sie riechen. Wusstet ihr, dass dem Hai die Zähne nachwachsen, wenn er sie verliert?«
»Nö. Aber ich hab eine Haifischkette, guck!« Stolz zog er eine Schnur mit einem Haifischzahn aus seinem Shirt. »Hat mir der Papa geschenkt!«
»Und du? Hast du auch eine Kette?«, fragte Tiryn das Mädchen.
»Jaaa!« Sie setzte sich auf und schwenkte ihren Anhänger.
»Oh, eine Tulpenmuschel. Die bringt dir Glück.«
Das Mädchen blickte über Tiryns Schulter und riss die Augen auf.
»Da! Walfische!«