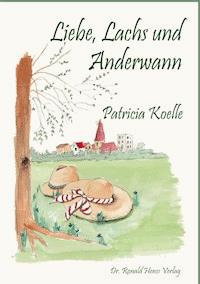6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ostsee-Trilogie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Drei Frauen auf der Suche nach ihrer Vergangenheit In Ahrenshoop an der Ostsee kreuzen sich die Wege ihres Schicksals Dritter Band der großen Ostsee-Trilogie Berlin, 1989: Die junge Architektin Ylvi lernt in der Mauerfallnacht den Gärtner Theo kennen. Eine Begegnung, die ihr Leben auf den Kopf stellt, denn sie ist verheiratet – und jetzt ist sie schwanger. Als ihre Mutter, die auf Teneriffa lebt, stirbt, findet sie in deren Hinterlassenschaft einen Brief ihres Vaters. Er ist eine Beichte und eine Bitte. Ylvi reist nach Ahrenshoop an der Ostsee, um endlich zu erfahren, wer sie wirklich ist… Die Romane der Berliner Autorin Patricia Koelle sind Wellness pur – wie ein wunderbarer Tag am Strand, ein erfrischendes Bad im Meer oder ein entspannender Spaziergang in den Dünen. »Der Horizont in deinem Namen« ist der dritte Teil der Ostseetrilogie der Autorin. Der Roman schließt die Handlung von »Das Meer in deinem Namen« und »Das Licht in deiner Stimme« ab. Alle drei Bücher können jedoch auch einzeln gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 652
Ähnliche
Patricia Koelle
Der Horizont in deinen Augen
Roman
Über dieses Buch
Berlin, 1989: Die junge Architektin Ylvi lernt in der Mauerfallnacht den Gärtner Theo kennen. Eine Begegnung, die ihr Leben auf den Kopf stellt, denn sie ist verheiratet – und jetzt ist sie schwanger. Als ihre Mutter, die auf Teneriffa lebt, stirbt, findet sie in deren Hinterlassenschaft einen Brief ihres Vaters. Er ist eine Beichte und eine Bitte. Ylvi reist nach Ahrenshoop an der Ostsee, um endlich zu erfahren, wer sie wirklich ist …
Die Sommerromane der Berliner Autorin Patricia Koelle sind Wellness pur – wie ein wunderbarer Tag am Strand, ein erfrischendes Bad im Meer oder ein entspannender Spaziergang in den Dünen.
»Der Horizont in deinen Augen« ist der dritte Teil der Ostsee-Trilogie von Patricia Koelle. Der Roman schließt die Handlung von »Das Meer in deinem Namen« und »Das Licht in deiner Stimme« ab. Alle drei Bücher können auch einzeln gelesen werden.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Patricia Koelle ist eine Autorin, die in ihren Büchern ihr immerwährendes Staunen über das Leben, die Menschen und unseren sagenhaften Planeten zum Ausdruck bringt. Bei FISCHER Taschenbuch erschienen, neben Romanen und Geschichten-Sammlungen, die Ostsee- und Nordsee-Trilogie sowie die Inselgärten-Reihe. ›Das Licht in den Bäumen‹, ›Das Glück in den Wäldern‹ und ›Das Leuchten der Blätter‹ gehören zu ihrer Sehnsuchtswald-Reihe.
Inhalt
[Widmung]
Prolog
Ylvi
1 Das tödlich geheime Land
2 Überraschung
Birnenkonfekt
Myra
3 Der Schmuggler
Ylvi
4 Die Stimme im Gewitter
Störtebeker-Salat
Myra
5 Ein Sommer für das Leben
6 Abschiede
Ylvi
7 Luftschlösser
8 Zurück im Geheimen Land
Myra
9 Sturmkind
Ylvi
10 Gartenzauber
Ylvi
11 Gespräche vom Vulkan
Reginas Himbeertraum
12 Verletzungen
Myra
13 Die Fremde
Ylvi
14 Rickys beste Seite
Myra
15 Das Geschäftskind
Oskars Entenkeulen
Ylvi
16 Ein Schatten in der Nacht
Ylvi
17 Erkenntnisse
18 Aufbruch
19 Neue Musik
Ropa vieja
Myra
20 Nachwuchs auf Naurulokki
Carlys Erdnussbutterkekse
21 Claas und Orenda
22 Wer die Bernsteinwellen macht
Myra
23 Liv und das Bernsteinschiff
Myra
24 Wahrheiten und offene Fragen
Ylvi
25 Der Vulkan
26 Rainers Beichte
27 Neugier
Ylvi
28 Verwandte
Darßer Sauerampfersuppe
29 Verbindungen
Myra
30 Schwierige Verhältnisse
Jakobs Rehrücken
Ylvi
31 Myra und Ylvi
Myra
32 Blaue Stunde
Ylvi
33 Luftschlösser und braune Flügel
34 Viele Fragen
35 Alte Liebe
Nussecken aus dem Café Namenlos
Myra
36 Ein Wiedersehen
Ylvi
37 Neue alte Töne
Myra
38 Carlys Erkenntnis
39 Als die Zeit verschwand
Ylvi
40 Frenjas Vermächtnis
Epilog
Danksagung
Leseprobe aus »Die eine, große Geschichte«
1. Kapitel
2. Kapitel
Für alle, die ihren Ort gefunden haben.
Und für alle, die noch auf dem Weg dorthin sind.
Prolog
2005
»Da!« Regina machte große Augen und zeigte mit zitternder Hand auf den fernen Gipfel, der noch eine Mütze aus Schnee trug.
Ylvi legte die Schaufel beiseite, mit der sie gerade einen Hibiskus umtopfte, kniete sich neben ihre Mutter auf die sonnenwarme Terrasse und steckte die Decke wieder fest, die von den dünnen Beinen gerutscht war.
»Es ist alles in Ordnung, Mama«, sagte sie beruhigend. »Florentina kommt auch gleich wieder.« Immer wenn die fröhliche spanische Krankenschwester fort war, wurde Regina noch unruhiger als sonst. Jetzt packte sie Ylvi mit überraschender Kraft am Ärmel.
»Der Vulkan! Der Vulkan wird das Geheimnis verraten!«
»Der Vulkan schweigt seit über hundert Jahren, Mama. Er wird alle Geheimisse für sich behalten.«
Meins auch, falls er es kennt, dachte Ylvi und sah zu dem dunklen Berg hinüber. Friedlich ragte er mitten auf der Insel in den hellblauen Frühlingshimmel, ungerührt vom Passatwind, der Reginas weiße Haare und Ylvis feinen blonden Pferdeschwanz Richtung Westen wehen ließ. Es konnte sein, dass er es kannte, so oft hatte sie in seine Richtung geträumt, wenn sie an ihr Geheimnis dachte. An jene Nacht, die so lange zurücklag. An die Nacht, in der keine Regeln galten …
Ylvi
1989
Berlin
1Das tödlich geheime Land
Das Gesicht tief in ihren Schal vergraben, lief Ylvi die dunkle Osloer Straße entlang zum U-Bahnhof. Nur ihrer Freundin Heike zuliebe war sie beinahe bis Mitternacht auf der Party geblieben. Heike hatte die Einweihung ihrer neuen Wohnung gefeiert. Sie fand die Gegend toll, aber Ylvi war die Atmosphäre in der Wohnung und dem ganzen Stadtteil unheimlich. Zum Glück hatte sie vor dem Aufbruch noch ein Glas Bowle getrunken, sonst hätte sie sich noch mehr vor dem Heimweg gefürchtet. Wenn jetzt jemand hinter einer Ecke hervorsprang und sie in einen Keller zerrte, würde sie nicht einmal so bald jemand vermissen.
»Vielleicht übernachte ich bei Heike, wenn es spät wird, und helfe ihr morgens beim Aufräumen. Warte nicht auf mich«, hatte sie zu Ricky gesagt. Er hatte nur kurz hochgeblickt, mit seinem verschmitzten Lausbubengrinsen, in das sie auch nach einem ganzen Ehejahr noch verliebt war.
»Alles klar. Vielleicht ist er bis dahin fertig!« Ricky wies auf den Roboter, an dem er tüftelte.
»Was soll er denn können? Was macht ihr zwei überhaupt im Badezimmer?«
»Er übt, die Rolle Klopapier auf den Halter zu schieben. Phantastisch, oder?«
»Meinst du, das ist unverzichtbar für die geistige Weiterentwicklung der Menschheit?«
»Klar. Heute schiebt er Rollen auf Klopapierhalter, morgen schmeißt er den ganzen Haushalt und die Menschen haben viel mehr Zeit, sich geistig zu entwickeln.« Er sprang auf und gab ihr einen langen Abschiedskuss. »Ich fahr noch mal in die Uni. Ich brauche Teile.«
»Okay. Ich warne dich. Wenn ich zurück bin, gehe ich davon aus, dass ich nie wieder selbst Klopapier aufhängen muss.«
Bei Heike zu übernachten war aber dann nicht in Frage gekommen. Die hatte nämlich mit einem schmierigen Typen herumgeknutscht, der wohl über Nacht bleiben würde. Da war es Ylvi lieber, sich durch das finstere Viertel zum Bahnhof durchzuschlagen.
Doch so leer, wie sie erwartet hatte, waren die Straßen nicht. Tatsächlich waren seltsam viele Menschen unterwegs, ganze Gruppen sogar. Eine Spannung völlig fremder Art dehnte die Luft wie ein Gummiband. Ylvi konnte nicht deuten, ob das gut oder ungut war. Die Menschenmenge wurde dichter, spülte sie mit sich fort, dann bewegte sie sich hin zu etwas.
»Ich will nach Hause!«, brummelte Ylvi unwirsch vor sich hin, während sie versuchte, sich zu orientieren. Wo war nun der U-Bahnhof?
»Bestimmt nicht. Niemand will heute nach Hause!«, sagte eine Stimme neben ihr, die scheinbar körperlos war. Mit Mühe machte sie die Umrisse eines schlanken Mannes in dunkler Kleidung aus, der ein schwarzes Fahrrad schob.
»Was ist hier bloß los?«
»Wo kommst du denn her? Kein Radio gehört, kein Fernsehen geguckt?«
»Nee, Umzug gefeiert. Klärst du mich auf? Was ist passiert?«
So war das in Berlin, unter jungen Leuten. Man duzte sich. Der Mann stellte sich trotzdem höflich vor. Sein Händedruck war fest und warm. »Ich bin Theo. Ich kann es zwar noch nicht glauben, aber du und ich, wir erleben hier einen historischen Moment. So was verpasst man nicht.« Er räusperte sich unnötig, als bekäme er die Worte an seinem eigenen Zweifel nicht vorbei. »Halt dich fest: Die Mauer ist offen!«
Ylvi starrte den Unbekannten an, so gut das ging im Dunkeln, und war vollkommen verwirrt. War der irre oder die Bowle doch zu viel gewesen? Nein, verhört hatte sie sich nur, natürlich. Oder?
»Die Mauer. Wie?«, sagte sie, bekam keinen vernünftigen Satz zusammen. Bilder aus den Nachrichten der letzten Zeit flimmerten durch ihren Kopf: verzweifelte Menschenmassen in Botschaften, schreiende Kinder, die über Zäune gereicht wurden, Genscher auf dem Balkon, Jubel.
Jubel war auch jetzt zu hören, der in Wellen gegen die gespannte Stille aufbrandete, mit dem Novemberwind durch die Häuserschluchten gedrückt.
Konnte es wahr sein, was Theo behauptete? Konnte wahr sein, was nicht wahr sein konnte? Ylvi spürte ein Prickeln unter den Ärmeln ihrer dicken Jacke, erst heiß, dann kalt.
»Ich kann es auch nicht glauben«, wiederholte er, »lass uns nachsehen. Komm mit, ja? Meine Frau und mein Sohn sind in Westdeutschland, bei meiner Schwiegermutter, leider. So einen Moment sollte man nicht allein erleben. Wo ist deine Familie?«
»Mein Mann ist zu Hause. Er arbeitet. Für die Technische Universität. Er baut Roboter. Vielleicht ist er auch im Institut geblieben, er brauchte noch Teile und vergisst oft die Zeit, wenn er arbeitet …« Himmel hilf, sie plapperte wirres Zeug. Vor Nervosität, Aufregung, Verwirrung. Jetzt nur nicht noch erzählen, dass dieser Roboter Klorollen auf Halter schob. Nicht in einem Augenblick, der Weltgeschichte schrieb.
»Na ja. Konnte ja auch keiner wissen, dass die Mauer geöffnet wird. Kommst du mit?«, fragte Theo noch einmal.
»Haben wir eine Wahl?« Längst wurden sie unerbittlich von anderen geschoben. Es gab kein Entrinnen. Theo hielt eisern sein Fahrrad fest. Gefallene Lindenblätter schimmerten im spärlichen Laternenlicht unter den vielen Füßen, ihr rauchig-moderiger Geruch stieg Ylvi vertraut in die Nase, zusammen mit dem fremden Aftershave.
»Übrigens, wenn das stimmt – ich wollte schon immer …« Ylvi brach ab.
»Was?«
»Als ich klein war. Das Land hinter der Mauer. Sie sagten, die Menschen dort sind nicht frei. Aber wir waren es, die nicht aus der Stadt fahren konnten, nicht auf einem Feld oder einer Wiese Picknick machen wie die Kinder in meinen Büchern.« Ylvi begann, schwer zu atmen. Sie rannten fast, so eilig hatte es die Menge. »Ich wollte so gerne durch ein Tor in der Mauer spazieren und auf einem Feld Drachen steigen lassen. In dem ›Geheimen Land‹. Ohne dass man erst auf die großen Ferien warten musste, ohne dass man stundenlang fahren und sich vorher und nachher von grimmigen Grenzsoldaten anstarren und herumkommandieren lassen musste.«
»In dem ›Geheimen Land‹?« Ylvi mochte die freundliche Neugier in seiner Stimme, verlor aber den Anfang ihrer Antwort im Gedränge, als sie von hinten angerempelt wurde.
»Hoppla!« Theo fing sie auf, ließ ihren Arm sicherheitshalber nicht mehr los. Noch ein fremder Geruch rollte heran. Auf einmal kamen ihnen Autos entgegen, teilten im Schritttempo die Menge. Kleine, eckige Autos. Blumen lagen auf ihren Dächern, Arme winkten aus allen Öffnungen.
»Trabis! Du, das sind Trabis!«, rief Ylvi, immer noch ungläubig. Es war für sie, als spazierten Dinosaurier die Straße entlang oder Kängurus – unmöglich, märchenhaft, großartig. Traum – Illusion – Wirklichkeit? Trabis kamen nicht durch die Mauer, noch nie.
Es sei denn …
»Sie ist offen! Die Mauer ist offen!« Die Trabis waren der Beweis. Ylvis und Theos Stimmen reihten sich jetzt unwillkürlich ein in den Ruf, der um sie herum hallte. Jemand drückte ihnen eine angebrochene Flasche Sekt in die Hand. »Offen!«, das gemeinsame Wort überholte sich selbst, brach sich an den Hauswänden, geriet unter aufgeregte Füße, begegnete seinem Echo und schwang sich wieder in den aufklarenden Himmel.
Dann sahen sie es. Grenzübergang Bornholmer Straße. Der spie die Trabis aus und auch Menschen; diese Lücke gebar den Jubel. Es wurde gewunken, geschrien, geweint, gestammelt, jeder umarmte jeden.
Auf der Mauer, ja wirklich: auf DER MAUER standen Menschen wie Ausrufezeichen, und einer davon schwang von oben herab einen Vorschlaghammer gegen den Beton, langsam, gleichmäßig. Ein Metronom, das dem Sterben einer Grenze einen Takt gab, dem Rausch der verblüfften Menschenmenge einen Herzschlag.
Sie standen, lauschten, verloren sich im Unbegreiflichen. Zeit spielte keine Rolle, es gab sie gerade nicht. Bis Theo, der jetzt im Scheinwerferlicht der Raum erobernden Autos besser zu sehen war, sich zu Ylvi umdrehte. »Wollen wir?«
»Keiner schießt!«, stellte diese fest, aus ihrer Fassungslosigkeit aufgeschreckt. »Warum hat keiner geschossen?«
»Wollen wir? Komm schon!«
»Was? Wohin?«, fragte sie begriffsstutzig.
»Na, rüber. In dein ›Geheimes Land‹.«
»Du meinst, wir sollen …«
»Wenn alle in diese Richtung können, kann man auch in die andere. Oder?«
»Und wenn wir nicht zurückkommen? Wenn sie wieder zumachen?«
»Das da«, seine Geste umfasste das gesamte Eilen, Strömen, Hüpfen und Umarmen um sie her, »das hält niemand mehr auf. Da hat keiner den Überblick. Wir interessieren die nicht. Und notfalls haben wir einen Westausweis. Los, halt dich an mir fest.«
Er schob das Fahrrad am Rand gegen den Strom, Schritt für Schritt. Ylvi ging dicht hinter ihm, die Hand auf dem Sattel. Ein paar verwirrte Blicke prallten gegen sie, sonst beachtete sie niemand. Kurz bevor sie den offenen Schlagbaum erreichten, blieb Theo stehen.
»Ich weiß immer noch nicht, wie du heißt!«
»Verzeihung – Ylvi. Ich bin Ylvi.« Plötzlich fing sie an zu lachen. Was für eine Situation.
»Freut mich. Willkommen im Osten, Ylvi!«
Ehe sie es begriff, waren sie durch, ließen die Grenzanlagen hinter sich, die Menschenmenge lockerte sich auf, auch wenn sie sich noch immer gegen die Strömung arbeiten mussten. Hier waren es nur Rinnsale, die aus allen Richtungen einem gemeinsamen Ziel entgegenstrebten.
So viel anders war es auf dieser Seite nicht, nicht im Dunkeln. Es herrschte derselbe Geruch wie gerade noch drüben: nach Herbstblättern und den Abgasen der ungewohnten Autos. Die Häuser, die man gegen den Himmel gerade noch erahnen konnte, waren vielleicht höher und eckiger, die Beleuchtung war spärlicher.
»Komm, steig auf!« Theo zeigte auf den Gepäckträger.
»Auf dem Gepäckträger bin ich nicht mehr gefahren, seit ich in der fünften Klasse in Paul Untertrifalla verliebt war«, erinnerte sich Ylvi belustigt.
»Das kriegst du schon hin. Was wurde aus Paul?«
»Er hat mir einen Frühling lang Gummibärchen geschenkt, und kurz darauf ist er sitzengeblieben und kam in ein Internat. Nach Westdeutschland.« Unerreichbar, damals.
»Wo entlang möchtest du?« Die Straße teilte sich.
»Rechts«, sagte Ylvi, weil dort mehr Sterne funkelten.
Theo folgte ihrem Wunsch, reichte ihr aber einen Schlüsselbund nach hinten.
»Da ist eine Taschenlampe dran und ein Kompass. Lass uns Richtung Osten fahren, bis wir aus der Stadt kommen. Das wolltest du doch? Ein Feld, eine Wiese. Einfach so.«
»Bist du Pfadfinder?«
»Den Kompass hat mir meine Schwester geschenkt. Ich solle mich im Leben nicht verlaufen. Im Übrigen bin ich Gärtner. Die haben immer allerhand Werkzeug bei sich.«
Die Straßen waren holpriger als die im Westen. Ein rhythmisches Holpern, sie kannte es auch von der Autobahn, von den Transitstrecken. Betonplatten, die mit Nähten aus Teer verbunden waren, jede Naht ein kleiner Schreck für die Räder.
»Erzähl mir von deinem ›Geheimen Land‹, als du klein warst«, bat Theo sie.
Ylvi hörte seinen schweren Atem. Hier ging es leicht bergauf zwischen Häuserreihen, die alle gleich aussahen. Wenige Bäume, weniger als im Westteil der Stadt. Die Zeit hatte sich wieder zurückgezogen, alles war jetzt.
»Ich dachte, wenn ein Land hinter einer Mauer versteckt und von Soldaten mit Gewehren bewacht wird, muss es besonders schön und voller Schätze und Geheimnisse sein. Märchenhafte Blumen. Wiesen, Schafe, Strände, bunte Kiesel. Das waren für mich Schätze. In der Stadt gab es die ja nicht. Nur in den großen Ferien, wenn wir in den Harz oder an die Nordsee fuhren. Aber da mussten wir erst durch die DDR. An der Grenze stehen im Stau, stundenlang. Die Grenzsoldaten starrten uns an, ob wir auch wie unser Passfoto aussahen. Wir hatten die Koffer zu öffnen, und die Männer wühlten in unserer Wäsche herum. Sogar die Sitzbänke mussten wir hochklappen, ob nicht klein zusammengefaltete Menschen auf der Flucht darunter waren. Na, du kennst das ja.«
»Ich glaube, das wird nie mehr so sein. Nie wieder. Nicht hier.« So wie er das sagte, klang es wahr. Unverrückbar wie der Findling, an dem sie gerade vorbeigefahren waren.
»Ich dachte, wenn die so sorgfältig und streng sind, muss es ein sehr geheimnisvolles Land sein, das sie bewachen. Die Leute, die von dort zu uns wollten, haben sie sogar erschossen, damit sie nichts erzählen. Von den Transitstrecken aus sah man nichts außer einförmigen Wäldern, ab und zu ein Kornfeld. Der eigenartige Geruch um Bitterfeld herum und die einzige, ewig gleiche Werbung an einer Brücke. Von der Autobahn abbiegen durfte man nicht. Das ›Geheime Land‹ blieb hinter den Wäldern verborgen. Es war so geheim, dass es auf den Landkarten in unserem Schulatlas weiß war, einfach nicht da. Erst Westdeutschland war wieder grün. Es war schön dort, aber das Schöne war nur geliehen, für die Dauer von drei Wochen.«
»Und das hat dir nicht genügt.«
»Nein, ich wollte barfuß eine Wiese erobern, wann immer es mir passte. Loslaufen, Mohn auf einem Kornfeld pflücken. Jede Stadt hatte einen Rand. Nur unsere nicht. Da war die Mauer, da kam man nicht weiter, Punkt. Sie teilte die Straßen in zwei Hälften. Die eine hörte einfach auf – und die andere blieb eben geheim. Die Wachleute auf den Türmen beachteten mich nicht. Ich habe gewunken, aber keiner winkte zurück. Ich stellte mir vor, man müsste nur den Schlüssel finden, wie in dem Kinderbuch, ›Der geheime Garten‹.« Sie schluckte. » Und jetzt hat ein ganzes Volk den Schlüssel gefunden!«
»Mir hat einmal einer gewunken.« Theo hörte auf zu treten. Hier ging es sanft bergab. Mehr Sterne sah man hier, viel mehr als drüben, weil die Stadt nicht so viel verirrtes Licht in den Himmel streute. »Ich kannte eine Stelle, da hatte die Mauer einen Spalt auf meiner Augenhöhe. Der Todesstreifen war wie kahlrasiert, nur Sand mit ein paar müden Grashalmen. Kaninchen haben sich dort vermehrt, aber sie sahen hungrig aus. Ich stellte mir vor, da einen Rosengarten zu pflanzen, den ganzen nackten breiten Streifen entlang, rund um Berlin, sobald die Mauer einmal nicht mehr da wäre. Nicht rote Rosen, sondern Rosen in den Farben des Sonnenaufgangs. Aprikosenfarben und goldgelb. Vielleicht bin ich deshalb Gärtner geworden. Mein Vater hat immer gesagt, eines Tages wird die Mauer wirklich weg sein. Er hatte wohl recht. Wer weiß, was jetzt passiert!«
Ylvi lauschte seiner Stimme im Fahrtwind. Sie wusste kaum noch, wo die Geschichten aufhörten und die Wirklichkeit anfing. Ihre Welt hatte sich verbogen, war in Stücke geborsten und setzte sich erschütternd neu zusammen.
»Wart ihr nie mit einem Visum in der DDR, für einen Tag wenigstens?«, fragte Theo.
»Nee. Meine Eltern lehnten das kategorisch ab. Sie fanden es schlimm genug, sich beim Transit an der Grenze demütigen lassen zu müssen. Sie wollten der Diktatur keine Devisen zukommen lassen.«
»Ach so. Und später?«, fragte Theo.
»Nicht dazu gekommen. Da war mein Architekturstudium, das Austauschsemester in Spanien. Vielleicht wollte ich auch nichts entzaubern. Keine Ahnung. Und in letzter Zeit steckte ich in den Prüfungen, hab kaum noch Nachrichten gehört oder Zeitungen gelesen.«
»Das ›Geheime Land‹ blieb also geheim.« Er drehte sich zu ihr um. Ylvi glaubte, ein Glänzen in seinen Augen zu sehen. »Und jetzt sind wir hier – mittendrin! Ist das nicht phantastisch?«
Eine neue Straßenkreuzung.
»Wo ist Osten?«, fragte er. »Warte, ich kann auch nach den Sternen gucken. Du, ich glaube, hier ist der Stadtrand! Da sind kaum noch Häuser!«
Sie knipste die Taschenlampe an. »Der Kompass sagt da lang, wo Ahrensfelde auf dem Schild steht.« Sie fasste ihn an der Schulter, umklammerte sie aufgeregt. »Wahnsinn! Da vorne ist ein Feld! Und dahinter eine Wiese, glaub ich. Es riecht so. Riechst du das? Der Wind erzählt von Gras und Herbsterde und Fallobst! Da halten wir, ja, direkt an der Wiese?«
Theo lächelte im Schein der Lampe. Er stellte sich wohl die fünfjährige Ylvi vor, die Stimme heller, die Ungeduld und die Sehnsucht dieselbe. Ihr war egal, was er dachte. Sie hatten eine Wiese gefunden, einfach so! Er ließ das Rad ausrollen, an dem abgeernteten Stoppelfeld vorbei, und bog in einen schmalen Weg ein, der das Feld von der Wiese trennte. Ylvis Nase hatte sie nicht getäuscht. Er bremste, stellte das Rad an einen Holunderbusch, rieb sich die klammen Hände. An den Zweigen baute Raureif eine zarte Illusion von Dornen.
Ylvi wies auf einen fernen Umriss. »Wer zuerst bei dem Baum ist!«, und schon rannte sie los.
Theo lachte laut auf, streckte sich, holte sie dann kurz vor dem Ziel mühelos ein und umfing sie von hinten. Sie wandte sich um, sah zu ihm auf, blickte in seine dunklen Augen, einen Moment lang. Ja, es gab keine Zeit heute Nacht, Unvorstellbares war bereits passiert, es galten keine Regeln, alles war ungültig geworden.
Dann ließ er sie los und nahm ihre Hand. »Komm!« Sie liefen das letzte Stück zusammen, ließen sich schnaufend in langes Gras fallen. Breiteten die Arme aus, spürten die weite Erde unter sich. Da waren Knubbel. »Walnüsse! Das ist ein Nussbaum!«, sagte Theo.
Der Mond kam jetzt gelegentlich hinter den Wolken hervor und warf silbriges Licht auf die Landschaft. Die Reste eines Schuppens standen windschief hinter ihnen, daneben ein Zaun mit Lücken wie ein nicht lesbarer Satz vor dem Horizont. Theo kramte in seinem Rucksack, reichte Ylvi eine angefangene Wasserflasche. Als sie ihren Atem wiedergefunden hatten, erkundeten sie die Gegend.
»Meine Nase hat mich nicht getäuscht! Falläpfel!«, stellte Ylvi stolz fest, als sie hinter dem Schuppen auf einen weiteren uralten Baum traf. »Hier, probier mal! Hat dir schon einmal ein Apfel so gut geschmeckt?«
»Passt perfekt zu den Walnüssen.« Er knackte ihr eine mit nur einer Hand. Das behelfsmäßige Mahl schmeckte nach einer Mischung aus Herbst und Weihnachten, mit einem Hauch Frühling, genau wie ihnen zumute war. Gestärkt wanderten sie herum, entdeckten weitere Reste eines vergessenen Gartens.
»Hier blüht noch eine Rose!« Theo pflückte die Blüte nicht, stellte nur die Lampe davor auf den Boden und wies Ylvi darauf hin. Trocken, märchenhaft raureifgerändert, und dennoch konnte man die Farbe noch erkennen, irgendwo zwischen Goldgelb und Aprikose, fast kupfern. Ylvi sah, wie sich die Rose vor dem Lichtpunkt winzig in Theos dunklen Augen spiegelte und noch einmal in seiner Brille, zusammen mit dem weiten, neuen Horizont. Sie konnte dort beinahe schon den Garten sehen, den er nun eines Tages rund um die Stadt auf dem einst kahlen Todesstreifen anlegen würde.
Theos Hand suchte auf der Erde, wischte braune Blätter zur Seite. »Da! Diese Ranke hat Wurzeln gezogen. Ich nehme sie mit, daraus kann ich einen Ableger ziehen.« Behutsam hob er seinen Fund aus der Erde. »Du hattest recht. Es gibt wirklich Schätze in deinem geheimen Land!«
»Hörst du das?«, fragte Ylvi nach einer Weile.
Er lauschte.
»Diese Stille ohne Boden und Wände, die für erschöpfte Großstadtohren Musik ist? Darf ich bitten?« Sie nahm seine Hand und zog die Schuhe aus.
»Bist du verrückt? Es friert!«
»Ich wollte doch barfuß auf eine Wiese!«
Sie tanzten zu der großartigen Stille, bis Ylvi hinter dieser Stille eine tonlose, wundervolle Musik hörte und die Ungeheuerlichkeit des Geschehens der Nacht sie überrollte, und plötzlich weinte sie, weil alles so groß war. Theo hielt sie und weinte ungeniert mit. Danach wickelte er sie in eine Decke, die er im Schuppen gefunden hatte.
Sie hörte ein Knirschen. »Was machst du?«
Er knipste die Taschenlampe wieder an. Sie sah, wie er ein loses Stück Brett vollends aus der Schuppenwand löste, dann sorgfältig etwas darauf schrieb, mit einem Zimmermannsbleistift aus seiner Tasche. Feierlich überreichte er es ihr. Sie las.
Ylvi, möge deine Zukunft stets in einem geheimen Land voller Wiesen, Wind und Wunder stattfinden.
In Erinnerung an eine Nacht wirklicher Wunder.
Theo
Die alte Decke reichte für sie beide, wie sich herausstellte. Jedenfalls froren sie nicht in dieser zugleich märchenhaften und unfassbar wahren Nacht, die von allen Grenzen befreit war. Später radelten sie in der Morgendämmerung zurück, sprachlos, wie aus einem Traum erwacht. Nebel ließ das Land unwirklich erscheinen, das an diesem Tag begann, nicht nur Ylvi seine Wunden und seine Möglichkeiten zu offenbaren. An der Grenze herrschten noch immer Gedränge, Verwirrung, Tränen und Jubel. Diesmal wurden sie mit dem Strom gespült. Jemand drückte ihnen einen Blumenstrauß in die Hand, weil sie aus dem Osten kamen.
Zu Hause fand Ylvi eine Walnuss in ihrer Tasche. Sie pflanzte sie in einen Topf. Für den jungen Baum würde sie später in ihrem Garten einen besonderen Platz finden, und eines Tages würde er Früchte tragen.
Erst dabei fiel ihr ein, dass sie gar nicht Theos Nachnamen kannte.
2Überraschung
Ylvi hatte einen seltsamen Traum gehabt von einer großen Möwe mit hellen Augen. Der Vogel war aufgeregt an ihrem Fenster auf und ab geflattert wie die Meisen, die sie dort immer aus der Hand fütterte. Die Möwe trug etwas im Schnabel, aber was Ylvi erst für einen Fisch gehalten hatte, war eine Rose! Eine Rose wie die, die Theo gefunden hatte, nur war diese Blüte nicht erfroren, sondern gerade erst aufgeblüht. Aber warum blickte der Vogel so streng?
Ylvi befreite sich aus ihren verschwitzten Decken. Ricky schlief noch. Auf dem Weg zum Badezimmer wurde ihr erst schwindelig, dann übel. Sie stützte sich hastig auf das Tischchen im Flur. Der Adventskranz darauf verlor vor Schreck einige trockene Nadeln.
»Ist dir schlecht?« Rickys Stimme klang erst besorgt, dann hoffnungsvoll. »Schon wieder? Bist du vielleicht doch endlich schwanger?«
Ylvi wandte mühsam den Kopf und starrte ihn ungläubig an. Wie im schnellen Vorlauf eines Films rasten Bilder der letzten Wochen durch ihr Hirn. So war es angeblich kurz bevor man starb. Aber hier handelte es sich um das Gegenteil vom Tod, wenn Ricky recht hatte. Und in ihr war eine plötzliche eiskalte Gewissheit, dass er recht hatte.
Nur seine Freude konnte sie nicht teilen.
Der Film in ihrem Kopf trug sie zurück an jenen Morgen nach dem Mauerfall. Sie sah sich selbst die Walnuss aus ihrer Tasche holen und zärtlich in einen Blumentopf betten.
Ylvi hatte dem Kern den besten Platz auf dem Fensterbrett geschenkt. Hoffentlich würde die Walnuss keimen und genug Licht bekommen, dem langen Winter zum Trotz, der bevorstand. Obwohl sie kaum geschlafen hatte, fühlte sie sich so wach wie noch nie.
Ricky war nicht zu Hause an diesem Morgen des zehnten November, sein Bett ebenso unberührt wie ihres. Gerade als sie den Topf fertig gegossen hatte, hörte sie den Schlüssel in der Tür, dann Rickys schnellen Schritt im Flur.
»Ylvi? Ylvi, wo bist du? Es gibt Neuigkeiten!«
»Unglaublich, oder?« Wo er wohl den Mauerfall erlebt hatte? Mit den Kollegen in der Uni vor dem Fernseher?
Seine Haare standen wild in die Höhe, sein T-Shirt trug Ölspritzer, und seine Augen waren dunkel umrandet vor Müdigkeit, aber sie blitzten vor Aufregung. »Stell dir vor, wir haben heute Nacht Herrn Nilsson weiterentwickelt! Wir hatten eine Art kollektiven Geistesblitz. Wir werden ihn für den Wissenschaftspreis anmelden. Das kann eine ganz große Sache werden, Süße! Herr Nilsson hat Kriechen und Klettern gelernt. Der wird einmal in Erdbebengebieten helfen, Menschen in Ruinen zu finden. Oder unterirdische Rohre reparieren.«
»Herr Nilsson? Wer ist Herr Nilsson?« Ylvi war verwirrt.
»Na, der Roboter. Lukas hat ihn so getauft, nach dem Affen in Pippi Langstrumpf. Weil er so gut klettern kann und oft noch nicht das tut, was man ihm sagt. Lukas liest Pippi Langstrumpf gerade seiner kleinen Tochter vor, deshalb. Das wird unser Durchbruch!« Er packte sie bei den Schultern und wirbelte sie durch die Küche. »Machst du Frühstück? Ich habe einen Riesenhunger, aber erst muss ich unter die Dusche.«
»Ricky, das hört sich toll an, aber was sagst du zum Mauerfall? Ich kann das immer noch nicht glauben, und dabei war ich drüben! Einfach so. Ohne Grenzkontrolle. Und keiner hat geschossen!« Gerade das konnte sie noch immer nicht begreifen. Es war ein Wunder. Dann gab es die also tatsächlich – wirkliche Wunder! Es war das erste, das sie erlebte.
Ricky sah sie verwirrt an.
»Wie, Mauerfall? Wovon sprichst du?«
Ylvi war sprachlos. »Hat denn keiner von euch Radio gehört? Nicht mal im Auto? Ist dir nichts aufgefallen auf den Straßen?«
»Nein, wieso? Bisschen voll auf den Straßen vielleicht. Ich war mit den Gedanken noch bei Herrn Nilsson. Was soll denn sein?«
Ylvi erzählte. Sie erzählte von den jubelnden, tränenüberströmten Menschenmassen, von den Trabis mit den Blumen und von dem Mann mit dem Vorschlaghammer. Und dass niemand geschossen hatte.
Theo erwähnte sie nicht.
Ricky blieb in der Tür stehen. Er nahm zur Kenntnis, was sie sagte, doch sie sah in seinen Augen, dass er es nicht wirklich glaubte und die Bedeutung nicht begriff. Er war im Kopf schon halb im Badezimmer und mit der anderen Hälfte seiner Aufmerksamkeit bei der Weiterentwicklung von Herrn Nilsson. Sie nahm es ihm nicht übel. Man musste dabei gewesen sein, um das Große dieser Nacht glauben und verstehen zu können. Ricky mochte einen historischen Moment versäumt haben, aber vielleicht hatte er in dieser Zeit etwas anderes Historisches erschaffen. Etwas, das Menschenleben retten konnte. Sie liebte ihn so, wie er war.
»Geh duschen. Ich mache Frühstück«, sagte sie, nahm ihm die verschwitzte Jacke ab und schob ihn aus der Küche.
Laut klappernd deckte sie den Tisch, als könnte sie mit dem Krach die Schuld aus ihrer Seele vertreiben. Theo! Wie hatte ihr das nur passieren können?
Die Geschehnisse dieser Nacht waren eine Art Rausch gewesen. Ein Ausnahmezustand. Fast ein Schock.
Ricky sah ihr das schlechte Gewissen nicht an. Mit Appetit verputzte er Brote, trank Kaffee und überflog seine Notizen. »Ich leg mich ein paar Stunden hin und gehe dann wieder ins Institut«, sagte er, küsste sie auf den Scheitel und verschwand.
Ylvi holte die Zeitung aus dem Kasten. Wenn dort nichts vom Mauerfall erwähnt wurde, hatte sie alles doch nur geträumt. Dann stand die Mauer zwar leider noch, aber dann hatte es auch Theo nie gegeben, und alles war gut.
Doch der Topf auf der Fensterbank war Wirklichkeit, und in der Zeitung stand eine Menge, groß und dick auf Seite eins.
In den nächsten Wochen gewöhnte Ylvi sich daran, dass überall Trabis fuhren und parkten und die Stadt zum Bersten voller Menschen und Aufregung war. Die Mauer zerfiel in Staub und Brocken, auch Ylvi schlug sich ein Stück heraus und legte es in ihren Bücherschrank. Den einzigartigen hallenden Klang der Hämmer auf dem Beton würde sie nie wieder vergessen. So viele Berliner und Touristen aus aller Welt schleppten Bruchteile in Plastiktüten fort, dass bald nicht mehr viel übrig war. Theo würde sich beeilen müssen, wenn er seinen Rosengarten um die Stadt ziehen wollte, denn schon wucherten Trampelpfade und Klee im Todesstreifen. Kinder liefen Rollschuh, wo früher die Grenzsoldaten Patrouille gefahren waren, und gassigehende Dackel in karierten Mäntelchen hinterließen ihre Häufchen dort, wo vor kurzem noch die scharfen Wachhunde jaulend an ihren Ketten auf und ab gerannt waren. Für Theos Rosen würde bald kein Platz mehr sein.
Theo!
»Könntest du bitte aus meinen Gedanken verschwinden?«, fragte Ylvi mit gerunzelter Stirn den Walnusskeimling auf der Fensterbank, der zwei grüne Blätter ins Licht reckte. Zwei. Eins für Theo und eins für sie. Eine Einheit. Warum nur konnte sie ihn nicht vergessen?
Doch die stumme Melodie jener Nacht geisterte durch ihre Gedanken und Gefühle wie ein hartnäckiger Ohrwurm.
Bei Ylvi war es schon immer so gewesen, dass eine Landschaft für sie eine stille Musik spielte. Hell und leicht war die Melodie in den österreichischen Bergen gewesen, als sie dort mit Ricky einmal Urlaub gemacht hatte. Hier in ihrem eigenen Haus, das sie mit Ricky eingerichtet hatte, war die Melodie ruhig und gleichbleibend, anheimelnd und vertraut. Auf Teneriffa, wo sie mit ihren Eltern als Kind einst die Sommerferien verbracht hatte, war die stumme Musik dunkel und geheimnisvoll wie der schwarze vulkanische Sand, manchmal auch beschwingt und verträumt wie die vielen Regenbögen, die man dort sah. Sie versuchte, die Melodie vor sich hinzupfeifen, bis ihr Spielkamerad Yeray sie scherzhaft »Pinzon«, Fink, nannte.
»Ich schenke dir lieber eine Piccoloflöte, das geht besser als Pfeifen!«, sagte ihr Vater einmal und überreichte ihr ein schmales Päckchen und einen Gutschein für Unterrichtsstunden. Sie mochte den jungen Musiklehrer, aber seine Noten fand sie weniger interessant. Lieber zog sie sich zurück und versuchte, die Lieder der Landschaften nachzuspielen.
In der Nacht des Mauerfalls hatte der verlassene Garten eine Melodie in ihr zum Klingen gebracht, die sie berührt hatte wie noch keine andere zuvor. Aber so einen Moment, in dem etwas derart Gewaltiges, Historisches geschah, hatte sie auch noch nie zuvor erlebt.
Immer wieder kamen ihr diese Töne in den Sinn und mit ihnen Theos Geruch, seine Hände und das zärtliche Staunen in seiner Stimme, als er die Rose fand. Der süßlich-herbe Geschmack der Falläpfel, die sie geteilt hatten, lag noch immer auf ihrer Zunge. Sie stürzte sich in die Arbeit, bestand die letzte Prüfung mit einer glatten Eins und machte sich eifrig daran, die Stellenanzeigen zu durchforsten. Sie wollte endlich in ihrem Traumberuf arbeiten.
»Lass dir Zeit«, sagte Ricky. »Finanziell kommen wir doch auch so gut klar.«
Aber Ylvi hatte keine Zeit. Sie war siebenundzwanzig, voller Tatendrang, sie wollte vorwärts, in Bewegung bleiben, auch damit die Vergangenheit sie nicht einholte. Sie war neugierig auf die Zukunft. Jetzt würde in der Stadt so viel gebaut und renoviert werden wie noch nie. Da wollte sie dabei sein, ein Teil davon werden. Nicht nur Theo … nicht nur andere hatten Träume und Vorstellungen, was man mit einer Stadt ohne Mauer anfangen konnte, mit den Räumen, die sich erschlossen.
Der alte Steinbaukasten ihres Vaters war ebenso schuld an ihrem Wunsch, Architektin zu werden, wie ein Spruch ihrer Mutter, die einmal ausgerufen hatte: »Das sind doch nur Luftschlösser!«
Das bezog sich auf einen vagen Plan ihres Vaters, irgendwann nach Teneriffa auszuwandern. Aus diesem Plan wurde dann auch nie etwas, aber der Begriff Luftschloss faszinierte die sechsjährige Ylvi, die von da an mit dem Steinbaukasten nur noch »Luftschlösser« baute.
Als sie älter wurde, war ihr klar, dass die Gebäude, die sie bauen würde, nicht am Himmel, sondern auf der Erde stehen mussten und keine Schlösser sein konnten. Doch sie war bereit, sich damit zu begnügen, denn wenn sie für Familien Traumhäuser bauen konnte, dann waren das doch auch Luftschlösser, die in Erfüllung gingen.
Und nun, da sie ihren Abschluss in der Tasche hatte, wollte sie in einem Architekturbüro anfangen und endlich etwas mit der Wirklichkeit zu tun haben.
»Du schaffst das schon! Hauptsache, du machst einen Anfang!«, ermutigte ihr Vater sie.
Doch es fiel ihr schwer, sich auf ihre Bewerbungsmappe zu konzentrieren. Wenn sie nur nicht so müde wäre – manchmal war ihr sogar übel. Sie schob es auf ihr schlechtes Gewissen.
An eine Schwangerschaft hatte sie nicht gedacht. Dabei hatten Ricky und sie seit einiger Zeit versucht, ein Kind zu bekommen.
Ricky war beglückt. »Siehst du, alles funktioniert. Einen besseren Zeitpunkt hätte es nicht geben können! Du hast deinen Abschluss, und ich bin auf dem besten Weg zu einem Riesenerfolg.«
Ylvi ging zum Frauenarzt. Vielleicht war es ja doch ein Fehlalarm? Aber er bestätigte ihr, was sie ohnehin wusste.
Er sagte ihr auch, in welcher Woche sie war.
Prompt wurde ihr wieder übel, doch diesmal lag es nicht an den Hormonen. Sie konnte nun nicht mehr verdrängen, dass es eine kleine, aber erschreckend reelle Chance gab, dass nicht Ricky der Vater war.
Ging ihr Theo darum nicht aus dem Kopf? Verstummte die Melodie des Gartens deshalb nicht in ihr? Wie betäubt verließ Ylvi die Praxis, schob den Schnee von einer Bank im Park und setzte sich. Sie konnte ihre Gefühle nicht einordnen. Wenn Theo der Vater wäre – dann war dieses Baby nicht nur das Ergebnis der Vereinigung zweier Menschen, deren Leben sich in einem verzauberten und historisch einmaligen Augenblick kurz, aber nachhaltig berührt hatten. Es wäre auch ein Kind der versöhnlichen und wundersamen Vereinigung zweier sich schon lange fremd gewordener Hälften eines Landes.
Sie musste Theo finden! Aber wie sollte sie das anstellen? Außer seinem Vornamen wusste sie nur, dass er Gärtner war und Frau und Sohn hatte. Selbst wenn sie ihn finden könnte, es war ziemlich sicher, dass er nicht gefunden werden wollte. Und Ricky?
»Oh je!«, stöhnte sie und vergrub das Gesicht in den Händen.
»Kann ich Ihnen helfen? Geht es Ihnen schlecht?« Ylvi sah auf. Vor ihr stand ein Mann, schlank und groß und dunkelhaarig, und sah sie besorgt an. Er ähnelte Theo ein wenig, nur war er etwa zwanzig Jahre älter. Ylvi spürte, wie kalt ihre Füße geworden waren und stand etwas mühsam auf.
»Nein.« Zu ihrer eigenen Überraschung strahlte sie den Mann an. »Ganz im Gegenteil. Es geht mir hervorragend. Ich bekomme ein Kind!«
»Na, dann gratuliere ich Ihnen. Aber wenn das so ist, sollten Sie bestimmt nicht so lange in der Kälte sitzen. Haben Sie es weit bis nach Hause? Soll ich Ihnen ein Taxi besorgen?«
»Nein, vielen Dank. Es ist nicht weit. Auf Wiedersehen!« Fröhlich stapfte sie los. Sie spürte eine ganz neue, funkelnde Kraft in sich. Das war doch das einzig Wichtige. Sie bekam ein Kind! Alles würde gut werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass Ricky der Vater war, war hoch.
Aber ganz tief im Inneren ahnte sie, dass etwas geschehen war, das den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung ebenso wenig folgte, wie es der friedliche Mauerfall getan hatte.
Die Bewerbungen konnte sie nun erst mal vergessen. Stattdessen stürzte sie sich, nachdem der Schnee getaut war, in die Gartenarbeit. Seit Leben in ihr heranwuchs, machte es ihr besondere Freude, erst die Krokusse wachsen zu sehen, dann die Tulpen und die Osterglocken. Auch dieser Garten begann, eine Melodie zu haben, aber sie war verhalten, und die Töne passten noch nicht zusammen. Ylvi pflanzte ein Apfelbäumchen und Brombeeren und, als es warm wurde, in einer geschützten Ecke den kleinen Walnussbaum, der erst eine Handspanne hoch war. Sie baute einen kleinen Käfig aus Kaninchendraht um ihn herum, damit ihn niemand zertrat oder anknabberte. Von Tag zu Tag bekam er hoffnungsvolle neue Triebe, während sich Ylvis Bauch rundete.
Sie baute auch ein Vogelbad, und ihre gefiederten Freunde kamen in Scharen. Doch so sehr sie sich auch mühte, seit jener Novembernacht hatte sie das unbestimmte Gefühl, dass sie nicht am richtigen Ort war.
Immer wieder grübelte sie, ob sie Ricky ihren Seitensprung beichten sollte. Aber was waren die Worte für so etwas? Sie hatte Angst. Sie wollte Ricky nicht verlieren. Er würde sicher nicht nur verletzt, sondern auch zutiefst in seinem Stolz gekränkt sein.
Insgeheim aber befürchtete sie vor allem, dass er so etwas sagen würde wie: »Ach, wirklich? Du, wir haben gestern Herrn Nilsson eine Elektrode eingesetzt, die es ihm ermöglicht, Kreuzworträtsel zu lösen.«
Denn so sehr sich Ricky über ihre Schwangerschaft freute, er war dennoch immer mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Arbeit, seinen Kollegen, seinen Plänen und Entwürfen. Sie konnte es ihm nicht vorwerfen. Seine Begeisterungsfähigkeit für alles, was er anpackte, war einer der Gründe gewesen, warum sie sich in ihn verliebt hatte.
Irgendwann kam er doch mit zur Ultraschalluntersuchung und bestaunte mit ihr den winzigen Herzschlag auf dem Monitor.
»Möchten Sie wissen, was es wird?«, fragte die Ärztin. »Jetzt kann man es erkennen.«
»Mir ist das egal«, sagte Ylvi verträumt.
»Doch, verraten Sie es uns«, bat Ricky.
»Ein Mädchen. Sie bekommen eine Tochter.«
»Aha.« Bildete sie sich das ein, oder klang Ricky enttäuscht? Nun, sie würde ihn schon noch aufklären, dass auch Mädchen sich für Roboter interessieren konnten.
Wobei es natürlich möglich war, dass gerade dieses Mädchen sich mehr für Blumen begeistern würde. Aber jetzt, da er das Herz schlagen gehört und das Ultraschallbild gesehen hatte, war wohl endgültig der Zeitpunkt vorüber, Ricky die Wahrheit zu sagen.
Nach der Geburt würde sie einen Weg finden, die Vaterschaft feststellen zu lassen, und sicher war alles so, wie es sein sollte. Bestimmt sah das Mädchen Ricky sogar ähnlich. Wenn nicht – ja, wenn nicht, dann konnte sie ihm immer noch alles gestehen; und sicher würde er das Kind bis dahin schon so sehr lieben, dass er sich so oder so als Vater fühlte. Er würde Ylvi verzeihen und verstehen, dass in jener verrückten Nacht des Mauerfalls die Wirklichkeit und alle ihre Gesetze für kurze Zeit außer Kraft gesetzt waren. Dass der Seitensprung eigentlich kein Seitensprung gewesen war, sondern eine Entladung von Wunder und Euphorie und einer völlig überraschenden lebensbejahenden Kraft, die wie eine Sturmwelle über den Alltag hinweggerollt war und sie ohne jede Vorwarnung mitgerissen hatte.
Ab diesem Tag entspannte sich Ylvi. Es würde kommen, wie es eben kam. Sie kümmerte sich um ihren Garten, zeichnete Entwürfe für Luftschlösser, die sie schließlich zu einem Bilderbuch für das Kind zusammenband, und besuchte häufig ihre Eltern.
»Ich kann es kaum erwarten, Großvater zu werden«, sagte ihr Vater jedes Mal wieder, und Ylvis Mutter hörte nicht auf zu strahlen, als sie das erste Mal unter ihrer Hand das Kind strampeln fühlte.
Ylvi bekam einen ungewöhnlichen Heißhunger auf Currywurst, dabei aß sie sonst wenig Fleisch. Aber irgendetwas fehlte ihr noch dazu. Sie stöberte im Kühlschrank und fand ein Glas mit der Aufschrift »Wildapfelgelee«. Sie öffnete es und kostete. Genau was sie gesucht hatte! Wie himmlisch. Es schmeckte herb und rauchig und süß und geheimnisvoll, alles auf einmal. Fast war ihr, als hätte der Geschmack auch eine Musik, dunkel und weich und doch voller Licht, genau wie die dunkelgoldene durchsichtige Farbe des Gelees. Es musste die Melodie der Landschaft sein, in der die Früchte gereift waren. Sie fügte ein paar Löffel davon ihrer Currywurst hinzu.
»Ich hoffe, ich verderbe dir nicht deinen Geschmack, aber ich kann nicht anders«, sagte sie zu dem kleinen Wesen in ihrem Bauch und aß gierig. »Dafür bleiben dir die sauren Gurken erspart.« Nach zwei Tagen war das Gelee alle. Auf dem Preisschild entzifferte Ylvi, dass sie das Glas bei ihrem Lieblingsfeinkosthändler in Schöneberg mitgenommen hatte. Hoffentlich hatte er noch mehr davon. Zeit genug hatte sie ja und machte sich auf den Weg.
»Da haben Sie Glück«, sagte der Inhaber Herr Herbst, den sie schon seit Jahren kannte. »Hier sind noch drei Gläser. Und hier, kosten Sie doch einmal. Das könnte Ihnen auch schmecken. Birnenkonfekt.« Er entnahm einer kleinen Kiste mit seiner silbernen Zange eine Praline und legte sie auf ihre Handfläche.
Ylvi schloss die Augen, als sich das Aroma auf ihrer Zunge ausbreitete. Es schmeckte nach allen guten Tagen des letzten Sommers. Nach Wärme und nach Sonne. Wie die Essenz von Träumen und von Hoffnung. Und ihr war, als hätte sie diesen Geschmack schon vor langer Zeit gekannt, konnte sich nur nicht mehr erinnern. Er gab ihr Kraft.
»Das muss ich unbedingt haben, Herr Herbst. Wo kommt das her?«
»Ich packe Ihnen auch noch ein paar getrocknete Birnenringe dazu. Es sind dieselben Früchte.« Er machte sich an Tüten und Kisten zu schaffen. »Seit dem Mauerfall fahre ich gelegentlich in der DDR herum auf der Suche nach Besonderem. Die Leute dort haben Obstsorten, von denen wir lange nichts gehört haben. Die haben dort einfach die Zeit überdauert wie in einem Dornröschenschlaf. In Ahrenshoop auf dem Darß an der Ostsee habe ich in einem Teeladen das Wildapfelgelee entdeckt, und dieses Birnenkonfekt und die getrockneten Ringe und noch einige andere Marmeladensorten. Der Besitzer des Ladens erklärte mir, dass eine alte Frau namens Kaja Benjes all dies herstellt. Sie hat einen Garten, in dem es Obstbäume gibt, die zum Teil mehrere hundert Jahre alt sind, jedenfalls der Wildapfelbaum. Ich finde, man schmeckt es. Ich frage mich, ob sie dem Gelee nicht etwas Seetang zugefügt hat.«
Diesen Garten hätte Ylvi gern einmal gesehen. Auf jeden Fall half ihr der Geschmack seiner Früchte über die schwereren Tage der Schwangerschaft hinweg. Das Kauen der Birnenringe wirkte sogar gegen die morgendliche Übelkeit.
Gelegentlich schlenderte sie mit klopfendem Herzen durch Berliner Gärtnereien, doch kein Theo tauchte dort auf. Auch unter den Kleinanzeigen in der Zeitung war keine, in der ein Theo eine Ylvi suchte, mit der er auf dem Fahrrad in der Mauerfallnacht in den Osten aufgebrochen war.
Ylvis Zukunft würde wohl Theo-los bleiben, und so gehörte es sich auch.
Wann immer ihr doch mulmig zumute wurde, zog sie sich hinter die Hecke zurück und spielte auf ihrer Piccoloflöte. Angeblich hörten die Babys ja schon im Bauch die Musik in der Umgebung. Sie hoffte, dass sie auf diese Weise nicht nur sich selbst, sondern auch das kleine Mädchen beruhigte, das kräftig in ihr strampelte.
Sie wusste immer noch nicht, ob sie fürchtete oder sich wünschte, dass dieses Kind sie eines Tages mit Theos Augen ansehen würde.
Birnenkonfekt
1 kg reife Birnen
500 g aromatische Äpfel
Saft von 3 Zitronen
100 g Mandelsplitter, geröstet
etwa 1 kg Zucker
1–2 Päckchen dunkle Kuvertüre
Birnen und Äpfel vierteln oder achteln, mit wenig Wasser weichkochen und durch ein Sieb streichen. Das Mus mit der gleichen Gewichtsmenge Zucker und dem Zitronensaft dick einkochen. Zuletzt die Mandeln unterrühren. Die Masse etwas abkühlen lassen und dann 1 cm dick auf die mit Folie belegten Trockengitter streichen und trocknen. Dabei einmal über frischer Folie wenden. Dunkle Kuvertüre im Wasserbad schmelzen lassen. Konfekt damit bestreichen. Wenn alles getrocknet ist, in Würfel oder Rauten schneiden.
Myra
1943
Ahrenshoop/Ostsee
3Der Schmuggler
Für Mitte Oktober war es heute ungewöhnlich mild. Myra Webelhuth stand bis über die Knie im Wasser und genoss das Prickeln der eisigen Wellen an ihrer Haut. Der Herbstwind zog an ihren langen dunkelblonden Haaren, die sich in der feuchten Luft leicht lockten. Außer ihr wäre jetzt niemand hier barfuß ins Meer gelaufen, aber sie war es von klein auf gewohnt. Nichts schreckte Myra so leicht. Sie war gerade erst siebzehn geworden, aber in diesen Zeiten wurde man schnell erwachsen. Myra sowieso.
»Du hast jetzt die Verantwortung, Mädchen«, hatte ihr Vater gesagt, als er freiwillig in den Krieg zog. »Ich verlasse mich auf dich. Du machst das schon, auch wenn du nur eine Frau – nur ein Mädchen bist.« Da war sie dreizehn gewesen.
Sie hatte kein enges Verhältnis zu ihrem Vater. Das Einzige, was er und sie gemeinsam hatten, war das Wissen, dass ihre Mutter keine Frau der Tat war. Anfänglich hatte sie für Myra gesorgt, wie man für kleine Kinder eben sorgen muss. Doch dann war es Jonas Webelhuth, der nach und nach den Haushalt organisierte und sich um alles kümmerte, bis Myra mit zehn anfing, mehr und mehr davon selbst zu übernehmen. Ihre Mutter war die Tochter eines Feriengastes aus der Großstadt, sie hatte sich in dem rauen Küstenklima nie zu Hause gefühlt. Sie verbrachte ganze Tage auf dem Sofa, zog die Gardinen zu und bestickte Tischdecken mit immer denselben Mustern. Als Jonas Webelhuth in den Krieg verschwand, öffnete sie die Gardinen nur noch selten und verließ das Haus kaum. Sie schloss den Krieg und die Wirklichkeit aus ihrem Leben aus; und als es kein feines Garn mehr gab, dröselte sie einen alten Pullover auf und stickte weiter Vergissmeinnicht und Veilchen.
Myra brachte ihr Essen und drängte sie gelegentlich dazu, wenigstens eine Stunde auf der Terrasse zu sitzen. Länger hielt es Myra selbst nicht dort aus. Sie war voller Bewegungsdrang und Tatendurst, putzte das Haus, pflanzte im Garten Kartoffeln und Rüben, damit sie etwas zu essen hatten, fuhr mit ihrem Fahrrad in der Gegend herum und tauschte Bernstein gegen Lebensmittel, Kleidung und Medikamente. So versorgte sie nicht nur ihre Mutter und sich selbst, sondern auch die kleine Henny Badonin von nebenan und deren nicht mehr sehr rüstige Großeltern. Myra brauchte das. Sich um andere zu kümmern gab ihr das Gefühl, dass dieses verrückte Leben noch einen Sinn hatte.
Es war großes Glück, dass sie ein solches Talent hatte, Bernstein zu finden. Manche behaupteten, sie müsse ihn riechen – ein Unsinn, den sie belächelte. Bernstein entfaltete seinen Duft nach uralten Wäldern nur, wenn man ihn schliff oder anderweitig erhitzte. Andere tuschelten sogar, es ginge bei Myra nicht mit rechten Dingen zu.
Der alte Oskar aus Prerow, der Bernsteinschmuck herstellte und verkaufte, war einer ihrer besten Kunden. Er schüttelte immer den Kopf, wenn Myra ihm ihre Funde anbot.
»Wie machst du das nur immer, Myra Webelhuth? Auch ich weiß, wann der Bernsteinwind weht und das Wasser die richtige Temperatur hat und an welchen Stellen man den meisten Bernstein findet. Aber egal, wie sorgfältig und wie oft ich suche, meine Ausbeute ist immer mager. Willst du mir nicht endlich dein Geheimnis verraten?«
»Ach, Oskar, du verdienst genug mit deinen Waren, auch wenn du mich für das Material bezahlen musst.«
»In Friedenszeiten vielleicht«, brummelte er. »Wollen wir hoffen, dass die irgendwann wiederkehren!«
Das hoffte Myra auch. Sie wollte nicht ewig ihre schönsten Funde gegen Fleisch und Mehl eintauschen müssen. Am liebsten wollte sie alle behalten und ein kleines Bernsteinmuseum einrichten, damit Feriengäste aus der ganzen Welt sehen konnten, was für zauberhafte und verwunschene Schätze die uralten Sommer von vor Jahrmillionen im Meer hinterlassen hatten. Die meisten Menschen ahnten nicht, wie viele verschiedene Farben Bernstein haben konnte: Weiß und fast Schwarz, mitunter Blau und Grün, und dann waren da noch die Geheimnisse in seinem Inneren. Spuren von Erde, ganze Ameisen, kleine Blüten, unversehrte Samen oder der fein gezeichnete Flügel einer Biene, die durch eine Welt geschwirrt war, in der von Menschen und von Krieg noch lange keine Rede gewesen war. Obwohl es auch damals sicherlich nicht nur friedlich zuging, denn irgendwie musste der Biene ja der Flügel abhandengekommen sein. Myra stellte sich einen jungen Flugsaurier vor, der seine erste Beute fing und dabei seine Krallen in die Rinde eines Nadelbaums schlug, so dass ein Tropfen Harz zu Boden fiel, gleichzeitig mit dem Flügel des Insekts, das er gerade verschlang.
Nachdem ihr Vater fort war und sie die ganze Last allein tragen musste, bedeutete ihr das Bernsteinfischen besonders viel. Nicht nur weil es ihr den Lebensunterhalt ermöglichte, sondern weil ihr diese Momente hier draußen allein am Flutsaum mit den Wellen, dem Wind und dem Sand Momente kostbarer Freiheit und Leichtigkeit gaben. Daraus zog sie ihre Kraft, darum war diese Kraft unerschöpflich und reichte auch für Henny und die Großeltern Badonin und nun auch für Nicholas, diesen zarten, verschüchterten kleinen Bengel, den Henny kürzlich angeschleppt hatte. Er weckte sofort Myras Beschützerinstinkt. Zerbrechlich war er und liebebedürftig und gleichzeitig so talentiert. Seine Bilder beeindruckten durch fesselnde Lebendigkeit, und seine Augen waren Myra fast ein wenig unheimlich. Sie wirkten, als ob sie mehr sähen als andere – Dinge, die womöglich niemand sonst wahrnahm.
Als er zögernd von seinem brutalen Vater erzählte, weil Myra die blauen Flecken und roten Striemen entdeckt hatte, flog ihm ihr Herz zu. Sie konnte Ungerechtigkeiten nicht ertragen, und das Wissen über Nicholas’ Vater trug dazu bei, dass sie Männer noch weniger mochte als ohnehin. Männer enttäuschten einfach zu oft. Da war Hennys Vater Hendrik Badonin, der nach dem Tod seiner Frau sein Baby im Stich gelassen hatte und verschwunden war. Da war ihr eigener Vater, der die erstbeste Gelegenheit ergriffen hatte, von seiner wehleidigen Frau und seiner Tochter fortzukommen, die nicht der ersehnte Sohn geworden war. Und nun Justus Ronning, der seinen kleinen Sohn auf die Dächer prügelte, damit er ihm beim Reparieren helfen sollte und auch ein »Mann« werden, der sich vor nichts fürchtete.
Aber sie, Myra, würde das Zarte, Ungewöhnliche in Nicholas nun beschützen. Sie würde Fleisch auf seine Knochen bringen und dafür sorgen, dass er nicht mehr ständig frieren musste. Und Henny konnte ihn das Lachen lehren. Myra hielt einen Bernstein, den sie gerade zu ihren Füßen ertastet hatte, gegen den heller werdenden Himmel und lächelte. Ein schönes Stück. Dafür würde sie Wolle eintauschen, für einen Pullover für Nicholas.
Eine Bewegung hinter ihr und ein kaum hörbares Plätschern rissen sie aus ihren Gedanken.
»Wenn Sie kein Wassergeist sind oder das Bild eines Traumes, dann würde ich diesen Schatz gerne erwerben!« Der Wind trieb die Stimme in ihre Ohren, bevor sie sich umdrehen konnte. Eine Männerstimme, die das Rauschen der Wellen mühelos übertönte, ohne laut zu werden.
Aus dem Nebel sah sie ein Boot auftauchen. Wasser vom letzten Schlag tropfte noch von den Ruderblättern, obwohl der Mann regungslos und aufrecht saß. Das Erste, was ihr an ihm auffiel, waren seine rauchgrauen Augen mit einem Leuchten darin wie der Morgen, dessen Licht sich jetzt ringsum diffus im herbstlichen Dunst über dem Meer brach und dem Tag ein weiches Schimmern verlieh wie der Perlmuttglanz im Inneren einer Muschel.
Myra ließ die Hand mit dem Bernstein sinken.
»Über einen guten Handel kann man immer sprechen«, sagte sie kühl. Sie ärgerte sich, dass sich jemand angeschlichen und sie in einem Moment überrascht hatte, in dem sie sich allein wähnte mit dem Meer und dem Himmel und sich ihnen hingegeben hatte. Sie fühlte sich verletzlich, da sie kaum Zeit hatte, ihre gewohnte Unnahbarkeit wieder wie einen schützenden Umhang anzulegen.
»Es tut mir leid, dass ich mich so angeschlichen habe«, sagte er, als hätte er ihre Gedanken gelesen. »Es war nicht meine Absicht. Der Nebel hat alle Geräusche verschluckt, bis er überraschend dieses wunderschöne Bild freigab.«
Diese Augen ließen sie nicht los. Bewunderung lag darin. Er machte einen einzigen weiteren Ruderschlag, der ihn näher zu ihr hintrieb.
»Ich hörte bereits, dass dieses Dorf ein Künstlerdorf ist. Nun verstehe ich, warum! Als ich Sie da im Morgennebel stehen sah, den Bernstein zum Himmel gereckt und Wind in den Haaren, hielt ich Sie fast für eine Tochter Neptuns. Mit blauen Augen, klar und tief wie das Meer, und mit Haaren, dunkelblond wie der Strandhafer. Leider kann ich Sie nicht malen, sondern Ihnen nur einen fairen Handel anbieten. Ein Tauschgeschäft. Sie haben nicht zufällig noch einen zweiten Bernstein?«
Myra starrte ihn an.
Du willst ein wenig angeben, Myra?, raunte da die Stimme in ihrem Kopf, die sie gelegentlich zu hören glaubte und die doch Einbildung sein musste. Nur zu, warum nicht? Gehe drei Schritte auf die Buhne zu und sieben nach links ins tiefere Wasser.
Wie oft hatte sie sich schon gefragt, ob es das Meer selbst war, das zu ihr sprach. Doch im Moment war wichtiger, dass die Stimme recht behielt, egal woher sie kam. Myra antwortete dem Fremden nicht, sondern konzentrierte sich auf ihre Schritte und dass die Wellen sie nicht aus dem Tritt brachten. Drei Schritte vor, sieben auf den Horizont zu. Das Wasser wurde tiefer hier, aber zu ihren Füßen im Strömungsschatten der Buhne fühlte sie ein Knäuel aus Tang und Treibholz. Sie bückte sich und tastete darin herum. Da! Sie spürte es am Gewicht und an der Oberfläche. Ein Bernstein, fast hühnereigroß. Sie befreite ihn aus dem Knäuel, schloss ihre Hand darum und watete zurück. Triumphierend hielt sie dem Ruderer ihren Fund entgegen. Er hatte sie nicht aus den Augen gelassen. Nun nahm er das Stück skeptisch entgegen, wog es in der Hand, hielt es gegen das Licht.
»Donnerwetter. Das gibt es doch nicht. Woher wussten Sie das? Die genaue Stelle? Es sah aus, als würden Sie den Bernstein rufen und der käme zu Ihnen. Was sind Sie, eine Bernsteinbeschwörerin?«
Das Wort gefiel ihr so gut, dass sie ihm ihr bestes Lächeln schenkte. Seine Augen weiteten sich, dann kniff er sie zusammen und betrachtete Myra genauer. Er schwang die Beine über den Bootsrand, sprang ins Wasser und kam auf sie zu. Das Ruderboot zog er am Tau hinter sich her.
Er kam ihr nahe, so nahe, dass sie in dem Nebelgrau seiner Augen eine heitere Wärme entdeckte.
»Bist du überhaupt schon geschäftstüchtig? Ich glaube, wir können Du sagen. Ich bin neunzehn, und du?«
Myra hatte ihn für älter gehalten, wahrscheinlich weil er einen ganzen Kopf größer war als sie, was sie nicht gewohnt war, und weil Seewind und Sonne bereits Spuren auf seiner Haut hinterlassen und Fältchen in seine Augenwinkel gezeichnet hatten. Sie musste über seinen Akzent lächeln.
»Du bist also aus Dänemark. Ich bin siebzehn. Und ich vermute, du meinst geschäftsfähig. Geschäftstüchtig bin ich auf jeden Fall. Und nach der Geschäftsfähigkeit fragt schon lange niemand mehr. Es ist Krieg.«
»O ja. Das weiß ich wohl. Gestatten, Frederic fünf, Kapitän. Das da draußen ist mein Schiff.« Er wies in Richtung Fahrrinne. Der Nebel hatte begonnen, sich zu heben. Myra sah den Umriss eines breiten, eher zuverlässigen denn eleganten Rumpfes, nicht besonders groß.
»Ein alter Fischkutter. Von wegen Kapitän! Niemand ist mit neunzehn Kapitän. Und warum Frederic fünf? Ist das ein Deckname? Hast du etwas zu verbergen? Bist du Pirat? Oder Schmuggler?«
»Haben wir in diesen Zeiten nicht alle etwas zu verbergen? Meinen richtigen Namen verrate ich niemandem. Es ist sicherer so. Aber es ist mein Schiff, und ich entscheide, wohin es fährt. Also bin ich der Kapitän. Es mag ein Fischkutter sein, aber ein frisierter Fischkutter. Du würdest dich wundern, was der Motor leistet! Und die alte Fremtid segelt auch besser, als sie aussieht.«
»Fremtid? Was bedeutet das?«
»Zukunft. Ich fand, in diesen Zeiten ist das der beste Name für ein Schiff.«
Das gefiel Myra. Zukunft, das konnte man brauchen, auch in Form eines schwerfälligen Schiffes, das möglicherweise zu mehr fähig war, als man ihm ansah.
»Nun gut, Kapitän Frederic, was ist mit unserem Tauschhandel? Was hast du anzubieten gegen zwei wertvolle Bernsteine?«
»Außer dem Bernstein möchte ich noch deinen Namen. Wie heißt du, wunderschöne Neptunstochter und geheimnisvolle Bernsteinbeschwörerin? Und was hättest du gerne im Tausch gegen deine Schätze?«
Sie war Schmeicheleien nicht gewohnt und rettete sich in die Rolle der Geschäftsfrau. »Myra Webelhuth aus Ahrenshoop. Hast du zufällig Wolle an Bord? Dicke, stabile Wolle, aus der man warme Pullover stricken kann?«
Er schüttelte bedauernd den Kopf. »Damit kann ich leider nicht dienen. Aber wie wäre es mit ein paar Metern warmes Tuch, aus dem man eine Winterjacke schneidern kann?«
Myra wurde hellhörig. Genau was sie brauchte, um nicht nur für Nicholas, sondern auch für Henny etwas Warmes zu nähen.
»Nicht nur ein paar Meter. Für zwei so große Steine möchte ich den ganzen Ballen. Ich poliere sie dafür auch noch vor.«
Sie waren inzwischen zum Strand gewatet, und Frederic hatte das Boot an Land gezogen. Myra ging zu ihrer Tasche, zog ein Stück Sandpapier, ein grobes und ein weiches Tuch heraus und machte sich daran, ihre beiden Funde zu säubern und zu polieren, bis die Oberfläche zu glänzen begann. Ein würziger Geruch nach Harz mischte sich in den Herbstwind. Frederic sah ihr zu und schüttelte den Kopf.
»Für den ganzen Ballen braucht es noch eine weitere Dreingabe.«
Sie reichte ihm den ersten, fertigen Bernstein, und er fuhr mit dem Finger andächtig über das glatte Schimmern. Myra fragte sich, ob er die Steine bei nächster Gelegenheit gegen etwas anderes eintauschen würde oder ob er sie für eine bestimmte Frau wollte. Doch um keinen Preis würde sie ihn das fragen. Was war bloß los mit ihr, sie war doch sonst nicht so neugierig? Leben und leben lassen war ihr Motto. Die Dinge waren wesentlich einfacher, wenn sich jeder um seinen eigenen Kram kümmerte. Außer wenn jemand Hilfe brauchte natürlich.
»Was für eine Dreingabe hast du im Sinn?«, fragte sie.
»Sag du es mir. Lass dir was einfallen. Ich kann nichts wissen über deine Geheimnisse.«
»Und woher soll ich wissen, ob der Stoff etwas taugt?«
Er breitete die Arme aus. »Würde ich es wagen, eine Frau zu betrügen, die Bernstein aus dem Meer heraufbeschwören kann?«
Verflixt, sie mochte dieses verschmitzte Funkeln in seinen Augen! Für einen Schmuggler wirkte er ehrlich. Myra überlegte und wühlte in ihrem Beutel herum. Aus einer Seitentasche zog sie zögernd ein Blatt dickes Zeichenpapier und hielt es ihm vor die Nase.
»Wie wäre es damit? Ein Stück Sommer, vielleicht für deine Mutter?«
Er nahm das Blatt behutsam in die Hand und sah lange darauf. Es war die Zeichnung einer Mohnblume, groß und stolz in kräftigen Farben, die fiedrigen grünen Blätter wie Hände zum Himmel gestreckt, die Blüte weit offen, um nichts vom Sonnenlicht zu verpassen. Myra hatte die Zeichnung am Vortag gemacht, in einem Anfall von Sehnsucht nach Farbe und Leben, nachdem sie eine Stunde bei ihrer Mutter gesessen hatte. Frederic rollte das Papier sorgsam zusammen und steckte es in seine Brusttasche.
»Für meine Mutter und meine Tante sind bereits die beiden Bernsteine gedacht«, sagte er. »Doch meine Großmutter wird sich sehr über ein solch lebendiges und kräftiges Stück Sommer freuen.«
Der Bernstein war also nicht für seine Freundin. Hatte er schon wieder ihre Gedanken gelesen, dass er sie dies wissen ließ?
»Du sorgst wohl gut für deine Familie? Sie scheint groß zu sein.« Myra biss sich auf die Lippen. Hatte sie neidisch geklungen? Eine große Familie, das wünschte sie sich manchmal auch. Dabei hatte sie doch Henny und deren Großeltern und nun auch noch Nicholas.
Frederic stand auf. »Ich versuche es. Man darf nicht nur für Nahrung sorgen. Man muss auch an ihre Seelen denken, jetzt, da alles so schwer ist. Darum danke ich dir, Bernsteinbeschwörerin, für die lebendige Schönheit in den Dingen, die ich von dir erwerben darf. Ich werde rasch zur Fremtid hinausrudern und dir das Tuch holen. Wartest du hier auf mich oder soll ich es dir irgendwo hinbringen? Ist dir kalt?«
»Nein, alles in Ordnung. Ich wollte ohnehin Zeit am Strand verbringen, darum bin ich ja hier. Ich warte.«