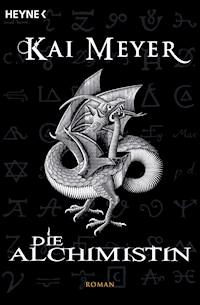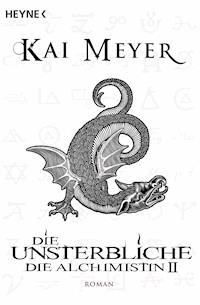17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Ein Bücherdieb, ein Junge ohne Erinnerung und die Magie des Lesens: Kai Meyers großer zeitgeschichtlicher Roman über die Geheimnisse der Bücher und eine schicksalhafte Liebe Dichter Nebel wogt durch die Gassen der Bücherstadt Leipzig, 1933, als das Böse die Macht ergreift. Hier entspinnt sich die tragische Liebe des Buchbinders Jakob Steinfeld zu einer rätselhaften jungen Frau. Juli hat ein Buch geschrieben, das sie einzig ihm anvertrauen will. Doch bald darauf verschwindet sie spurlos. Fast vierzig Jahre später ist auch Jakobs Sohn Robert den Büchern verfallen und reist auf der Suche nach seltenen Ausgaben durch ganz Europa. Er liebt seine Arbeit und die Bücher – von Menschen hält er sich meist eher fern. Doch als die Bibliothekarin Marie ihn bittet, ihr bei einem Auftrag der geheimnisumwitterten Verlegerfamilie Pallandt zu helfen, stoßen sie auf das Mysterium eines Buches, dessen Geschichte eng mit Roberts eigener verknüpft ist – es ist der Schlüssel zum Schicksal seiner Eltern. Bestseller-Autor Kai Meyer hat eine wunderschöne Liebeserklärung an die Welt der Bücher geschrieben, die zugleich ein berührender historischer Roman und ein hochspannendes Stück Zeitgeschichte vom Zweiten Weltkrieg bis in die 70er Jahre ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 650
Ähnliche
Kai Meyer
Die Bücher, der Junge und die Nacht
Roman
Knaur eBooks
Über dieses Buch
Dichter Nebel wogt durch die Gassen der Bücherstadt Leipzig, 1933, als das Böse die Macht ergreift. Hier entspinnt sich die tragische Liebe des Buchbinders Jakob Steinfeld zu einer rätselhaften jungen Frau. Juli hat ein Buch geschrieben, das sie einzig ihm anvertrauen will. Doch bald darauf verschwindet sie spurlos. Fast vierzig Jahre später ist auch Jakobs Sohn Robert den Büchern verfallen. Als die Bibliothekarin Marie ihn bittet, ihr bei einem Auftrag der geheimnisumwitterten Verlegerfamilie Pallandt zu helfen, stoßen sie auf das Mysterium eines Buches, dessen Geschichte eng mit Roberts eigener verknüpft ist – es ist der Schlüssel zum Schicksal seiner Eltern.
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
1
1943
Bomben fielen vom Nachthimmel, als der Junge sein Gefängnis verließ, den Raum ohne Fenster, den Raum voller Bücher.
Er war zehn Jahre alt und ebenso lange eingesperrt gewesen. An den Wänden seines Zimmers reichten die Regale bis zur Decke, die Bücher standen Rücken an Rücken, viele in dichten Doppelreihen. Mit fünf hatte man ihm das Lesen beigebracht, seitdem war seine Welt aus Papier.
In dieser Nacht erfuhr er, dass kaum etwas besser brannte.
Das Draußen seiner Träume, in das er sich jahrelang fortgelesen hatte, war voller Heldenmut und Abenteuer, ein Panorama großer Taten und Leidenschaften, in dem die Menschen beständig die Liebe beschworen und das hohe Ideal der Freiheit priesen. Dort kämpften Männer und Frauen, um beides zu erlangen, die Liebe und die Freiheit, doch dem eingesperrten Jungen waren solche Ziele so fremd wie die Stadt jenseits der Zimmertür, so unerreichbar wie die Steppen der Tataren und die Meere wilder Seeräuber.
Vor wenigen Minuten, kurz vor vier in der Nacht, hatten ihn Erschütterungen und ohrenbetäubender Lärm aus dem Bett getrieben. Regale waren umgestürzt und hatten zahllose Bücher unter sich begraben. Dann war Rauch unter der Tür hervorgequollen, weiß und dicht und beißend. In Windeseile hatte er sich Kleidung und Schuhe übergestreift und sich am Kopfende seines Bettes zusammengekauert, mit angezogenen Knien und brennenden Augen, und darauf gewartet, dass jemand kommen und ihn holen würde.
Keiner war gekommen. Da war ihm klar geworden, dass er sterben würde.
Er hatte die Luft angehalten, während der Türspalt immer heller geglüht hatte und Funken darunter hervorgestoben waren. Das Trommelfeuer aus Detonationen war erst weitergezogen, dann zurückgekehrt. Schließlich hatte eine markerschütternde Explosion die Welt aus den Angeln gehoben, lauter und kräftiger als alle zuvor, und der Boden war mitsamt der Bücherberge eingestürzt und hatte den Jungen verschlungen.
Im nächsten Moment fiel er mit seiner Matratze auf einen harten Kellerboden, umwirbelt von einer Schleppe aus Rauch. Geistesgegenwärtig sprang er auf und lief los, durch eine Dunkelheit ohne Flammen, hinaus in einen Gang, durch den man ihn vor fast einem Jahr an Weihnachten hinüber ins große Haus geführt hatte, in eine Bibliothek, in die sein kleines Bücherzimmer viele, viele Male gepasst hätte. Damals waren von irgendwoher leise Musik und der Geruch von Gebäck herangeweht – beides nicht für ihn –, während er dort hatte stöbern dürfen. Und dann hatte man ihn mit einem Stapel neuer Bücher zurückgebracht, wieder durch diesen unterirdischen Gang, der das große Haus mit dem kleineren verband, zurück in seine Schatzkammer der Geschichten, seinen Kerker aus Buchstaben und Schweigen.
Heute aber, in der Nacht des Luftangriffs, führte ihn derselbe Gang in die Freiheit. Benommen, immer wieder hustend, lief er durch den Korridor hinüber in das Haus, in dem jene lebten, die ihn festgehalten hatten. Als er die Treppe zum Erdgeschoss erreichte, schlug ihm von oben Hitze entgegen. Er presste die Armbeuge vor Nase und Mund, kniff die Augen zusammen und sprang die Stufen hinauf, geradewegs ins Feuer.
Die Villa brannte lichterloh, und die neue Welt des Jungen, die ihm für Minuten so unverhofft grenzenlos erschienen war, schrumpfte abermals auf wenige Meter zusammen.
Hätte er sich in dieser Minute wie ein Vogel in die Lüfte erheben können, hoch über die Dächer des Graphischen Viertels, dann hätte er Leipzig brennen sehen, eine Hölle aus lodernden Straßenzügen, ein Labyrinth verwinkelter Flammenwände, durch das rußschwarze Menschen irrten und über verkohlte Leichen stiegen. Dann hätte er die teuflischen Stürme gespürt, die entstanden, als die Feuersbrünste den Himmel über der Stadt zum Kochen brachten, sodass die Luftmassen über dem Zentrum in die Höhe stiegen und jene aus den Randgebieten mit sich zerrten, ein Mahlstrom aus Höllenhitze, der Trambahnen von den Schienen riss und Autos gegen die Fassaden schleuderte. Er hätte beobachtet, wie all die Bücherlager und Papierhallen zu turmhohen Fackeln wurden und Buchseiten in endlosen Strömen durch die Straßen trieben.
Vielleicht hätte er auch intimere Vignetten der Vernichtung mitangesehen, etwa die kostbare Sammlung historischer Buchstabentypen, die zu Schlacke geschmolzen die Treppe einer Druckerei hinabfloss und als silbriges Kauderwelsch im Hof endete. Oder die Halle mit brennenden Lesebändchen, die sich wie Zündschnüre schlängelten und zu Asche zerfielen. Er wäre Augenzeuge geworden, wie in wenigen Stunden fünfzig Millionen Bücher verbrannten, zweitausend Menschen starben und das legendäre Graphische Viertel, das Herz der alten Bücherstadt, für alle Zeiten verging.
Doch von alldem sollte der Junge erst später hören, nach seiner Begegnung mit dem Maskenmann.
Der Fremde kam aus einem brennenden Türrahmen auf den Jungen zu, packte ihn und riss ihn mit sich. Keinen Atemzug später schmetterte dort, wo das Kind gestanden hatte, ein gläserner Kronleuchter auf den Boden und zersprang in einer klirrenden Kaskade. Der Junge schrie auf, aber nicht sehr laut, denn er war das Sprechen nicht gewohnt und das Schreien erst recht nicht. Als er wieder auf eigenen Füßen stand, beugte sich die massige Gestalt zu ihm herab, ein Unhold in langem Ledermantel und Gasmaske, ein Furcht einflößender Bastard aus Pestdoktor und Märchenriese. Ehe der Junge sich wehren konnte, wurde ihm ebenfalls eine Maske übergestülpt, der Mann rief: »Atme!«, und dann sah er die Welt durch zwei runde Scheiben und saugte tranige, stinkende Luft in die Lunge.
»Ganz ruhig atmen!«, brüllte der Mann, kaum zu verstehen durch seinen klobigen Rüssel aus Kunststoff und Metall. »Wenn du leben willst, musst du dich beruhigen!«
Der Junge atmete tief ein und aus, konzentrierte sich auf seine Nase, seinen Hals und seinen Brustkorb. Seine Panik legte sich weit genug, dass er wieder klar denken konnte. Ganz in der Nähe fauchten Flammen, ihre Hitze schmerzte auf seiner Haut.
Das Gesicht des Fremden war nicht zu sehen, selbst seine Augen blieben unsichtbar hinter dem Glas. Aber der Junge spürte, dass er ihn beobachtete, abschätzte, vielleicht überlegte, ob sein Leben es wert war, gerettet zu werden.
»Komm mit«, sagte der Mann. Er fragte nicht nach dem Namen des Jungen, der sich selbst kaum noch daran erinnern konnte. Man hatte ihn immer nur »Junge« genannt. Junge, tu dies, Junge, tu das. Putz dir die Zähne, zieh dich ordentlich an. Weine nicht. Vor allem das: Junge, weine nicht.
Er hatte schon lange nicht mehr geweint.
Kurz überlegte er, vor dem Mann davonzulaufen, aber er wusste nicht, wohin. Überall Feuer und Rauch. In einem Bilderrahmen brannte ein Frauengesicht; es sah aus, als wäre ihr Haar aus Flammen.
»Mach schon!«, rief der Mann, packte die Hand des Kindes und zog es mit sich, durch eine zweite Tür und einen vernebelten Korridor hinab. Hinter dunklen Holztäfelungen stieg Rauch auf. Alle Türen waren aus den Rahmen gebrochen: Die auf der rechten Seite lagen kreuz und quer im Gang, die auf der linken in den offenen Zimmern. In der Ferne dröhnten weitere Explosionen, aber keine Sirene, keine Geschütze zur Gegenwehr. Die Stadt schien so hilflos wie ein Ameisenhaufen, in den jemand Streichhölzer warf, um das brennende Gewimmel zu bestaunen.
Sie erreichten einen Raum, den der Junge wiedererkannte. Dies war die Bibliothek, in die sie ihn an Weihnachten gebracht hatten. Der Stuck war in großen Brocken von der Decke gefallen. Ein weiterer Kronleuchter lag mitten im Zimmer, umschlungen von einer schweren Kette. Auch hier waren Regale umgestürzt, Bücher bedeckten Parkett und Teppich. In einer Wand hatte sich neben einer hohen Eichentür ein Spalt aufgetan. Am Fuß der Tür lagen ein Brecheisen und ein Hammer. Offenbar hatte jemand – der Mann? – vergeblich versucht, den Eingang aufzustemmen. Durch die gerissene Wand hatte sich der Rahmen verzogen und die Tür unpassierbar gemacht.
»Du musst durch den Spalt in der Mauer klettern«, brüllte der Maskenmann.
Die Augen des Jungen folgten seinem Blick. Die dunkelgrüne Tapete war vom Boden bis zur Decke aufgerissen, die Ränder mit Verputz gepudert.
»Ich pass da nicht rein!«, rief der Mann. »Du schon!«
»Geht es da nach draußen?«, fragte der Junge zaghaft.
»Ich versteh dich nicht!«
»Geht es da nach draußen?«
»Du kannst also sprechen.«
Der Junge nickte.
»Dahinter ist ein Zimmer. Ein geheimes Zimmer. Du kletterst hinein und bringst mir ein Buch, das dort liegt.«
»Hier sind überall Bücher. Woher weiß ich, welches du willst?«
»Da drüben gibt es nur ein einziges. Bevor der Angriff losging, war es auf einer Art Altar drapiert.«
Der Junge kannte einen Altar nur aus Romanen und stellte sich einen Tisch vor, auf dem weiße Kerzen standen. »Ist es eine Bibel?«
»Nein. Es heißt Das Alphabet des Schlafs.« Tief im Haus stürzte lärmend eine Decke ein, gefolgt von einer Wand. »Du musst dich beeilen. Wenn du mir das Buch bringst, schaffe ich dich lebend hier raus.«
»Versprochen?«
»Ehrenwort. Und jetzt los! Hier wird gleich alles brennen.«
Dem Jungen blieb keine Zeit zum Nachdenken. Kurzerhand lief er zum Spalt und begann, sich hineinzuzwängen. Wenigstens drang von dort kein Rauch herüber, auf der anderen Seite war es dunkel. Die Gasmaske behinderte ihn und er wollte sie herunterziehen, aber sofort war der Mann heran und hielt seine Hand fest.
»Nicht. Der Rauch bringt dich um.«
»Aber damit pass ich nicht durch.«
»Doch, tust du. Du bist sehr dünn. Dreh den Kopf zur Seite, während du dich durchschiebst.«
»Aber –«
»Sieh mich an!«
Während der Junge sich in den Spalt zwängte, drehte er das Gesicht mit dem Maskenrüssel so weit es ging nach links. Erst jetzt bemerkte er, dass hinter dem Mann ein hohes Fenster geborsten war. Draußen im Freien brannten drei Baumkronen wie Medusenhäupter aus Flammen, umwabert von dichtem Qualm. Durch den Rahmen sahen sie aus wie eine Zeichnung aus seinen Sagenbüchern.
Die Mauer war zweimal so breit wie er selbst. Auf halbem Weg zur anderen Seite blieb er stecken. Ihm war, als hörte er ein Knirschen. Vielleicht schloss sich der Spalt gerade wieder, vielleicht stürzte das ganze Haus über ihm ein. Sein Hals tat weh, weil er ihn so unnatürlich verrenken musste, und ihm wurde bewusst, dass er nicht sah, wohin er sich bewegte und was dort vor ihm lag. Stattdessen hatte er keine andere Wahl, als den Mann anzusehen, den schwarzen Koloss aus Leder und Gummi.
»Mach schneller!«
»Ich steck fest!«
»Dann atme aus. Du musst die ganze Luft aus deiner Lunge drücken!«
Der Junge gehorchte und konnte sich tatsächlich wieder bewegen. Augenblicke später ertastete seine rechte Hand die Kante am Ende des Spalts, klammerte sich darum und zog. Der Druck auf seine Brust ließ nach. Im nächsten Moment war er frei.
Oder, nein, nicht frei. Allein in einem dunklen Zimmer ohne Fenster, hinter einer verschlossenen Tür. Schlagartig war alles wie immer, wenn sie von außen das Licht gelöscht hatten, um ihn für seinen Ungehorsam zu bestrafen. Wenn er nicht lernte und die Aufgaben nicht erledigte, die sie ihm stellten. Sie hatten ihn gefangen gehalten, aber sie hatten keinen dummen Gefangenen gewollt, das hatten sie wieder und wieder gesagt.
Lese. Lerne. Sei respektvoll und gehorsam. Wasch dich und treibe Gymnastik. Achte auf deine Gesundheit und iss das Gemüse.
»Hier!« Der Mann reichte ihm mit gestrecktem Arm eine schwere Stablampe durch den Spalt. Sie war bereits eingeschaltet.
Der Junge nahm sie entgegen und blickte sich um. Der Raum maß etwa vier Meter im Quadrat. An den Wänden hingen gerahmte Fotografien einer jungen Frau mit hellem Haar. Auf manchen Bildern war ein Kind zu sehen, ein Mädchen. Wahrscheinlich dieselbe Person, dachte der Junge. Es gab noch mehr Dinge: ein zerbrochenes Tintenfass, einen Füllfederhalter und eine wuchtige Schreibmaschine.
»Das Feuer kommt näher!«, erklang die dumpfe Stimme des Mannes von der anderen Seite. »Siehst du das Buch?«
Da war ein Buch. Es war von einer Ablage gerutscht, bei der es sich womöglich um den Altar handelte, von dem der Mann gesprochen hatte. Besonders eindrucksvoll sah er nicht aus. Der Junge bückte sich und hob es mit der linken Hand auf. Es war groß, aber nicht besonders dick, und hatte einen dunkelroten Ledereinband. Er sah kostbar aus, bedeckt mit geschwungenen Mustern.
»Gib es mir!«, rief der Mann.
Der Titel stand nicht vorn auf dem Deckel, sondern in goldenen Lettern auf dem schmalen Buchrücken. Das Alphabet des Schlafs. Und ein Name: S. Morena.
Wieder erschütterten Detonationen das Haus, nun lauter. Eine Sirene heulte auf und verstummte nach wenigen Sekunden. Putz rieselte von der Decke auf den Jungen und das Buch. Die stinkende Luft in der Maske wurde immer heißer.
Der Mann schrie etwas Unverständliches und streckte die Hand in den Spalt, um das Buch entgegenzunehmen. Doch der Junge, der sich mit Gefangenschaft auskannte, war nicht bereit, es ihm so leichtfertig zu überlassen. Gewiss würde der Mann sonst ohne ihn verschwinden.
»Gib schon her!«
Der Junge schüttelte den Kopf, drehte ihn dann nach links und schob sich in den Spalt. »Nimm den Arm da weg!«, rief er.
»Erst das Buch!«
»Nein.«
Aber er bemerkte schnell, dass er die linke Hand brauchen würde, um sich an der Kante auf die andere Seite zu ziehen. Diesmal bekam er Panik, als er die enge Stelle in der Mitte erreichte, und darüber ließ ihn die Maske im Stich. Er begann Lichter zu sehen, tanzende, feurige Kreise, und da ließ er das Buch einfach fallen.
Der Mann fing es auf und zog es aus dem Spalt. Er las den Titel, nickte zufrieden und schob es unter seinen Mantel. Das Buch verschwand darin, als würde es ein Teil von ihm, so als wäre sein Brustkorb aus Gelee. Der Junge hatte plötzlich Angst davor, den Mann ohne Maske zu sehen.
»Deine Hand!«
Der Junge kämpfte mit Panik und Platzangst, aber es gelang ihm, seinen linken Arm für einen kurzen Moment ruhig zu halten. Der Fremde packte ihn und zerrte ihn mit einem brutalen Ruck aus dem Spalt. Der Junge stieß gegen ihn, und beinahe wären beide gestürzt, mitten in das Meer von Büchern auf dem Boden der Bibliothek.
»Pass doch auf!«
»Entschuldigung.«
»Entschuldige dich nicht.«
»Aber ich –«
»Spar deine Atemluft. Du wirst sie noch brauchen.« Der Mann lief los, ohne sich umzusehen, eilte mit großen Schritten über die Bücherhügel und geborstenen Regale, trat einen hölzernen Globus beiseite – ganz Europa brannte – und hielt kurz vor einer leeren Stelle an der Wand inne.
Der Junge sah ebenfalls hin. »Was war da?«
»Nichts. Gar nichts.«
Aber selbst durch das Maskenglas und den Rauch konnte der Junge einen verfärbten Umriss auf der Tapete erkennen, so als hätte dort lange Zeit etwas gestanden, groß wie eine Standuhr. Oder ein Sarg.
»Weiter!« Der Mann setzte sich wieder in Bewegung, und der Junge folgte ihm. Das Getöse der brennenden Villa kam von überallher, wahrscheinlich hätte er allein keinen Ausweg gefunden. Manchmal konnte er im Qualm den Mann kaum mehr sehen, obwohl der direkt vor ihm war. Dann wieder schienen Flammen die dichten Schwaden zu verzehren und loderten in glasklarer Glut nur wenige Schritte entfernt. Immer wieder krachte es ganz in der Nähe, Teile der Decke fielen herunter. Kristalllüster schwankten hoch über ihnen, ihre geschliffenen Oberflächen reflektierten die Feuersbrunst. Die Hitze war kaum zu ertragen, die Luft unter der Maske schmerzte beim Einatmen wie geriebenes Glas.
Immer wieder rief der Mann etwas, das den Jungen antreiben sollte, doch das war nicht nötig. Er wusste, dass er um sein Leben rannte, und das tat er: rannte so schnell er nur konnte, wich Flammenlohen aus offenen Türen aus und dem Inferno im Foyer, wo eine mächtige Freitreppe Feuer gefangen hatte, eine Klaviatur aus grell lodernden und verkohlten Stufen. Auf halber Höhe lag eine tote Frau mit brennendem Oberkörper.
»Raus!«, schrie der Mann und gestikulierte zur offenen Haustür. »Raus hier, schnell!«
Über ihnen rasten Risse durch die Decke des Foyers, glühende Verästelungen, wo sich das Flammenmeer im ersten Stock durch Steine und Balken fraß.
»Phosphor!«, brüllte der Mann, was dem Jungen nichts sagte. Aber das Wort klang bedrohlich genug, um wieder nach vorn zu blicken, der Tür entgegen und dem, was dort draußen war. Noch mehr Feuer, der Garten brannte, und jenseits davon die schreiende, gemarterte Stadt, deren Existenz er nur vom Hörensagen kannte.
Sie waren gerade zur Tür hinaus, als die Decke des Foyers einstürzte. Unter brüllendem Lärm fielen die Stücke herab, barsten auf rußigem Marmor und begruben die Leiche auf der Treppe. Darüber ergoss sich eine Kaskade schneeweißer Glut, eine andere Art von Feuer als jenes, das der Junge bislang gesehen hatte. Flammen, die auseinanderspritzten und neue Brände entfachten, verheerender als alle vorherigen.
Am Rand des Vorplatzes lag eine Limousine auf der Seite. Feuer schlug aus den geborstenen Scheiben. Die Druckwelle einer Explosion hatte sie gegen den Stamm einer Eiche geschleudert. Aus der zerstörten Windschutzscheibe hingen verkohlte Überreste eines Körpers wie schwarze Äste.
Der Mann und der Junge rannten über Kies und Gras zwischen brennenden Bäumen hindurch. Der Rauch schien in bizarren Strömungen aufzusteigen, in grauen Säulen dem Nachthimmel entgegen, kroch aus Hecken und Laubengängen und aus den Fensterhöhlen hoher Backsteinbauten jenseits des Gartens.
So weit war der Junge noch nie gekommen. Er hatte den Park durch die Fenster der Bibliothek gesehen, bei dem Weihnachtsbesuch im großen Haus, aber er wusste nicht, wie es dahinter aussah.
»Ich bring dich hier raus!«, rief der Mann über die Schulter. »Ich halte mein Wort!«
Auch der Junge blickte zurück in die Hölle, in die sich die Villa und das prunkvolle Gartenhaus verwandelt hatten, vereint zu einer einzigen Feuersbrunst. Seine Gasmaske fühlte sich glühend heiß an, wie festgeschmolzen an seinem Gesicht. Als er Ruß von den Augengläsern wischen wollte, verbrannte er sich die Finger. Ein Wunder, dass er überhaupt noch etwas sah – und dabei den Vogel entdeckte.
Die Eule stieg aus dem Hochofen der prasselnden Villa auf, entging einem Fangarm aus Flammen und wurde eins mit dem Rauch. Der Junge war sicher, dass sie aus dem Haus geflogen war, nicht aus den Bäumen – eine Kreatur auf der Flucht wie er selbst –, und er dachte wehmütig, dass er sie gern schon früher gesehen hätte, denn er kannte Vögel nur von Bildern und war noch nie einem lebenden begegnet.
»Da war eine Eule«, sagte er zu dem Mann, doch der schien ihn nicht zu hören. »Eine echte, fliegende Eule!«
Sie rannten durch hohe Tore und Innenhöfe, immer weiter, bis die Luft nicht mehr in der Kehle brannte und das nächste Feuer fern genug war, um keine unmittelbare Bedrohung zu sein.
Da blieb der Mann stehen, drehte sich zu dem Jungen um, riss ihm die qualmende Maske vom Kopf, schob seine eigene nach oben und entblößte sein Gesicht.
2
1971
In meiner Erinnerung hielt Marie meine Hand, als wir den Bibliothekssaal des Schlosses betraten. Ich weiß nicht, ob es genau so geschehen ist, aber wenn es so war, dann dachte sie sich gewiss nichts dabei. Oder dachte sich gerade etwas dabei, denn so war Marie, mit ihrem vieldeutigen Lächeln, diesem delphischen Wissen über das, was ich fühlte, sobald ich sie ansah, ob nun verstohlen oder unverhohlen.
Das Barockschloss der Familie Pallandt lag außerhalb von München, eine Dreiviertelstunde in Maries gelbem Käfer, mit dem sie mich am Hauptbahnhof abgeholt hatte. Rauchend, mit offenen Fenstern, waren wir über schmale Landstraßen gefahren, hinaus aus der Stadt, die träge in der Sommersonne lag wie die Nackten in den Isarauen.
Eigentlich waren wir Konkurrenten, kannten uns seit Jahren, waren ein paarmal zusammen im Bett gelandet, hätten aber nicht im Traum daran gedacht, das Ganze Beziehung zu nennen. Ich war nicht sicher, wie bindungsfähig Marie damals war, ich zumindest war es nicht. Am Bahnhof hatte sie kurz ihren Freund erwähnt, vielleicht, damit ich nicht auf falsche Gedanken kam, aber eigentlich hatte sie immer irgendeinen Freund gehabt – und wie hätte es auch anders sein können, wenn man sie so ansah: klein und schmal, mit nussbraunem Haar, das sie immer sehr kurz trug, und diesem renitenten Blitzen hinter den runden Brillengläsern. Ihre Nase war klein und spitz und ein wenig nach oben gebogen, und aus irgendeinem Grund fand ich immer, dass sie von all dem Hübschen an ihr das Allerhübscheste war.
An diesem Tag trug sie Jeans mit weitem Schlag und ein kurzärmeliges gelbes Hemd, die Knöpfe offen bis zum Brustbein. Sie würde wohl noch als alte Dame wie eine Studentin erscheinen, indes mir die Vorstellung, Marie könnte je alt werden, absurd vorkam. Marie Ludwig war einunddreißig, sah aber aus wie einundzwanzig, war viel geschäftstüchtiger als ich und schnappte mir regelmäßig die besten Jobs weg. Darüber waren wir irgendwie zu Freunden geworden, was voll und ganz den Widersprüchen entsprach, die Marie wie einen Sternschnuppenschweif durchs Leben wirbelte.
Auch diesen Job hätte ich gern gehabt, spätestens als ich das Schloss vor uns sah und eine Ahnung davon bekam, welchen Tagessatz Maximilian Pallandt ihr bezahlte. Sie parkte an der Rückseite und führte mich durch einen Hintereingang in das weiße Gemäuer. Irgendwo hörte ich Angestellte mit Töpfen klappern, doch ich sah keinen von ihnen, weil Marie ein Händchen für günstige Momente besaß, vor allem, wenn es um Verbotenes ging.
Und dann, wie gesagt, ergriff sie meine Hand und führte mich in die Schlossbibliothek. Innerhalb eines Augenblicks vergaß ich alles andere, die Sorge über die Angestellten ebenso wie den Anflug von Neid. So war es schon immer gewesen: Beim Anblick alter Bücher neige ich dazu, jeden Gedanken an angemessene Vergütungen und gesicherten Lebensunterhalt zu vergessen.
Ich hatte die Bücher gerochen, bevor ich sie zu sehen bekam, diesen ganz besonderen Duft, der vom Sterben kündet, auch wenn das den wenigsten bewusst ist. Was wir als wunderbaren Buchgeruch empfinden, der so betörend ist wie das Lesen selbst, ist eine Folge der bakteriellen Zersetzung des Papiers. Armeen von Mikroorganismen sind nimmermüde zwischen den Deckeln zugange, marschieren im Stechschritt über Zeilen und Verse, nagen fleißig an Seiten und Serifen, verdauen Holz und Leim und Leder. Wir schwelgen in der duftenden Verheißung voller Bücherregale, während wir doch tatsächlich ihrem Untergang beiwohnen.
»Beeindruckend, oder?« Marie schloss die Tür und trat neben mich. Wir standen da wie zwei Sternsucher unter der Kuppel eines Planetariums. Ich kam mir sehr gewöhnlich vor inmitten dieser barocken Pracht aus wimmelnden Deckengemälden und üppigem Stuck, geschnitztem Regalschmuck, gebohnertem Parkett und Ledersesseln, die schon beim Ansehen knirschten.
Operettenhafte Ornamente bedrängten das Auge von allen Seiten, und doch hing mein Blick nur an den Büchern. Sie standen dicht gedrängt in Reihen vom Boden bis zur Decke, die meisten sehr alt, mit braunen, gerundeten Rücken, unter denen sich hier und da gespaltene Lesebändchen wie Teufelszungen hervorschlängelten. Dies war die Bibliothek eines Sammlers, nicht eines Lesers. Hier hatte jemand um Vollständigkeit gerungen, um Gesamtausgaben, um Seltenheit und beständige Werte. Wenn Marie es geschickt anstellte und all das hier an die richtigen Leute verkaufte – und weil sie das konnte, war sie hier –, würde sie für die nächsten paar Jahre ausgesorgt haben.
Das Sichten, Katalogisieren und gewinnbringende Veräußern von Bibliotheken war unser beider Geschäft. Wir wurden gerufen, sobald die Sammler in ihren Särgen lagen und hilflose Erben vor Bücherwänden standen wie verirrte Konquistadoren vor aztekischen Dschungelruinen.
»Hast du gewusst, was dich hier erwartet?«, fragte ich, während ich an ein Regal trat und die Titel überflog.
»Sagen wir, ich hatte so ein Gefühl«, sagte Marie mit einem Lächeln, das keinerlei Zweifel daran ließ, dass sie sich gründlich vorbereitet hatte, bevor sie zum ersten Mal hergekommen war. Gewiss hatte sie jeden Artikel über Konrad Pallandt ausfindig gemacht, jeden Zeitungsschnipsel auf irgendeinem Mikrofilm, jedes Porträt, in dem die Rede von der Sammelleidenschaft des Alten war. Zweifellos hatte sie alle veröffentlichten Fotos dieses Saales gekannt und wahrscheinlich noch einige mehr. Dabei hatte sie im Kopf überschlagen, wie viel Geld der Patriarch für sein Hobby ausgegeben hatte und was ihr das einbringen würde. Ich hätte es nicht anders gemacht. Nur nicht ganz so gründlich.
»Solide sechsstellig«, sagte ich. »Dein Anteil, nicht der Verkauf.«
Sie presste die Lippen aufeinander und lächelte noch ein wenig breiter.
Ich musste ebenfalls lachen. »Verdammt, wie hast du das angestellt? Es gab nicht mal eine Ausschreibung.«
»Gute Kontakte.«
»Die hab ich auch.«
Sie hob die Schultern und strich mit den Fingerspitzen an den Buchrücken entlang. »Maximilian Pallandt weiß, was sein Vater hier zusammengetragen hat. Nicht im Detail, aber er hat eine ungefähre Ahnung. Und ich hab nicht versucht, ihn bei meiner ersten Schätzung übers Ohr zu hauen. Der Mann ist Unternehmer, und er weiß es zu würdigen, wenn man ihn nicht für einen Idioten hält.«
»Dann waren noch andere hier?«
»Drei, vier«, sagte sie vage. »Lemmberg, soweit ich weiß. Auf jeden Fall Parnell. McCulloch ist extra aus Edinburgh eingeflogen. Sie haben’s auf die übliche Tour versucht: Das sehe ja alles sehr wertvoll aus, aber in Wahrheit gebe es kaum Käufer dafür, blablabla. Und Pallandt ist ihnen nicht auf den Leim gegangen.«
»Gut für dich«, sagte ich.
»Gut für mich. Und für dich.«
Ich schüttelte den Kopf. »Du brauchst meine Hilfe nicht.«
»Nein, aber du meine.«
»Wie meinst du das?«
»Komm mit.«
Sie ging voraus, quer durch den Saal, vorbei an Tischen voller Bücherstapel, und bog um eine Ecke in einen kleineren Seitentrakt, der immer noch weitläufiger war als viele Stadtbibliotheken. Hier standen die meisten Bände hinter Glas, viele hinter Gittern. Durch kleine Fenster unter der Decke fielen Lichtstrahlen, die auf ihrer Wanderung über den Marmorboden niemals die Bücherschränke berühren würden. Nichts an diesem Ort war dem Zufall überlassen worden, auch wenn es nicht danach aussehen sollte.
An der Stirnwand des Seitenflügels hatte man einen ägyptischen Sarkophag hochkant aufgestellt. Er war offen, der goldene Deckel dekorativ daneben drapiert. Im Inneren befand sich, ebenfalls durch Glas geschützt, eine menschliche Mumie, eingewickelt in Bandagen und so vergilbt wie die Bücher. Auch das Gesicht war fast vollständig bedeckt, die Arme vor der Brust gekreuzt. Nur die Augenpartie lag offen, die Lider waren geschlossen.
»Ist die echt?«
Marie nickte. »Ist aber kein Pharao, nur irgendein armer Mönch, der sich nicht im Traum vorstellen konnte, dass er mal als Deko in der Bibliothek eines stinkreichen Buchhändlers landen würde.« Konrad Pallandt war kein einfacher Buchhändler gewesen, und darum überraschte mich auch die Mumie nicht allzu sehr. »Jedenfalls sagt das Pallandt junior. Sein Vater hat das Ding samt Sarkophagimitat schon vor dem Krieg von einem verarmten Adeligen gekauft.«
»Bibliotheksmumien waren mal ’ne große Sache«, sagte ich. »In der Bibliotheca Theresiana in Wien stehen gleich zwei davon. Und im Karmelitenkloster von Lissabon sogar drei. Zwei davon kommen allerdings aus Peru, nicht aus Ägypten. Ich bin nicht sicher, ob die zählen.«
Marie lächelte höflich. Zweifellos kannte sie alle fünf, vielleicht sogar persönlich.
Die Präsentation von Bibliotheksmumien war durchaus verbreitet. Ich hatte eine in der Stiftsbibliothek von St. Gallen gesehen, eine andere in einem Kloster bei Sevilla. Zudem gab es viele Berichte über Mumien, die im Laufe der Jahre aus berühmten Bibliotheken verschwunden waren. In Cambridge hatte es zwei gegeben, eine davon in der Bibliothek des Trinity Colleges, und es existierten Gerüchte über die angebliche Mumie der Kleopatra, die in der französischen Nationalbibliothek ausgestellt worden war. In Deutschland hatte eine Mumie in der Fürstlichen Bibliothek von Kassel gestanden, in Polen eine in Breslau. Sie war vom Dichter Gryphius höchstpersönlich seziert worden, irgendwann im siebzehnten Jahrhundert, und natürlich hatte er nichts Besseres zu tun gehabt, als ein Buch darüber zu schreiben. Mumiae Wratislavienses. Übrigens kein Bestseller.
Ich trat einen Schritt von dem falschen Sarkophag und der echten Mumie zurück, sah flüchtig die Spiegelung meines Gesichts auf ihrem, und wandte mich wieder Marie zu.
»Du hast mich nicht wegen einer Mumie herkommen lassen.«
»Nein«, sagte sie, »deswegen.«
Mein Blick folgte ihrer ausgestreckten Hand zu einem Glasschrank, der ein Stück weiter links stand. Er ähnelte den vielen anderen Schränken in diesem Teil der Schlossbibliothek. Aus der Hosentasche ihrer Jeans zog sie einen Schlüssel, den sie schon am Bahnhof dabeigehabt haben musste. Maximilian Pallandt wäre damit wohl nicht einverstanden gewesen. Genauso wenig hätte es ihm gefallen, einen Fremden in seinem Schloss anzutreffen. Private Führungen gehörten gewiss nicht zu Maries Aufgaben; ich war sicher, dass sie gerade ihren Job aufs Spiel setzte, um mir das hier zu zeigen.
Sie öffnete die Glastür des Schranks und trat einen Schritt beiseite. »Schau’s dir an.«
Jedes der Bücher im Inneren – grob überschlagen um die zweihundert – war in dunkelrotes Leder gebunden. Die Rücken besaßen sauber gearbeitete Bünde und Schilde mit feiner Typografie und vergoldeten Verzierungen. Viele davon waren nicht geprägt, sondern sorgsam aufgemalt. Ich erkannte die vorzügliche Handarbeit sofort, und ich begriff, warum Marie mich hier haben wollte.
»Sind das alles Steinfelds?«, fragte ich und kannte die Antwort, noch ehe ich sie aus dem Augenwinkel nicken sah.
»Jedes einzelne.«
Mein Name ist Robert Steinfeld, und diese Bücher stammten aus der Buchbinderwerkstatt meiner Vorfahren. Jakob Steinfeld, mein Vater, hatte das Geschäft von seinem Vater übernommen und bis zu seinem Tod die Familientradition – das Binden kostbarer Einzelstücke – mit höchster Präzision und Hingabe betrieben. Vielleicht hätte ihm gefallen, dass auch ich beruflich mit Büchern zu tun hatte. Ich hatte nie die Möglichkeit, ihn danach zu fragen.
Beinahe ehrfürchtig zog ich einen Band aus einem der fünf Regalfächer des Glasschranks. Alles daran war makellos, von den Bordüren am Rand des Deckels über den farbigen Buchschnitt bis hin zu den goldenen Innenkanten und dem Vorsatz aus feinstem Papier. Abgesehen vom Buchschmuck waren die Deckel leer, der Titel stand auf dem Rücken: Die Fünf und Vierzig von Alexandre Dumas.
Marie blickte über meine Schulter. »Die Fortsetzung der Dame von Monsoreau.1847 auf Deutsch erschienen.« Sie schmunzelte. »Hast du’s gewusst?«
Ohne zu antworten, blätterte ich zum Rückdeckel.
»Natürlich hast du«, sagte sie.
Dumas war eines meiner Spezialgebiete, nicht weil ich seine Romane so mochte – das tat ich, aber nicht mehr als die der anderen großen Kolportageschriftsteller –, sondern weil meinem Vater so viel an seinen Büchern gelegen war.
Steinfeld, Graphisches Viertel, 1891 war mit zwei Stempeln nahezu unsichtbar in den Nachsatz geprägt worden. Also hatte mein Großvater den Band von 1847 vierundvierzig Jahre nach Erscheinen neu gebunden und nach allen Regeln seiner Kunst verziert. Bis ins zwanzigste Jahrhundert war es üblich gewesen, wertvolle Bände mit neuen Buchdeckeln zu versehen. Schönheit und Stabilität waren wichtiger gewesen als ein authentisches, aber mangelhaftes Äußeres. Meine Vorfahren waren darauf spezialisiert gewesen, Büchern wie diesem neuen Glanz zu schenken, und mit den Jahren waren die Einzelstücke aus der Steinfeld’schen Buchbinderei sehr viel wertvoller und gesuchter geworden als die abgegriffenen Originalausgaben.
Die übrigen Bände der Reihe um die Dame von Monsoreau standen ebenfalls in dem Regal, zwischen Dutzenden anderer bekannter und weniger bekannter Titel aus dem achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert. Einige waren noch älter, obgleich alle Umschläge die unverkennbare Handarbeit meines Großvaters und Vaters aufwiesen. Dies hier war mit weitem Abstand die größte Sammlung von Steinfeld-Ausgaben, die ich je zu Gesicht bekommen hatte. Ich selbst besaß nur vier Bände, andere Sammler bis zu einem halben Dutzend. Demnach hatte Konrad Pallandt neben allem, was er in dieser Bibliothek zusammengetragen hatte, das Vermächtnis meiner Vorfahren gehütet.
Ich spürte, dass Marie gespannt auf meine Reaktion wartete.
»Erstaunlich«, sagte ich leise.
»Das ist alles?«
Ich blätterte in einem zweiten Buch, Anselmo von Charles Didier, erschienen 1835. »Was hast du erwartet?«
»Na, ein bisschen sprühenden Enthusiasmus, zum Beispiel.«
»Hast du mich jemals enthusiastischer erlebt?«
»Ja.«
Ich verzog einen Mundwinkel. »In einer Bibliothek?«
»Einmal. In –«
»Okay.« Ich schenkte ihr ein aufrichtiges Lächeln. »Wirklich, das ist großartig. Ich bin ein bisschen überwältigt. Und überrascht, das alles ausgerechnet bei den Pallandts zu finden.«
»Früher stand ihr Verlagshaus neben der Werkstatt deines Vaters, oder?«
»Das Verlagshaus, die Druckereien, die Lagerhallen.« Ich holte tief Luft. »Und dann ist alles beim Luftangriff auf Leipzig dem Erdboden gleichgemacht worden, ihre Gebäude genauso wie der Laden meines Vaters. Die Pallandts haben sich wieder berappelt und sind '45 nach Bayern umgesiedelt. Mein Vater ist in seiner Werkstatt gestorben, als die Bomben fielen, und nach dem wenigen, was ich über ihn in Erfahrung bringen konnte, hätte er es auch gar nicht anders gewollt. Er hat nur für seine Bücher gelebt.«
Marie nahm mir den Anselmo aus der Hand wie einem Kind, das sich für die falschen Dinge interessiert, stellte ihn zurück und zog ein anderes Buch aus einem der unteren Fächer. »Die Werkstatt der Steinfelds gibt es also seit dem Dezember 1943 nicht mehr, richtig?«
»Worauf willst du hinaus?« Ich klang jetzt etwas ungehalten, und das war nicht ihre Schuld, aber mir war nicht nach Spielchen zumute.
Sie drückte mir das Buch in die Hand. Cagliostro in Petersburg von Theodor Mundt, 1858. »Sieh dir die Prägung an.«
Ich schlug den Nachsatz auf und las.
Steinfeld, Graphisches Viertel, 1953.
»Unmöglich. 1953 hat das Graphische Viertel nicht mehr existiert. Jedenfalls nicht mehr in seiner ursprünglichen Form. Und ganz sicher nicht die Buchbinderei meines Vaters.«
Marie griff nach einem weiteren Buch und schlug es auf. Steinfeld, Graphisches Viertel, 1956. Und noch eines, diesmal von 1961.
Ich schüttelte den Kopf. »Jeder, der sich auch nur ein wenig auskennt, weiß, dass es keine originalen Steinfeld-Ausgaben geben kann, die neuer sind als 1943.«
»Hier schon. Und zwar eine ganze Menge.« Sie schob den Band zurück ins unterste Regal und ließ den Zeigefinger an den Rücken entlangwandern. »Die hier sind aus den späten Vierzigern und den Fünfzigerjahren. Das neueste ist von 1963. Danach ist Schluss. Ich hab sie alle durchgesehen.«
Sie trat ein paar Schritte zurück, während ich nacheinander alle Bücher aufschlug. Sie sagte kein Wort, ließ mich einfach machen und tat, als beschäftigte sie sich mit irgendetwas anderem.
Sie hatte die Wahrheit gesagt. Ein Exemplar des Sandoval von 1827 war 1963 neu gebunden worden, vor gerade mal acht Jahren. Qualitativ unterschied es sich nicht von den Bänden, die mein Großvater im neunzehnten Jahrhundert gefertigt hatte, das Leder besaß die gleiche feine Struktur und der präzise Buchschmuck war perfekt.
»Wer also hat die gebunden?«, fragte ich schließlich.
Marie kam zu mir zurück. »Gibt es irgendwelche Verwandten, von denen du vielleicht nichts weißt?«
»Kann ich mir nicht vorstellen.«
»Aber du kennst deine leibliche Mutter nicht.«
In irgendeiner Nacht, in irgendeinem Hotel hatte ich Marie davon erzählt, und wer weiß, was damals in mich gefahren war, sie mit meiner Familiengeschichte zu langweilen.
Heute gab es immerhin einen vernünftigen Grund. »Meine Mutter hieß nicht Steinfeld, weil mein Vater nie verheiratet war, aber man hat trotzdem dafür gesorgt, dass dieser Name in meiner Geburtsurkunde steht. Sie ist erst später ausgestellt worden, kurz nach dem Krieg. Da mussten so viele verlorene Dokumente ersetzt werden, dass wahrscheinlich kaum einer Fragen gestellt hat.« Natürlich hatte ich mir Gedanken darüber gemacht, aber nicht mehr als nötig. Hinter meiner Geburt stand seit jeher ein großes Fragezeichen. Meine Stiefmutter war zwar großzügig und herzensgut gewesen, aber nicht allzu gesprächig. »Ich hab mir seinen Stammbaum angesehen, so gut das eben ging. Falls es heute in Leipzig noch irgendwelche Steinfelds gibt, haben sie nichts mit meinem Vater zu tun. Und nichts mit seinen Büchern.«
Das Graphische Viertel war im Dezember 1943 ausgebombt worden, auch weil in seinen riesigen Druckereien ein Großteil der Nazipropaganda hergestellt worden war. Während der sowjetischen Besatzung und nach Gründung der DDR waren dort nur wenige Verlage und Druckereien erhalten worden, staatliche Unternehmen, die nichts mehr mit der atemberaubenden Vielfalt des Viertels vor dem Krieg gemein hatten. Von den zweitausend Firmen, auf denen sich Leipzigs Ruf als Bücherstadt gegründet hatte, war nach '45 nur eine Handvoll übrig geblieben. Hätte dort jemand bis vor wenigen Jahren unter dem Namen Steinfeld Bücher gebunden, wären mir einzelne Bände schon früher in die Hände gefallen.
»Das Steinfeld-Logo sieht aus wie die Originalprägung«, sagte ich beim Blick in den Sandoval. »Das Datum wurde separat geprägt, genau wie bei den anderen Bänden.«
»Vielleicht hat jemand nur ein paar Utensilien aufbewahrt«, sagte Marie.
»Und macht in derselben Qualität weiter? Das müsste jemand sein, der sehr genau weiß, wie mein Vater gearbeitet hat.«
»Gab es Lehrlinge?«
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Müsstest du es denn wissen? Du hast gesagt, du bist deinem Vater nie begegnet und erinnerst dich an gar nichts von damals. Also könnte es doch –«
Sie brach schlagartig ab und horchte in den Saal hinaus.
»Scheiße«, flüsterte sie.
Ich hörte es auch. Draußen vor dem Schloss knirschte Kies, als sich mehrere Fahrzeuge näherten.
»Ist das Pallandt?«, fragte ich. »Ich dachte, er ist bei seinem toten Vater in der Klinik.«
»Dachte ich auch.« Mit verbissener Miene lief sie hinüber in den großen Saal, während ich die Bücher zurück an ihren Platz stellte, den Glasschrank schloss und, nach kurzem Zögern, den Schlüssel stecken ließ.
Im Hauptsaal der Bibliothek gab es Fenster mit dicken, schwarzen Vorhängen. Marie hatte einen davon einen Spalt weit geöffnet und lugte verstohlen hindurch.
»Das ist die Limousine von Maximilian Pallandt«, sagte sie. »Außerdem ein Leichenwagen.« Ehe ich etwas sehen konnte, schloss sie den Vorhang wieder. »Er lässt den Alten im Schloss aufbahren. Du musst hier weg, sofort.«
Sie lief los, und ich folgte ihr aus der Bibliothek. Bei unserer Ankunft hatte ich mir gemerkt, durch welche Gänge wir gekommen waren, doch diesmal nahmen wir eine Abkürzung durch die Schlossküche. Vorhin hatte ich hier noch Angestellte bei der Arbeit gehört.
»Sind die alle nach vorn zum Eingang?«, fragte ich leise, als wir die verlassene Küche durchquerten, vorbei an einem offenen Kamin, groß genug, um Schweine darin zu rösten.
»Sie stehen draußen Spalier«, bestätigte Marie. »Dem Toten Respekt zollen, Abschied nehmen, seinen Siegelring küssen, was weiß denn ich. Ich hatte noch keine Dienstboten.«
Ich konnte nicht anders, als bei der Vorstellung zu lächeln, wie Marie mit ihren Schlaghosen und den hochgekrempelten Hemdsärmeln eine ganze Kohorte von Hausdienern und Küchenmädchen herumkommandierte. So etwas hatte ich nur in England erlebt, wo sich Swinging London und das Chelsea Set zwar modern und bürgerlich gegeben hatten, in Wahrheit aber von der verwöhnten Brut der Bourgeoisie beherrscht worden waren.
Marie öffnete die Hintertür, spähte vorsichtig hinaus und gab mir ein Zeichen, dass die Luft rein war. Wir liefen zum Käfer und sprangen hinein. Sie wartete ein paar Minuten, bis die Leichenträger den Toten hoffentlich ins Schloss verfrachtet hatten, dann befahl sie mir: »Duck dich!«, startete den knatternden Motor und fuhr um den Seitenflügel zur Auffahrt.
3
Marie brachte mich in die Außenbezirke Münchens, lud mich samt Reisetasche an der erstbesten Straßenbahnhaltestelle ab und machte sich auf den Rückweg zum Schloss. Man erwarte von ihr, den ganzen Tag dort zu sein, sagte sie, aber ich hatte den Verdacht, dass es ihr vor allem darum ging, wenigstens einmal Konrad Pallandt leibhaftig gegenüberzustehen. Selbst wenn es nur seine Leiche war. Und ich verstand sie vollkommen: In unserem Beruf sieht man eine Sammlung mit anderen Augen, wenn man ihrem Kurator begegnet ist. Wenn man nicht nur die Bücher betrachtet, sondern das Gesicht des Menschen dahinter. Also nahm ich die nächste Bahn in die Innenstadt und quartierte mich in einer Pension ein, gleich um die Ecke vom Siegestor.
Wir hatten uns für den Abend in Schwabing verabredet, und es war noch immer taghell, als ich gegen acht vor einem Café an der Leopoldstraße Platz nahm. Alles war voll mit jungen Leuten, die sich gegenseitig in dem Bestreben überboten, die Münchner Bohème zu sein. Die Männer trugen enge Rollkragenpullover, meist in Braun oder Schwarz, und erstaunlich oft Mäntel mit Pelzkragen, obwohl die Abendluft warm war. Bei den Mädchen hatten in diesem Sommer bunte Hotpants Hochkonjunktur, dazu Lackstiefel, die über die Knie reichten. Daneben sah man geknöpfte Miniröcke und immer öfter Wickelkleider mit ultrakurzem Glockenröckchen. München war nicht London, aber in Sachen Mode wollte man nicht nachstehen. Entlang der Cafés fand ein Schaulaufen bunter Plüschjacken, knalliger Handtaschen und einer Menge Velours statt. Die Frisuren der Frauen waren voller Löckchen und Kringel, während die Haare ihrer Freunde mindestens bis zur Schulter reichten.
Marie hatte noch immer ihr gelbes Hemd an, als sie sich zu mir setzte, und ihr brauner Pony lag glatt auf dem Rand ihrer Brille. Irgendwie brachte sie es fertig, erschöpft und bezaubernd zugleich auszusehen.
Wir bestellten Weißwein und italienischen Käse, und eine Weile saßen wir nur da wie zwei Touristen, die es aus der Provinz in das trubelige Schwabing verschlagen hatte und die auf gar keinen Fall all die Schauspieler und Sängerinnen verpassen wollten, die zwischen schicken Cafés und rustikalen Kneipen flanierten.
»Pallandt kann mich nicht ausstehen«, sagte sie nach einer Weile.
»Hat er dich gefeuert?« Ich spülte mein vages Schuldbewusstsein mit Wein herunter, worin ich durchaus Erfahrung besaß.
»Nein, aber er hat diesen Blick, wenn er mich ansieht.«
»Den hab ich auch.«
Sie grinste und verspeiste ein Riesenstück Käse. »Die andere Art. Abweisend und ein bisschen finster.«
»Immerhin ist heute sein Vater gestorben.«
»Den er auch nicht ausstehen konnte, nach allem, was man so hört.« In hohem Bogen spuckte sie einen Olivenkern über den Gehweg gegen die Tür eines Porschefahrers, der gerade seinen Aschenbecher aus dem Fenster entleerte. Er beschimpfte sie auf Bayrisch, aber als von den anderen Tischen zustimmende Pfiffe ertönten, zündete er zeternd seinen Motor und röhrte die Leopoldstraße hinunter.
Marie stand auf, verbeugte sich unter Applaus in alle Richtungen und nahm wieder Platz. Jemand warf ihr eine Rose zu. Sie drehte die Blüte ab, beugte sich herüber und steckte sie in die Brusttasche meines Hemdes.
»So«, sagte sie, »jetzt bist du ein echtes Blumenkind.«
»Mit siebenunddreißig. Wurde auch Zeit.«
»Stimmt, ein Scheißalter. Nicht mehr jung und heiß, aber auch noch nicht reif und sexy.«
»Haben dir das die Schlossdiener erzählt? Ich meine, dass es Ärger gab zwischen Maximilian Pallandt und seinem Vater?« Nach über zehn Jahren in diesem Job hatte ich eine Menge Hauspersonal erlebt, aber beim Wort Schlossdiener konnte ich immer nur an Eddi Arent denken.
»Mussten sie gar nicht«, sagte Marie. »Der Junior hat mich angeheuert, um die Bibliothek aufzulösen, bevor der Alte überhaupt tot war. Hast du das schon mal erlebt? Das sagt doch genug aus über das Verhältnis der beiden.«
»Wie alt ist denn der ›Junior‹?«
»Sechzig.«
»Konrad Pallandt war über neunzig, oder?«
Den nächsten Kern legte sie artig auf ihren Teller. »Siebenundneunzig.«
»Und wie ging’s ihm zuletzt?«
»Anscheinend nicht so toll, aber bis vor Kurzem saß er noch fest im Chefsessel. Maximilian Pallandt führt das Unternehmen seit gerade mal drei Jahren.«
»Da kann man schon mal schlechte Laune haben.«
Ein paar Minuten lang beobachteten wir wieder die Passanten auf ihrem Laufsteg, dann fragte Marie: »Willst du mal drüber reden? Über die Sache mit deinem Vater?«
»Ich hab ihn nicht gekannt. Im Grunde weiß ich nicht mal genau, ob er wirklich mein Vater war.«
Mit wachen Augen sah sie mich an. Die Erschöpfung, mit der sie vorhin hier aufgeschlagen war, schien wie weggewischt.
Ich wand mich ein wenig unter diesem Blick. »Willst du wirklich die ganze elende Geschichte hören?«
»Natürlich. Warte, ich bestell mehr Wein.« Was sie auch tat. Dann sagte sie: »Ich weiß das mit der Entführung, aber –«
»War es denn eine Entführung?« Die Frage war mehr an mich selbst als an sie gerichtet. »Bis ich zehn Jahre alt war, war ich in einem Zimmer eingesperrt, in einem Gartenhaus im Park einer Villa. Nicht so eine Bretterbude, sondern eine Art Orangerie mit viel Glas und Jugendstil. Aber von außen hab ich beide Häuser nur ein einziges Mal gesehen, und da standen sie in Flammen.«
Von meiner Gefangenschaft als Kind hatte ich ihr schon damals erzählt, in nur wenigen Sätzen, weil das nichts ist, womit man anderen auf die Nerven gehen will, und viel mehr gab es dazu auch nicht zu sagen. Ich senkte meine Stimme, damit die Leute an den Nebentischen nicht mithören konnten, dann sprach ich trotzdem darüber. Das alles schien mir zweihundert Jahre her zu sein, auch wenn es nicht mal dreißig waren. Der ganze verdammte Krieg schien in einem anderen Leben stattgefunden zu haben, und ich weiß, dass nicht nur ich das so empfand. Zwischen der Leopoldstraße im Jahr 1971 und dem brennenden Leipzig von 1943 lagen Welten. Manche hätten mir widersprochen und auf die Altnazis in der Regierung und in den Konzernen verwiesen, doch mir kam es vor, als wäre das hier nicht mal mehr dasselbe Land. Feuerstürme, Hungerwinter und Güterwaggons, aus denen Hände ragten, fühlten sich weiter entfernt an als Vietnam und Kambodscha.
Ich erzählte Marie noch einmal von dem Zimmer voller Bücher, davon, dass man mich im Großen und Ganzen gut behandelt hatte, durchaus fürsorglich, aber ohne jede Zuneigung oder menschliche Wärme. Da war ein Hausmädchen gewesen, dem nicht wohl zu sein schien, wenn es mir etwas brachte. Und ein großer Mann in einer Art Uniform. Er hatte mir nie etwas angetan, aber manchmal, wenn ich vor Wut über meine Einsamkeit geschrien und um mich geschlagen hatte, war er gerufen worden, um mich festzuhalten, bis ich mich wieder beruhigte. Hin und wieder hatte er mir dabei ein Schlaflied ins Ohr gesungen, was mir selbst mit sieben oder acht sehr hilflos vorgekommen war, und dann hatte er mir fast ein wenig leidgetan.
Später sagte ich mir, dass man ihn sicher gut für sein Schweigen bezahlt hatte und dass er ebenso schuldig war wie die anderen. Aber es ist schwer, gegen die eigenen Kindheitserinnerungen mit der Vernunft des Älteren zu argumentieren. Am Ende ist jede rationale Distanz nur eine Illusion, wie das Erwachsensein selbst.
»Du glaubst, es könnte die Villa der Pallandts in Leipzig gewesen sein, oder?« Marie klang mitfühlend, auf eine sachlich Art. Dafür mochte ich sie gleich noch ein bisschen mehr.
Ich trank hastig mein Glas leer. »Ihre Villa stand ganz hinten auf dem Betriebsgelände im Graphischen Viertel. Hinter den Verlagsgebäuden, den Lagerhallen und der größten Druckerei der Stadt. Sie hatte tatsächlich einen eigenen Park, und alles war hinter einer hohen Mauer versteckt. Das Haus, in dem die Werkstatt und der Laden meines Vaters waren, stand gleich neben der Mauer. Und Fakt ist, dass er und Konrad Pallandt Streit miteinander hatten.«
Sie nickte langsam. Weil sie das alles bereits in groben Zügen wusste, hatte sie mich nach München gerufen. Allein der Name Pallandt war Grund genug gewesen, sofort herzukommen. Sie hatte gut daran getan, nicht auch noch die Steinfeld-Ausgaben im Schloss zu erwähnen. Wahrscheinlich hatte sie befürchtet, dass ich sonst auf dem Weg hierher irgendeine Dummheit aushecken könnte. So hatte sie mich überrumpelt, und ich musste erst mal darüber nachdenken, wie ich weiter vorgehen wollte.
»Gut«, sagte sie, »die beiden hatten also Ärger. Kommt vor. Aber deshalb sperrt man nicht gleich ein Kind ein und füttert es jahrelang durch, gibt ihm Hunderte Bücher zu lesen und sorgt dafür, dass es seine Möhren aufisst. Ich meine, wer kleine Jungs entführt und wegsperrt, ihnen aber niemals ein Haar krümmt, der hat doch irgendwas anderes vor.«
»Jemandem wehzutun«, sagte ich. »Jemandem, den man hasst.«
»Konrad Pallandt war schon damals einer der reichsten Männer der Stadt. Glaubst du nicht, es wäre einfacher gewesen, ein paar Schläger anzuheuern und deinem Vater alle Knochen zu brechen? Oder ihn gleich umzubringen? Kindesentführung ist ein ziemlich unorthodoxes Mittel, um jemanden zu bestrafen. Zumal dein Vater seine Werkstatt offenbar bis 1943 betrieben hat, zehn Jahre nach deiner Geburt. Pallandt ist ihn also nicht losgeworden und –«
»Und mein Vater hat nicht nach mir gesucht. Ich weiß.« Ich lehnte mich mit einem Seufzer zurück und wünschte mir, wir hätten gar nicht erst davon angefangen. »Die Villa der Pallandts und die umliegenden Gebäude sind '43 ausgebrannt und kurz danach abgerissen worden. Da ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Ein Großteil des Graphischen Viertels ist einfach verschwunden. Während der Buchmesse bin ich mal durchgefahren.«
Ich veräußerte Bücher nicht nur für andere, ich kaufte auch welche an, bearbeitete obskure Suchlisten und flog dafür um die halbe Welt. Ich war fast ein Dutzend Mal in der DDR gewesen, hatte die vielen Antiquariate durchforstet und seltene Exemplare mit Devisen bezahlt. Nicht mein Geld, wohlgemerkt, sondern das von steinreichen Sammlern. Das war die eine Sache, in der ich besser war als Marie: Vergessene Bücher aufzuspüren lag mir im Blut. Ich mochte die Detektivarbeit, den Papierkram, sogar das ewige Gezerre mit den Grenzbehörden, das Herantasten, Umschmeicheln, die Bestechungen und schließlich das blitzschnelle Zuschlagen, die Rettung eines kostbaren Bandes und die Überführung in eine Bibliothek, in der man ihn zu schätzen wusste. Nach meiner Moralvorstellung durfte man Büchern um keinen Preis Schaden zufügen. Bei Menschen sah ich das situativ bedingt anders.
In Maries Blick stand der Anflug einer Ahnung. »Was hast du jetzt vor?«
»Was erwartest du denn, nachdem du mir die Bücher gezeigt hast?«
»Rücksichtnahme?«, schlug sie vor.
»Keine Sorge. Ich hab nicht vor, dich in irgendwas reinzureiten.«
»Lass mich einfach nur mein Geld verdienen. Von mir aus kannst du mit Maximilian Pallandt sprechen, aber du wirst auf keinen Fall erwähnen, dass du von den Steinfeld-Bänden in der Bibliothek weißt.«
»Okay.«
»Scheiße, Robert, du wirst mir das hoch und heilig schwören!«
»Im Ernst?«
Sie spuckte in ihre Hand und hielt sie mir entgegen.
Ich musste grinsen. »Das ist eklig.«
»Früher hattest du keine Probleme mit meinen Körperflüssigkeiten.«
Ich tat ihr den Gefallen, machte es wie sie und schüttelte ihre Hand. »Ich werde die Steinfeld-Ausgaben mit keinem Wort erwähnen. Ich schwör’s dir.«
»Hmm«, machte sie, kippte sich Weißwein über die Hand und wischte sie an der Tischdecke trocken. Sie war wirklich für so manche Überraschung gut. »Dann red mit ihm«, sagte sie. »Und ich werd mal versuchen, für dich rauszufinden, wie die Bände in die Bibliothek gelangt sind. Woher sie kommen und warum es so viele sind.«
»Du bist die Beste«, verkündete ich und bestellte neuen Wein.
Später schwankte ich betrunken zu meiner Pension in der Georgenstraße, fuhr vorsichtshalber in dem antiken Gitterlift nach oben, vergaß, mich auszuziehen, und schlief allein auf meinem Bett ein.
4
1933
Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis stapfte Jakob Steinfeld durch braunen Schneematsch zurück ins Graphische Viertel, auf dem schnellsten Weg nach Hause.
Um ihn erhob sich ein Wald aus geisterhaften Schloten und gespenstischen Backsteinkolossen, umhangen von ewigem Nebel. Der Qualm der dampfbetriebenen Druckmaschinen war so rußig, dass einem an manchen Tagen der Kohlenstaub in schwarzen Tränen aus den Augen rann.
Es war der 28. Februar, der Morgen nach dem Brandanschlag auf den Reichstag. Die Welt war eine andere geworden, seit man Jakob vor drei Monaten weggesperrt hatte. Ende Januar waren die Nationalsozialisten an die Macht gekommen, weil sie den senilen Hindenburg übers Ohr gehauen hatten, und seit gestern hatte der neue Reichskanzler Hitler einen Grund, die Menschenjagd auf Kommunisten zur offiziellen Staatsangelegenheit zu erklären.
Jakob war kein Kommunist, aber er hatte im vergangenen November einen Uniformierten geschlagen, und das hatte auch unter der alten Regierung für eine Verurteilung gereicht. Eigentlich lief seine Haft erst in einer Woche aus, doch die Nationalsozialisten brauchten jede freie Zelle für ihre politischen Gegner. Erst hatten sie ihre eigenen Leute aus den Gefängnissen geholt, dann, um Platz zu schaffen, die Kleinkriminellen und Ganoven. Bei seiner Verhandlung vor dem Schnellgericht hatte Jakob zum ersten Mal vor einem Richter gestanden, und er brannte nicht darauf, diese Erfahrung zu wiederholen. Trotzdem bedauerte er nicht, dass er dem Schutzmann Hartung die Nase gebrochen hatte. Der Dreckskerl hatte Schlimmeres verdient.
Der Nebel schien dichter zu werden, je tiefer Jakob ins Graphische Viertel vordrang. Die Straßenlaternen brannten, obwohl es nicht einmal Mittag war. Um alle lagen hellgraue Kugeln aus Licht, wabernd wie Luftblasen. Es war, als sei die Sonne heute gar nicht erst aufgegangen, und wenn doch, so beschien sie vielleicht die Villen der Verleger und reichen Buchhändler im Musikviertel, aber nicht die düsteren Ziegelblocks und Innenhöfe der Buchfabriken, denen sie ihren Wohlstand verdankten.
Über Toren und Fenstern waren Skulpturen und Reliefs eingelassen wie in die Fassaden gotischer Kathedralen: Greife und Götter, Adler, Eulen und geflügelte Pferde. Von überallher erklang das Lärmen der Maschinen, das der Nebel zu einem diffusen Brummen dämpfte. Es schien aus den aufgerissenen Schlünden der Fabelwesen zu dringen, die von den Friesen und Portalen auf Jakob herabsahen.
In manchen Fassaden waren noch immer Einschusslöcher zu sehen, Mahnmale der Straßenschlachten von 1920. Damals waren die Rechten bei dem Versuch gescheitert, sich mit Gewalt an die Macht zu putschen. Heute, dreizehn Jahre später, hatten sie ihr Ziel ganz legal erreicht und ließen triumphierend ihre Kampfverbände in Fackelzügen durchs Brandenburger Tor marschieren, um dem neuen Reichskanzler auf seinem Balkon zu huldigen.
Jakob bog von der breiten Dresdner Straße mit ihren Automobilen und Fuhrwerken in die Blumengasse. Am Werktor des Pallandt’schen Betriebsgeländes musste er warten, bis eine Flotte Lastwagen voller Bücher den Bürgersteig überquert hatte und auf dem Pflaster davonrumpelte. Als er im Vorbeigehen den Mann im Pförtnerhaus grüßte, senkte der hastig den Blick. Gut hundert Meter lief Jakob an der Backsteinfassade entlang, ehe sich im Nebel ihr Ende abzeichnete. Gleich dahinter, nur durch einen schmalen Einschnitt vom Bücherlager der Pallandts getrennt, lag die ehemalige Kapelle, in der sich sein Geschäft befand.
Montecristo stand in gemeißelten Lettern auf einer Steintafel über dem Eingang. Der kleine Buchladen mit dem dicht bestückten Schaufenster war spezialisiert auf Abenteuerliteratur im Stile Dumas', auf Geheimbund- und Logenromane und auf romantische Dichtung. Die Buchbinderwerkstatt befand sich im Hinterzimmer. Hier schuf Jakob neue Einbände für alte Bücher, vor allem für jene, die er im Laden verkaufte. Aufträge nahm er nur gelegentlich an, meist dann, wenn die Kasse zu leer war, um wählerisch zu sein, oder wenn ihn ein Band ganz besonders reizte.
Gelbliches Licht schien aus dem Fenster hinaus in den Nebel. Jakob hielt inne und betrachtete den Kapellengiebel, der wie ein Schiffsbug über ihm aus dem Dunst aufgetaucht war. In einer gemauerten Nische hatte dort früher eine Muttergottes gestanden, aber schon sein Großvater hatte sie ersetzt durch Sandsteinfiguren von Merkur und Minerva. Der Gott des Handels hielt seinen Caduceus, die Göttin der schönen Künste eine Weltkugel als Insigne ihrer Herrschaft.
Durchs Fenster sah Jakob jemanden zwischen den vollen Bücherregalen. Ein Lächeln lag auf seinen Zügen, als er die Klinke herabdrückte und seinen Laden betrat.
»Augenblick«, rief eine tiefe Stimme, »bin gleich bei Ihnen.« Angestrengtes Schnaufen ließ darauf schließen, dass dort hinten gerade eine große Menge Bücher getragen wurde.
Jakob schloss die Tür und sog den Duft ein. Erst jetzt, als der Gestank der Kohlefeuer draußen blieb und der vertraute Geruch von Papier und Buchbinderleim um ihn war, fühlte er sich ganz und gar zu Hause. Aus dem warmen Lichtschein im Inneren des Montecristo blickte er zurück nach draußen, wo die Welt am Bordstein endete; jenseits davon stand die wogende Nebelwand. Innerhalb weniger Augenblicke wurde das Gefängnis zu einer fernen Erinnerung.
»Einen Moment noch! Ich muss erst den Stapel absetzen, sonst gibt das ein Malheur.«
»Lass dir Zeit«, sagte Jakob mit breitem Grinsen.
Kurz herrschte Schweigen im hinteren Teil des Ladens, sogar das Keuchen brach ab. Dann polterte etwas zu Boden, schwere Schritte ertönten und ein rotes Gesicht tauchte wie ein Blutmond hinter einer Regalwand auf.
»Jakob? … Meine Güte, Kleiner!«
Der Mann war gebaut wie ein Troll, nicht größer als Jakob, aber mit doppelt so breiten Schultern und muskulösen Armen, die fast bis zum Boden reichten. Seine kurzen, stämmigen Beine bildeten ein makelloses O, und auf seinem Kopf wucherte das Haar so zügellos wie auf einer Mütze aus Rentierfell.
»Grigori!«
Gleich darauf lagen sich die beiden in den Armen, Jakob Steinfeld und Grigori Gomorov, beste Freunde und verschworene Blutsbrüder, Kapitän und Steuermann ihres steinernen Kahns im Nebelmeer des Graphischen Viertels.
»Du stinkst«, sagte Grigori.
»Und du riechst nach Rosenblüten«, entgegnete Jakob. »Ist das immer noch dieses Duftwasser aus Ungarn?«
»Stets bereit für den großen Augenblick, wenn meine Schöne aus den Himmeln herabsteigt und mich endlich in die Arme schließt.«
Grigori hatte sich vor Jahren die deutsche Sprache zu eigen gemacht, indem er ausschließlich alte Abenteuerbücher verschlungen hatte. Eines Tages hatte er mit großen Augen im Montecristo gestanden, staunend vor den neu gebundenen Erstausgaben, die viel zu teuer für ihn gewesen waren. In gebrochenem Deutsch hatte er Jakob darauf hingewiesen, dass der Merkur über seiner Tür nicht nur der Gott der Händler, sondern auch der Gott der Diebe war, und dass es zweifellos jener wäre, den man hier verehre. Daraufhin hatte Jakob ihm – beeindruckt von der Bildung des Mannes, der sich ansonsten kaum verständlich machen konnte – für Pfennigbeträge einen großen Stapel Mängelexemplare verkauft, mit loser Bindung, gebrochenen Rücken und fleckigen Seiten. Für Grigori hatte das Äußere von Büchern keine Rolle gespielt, ihm war es einzig um den Inhalt gegangen. Damals hatte er nur das Nötigste seiner Lektüre verstanden, doch Wortwahl und Duktus hatten Spuren hinterlassen. So kam es, dass ein russischer Gärtner, der gelegentlich als Buchhändler aushalf, zuweilen in die Sprachmarotten des achtzehnten Jahrhunderts verfiel, ohne sich dessen bewusst zu sein.
Seit seinen Lehrjahren in Moskau hatte Grigori als Gärtner so viele herrschaftliche Anwesen besucht, dass er den Wunsch gefasst hatte, eines Tages selbst in einem Haus voller Bücher zu leben. Nachdem Jakob und er gute Freunde geworden waren, hatte Jakob ihm seinen Wunsch erfüllt: Seit drei Jahren bewohnte Grigori die kleine Kammer neben der Werkstatt, ging den Sommer über seinen Aufgaben in den Gärten und Privatparks an der noblen Karl-Tauchnitz-Straße nach und arbeitete im Winter im Laden.
Schließlich gelang es Jakob, sich aus der Umarmung seines bärenstarken Freundes zu befreien. »Ich muss raus aus den Sachen und in die Wanne.«
Grigori strahlte übers ganze Gesicht und gestikulierte aufgeregt mit den Pranken. »Ich dachte, du kommst erst in einer Woche raus. Du liebes bisschen! Ich wollte doch am Gefängnistor stehen, sobald man dich wieder in die Welt der braven Bürger ohne Fehl und Tadel entlässt.« Er grinste von einem Segelohr zum anderen. »Ich hab sogar gelernt, mit zwei Fahrrädern gleichzeitig zu fahren, um dich mit allem angemessenen Komfort abzuholen.«
»Ernsthaft?«, fragte Jakob gerührt.
Grigori nickte. »Auf einem sitze ich, das andere führe ich mit links am Lenker. Keine Schlenker, keine Zusammenstöße. Nicht mal das schlimmste Pflaster und das tiefste Schlagloch werfen meinen treuen Drahtesel und mich aus der Bahn. Wochenlang hab ich geübt, damit vorm Gefängnistor ein eigenes Rad für dich bereitsteht und wir gemeinsam der Freiheit entgegenjagen wie Winnetou und Shatterhand auf Iltschi und Hatatitla.«
Jakob klopfte seinem Freund auf die Schulter, dann sah er sich beeindruckt im Laden um. »Du hast hier wirklich alles bestens am Laufen gehalten.«
Grigori glühte vor Stolz. Er konnte keine Bücher binden – deshalb hatte dieser Teil des Geschäfts zwangsläufig ein Vierteljahr lang brachliegen müssen –, aber er hatte den Laden weitergeführt und sogar ein paar kleine Sammlungen eingekauft. Neben der Kasse waren mehrere Büchertürme gestapelt, die dringend aufgemöbelt gehörten.
»Später musst du mir alles erzählen, was hier passiert ist«, sagte Jakob.
»Ich dir? Du bist derjenige, der drei Monate in dieser Mördergrube saß und jetzt der beste Freund von Diamantenschmugglern und Mädchenhändlern ist, gestählt vom Steineklopfen und all den ruhmreichen Aufständen, die du gewiss gegen die finsteren Kerkermeister angezettelt hast.«
»Nun«, sagte Jakob verkniffen, »so war es nicht ganz.«
»Gewiss bist du dadrinnen verstoßenen Prinzen und ehrenvollen Schurken begegnet, hast die Klinge deines Brotmessers mit der von Halunken gekreuzt und die Flagge der Freiheit auf dem Gefängnisdach gehisst. Du hast der eisernen Kugel am Fuß getrotzt und die Barrikaden der Ordnungshüter gestürmt, hast unterirdische Gänge gegraben, tückische Vergeltung geplant und einen Fesselballon aus gestreiften Hosen für die Flucht durch die Lüfte genäht.«
Jakob stieß einen Seufzer aus. »Wie sonst sollte ich auch schon eine Woche früher als geplant draußen sein?«
»Beim Barte Rasputins! Das ist er – mein Freund der Haudegen und Heißsporn, der Waghals und Eisenfresser, der Meuterer und Bilderstürmer!« Grigoris Blutdruck lief jetzt auf Hochtouren. »So kenn ich dich, mein Lieber! Genauso kenn ich dich!«