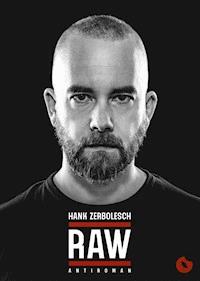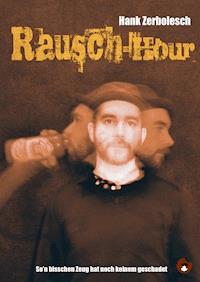Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl GmbH & Co. OHG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn man die Stille zu Hause nicht mehr aushält, geht man in Gorbach auf ein Bier ins »Kippchen«. Oder zum Büdchen um die Ecke. Hier prallen sie aufeinander, am Rand der großen Stadt: Buchhalter, Lehrer, Musikerinnen, Schlachter, Junkies, Lkw-Fahrer, Polizistinnen. Es stellt sich die Frage, ob die Menschen den Ort machen, oder der Ort die Menschen. Der irre Ele, an seine Wohnung und den Rollstuhl gefesselt, erinnert sich an seine ruhmreiche Vergangenheit als stadtbekannter Kleinkrimineller. Filiz hat einen Mitschüler krankenhausreif geprügelt, weil der ihre Mutter beleidigt hat. Eine Radiomoderatorin schließt sich im Studio ein und rechnet on air mit ihrem Chef ab. Dass es zornig und laut zugeht, ist unvermeidlich. Zerbolesch aber findet die leisen und zartfühlenden Zwischentöne, erzählt von Empathie und Hoffnung zwischen Perspektivlosigkeit und alltäglicher Gewalt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Du kriegst die Leute aus Garath, aber Garath nicht aus den Leuten.«
— Holger H.
Inhalt
Der irre Ele
Das Kippchen
Eine lange Geschichte
Udos Mutter
Der Russe
Boryana
Björn
Filiz
Der Sandmann
Key
Die Augen lügen nie
Der Mike-mann
Hoffnung
Achim Schneider
Der Junge auf dem Fahrrad
Die Frau im Radio
Drei
Feuer
Wenn ich einmal traurig bin …
Der barmherzige Samuel
Der Ansgar
Kalle
Die dicke Gugliczka
Danksagung
Impressum
DER IRRE ELE
Abgekoppelt vom Rest der Welt sitzt der irre Ele in seinem Rollstuhl, starrt aus dem Fenster und wartet. Auf den Nachbarn, den Pfleger, die Polizistin, einen wässrigen Schiss, auf irgendwas. Aber alles, was passiert, ist, dass ihm der Kopf hin und her und vor und zurück zittert. Die schnellen Bewegungen balancieren seine Gedanken aus. Die nämlich schwirren da drinnen rum, in seinem Kopf, und finden den scheiß Ausgang nicht, die kommen einfach nicht da raus. Und wenn er den Mund aufreißt, weil er denkt, dass selbst ein blindes Huhn mal ein Korn oder ein umherfliegender Gedanke mal den Ausgang finden muss, dann fängt er an zu stottern oder zu brabbeln und wird darüber so sauer, dass er kurz darauf wie ein Irrer zappelnd und zitternd und spuckend in seinem Rollstuhl auf und ab hüpft. Und auch wenn es auf der Hand läge, ist das nicht der Grund, warum man ihn den irren Ele nennt.
Oder nannte.
Die, die ihn früher einmal so genannt hatten, die hatte er nicht mehr gesehen, seit er den Camaro gegen das Kassenmodell hier eingetauscht hatte. Dieses scheiß Behindertentaxi.
Der irre Ele war ein Mythos gewesen. Wie der Marlboro Mann. Oder Michael Jackson. Über den irren Ele hatte man sich Geschichten erzählt. In den Kneipen, auf den Polizeiwachen, in den Krankenhäusern. Einige der Geschichten hatten einen wahren Kern, die meisten aber waren das Ergebnis von Langeweile und dem Drang, der Welt irgendwas mitzuteilen. Und er hatte dem nie widersprochen. Warum auch.
Einmal, da hatte er in dieser Kneipe gesessen, dem Kippchen, und die beiden Vögel am Tresen, die hatten ihm eine Geschichte erzählt. Eine Geschichte, in der der irre Ele auf der Flucht vor den Bullen vom Dach eines Kaufhauses in die Krone eines Baums gesprungen war, sich wie Johnny Weissmüller in »Tarzan, der Affenmensch« heruntergehangelt hatte – nicht, dass der irre Ele ein Affe wär, so wäre das nicht zu verstehen – und laut lachend und den beiden Bullen die Mittelfinger zeigend in den Seitenstraßen der Innenstadt verschwunden war.
»Ich bin übrigens der Micha«, hatte der eine gesagt, »und das hier ist der Udo.«
»Wie der Lindenberg«, hatte der andere gesagt. »Nur ohne Hut.«
»Und, dass du nicht in nem Hotel wohnst«, hatte der eine geantwortet.
»Ne«, hatte der andere gesagt. »Total unpersönlich, so in nem Hotel zu leben.«
»Woher willst du denn das wissen? Warst du überhaupt schon mal in nem Hotel?«
»Klar war ich das! Da war ich zur Fortbildung in Frankfurt. Weißt du doch. Als ich in diesem Restaurant war. Das von Goethes Opa.«
»Im Weidenhof.«
»Genau, im Weidenhof. Da war ich im Hotel.«
»Stimmt.«
»Total unpersönlich da.«
»Und du? Wer bist du?«, hatte der eine Ele gefragt.
»Ich bin der Andi«, hatte Ele gesagt. »Andi mit i.«
Dann hatte er sich weiter Geschichten vom irren Ele angehört. Einige kannte er, andere waren ihm neu, und eine Geschichte, die war ihm so peinlich, dass er den hinteren der beiden, Udo, dass er den fast vom Hocker geboxt hätte.
Bis zu der Sache mit dem Camaro hatte er vieles über sich gehört. Aber die Begegnung mit den beiden Vögeln im Kippchen, diese Erinnerung, die war so eine Art Wärmelampe. Wenn er die Schnauze voll hatte. So richtig voll. Wenn er an der Klippe zum Wahnsinn stand, oder saß, in seinem scheiß Rollstuhl hier, dann holte er sie raus, die Lampe, knipste sie an und genoss das rot orangene Licht. Er hatte ihr auch einen Namen gegeben, der Erinnerung. »Die Geschichte vom irren Ele«, hatte er sie getauft.
Das war der irre Ele gewesen.
Heute war er nur noch Elmar Maretczka. Der behinderte Brabbel-Affe im Rollstuhl. Der Zitter-Ele. Der Spuck-Spasti. Heute war sein Highlight die Polizistin, die ihn ab und an besuchte. Die ihn damals aus dem Camaro gezogen und wiederbelebt hatte.
Hätt sich mal mehr Mühe geben sollen, die blöde Fotze.
Hat sie aber nicht. Darum sitzt er jetzt in diesem Behindertentaxi. Sitzt und starrt und wartet darauf, dass die blonde Bullenkuh kommt, sich neben ihn setzt und sich entschuldigt. Die Frau vom Pflegedienst hat ihr sogar einen Schlüssel nachmachen lassen. Seine Haustürschlüssel. Die Alte, die es verkackt hatte, ihn wiederzubeleben, ihn richtig wiederzubeleben, die ging bei ihm ein und aus, als zahle die Miete. Und dann klingelte die immer, bevor sie die Tür aufschloss. Als könnte er ihr aufmachen. Oder »Herein« rufen. Die klingelt, schließt auf, kommt rein, sagt »Hallo Elmar«, so als wären sie beide Geschwister, oder so. Dann nimmt sie sich einen Stuhl, setzt sich neben ihn und erzählt ihm Dinge, die ihn einen Scheiß interessieren. Die Mutter hat wieder Ärger mit den Drogendealern vor ihrer Tür, die Judith wurde im Einsatz verletzt, der Ferit angeschossen, nach Feierabend, Gott sei Dank, hätte der nämlich seine Dienstwaffe dabei gehabt, der hätte keine Sekunde bla bla bla. Und dann, auf einmal, fängt die an zu heulen, entschuldigt sich schluchzend, steht auf und läuft davon. Immer! Aber wenn hier irgendwem zum Heulen wär, dann ja wohl ihm! Dem irren Ele!
Er in einem Rollstuhl. So eine Scheiße.
Er hat Hunger. Nicht auf Pudding oder Joghurt oder auf die Magensonden-Scheiße, richtig Hunger. Auf ein Steak. Mit Bratkartoffeln. Und Zwiebeln. So lange in der Pfanne geröstet, bis die Kartoffeln richtig kross sind. Nicht ganz, aber beinahe wie Pommes. Mit Salz und Pfeffer. Nicht das grobe Zeug. Das versaut dir bloß den Geschmack, wenn du plötzlich auf einen Salzkristall beißt, so groß wie ein Fünfcentstück. Salz aus dem Streuer, Pfeffer aus dem Streuer. Und dazu ein Bier. Meine Fresse. Ficken und Bier. Er würde töten für Ficken und Bier. Aber weder Ficken noch Bier noch Töten wird in seinem Leben noch mal eine Rolle spielen, das weiß er. Der Körper ist zwar behindert, aber der Kopf, der ist noch voll da.
Ficken und Bier, ey. Das wär was.
Es klingelt an der Haustür. Ein Schlüssel schiebt sich ins Schloss. Er schließt die Augen. Atmet ein und aus und denkt an …
DAS KIPPCHEN
An manchen Tagen ist es im Kippchen schlimmer als zu Hause. An diesen Tagen ist sie kaum auszuhalten, die Stille. Man kann alles hören. Sogar das Atmen. Wie Verzweiflung mit Raucherhusten klingt das.
Nichts passiert.
Wirklich gar nichts.
Atmen und Trinken und das war’s.
»Irgendwann sterben wir einfach«, sagt Udo.
»Ich weiß«, sagt Micha.
Julia sieht von ihrem Handy auf. Mit einem Akzent so kantig wie die Alpen sagt sie: »Was wisst ihr schon.« Dann verschwindet sie wieder kopfüber in ihrem Smartphone.
Ohne einmal abzusetzen, trinkt Udo sein noch frisches Glas Bier aus. Micha folgt ihm. »Julia?«, fragt Micha. »Machst uns noch zwei Bier?«
Julia legt das Handy beiseite, nimmt die beiden leeren Gläser vom Tresen, spült sie im Spülboy und stellt sie auf das Abtropfgitter. Sie nimmt zwei neue Gläser vom Rückbuffet, wischt sie mit dem rot-weiß karierten Spültuch aus, hängt sich das Tuch über die Schulter. Viel zu schnell lässt sie das Bier aus dem Zapfhahn in die Gläser laufen. Dann stellt sie die Gläser vor Udo und Micha auf den Tresen: zwei drittel Bier, ein drittel Schaum.
»Danke«, sagt Micha.
»Richtig Mühe gegeben hat die sich«, sagt Udo. Er klingt, als habe er auf nüchternen Magen acht Bier in einer halben Stunde getrunken.
Julia nimmt ihr Handy und verschwindet wieder darin.
»Scheiß drauf«, sagt Udo. »Prost.«
»Prost«, sagt Micha.
Als irgendwann später die Tür aufgeht und diese Frau im Kippchen steht, haben Udo und Micha zur selben Zeit den gleichen Gedanken: Die will hier arbeiten. Auch Julia sieht auf die Frau, sieht sie an, als wäre die Frau hier, um ihr zu sagen, dass Julias Mann jetzt ihrer wär.
»Hallo«, sagt die Frau. »Haben Sie geöffnet?«
Durch die Höflichkeit der Frau beruhigt, sieht Julia wieder auf ihr Handy.
»Is auf«, sagt Udo.
»Komm rüber«, sagt Micha. »Setz dich. Willst du was trinken?«
Die Frau kommt näher, setzt sich ans Ende des Tresens. »Ein Bier vielleicht«, sagt sie. Julia legt ihr Handy beiseite, zapft ein Bier, schlängelt ein Pilsdeckchen um den Stiel des Glases und stellt es auf einem Bierdeckel vor die Frau auf den Tresen.
»Guck mal, Udo«, sagt Micha. »Sie kriegt sogar einen Bierkragen.«
»Hat sie in ihr Herz geschlossen, die Julia«, sagt Udo. »Prost.«
»Prost.«
»Prost.«
Julias Handy macht ein Geräusch. Dann ist da wieder diese Stille.
Sie dauert beinahe zwei Bier, die Stille, bis die Frau am Ende des Tresens plötzlich zu weinen anfängt. Als sei ihr in diesem Augenblick eingefallen, dass sie nur noch dieses eine Bier zu trinken hat, bevor sie tot umfällt, wirft sie den Kopf in ihre Hände und weint so bitterlich wie ein herrenloser, hellbraun gefleckter Beagle nachts allein im finstren Wald. Julia lässt ihr Handy auf die Ablage fallen, geht rüber zur weinenden Frau und legt ihr die Hand auf die Schulter.
»Is alles in Ordnung, Mädchen?«, fragt Udo.
»Bist du blind, nicht in Ordnung«, schnauzt Julia Udo an. »Ist auch kein Mädchen, ist Frau.«
»Ja ja«, sagt Udo. »Wollt ja bloß helfen.«
Unter Julias Hand zieht das Weinen der Frau ab, zischt, gurgelt und geht über in ein Schluchzen. Die Frau hebt den Kopf. Wischt sich die Tränen aus dem Gesicht.
»Vodka?«, fragt Julia.
»Danke, nein«, sagt die Frau. »Alles okay. Wirklich. Mir geht’s gut.« Sie lächelt. Zieht die Nase hoch. »Ich hab nur manchmal … also manchmal, da muss ich …« Tränen schießen ihr aus den Augen, fließen hinab wie wildes Gewässer. Als wäre die Frau ihre Enkelin, fasst Julia ihr mit beiden Händen ins Gesicht, streichelt ihre Wangen, wischt ihr mit dem Daumen die Tränen von der Haut.
»Entschuldigung?« Michas Stimme klingt, als probiere sie mit jedem Schritt, mit jeder Silbe, ob der See schon gefroren ist oder nicht. »Können wir irgendwas für Sie tun?«
Die Frau atmet ein paar Mal tief durch. Julia nimmt ihre Hände aus dem fremden Gesicht.
»Wissen Sie«, sagt Micha, »wir sind ganz passable Zuhörer.«
»Naja«, sagt Udo
»Bekomm ich noch ein Bier, bitte?«, fragt die Frau, trinkt ihr Glas leer und stellt es vor Julia ab. Die nimmt es und geht. Die Frau holt noch einmal tief Luft. Beim Ausatmen flattern ihre Lippen. Ein Geräusch, fast wie von einem Pferd. Dann zieht ein Lächeln in ihr Gesicht. »Es ist wirklich –«
»Ist nicht in Ordnung«, sagt Julia. »Sogar Udo kann sehen.«
»Jep«, sagt Udo.
Die Frau sagt nichts mehr. Julia zapft.
»Ist kein стыд*, wenn man kann nicht mehr«, sagt Julia. »Und hilft sagen, was auf Geist liegt.«
»Auf der Seele«, sagt Micha. »Was einem auf der Seele liegt.«
Julia ignoriert ihn.
»Glauben Sie?«, fragt die Frau.
»Weiß ich«, sagt Julia. Sie stellt ein volles Glas Bier vor der Frau auf den Tresen und geht ein paar Schritte zurück.
»Okay?«, sagt die Frau, guckt abwechselnd auf ihr Bier und auf Julia. Dann sagt sie: »Ich bin Polizistin.«
»Da würd ich auch nur heulen«, sagt Udo. Julia peitscht mit dem rot-weiß karierten Spültuch in Udos Richtung. »Mund« zischt sie. Udo hebt die Hände. Aber die Frau ist verstummt. Das Bier mit den Händen umklammert sitzt sie da und starrt in ihr Glas, so wie Julia sonst in ihr Smartphone starrt.
»Schau mal«, sagt Micha und beugt sich den Tresen hinüber zur Frau. »Der Udo und ich, ne, wir haben keine Ahnung, was dich bedrückt. Ich mein wirklich, was wissen wir schon. Wir sitzen die ganze Zeit hier und zählen die Gläser in dem Spiegelschrank da hinten.«
»Ey«, sagt Udo.
»Aber das eine weiß ich«, sagt Micha. »Wir haben alle unser Päckchen zu tragen.« Er sieht zu Julia. So, als lasse er sich den Satz von ihr abnehmen. »Und manchmal hilft das ja schon, wenn man weiß, dass man nicht alleine ist. Stimmt doch Udo, oder?«
»Sicher«, sagt Udo.
»Siehst du? Jeder hat so seine Sorgen. Der eine mehr, der andre weniger, aber alle schleppen sie ihre Päckchen mit sich rum. Der Udo hier zum Beispiel, der hatte mal Familie.«
»Hör doch auf«, sagt Udo.
»Was denn? Vielleicht hilft ihr das.«
»Wie soll ihr das denn helfen?«, ruft Udo. »Und was geht die meine Familie an?«
»Was ist mit Ihrer Familie?«, fragt die Frau.
»Sind gestorben«, sagt Micha und zieht seinen Oberkörper zurück vor sein Glas Bier. »Erst die Frau, aber das ist schon was länger her, und letzte Woche Udos Mutter.« Udo sagt nichts mehr. »Schlimmer Tod war das«, sagt Micha in sein Bier hinein und dreht dabei das Glas in seiner Hand.
»Das tut mir leid«, sagt die Frau. »Mein Beileid.«
»Der redet da nicht gern drüber, der Udo«, sagt Micha. »Aber der macht weiter. Was soll man auch sonst machen, oder? Hält ja keiner an die Welt, wenn einer stirbt. Geht ja immer weiter.«
»Ja.«
»Der Micha braucht ein neues Herz«, sagt Udo. Es klingt, als sei Udo bockige acht Jahre alt. Der Micha braucht ein neues Herz.
»Was?«, fragt die Frau. »Warum?«
»Hat seines kaputt gesoffen«, sagt Udo und trinkt.
»Wirklich?«, fragt die Frau.
»Nein«, sagt Micha, »Quatsch. Das war schon immer nicht in Ordnung. In der Schule beim Sport bin ich nach einer halben Runde in der Turnhalle immer umgefallen. Die haben alle gedacht, ich würd das extra machen. Weil ich keine Lust auf Sport hab. Hatte ich auch nicht. Aber ich hab trotzdem immer mitgemacht.«
»Und bist immer umgefallen«, sagt Udo.
»Bin ich«, sagt Micha.
»Idiot«, sagt Udo.
»Und irgendwann dann«, sagt Micha, »da war ich schon über die Vierzig drüber, da war ich bei einem Arzt und der hat rausgefunden, dass mit meinem Herz was nicht in Ordnung ist. ›Das pfeift aus der letzten Lunge‹, hat der gesagt. Ein guter Witz, wenn man mal darüber nachdenkt. Das Herz, das aus der Lunge pfeift.«
»Und jetzt braucht der ein neues Herz«, sagt Udo.
»Oje«, sagt die Frau. »Das tut mir leid.«
»Tja«, sagt Micha. »Das alte macht’s nicht mehr lange, haben sie gesagt.«
»Aber der Micha kriegt kein neues Herz«, sagt Udo.
»Was?«, ruft Julia. »Warum du kriegst nicht Herz? Kriegt jeder Herz!«
»Die wachsen ja nicht auf Bäumen, die Herzen«, sagt Micha. »Die sind sehr selten. Und nur für die Guten. Für die, die nicht trinken und nicht rauchen. Die gesund essen, immer Sport machen, fleißig sind und was mit ihrem Leben anstellen.«
»Und wenn Sie mit dem Trinken aufhören?«, fragt die Frau. Micha lacht kurz auf. »Einen alten Baum verpflanzt man nicht«, sagt er.
»Was meint?«, fragt Julia.
»Das meint«, sagt Udo, »dass man zu alt ist, um sich zu ändern.«
»бред**«, sagt Julia. »Man nie zu alt zum Ändern.«
»Du bist noch jung«, sagt Udo. »Du hast keine Ahnung.«
»Nein, hast du keine Ahnung«, ruft Julia. »Musste ich auch ändern, alles! Meine ganze Familie! Meine Leben! Und sitze ich nicht und trinke?«
»Nein«, sagt Udo. »Du spielst nur mit deinem Handy rum.«
»Spiele ich nicht, schreibe ich. Mit Kindern. Sind zu Hause allein.«
»Sie haben Kinder?«, fragt die Frau.
»Zwei«, sagt Julia. »Junge und Mädchen.«
»Und wie heißen die?«
Julia zögert kurz. Dann sagt sie: »Ana und Artem.«
»Und wie alt sind die beiden«, fragt Micha.
»Zu jung für alleine Zuhause.«
»Und warum bist du dann hier?«, fragt Udo.
»Weil ist so schön hier«, zischt Julia. »Bist du blöd, warum ich hier? Bekomme ich Geld, dass ich gebe dir Bier.«
»Was ist mit Ihrer Familie passiert?«, fragt die Frau.
Vier Schlucke Bier lang sieht Julia die Frau an. Dann sagt sie: »Das ist …
* Schande
** Quatsch
EINE LANGE GESCHICHTE
Der Krieg ist im Fernsehen genau so weit weg wie in dem Augenblick, wenn dir eine Bombe die Wand aus deinem Schlafzimmer reißt.
Jahrelang schon hatten sie im Staatsfernsehen darüber gesprochen. »Einmarsch der Separatisten.« »Kriegserklärung an die Heimat.« »Wieder zwei Tote bei Explosion am Stadtrand.« Wir hatten im Wohnzimmer gestanden und die Bilder gesehen. Erst waren wir sprachlos gewesen. Dann wütend. Dann mussten die Kinder in die Schule, Bohdan ins Amt und ich in den Supermarkt.
»Mama«, rief Ana und zeigte auf den Fernseher, »Mama, was ist das?«
»Nichts.« Bohdan schaltete den Fernseher aus.
»Was war mit dem Mädchen?«, fragte Ana. »Warum hat die geweint?«
»Geh und iss dein Frühstück«, sagte ich.
»Ich bin fertig«, sagte Ana.
»Ana hat ihren Kakao nicht getrunken!«, rief Artem aus dem Esszimmer.
»Du bist so eine Petze!«, rief Ana.
»Trink deinen Kakao, Schatz«, sagte Bohdan.
»Okay«, sagte Ana und ging. Bohdan sah mich an und zuckte mit den Schultern: Tut mir leid.
Seitdem lief der Fernseher ständig. Und je mehr sie über die Kämpfe berichteten, desto weniger hörten wir zu. Wir bekamen nicht mit, wie Bomben einen Teil des Landes in Schutt und Asche legten. Wir bekamen nicht mit, wie sich die Kämpfe Meter um Meter näherten. Und als Bohdan eines Abends von der Arbeit nicht nach Hause kam, brachte ich das in keinen Zusammenhang mit den Bildern im Fernsehen. Selbst als ich meinen Mann auf dem Amt anrufen wollte und die Leitung tot war, selbst da waren das zwei völlig unterschiedliche Handlungsstränge. Im Fernsehen tobte ein Krieg, ich suchte meinen Mann.
Das letzte Mal, dass ich ohne Bohdan eingeschlafen war, war in der Nacht nach Anas Geburt gewesen. Das war jetzt wie lange her? Fünf Jahre? Auf jeden Fall lange genug, dass ich nicht gedachte hätte, ohne ihn einschlafen zu können.
Dass ich trotzdem eingeschlafen war, merkte ich erst in dem Augenblick, als ein Knall, so laut wie eine Bombe, die neben deinem Bett explodiert, die Wand meines Schlafzimmers aus dem dritten Stock unseres Hauses riss. Die Kinder schrien, ich schrie, alle schrien, und draußen, hinter dem Loch in meiner Schlafzimmerwand, da brannte die Welt.
»Mama!«, rief Ana, »Mama!«
»Papa!«, rief Artem, »Papa!«
Ich sprang aus dem Bett, rannte ins Kinderzimmer.
»Mama.« Ana weinte, Artem weinte, ein zweiter Knall ließ unser Haus erzittern. Ich balancierte mich aus wie auf einem Seil, hoch oben in der Luft. Ana schrie, Artem schrie.
»Kommt mit!«, rief ich und packte die Kinder, »Kommt!«
»Wo ist Papa?«, rief Artem.
»Komm jetzt!«, schrie ich, aber Artem blieb liegen, blieb in seinem Bett, als hätte ihn jemand in die Matratze hinein betoniert.
»Komm Artem!«, rief Ana. Sie zog ihrem Bruder die Decke weg und sah auf den Fleck zwischen seinen Beinen, sah auf ihren großen und weinenden Bruder. »Komm schon!«, rief Ana und griff nach seiner Hand, »Komm!« Ich lief in den Flur, packte unsere Jacken, mein Handy. In der Tür zum Kinderzimmer stand Ana, ihren großen und weinenden Bruder an der Hand. »Er hat Pipi gemacht«, sagte Ana.
»Ich weiß, Schatz«, sagte ich. »Das ist nicht schlimm, hörst du? Artem hat sich erschrocken.« Artem weinte. »Und jetzt ist er ein bisschen durcheinander. Kannst du ihn an der Hand halten?« Ana nickte. »Gut, mein Schatz. Okay. Pass auf.« Von irgendwo ein Knall. Leiser als der Letzte. »Du hältst jetzt deinen Bruder gut fest. Und dann gehen wir zusammen in den Keller, okay?« Ana nickte. »Gib mir deine Hand.« Ana gab mir ihre Hand. »Ich zähl jetzt bis drei, und dann rennen wir die Treppen runter in den Keller, so schnell wir nur können, okay?« Ana nickte. »Okay. Eins, zwei, drei!«
Ich riss die Haustür auf, packte Artem unter den Achseln, nahm ihn auf den Arm. Mit der anderen Hand griff ich wieder nach Ana, hielt sie fest und zusammen rannten wir die Stufen hinunter in den Keller, rannten und rannten, ohne zu stolpern, Stufe für Stufe, doch als wir vor der Kellertür ankamen, war die verschlossen.
»Die Tür ist zu«, sagte Ana.
»Ich weiß, Schatz.« Ich stellte Artem wieder ab, kramte nach meinem Schlüssel. Ana bearbeitete die Türklinke, so als müsse man die nur oft genug hinunter drücken, so als gäbe es einen Code, um sie zu öffnen: dreimal kurz, viermal lang, dreimal kurz.
»Scheiße!«, rief ich. Dann klackte es und die Tür ging nach außen hin auf.
»Kommt rein«, sagte die alte Elizaveta, »schnell schnell!« Sie schob erst die Kinder, dann mich in den Keller, dann schloss sie die Tür. Von draußen Sirenen wie bei einem Feueralarm. »Kommt mit zu den anderen.« Durch den schmalen Gang folgten wir der alten Elizaveta bis hinein in den Waschkeller. Dort, wo sonst die Wäsche an den Leinen hing, standen sie herum wie aussortierte Küchenschränke.
»Wo ist dein Mann?«, fragte Diana.
Ein Knall durchbrach die Stille meiner Antwort. Laut genug, dass alle zusammenzuckten. Ich vergrub den nach seinem Papa schreienden Artem in meinem Nachthemd. Ana drückte meine Hand. So feste, dass ich sie nicht mehr spürte. Draußen reihte sich eine Explosion an die andere, so akkurat wie Menschen in der Schlange vor einer öffentlichen Toilette, beinahe gesittet. Und manchmal zitterte das Haus heftiger als die Menschen darin.
Ich sah mich im Waschkeller um. Sah die alte Elizaveta. Sah Diana und Sophia und Natalia, sah Ulyana und Maria. »Wo sind eure Männer?«, fragte ich. Niemand antwortete.
Ich setzte mich an die Wand gegenüber der Eingangstür. Links und rechts von mir Ana und Artem. Ana legte ihren Kopf in meinen Schoß und schlief so schnell ein, als liefe im Fernsehen ihre Lieblingssendung. Artem hatte aufgehört zu weinen. Er sah aus dem kleinen fensterähnlichen Loch unter der Decke des Waschkellers hinaus in die flackernde Nacht. Irgendwann war auch er eingeschlafen. Und ich saß da, im Keller unseres Hauses, zwischen meinen Kindern und dachte daran, dass das, was da vor den Türen geschah, dass das kein Krieg war, das war ein Terroranschlag. Ein Attentat auf die westliche Welt. Krieg war bei den anderen. Bei denen ohne Handynetz.
Es war die alte Elizaveta gewesen, die gesagt hatte, dass es vorbei sei. Dass wir rausgehen sollten. Helfen. Bei der letzten Explosion war es noch dunkel gewesen, und inzwischen waren durch das Abluftfenster Stimmen zu hören.
»Warten wir noch«, sagte Diana.
»Hörst du das?«, fragte die alte Elizaveta und zeigte nach draußen. »Worauf sollen wir warten? Dass die Schreie aufhören?«
Dann wurden es weniger Schreie. Diana sah auf den Boden. Ich weckte die Kinder.
»Wo ist Papa?«, fragte Artem, noch nicht ganz wach.
»Bei der Arbeit«, sagte die alte Elizaveta. »Bei dem Krach gestern konnte doch niemand auf die Straße. Darum sind alle Männer bei der Arbeit geblieben, nicht wahr?«
»Richtig«, sagte ich, sah mich um, stand auf.
»Wir sollten zusammenbleiben«, sagte Sophia.
Ich nahm mein Handy, wählte Bohdans Nummer. Die alte Elizaveta sah mich an. Ich schüttelte den Kopf, steckte das Handy zurück in meine Jacke. »Kinder?«, sagte ich, »ich geh kurz nach oben und hol uns ein paar Sachen. Ihr bleibt so lange bei Elizaveta, okay?«
»Okay«, sagte Ana. Artem nickte, die Augen noch ganz verklebt. Die alte Elizaveta drückte die beiden Kinder an sich, als seien es ihre eigenen. »Ich bin gleich wieder da.« Ich küsste Ana und Artem. Dann ging ich aus der Waschküche. »Der Schlüssel!«, rief die alte Elizaveta. »Der Kellerschlüssel.« Sie gab ihn mir.
Die Kellertür klemmte. Ich warf mich mit aller Kraft dagegen. Einmal. Zweimal. Beim dritten Mal knirschte sie nach außen hin auf. Kleine und etwas größere Steinbrocken rutschten unter die Metalltür, kratzten Schlieren in die vor ein paar Stunden noch gebohnerten Steinfliesen. Jeder Schritt klang wie ein Kies-Mahlwerk. Ich ging hinauf ins Erdgeschoss.
Wie das verdrehte Bein eines Mannes, der ungünstig vom Dach eines zweieinhalbstöckigen Hauses gefallen war, hing die Haustür im Rahmen. In der Luft ein Geruch wie am Neujahrsmorgen. Nur intensiver. Ich stieg die Treppen weiter hinauf bis in den dritten Stock.
Unsere Wohnungstür stand auf. Ich ging hinein. Im Flur lag eine Hälfte meines Nachtschränkchens. Im Schlafzimmer fehlten die Wand, Teile des Bodens und der Teil des Bettes, in dem Bohdan gelegen hätte, wäre er zu Hause gewesen. Rauch stieg aus anderen Häusern auf. Menschen liefen umher. Einige hatten Ketten gebildet und trugen Steine, große und kleine, von Orten, an denen einmal Häuser gestanden hatten. Ich ging bis an die Abbruchkante meines Schlafzimmers. Ich sah nach links. Sah nach rechts. Sah makellose Häuser zwischen Schutt und Asche.
Das Wohnzimmer sah aus, als wären wir aus einem sehr langen Urlaub zurückgekommen: Staub auf Ordnung. Ich schaltete den Fernseher ein. Sie sprachen über einen Krieg, der sich immer weiter ausbreitete. Einen Krieg, der jetzt auch Teile des Landes erreicht hatte, die bisher verschont geblieben waren. Und gerade als der Nachrichtensprecher den Namen einer Stadt nannte, sagte mein Mann in einem ungewohnt dünnhäutigen Ton: »Wo sind die Kinder?« Wie nach dem Knall, der die Wand aus unserem Schlafzimmer gerissen hatte, drehte ich mich um und sah auf den in grauen Staub gewickelten Bohdan. Ich schrie auf, hielt mir die Hände vor den Mund. »Wo sind die Kinder?«, wiederholte er. Ich rannte auf ihn zu und seine Arme umschlangen mich und ich weinte, weinte laut und schlug auf seinen Rücken und der Staub wirbelte auf und hing da wie eine Aura. Bohdan hielt mich fest, drückte mich an sich. Seine Angst war so körperlich, man hätte ihr einen Namen geben und sie taufen können.
Ich atmete tief und gleichmäßig. Sah ihn an. »Denen geht’s gut«, sagte ich.
»Wo sind sie?«
»Im Keller. Bei der alten Elizaveta.«
»Okay«, sagte Bohdan. »Wir müssen hier weg.«
»Was? Wohin?«
»Ich weiß nicht, aber wir müssen hier weg.«
»Bohdan, wir können hier nicht weg!«
»Es wird schlimmer«, sagte er.
»Wer sagt das?«
»Die Regierung.«
»Unsere?«, fragte ich.
»Alle.«
»Dann bleiben wir im Keller.«
Bohdan packte mich an den Schultern, packte mich fest und unbarmherzig. »Die Kinder müssen hier weg«, sagte er. Ich dachte an das Schlafzimmer. Dachte an die Kinder. Dann hörte ich auf zu denken.
»Ich hab dich angerufen«, sagte ich.
»Alle Leitungen sind tot.«
»Und dein Handy?«
»Ist weg.«
Ich sah mich um. Sah die Bilder im Fernsehen. Orte, die ich kannte. So, wie ich sie noch nie gesehen hatte.
»Wo warst du?«, fragte ich.
»Im Amt«, sagte er. »Wir müssen ein paar Sachen mitnehmen. Papiere, Kreditkarten, Handys, Ladekabel, Zahnbürsten.«
»Aber –«
»Pack alles in die Rucksäcke der Kinder. Wir bleiben ohne Gepäck.«
»Warum –«
»Wir machen einen Ausflug«, sagte Bohdan.
»Okay.«
»Papa!« Artem war aufgesprungen, lief auf seinen Vater zu, der ging in die Knie und Artem fiel ihm um den Hals, beinahe schneller als Ana. Bohdan lachte und stöhnte auf unter dem Druck der Umarmungen seiner Kinder. Die alte Elizaveta wischte sich etwas aus dem Gesicht, und nur Diana sah uns an, als wäre etwas in sie gestiegen, schwarz und haarig und voller Groll.
»Wo warst du, Papa?«, fragte Ana.