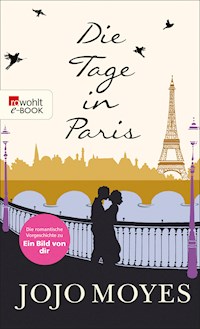12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Von der Autorin des weltweiten Nr. 1-Bestsellers «Ein ganzes halbes Jahr» ein neuer bewegender Roman über die Suche nach dem, was uns verbindet, und dem Ort, an dem wir uns zuhause fühlen. Sarah und ihr Großvater teilen die Liebe zu Pferden. Einst war Henri ein gefeierter Dressurreiter, bis das Schicksal seine Karriere beendete. Täglich trainiert er die Vierzehnjährige und ihr Pferd. Seit dem Tod von Mutter und Großmutter haben die beiden nur einander. Und als Henri einen Schlaganfall erleidet, bleibt seine Enkelin allein zurück. Natasha und ihren Mann Mac verbindet nur noch wenig. Ihre Ehe ist gescheitert, doch bis das gemeinsame Haus verkauft ist, müssen sie sich arrangieren. Für Natasha nicht leicht, denn ihre Gefühle für den Mann, der einmal die Liebe ihres Lebens war, sind alles andere als lauwarm. Als zufällig Sarah in ihr Leben tritt, nehmen die beiden das verschlossene Mädchen bei sich auf. Das Zusammenleben ist schwierig. Gibt es überhaupt etwas, was die drei miteinander verbindet? Plötzlich ist Sarah verschwunden. Und Natasha und Mac machen sich widerstrebend gemeinsam auf die Suche. Ein turbulenter Roadtrip durch England und Frankreich beginnt ... Familie, das sind die Menschen, bei denen wir uns zuhause fühlen. Auf ihre ganz eigene bewegende und gleichzeitig unterhaltsame Art schreibt Jojo Moyes über Familie: die, in die wir geboren werden, und die, die wir uns suchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 691
Ähnliche
Jojo Moyes
Im Schatten das Licht
Roman
Über dieses Buch
Sarah und ihren Großvater verbindet die Liebe zu Pferden. Einst war Henri ein gefeierter Dressurreiter, bis das Schicksal seine Karriere beendete. Täglich trainiert er die Vierzehnjährige und ihr Pferd. Seit dem Tod von Mutter und Großmutter haben die beiden nur einander. Und als Henri einen Schlaganfall erleidet, bleibt seine Enkelin allein zurück.
Natasha und ihren Mann Mac verbindet nur noch wenig. Ihre Ehe ist gescheitert, doch bis das gemeinsame Haus verkauft ist, müssen sie sich arrangieren. Für Natasha nicht leicht, denn ihre Gefühle für den Mann, der einmal die Liebe ihres Lebens war, sind alles andere als lauwarm.
Als zufällig Sarah in ihr Leben tritt, nehmen die beiden das verschlossene Mädchen bei sich auf. Das Zusammenleben ist schwierig. Gibt es überhaupt etwas, was die drei miteinander verbindet? Plötzlich ist Sarah verschwunden. Und Natasha und Mac machen sich widerstrebend gemeinsam auf die Suche. Ein turbulenter Roadtrip durch England und Frankreich beginnt …
Vita
Jojo Moyes, geboren 1969, hat Journalistik studiert und für die «Sunday Morning Post» in Hongkong und den «Independent» in London gearbeitet. Der Roman «Ein ganzes halbes Jahr» machte sie international zur Bestsellerautorin. Zahlreiche weitere Nr.-1-Romane folgten, zuletzt «Über uns der Himmel, unter uns das Meer». Jojo Moyes lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern auf dem Land in Essex.
Silke Jellinghaus, geboren 1975, ist Übersetzerin, Autorin und Lektorin und lebt in Hamburg. Unter anderem hat sie Jojo Moyes und Olivia Manning übersetzt.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel «The Horse Dancer» bei Hodder & Stoughton / An Hachette Livre UK Company, London.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«The Horse Dancer» Copyright © 2009 by Jojo Moyes
Redaktion Anne Tente
Covergestaltung SO YEAH DESIGN, Gabi Braun
Coverabbildung Silke Schmidt
ISBN 978-3-644-49821-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vorbemerkung der Autorin
Ich liebe Pferde, seit ich ein kleines Mädchen war, das in der Großstadt aufwuchs. Ich war so besessen von ihnen, dass ich meine Mutter überredete, mir mein Zimmer zum Geburtstag mit Heu zu füllen (man muss ihr zugutehalten: Sie hat es gemacht). Ich war vierzehn, als ich mein erstes Pferd kaufte, ohne meinen Eltern davon zu erzählen – bezahlt habe ich es mit dem Lohn aus einer Reihe von Putzjobs. Das Pferd brachte ich auf einem winzigen Hof in der City unter. Er lag in einem Viertel, in dem es viele solcher versteckter Stallhöfe gab, betrieben von wortkargen Männern. Ich dachte nie wirklich darüber nach, bis ich auf einer Reise in die USA einen Artikel über die Philadelphia Black Cowboys las, die in Problembezirken aktiv sind und dabei helfen, Stadtkindern eine Aufgabe zu geben. Ich las die Geschichte einer begabten jungen Reiterin, die ihrer Vergangenheit auf dem Rücken der Pferde hätte entkommen sollen, von ihr jedoch eingeholt wurde. Ihre Geschichte brachte mich dazu, über meine eigene städtische Reitvergangenheit nachzudenken.
«Im Schatten das Licht» ist das Resultat. Das Buch handelt von Flucht und Hoffnung und Liebe und komplizierten zwischenmenschlichen Beziehungen.
Inzwischen lebe ich mit meinen eigenen Pferden auf neun Hektar Land. Von ihnen ist keines so talentiert wie Boo, das Pferd aus meiner Geschichte – die meisten von ihnen sind offen undankbar für ihr idyllisches Leben. Ich aber werde immer dankbar für das sein, was die Jahre des Reitens in der Stadt mir gegeben haben: Widerstandsfähigkeit, Freude, Liebe und die Möglichkeit zu fliehen.
Ich hoffe, euch gefällt die Geschichte.
Jojo Moyes
Für C, S, H und L
Und für Mecca Harris
Zeige mir dein Pferd,
und ich sage dir, wer du bist.
Altes englisches Sprichwort
Prolog
Er sah ihr gelbes Kleid, bevor er sie sah, glühend im Abendlicht, ein Leuchtfeuer am anderen Ende der Stallungen. Er hielt einen Moment inne, unsicher, ob er seinen Augen trauen konnte. Dann streckte sie ihren blassen Arm aus, Gerontius’ eleganter Kopf erschien über der Tür, um die Leckerei zu nehmen, die sie ihm hinhielt, und schon war er unterwegs, rannte beinahe, die Metallspitzen seiner Stiefel klapperten auf den nassen Pflastersteinen.
«Du bist da!»
«Henri!»
Sie drehte sich um, und seine Arme umschlangen sie; er küsste sie, neigte den Kopf, um den himmlischen Duft ihres Haars einzuatmen.
«Wir sind heute Nachmittag angekommen», sagte sie an seiner Schulter. «Ich hatte kaum Zeit, mich umzuziehen. Ich sehe bestimmt furchtbar aus … aber ich saß im Publikum und habe dich durch den Vorhang hindurch gesehen. Da musste ich einfach kommen und dir Glück wünschen.»
Ihre Sätze waren gestammelt, aber er nahm ohnehin kaum etwas wahr, so sehr wühlte ihn ihre schiere Anwesenheit auf, das Gefühl, sie nach so langer Zeit wieder in den Armen zu halten.
«Sieh dich nur an!» Sie trat einen Schritt zurück, und ihr Blick glitt von seinem schwarzen Zweispitz hinab über seine makellose Uniform, dann streckte sie die Hand aus, um einen eingebildeten Fleck von einer seiner goldenen Epauletten zu wischen. Dankbar bemerkte er, wie widerwillig sie ihre Finger zurückzog. Da war keine Beklommenheit, staunte er, trotz all der Monate, die sie sich nicht gesehen hatten. Keine Koketterie. Sie war vollkommen unbefangen – das Mädchen aus seiner Vorstellung war wieder Fleisch und Blut geworden.
«Du siehst großartig aus», sagte sie.
«Ich … kann nicht bei dir bleiben», sagte er. «Wir reiten in zehn Minuten.»
«Ich weiß. Le Carrousel ist so aufregend. Wir haben die Motorradfahrer gesehen und die Panzer-Parade», sagte sie. «Aber ihr, Henri, ihr und die Pferde seid eindeutig die Hauptattraktion.» Sie warf einen Blick in die Arena hinter sich. «Ich glaube, ganz Frankreich ist hier, um euch zu sehen.»
«Hast du … hast du les billets?»
Ratlos sah sie ihn an. Obwohl sie sich beide bemühten, war die Sprache immer noch eine Barriere.
«Billets …» Er ärgerte sich über sich selbst. «Die Karten. Die Eintrittskarten. Die besten Karten.»
Sie strahlte ihn an, und seine Unzufriedenheit löste sich in Luft auf.
«Oh, ja. Edith, ihre Mutter und ich sitzen in der ersten Reihe. Sie können es nicht erwarten, dich reiten zu sehen. Ich habe ihnen alles über dich erzählt. Wir wohnen im Château de Verrières.» Sie senkte ihre Stimme zu einem Flüstern, obwohl niemand in der Nähe war. «Es ist ziemlich nobel. Die Wilkinsons haben entsetzlich viel Geld. Viel mehr als wir. Es ist wirklich nett von ihnen, dass sie mich mitgenommen haben.»
Er ließ sie nicht aus den Augen, während sie sprach – abgelenkt von der sinnlichen Kurve ihrer Oberlippe. Sie war hier. Seine Hände in den weißen Glacéhandschuhen umfingen ihr Gesicht. «Florence», murmelte er und küsste sie erneut. Ihre Haut verströmte den Geruch der Sonne, obwohl die Abenddämmerung längst angebrochen war. Es war berauschend, als wäre sie nur erschaffen worden, um Wärme auszustrahlen. «Jeden Tag vermisse ich dich. Vor dir gab es für mich nur den Cadre Noir. Jetzt … ist ohne dich nichts gut genug.»
«Henri …» Sie streichelte seine Wange, lehnte ihren Körper an seinen. Ihm war beinahe schwindelig.
«Lachapelle!»
Henri fuhr herum. Didier Picart stand am Kopf seines Pferdes, hinter ihm zurrte ein Stallbursche den Sattelgurt fest. Picart zog sich die Handschuhe über. «Wenn du dich aufs Reiten genauso konzentrierst wie auf deine englische Hure, erreichen wir vielleicht was.»
Florence konnte nicht genug Französisch, um ihn zu verstehen, aber sie erfasste den Ausdruck, der über Picarts Gesicht huschte. Henri sah, dass sie erriet, wie wenig schmeichelhaft dessen Worte gewesen waren.
Die altbekannte Wut stieg in ihm auf, und er biss die Zähne zusammen. Er sah Florence an und schüttelte den Kopf in dem Versuch, ihr zu vermitteln, wie dumm, wie unbedeutend Picart war. Seit der Reise nach England, auf der Henri sie kennengelernt hatte, war Picart so verletzend, so provokant gewesen. Englische Mädchen hätten keine Klasse, hatte Picart in der Messe herumposaunt. Henri wusste, dass er damit ihn treffen wollte. Englische Mädchen wüssten nicht, wie man sich anzieht. Sie fräßen wie Schweine aus einem Trog. Sie würden für ein paar Francs oder ein Pint von diesem widerlichen Bier mit jedem ins Bett gehen.
Es hatte Wochen gedauert, bis Henri dämmerte, dass Picarts Gehässigkeit wenig mit Florence zu tun hatte, sondern allein dem Zorn darüber entsprang, im Cadre Noir vom Sockel gestoßen worden zu sein – und das von dem Sohn eines Bauern. Aber auch diese Erkenntnis machte es für Henri nicht einfacher, sich das Gerede anzuhören.
Picarts Stimme hallte über den Hof. «Mir ist zu Ohren gekommen, dass es in der Nähe vom Quai Lucien Gautier Zimmer zu mieten gibt. Ein wenig passender als ein Stallhof, n’est-ce pas?»
Henris Hand krampfte sich um die von Florence. Er bemühte sich darum, mit ruhiger Stimme zu sprechen. «Und wenn du der letzte Mann auf der Welt wärst, wäre sie noch zu gut für dich, Picart.» Henri machte Anstalten, einen Schritt auf ihn zuzugehen, aber Florence hielt ihn auf.
«Liebling, hör mal, ich gehe besser auf meinen Platz», sagte sie und löste sich von ihm. «Du musst dich vorbereiten.» Sie zögerte, dann reckte sie sich, zog mit ihrer schlanken weißen Hand seinen Nacken zu sich herunter und küsste ihn noch einmal. Er begriff, was sie beabsichtigte: Sie wollte ihn von Picarts Gift ablenken. Und es gelang ihr. Es war unmöglich, irgendetwas anderes als pures Glück zu empfinden, wenn Florences Lippen seine berührten. Sie lächelte. «Bonne chance, mon écuyer.»
«Mon écuyer!», wiederholte er, berührt davon, dass sie in seiner Abwesenheit das korrekte Wort für «Rittmeister» gelernt hatte.
«Ich lerne!» Sie warf ihm eine Kusshand zu, ihre Augen füllten sich mit Schalk, mit einem Versprechen, und dann war es fort, sein englisches Mädchen.
Das jährliche Militärfest Le Carrousel markierte für die jungen Kavallerie-Offiziere von Saumur den Abschluss des Trainingsjahres. Wie üblich bevölkerten auch an diesem Juliwochenende viele Besucher die mittelalterliche Stadt. Sie wollten nicht nur den Auszug der jungen Kavalleristen sehen, sondern auch die traditionelle Zurschaustellung der Künste der Kavallerie, die Akrobatik auf Motorrädern und die Parade der Militärfahrzeuge, deren Karosserien noch von den Narben des Krieges gezeichnet waren.
Es war das Jahr 1960. Die alte Garde wankte unter dem Ansturm der Pop-Kultur, Johnny Hallydays und einer neuen Mentalität, aber in Saumur herrschte wenig Lust auf Veränderung. Die jährliche Vorführung der zweiundzwanzig französischen Elitereiter, die zusammen den Cadre Noir bildeten, einige aus den Rängen des Militärs, einige Zivilisten, war der Höhepunkt des Wochenendes von Le Carrousel und garantierte immer, dass die Karten innerhalb von Tagen ausverkauft waren: an die Bürger von Saumur, an diejenigen, die das Erbe Frankreichs hochhielten, aber auch schlicht an alle, die von den in der gesamten Loire-Region aufgehängten Plakaten angelockt wurden, die versprachen: «Majestäten, alte Geheimnisse und Pferde, die die Schwerkraft besiegen».
Le Cadre Noir war beinahe zweihundertfünfzig Jahre zuvor ins Leben gerufen worden, nach der Dezimierung der französischen Kavallerie in den napoleonischen Kriegen. Um wiederzubeleben, was einmal eine stolze Reiternation gewesen war, wurde in Saumur eine Reitschule gegründet. Dressurreiten hatte in der Stadt eine lange Tradition, schon im 16. Jahrhundert hatte es hier eine Reitakademie gegeben. Man versammelte ein Corps von Ausbildern, maîtres écuyers genannt, aus den besten Reitschulen des Landes, um die hohe Kunst des Reitens an eine neue Generation von Offizieren weiterzugeben.
Seit der Erfindung von Panzern und der maschinellen Kriegsführung wurde Le Cadre Noir gelegentlich mit Fragen nach seiner Relevanz konfrontiert. Doch seit Jahrzehnten sah sich keine Regierung in der Lage, etwas abzuschaffen, das längst als Teil des kulturellen Erbes Frankreichs galt: Die Reiter in ihren schwarzen Uniformen waren Ikonen, und Frankreich mit seiner Académie Française und Haute Cuisine und Haute Couture hatte Sinn für den Wert von Tradition. Die Reiter selbst erweiterten ihr Wirkungsfeld, vielleicht weil sie begriffen, dass sie ihr Überleben sichern konnten, indem sie sich eine neue Rolle suchten: Zusätzlich zur Ausbildung der Kavalleristen öffnete die Schule ihre Türen und präsentierte ihre hohe Reitkunst und ihre prächtigen Pferde in öffentlichen Vorführungen in ganz Frankreich und im Ausland.
Diesem Cadre Noir nun gehörte Henri Lachapelle an. Die Vorstellung an diesem Abend in der eigenen Arena war die wichtigste des Jahres und eine Chance, die hart erarbeiteten Fertigkeiten den Freunden und der Familie vorzuführen.
Es lagen die Gerüche von Karamell, Wein und Feuerwerk sowie die Hitze Tausender Körper in der Luft. Die Volksfeststimmung wurde von der Julihitze noch verstärkt, Kinder rannten mit Luftballons oder Zuckerwatte herum, ihre Eltern verschwanden in den Menschentrauben, die sich um die Stände drängten, an denen Wein ausgeschenkt wurde. Gleichzeitig drang aufgeregtes Stimmengebrumm von denen herüber, die schon ihre Plätze um die Grand Manège herum eingenommen hatten.
«Attendez!»
Als Henri den Ruf hörte, überprüfte er Sattel und Zaumzeug und fragte den dresseur zum fünfzehnten Mal, ob seine Uniform korrekt saß. Dann strich er Gerontius über die Nüstern, bewunderte die winzigen Zöpfe am glänzenden Hals des Pferdes, in die der Stallknecht Bänder geflochten hatte, und murmelte Lobesworte und Ermutigungen in Gerontius’ Ohr. Das Pferd war siebzehn und somit ein älterer Herr nach den Maßstäben der Akademie. Bald würde er in den Ruhestand geschickt werden. Er war Henris Pferd, seit dieser vor drei Jahren dem Cadre Noir beigetreten war, und sofort hatten sie eine enge Verbindung zueinander gespürt. Hier auf dem Gelände der alten Reitschule war es nichts Ungewöhnliches, wenn junge Männer ihre Pferde auf die Nasen küssten und Liebkosungen murmelten, die sie einer Frau gegenüber aus Verlegenheit nie über die Lippen bringen würden.
«Vous êtes prêts?» Le Grand Dieu, der leitende Rittmeister, kam mit langen Schritten über den Vorbereitungsplatz. Er stellte sich vor den jungen Reitern und ihren unruhigen Pferden auf. «Der Tag heute ist, wie Sie wissen, der Höhepunkt unseres Jahres. Diese Zeremonie ist über einhundertdreißig Jahre alt, die Tradition unserer Schule noch viel älter. Sie geht zurück auf Xenophon und das Zeitalter der Griechen. Vieles scheint heutzutage getrieben vom Bedürfnis nach Veränderung, davon, alte Lebensweisen über Bord zu werfen. Im Cadre Noir glauben wir noch daran, dass es einen Platz für eine Elite gibt, für das Streben nach Exzellenz. Heute Abend sind Sie unsere Botschafter. Sie müssen zeigen, dass echte Anmut und wirkliche Schönheit nur das Ergebnis von Disziplin, Ausdauer und Verzicht sein kann.»
Er blickte sich um. «Unsere Kunst ist dergestalt, dass sie in dem Moment schon vergeht, in dem sie entsteht. Lassen Sie uns den Menschen von Saumur das Gefühl vermitteln, welch Privileg es ist, diesem Moment beiwohnen zu dürfen.»
Die Männer murmelten ihre Zustimmung und stiegen auf ihre Pferde, einige fummelten noch an ihren Hüten herum oder wischten sich nicht existenten Staub von den Stiefeln – kleine Gesten, um das aufkommende Lampenfieber zu vertreiben.
«Sind Sie bereit, Lachapelle? Nicht zu nervös?»
«Nein.» Henri stand stramm, spürte den Blick des Rittmeisters über seine Uniform gleiten. Ihm war bewusst, dass der Schweiß, der ihm von den Schläfen in den gestärkten Kragen tropfte, seine Worte Lügen strafte.
«Es ist keine Schande, wenn man bei seinem ersten Carrousel das Adrenalin spürt», sagte Le Grand Dieu und tätschelte Gerontius’ Hals. «Dieser alte Knabe wird Ihnen helfen. Sie führen also die Capriole beim Auftritt des zweiten Teams aus. Dann vollführen Sie mit Phantasme La Croupade. D’accord?»
«Jawohl.»
Er wusste, dass die maîtres écuyers geteilter Meinung darüber gewesen waren, ob man ihm eine solch exponierte Rolle zuteilen sollte angesichts der letzten Monate, der dauernden Auseinandersetzungen, seines angeblich katastrophalen Mangels an Disziplin. Er hatte sogar gehört, dass ihn sein rebellisches Verhalten beinahe seinen Platz im Cadre Noir gekostet hätte.
Er hatte nicht den Versuch unternommen, sich zu verteidigen. Wie konnte er ihnen die grundlegende Veränderung erklären, die in ihm stattgefunden hatte? Wie konnte er ihnen sagen, dass ihre Stimme, ihre Liebenswürdigkeit, ihre Brüste, ihr Duft und ihr Haar für einen Mann, der zuvor nie ein freundliches Wort oder eine liebevolle Berührung gekannt hatte, nicht einfach eine Zerstreuung bedeuteten, sondern zu einer Obsession geworden waren, die um vieles mächtiger war als eine intellektuelle Abhandlung oder die Finessen der Reitkunst?
Henri Lachapelle hatte seine Kindheit in einer chaotischen, lieblosen Welt verbracht, die von seinem Vater beherrscht wurde. In ihr galt schon eine Flasche Wein für zwei Francs als vornehm, und jeder Versuch, etwas zu lernen, war belächelt worden. Zur Kavallerie zu gehen war Henris Rettung gewesen, und sein schneller Aufstieg durch die Ränge bis hin zur Empfehlung für einen der begehrten Plätze im Cadre Noir schien ihm der Gipfel dessen zu sein, was ein Mann im Leben erreichen konnte. Mit fünfundzwanzig fühlte er sich zum ersten Mal angekommen.
Er war außerordentlich begabt. Die Jahre auf dem Bauernhof hatten ihn gelehrt, hart zu arbeiten. Er besaß besonderes Geschick im Umgang mit schwierigen Pferden. Hinter vorgehaltener Hand flüsterten einige, Henri Lachapelle würde es sicher eines Tages bis zum maître écuyer bringen – vielleicht gar zum Grand Dieu.
Henri war sich sicher gewesen, dass die Präzision, die Disziplin, die schiere Freude am Lernen sein einziger Lebensinhalt sein würden.
Und dann hatte Florence Jacobs aus Clerkenwell, die sich noch nicht einmal sonderlich für Pferde interessierte, sondern bloß eine Freikarte für die Vorführung der französischen Reitschule in England ergattert hatte, alles zerstört: seinen Seelenfrieden, seine Entschlossenheit, seine Geduld. Später, mit mehr Lebenserfahrung, hätte er seinem jüngeren Ich vermutlich sagen können, dass solch eine Leidenschaft bei der ersten Liebe zu erwarten war, dass diese alles in Frage stellenden Gefühle mit der Zeit nachlassen und vielleicht sogar verschwinden würden. Aber Henri, ein Einzelgänger ohne Freunde, die solch weisen Rat hätten erteilen können, wusste nur eins: Seitdem er das dunkelhaarige Mädchen mit den staunenden Augen drei Abende in Folge im Publikum gesehen hatte, konnte er nur noch an sie denken. Er hatte sich ihr nach der Aufführung vorgestellt, ohne genau zu wissen, was er damit bezweckte. Seitdem fühlte sich jede Minute ohne sie an wie ein Ärgernis oder, schlimmer, ein bodenloser, sinnloser Abgrund. Und was bedeutete das für alles andere in seinem Leben?
Seine Konzentration schwand beinahe über Nacht. Wieder zurück in Frankreich, begann er, die Doktrin zu hinterfragen, sich über kleine Details aufzuregen, die er irrelevant fand. Er warf Devaux, einem der dienstältesten maîtres écuyers, vor, «in der Vergangenheit stecken geblieben» zu sein. Erst als er zum dritten Training in Folge nicht erschienen war und sein Stallbursche ihn warnte, dass man ihn entlassen könnte, wurde ihm bewusst, dass er sich zusammenreißen musste. Er las Xenophon, vertiefte sich in seine Arbeit. Er hielt sich aus Streitigkeiten heraus. Florences immer häufigere Briefe, ihr Versprechen, dass sie ihn diesen Sommer besuchen käme, machten ihm Mut. Und ein paar Monate später hatte man ihm, vielleicht zur Belohnung, die Hauptrolle in Le Carrousel gegeben: La Croupade, eine der schwierigsten Lektionen der Hohen Schule, die ein Reiter ausführen konnte. Damit hatte er Picart verdrängt.
Le Grand Dieu stieg auf sein Pferd, einen robusten portugiesischen Hengst. «Enttäuschen Sie mich nicht, Lachapelle. Betrachten wir diesen Abend als Neuanfang.»
Henri nickte nur, da eine neue Aufwallung von Lampenfieber ihm den Atem raubte. Er stieg auf, ergriff die Zügel, überprüfte, ob der schwarze Hut gerade auf seinem geschorenen Kopf saß. Er konnte das Murmeln der Menge hören, das erwartungsvolle Psst, als das Orchester probeweise ein paar Töne spielte, die aufgeladene Stille, die nur entsteht, wenn tausend Menschen aufmerksam Ausschau halten. Vage nahm er ein geflüstertes «viel Glück» wahr, dann lenkte er Gerontius an seinen Platz, in die Mitte der exakt ausgerichteten Reihe glänzender Pferde. Dann wurde der schwere rote Vorhang zurückgezogen, und sie standen im Flutlicht der Arena.
Trotz des ruhigen, geordneten Auftretens der zweiundzwanzig Reiter war das Leben im Cadre Noir körperlich wie mental eine Herausforderung. Tag für Tag war Henri Lachapelle erschöpft gewesen, hatte beinahe geweint vor Frust über die ständigen Korrekturen durch die maîtres écuyers, seine anscheinende Unfähigkeit, die riesigen, nervösen Pferde den Ansprüchen seiner Lehrmeister gemäß die «Schulen über der Erde» vollführen zu lassen. Auch wenn er es nicht beweisen konnte, hatte er ihre Vorbehalte gegenüber denjenigen gespürt, die wie er über das Militär zur Eliteschule gekommen waren. Seine zivilen Kollegen dagegen entstammten alle der französischen Oberschicht, hatten zuvor Turniere bestritten und ausreichend Zeit und Ressourcen gehabt, um ihre Fähigkeiten auf edlen Rössern zu verfeinern. Theoretisch waren alle im Cadre Noir gleich. Doch Henri war bewusst, dass sich dieses Gleichheitsprinzip nur bis zu den Uniformen erstreckte.
Langsam und hartnäckig hatte sich der Bauernsohn aus Toulon durch steten Einsatz von sechs Uhr morgens bis in die späten Abendstunden hinein den Ruf aufgebaut, ein harter Arbeiter zu sein und ein Händchen für die schwierigsten Pferde zu haben. Henri Lachapelle, stellten die maîtres écuyers unter ihren schwarzen Hüten fest, hatte einen «ruhigen Sitz». Er war sympathique. Deshalb hatte man ihm zusätzlich zu seinem geliebten Gerontius die Verantwortung für Phantasme übertragen, den explosiven eisengrauen jungen Wallach, der nur den allerkleinsten Vorwand brauchte, um sich katastrophal danebenzubenehmen. Henri hatte sich die ganze Woche den Kopf darüber zerbrochen, ob es richtig war, Phantasme heute eine solch prominente Rolle zu übertragen. Doch als er jetzt die Augen der Menge auf sich spürte, die schönen Harmonien der Streicher in den Ohren, Gerontius’ gleichmäßige Bewegungen unter sich, fühlte er sich plötzlich tatsächlich, einem Ausspruch Xenophons folgend, wie ein «Mann mit Flügeln». Er war sich Florences bewundernder Blicke bewusst und wusste, dass später seine Lippen ihre Haut berühren würden, und er ritt noch inniger, eleganter, gab Gerontius nur ganz leichte Hilfen, sodass das altgediente Pferd zu prahlen begann und seine gepflegten Ohren vor Vergnügen zuckten.
Hierfür bin ich gemacht, dachte er dankbar. Alles, was ich brauche, ist hier. Er sah die Fackeln auf den alten Säulen flackern, hörte das rhythmische Aufschlagen der Pferdehufe, als sich die Tiere um ihn herum in akkurate Formationen einfügten und wieder auseinanderstrebten. Er ritt in kurzem Galopp in Formation einmal um die große Arena, ging völlig im Moment auf und nahm nur das Pferd wahr, das sich unter ihm so wunderbar bewegte und seine Hufe mit solchem Schwung nach hinten warf, dass Henri am liebsten aufgelacht hätte.
«Sitz gerade, Lachapelle. Du reitest wie ein Bauer.»
Er sah Picart zu sich aufschließen.
«Warum rutschst du so im Sattel herum? Hat deine Hure dir ein Jucken verpasst?», zischte er ihm zu.
Henri wollte gerade etwas erwidern, da unterbrach der Grand Dieu mit dem Ruf: «Levade!» Und in einer geraden Linie brachten alle Reiter ihre Pferde dazu, sich auf die Hinterbeine zu erheben. Applaus brandete auf.
Als die Vorderbeine der Pferde wieder den Boden berührten, drehte Picart ab. Seine Stimme war dennoch klar verständlich: «Fickt sie auch wie eine Bäuerin?»
Henri zwang sich zur Ruhe, damit seine Wut nicht die Zügel hinabwanderte und sein sanftes Pferd ansteckte. Leise wiederholte er für sich Xenophons Satz: «Niemals ein Pferd im Zorn behandeln ist für das Pferd die beste Lehre.» Er würde Picart nicht erlauben, diesen Abend zu zerstören. «Mesdames et messieurs, in der Mitte der Arena sehen Sie nun Monsieur de Cordon, wie er mit seinem Pferd die Levade ausführt. Beachten Sie, wie das Pferd im exakten Winkel von fünfundvierzig Grad auf seinen Hinterbeinen balanciert.» Dunkel war sich Henri des schwarzen Pferdes bewusst, das sich irgendwo hinter ihm aufrichtete, dann brandete Applaus auf. Er zwang sich zur Konzentration, aber immer wieder stand ihm Florences Gesichtsausdruck vor Augen, als Picart vorhin seine Obszönitäten von sich gegeben hatte, die Furcht, die über ihre Miene gehuscht war. Was, wenn sie mehr Französisch verstand, als sie ihn wissen ließ?
«Und nun sehen Sie, wie Gerontius, eines unserer älteren Pferde, die Capriole ausführt. Es ist eine der anspruchsvollsten Bewegungen überhaupt, sowohl für das Pferd als auch für den Reiter. Das Pferd springt hoch und schlägt mit den Hinterbeinen aus, während alle vier Beine gleichzeitig in der Luft sind.»
Henri ließ Gerontius langsamer werden und ergänzte den Zug seiner Hände durch eine kurze Anweisung mit den Sporen. Er spürte, wie sich das Pferd unter ihm hin- und herzubewegen begann, es war das terre à terre, das Wiegen auf der Stelle, mit dem das Pferd unter ihm Kraft sammelte. Ich zeige es ihnen, dachte er, ich zeige es ihm.
Alles andere versank. Da waren nur noch er und das tapfere alte Pferd, seine anschwellende Kraft unter ihm. Dann stieß er den Ruf «Derrière!» aus, ließ gleichzeitig seine Hand mit der Peitsche zur Kruppe des Pferdes schnellen und drückte ihm die Sporen in den Bauch. Gerontius sprang ab, seine Hinterbeine schossen horizontal hinter ihm in die Höhe. Henri nahm das plötzliche Aufblitzen von Kameras wahr, ein unisono ausgestoßenes, begeistertes «Aaaaah», Applaus, und schon war er im kurzen Galopp wieder auf dem Weg in Richtung des roten Vorhangs. Mit sich nahm er den Anblick der stolz lächelnden Florence, die sich erhoben hatte, um ihm zu applaudieren.
«Bon! C’était très bon!» Er glitt von Gerontius, rieb ihm noch einmal über die Schulter, bevor der dresseur ihn wegführte. Entfernt nahm er den verebbenden Applaus wahr, dann einen Tempowechsel der Musik in der Arena.
«Phantasme ist sehr nervös.» Der Stallbursche erschien mit besorgtem Gesichtsausdruck neben ihm. «Achte auf ihn, Henri.»
«Er wird es gut machen», sagte Henri abwesend und schob den Hut hoch, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen. Der Stallbursche nahm ihm vorsichtig den Hut ab. Das nächste Kunststück wurde mit bloßem Kopf ausgeführt, damit der vom Kopf rutschende Hut den Reiter nicht ablenkte. Aber so fühlte sich Henri immer seltsam verletzlich.
Er sah das metallisch graue Pferd vor sich in die Arena tänzeln, sein Hals war bereits vom Schweiß dunkel verfärbt, an jeder Schulter hielt es ein Mann im Zaum.
«Geh. Geh jetzt.» Der dresseur bürstete ihm einmal schnell über die Rückseite seiner Uniform und schob ihn dann in die Arena. Drei écuyers umringten das Pferd, je einer rechts und links an seinem Kopf, einer an der Kruppe.
Henri trat mit großen Schritten hinaus ins Licht und wünschte sich plötzlich, er hätte wie die anderen ein Pferd, an dem er sich festhalten konnte.
«Bonne chance!», hörte er seinen Stallburschen rufen, bevor dessen Stimme im Applaus unterging.
«Mesdames et messieurs, voilà La Croupade, die in der Kavallerie des achtzehnten Jahrhunderts ihren Ursprung nimmt. Damals wurde sie als Test der Sattelfestigkeit eines Kavalleristen angesehen. Bewegungen wie diese müssen vier bis fünf Jahre lang geübt werden. Monsieur Lachapelle wird Phantasme ohne Zügel oder Steigbügel reiten. Diese Übung, die wir auf die alten Griechen zurückführen, ist für den Reiter noch anspruchsvoller als für das Pferd. Wenn Sie so wollen, ist es eine elegantere Form von Rodeo.»
Lachen wogte durch das Publikum. Halb geblendet von den Flutlichtern, blickte Henri auf Phantasme, in dessen vor Nervosität und mühsam unterdrückter Wut rollenden Augen das Weiße zu sehen war. Er war ein von Natur aus akrobatisches Pferd und verabscheute es, so fest am Kopf gehalten zu werden. Der Lärm und der Geruch von Le Carrousel schienen seine schlechte Laune noch zu vergrößern.
Henri berührte die verspannte Schulter des Pferdes. «Schsch», machte er. «Alles ist gut. Alles ist gut.» Er bemerkte das Lächeln, das über die Gesichter von Duchamp und Varjus huschte, die Phantasmes Kopf hielten. Sie waren beide echte Pferdekenner und reagierten schnell auf die wechselhafte Laune eines Tieres.
«Wünsche festen Sitz», grinste Varjus, als er für Henri die Räuberleiter machte. «Un, deux, trois … und hoch.»
Das Pferd strahlte Anspannung aus. Das ist gut, sagte sich Henri, als er sich im Sattel aufrichtete. Das Adrenalin lässt ihn höher springen. Es wird für die Menge, für Le Grand Dieu besser aussehen. Er zwang sich, tief durchzuatmen. In diesem Moment, als er die Hände in der traditionellen passiven Position, die ihn immer unangenehm an die eines Gefangenen erinnerte, hinter seinem Rücken verschränkte, warf Henri einen Blick hinter sich und sah, wer an Phantasmes Kruppe beordert worden war.
«Dann wollen wir mal sehen, was für ein Reiter du in Wirklichkeit bist, Lachapelle», sagte Picart.
Henri blieb keine Zeit zu antworten. Er hörte den Sprecher etwas sagen und fühlte das erwartungsvolle Schweigen in der Arena.
«Attendez.»
Varjus blickte sich um. Das terre à terre baute sich unter Henri auf. «Un, deux, derrière!»
Er spürte, wie Phantasme sich zum Absprung bereit machte, hörte das plötzliche Zischen, als Picarts Peitsche auf seine Kruppe traf. Phantasme buckelte, sein Hinterteil schoss hoch, und Henri wurde nach vorn geschleudert wie von einem Peitschenhieb. Es gelang ihm gerade eben so, die verschränkten Hände hinter seinem Rücken nicht zu lösen. Das Pferd beruhigte sich, und Applaus brandete auf.
«Nicht schlecht, Lachapelle», hörte er Varjus murmeln, der sich gegen Phantasmes Brust stemmte.
Und dann, plötzlich, ohne dass er Zeit gehabt hätte, sich vorzubereiten, erklang ein weiterer «Derrière!»-Ruf. Phantasmes Hinterbeine hebelten ihn nach oben.
«Nicht so schnell, Picart! Du sorgst dafür, dass er ihn abwirft!», hörte Henri Varjus verärgert sagen.
«Zwei Sekunden. Gebt mir zwei Sekunden», murmelte er und versuchte, sich zu fangen. Doch schon hörte er ein weiteres Schnalzen. Es kam hart und von oben, und dieses Mal buckelte das Pferd gewaltig. Henri spürte erneut, wie er nach vorne geschleudert wurde, die abrupte, verwirrende Distanz zwischen ihm und dem Sattel.
Phantasme warf sich nun wütend zur Seite, und die Männer kämpften, um den Kopf des Pferdes zu halten. Varjus zischte etwas, das Henri nicht verstand. Sie waren in der Nähe des roten Vorhangs. Er erspähte Florence in ihrem gelben Kleid, ihre Verwirrung und Besorgnis. Und dann: «Enfin! Derrière!» Bevor er sich wieder zurechtsetzen konnte, ertönte ein neuer Knall hinter ihm. Mit verdrehtem Rücken wurde er nach vorn geworfen, und Phantasme, noch wütender geworden durch diesen unvernünftigen Einsatz der Peitsche, sprang so lange vorwärts und seitwärts, bis Henri schließlich die Balance verlor. Er fiel gegen Phantasmes bezopften Hinterkopf, er hing kopfüber von Phantasmes Hals, und als dieser erneut buckelte, schlug er, unter dem hörbaren Aufstöhnen der Menge, auf dem Boden auf.
Henri blieb liegen, undeutlich drang der Tumult in der Arena in sein Bewusstsein vor. Varjus fluchte, Picart protestierte, der Sprecher lachte. Als Henri seinen Kopf vom Sand hob, konnte er gerade die Worte ausmachen: «So kann es gehen. Eine Bewegung, bei der man nur sehr schwer im Sattel bleiben kann. Wir wünschen Ihnen mehr Erfolg im nächsten Jahr, was, Monsieur Lachapelle? Sie sehen, mesdames et messieurs, manchmal braucht es viele Jahre Übung, um die Maßstäbe der maîtres écuyers zu erfüllen.»
Er vernahm das «un, deux, trois» und Varjus, der ihm zuzischte: «Steig auf, steig wieder auf.» Er blickte an sich herab und sah, dass seine makellose schwarze Uniform voller Sand war. Dann war er wieder auf dem Pferd, und unter mitleidigem Applaus verließen sie die Arena. Es war das schmerzhafteste Geräusch, das er je gehört hatte.
Er war starr vor Schock. Vor sich nahm er einen heftigen Streit zwischen Varjus und Picart zur Kenntnis, aber in seinen Ohren dröhnte das Blut so laut, dass er kaum etwas hörte.
«Was war das denn?» Varjus schüttelte den Kopf. «Niemand ist bei La Croupade jemals vom Pferd gefallen. Du hast uns blamiert.» Es dauerte einen Moment, bis Henri begriff, dass Varjus’ Worte an Picart gerichtet waren.
«Ist nicht mein Fehler, wenn Lachapelle nur seine englische Hure reiten kann.»
Henri glitt vom Pferd und ging außer sich vor Wut auf Picart zu. Er bekam den ersten Faustschlag kaum mit, nur das laute Knacken, mit dem seine Faust auf die Zähne des Mannes traf, und inmitten des Geräuschs ein befriedigendes Nachgeben, die körperliche Erkenntnis, dass etwas zerbrochen war, lange bevor der Schmerz die Möglichkeit aufscheinen ließ, dass es seine eigene Hand gewesen sein könnte. Pferde wieherten auf und sprangen zur Seite. Männer riefen etwas. Picart lag mit erschrocken geweiteten Augen im Sand, die Hand an sein Gesicht gepresst. Dann rappelte er sich auf, stürzte sich auf Henri und rammte ihm seinen Kopf in die Brust. Damit hätte er auch einen größeren Mann zu Fall gebracht, und Henri war nur 1,75 Meter groß. Doch er besaß den Vorteil einer Kindheit, in der Schlägereien an der Tagesordnung gewesen waren, und hatte seinem Gegner sechs Jahre in der Nationalgarde voraus. Sekunden später saß er auf Picart, seine Fäuste flogen mit der aufgestauten Wut der vergangenen Monate in das Gesicht des jungen Mannes.
Dann zogen ihn Hände weg, Stimmen schimpften laut und ungläubig.
«Picart! Lachapelle!»
Sein Sichtfeld verschwamm und wurde wieder deutlich, er stand auf, spuckend und schwankend, während Hände seine Oberarme umklammerten. Le Grand Dieu stand mit wutverzerrtem Gesicht vor ihm. «Was um Himmels willen sollte das?»
Henri keuchte, begriff das Ausmaß seines Fehltritts erst in diesem Moment.
«Le Carrousel!», zischte Le Grand Dieu. «Der Inbegriff von Anmut und Würde. Von Disziplin. Wo ist Ihre Selbstbeherrschung geblieben? Sie beide haben uns Schande gemacht. Ab in die Ställe mit Ihnen. Ich muss eine Vorführung zu Ende bringen.»
Der Grand Dieu stieg auf sein Pferd, und Picart schwankte vorbei, ein Taschentuch gegen sein aschfahles Gesicht gepresst. Henri sah ihm nach. Allmählich wurde ihm bewusst, dass in der Arena hinter dem Vorhang seltsame Stille herrschte. Sie hatten es gesehen, begriff er entsetzt.
«Zwei Wege.» Le Grand Dieu blickte auf ihn herab. «Zwei Wege, Lachapelle. Das habe ich Ihnen das letzte Mal gesagt. Es war Ihre Entscheidung.»
«Ich kann nicht …», begann er.
Aber Le Grand Dieu war bereits ins Flutlicht hinausgeritten.
«Und in der Tat ist ein solches Pferd, das sich hebt, etwas so Schönes, Bewunderns- und Staunenswürdiges, daß es aller Zuschauer Augen, sowohl junger als älterer, auf sich zieht.»[*]
Xenophon, Über die Reitkunst, ca. 350 v. Chr.
Kapitel 1
August
Der Zug um sechs Uhr siebenundvierzig war überfüllt. Natasha Macauley setzte sich auf einen der letzten freien Plätze und bat leise die Frau um Verzeihung, die ihretwegen ihre Jacke aus dem Weg räumen musste. Der Mann im Anzug, der nach ihr eingestiegen war, quetschte sich in die Lücke zwischen den beiden Fahrgästen ihr gegenüber und schlug unverzüglich seine Zeitung auf, ohne wahrzunehmen, dass er damit der Frau neben ihm teilweise die Sicht auf ihr Taschenbuch nahm.
Es war ein für Natasha ungewöhnlicher Arbeitsweg. Sie hatte nach einem juristischen Vortrag die Nacht in einem Hotel in Cambridge verbracht. In ihrer Jackentasche befand sich eine zufriedenstellende Anzahl von Visitenkarten diverser Anwälte, die ihr zu ihrem Vortrag gratuliert und eine gelegentliche Zusammenarbeit vorgeschlagen hatten.
Natasha umklammerte ihren heißen Pappbecher mit Kaffee, blickte auf ihren Terminkalender hinab und gab sich selbst das Versprechen, dass sie irgendwann an diesem Tag mehr als eine halbe Stunde freischaufeln würde, um ihren Kopf durchzulüften. Sie würde einen Besuch im Fitnessstudio einplanen. Und sie würde sich eine Stunde Zeit zum Mittagessen nehmen. Sie würde, wie es ihre Mutter immer anmahnte, sorgsam mit sich umgehen.
Aber im Augenblick stand da:
9 Uhr: L.A. gegen Santos, Gerichtssaal 7
Die Persey-Scheidung. Psychologisches Gutachten Kind?
Gebühren! Mit Linda sprechen wegen Prozesskostenhilfe
Fielding – Wo ist die Zeugenaussage? HEUTE FAXEN
Jede Seite ihres Kalenders war mindestens zwei Wochen im Voraus mit unbarmherzigen, endlos aktualisierten Listen gefüllt. Ihre Kollegen bei Davison Briscoe nutzten alle elektronische Kalender auf ihren iPhones und BlackBerries, um damit ihre Leben zu organisieren, aber sie bevorzugte die einfachen Mittel Stift und Papier, auch wenn ihre Sekretärin Linda sich darüber beschwerte, dass ihre Zeitpläne unlesbar seien.
Natasha nippte an ihrem Kaffee, bemerkte das Datum und zuckte zusammen. Sie fügte hinzu:
Blumen/Karte Geburtstag Mum
Der Zug rumpelte in Richtung London, das Tiefland von Cambridgeshire ging über in die grauen Industrieausläufer der Stadt. Natasha starrte auf ihre Unterlagen und bemühte sich krampfhaft um Konzentration. Sie saß einer Frau gegenüber, die es offenbar in Ordnung fand, zum Frühstück einen Hamburger mit extra Käse zu essen, und einem Teenager, dessen leerer Gesichtsausdruck nicht zu dem Beat passte, der aus seinen Kopfhörern drang. Es würde ein erbarmungslos heißer Tag werden.
Sie schloss die Augen, öffnete sie dann wieder, als ihr Mobiltelefon piepte. Sie wühlte in ihrer Tasche und machte es zwischen Make-up und Portemonnaie ausfindig. Eine SMS leuchtete auf:
Kommunalbehörde gibt im Watson-Fall nach. Sie müssen um neun nicht ins Gericht. Ben
Seit vier Jahren war sie nun bei Davison Briscoe, und ihr Rechtsbeistand war immer dann besonders gefragt, wenn es um ihr Spezialgebiet ging, die Vertretung von Kindern.
Danke. Bin in einer halben Stunde im Büro
schrieb sie ihrem Referendar mit einem Seufzer der Erleichterung zurück. Dann fluchte sie leise. Sie hätte das Frühstück also nicht ausfallen lassen müssen.
Sie wollte ihr Telefon gerade weglegen, als es klingelte. Es war erneut Ben: «Ich wollte Sie nur daran erinnern, dass wir das pakistanische Mädchen – äh – auf halb elf verschoben haben.»
«Die, deren Eltern das Kindesentzugsverfahren anfechten?»
Neben ihr räusperte sich eine Frau. Natasha blickte auf und sah das Schild mit dem durchkreuzten Mobiltelefon an der Scheibe. Sie neigte den Kopf und blätterte in ihrem Kalender. «Und die Eltern von dem Missbrauchsfall kommen um zwei. Können Sie die relevanten Unterlagen rauslegen?», flüsterte sie.
«Schon geschehen. Und ich habe Croissants», fügte Ben hinzu. «Ich bin davon ausgegangen, dass Sie noch nichts gegessen haben.»
Das hatte sie nie. Sollte Davison Briscoe je damit aufhören, Referendare auszubilden, würde sie wohl verhungern.
«Es sind Mandelcroissants, die mögen Sie doch am liebsten.»
«Gut eingeschleimt, Ben, Sie werden es weit bringen.»
Natasha steckte erst das Handy weg und klappte dann ihren Kalender zu. Sie hatte gerade die Unterlagen über das pakistanische Mädchen auf dem Schoß, als das Telefon wieder klingelte.
Dieses Mal wurde hörbar gezischt. Sie murmelte eine Entschuldigung, ohne jemandem in die Augen zu sehen. «Natasha Macauley.»
«Linda. Michael Harrington hat eben angerufen. Er hat sich bereit erklärt, uns bei der Persey-Scheidung zu unterstützen.»
«Großartig.» Bei der Scheidung ging es um viel Geld, und es waren komplizierte Sorgerechtsfragen zu klären. Sie hatte einen renommierten Anwalt gesucht, der ihr bei den finanziellen Fragen half.
«Er will heute Nachmittag ein paar Dinge mit dir besprechen. Hast du um zwei Zeit?»
«Ich denke, das geht in Ordnung.» Ihr fiel ein, dass ihr Kalender wieder in der Tasche steckte. «Moment. Nein. Ich habe einen Termin.»
Die Frau tippte ihr auf die Schulter. Natasha legte die Hand über das Telefon. «Noch zwei Sekunden», sagte sie schroffer, als sie es beabsichtigt hatte. «Ich weiß, dies ist ein Ruheabteil, und es tut mir leid, aber ich muss dieses Telefonat zu Ende bringen.»
Sie klemmte sich das Telefon zwischen Ohr und Schulter, wühlte nach ihrem Kalender und fuhr gereizt herum, als die Frau sie erneut berührte.
«Ich sagte, ich muss nur …»
«Ihr Kaffee steht auf meiner Jacke.»
Sie sah nach unten. Der Becher balancierte wackelig auf dem Saum der cremefarbenen Jacke. «Oh. Entschuldigung.» Sie griff nach dem Becher. «Linda, können wir das verlegen? Ich muss heute Nachmittag doch irgendwann eine Lücke haben.»
Sie strich den Gerichtstermin in ihrem Kalender durch, fügte das Treffen mit Harrington hinzu und wollte das Büchlein gerade wieder in ihre Tasche stecken, als ihr eine Schlagzeile der Zeitung gegenüber ins Auge stach.
Um zu überprüfen, ob sie den Namen im ersten Absatz richtig entziffert hatte, lehnte sie sich so weit vor, dass der lesende Mann die Zeitung senkte und sie anfunkelte. «Es tut mir leid», sagte sie, wie gelähmt von der Nachricht. «Könnte ich … könnte ich einen ganz kurzen Blick in Ihre Zeitung werfen?»
Er war zu verblüfft, um abzulehnen. Sie nahm die Zeitung entgegen, drehte sie um und las den Artikel zweimal durch. Alle Farbe wich aus ihrem Gesicht.
Sarah schnitt das zweite Sandwich-Quadrat diagonal durch, bevor sie die beiden Brote jeweils sorgsam in Butterbrotpapier wickelte. Eins der Pakete legte sie in den Kühlschrank, das andere steckte sie zusammen mit zwei Äpfeln ordentlich in ihre Tasche. Sie wischte die Arbeitsfläche mit einem feuchten Tuch ab und überprüfte die kleine Küche noch einmal auf Krümel, bevor sie das Radio ausmachte. Papa hasste Krümel.
Sie warf einen Blick auf die Uhr und dann auf den Kaffeefilter, um zu sehen, ob die dunkelbraune Flüssigkeit bereits durchgelaufen war. Jede Woche wies sie Papa darauf hin, dass das echte Zeug viel mehr kostete als Instantkaffee, aber er zuckte nur mit den Schultern und sagte, es gebe auch so etwas wie Sparsamkeit an der falschen Stelle. Sie wischte den Kaffeebecher von unten ab, ging in den engen Flur und blieb vor seiner Zimmertür stehen.
«Papa?» Er war für sie schon lange nicht mehr Großpapa.
Sie drückte die Tür mit der Schulter auf. Das kleine Zimmer erstrahlte in der Morgensonne, und man konnte sich einen Moment lang vorstellen, da draußen läge ein lieblicher Ort, ein Strand oder ein ländlicher Garten anstelle eines heruntergekommenen Wohnblocks aus den sechziger Jahren in East London. Auf der anderen Seite von Papas Bett stand eine kleine Kommode, auf der seine Haar- und Kleiderbürsten ordentlich aufgereiht neben dem Foto von Nana lagen. Seit sie gestorben war, schlief er nicht mehr in einem Doppelbett. Im Zimmer sei mit einem Einzelbett mehr Platz, sagte er. Sie wusste, dass er die Leere eines großen Bettes ohne ihre Großmutter darin einfach nicht ausgehalten hatte.
«Kaffee.»
Der alte Mann rappelte sich in seinen Kissen auf und tastete auf dem Nachttisch nach seiner Brille. «Gehst du? Wie viel Uhr ist es?»
«Kurz nach sechs.»
In seinem Schlafanzug sah er eigenartig verletzlich aus, dieser Mann, der seine Kleidung trug, als sei sie eine Uniform.
«Schaffst du noch den Bus um zehn nach?»
«Wenn ich renne. Deine Sandwiches sind im Kühlschrank.»
«Sag dem verrückten Cowboy, dass ich ihn heute Nachmittag bezahle.»
«Das habe ich ihm schon gestern gesagt, Papa. Es ist in Ordnung.»
«Und sag ihm, er soll ein paar Eier beiseitelegen. Wir essen sie morgen.»
Sie erreichte den Bus gerade eben noch. Keuchend zeigte sie ihre Monatskarte vor, setzte sich und nickte der indischen Frau zu, die jeden Morgen mit Eimer und Wischmopp auf dem gleichen Platz saß. «Schön», sagte die Frau, als der Bus am Wettbüro vorbeifuhr.
Sarah drehte sich um und blickte auf die vom wässrigen Morgenlicht erhellten, schmutzigen Straßen. «Ja, heute wird es schön», stimmte sie zu.
«Dir wird heiß werden in diesen Stiefeln», sagte die Frau.
Sarah klopfte auf ihre Tasche. «Meine anderen Schuhe sind hier drin.»
Sie lächelten sich unbeholfen an, nach Monaten des Schweigens verlegen, so viel miteinander gesprochen zu haben. Sarah lehnte sich in ihrem Sitz zurück und wandte sich zum Fenster.
Die Strecke bis zu Cowboy John dauerte morgens um diese Zeit nur siebzehn Minuten. Eine Stunde später wären die Straßen östlich der City verstopft, und es würde mindestens dreimal so lange dauern. Normalerweise war sie vor ihm da, und sie hatte als Einzige Zweitschlüssel. Meistens ließ sie gerade die Hennen ins Freie, wenn er mit steifen Beinen die Straße heraufschlenderte. Üblicherweise konnte man ihn singen hören.
Als Sarah am Vorhängeschloss des Tors fummelte, bellte Sheba, die Schäferhündin, einmal kurz auf, setzte sich aber wieder, als sie Sarah erkannte, und klopfte erwartungsvoll mit dem Schwanz auf den Boden. Sarah warf ihr ein Leckerli aus ihrer Tasche zu, betrat den kleinen Hof und schloss mit einem gedämpften Krachen das Tor hinter sich.
Früher hatte es in diesem Teil Londons viele kleine Ställe am Ende enger Kopfsteinpflasterstraßen gegeben, versteckt hinter Hof- oder Gartentoren, in jede Lücke gequetscht. Pferde hatten zum Alltag gehört, hatten Brauerei-, Kohlen- und Lumpenwagen gezogen. Der Stall von Cowboy John war einer der wenigen, die überlebt hatten. Er lag am Ende einer Gasse, die in die Hauptstraße mündete. Die Stallanlagen erstreckten sich unter vier Eisenbahnbogen, drei oder vier Pferdeboxen und abschließbare Geräteschränke waren unter jedem von ihnen untergebracht. Vor den Bögen gab es einen ummauerten, gepflasterten kleinen Hof, auf dem sich Paletten stapelten. Hühnerställe, Mülltonnen und ein oder zwei Container standen herum, außerdem das Auto, das Cowboy John gerade verkaufen wollte, und eine Feuerschale, die nie ausging. Ungefähr alle zwanzig Minuten rumpelte ein Pendlerzug über sie hinweg, aber weder Menschen noch Tiere beachteten ihn. Hühner pickten herum, eine Ziege nahm einen vorsichtigen Bissen von etwas, das sie nicht fressen sollte, und Shebas bernsteinfarbene Augen blickten wachsam hinaus in die Welt jenseits des Tors, bereit, nach jedem zu schnappen, den sie nicht kannte.
Zwölf Pferde waren hier im Moment untergebracht: die beiden Clysedales, die Tony, dem Kutscher im Ruhestand, gehörten, die Gäule mit den eleganten Hälsen und wilden Augen des Maltesers Sal und seiner Wettkollegen und eine bunte Mischung zotteliger Ponys, die dort von Kindern aus der Nachbarschaft gehalten wurden. Sarah war nie sicher, wie viele Menschen überhaupt von ihrer Existenz wussten: Der Parkwärter, der sie regelmäßig verscheuchte, wusste jedenfalls Bescheid, und gelegentlich erhielten sie Briefe, die an «Die Pferdebesitzer, Sparepenny Lane Arches» adressiert waren und ihnen mit Gerichtsverfahren drohten, sollten sie mit ihren Tieren weiterhin Gemeindeland betreten. Cowboy John lachte dann und warf die Briefe in die Feuerschale. «Soweit ich weiß, waren die Pferde zuerst hier», nuschelte er mit seinem amerikanischen Akzent.
Er behauptete, ein waschechter Philadelphia Black Cowboy zu sein. Das waren keine wirklichen Cowboys, nicht die Sorte jedenfalls, die Rinder züchteten. In Amerika, sagte er, gebe es ebenfalls Stadthöfe wie diesen. Cowboy John war in den Sechzigern wegen einer Frau nach London gezogen, die, wie sich dann herausgestellt hatte, «viel, viel zu anstrengend» gewesen war. Er hatte die Stadt gemocht, aber seine Pferde so sehr vermisst, dass er eines Tages auf dem Markt in Southall ein Vollblut mit kaputten Knien und von der Stadt ein paar baufällige Ställe aus dem 19. Jahrhundert kaufte. Vermutlich bereute die Stadt das seitdem.
Inzwischen war Cowboy John eine Institution, oder ein Ärgernis, das kam auf die Perspektive an. Die Stadtbeamten mochten ihn nicht und stellten andauernd Verwarnungen aus, weil der Stall eine Gefahr für die Umwelt darstellen und er keine genügende Ungezieferbekämpfung betreiben würde. John ließ sie wissen, dass sie sich von ihm aus die ganze Nacht in Käsesoße getunkt hier draußen auf die Lauer legen könnten, sie würden keinen einzigen Nager zu Gesicht bekommen – er hielt nämlich eine Schar angriffslustiger Katzen. Bauträger und Projektentwickler mochten ihn auch nicht, weil sie ihre Häuserblöcke hierhin stellen wollten und Cowboy John nicht verkaufte. Aber die meisten Nachbarn störte er nicht mit seinen Ställen. Sie kamen täglich zum Plaudern vorbei oder kauften, was er an frischen Erzeugnissen anzubieten hatte. Auch die Restaurants der Umgebung mochten ihn: Manchmal kamen Ranjeet oder Neela vom Raj Palace und erstanden Hühner oder Eier oder die eine oder andere Ziege. Und dann gab es noch ein paar wenige wie Sarah, die jeden Augenblick dort verbrachte, den sie nicht in der Schule sein musste. Die aufgeräumten viktorianischen Ställe und schwankenden Heuhaufen boten einen Rückzugsort vor dem unermüdlichen Lärm und Chaos der Stadt um sie herum.
«Hast du die dumme Gans schon rausgelassen?»
Sie warf gerade den Ponys Heu zu, als Cowboy John eintraf. Er hatte seinen Stetson auf – für den Fall, dass es jemanden gab, der es noch nicht begriffen hatte –, und seine hohlen Wangen waren erhitzt von der Anstrengung, in der schon warmen Sonne zu gehen und zu rauchen.
«Nö. Sie beißt mich immer in die Beine.»
«Mich auch. Ich werde mal hören, ob dieses neue Restaurant sie haben will. Mann, ich hab schon lauter rote Stellen an den Knöcheln.» Sie beäugten den übergroßen Vogel, den er spontan vorige Woche auf dem Markt gekauft hatte. «Pflaumensoße!», fuhr er die Gans an, und als Antwort zischte sie zurück.
Sarah konnte sich kaum an die Zeit erinnern, in der sie nicht jede freie Minute in der Sparepenny Lane verbracht hatte. Als sie noch ganz klein gewesen war, hatte Papa sie immer auf Cowboy Johns zottige Shetland Ponys gesetzt. Als ihre Mutter verschwand, kam Papa mit ihr hierher, damit sie Nanas Weinen nicht mitbekam oder das Geschrei, wenn ihre Mutter ganz selten einmal wieder nach Hause kam und Nana sie anflehte, einen Entzug zu machen.
Hier hatte Papa ihr das Reiten beigebracht, die Gassen hinauf und wieder hinunter, bis sie das Leichttraben beherrschte. Papa verabscheute es, wie die meisten Pferdebesitzer bei Cowboy John ihre Tiere hielten. In einer Stadt zu leben sei keine Entschuldigung dafür, sie nicht jeden Tag zu bewegen, sagte er. Er gab Sarah nie zu essen, bevor nicht das Pferd gefüttert war, ließ sie nie duschen, bevor sie nicht ihre Reitstiefel poliert hatte. Nach Nanas Tod hatten sie dann Baucher bekommen, oder Boo, wie sie ihn nannten. Sie hatten eine neue Beschäftigung gebraucht, einen Grund, das Zuhause zu verlassen, das sich nicht mehr wie eines anfühlte. Papa hatte begonnen, den kupferfarbenen jungen Hengst und seine Enkelin zu trainieren. Er übte mit ihnen weit mehr als das, was die Kinder des Viertels «reiten» nannten. Papa trichterte ihr immer wieder Details ein, die andere nicht einmal erkennen konnten: den auf den Millimeter korrekten Winkel ihres Unterschenkels, die völlige Bewegungslosigkeit ihrer Hände. Er tat es, bis sie weinte, weil sie manchmal einfach gern mit den anderen losgaloppiert wäre und er es nicht erlaubte. Nicht nur, weil er Boos Beinen die asphaltierten Straßen nicht zumuten wollte. Er wollte ihr auch beibringen, wie er sagte, dass man nur mit Arbeit und Disziplin etwas Magisches erreichen konnte.
Er redete immer noch so, ihr Papa. Aus dem Grund nannten John und die anderen ihn Captain. Es sollte ein Witz sein, aber Sarah wusste, dass sie sich auch ein wenig vor ihm fürchteten.
«Willst du einen Tee?» Cowboy John deutete auf den Wasserkocher.
«Nein. Ich habe nur eine halbe Stunde zum Reiten. Heute muss ich früh in der Schule sein.»
«Übst du immer noch deine Tricks?»
«Genau genommen», sagte sie mit übertriebener Höflichkeit, «werden wir heute Morgen an unserer Traversale mit fliegendem Galoppwechsel arbeiten und die eine oder andere Piaffe üben. Wie es der Captain befohlen hat.» Sie streichelte den glänzenden Hals des Pferdes.
Cowboy John schnaubte. «Das muss ich deinem alten Herrn lassen. Wenn der Zirkus das nächste Mal in die Stadt kommt, reißen sie sich um euch.»
In Natashas Job war es nicht ungewöhnlich, wenn man das Kind, das man gerade vertreten hatte, nur Wochen später wieder vor Gericht antraf. Gelegentlich schafften sie es sogar in die Zeitungen. Aber dieser Junge hier überraschte sie, nicht nur wegen der Schwere seines Vergehens. Tag für Tag berichteten Kinder in ihrem Büro von Elend, Missbrauch und Vernachlässigung. Meistens konnte sie zuhören, ohne mit der Wimper zu zucken. Nach zehn Jahren hatte sie so viele Schicksale gehört, dass nur wenige in ihr mehr auslösten als das Abhaken einer mentalen Checkliste: Waren alle Kriterien erfüllt? Wie stark ist meine Position als Verteidigerin? Sind die Rechtsbeihilfe-Anträge unterschrieben? Ist das Kind ein glaubwürdiger Zeuge? Wie alle anderen hätte Ali Ahmadi in ihrer Erinnerung verblassen müssen, ein weiterer schnell vergessener Name auf ihrer Liste.
Er war zwei Monate zuvor mit vor Misstrauen und Traurigkeit leeren Augen in ihr Büro gekommen. Seine Füße steckten in billigen Turnschuhen aus der Kleiderspende, ein schlecht sitzendes Hemd hing an seinem dünnen Körper herab. Er brauchte einen Eilantrag gegen seine Abschiebung in das Land, das ihn, wie er angab, beinahe zerstört hätte.
«Ich nehme eigentlich keine Asylrechtsfälle an», hatte sie erklärt, aber der dafür zuständige Anwalt Ravi war nicht im Haus gewesen, und er wirkte so verzweifelt.
«Bitte», hatte die Pflegemutter gesagt, «ich kenne Sie, Natasha. Sie können das für uns schaffen.» Zwei Jahre zuvor hatte Natasha ein anderes ihrer Kinder vertreten.
Sie hatte die Unterlagen überflogen, aufgeblickt und ihn angelächelt, und einen Augenblick später hatte er zurückgelächelt. Kein selbstbewusstes Lächeln, eher beschwichtigend. So, als würde das von ihm erwartet. Während sie die Schreiben durchlas, begann er mit zunehmender Dringlichkeit zu sprechen, und die Frau übersetzte. Seine Hände malten Worte in die Luft, die Natasha nicht verstand.
Die Mitglieder seiner Familie waren als politische Dissidenten verfolgt worden. Sein Vater war auf dem Heimweg von der Arbeit verschwunden. Seine Mutter war auf offener Straße zusammengeschlagen worden und dann mitsamt seiner Schwester verschwunden. Ali war mit dem Mut der Verzweiflung in dreizehn Tagen zu Fuß zur Grenze gewandert. Während er sprach, kamen ihm die Tränen, und er blinzelte sie mit der Verlegenheit eines Teenagers weg. Wenn er zurückkehrte, würden sie ihn umbringen. Er war fünfzehn.
Es war eine wenig auffällige Geschichte, sie klang, wie sie eben so klangen.
Linda hatte an der Tür gewartet. «Kannst du für mich im Gericht anrufen? Kläre bitte ab, ob wir Gerichtssaal vier bekommen.»
Bevor sie gingen, legte sie dem Jungen ihre Hand auf die Schulter. «Ich tue, was ich kann», sagte sie zu der Pflegemutter, «aber ich glaube dennoch, dass Sie besser beraten wären, sich einen anderen Anwalt zu nehmen.»
Ihrem Eilantrag wurde stattgegeben, und sie hätte den Jungen augenblicklich vergessen, wenn sie nicht beim Zusammenpacken ihrer Unterlagen bemerkt hätte, dass er wieder weinte. Er stand in der Ecke des Gerichtssaals, geräuschloses Schluchzen schüttelte ihn. Ein wenig peinlich berührt hatte sie die Augen abgewandt, als sie an ihm vorbeiging. Doch er hatte sich von seiner Pflegemutter gelöst, sich eine Kette vom Hals gezerrt und sie ihr in die Hand gedrückt. Er sah sie nicht an, auch nicht, als sie ihm sagte, das sei wirklich nicht nötig. Er stand einfach mit gesenktem Kopf da und drückte seine Handfläche in ihre, auch wenn dieser Kontakt den Regeln seiner Religion widersprach. Sie erinnerte sich, wie sich seine Hand in einer seltsam erwachsenen Geste um ihre geschlossen hatte.
Es waren dieselben Hände, die vor zwei Nächten angeblich einen hinterhältigen tätlichen Angriff auf eine namentlich noch nicht bekannte sechsundzwanzigjährige Verkäuferin in deren Wohnung verübt hatten.
Ihr Telefon klingelte wieder. Das Zischen um sie war diesmal nicht mehr leise. Mit einer erneuten Entschuldigung raffte Natasha ihre Habseligkeiten zusammen und drängte sich durch das volle Abteil. Nur mit Mühe hielt sie die Balance, als der Zug plötzlich nach links schwenkte. Sie klemmte ihre Tasche unter den Arm und fand einen engen Stehplatz am Fenster, so nah, wie es ging, an einem Abteil, in dem Telefonieren erlaubt war.
In dem Moment legte der Anrufer auf, sie ließ ihre Tasche fallen und fluchte. Sie hatte ihren Sitzplatz umsonst aufgegeben. Als sie das Handy gerade wieder einstecken wollte, sah sie die SMS:
Hi. Muss ein paar Sachen abholen. Und reden. Passt es dir irgendwann nächste Woche? Mac
Mac. Sie starrte auf den kleinen Bildschirm, und um sie herum wurde es ganz still. Mac.
Sie hatte keine Wahl.
Kein Problem
tippte sie und drückte auf Senden.
Früher einmal hatte es in den Altbauten dieses Stadtteils ein Anwaltsbüro neben dem anderen gegeben; vergoldete Schilder mit den Namen der Partner versprachen rechtlichen Beistand in geschäftlichen, steuerlichen und privaten Belangen. Die meisten Kanzleien waren längst in neue Geschäftsräume in glänzenden, gläsernen Gebäuden am Rande der City gezogen – die von Architekten entworfenen Büros waren Ausdruck des ins einundzwanzigste Jahrhundert gerichteten Blicks ihrer Inhaber. Bislang hatte sich Davison Briscoe diesem Trend entzogen. Natashas enges, mit Büchern vollgestopftes Büro in dem leicht verwohnten georgianischen Gebäude, das sie und fünf weitere Anwälte beherbergte, ähnelte mehr einem Seminarraum an der Uni als einem Büro in einer Kanzlei.
«Hier sind die Unterlagen, die Sie angefordert haben.» Ben, ein schlaksiger, strebsamer junger Mann, dessen kindlich glatte Wangen seine fünfundzwanzig Jahre Lügen straften, legte einen dicken Aktenordner vor ihr ab. «Sie haben Ihr Croissant ja noch gar nicht angerührt», sagte er.
«Tut mir leid», sagte sie und blätterte durch die Unterlagen auf ihrem Tisch. «Habe den Appetit verloren. Ben, tun Sie mir einen Gefallen. Graben Sie die Akte Ali Ahmadi aus, ja? Ein Eilantrag von vor zwei Monaten.»
Als Ben das Zimmer verließ, schlüpfte Conor herein. Er trug das blau gestreifte Hemd, das sie ihm zum Geburtstag geschenkt hatte.
«Morgen, Hotshot.» Er lehnte sich über den Schreibtisch und küsste sie leicht auf die Lippen. «Wie ist es gestern Abend gelaufen?»
«Gut», sagte sie. «Wirklich gut. Du wurdest vermisst.»
«Ich hatte die Jungs. Entschuldige, du weißt ja, wie das ist. Solange ich sie nicht öfter bekomme, will ich keinen Abend mit ihnen verpassen.»
«Hattet ihr Spaß?»
«Es war eine wilde Party. Harry Potter auf DVD, Baked Beans auf Toast. Wir haben das Haus gerockt. War dein riesiges Hotelbett zu groß ohne mich?»
Sie lehnte sich zurück. «Conor, ich bin völlig verrückt nach deiner Gesellschaft, aber um Mitternacht war ich so erledigt, dass ich auf jeder x-beliebigen Parkbank geschlafen hätte.»
Ben erschien wieder, nickte Conor zu und legte die Akte auf ihren Schreibtisch. «Mr. Ahmadi», sagte er.
Conor warf einen Blick darauf. «War das nicht so ein Abschiebungsfall von dir? Warum gräbst du ihn wieder aus?»
«Ben, holen Sie mir bitte einen Kaffee? Aus dem Coffee Shop, nicht Lindas braune Brühe.»
Conor warf ihm einen Geldschein zu. «Mir auch. Einen doppelten Espresso, ohne Milch.»
«Du bringst dich noch um», bemerkte sie.
«Aber das werde ich immerhin effizient tun. Okay», sagte er, als Ben das Büro verlassen hatte, «was ist los?»
«Das da.» Sie reichte ihm die Zeitung und zeigte auf den Artikel.
Er überflog ihn schnell. «Ah, verstehe.»
«Ja.» Sie streckte die Arme vor sich aus, ließ ihr Gesicht für einen Moment auf die Schreibtischplatte sinken. Dann griff sie über den Tisch nach einem Mandelcroissant. «Ich frage mich, ob ich Richard davon erzählen soll.»
«Du willst unserem Seniorpartner davon erzählen? Nein, nein, nein. Kein Anlass, zu Kreuze zu kriechen, Hotshot.»
«Es geht um ein wirklich schweres Verbrechen.»
«Aber keines, das du hättest vorhersehen können. Lass es ruhen, Natasha. Das gehört zu unserem Job, Liebling. Du weißt das.»
«Ja, ich weiß. Es ist nur … es ist so grauenvoll. Und er war …» In Erinnerungen versunken, schüttelte sie den Kopf. «Ich weiß nicht. Er war irgendwie nicht der Typ dafür.»
«War irgendwie nicht der Typ dafür!» Conor musste tatsächlich lachen.
«War er wirklich nicht. Es gefällt mir einfach nicht, dass ich an etwas so Schrecklichem Anteil habe. Ich kann nicht aufhören, mich verantwortlich zu fühlen.»
«Was? Hast du ihn gezwungen, die Frau anzugreifen?»
«Du weißt, dass ich das nicht meine. Ich habe vor Gericht alles darangesetzt, ihm zu ermöglichen, im Land zu bleiben. Wegen mir ist er noch hier.»
«Weil niemand anderes dazu in der Lage gewesen wäre, oder?»
«Also …»
«Reiß dich zusammen, Natasha.» Conor tippte mit dem Finger auf die Akte. «Wenn Ravi hier gewesen wäre, hätte es ihn getroffen. Schau nach vorn. Heute Abend trinken wir was zusammen. Steht unsere Verabredung? Lust auf das Archery? Da gibt es neuerdings auch Tapas.»
Doch Natasha war immer nur gut darin gewesen, Ratschläge zu erteilen, und nicht darin, sie anzunehmen. Einige Stunden später schlug sie deshalb Ahmadis Akte zum zweiten Mal auf und suchte darin nach Hinweisen, warum dieser Junge, der so sanft ihre Hand gehalten hatte, zu einer solchen Gewalttat fähig gewesen war. Es ergab keinen Sinn. «Ben? Können Sie bitte einen Atlas für mich auftreiben?»
«Einen Atlas?»
Zwanzig Minuten später hatte er einen abgewetzten gefunden, dessen Rücken teilweise fehlte. «Er ist vermutlich ziemlich veraltet. Es gibt darin noch – äh – Persien und Bombay», entschuldigte er sich. «Wahrscheinlich ist es besser, wenn Sie im Internet nachschauen. Ich könnte sonst auch für Sie recherchieren.»
«Manchmal muss es Papier sein, Ben», sagte sie und blätterte durch das Buch, «das wissen Sie.»
Einer Eingebung folgend, wollte sie nachschlagen, wo der Junge herkam. Der Name der Stadt war ihr im Gedächtnis haften geblieben. In dem Moment, als sie auf die Karte starrte und den Ortsnamen mit dem Finger folgte, fiel ihr auf, dass niemand, weder die Sozialarbeiter noch die Anwälte oder die Pflegemutter, Ali Ahmadi die Frage gestellt hatte, die sich förmlich aufdrängte: Wie konnte jemand in dreizehn Tagen eintausendvierhundertfünfzig Kilometer zu Fuß gehen?
Abends saß Natasha in der Bar und verfluchte sich dafür, nicht gründlich genug gewesen zu sein. Als sie Conor die Geschichte erzählte, lachte er kurz auf und zuckte dann mit den Schultern. «Du weißt ja, diese Kids sind verzweifelt», sagte er. «Sie erzählen dir, was du hören willst.»