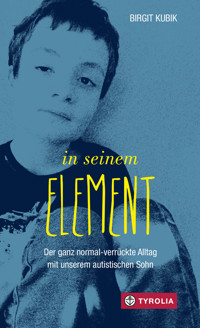
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
"Hallo, ich bin's, der Max, hört ihr mich?" Vom täglichen Leben mit einem behinderten Kind – aus dem Tagebuch einer Mutter Für Birgit Kubik und ihren Mann kommt nach der Geburt ihres ersten Sohnes alles anders als gedacht. Max muss mit drei Wochen operiert werden, viele medizinische Maßnahmen folgen. Bald wird klar: Max ist behindert. Später gibt es Namen dafür: Entwicklungsrückstand, atypischer Autismus, zwanghafte Verhaltensweisen, ADHS … Für die Familie wird das Leben mit Max herausfordernd und voller Überraschungen. So spricht Max zunächst gar nicht, doch sobald er es lernt, flutet er seine Umwelt mit Fragen. Max lernt nicht lesen, aber sein exaktes inneres Zeitgefühl und sein verblüffendes Gedächtnis machen ihn zum "Terminkalender" in Schule, Therapiezentren und zu Hause. Mitten im Supermarkt oder sonst wo spricht Max fremde Menschen an, berührt sie oder macht ihnen Komplimente. Was die Mutter immer wieder überrascht: Viele empfinden seine energische Kontaktaufnahme als wohltuend. In sachlichem und doch so unmittelbarem Tagebuchstil beschreibt die Autorin, verheiratete Mutter von zwei Kindern, den Familienalltag von Maxʼ Geburt bis zu seiner Volljährigkeit. Sie schildert Glücksmomente des Familienlebens und Meilensteine in Maxʼ Entwicklung. Doch sie verschweigt auch nicht, dass es immer wieder Rückschläge gibt und das ständige Verfügbar-sein-Müssen anstrengend ist: Max kann nicht allein sein, seine Fragen verlangen Antworten, Therapien, Schulgespräche sowie Arzttermine reihen sich aneinander … Da ist es wichtig, dass das soziale Netzwerk der Familie gut funktioniert und Birgit Kubik gelernt hat zu "switchen", das heißt ihren kostbaren Freiraum bewusst zu genießen. Ein bestechend ehrlicher, authentischer Erfahrungsbericht aus erster Hand, inspirierend für Angehörige beeinträchtigter Kinder und hilfreich für alle, die Kinder mit besonderen Bedürfnissen betreuen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Birgit Kubik
In seinem Element
Birgit Kubik
in seinemELEMENT
Der ganz normal-verrückte Alltag mit unserem autistischen Sohn
Für Max
… und all jene, die sich in ähnlichen Situationen befinden, die Tag für Tag Höchstleistungen für ihre Kinder oder Angehörigen vollbringen, selbst viel zurückstecken müssen und dennoch nicht ihre Lebensfreude verloren haben.
Unsere Geschichte ist nur eine von vielen.
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT Oscarverdächtig!
PROLOG In seinem Element
EINS Es beginnt
ZWEI Erste Anzeichen
DREI Therapien über Therapien
VIER Max geht
FÜNF Max’ Hobbys
SECHS Eskalation
SIEBEN Vom Warten und Fragen
ACHT Auserwählt
NEUN Auch wir haben Fragen
ZEHN Doch außerirdisch?
ELF Danke, Max!
ZWÖLF Was ist schon normal?
DREIZEHN Kirche, ein Ort der Struktur
VIERZEHN Im Dauereinsatz
FÜNFZEHN Kraftquellen
EPILOG Max zieht aus
DANK
VORWORT
OSCARVERDÄCHTIG!
Es ist unvergleichlich schwieriger, ein autistisches Kind auf seinem Lebensweg zu begleiten und zu erziehen, als ein neurophysiologisch unauffälliges Kind. Die Herausforderung liegt sowohl im physischen Bereich durch jahrelangen Schlafentzug, unzählige Therapie- und Arzttermine, als auch im psychischen Bereich aufgrund vieler Sorgen rund um die Entwicklung und Zukunft des Kindes. Betroffene Familien ermöglichen nächsten Generationen eine bessere Inklusion und leisten Pionierarbeit, damit sich ihre Kinder später gut in der Gesellschaft zurechtfinden können.
Einerseits erlebe ich in meinem Beruf, dass Familien an diesen großen Herausforderungen zerbrechen können, da die eigenen Kräfte und die Unterstützung der Großfamilie und Gesellschaft leider oft nicht ausreichen.
Andererseits gehört es in meinem Beruf mit zum Schönsten zu sehen, wie sich schwer beeinträchtigte Kinder gleichsam wie in einer „Hängematte der Liebe“ – die in erster Linie durch die Eltern und Geschwister gespannt wird – geborgen und gebunden fühlen. Die Freude am Leben, die diese Kinder durch den liebevollen Umgang der Eltern mit ihnen ausstrahlen, ist berührend und etwas ganz Besonderes.
Da der Bedarf an körperlicher Nähe und der Aufwand in der Erziehung eines beeinträchtigten Kindes um ein Vielfaches höher ist, ist das Loslassen nach der Pubertät bzw. im jungen Erwachsenenalter für diese Eltern schwieriger. Aber wie bei jedem gesunden Kind ist es ein notwendiger Prozess. Der sichere Platz im Herzen der Eltern wird den Kindern, ob beeinträchtigt oder nicht, bleiben. Es gilt, immer wieder neue Möglichkeiten zu finden, die Bindung zum nun jungen Erwachsenen aufrechtzuerhalten, wenn auch nicht im ständigen Kontakt.
Ich habe große Hochachtung vor allen Eltern und ihren Großfamilien, die ein entwicklungsbeeinträchtigtes Kind mit emporbildendem Verständnis und unendlich viel Liebe auf ihrem Lebensweg begleiten. Diese Familien sind Botschafter der Liebe in einer Zeit, wo Egoismus und das Kreisen um die eigenen, dagegen oft sehr kleinen, Probleme im Mittelpunkt stehen.
Jede dieser Familien ist oscarverdächtig! Wenn ich könnte, würde ich all diesen Familien persönlich den „Oscar“ überreichen, als Wertschätzung für ihren Dienst an ihrem Kind und der Gesellschaft. So auch der Autorin dieses Buches, Birgit Kubik, und ihrer Familie.
Linz, im Jänner 2023
MR Dr. med. Manuela Baumgartner
leitet die Ambulanz für Entwicklungsneurologie und Neuropädiatrie am Ordensklinikum Linz, Barmherzige Schwestern
PROLOG
IN SEINEM ELEMENT
Es ist Sommer. In unserer Stadt findet am Hauptplatz ein Konzert statt. Wir sind mit unserem beeinträchtigten Sohn Max live dabei. Max ist nun schon groß, er kann gehen und darf allein seine Runden drehen. Wir haben ihn im Blick – meistens zumindest. Er freut sich, weil er viele Leute trifft, er stellt seine Fragen und bekommt seine Antworten. Er klatscht in die Hände, juchzt und hüpft von einem Bein auf das andere. Wenn er ein Lied kennt, schreit er vor Freude und singt lauthals mit, er ist voll dabei und mittendrin. Er ist in seinem Element.
Als ich schwanger war, habe ich mir nie ernsthafte Gedanken oder Sorgen gemacht, ein behindertes Kind zur Welt zu bringen. Behinderte Kinder bekommen andere. Doch am 26. Juni 2004 werde ich eine der „anderen“. Ohne Vorwarnung und ohne, dass ich es gleich bemerke. Mein Mann und ich nehmen das Anderssein unseres Sohnes lange nicht wahr, es gibt immer plausible „Ausreden“ und Gründe für seine Schlaffheit, seine vielen Lungenentzündungen, sein starres An-die-Decke-Blicken, sein Nicht-lachen-Wollen, sein Geplapper, das lange Zeit nicht über ein Lautieren hinausging.
Wahrhaben und akzeptieren zu können, dass Max nie „normal“ sein würde, das dauert seine Zeit. Wir bekommen auch nie die eine alles niederschmetternde Diagnose, nein, die Probleme kommen schleichend. Max deckt – nach wie vor – ein breites Feld an Beeinträchtigungen ab. Anfängliche Herausforderungen legen sich und verschwinden fast zur Gänze, neue kommen hinzu, andere bleiben und verändern sich. Wir wachsen in die unterschiedlichsten Aufgaben hinein und wachsen dabei über uns hinaus.
Zu Beginn versuchen wir, den Alltag so normal wie möglich zu gestalten, aber immer mehr und immer öfter stellt sich heraus, dass das so nicht möglich ist. Wir müssen nicht nur Bett, Kasten und Bilder verrücken, um störende zwanghafte Verhaltensweisen umzulenken, wir müssen auch immer mehr unseren Alltag ver-rücken. Um dabei selbst nicht „verrückt“ zu werden, ist Unterstützung in vielerlei Hinsicht nötig – gewollt und geplant. Aber auch ungeplant und unerwartet, von den vielen Max wohlgesonnenen Menschen in unserer Umgebung: Menschen, die Max fordern und fördern. Menschen, die Max so nehmen, wie er ist, die seine Eigenheiten tolerieren, die dafür sorgen, dass er sich trotz seines Andersseins gut entwickeln kann.
Er dankt es uns mit seiner Lebensfreude – Lebensfreude, die ansteckt und die uns immer weitermachen lässt.
EINS
ES BEGINNT
26. Juni 04. Max ist da
34. Schwangerschaftswoche. Vor etwa zwei Wochen sind Michael und ich von Wien in meine Heimatstadt Enns übersiedelt. Wir haben es uns in einem charmanten Häuschen aus den Fünfzigerjahren gemütlich eingerichtet. Sogar Vorhänge habe ich genäht. Nun freue ich mich auf sechs Wochen Ruhe und Erholung. Erholung von den Strapazen der letzten Wochen und Monate.
Doch es kommt anders. Max legt sich quer, im wahrsten Sinne des Wortes. Es bleibt die Hoffnung, dass er sich noch in die richtige Position drehen wird. Immerhin hat er dafür noch sechs Wochen Zeit. Nach einigen Tagen Ruhe setzen die Wehen ein. Im Krankenhaus werden mir wehenhemmende Medikamente verabreicht, dennoch behalten sie mich über das Wochenende auf der Station. „Am Montag dürfen Sie nach Hause“, prognostiziert der Arzt. „Immerhin“, freue ich mich. Allerdings verlieren die Medikamente an Wirkung und bereits am Samstagnachmittag bekomme ich wieder Wehen. Spätabends bei der Kontrolle sind Max’ Herztöne nicht mehr zu hören. „Er schläft“, meint die Schwester und versucht Max zu wecken, indem sie meinen Bauch massiert. Er wird nicht munter. Ein Arzt wird zu Rate gezogen und aufgrund der Querlage des Kindes beschließen sie, einen Notkaiserschnitt durchzuführen. Ich werde nervös, mein einziger Gedanke ist: „Oh mein Gott, in einer halben Stunde bin ich Mama.“ Ich bin doch noch nicht richtig darauf vorbereitet und erholt schon gar nicht. Die Epiduralanästhesie, eine Betäubung des Unterleibs, ist ein schwieriges Unterfangen, da meine Gliedmaßen vor Aufregung völlig unkontrolliert zu zittern beginnen. Doch sie gelingt und, nachdem die Empfindungslosigkeit eingesetzt hat, wird der erste Schnitt gesetzt. Nach langen Minuten höre ich die Stimme des Primars: „Jetzt haben wir die Bauchdecke geöffnet. Bald haben wir es geschafft.“ Weitere lange Minuten später ein Schrei, es ist 23:58 Uhr. Ein graues Bündel wird mir kurz ans Gesicht gehalten, Max ist da. Ich bin Mutter.
27. Juni 04. Neo-Intensivstation
Ich darf noch nicht aufstehen, Michael schiebt mich im Rollstuhl auf die Neo-Intensivstation. Da liegt er, unser Sohn. Natürlich der hübscheste Junge. Und so klein und zart mit seinen 44 cm und nicht ganz zwei Kilogramm. Maxi liegt im warmen Brutkasten, einem Inkubator. Versehen mit ein paar Kabeln zur Überwachung der Herztöne und des Sauerstoffgehalts schläft er ruhig. Der Inkubator wirkt befremdlich, aber Max’ friedlicher Gesichtsausdruck tröstet mich. Es scheint ihm gut zu gehen.
Im Inkubator
Der Primar kommt zu uns: „Ihr Max ist ein starkes Kerlchen. Die Geburt war mit so vielen Komplikationen verbunden, dass es ein Wunder ist, dass er überlebt hat.“ Diese Aussage schockiert uns. Wir wussten nicht, dass es eine lebensgefährliche Situation für Max war. Aber wir sind auch erleichtert und freuen uns. Und wir sind stolz auf unseren tapferen Sohn. Dennoch drängt sich immer wieder die eine oder andere Sorge dazwischen.
29. Juni 04. Nicht erschrecken
Seit Maxis Geburt bin ich im Krankenhaus. Wie jeden Tag begebe ich mich nach dem Frühstück auf die Neo-Intensivstation, um bei Max zu sein. Da ich ihn nicht zu mir nehmen darf, sitze ich stundenlang vor dem Inkubator, stecke meine Hand durch das Loch, um ihm die Hand auf die Brust zu legen. So kann er mich zumindest etwas spüren. Heute begrüßt mich die Krankenschwester mit den Worten: „Erschrecken Sie nicht, Maxi hat eine Magensonde. Das Trinken ist sehr anstrengend für ihn, er muss sich schonen.“ Da wird also die Muttermilch, die ich mit der Milchmaschine absauge, nicht mehr über das Fläschchen, sondern über die Sonde, die im linken Nasenloch steckt, zugeführt. Natürlich hat mich das erschreckt.
Drei Tage später begrüßt mich die Schwester wieder mit einem freundlichen „Erschrecken Sie nicht, Frau Hofer.“ (Wir waren damals noch nicht verheiratet.) Diesmal hat Max zusätzlich eine Augenmaske umgebunden, da er Gelbsucht hat. „Gelbsucht haben viele Kinder“, denke ich nicht weiter beunruhigt. Aufgrund des Weißlichtes darf ich jedoch die Hand nicht in den Inkubator stecken. Ich bin enttäuscht und traurig, da ich Maxi nicht berühren darf. Hilflos setze ich mich vor den Inkubator und betrachte unser Kind. Max wirkt so zerbrechlich. Ich erzähle ihm, was mit ihm los ist. Er soll schließlich Bescheid wissen, warum ich ihn heute nicht berühre. So ein kleines, tapferes Kerlchen. Gegen die aufkommenden Tränen ankämpfend beginne ich, leise ein Lied von Sinéad O’Connor zu singen: „My darling child, my darling baby …“
03. Juli 04. Die erste Lungenentzündung
Es ist 22 Uhr abends. Michael und ich sitzen wie jeden Abend auf der Neo-Intensivstation. Es ist friedlich, die winzigen Frühchen schlafen, man hört nur die Überwachungsgeräte surren und sieht das Blinken auf den Monitoren. Für uns ist heute ein besonderer Tag. Maxis Kabel werden abgesteckt. Wir sind beide aufgeregt. Zum ersten Mal, seit er auf der Welt ist, darf Max aus dem Inkubator. Endlich dürfen wir ihn in den Arm nehmen. Kangarooing nennt man diese Kuscheltherapie, bei der das Baby auf der bloßen Brust von Mama oder Papa Wärme und Liebe tankt. Ich genieße es. Endlich nicht nur die Hand durch das Loch beim Inkubator stecken, einen Platz auf Maxis Brust suchen, den Blick gebannt auf den Monitor gerichtet, hoffend, dass durch die Berührung Puls und Blutdruck sinken und der Sauerstoffgehalt steigt. Endlich Maxi das erste Mal im Arm halten. Was für eine Freude. Wohliges Glück durchströmt meinen Körper. Wie verzaubert sitze ich da und schmiege Max an mich. Die Sorgen sind für kurze Zeit vergessen. Es tut so gut, das kleine Bündel zu spüren.
Ein Arzt betritt die Station und verschwindet hinter der Glaswand des angrenzenden Ärztezimmers. Er sieht uns nicht. Die diensthabende Schwester steht bei uns. Da hören wir ihn plötzlich rufen: „Von wem ist denn dieses schlimme Lungenröntgen?“ Die Schwester springt auf und eilt zu ihm: „Pst, die Eltern sind hier.“ Doch da ist Michael schon aufgesprungen und eilt ebenfalls zu ihm. Maxi hat also auch noch eine schwere Lungenentzündung.
Der Primar erklärt uns am nächsten Tag: „Ihr Sohn kämpft nun zum zweiten Mal um sein Leben.“ Klingt nicht sehr beruhigend. Trotzdem meint er, ich solle mal zuhause schlafen. Sollte sich Maxis Zustand verschlimmern, werden wir angerufen. Schweren Herzens lasse ich Maxi das erste Mal allein im Krankenhaus zurück.
Das Essen, das ich zuhause koche, schmeckt grauenhaft. Wir sitzen auf der Terrasse. Schweigend, jeder in Gedanken bei Maxi. Ich blicke zum Himmel, Wolken ziehen vorüber. Da sehe ich auf einer Wolke unseren Maxi sitzen. Ich erschrecke. Das bedeutet doch … Schnell ändere ich das Bild, setze einen Schutzengel auf die Wolke und bitte ihn, ganz schnell zu Maxi zu sausen und ihm zu helfen.
Muttersein habe ich mir anders vorgestellt.
10. Juli 04. Überstellung mit Blaulicht
Der Ductus arteriosus ist ein kleines Gefäß, das beim ungeborenen Baby die Aorta mit der Lungenschlagader verbindet. Dieses verschließt sich normalerweise nach der Geburt. Nicht so bei Max.
Trotz medikamentöser Behandlung stellt sich die erhoffte Schließung nicht ein. Beim Gespräch erklärt uns der Arzt, dass Max’ Ductus deshalb operativ geschlossen werden muss. Dazu müssen wir in die Kinderklinik überstellt werden. Es geht alles schnell. Ich packe unsere Sachen. Max kommt in einen Transport-Inkubator. Wir warten auf ein Rettungsauto, das genügend Sauerstoff für unseren Maxi hat. Endlich geht es los, das Blaulicht wird eingeschaltet. Über Funk wird eine Polizei-Eskorte angefordert. Schon bald gesellt sich ein Polizeiauto zu uns. Es fährt voran, wir hinterher. Fortan düsen wir über alle Kreuzungen, auch bei roter Ampel. In nur dreißig Minuten sind wir in der Kinderklinik. Ich finde das aufregend.
13. Juli 04. Operationen
Mit nicht einmal drei Wochen hat Maxi seine erste herznahe Operation. Der Ductus arteriosus wird erfolgreich geschlossen. Wir atmen auf, als wir hören, dass alles gut gegangen ist. Maxi liegt in seinem Inkubator auf der Neo-Intensivstation der Kinderklinik, diesmal an noch viel mehr Kabel und Schläuche angehängt. Unsere Blicke hängen am Monitor. Dort beobachten wir Maxis Werte: Puls, Blutdruck, Sauerstoffgehalt. Der Blutdruck zeigt beängstigend hohe Werte. Das kann nicht gesund sein.
Beim Gespräch mit dem Chirurgen klärt uns dieser auf: Es tut ihm leid, aber Maxi hat eine hochgradige Aortenisthmusstenose, eine Einengung der Aorta. Er hatte es schon vermutet, konnte aber während der Ductus-Operation die Verengung nicht ausfindig machen, da diese an einer unüblichen Stelle liegt. Ist das Unübliche schon typisch für Max?
Max muss erneut operiert werden. So wird das kleine Kerlchen nur drei Tage später an derselben Stelle wieder aufgeschnitten. Die Herz-Lungen-Maschine steht bereit. Max benötigt drei Blutkonserven. Das enge Stück der Aorta wird erfolgreich entfernt. Und wieder atmen wir auf.
21. Juli 04. Intubiert
Maxi ist bereits seit sieben Tagen intubiert und sediert. Ich bin immer bei ihm, von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Zwischendurch gehe ich nur Muttermilch abpumpen oder in die Kantine essen. Michael kommt jeden Tag nach der Arbeit ins Krankenhaus. Und das seit vier Wochen. Draußen ist Sommer, es ist brütend heiß, auf der Neo-Intensiv auch. Hier bei den Frühchen gibt es keine Klimaanlage, zu groß ist die Gefahr der Verbreitung von Keimen.
22. Juli 04. Extubiert
Es ist 8:30 Uhr, kurz vor der Visite. Ich sitze an Maxis Krankenbettchen, bahne mir einen Weg durch die achtzehn Kabel und Schläuche, an die er angeschlossen ist. Das ist fast unmöglich bei so einem kleinen Körper. Die einzige Möglichkeit ihm zu helfen ist, da zu sein und versuchen ihn zu berühren. Geschafft, ich finde Platz für meine große Hand. Zum tausendsten Mal summe ich das Lied My Darling Child. Da sehe ich, wie Maxi zu weinen beginnt. Ein stilles Weinen, ein schrecklich stilles Weinen. Intubierte Personen haben keine Stimme. Ich bin verzweifelt und überlege, eine Schwester zu rufen. Da bewegt Maxi sein dünnes kleines Händchen zum Mund, schnappt sich mit seinen winzigen Fingerchen den Intubationsschlauch und extubiert sich. Ich erschrecke und rufe nach einem Arzt. Eine Schwester eilt herbei. Ein Blick auf den Monitor zeigt, dass Maxi selbstständig atmet. Sie beruhigt mich und sagt: „Es gibt Kinder, die wissen, wann es Zeit ist, die Intubation zu beenden.“ Unser Maxi ist einer davon. Ich bin glücklich und stolz. So einen gescheiten Buben haben wir also. Und eine Kämpfernatur.
Da wir Maxi jeden Tag erzählen, was mit ihm los ist und was mit ihm gemacht wird, war es damals nicht leicht für uns, ihm von seiner bevorstehenden zweiten Operation zu erzählen. Aber heute ist es gut. Er hat sich den ersten Schlauch gezupft und es ist beglückend, ihm mitteilen zu können, dass es von nun an bergauf gehen würde. Schritt für Schritt wird er von seinen Schläuchen und Kabeln befreit.
31. Juli 04. Endlich zuhause
Nach fünf langen und bangen Wochen dürfen wir nach Hause. In einer Woche wäre sein ursprünglicher Geburtstermin. Wie anders ist doch alles gekommen. Maxi hat fast sein Geburtsgewicht erreicht. Endlich können wir unsere Willkommenskarten verschicken. Statt des üblichen „Hallo, hier bin ich“ gibt es Karten mit „Endlich zuhause! Danke fürs Daumendrücken.“
August 04. Wieder etwas geschafft
Geschafft! Nach acht Wochen Muttermilch-Abpumpen und Fläschchen-Geben wird Maxi nun voll gestillt. Es gibt kein mehrmaliges nächtliches Abpumpen mehr. Ich muss danach nicht mehr in die Küche hinunterlaufen, das Fläschchen richten und Max zu trinken geben, zwei Stunden schlafen und das Ganze wieder von vorne beginnen. Es ist vorbei! Ich bin keine Melkkuh mehr. Nein, ich fühle mich wie eine richtige Mutter. Ich freue mich, denn die Krankenschwestern meinten ursprünglich, dass Kinder, die den Sauger gewohnt sind, sich gar nicht aufs Stillen einlassen. Unser besonderer Maxi hat jedoch auch das geschafft. Wie wunderbar. Wir sind frei!
September 04. Noch eine Befreiung
„Piep, piep, piep“, so geht es Nacht für Nacht. Nach drei Monaten dürfen wir Maxi nachtsüber endlich vom Apnoe(Atemstillstand)-Überwachungsgerät befreien. Die Auswertung ergibt, dass die vierzig Alarme, derentwegen wir geweckt wurden und aufstehen mussten, nur Fehlalarme waren, keine Apnoen. Aus diesem Grund ist keine Überwachung mehr notwendig. Nun wird sich unser Alltag und unsere „Allnacht“ immer mehr normalisieren. Wir sind optimistisch.
ZWEI
ERSTE ANZEICHEN
Oktober 04. Erste Therapie
„Wozu eine Therapie und warum jetzt schon?“, frage ich verständnislos. Maxi ist doch erst drei Monate alt und noch so klein. Er hatte einen schweren Start, zwei herznahe Operationen und musste unzählige Untersuchungen über sich ergehen lassen. Jetzt muss er sich doch erst einmal erholen.
Eine Physiotherapie, nur weil er etwas schlaff ist? Hypoton, wie es in der Fachsprache heißt. Ich erkenne keinen Sinn darin. Und so lege ich mir jede zweite Woche eine Ausrede zurecht, damit ich nicht ins Krankenhaus zur Therapie fahren muss. Überhaupt denke ich eher an einen „Zehnerblock“. Ich ahne noch nicht, dass es anstelle des Zehnerblocks eine monatelange, jahrelange, ja lebenslange Therapie werden wird.
November 04. Offene Augen
Max hat bereits seine zweite Lungenentzündung. Wir sind wieder einmal stationär im Krankenhaus. Er schläft. Die Ärztin kommt herein und fragt mich laut, wie es Max gehe. Ich antworte: „Pst, bitte nicht so laut. Er schläft.“, „Er hat doch die Augen offen.“ Wenn Max zu erschöpft ist, ist er sogar zu schwach, die Augen zu schließen. Dann schläft er mit offenen Augen, was sehr beängstigend aussieht. Manchmal schließe ich seine Augen, was sich noch eigenartiger anfühlt.
Dezember 04. Kein Kuscheln
Max lacht nicht und er kuschelt nicht. So gerne würde ich ihn im Arm halten und mit ihm schmusen. Er mag nicht und zeigt das, in dem er sich so sehr überstreckt, dass es mir nicht mehr möglich ist, ihn im Arm zu halten. Enttäuscht lege ich ihn zurück ins Gitterbett. Dort liegt er dann am Rücken, die Hände über dem Gesicht, sich hin und her schaukelnd. Ich weiß noch nichts über stereotype und repetitive Verhaltensweisen, noch nichts über erste Anzeichen einer autistischen Spektrum-Störung. Ich nehme es persönlich, bin beleidigt, noch mehr, ich bin traurig. Ich setze es mir zur Aufgabe, ihn einmal am Tag zum Lachen zu bringen. Das ist gar nicht zum Lachen, so mühsam ist es.
Max hält in den ersten Monaten Augenkontakt, er blickt mit seinem großen braunen Auge und seinem aufgrund seiner Ptosis (Lidmuskelschwäche, Hängelid) etwas kleineren braunen Auge tief in unsere Augen. Ohne Lachen, ohne Mimik, ernst durchbohrt er uns mit seinem Blick. Er blickt in unsere Seelen. Oft fühle ich mich ertappt. Er vermittelt mir den Eindruck: „Ich weiß alles, du kannst mir nichts vormachen.“
Ich habe das Gefühl, Max’ Gehirn war zuerst eine graue leblose Masse. Erst mit der Zeit werden einzelne Neuronen aktiviert und Synapsen gebildet. In dieser noch eher inaktiven Zeit kann Max den Blickkontakt halten. Je mehr Gehirnzellen aktiviert werden, umso mehr bekommt er von der Umwelt mit. Je mehr er mitbekommt, desto gestresster wird Max. Viel zu viele Eindrücke für ein Gehirn, von dem wir noch gar nicht wissen, dass es autistisch tickt. Wir freuen uns, je mehr er wahrnimmt. Aber wir bemerken auch, dass er zwanghafte Verhaltensweisen entwickelt, der Blickkontakt verschwindet.
Jänner 05. Kräutertinkturen und Sitzhilfen
Das Überstrecken seines Körpers hört nach einigen Cranio-Sacral-Sitzungen fast gänzlich auf. Den hängenden Kopf mit Schiefhals bekommen wir mit der Atlastherapie, die sich die besonderen biologischen Gegebenheiten des ersten Halswirbels (Atlas) zunutze macht, gut in den Griff. Die Zähne, die partout nicht rauswollen, schießen nach Einnahme spezieller chinesischer Kräuter nur so aus dem Zahnfleisch. Dem permanenten Kopfschwitzen mit nassen Haaren werden wir mittels einer speziellen TCM-Kräutertinktur Herr. Es geht etwas weiter. Maxi ist sehr brav im Einnehmen dieser bitteren Granulate. Da ist er tatsächlich einmal unkompliziert.
Das hängende Augenlid müssen wir jahrelang stundenweise abkleben. Ein schwieriges Unterfangen, da Max das Augenpflaster gerne herunterreißt. Alle drei Monate müssen wir in die Sehschule zur Überprüfung seines Sehvermögens. In den ersten Lebenswochen waren sich die Ärzte gar nicht sicher, ob er überhaupt sehen konnte, da er nur ausdruckslos ins Leere starrte. Aber diese Sorge bestätigt sich zum Glück nicht. Genauso wenig wie ein Hydrocephalus (Wasserkopf). Max hat einen überdurchschnittlich großen Kopf im Verhältnis zu seinem schmalen zarten Körper. Aber auch hier ergibt die Untersuchung einen unauffälligen Befund.
Nach einigen Monaten und nachdem ich keinen Zehnerblock Physiotherapie bekommen habe, habe ich verstanden. Diese Therapie wird länger dauern. Ich bemerke, dass ihm die Physiotherapie guttut, beende meine Ausreden und fahre von nun an regelmäßig einmal in der Woche ins Krankenhaus zur Therapie. Drei Jahre lang, bis Max in den Kindergarten kommt. Unsere Physiotherapeutin ist eine sehr sympathische und erfahrene Person. Dennoch bringt Max sie zur Verzweiflung, weil er partout nicht auf dem Bauch liegen möchte. So etwas hat sie in all den Jahrzehnten nicht erlebt. Er verweigert dies konsequent. Wir mutmaßen, dass es etwas mit den Operationen zu tun haben könnte. Oder aber auch, dass er zu schwach sei, seinen großen Kopf am Bauch liegend anzuheben. Dennoch mache ich mir keine Sorgen: Max wird schon alles aufholen, er ist ja noch so jung und klein und zart und schwach.
Die Sitzhilfe ermöglicht Max, eine aufrechte Position einzunehmen
Wir bekommen unser erstes sperriges Therapiegerät, eine Sitzhilfe, damit Max die aufrechte Position kennenlernt. Er genießt es, mit uns am Tisch sitzen zu können.
Wegen seines Hängelids und der Unklarheit, wie gut Max’ Sehvermögen ist, bekommen wir eine Sehfrühförderin zugeteilt. Sie vermittelt uns mit feinfühligem Humor die schlimmsten Prognosen und wird zu einer wichtigen Begleiterin für Max und auch für mich.
Alle sechs Monate müssen wir zur Kontrolle in die Herzambulanz und in die Neonatologie zur Entwicklungsdiagnostik. In der Orthopädie-Ambulanz werden die Skoliose (Verkrümmung) der Wirbelsäule und die nicht ausreichend überdachten Hüften regelmäßig kontrolliert. Zudem stehen Termine beim Bandagisten am Programm: Die orthopädischen Fußprothesen (Orthesen) und der Hüftgurt müssen halbjährlich adaptiert werden.
Wir haben jährlich an die fünfunddreißig Termine, zusätzlich zu den unzähligen Therapiestunden. Langeweile kommt nicht auf.
Februar 05. Schuppen fallen von den Augen
Eine Freundin überredet mich zum Babyschwimmen. Maxi ist acht Monate alt. Wir beginnen mit der Vorstellrunde: Ringsherum dicke Wonnebrocken, gerade mal drei Monate alt, vor Freude quietschend, mit Michelin-Beinchen und -Ärmchen zappelnd oder am Bauch liegend, den Kopf freudig in die Höhe hebend. Daneben Maxi, am Rücken liegend. Er kann sich weder aufsetzen noch den Kopf halten. Er lacht nicht, er zappelt nicht, er überstreckt sich.
Da fällt es mir wie Schuppen von den Augen: Max wird seine Entwicklungsverzögerung nicht so schnell aufholen. Wo habe ich nur hingesehen? Ich, die von sich geglaubt hat, stets den Tatsachen in die Augen zu blicken, habe das nie richtig wahrgenommen. Waren das die Glückshormone, die beim Stillen ausgeschüttet werden und mich glauben ließen, Maxi würde bald aufholen? Er ist so etwas von weit entfernt von „normal“ entwickelt. Mir wird heiß und übel. Es geht ins Wasser. Welche Freude für die Babys und deren Mütter, welche Qual für uns. Maxi kann seinen Kopf nicht halten, immer wieder platscht er ins Wasser. Er tut mir so leid, es gibt mir einen Stich ins Herz. Ich drehe mich weg von den andern, denn ich kann die Tränen nicht zurückhalten und tauche selbst unter, um die Tränen zu verbergen. Ich drücke Maxi fest an mich und möchte nach Hause.
März 05. Und immer wieder Schleim
Es ist Winter. Ein strenger und langer Winter. In unserem charmanten Häuschen haben wir in der Früh uncharmante dreizehn Grad in der Küche. Morgens steht Michael eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Aufstehen auf, um den Heizstrahler im Bad einzuschalten. Es soll dort zumindest zwölf Grad haben, wenn wir uns duschen. Wir lieben dieses Haus, aber es ist im Winter nicht unbedingt der ideale Ort für ein Kind, das im ersten Lebensjahr drei Lungenentzündungen bekommt.
Max hat wieder einmal obstruktive Bronchitis. Er ist sehr verschleimt und versucht mehrmals täglich, diesen Schleim zu erbrechen. Der Schleim ist zäh. Er würgt und würgt, hat Brechreiz – den er im Laufe seines Lebens noch oft absichtlich herbeiführen wird –, bekommt keine Luft, wird blau. Verzweifelt hebe ich ihn an den Füßen hoch. Eine Krankenschwester hat mir das beigebracht. Es funktioniert. Max bekommt wieder Luft. Trotz Inhalierens und der Medikamente wird die Bronchitis nicht besser, die Atmung wird flacher. Mitten in der Nacht brechen wir auf ins Krankenhaus, da Max kaum mehr atmet. Begrüßt werden wir mit den Worten: „Na, der sieht aber nicht mehr gut aus.“ Wie aufbauend. Noch auf dem Weg ins Krankenzimmer wird bei Max Sauerstoff gelegt und seine Nase abgesaugt. Er hat wieder eine Lungenentzündung, bekommt wieder Cortison und Antibiotika. Wir müssen zehn Tage bleiben, liegen auf der Überwachungsstation. Alle zwei Stunden muss ich mit ihm inhalieren, auch nachts.
April 05. Geheime Mission
Im Krankenhaus lese ich die Beschreibung des blutdrucksenkenden Medikaments, welches Max seit seiner ersten herznahen Operation nehmen muss. Und da erfahre ich, dass eine häufige Nebenwirkung Husten ist, eine seltene Nebenwirkung Lungenentzündung. Deshalb frage ich den Arzt im Krankenhaus, ob wir dieses Medikament nicht absetzen können, da es eventuell mit verursachend für die bereits dritte Lungenentzündung ist. Zudem wurde die enge Aortenstelle, die den hohen Blutdruck ausgelöst hat, entfernt. Wahrscheinlich benötigt er das Medikament gar nicht mehr, mutmaße ich. Er aber meint, dies müsse ich mit dem Arzt besprechen, der das Medikament verschrieben hat. Ich bitte ihn, es doch zu versuchen, da Max auf der Überwachungsstation liegt und seine Blutdruckwerte ohnehin permanent kontrolliert werden. Da mir das verwehrt wird, beschließe ich es heimlich abzusetzen.
Aufgeregt kontrolliere ich den Überwachungsmonitor. Seine Blutdruckwerte bleiben stabil. Bei der Schlussbesprechung gestehe ich, das Medikament nicht mehr gegeben zu haben. Daraufhin wird Max nochmals eingehend untersucht. Und mir wird ärztlich bescheinigt, dass Max das Medikament nicht mehr nehmen muss. Ich freue mich. Von da an wird es mit seiner Bronchitis viel besser. Seine vierte Lungenentzündung bekommt Max erst mit vier Jahren.
Juni 05. Ewiger Singsang
Max ist ein Jahr alt. Er ist nach wie vor sehr hypoton, das heißt, fast ohne Muskelspannung. Deshalb kann er sich nicht aufrecht halten. Nicht einmal sitzen schafft er, er kippt sofort zur Seite. Da meint die Physiotherapeutin, dass Max sehr lange brauchen werde, bis er gehen könne. Mindestens bis er drei Jahre alt sei. Ich kann das dennoch nicht glauben. Max macht doch gute, wenn auch winzige Fortschritte. Er wird das schon schaffen, bleibe ich optimistisch.
Max ist sehr kooperativ bei den Therapien, wenngleich es vieler Motivation bedarf, damit er etwas länger bei den einzelnen Übungen durchhält. Uns fällt auf, dass ihm Singen gefällt und ihn motiviert. Also beginne ich, während der Physiotherapie zu singen. Es ist keine musikalische Glanzleistung, aber für Max reicht es. Ich kaufe ein Buch mit Kinderliedern und so beginnt unsere musikalische Laufbahn. Singen begleitet uns fortan durch den Tag, durch die Woche, das Monat, das Jahr. Wir singen uns quer durch fast alle Genres. Max entwickelt ein sensationelles Gehör. Schon bald erkennt er Lieder nach nur zwei Noten. Noten, nicht Takten. Eifrig summt und lautiert er mit.
Juli 05. Resümee erstes Jahr
Wir waren an hundert Tagen im Krankenhaus, entweder ambulant mit Untersuchungen, Kontrollen und Therapien oder stationär wegen Operationen und Lungenentzündungen.
Mein Plan von einem gemütlichen ersten Jahr mit meinem ersten Kind ist nicht so richtig aufgegangen.
DREI
THERAPIEN ÜBER THERAPIEN
Oktober 05. Rundherum, das ist nicht schwer
Wir übersiedeln in unser eigenes warmes Haus. Max kann nun viel am Boden liegen, ohne dass wir Angst haben müssen, dass er sich verkühlen wird.
„Einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer.“ Tausendmal mit Max gesungen. Er liegt, wie immer, am Rücken und bei „rundherum“ drehe ich ihn einmal um seine eigene Achse. Mit der Zeit entwickelt Max daraus seine erste Art und Weise sich fortzubewegen, seitwärts rollend. Mit eineinhalb Jahren kann er sich bereits einige Meter weit um die eigene Achse rollen.
Ein paar Monate später ist ihm das zu mühsam. Max entdeckt, dass es doch wesentlich weniger kräfteraubend ist, sich am Rücken liegend fortzubewegen, indem man sich mit den Beinen abstößt. So schiebt er sich am Boden entlang. Er entwickelt dabei ein unglaubliches Geschick. Wir kommen nicht dahinter, wo seine Sensoren eingebaut sind. Er stößt sich kein einziges Mal an einer Kante oder Ecke, an einer offenen Tür oder einem herumstehenden Ding. Er weicht, sich wie eine Schlange schlängelnd, geschickt jedem Hindernis aus, ohne dass er es zuvor gesehen hat. Er schiebt sich ja rücklings vorwärts.





























