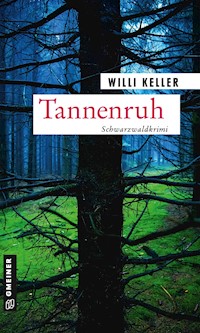Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Berger und Tamara Bieger
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
»Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen!« Alles beginnt mit leblosen Körpern im Offenburger Gifizsee sowie geheimnisvollen Zeichen, Buchstaben und Zahlen. Nur eine Warnung gegen Sittenverfall? Ein junger Kommissar vermutet mehr und ermittelt auf eigene Faust. Als er tot aufgefunden wird, nehmen Kriminalhauptkommissar Berger und seine Kollegin Tammy in der »Soko Gifiz« die Ermittlungen auf. Die Ermittler werden zunächst in die Irre geführt. Doch dann entdeckt Berger beängstigende Zusammenhänge …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 411
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Willi Keller
Irrglaube
SCHWARZWALDKRIMI
Zum Buch
Im Namen des GlaubensDreimal erhält Kriminalhauptkommissar Berger die Meldung, auf dem Gifizsee treibe ein lebloser Körper. In allen drei Fällen handelt es sich jedoch um eine nackte Puppe mit Hinweisen auf Bibelzitate. Nur eine Warnung gegen Sittenverfall? Ein junger Kommissar vermutet mehr und ermittelt auf eigene Faust. Als er tot aufgefunden wird, nehmen Berger und seine Kollegin Tammy in der »Soko Gifiz« die Ermittlungen auf. Nach einem Anschlag in Offenburg ist klar: Hier sind keine Moralapostel, sondern gefährliche Terroristen am Werk – die Bundesanwaltschaft schaltet sich ein. In der undurchsichtigen Welt des Darknets stoßen Berger und Tammy auf die Spuren einer bundesweit vernetzten Gruppe religiöser Fanatiker. Berger und seine Kollegen sind geschockt: Der Fundamentalismus, mit dem sie es zu tun haben, hat seine Wurzeln in ihrem eigenen Glauben, dem Christentum. Und die Keimzelle liegt in ihrer Heimat: in Offenburg.
Willi Keller – Autor und ehemaliger Nachrichtenredakteur des SWR – sammelt Sagen, die er seit den 1980er-Jahren in mehreren Büchern veröffentlicht hat. Er liebt das Erzählen, die Fantasie und die Ortenau. Mit »Irrglaube« legt er seinen ersten Roman vor. Darin zeigt er, dass er nicht nur nacherzählen, sondern selbst spannende Geschichten und lebendige Figuren erfinden kann. Mit besonderem Geschick und gut recherchierten Details verknüpft er aktuelle politische Themen mit Lokalkolorit der Ortenau. Damit erfüllt dieser Roman (fast) alle Voraussetzungen, selbst zur Sage zu werden …
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Christine Braun
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Norwin Gartner und Lutz Eberle
ISBN 978-3-8392-5632-9
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
A
Auftakt des täglichen Bibelstudiums war meist ein kurzer Text aus dem Johannesevangelium. An diesem besonderen Tag wählte er die »klassischen« Sätze:
»Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ward durch dasselbe, und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist.«
Er liebte diese liedhafte Strophe aus dem Johannesevangelium über alles. Sie leitete das Evangelium ein und pries die Stärke des Wortes. In jedem Wort war Gott. Das spürte er sofort, wenn er die Bibel aufschlug und ihre Wörter und Sätze in sich aufnahm. Ein heiliger Akt! Die Bibel war eine Quelle der Kraft für ihn. Aus ihr sprach Gott zu ihm. Gott irrte nicht. Er war frei von Fehlern und Täuschungen.
Vor ihm lagen zwei Bibelübersetzungen. Beide waren in schwarzes Leder eingebunden und hatten einen Goldschnitt. Die Elberfelder Bibel in der Bearbeitung aus dem Jahr 1905 lag ihm eher als die Lutherbibel, weil sie textgetreuer war. Von Anfang an richtete sie sich an den aramäischen, griechischen und hebräischen Urtexten aus. Sie war nicht zu verwechseln in ihrer Ursprünglichkeit. Mit Recht verwiesen die Übersetzer auf diesen Aspekt. Es fiel ihm nicht immer leicht, die Elberfelder Bibel zu lesen, weil ihre Texte nicht so geglättet waren. Wörtlichkeit und Genauigkeit gingen vor Schönheit. Aber beim Lesen in ihr erfuhr er stärker das Wort Gottes als in der Lutherbibel. Und er holte aus ihr mehr Kraft als aus den anderen Übersetzungen. Das war ihm schon früh aufgefallen. Gerade jetzt brauchte er die Kraft des Wortes. Im Regal standen Dutzende weitere Bibeln, ältere und neuere Übersetzungen. Darunter auch die neue katholische Bibel. Die evangelische und die katholische Kirche beanspruchten für sich, mit ihren Textrevisionen wieder dem Ursprung nahe zu sein. Es änderte nichts an seiner Einstellung. Am meisten Energie schöpfte er aus der alten Elberfelder Bibel. Sie hielt sich am meisten von allen zurück mit modernen Kommentierungen und Übersetzungen.
Interpretationen lehnte er grundsätzlich ab. Er hasste Kommentare und moderne Bibelauslegungen. Erklärungen akzeptierte er nur bis zu einem gewissen Grad. Die Exegeten der Jetztzeit zerstörten die Grundlage der Bibel. Sie nahmen ihr das Mystische, das Geheimnisvolle, das Göttliche. Sie vermenschlichten Jesus, indem sie seine vielen Wunder infrage stellten oder interpretierten. So entkräfteten sie ihn und machten aus ihm einen bloßen Wanderprediger. Mit ihrer historischen Bibelkritik und ihrer Skepsis entzogen sie dem Christentum die Grundlage. Die Exegeten ließen mehr den Zeitgeist zu Wort kommen als Gott und seinen Sohn. Mit falscher und liberaler Bibelauslegung richteten sie großen Schaden an. Sie beschmutzten das größte Werk der Menschheitsgeschichte. Gottes Wort war so einzigartig, dass man es nicht kommentieren oder interpretieren musste. Es machte ihn wütend und zornig, wenn er an die Entwicklung der Theologie dachte. Die modernen Theologen, die heutigen Bibelausleger waren keine Fackelträger des Christentums. Sie löschten das Licht, sie traten das Feuer aus, sie verbündeten sich mit dem Teufel. Wie oft hatte er mit den »Erneuerern« der Bibel gefochten, wie viel Demütigung hatte er ertragen müssen! Einmal hatte er Exegeten Sätze aus dem Johannesevangelium entgegengeschleudert. »Jesus sprach nun zu den Juden, welche ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Worte bleibet, so seid ihr wahrhaft meine Jünger; und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.« Das Zitat hatte seine Wirkung nicht verfehlt. Verblüfft hatten die Exegeten geschwiegen. Und als sie die entsprechende Stelle in der Bibel aufgeschlagen hatten, mussten sie erkennen, dass sie nichts entgegensetzen konnten. Betreten hatten sie eingesehen, welchem Missverständnis sie mit ihrer Interpretation aufgesessen waren. Die Schande der liberalen Exegese musste getilgt werden! Und die Glut des wahren Glaubens wieder angefacht! Jedes Mal, wenn er an diese Auseinandersetzungen zurückdachte, geriet er in Rage. Er hielt inne, um sich zu beruhigen. Wutausbrüche halfen ihm in dieser so wichtigen Stunde nicht.
Er hatte alles vorbereitet. »Gib mir Kraft, Herr!«, sprach er laut. Nur die eine Taste musste er noch drücken, um den Auftrag zu versenden. Er saß unbeweglich da, wie erstarrt. Was hielt ihn zurück? Seltsam, es gelang ihm nicht, mit dem rechten Zeigefinger das entscheidende Signal zu geben.
Er erinnerte sich, wie alles vor längerer Zeit begonnen hatte. Nach einem vertieften Studium der Offenbarung des Johannes hatte er eine Vision gehabt. Er sah diesen See vor sich. Ruhig lag das Gewässer in einem Morgenlicht, das er nicht beschreiben konnte. Bedeutete es Voraussehung, Aufbruch, Umbruch, Gutes oder Böses? Dünne Schleierwolken zogen vorbei. Er saß auf der obersten Reihe des Amphitheaters. Die Schleierwolken dehnten sich aus und wechselten die Farbe, bis der ganze Himmel bedeckt war mit einem dunklen Teppich. Ein starker Sonnenstrahl durchbrach die himmlische Finsternis und traf mit voller Wucht den See. Plötzlich wallte er auf und fing an zu brodeln wie kochendes Wasser. Und aus dem dampfenden See schossen nacheinander die vier apokalyptischen Reiter empor, wie dem Holzschnitt Albrecht Dürers entsprungen, jeder mit einer Waffe in der Hand. Es gab jedes Mal ein starkes Sauggeräusch, wenn ein Reiter aus dem See auftauchte. Der erste Reiter ritt auf einem weißen Pferd und hielt einen Bogen, der zweite auf einem feuerroten Pferd und war bewaffnet mit einem Schwert. Der dritte Reiter mit seinem schwarzen Pferd wich ab vom Bild Dürers und der Bibel, wie er es kannte. Er hatte keine Waage in der Hand, das Symbol für Teuerung und Hungersnot, sondern schwang eine Lanze. Und der vierte Reiter entsprach auch nicht der üblichen Vorstellung. Er saß zwar auf einem fahlen Ross, hatte aber eine große Schleuder statt eines Dreizacks bei sich. In einem weiteren Punkt unterschied sich das Verhalten der Reiter aus dem See von dem in Dürers Bild. Jeder Reiter verließ den See in eine andere Himmelsrichtung. Nach kurzer Zeit beruhigte sich der See wieder und strahlte eine Ruhe aus, als wäre nichts geschehen. Das Morgenlicht glänzte golden und spiegelte sich im Wasser. Für ihn waren die apokalyptischen Reiter aus dem See ein Aufgalopp, das Zeichen, dass die Zeit gekommen war, die Hure Babylon, die gottesfeindliche Macht, zu zerstören. Er hatte einen göttlichen Auftrag bekommen.
Die Vision von den Reitern im See hatte ihn stark mitgenommen, so wie keine vor ihr. Sie hatte seinen ganzen Körper beben lassen. Er war schon mehrfach von Visionen heimgesucht worden, im wachen Zustand und im Traum. Die im wachen Zustand forderten alles von ihm. Sie raubten ihm stunden- und oft auch tagelang die Kraft. Wenn diese Phase vorüber war, durchströmte erstaunlicherweise neue, stärkere Energie seinen Körper und seinen Geist. Nachdem er sich erholt hatte, erzählte er dem ersten Jünger von seinem Erlebnis mit den apokalyptischen Reitern. Niemandem sonst hatte er verraten, was er gesehen hatte. Sie müssten sich von jetzt an auf die Zukunft vorbereiten, vertraute er dem ersten Jünger an. Der erste Jünger schaute ihn verblüfft an, fast ungläubig. Er baute sich vor seinem Lieblingsjünger auf und sah ihm fest und lange in die Augen. Es wirkte wie ein Kräftemessen. Nach einer Weile sagte der erste Jünger, er werde ihm bedingungslos folgen. Seine Worte hatten wie ein heiliges Versprechen geklungen. Seither richteten sie ihre Kraft auf ihren großen Plan, auf ihren göttlichen Auftrag.
Aber wo versteckte sich jetzt diese Kraft, die er so nötig hatte? Warum fing er an zu zögern? Sie waren sich doch so sicher in ihrem Vorhaben, so fest in ihrem Glauben. Natürlich wussten sie, dass sie alle Brücken abbrachen. Aber das wollten sie. Die Entscheidung war getroffen. Alles hing von ihm ab. Ihm hatten sie es übertragen, das Zeichen zu setzen. Er musste den Posaunenstoß geben, der die Mauern einstürzen lassen und alles verändern würde.
»Und ich sah die sieben Engel, welche vor Gott stehen; und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er hatte ein goldenes Räucherfaß; und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, auf daß er Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Throne ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räucherfaß und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde; und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, bereiteten sich, auf daß sie posaunten.«
Die Worte aus der Offenbarung des Johannes rauschten durch seinen Kopf. Er versuchte noch einmal Kraft zu sammeln. So sehr er sich auch anstrengte, die Kraft wollte nicht kommen. Etwas anderes begann sich zu sammeln. Wie Nager tauchten Zweifel auf und begannen an ihm zu fressen. Konnte er sich auf alle verlassen? Fand der erste Jünger nicht immer Widerworte? Wollte er ihm, dem Meister, wirklich folgen, wie er es nach der Vision so felsenfest versichert hatte? In letzter Zeit gingen ihre Meinungen oft auseinander. Der erste Jünger war sein ältester Weggefährte. Mit ihm teilte er Freude und Leid. Und mit ihm teilte er ein dunkles Geheimnis, das sie zusammenschweißte. Blieb er ihm auf Dauer treu? Oder verriet er ihn eines Tages? Manchmal glaubte er, entsprechende Äußerungen des ersten Jüngers gehört zu haben, die auf einen kommenden Bruch hindeuteten. In letzter Zeit konnte er die Widerworte des ersten Jüngers nicht mehr so gut verkraften. Und die anderen Jünger? Konnte er sich ihrer absolut sicher sein? Verstanden sie seine Lehre? Strebten auch sie jedes seiner Ziele an? Er hatte eigentlich nicht zu klagen. Warum wurde er dann plötzlich so von Zweifeln geplagt? Das war die große Frage. Er, der immer Stärke und Festigkeit im Glauben vermittelte, durfte keine Schwäche zeigen. Andererseits gehörte zum Glauben der Zweifel. Diese Dichotomie, diese Gegensätzlichkeit von Glauben und Zweifel, die sich ergänzte, stärkte ihn letztlich. Hatte nicht Jesus, hatte nicht jeder große Kirchenlehrer diese Momente der Zerrissenheit durchmachen müssen? In dieser Gewissheit faltete er seine Hände zum Gebet. Fest drückte er sie zusammen und hoffte auf göttliche Energieströme für diesen wichtigen Schritt.
Feine Schweißperlen drangen durch die Handflächen. Er rieb die Hände an seiner schwarzen Kutte trocken. Aber sofort bildete sich ein neuer feuchter Film. Ein zweites Mal trocknete er die Hände an der Kutte ab. Nach wenigen Augenblicken fühlten sie sich wieder schwitzig an. Verzweifelt drückte er die nassen Hände an die Kutte. Unruhe stieg in ihm auf. Das Herz klopfte plötzlich so stark, als wollte es aus seinem Körper springen. Sein Puls beschleunigte sich. Und eine schwarze Macht drückte sich in seinen Hals und machte ihn enger. Er musste etwas tun, bevor er nicht mehr denken und handeln konnte. Die Angst, die er schon kommen sah, durfte nicht ihre Krallen in ihn schlagen. Es ging um Sekunden. Schnell stand er auf, schlüpfte aus der schwarzen Kutte und rannte nackt in seinen Altarraum. Er holte ein Buchenscheit aus dem alten Holzregal mit den vielen Bibelübersetzungen und legte es vor den Altar. Von der Wand riss er seinen schwarzen Rosenkranz. Mit den Knien ließ er sich auf das Buchenscheit fallen. Ein starker Schmerz stach durch seinen Körper und trieb ihm Tränen in die Augen. Bebend machte er das Zeichen des Kreuzes und fing an, den Rosenkranz zu beten. »Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.« Er sprach das Glaubensbekenntnis. Nein, er schrie es. Er berührte die große Perle über dem Kreuz und begann mit dem Vaterunser. Perle für Perle strömten die Gebete aus seinem Mund. Das anfängliche Schreien verflachte. Er kam in einen Rhythmus, der ihm allmählich die Unruhe nahm. Seine Hände wurden trockener. Nach Perle 30 pochte das Herz wieder regelmäßiger, der Puls verlangsamte sich. Er verfiel in seinen üblichen Singsang beim lauten Beten des Rosenkranzes. Als er alle 59 Perlen berührte hatte, stemmte er sich vorsichtig am Altar hoch. Die Knie schmerzten noch. Er sah auf die tiefen Spuren, die das Holzscheit hinterlassen hatte. Vorsichtig bückte er sich und hob es auf. Langsam strich er über die scharfe Kante, die den starken, nachhaltigen Schmerz verursacht hatte. Sie hatte die schwarze Macht ein weiteres Mal aus seinem Körper verbannt. Er legte das Holzscheit zurück in das Regal.
Die Herz-Jesu-Figur auf der rechten Altarseite schaute ihn gütig an. Er war immer wieder erstaunt, wie lebendig sie war. Es war ein Erbstück seiner Mutter. Sie hatte die Figur bei einem alten, frommen Herrgottsschnitzer in Auftrag gegeben. Er hatte ihr gesagt, die Fertigung werde lange dauern, aber keine Ewigkeit. Das »heilige Holz«, das er verwende, müsse er erst einmal monatelang in einem Rossstall lagern. Die Ausdünstungen des Stalles hätten so etwas wie eine imprägnierende Wirkung. Mit »heiligem Holz« meinte der Schnitzer die Linde. Sie wurde von vielen berühmten Bildhauern wie Tilman Riemenschneider und Veit Stoß verwendet. Seit Jahrhunderten wurden aus dem Holz der Linde Heiligenfiguren geschnitzt. Deshalb nannte man es mit der Zeit »heiliges Holz«. Seine Mutter hatte den Begriff gekannt und deshalb auch nicht gefragt, was darunter zu verstehen sei. Sie hatte tatsächlich lange auf die Figur warten müssen. Aber der Schnitzer hatte ein Wunderwerk geschaffen.
Es war eine überraschend große Figur aus einer Winterlinde. Sie war leicht rötlich. Ein matter Glanz verlieh ihr eine besondere Note. Von Anfang ging von ihr eine wahrnehmbare Ausstrahlung aus. Rund 80 Zentimeter hoch war sie. Mit ihren Abmessungen hätte sie besser in eine Kirche, eine Kapelle oder ein Kloster gepasst. Aber die Mutter hatte auf eine gewisse Größe gedrängt. Sie hatte dem Schnitzer gesagt, sie lebe in einem großen Haus. Das passe schon. Jesus hatte langes wallendes Haar. Seine ebenmäßigen Gesichtszüge strahlten Wärme, Güte und eine gewisse Strenge aus. Der rechte Arm war so angewinkelt, dass die Hand leicht nach oben zeigte. Mahnend streckte Christus den Zeigefinger vor. Der linke Arm war ebenfalls angewinkelt und nah beim Körper. Die Hand war zu einer Kelle gewölbt, als müsse sie das Blut auffangen, das Jesus für die Menschheit vergossen hatte. Die Brust zierte ein geschnitztes Herz mit einem Dornenkranz.
Beim Empfang der Herz-Jesu-Figur hatte seine Mutter nicht sprechen können. Vor Rührung hatte sie geweint. Der Dorfpfarrer, der in vollem Ornat und mit zwei Ministranten erschienen war, segnete die Figur. Einer der Ministranten schwang einen Weihrauchkessel. Ein reinigender Duft füllte den Raum. Und der Rauch aus dem Kessel vernebelte ihn einige Zeit. Als er verschwunden war, hatte der Raum plötzlich eine Aura. Zum Dank für die Zeremonie überreichte die Mutter dem Pfarrer eine großzügige Spende für die Kirche, und den Ministranten steckte sie ein ordentliches Trinkgeld zu. Zufrieden verließen der Pfarrer und die Ministranten das Haus, in dem sich noch lange der Geruch von Weihrauch hielt. Die Mutter stand vor der Figur und schien ein Gespräch mit Jesus zu führen. Glücklich sah sie aus. So viel Glück bemerkte man so gut wie nie in ihrem Gesicht. Sie hatte die Figur in der Diele auf ein altes Buffet stellen lassen, das eine dicke Platte aus dunklem Marmor hatte. So begrüßte Jesus jeden Besucher, der ins Haus kam, ob privat oder als Geschäftsmann. Sie hatten fast jeden Tag Besuch. Selbst am Sonntag klingelten Geschäftsleute an der Tür. Wer in die Diele trat, schaute sofort überrascht auf die große Christusfigur und sagte erst einmal kein Wort. Niemand konnte sich ihrer Ausstrahlung entziehen. Sie war immer wieder Gesprächsthema bei Besuchen. Für den Schnitzer war das eine hervorragende Werbung. Er bekam den einen oder anderen großen Auftrag. Ewig war er der Mutter dankbar.
Die Mutter hatte die Figur jedoch ohne Einwilligung des Vaters schnitzen lassen. Er machte nach außen hin gute Miene zu ihrem Spiel. Dass sie Jesus auch noch in der Diele platzierte, entlockte ihm zynische und verletzende Kommentare. Sie sagte nur, sie wolle in einem christlichen Haus leben. Der Vater konterte, die Leute im Dorf wüssten doch, dass das ein christliches Haus sei. Die Mutter sei ja überall bekannt als Betschwester. Da müsse man doch nicht noch eine riesige Holzfigur anschaffen und ausgerechnet für alle Besucher sichtbar in den Eingangsbereich klotzen. Der Ton des Vaters wurde verletzlicher. »Du und deine Holzfigur, ihr gehört beide ins Kloster!«
»Damit du endgültig freie Hand hast!« Die Mutter fing an zu schluchzen.
Höhnisch antwortete der Vater: »Freie Hand habe ich schon immer gehabt!«
Weinend lief die Mutter in ihr Zimmer.
Er hatte die Auseinandersetzung der Eltern belauscht. Die Worte des Vaters hatten ihm genauso wehgetan wie der Mutter. Der Vater war nie handgreiflich gegenüber der Mutter geworden, aber mit seinem Mund hatte er sie öfter angegriffen. Böse Worte trafen härter als Schläge.
Er strich langsam über den Kopf der Figur, küsste das Herz mit dem Dornenkranz, bekreuzigte sich und humpelte zurück in sein Arbeitszimmer. Vor dem »Computertisch« machte er halt und zog den Stuhl so zu sich, dass er sich bequem setzen konnte, ohne die Knie zu stark zu belasten. Es war ein alter großer Schreibtisch, den er in einem Antikladen in Gengenbach erstanden hatte. Er hatte links und rechts jeweils eine Tür und fünf Schubläden. In der Mitte unter der Tischplatte befand sich eine weitere Schublade. Dennoch bot der Tisch durch seine gewaltigen Ausmaße viel Beinfreiheit. An manchen Stellen sah man, dass er ziemlich in die Jahre gekommen war. Aber er machte immer noch etwas her, weil er Herrschaftliches ausstrahlte. Außerdem war er gut verarbeitet, hervorragende alte Handwerkskunst. Er lehnte sich zurück und bekreuzigte sich noch einmal. Regungslos saß er da und rätselte, warum er immer wieder dieser seltsamen Macht ausgesetzt war. Sie griff meist an, wenn er wichtige Entscheidungen zu treffen hatte. Er überlegte, wann sie ihn zum ersten Mal überfallen hatte. Vermutlich war es kurz nach dem Tod des einzigen Menschen, den er je geliebt hatte. Aber er konnte sich nicht mehr so genau erinnern. Er hatte noch nie mit jemandem über diese schwarze Macht gesprochen. Mit der Zeit fand er heraus, dass er sie zurückdrängen konnte, wenn er sich rechtzeitig ablenkte. Mit einer Schmerzattacke! Schaffte er das nicht, jagte die dunkle Macht mal Hitze, mal Kälte durch seinen Körper, setzte sich auf ihn und drohte ihn zu ersticken, kribbelte durch seine Gefäße oder betäubte sie. Er stand jedes Mal Todesängste aus. Wenn die schwarze Macht endlich Ruhe gab, verfiel er in einen Zustand der geistigen Lähmung, der einige Zeit dauerte. Man konnte ihn nicht vergleichen mit dem Zustand nach einer Vision. Ließ die Lähmung endlich nach, war er wie durchgeschüttelt und so verstört, dass er längere Zeit keine klaren Gedanken fassen konnte. Es war nicht leicht, der schwarzen Macht zu entrinnen, wenn sie schon nach ihm gegriffen hatte. Sie war meist zu schnell und krallte sich in ihn. Und ließ sich nicht mehr abschütteln. Dieses Mal hatte er sie rechtzeitig zurückwerfen können.
Er richtete sich auf, faltete die Hände und berührte ihre Spitzen mit der Stirn. So verharrte er eine Weile. Wieder bekreuzigte er sich, betete und bat Gott um Stärke. Er stand auf. Die Knie schmerzten nicht mehr so stark, aber die Striemen, die das Holzscheit hinterlassen hatte, waren deutlich zu sehen. Stark gerötet sahen sie aus, bluteten dieses Mal jedoch nicht. Ruhig und mit betont langsamen Schritten ging er zurück in den Altarraum. Er holte einen kleinen Stoffsack mit Räucherharz aus Myrrhe aus dem Regal, schnürte ihn auf und schüttete etwas Harz in eine bronzene Räucherschale aus dem 19. Jahrhundert, die auf der linken Seite des Altars stand. Schlicht sah sie aus. Ihren Wert konnte man nicht auf Anhieb entdecken. Sie hatte einen Durchmesser von zehn und eine Höhe von drei Zentimetern. Sorgfältig band er den Stoffsack wieder zu und legte ihn zurück ins Regal. Neben dem Säckchen befand sich eine große Streichholzschachtel. Er nahm sie an sich und schritt wie bei einer Zeremonie zum Altar. Vor der Räucherschale stoppte er und zog ein langes Streichholz aus der Schachtel. Gekonnt strich er es mit einem Ruck über die Reibefläche. Das Streichholz zischte und entzündete sich sofort. Er hielt das brennende Streichholz an das Räucherharz in der Schale. Kleine Flammen bewegten sich über die Stücke. Ein leichter, würziger Duft verließ die Schale und breitete sich aus. Die Flammen waren nicht mehr zu sehen. Das Räucherharz glomm in Ruhe vor sich hin, wie es sein musste. Es durfte nicht schnell verbrennen, sonst wirkte es nicht. Der Duft wurde stärker und spendete Balsam und regte seine Spiritualität an.
Mit Ehrfurcht blickte er auf den Altar. In der Mitte stand ein kleiner Tabernakel, der mit einem weißen Tuch verhüllt war. Wie in einer Kirche war der Altar gestaltet, mit Messbuch und Kelch, der im Tabernakel verborgen war und geweihte Hostien enthielt. Er wäre gern Priester geworden. Letztlich brauchte er das Sakrament der Weihe durch die Handauflegung eines Bischofs aber gar nicht. Gott hatte ihn geweiht und ihm eine Sendung übertragen. Ursprünglich hatte er ein anderes Ziel angesteuert, das man ihm verwehrte. Er hatte sich gefügt und beschritt nun den Weg, den Gott für ihn gewählt hatte.
Er fühlte sich entspannter und konzentrierte sich auf die große Aufgabe. Dem Regal entnahm er mit der rechten Hand ein Amulett mit Kette. Er umschloss das Amulett, das ihn so oft schon beschützt hatte. Am Schreibtisch im Arbeitszimmer legte er es ab und zog sein aufgeklapptes Notebook näher an sich heran. Es gab kein Links mehr, kein Rechts, vor allem kein Zurück. Seine Jünger warteten auf die Botschaft. Sie hatten gemeinsam alles sorgfältig geplant und vorbereitet. Sie schauten zu ihm auf, zu ihm, dem Meister. Er durfte keine Schwäche mehr zeigen. Die große Entscheidung lag in seinen Händen. Er konnte zwar alles noch stoppen. Ja! Jedoch würde er damit alle enttäuschen und in Verzweiflung stürzen. Nein! Die neue Zeit begann! Die nagenden Zweifel waren verschwunden. Fast feierlich legte er die linke Hand auf die Elberfelder Bibel und die rechte auf die Lutherbibel. Die Stärke kehrte wieder zurück. Er war bereit.
»Und er machte meinen Mund wie ein scharfes Schwert, hat mich versteckt in dem Schatten seiner Hand; und er machte mich zu einem geglätteten Pfeile, hat mich verborgen in seinem Köcher.«
Kräftig drückte sein rechter Zeigefinger auf »Senden«. Die Botschaft schoss wie ein Pfeil durch die dunklen Portale.
B
»Bannwald! Dieser Wald soll sich ungestört zum ›Urwald von morgen‹ entwickeln. Er dient außerdem als wissenschaftliche Beobachtungsfläche für die Urwaldforschung. Beachten Sie: Im Bannwald ist die Gefahr durch herabfallende Äste und umstürzende Bäume besonders groß! Bitte entnehmen Sie keine Pflanzen, sammeln Sie keine Früchte und bleiben Sie auf den Wegen!«
Er hatte hier oben kein Schild erwartet. Aber in diesem Land waren überall Schilder, warum nicht in einem dichten Wald. Er konnte nicht lesen, was auf diesem Schild stand. Die Sprache war ihm fremd. Aber auch seine eigene Sprache, Bulgarisch, konnte er kaum lesen. Er hatte es nicht so mit dem Lesen und dem Schreiben. Beides war ihm fast unheimlich. In der Schule war er schlecht gewesen. Den Körper einsetzen, die Hände benutzen, das lag ihm. Von Kindheit an hatte er im Wald oder auf dem Feld gearbeitet. Das machte er auch hier in diesem Land mit den vielen Schildern und Vorschriften. Vor keiner Arbeit drückte er sich, war sie auch noch so schwer. Er war etwas außer Atem und musste tief schnaufen. Und er schwitzte. Der Weg zu diesem Schild war sehr steil. Früher hätte er so eine Strecke ohne Probleme geschafft, und ohne Schweißtropfen. Er wurde alt. Alles tat ihm weh, die Füße, der Rücken, die rechte Schulter. Seit längerer Zeit konnte er nicht mehr auf der rechten Seite einschlafen. Die Schulter schmerzte zu sehr. Entweder war eine Sehne entzündet oder er hatte einen Knorpelriss in der Schulter. Jedenfalls vermuteten das seine Arbeitskollegen. Zu einem Arzt wollte er nicht gehen. Das konnte er sich auch gar nicht leisten. Er fürchtete, dass der Arzt sagte, er müsse ihn krankschreiben. Vor so einer Entscheidung hatte er mächtige Angst. Er musste doch seine Familie ernähren! Aber er wusste auch, dass sein ganzer Körper abgenutzt war von der harten Arbeit. Sein Körper wollte eine Pause haben. Aber er durfte sie ihm nicht gönnen. Er schaute um sich. Seine Augen entdeckten, was er suchte. Rechts von diesem Schild sah er nur wenige Meter von ihm entfernt einen großen Stein mit einer Vertiefung, der einen Moospelz hatte. Er setzte sich hinein. Wie in einem richtigen Stuhl saß er. Der Moospelz war angenehm weich und trocken. Entspannt sank er zusammen.
So blieb er sitzen, bis ihn etwas aufschreckte. Was war das für ein Geräusch? Es hatte sich wie ein Rascheln angehört. Er drehte sich langsam um. Hatte sich hinter ihm etwas bewegt? Er konnte nichts entdecken. Im Wald bewegte sich immer irgendetwas. Wieder hörte er ein Geräusch. Ein Knacken. Er stand auf und lief auf einem schmalen Streifen, der nicht überwuchert war, weiter in das Waldstück hinein. Aber es fiel ihm nichts auf. Er kehrte zum Stein zurück. Kurz stockte er. Im Unterholz meinte er, eine dunkle Stelle auszumachen. Er bückte sich leicht, um besser sehen zu können. Noch ein Geräusch, das er nicht richtig einschätzen konnte. Es lenkte ihn von der dunklen Stelle ab. Hatte jemand geflüstert? Nichts war zu sehen und zu hören. Einige Minuten blieb er stehen und horchte und schaute. Der Wald schwieg. In den Wäldern seiner Heimat wäre er nicht aufgestanden und hätte nach den Ursachen der Geräusche gesucht. Dort war ihm alles vertraut. Die Vögel, der Rothirsch, das Wildschwein, der Schakal, der Fuchs, der Dachs, der Hase, das Knarren der Schwarzkiefer, der Schlangenhautkiefer, das Knacken der Äste, das Rascheln des Laubes. Aber dieser Wald war ihm völlig fremd. Ein leichter Schauder überfiel ihn. Er hatte Lust auf eine Zigarette. Wie ein alter, müder Mann stolperte er zum bemoosten Stein zurück und ließ sich in die Vertiefung fallen.
Rauchen im Wald war verboten, das wusste er. Alles war sehr trocken in diesem Sommer. Der Bauer, für den er arbeitete, hatte selber Wald. Er warnte fast jeden Tag vor der Brandgefahr. Der Regen helfe nicht viel. Die Böden seien viel zu trocken. Er brauchte eine Zigarette, er würde schon aufpassen, dass sich kein trockenes Laub entzündete, falls etwas glühende Asche auf den Boden fiel. Er griff mit der rechten Hand in die linke Brusttasche und zog ein Päckchen Zigaretten von der Sorte Opal heraus. Es war schon angebrochen und leicht eingedrückt. Er schüttelte das Päckchen und suchte nach einer Zigarette, die unversehrt war. Tatsächlich fand er eine. Eine filterlose Zigarette. Opal war seine Lieblingsmarke. In der rechten Hosentasche steckte sein altes Feuerzeug aus Silber, das sehr abgeschabt aussah. Aber es tat noch immer seinen Dienst, wie jetzt auch. Kräftig zog er an der Zigarette. Ein würziger Duft stieg ihm in die Nase, als er seine erste Rauchwolke ausstieß. Der erste Zug war immer der beste. Er musste plötzlich husten. In letzter Zeit passierte ihm das oft nach dem ersten Zug. Manchmal schüttelte es ihn richtig durch, wenn der Husten nicht aufhören wollte. Es würgte ihn. Sein Hals kratzte. Er räusperte sich und spuckte einen bräunlichen Auswurf aus. Tief schnaufte er durch. Allmählich hatte er sich wieder im Griff. Er zog ein zweites Mal kräftig an der Zigarette. Eine Rauchwolke schwebte nach oben, noch dichter als die erste. Er sah ihr nach. Sehr langsam löste sie sich in der windstillen Luft auf. Er hängte die Zigarette in den linken Mundwinkel. So kannten ihn die Leute in seiner Heimat und die Arbeitskollegen. Nachdenklich rieb er seine schwieligen Hände, die sehr trocken waren und viele Risse hatten. Die Nägel sahen verschmutzt aus. Manche waren abgebrochen oder eingerissen. Er legte die Hände auf die Knie und stützte sich auf.
Sein Zuhause fehlte ihm. Er hatte wie so oft schreckliches Heimweh. Aber er redete mit niemandem darüber, nicht einmal mit seinen Arbeitskollegen aus Bulgarien. Er vermutete, dass es ihnen nicht anders ging. Keiner verlor ein Wort über diese Belastung. Manche tranken abends viel Schnaps, um alles zu vergessen. Er hielt sich zurück. Morgens wollte er keinen dicken Kopf haben. Er konnte außerdem den Schnaps nicht mehr so vertragen wie früher. Als er jünger war, hatte er viel Schnaps getrunken, zu viel Schnaps. Manchmal war er dann gewalttätig geworden und hatte seine Frau geschlagen. In den letzten Jahren war so etwas nicht mehr vorgekommen. Er griff nur noch gelegentlich zur Flasche, trank sie aber nicht mehr aus wie früher. Seine Frau sah ihn jedes Mal dankbar an, wenn er die Flasche nach wenigen Schlucken zumachte und wegstellte. Oft verfluchte er sich, dass er sie geschlagen hatte. Er überließ sich jetzt ganz dem Heimweh nach seiner Frau, seiner Tochter und den beiden Söhnen, und auch nach den Schwiegereltern. Mit jedem Tag wurde die Sehnsucht nach seinem Zuhause größer. Es war ein karges Zuhause, ein Haus aus Naturstein und Lehm. Aber es war nicht verfallen wie viele andere Gebäude im Slavjanka-Gebirge. In sechs Wochen konnte er wieder in sein Bergdorf zurückfahren. Dann brachte ihn ein Kleinbus heim. Der Bus würde wieder quietschen und ächzen, wenn sie über die kleine, löchrige Straße hinauffuhren. Jedes Loch versetzte ihm einen Stoß. Aber das nahm er in Kauf, und vieles andere auch. In seinem Bergdorf fand er schon seit Jahren keine Arbeit mehr. Es war ein Dorf der Alten und Mittelalten. Die meisten jungen Leute hatten die Gegend verlassen. Und seine Kinder zogen sicher auch in die Stadt oder nach Europa, vielleicht nach Deutschland. Sie waren bald erwachsen. Es würde nicht mehr lange dauern. In seinem Dorf wurde es immer trauriger. Es gab nur noch ein kleines Magazin zum Einkaufen. Jede Woche kam ein Händler mit seinem klapprigen dreirädrigen Lieferwagen und verkaufte Obst und Gemüse. Seine Frau und seine Schwiegereltern hielten ein paar Ziegen und bewirtschafteten einen kleinen Acker. Und weiter unten in den Dörfern hatten es die Leute nicht viel besser.
In dünnen Fäden zog der Rauch der Zigarette nach oben. Der Aschenkörper wurde größer, konnte sich aber noch halten. Er stöhnte leise. Bis zur Abfahrt musste er durchhalten, auch wenn die Arbeit auf den Feldern noch so schmerzhaft war. Er hatte schon alles gemacht, Spargel gestochen, Erdbeeren gepflückt, Reben geschnitten und Trauben geerntet. Seit Jahren kam er in dieses Land. Es war ein hartes Leben. Aber in sechs Wochen hatte er so viel Geld zusammen, dass sie einigermaßen über den Winter kamen. Es musste reichen bis weit in das nächste Jahr. Im Frühjahr brachte ihn wieder der Kleinbus hinunter zur Sammelstelle. Und mit einem großen Bus fuhr er mit anderen in dieses Land mit den vielen Schildern und den schönen Häusern. Hier waren die Häuser nicht zerfallen.
Ein erneuter Hustenanfall kündigte sich an. Er musste aufstehen und die Zigarette aus dem Mundwinkel nehmen. Der Aschenkörper fiel auf den Boden. Hustend und würgend trat er ihn mit dem rechten Schuh aus. Er räusperte sich kräftig und spuckte wieder. Als er sicher war, dass die Asche keinen Schaden anrichtete, lief er ein Stück in den Wald hinein. Der Hustenanfall legte sich. Er kehrte um und steuerte wieder den Sitzplatz an. Auf dem Moospelz fühlte er sich wohl. Er steckte die Zigarette, von der nicht mehr so viel übrig war, wieder in den linken Mundwinkel. Sein Heimatdorf kam ihm wieder in den Sinn, seine Familie. Niemand in der Familie durfte krank werden. Vor allem er musste durchhalten und alles durchstehen. Und das Dach musste halten. Er hatte es in den letzten Jahren oft ausbessern müssen. Und er musste noch viel Holz machen, denn die Winter in seinem Bergdorf waren lang und hart. Irgendetwas knackte wieder in der Nähe. Aber er hatte keine Lust, sich noch einmal umzudrehen oder aufzustehen.
Wie aus dem Nichts umschlossen ganz plötzlich schwarze Hände und Arme seinen Körper. Er war so überrascht, dass sein Mund sich öffnete und die Zigarette mit ihrem kleinen Aschenkörper auf den Boden fiel. Er konnte nicht einmal an die Gefahr eines Waldbrandes denken. Im Nacken spürte er einen Stich wie von einer Mücke. Zum Kratzen hatte er keine Möglichkeit, weil starke Arme ihn von hinten gepackt hatten und die schwarzen Hände seine Unterarme festhielten. Wo kamen die nur her? Und wie viele waren es? Vor ihm tauchten zwei weitere schwarze Hände auf. Sie zogen eine Spritze auf und stachen ihn unter den Nagel des Mittelfingers an der rechten Hand. Alles, was seine Augen sahen, begriff er nicht, alles war ihm ein Rätsel. Die schwarzen Hände drückten seinen Körper noch stärker. Er fing an zu schwitzen. Ihm wurde schlecht. Er taumelte in einen Nebel.
Die schwarzen Hände warteten. Als das Leben aus dem fremden Körper zu weichen schien, lockerten sie ihren Griff. Sie zogen den erschlafften Leib vom Stein und rissen etwas Moospelz mit. Zwei Hände durchsuchten seine Hosentaschen und die Brusttaschen. Die Ausbeute war gering: eine zerdrückte Zigarettenschachtel, ein altes Feuerzeug, ein löchriges altes Taschentuch aus Stoff, das schon mehrfach gebraucht war. Verschleimt sah es aus. Die schwarzen Hände stopften die Fundsachen in einen Rucksack. Wie auf ein Kommando packten alle schwarzen Hände den Körper und zogen ihn vom Stein weg über den schmalen Pfad bis zu einer ehemaligen Holzriese. Sie war fast nicht mehr zu erkennen, weil sie von gebrochenen Ästen, verfaulten Baumstämmen und Gestrüpp überdeckt war. Sie hoben das Totholz an, bogen das Gestrüpp etwas beiseite und schoben den Körper in die Riese, eine tiefe Rinne, über die in früheren Zeiten Holz ins Tal geschleift worden war. Sorgfältig zogen sie Äste und Totholz wieder zurecht und richteten das eingedrückte Gestrüpp auf, sodass nichts mehr von dem Körper zu sehen war. Sie suchten nach der Zigarette, die schon fast ausgeglüht war, drückten sie aus und steckten den Stummel in den Rucksack mit den Fundsachen. Dem Stein gaben sie seine abgerissenen Pelzstücke aus Moos zurück. Und den Boden vom Eingang des Bannwaldes bis zum Stein bearbeiteten sie so, dass er unberührt aussah. Lautlos entfernten sich die schwarzen Hände.
Der Bannwald barg von jetzt an ein Geheimnis. Schon seit Jahrzehnten gab er nichts preis. Was in seinem Bereich blieb, veränderte sich. Den Tod im eigentlichen Sinn kannte er nicht. Er lebte auf ewig vom Vergehen und vom Werden.
C
Christliche Terroristen! Er schüttelte immer wieder den Kopf. Kopieren und einfügen. Screenshot. Bildschirminhalt abspeichern. Übertragen auf zwei verschiedene USB-Sticks. Seiten im Notebook löschen. Virenscanner laufen lassen. Seit Wochen sammelte er alle Botschaften, die er bekam. Vor Monaten war ihm die geheimnisvolle Gruppe auf der Suche nach christlichen Fundamentalisten aufgefallen. Er hatte die sozialen Medien durchsucht und immense Zeit im Internet damit verbracht, durch die vielen Zwiebelhäute des Darknets zu stoßen. Ihn interessierten Gruppen aus dem Umfeld des Antimodernismus, die gegen politische, gesellschaftliche und kirchliche Reformen wetterten und kämpften. Er wollte wissen, ob es vorstellbar war, dass auch christliche Gruppen sich so radikalisierten, dass sie zu einer Gefahr für die Gesellschaft wurden. Er lernte Integralisten kennen, strenge Anhänger der katholischen Tradition, die den alten Zustand einer ganzheitlichen Kirche wiederherstellen wollten. Traditionalisten begegneten ihm, Moralisten, fundamentalistische Bibelausleger. Letztere beharrten darauf, dass die Bibel irrtumsfrei sei. Ihr Argument beeindruckte durch radikale Einfachheit: Gott sei der Autor der Bibel. Und Gott könne sich nicht irren. Die Bibel sei wortwörtlich zu verstehen. Wunder seien Tatsachenberichte.
Bei seinen Ausflügen im Internet und im Darknet hatte er zufällig das Forum einer Gruppe entdeckt, die er auf den ersten Blick nicht richtig beurteilen konnte. In ihrer Ideologie schien sie von allen etwas übernommen zu haben, von den Integralisten, von den Moralisten, von den Fundamentalisten. »Testamentsvollstrecker« nannten sich die Mitglieder. In ihrer sprachlichen Radikalität waren sie nicht zu überbieten. Bis dahin hatte er immer geglaubt, Gotteskrieger seien nur unter Islamisten zu finden. Die Seite hatte ihm die Augen geöffnet. Die »Testamentsvollstrecker« lehnten die freie Gesellschaft ab und wollten eine neue Ordnung schaffen. Genaue Pläne hatten sie zu diesem Zeitpunkt keine gehabt. Aber es war zu erkennen gewesen, dass sie zu Gewalttaten bereit waren, um ihr Ziel zu erreichen.
Er hatte vorsichtig versucht, im Forum mitzureden. Ohne Widerspruch ließen sie ihn gewähren und mitdiskutieren. Mit der Zeit baute er sich eine Legende und gab sich ebenfalls als Gotteskrieger aus. Das Spiel mit der Gruppe ließ ihn nicht mehr los. Eines Tages verständigten sie sich, ihre Seite aufzugeben. Es sei nicht auszuschließen, dass sie gehackt worden seien. Sie deuteten an, dass es eine Weile dauere, bis er die neue Seite besuchen könne. Damit er sie finden konnte, gaben sie einige Tipps. Sie entwickelten eine neue Seite, die anders gestaltet war. Sie hatten zwar wieder ein Forum, auf dem sie sich austauschten. Sie nannten es »resurrectio«, Auferstehung. Aber das Forum war immer nur kurze Zeit geöffnet. Und es wurde schnell wieder gesäubert. Zunächst verstand er die Kommunikation überhaupt nicht. Sie hatten ihn nicht eingeweiht in die Besonderheiten der Seite. Ihre Botschaften waren verschlüsselt. Sie bevorzugten Kombinationen von Buchstaben und Zahlen. Als er eine solche Kombination googelte, führte ihn ein Treffer zu einer Bibelstelle im Alten Testament. Er googelte weitere Kombinationen. Über die Verweise auf Bibelzitate gewann er ein Bild von ihnen. Sie waren in ihrem Denken tatsächlich sehr radikal. Das konnte er aus den Zitaten herauslesen.
Mit der Zeit genügte es ihm nicht mehr, die Hinweise auf das Alte und Neue Testament allein im Netz zu suchen. Eine Bibel musste her! Er hätte es nie für möglich gehalten, dass er sich eines Tages mit der Bibel beschäftigen musste. Die geheimnisvolle Gruppe mit ihrem Meister zwang ihn dazu. Als er dann an einem Samstagvormittag in der kleinen Buchhandlung in der Metzgerstraße in Offenburg stand und nach einer Bibel verlangte, staunte er nicht schlecht. Die Inhaberin und ein Schriftsteller, der ihr gelegentlich aushalf, belehrten ihn, dass es nicht nur eine oder die Bibel gebe, sondern viele Übersetzungen, neuere und ältere. Manche seien der modernen Sprache angepasst worden. Andere wie die Elberfelder seien sehr textgetreu und bereiteten beim Lesen Schwierigkeiten. Das ließ ihn aufhorchen. Der Meister benutzte doch oft Sätze, die ungewöhnlich alt wirkten und nur schwer zu verstehen waren. Welche Bibel er denn meine, fragten die Buchhändlerin und der Schriftsteller. Er habe keine Ahnung, räumte er ein. Für was er sie brauche? Den wahren Grund verheimlichte er. Er faselte von einer bibelkundlichen Studienreise in den Nahen Osten im nächsten Jahr. Der Veranstalter habe ihm geraten, sich schon einmal mit der Bibel vertraut zu machen. Vielleicht sei es ganz gut, nach einer textgetreuen, etwas älteren Ausgabe zu suchen, sagte er nach einer kurzen Pause. Eine Begründung nannte er nicht. Sie recherchierten für ihn. Wenige Tage später verließ er die Buchhandlung mit zwei Bibelübersetzungen: der Elberfelder von 1905 und der Lutherbibel von 1912. Außerdem schleppte er noch ein dickes Bibellexikon mit.
In seiner Freizeit vertiefte er sich seither in die Übersetzungen, holte Unterstützung aus dem Lexikon und aus dem Netz und versuchte, die Gruppe noch besser zu verstehen. Konnte er aus den Bibelzitaten der Gruppe ableiten, dass sie wirklich bereit war, zu handeln? Dass sie gewalttätig wurde, dass sie Anschläge beging? Überraschenderweise akzeptierte die Gruppe ihn weiterhin. Sie fühlte sich offenbar wieder sicherer und kehrte zur früheren Kommunikation zurück. Suchte sie neue Mitstreiter und ließ ihn deshalb mitreden? Er hatte den Eindruck, dass die Gruppe auf zwei Ebenen arbeitete, innerhalb und außerhalb des Netzes. Nur über das Netz kam er in Kontakt mit den Gruppenmitgliedern. Trafen sie sich außerhalb und schlossen ihn bewusst von dieser Ebene aus? Beobachteten sie ihn wie einen Anwärter?
Mit der Zeit zeichnete sich ab, dass die Gruppe hierarchisch gegliedert war. An ihrer Spitze stand einer, der sich als »Meister« anreden ließ. Wenn dieser im Forum mitredete, nannte er die anderen »Jünger«. Er wurde aus der Gruppe nicht so recht schlau. Das lag unter anderem daran, dass er sich natürlich kein Gesicht vorstellen konnte. Vor allem der Meister war eine Schattenfigur.
Eines Tages war im Forum davon die Rede, dass allmählich die Zeit der Taten komme. Man müsse jetzt Pläne schmieden. Der Meister rief seine Jünger auf, sich Gedanken zu machen. Und sie machten sich Gedanken und präsentierten Vorschläge. Von diesem Zeitpunkt an kopierte er die Botschaften und fotografierte die Seiten.
Die Pläne wurden immer konkreter. Sie einigten sich auf ein mehrstufiges Vorgehen. Verwirren, Aufmerksamkeit erregen, zuschlagen, neue Ordnung schaffen. Diese neue Phase wollte er nutzen, um näher an die Gruppe heranzukommen. Er musste zeigen, dass er zu ihnen gehörte, dass er ihre Auffassungen teilte und dass er bereit war, ihren Weg zu gehen. Für die ersten zwei Schritte, das Verwirren und das Erregen von Aufmerksamkeit, machte er gleich mehrere Vorschläge, die die strafbare Grenze jedoch nicht überschritten. Alle Vorschläge bis auf einen verwarfen sie. Es wunderte ihn, dass sie den einen für gut hielten, mehr oder weniger. Vor allem der Meister ließ Begeisterung erkennen. Der Widerspruch, der sich aus der Aktion entwickle, werde Aufmerksamkeit erregen, argumentierte er im Forum. Darauf zielte auch der Meister ab. Jede Aktion musste in die Öffentlichkeit wirken. Davon versprach sich der Meister sehr viel. Die meisten Aktionen, die die Gruppe vorhatte, waren kriminell. Er versuchte mehrmals, zurückhaltend zu opponieren und sie davon abzuhalten. So zogen sich im Forum die Diskussionen oft in die Länge. Sein Einfluss war gering, das spürte er. Ihm war unklar, wann er handeln musste, um das Schlimmste zu verhindern. Er befand sich auf einer gefährlichen Gratwanderung. Das machte ihm mitunter schwer zu schaffen. Aber zurückgehen auf sicheres Gebiet wollte er nicht. Immerhin konnte er erreichen, dass sie sich mit weiteren Aktionen zurückhielten, bis sein Vorschlag in die Tat umgesetzt war. Das brachte ihm etwas Zeitgewinn. Auch in diesem Punkt war der Meister auf seiner Seite. Einige Jünger waren nicht damit einverstanden, mit weiteren Aktionen abzuwarten. Aber sie beugten sich.
Der Meister hatte großen Einfluss auf die Gruppe. Die Diskussionen im Forum waren nur scheinbar offen. Der Meister pochte auf Gehorsam und Unterwerfung. Seine Autorität unterstrich er bei Meinungsverschiedenheiten in der Gruppe mit Bibelzitaten. Ohne ihn wurde keine Entscheidung getroffen. Er verlangte, dass bei jeder Handlung immer das gleiche Zeichen und eine Botschaft aus Zahlen und Buchstaben gesetzt werden müssten. Welche Zahlen und Buchstaben zu verwenden waren, legte der Meister fest. Er fragte sich, warum der Meister so auf dieses Zeichen versessen war. Steckte ein Geheimnis dahinter?
Mehrere Objekte für den ersten Schritt lagen nun in seinem geräumigen Arbeitszimmer. Die ganze Wohnung war überhaupt großzügig und auch noch günstig. Die Objekte hatte er schon vorbereitet. Aber sie hatten einen Fehler, der ihm nicht hätte unterlaufen dürfen. Er hatte aus Versehen das Zeichen, das der Meister vehement verlangt hatte, verkehrt herum aufgetragen. Es stand auf dem Kopf. Er hoffte, dass das niemand auffiel. Oder dass der Meister und seine Jünger das nicht so tragisch sahen. Das Zeichen konnte im umgedrehten Status auch anders ausgelegt werden, wie er bei Recherchen herausgefunden hatte. Für den Fall, dass die Gruppe den Fehler rügte, musste er sich wappnen. Er hatte noch keine Vorstellung davon, wie er sich herausreden konnte, falls es zur Konfrontation kam. Wenn er es mit der Gruppe zu tun hatte, spürte er immer eine starke Anspannung.
Jetzt, da die entscheidende Phase begann, begegneten sie sich mehrmals in der Woche im Forum. Meistens abends. Er schloss daraus, dass die meisten Gruppenmitglieder berufstätig waren. Auch nach Monaten musste er feststellen, dass er sich noch nicht vorstellen konnte, zu was die Gruppe fähig war. Wie weit würde sie im Ernstfall gehen? War sie wirklich so radikal, wie sie sich gab? Er ging von mehreren Optionen aus. Und in allen steckte Gefahrenpotenzial. Er musste hellwach sein und durfte sich nichts anmerken lassen. Vor allem nicht bei seiner Arbeit. Er hatte sich auf ein Abenteuer eingelassen, das ihn mit allen Sinnen forderte. Manchmal glaubte er, an der Grenze der Überforderung angelangt zu sein. Wann musste er aus diesem Abenteuer aussteigen? Das Schwierige war, dass er zurzeit mit niemandem reden konnte. Alles musste er allein abwägen und entscheiden. Beklagen durfte er sich nicht. Er hatte sich alles selbst eingebrockt. Vor allem: Man hatte ihn vor Alleingängen im Darknet eindringlich gewarnt.
Die Objekte hatte ihm einer der Jünger, der zwölfte, vor kurzer Zeit nachts in der Nähe von Lahr übergeben, auf dem Autobahnrasthof Mahlberg an der A5 Richtung Freiburg. Sie hatten vereinbart, sich auf den hintersten Parkplätzen zu treffen, die weit weg von Tankstelle und Rasthof lagen. Er konnte sich noch gut an die Szenen dieser merkwürdigen Nacht erinnern. Der Jünger kam mit einem weißen Lieferwagen, so wie man sie sah, wenn Sperrmüll vor die Häuser gelegt wurde. Der Jünger fuhr schnell auf einen der Parkplätze, die schräg angelegt waren. Der Lieferwagen hatte ein französisches Kennzeichen, das er gerne mit seinem Smartphone fotografiert hätte. Es bot sich aber keine Gelegenheit. Und merken konnte er sich die Nummer nicht. Französische Autokennzeichen prägten sich nicht so gut ein wie deutsche. Außerdem musste er sich unauffällig verhalten. Der andere durfte keinen Verdacht schöpfen.
Der Jünger war ein seltsamer Mensch. Wie ein frisch ausgewildertes Tier wirkte er, das eine schwere Zeit hinter sich hatte. Und Angst hatte vor der Freiheit. Die Objekte waren schwerer, als er vermutet hatte. Er schätzte, dass jedes mindestens 20 bis 30 Kilo wog. Wahrscheinlich hatten sie noch mehr Gewicht. Obwohl er einen großen Wagen hatte, war es nicht so leicht, sie unterzubringen. Aber er schaffte es, auch mit Hilfe des seltsamen Jüngers. Bei der Schlepperei stellte er fest, dass der Jünger nicht nur schlecht aussah, sondern auch stark nach altem Schweiß roch. Ganz offensichtlich hielt er wohl nichts von Körperpflege. Bei der Übergabe der Objekte versuchte er, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Er fragte nach dem Meister und den anderen Jüngern. Und wie er heiße? Ob man sich nicht mal treffen könne? Das sei doch besser, als sich nur über das versteckte Forum auszutauschen. Er würde sich gerne noch mehr einbringen. Der Jünger, dem einige Zähne fehlten, nuschelte nur: »Überlasse alles dem Meister. Er kennt die richtige Zeit.« Was für eine Antwort! Das Nuscheln erinnerte ihn an einen bekannten deutschen Schauspieler, der allerdings um einen Grad besser zu verstehen war. Zum Glück kamen sie sich nicht näher. Starker Mundgeruch wehte ihm entgegen. Mangelnde Mundhygiene, entzündetes Zahnfleisch. Er fragte den Jünger noch, ob der Lieferwagen ihm gehöre. Er habe ihn im Elsass besorgt. Und die Objekte? Auch. Er konnte sich vorstellen, was der Jünger mit »besorgt« meinte. Der seltsame Jünger stieg in seinen weißen Lieferwagen und fuhr davon.
Schnell schloss er die Hintertür seines Wagens, sprang auf den Fahrersitz und verfolgte den Jünger. Zum Anschnallen des Gurtes fehlte ihm die Zeit. Auf der Autobahn legte er endlich den Gurt an. Nur wenige Lkw und Autos waren unterwegs. Weiter vorn sah er in der mondhellen Nacht den weißen Lieferwagen. Er holte ein bisschen auf, wollte ihm aber nicht zu nahe kommen. Wohin wollte der Jünger? Ins Elsass? Dafür sprach das französische Nummernschild. Er richtete sich auf eine längere Nachtfahrt ein. Die Ausfahrt Ettenheim näherte sich. Bog der Jünger ab? Nein, er verlangsamte sein Tempo nicht. Vielleicht verließ er bei Rust die Autobahn? Er musste unbedingt mehr über diese seltsame Gruppe erfahren. Wo wohnten die Jünger und der Meister? Wie und wo trafen sie sich? Welche Berufe hatten sie? Wie verhielten sie sich in ihrem sozialen Umfeld, wenn sie überhaupt eines hatten? Gelang es ihm irgendwann, diese Fragen zu beantworten? Auch bei der Ausfahrt Rust machte der Jünger keine Anstalten, die Autobahn zu verlassen. Was hatte der nur vor? Ging es weiter Richtung Süden? Bis nach Freiburg? Oder sogar weiter? Welche Ausfahrt folgte jetzt? Es fiel ihm nicht gleich ein. Herbolzheim. Richtig! Der Jünger wurde langsamer und blinkte. Er musste aufpassen. Außer ihnen verließ niemand die Autobahn. Er ließ sich mehr zurückfallen. Von Weitem sah er, dass der Jünger bei Grün nach rechts abbog. Er hatte kein Glück. Die Ampel sprang auf Rot. Er konnte nur hoffen, dass die Ampelschaltung in der Nacht einen kürzeren Zeittakt hatte. Das Übliche! Wenn man warten musste, dehnte sich jede Sekunde. Endlich! Die Ampel sprang von Rot auf Gelb. Er bog schnell nach rechts ab. Wahrscheinlich hatte er den Jünger verloren. Die Straße führte nach Rheinhausen, wie er auf dem Verkehrsschild sah. Wenn er Glück hatte, entdeckte er den Jünger wieder.
Er traute seinen Augen nicht. Kurz vor dem Ortseingang von Rheinhausen stand rechts der weiße Lieferwagen mit dem französischen Kennzeichen. Das Warnlicht war eingeschaltet. Was war da los?