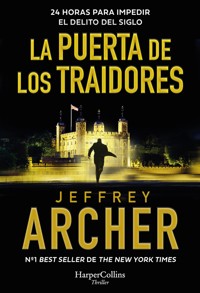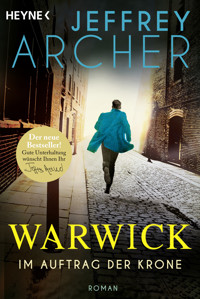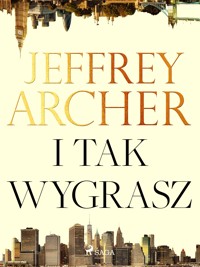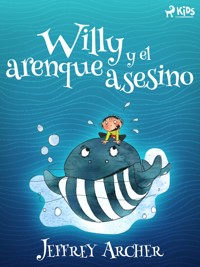Jeffrey Archer, Die Kain-Saga 1-3: Kain und Abel/Abels Tochter/ - Kains Erbe (3in1-Bundle) - E-Book
Jeffrey Archer
24,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Nach russischer Kriegsgefangenschaft gelangt Abel Rosnovski, unehelicher Sohn eines polnischen Adligen, mit einem Auswandererschiff nach Amerika. Dort arbeitet er sich zum Hotelmanager hoch. Sein Schicksal kreuzt sich dramatisch mit dem von William Lowell Kane, Erbe eines gigantischen Vermögens, der zum Bankpräsidenten werden soll. Der Gigantenkampf zwischen den Familien von Abel Rosnovski und seinem Feind William Lowell Kane setzt sich über Jahrzehnte bis in die nächste Generation fort: Erleben Sie die große Kain-Saga von Jeffrey Archer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1883
Sammlungen
Ähnliche
JEFFREY ARCHER
DIE KAIN-SAGA
DREI ROMANE IN EINEM BAND
KAIN UND ABEL
ABELS TOCHTER
KAINS ERBE
Die Bücher
Nach russischer Kriegsgefangenschaft gelangt Abel Rosnovski, unehelicher Sohn eines polnischen Adligen, mit einem Auswandererschiff nach Amerika. Dort arbeitet er sich zum Hotelmanager hoch. Sein Schicksal kreuzt sich dramatisch mit dem von William Lowell Kane, Erbe eines gigantischen Vermögens, der zum Bankpräsidenten werden soll. Der Gigantenkampf zwischen den Familien von Abel Rosnovski und seinem Feind William Lowell Kane setzt sich über Jahrzehnte bis in die nächste Generation fort:
Erleben Sie die große Kain-Saga von Jeffrey Archer.
Der Autor
Jeffrey Archer, geboren 1940 in London, verbrachte seine Kindheit in Weston-super-Mare und studierte in Oxford. Archer schlug zunächst eine bewegte Politiker-Karriere ein. Weltberühmt wurde er als Schriftsteller, »Kain und Abel« war sein Durchbruch. In Deutschland erscheinen seine großen Werke im Heyne Verlag. Mittlerweile zählt Jeffrey Archer zu den erfolgreichsten Autoren Englands, sein historisches Familienepos »Die Clifton-Saga« begeistert eine stetig wachsende Leserschar. Archer ist verheiratet, hat zwei Söhne und lebt in London, Cambridge und auf Mallorca.
Die Originalausgaben KANE AND ABEL, PRODIGAL DAUGHTER sowie SHALL WE TELL THE PRESIDENT? erschienen 1979 bei Hodder & Stoughton/2009 bei Pan Macmillan, 1982 bei Hodder & Stoughton, 1977 erstmals bei Jonathan Cape Ltd.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die erste Fassung von Kain und Abel erschien in Deutschland im Zsolnay Verlag
Abels Tochter erschien in Deutschland erstmals im Zsolnay Verlag
Kains Erbe erschien in Deutschland erstmals unter dem Titel Das Attentat bei Lübbe
Die Personen und Ereignisse in vorliegenden Büchern sind – mit Ausnahmen der historischen Persönlichkeiten und Handlungen – frei erfunden. Jede Ähnlichkeit ist zufällig.
Vollständige deutsche Sonderausgabe 04/2019
Copyright © 1979/2009, 1982/2010, 1977/1986 by Jeffrey Archer
Copyright © 2018 der deutschsprachigen Ausgaben by
Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Die Verwendung des Liedtextes Is it an eartquake … in Kains Erbe erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Chappell & Co., London
Umschlagillustration: Büro Süd unter Verwendung von:
Kain und Abel: Schiff: mauritius images / mauritius history;
Pier: Gettyimages/Christopher Butler/EyeEm
Abels Tochter: Paar: Arcangel/Stephen Carroll
Kains Erbe: Paar: Trevillion images/Lee Avison
ISBN: 978-3-641-25122-2V002
www.heyne.de
JEFFREY ARCHER
KAIN UND ABEL
DIE KAIN-SAGA 1
ROMAN
Vom Autor komplett überarbeitete Neuausgabe
Aus dem Englischen von Ilse Winger
Bearbeitet und teilweise neu übersetzt
von Barbara Häusler
»Kain und Abel war der große Durchbruch in meiner Karriere als Schriftsteller. Bis heute ist es vielleicht das beliebteste meiner Bücher, überall auf der Welt. Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, Kain und Abel noch einmal zu überarbeiten. Neun Monate hat es gedauert, den Roman so zu gestalten, wie er in meiner Vision schon immer hätte sein sollen. Bei allen Verbesserungen habe ich die Handlung und Personen freilich nicht geändert. Ich hoffe, meine alten und zukünftigen Leser werden diesen neuen Kain und Abel genauso genießen wie ich selbst, und sich darauf freuen, meinen beiden Helden William Lowell Kane und Abel Rosnovski wieder (oder auch zum ersten Mal) zu begegnen.«
Jeffrey Archer
Für Michael und Jane
Erster Teil
1906 – 1923
1
18. April 1906
Slonim, Polen
Sie hörte erst zu schreien auf, als sie starb. In diesem Augenblick begann der andere Schrei.
Der Junge, der im Wald Kaninchen jagte, war sich nicht ganz sicher, ob es der letzte Schrei der Frau oder der erste des Kindes war, der ihn aufmerksam machte. Eine Gefahr witternd, drehte er sich abrupt um, und seine Augen suchten nach dem Tier, das da offenbar verletzt worden war. Noch nie hatte er ein Tier so schreien hören. Vorsichtig schlich er in die Richtung, aus der die Klagelaute kamen; der Schrei war jetzt zu einem Wimmern geworden, aber auch das klang nicht nach einem ihm bekannten Tier.
Hoffentlich, dachte der Junge, ist es so klein, dass ich es töten kann; das wäre mal etwas anderes als das ewige Kaninchen zum Abendbrot.
Der seltsame Lärm kam vom Fluss, und so schlich der Junge in diese Richtung. Er lief von einem Baum zum nächsten und spürte dabei deren schützende Rinde an den Schulterblättern, etwas, das man anfassen konnte. Nie ohne Deckung bleiben, hatte ihn sein Vater gelehrt. Als er den Waldrand erreichte, konnte er das ganze Tal bis zum Fluss überschauen, aber auch jetzt dauerte es noch eine Weile, bis ihm klar wurde, dass der merkwürdige Schrei nicht von einem Tier ausgestoßen worden war. Er kroch weiter, doch jetzt war er ungeschützt auf freiem Feld.
Dann sah er die Frau – das Kleid über die Hüften gezogen, die bloßen Beine auseinandergespreizt. So hatte er noch nie eine Frau gesehen. Rasch lief er zu ihr hin, starrte auf ihren Bauch hinab und hatte Angst, sie anzurühren. Zwischen den Beinen der Frau lag ein kleines, blutbedecktes rosa Tier, das mit etwas, das wie ein Strick aussah, an sie angebunden war. Der junge Jäger ließ seine frisch gefangenen Kaninchen fallen und kniete sich neben dem kleinen Lebewesen hin.
Eine ganze Weile schaute er es fassungslos an, dann blickte er auf die Frau; er bereute es sofort. Sie war schon blau vor Kälte, ihr erschöpftes junges Gesicht kam dem Jungen alt vor. Niemand musste ihm sagen, dass sie tot war. Er hob den schlüpfrigen kleinen Körper auf, der zwischen ihren Beinen im Gras lag. Hätte ihn jemand gefragt, warum – und niemand fragte ihn je danach –, hätte er geantwortet, dass ihn die winzigen Fingernägel, die sich in das zerknautschte Gesichtchen pressten, dazu bewogen hatten. Jetzt merkte er, dass Mutter und Kind mit jener schleimigen Schnur verbunden waren.
Vor ein paar Tagen hatte er die Geburt eines Lamms mit angesehen, und er versuchte sich zu erinnern. Ja, das war es, was der Schäfer gemacht hatte, aber konnte er es auch bei einem Kind tun? Das Wimmern hatte aufgehört, und der Junge wusste, dass er handeln musste. Er zog sein Messer, mit dem er die Kaninchen häutete, aus der Scheide, wischte es an seinem Ärmel ab und zögerte nur einen Augenblick, bevor er die Schnur knapp am Körper des Kindes durchtrennte. Aus den abgeschnittenen Enden floss Blut. Was hatte der Schäfer dann mit dem neu geborenen Lamm getan? Er hatte einen Knoten gemacht, um das Blut zu stoppen. Na klar, natürlich; der Junge riss ein paar Grashalme aus und machte hastig einen Knoten in die Schnur.
Dann nahm er das Kind in die Arme. Langsam stand er auf und ließ drei tote Kaninchen und die tote Frau zurück, die dieses Kind geboren hatte. Bevor er ihr endgültig den Rücken zukehrte, zog er ihr das Kleid über die Knie und schob die Beine zusammen. Es kam ihm richtig vor.
»Großer Gott«, sagte er laut – etwas, das er immer sagte, wenn er etwas sehr Gutes oder etwas sehr Schlechtes getan hatte. Noch wusste er nicht genau, wie dies hier einzuordnen war.
Der junge Jäger lief zu dem kleinen Haus, in dem seine Mutter das Abendessen vorbereitete und auf die Kaninchen wartete; alles andere würde schon fertig sein. Sicher fragte sie sich, wie viele er heute gefangen hatte; für eine achtköpfige Familie brauchte sie mindestens drei. Manchmal brachte er eine Ente, eine Gans oder sogar einen Fasan, der sich vom Gut des Barons, auf dem sein Vater arbeitete, in den Wald verirrt hatte. Heute Abend hatte er ein anderes Tier gefangen, und als der junge Jäger das Haus erreichte, traute er sich nicht, seine Beute auch nur mit einer Hand loszulassen. Mit dem bloßen Fuß trat er gegen die Tür, bis seine Mutter ihm öffnete. Schweigend streckte er ihr seine Gabe entgegen. Sie nahm ihm das kleine Geschöpf nicht gleich ab, sondern starrte es, eine Hand auf die Brust gelegt, eine Weile an.
»Großer Gott«, sagte sie und bekreuzigte sich. Der Junge suchte im Gesicht seiner Mutter nach einem Anzeichen von Freude oder Ärger. Ihr Blick verriet eine Zärtlichkeit, die er noch nie an ihr gesehen hatte. Da wusste er, dass das, was er getan hatte, etwas Gutes gewesen sein musste.
»Ist es ein Baby, Matka?«
»Es ist ein kleiner Junge«, sagte seine Mutter und nahm das Kind in ihre Arme. »Wo hast du ihn gefunden?«
»Unten am Fluss, Matka«, sagte er.
»Und die Mutter?«
»Tot.«
Wieder bekreuzigte sie sich.
»Lauf rasch zu deinem Vater und sag ihm, was geschehen ist. Er soll Urszula Wojnak holen, sie ist auf dem Gut; du musst sie beide zu der Mutter führen und nachher hierherbringen.«
Der junge Jäger wischte sich die Hände an der Hose ab, einigermaßen froh darüber, dass er das kleine schlüpfrige Wesen nicht hatte fallen lassen, und lief aus dem Haus, um seinen Vater zu suchen.
Die Mutter schloss mit der Schulter die Tür und rief Florentyna, ihrem ältesten Kind, zu, den Kochtopf auf den Herd zu stellen. Sie selbst setzte sich auf einen Holzschemel, knüpfte die Bluse auf und schob eine müde Brustwarze in den kleinen gespitzen Mund. Ihre jüngste Tochter Sophia, gerade einmal sechs Monate alt, würde heute ohne Nachtessen auskommen müssen. Genau wie die restliche Familie.
»Und wozu?«, fragte die Frau laut und legte ihr Schultertuch um das Kind an ihrer Brust.
»Der arme kleine Wurm wird morgen früh ja doch tot sein.«
Aber als die alte Hebamme Urszula Wojnak spätabends den kleinen Körper wusch und den Stumpf der Nabelschnur versorgte, wiederholte sie diese Worte nicht. Schweigend stand ihr Mann daneben und beobachtete die Szene.
»Wenn ein Gast ins Haus kommt, kommt Gott ins Haus«, sagte die Frau, ein altes polnisches Sprichwort zitierend.
Der Mann spuckte aus. »Zum Teufel mit ihm. Wir haben genug eigene Kinder.«
Die Frau tat so, als hörte sie ihn nicht, während sie das spärliche dunkle Haar auf dem Kopf des Kindes streichelte.
»Wie wollen wir ihn nennen?«, fragte sie.
Er zuckte die Achseln. »Was spielt das für eine Rolle? Er kann auch namenlos begraben werden.«
2
18. April 1906
Boston, Massachusetts
Der Arzt hob das Neugeborene an den Knöcheln hoch und gab ihm Klapse auf den Hintern. Das Baby begann zu schreien.
In Boston, Massachusetts, gibt es eine Klinik, in der vorwiegend diejenigen versorgt werden, die an Wohlstandskrankheiten leiden; in Einzelfällen dürfen die Reichen dort auch Kinder zur Welt bringen. Die Mütter schreien dabei selten und gebären auch nicht vollständig angekleidet.
Vor dem Kreißsaal ging ein junger Mann auf und ab. Drinnen befanden sich zwei Frauenärzte und der Hausarzt. Bei seinem ersten Kind wollte der Vater keine Risiken eingehen; die Frauenärzte würden für ihre Anwesenheit ein stattliches Honorar erhalten. Einer von ihnen – er trug bereits einen Smoking unter dem weißen Kittel – würde zu spät zu einer Dinner-Party kommen, doch dieser speziellen Geburt hier fernzubleiben konnte er sich nicht leisten. Die drei hatten ausgelost, wer das Kind zur Welt bringen würde, und der Hausarzt Dr. MacKenzie hatte gewonnen. Ein solider, verlässlicher Mann, dachte der Vater, während er im Flur auf und ab ging.
Eigentlich hatte er keinen Grund, nervös zu sein. Roberts hatte die Frau des jungen Mannes heute Morgen in ihrer Pferdekutsche ins Krankenhaus gebracht, denn der Doktor hatte ausgerechnet, dass es der achtundzwanzigste Tag des neunten Monats war. Annes Wehen hatten kurz nach dem Frühstück eingesetzt, und man hatte ihm versichert, die Geburt werde bestimmt nicht stattfinden, bevor seine Bank schloss. Der Vater war ein disziplinierter Mann und sah keinen Grund, warum die Ankunft eines Kindes sein wohlorganisiertes Tagesprogramm durcheinanderbringen sollte. Trotzdem ging er weiter auf und ab. Krankenschwestern und junge Ärzte eilten an ihm vorbei, dämpften die Stimmen in seiner Nähe und wurden wieder lauter, wenn sie außer Hörweite waren. Er merkte es gar nicht, weil ihn jedermann ständig so behandelte. Die meisten Krankenhausangestellten kannten ihn nicht persönlich; doch alle wussten, wer er war. Sobald sein Sohn auf der Welt war – nicht einen Moment lang war ihm in den Sinn gekommen, das Kind könnte ein Mädchen sein –, würde er den neuen Kindertrakt bauen, den die Klinik so dringend benötigte. Sein Großvater hatte für die Gemeinde bereits eine Bibliothek und sein Vater eine Schule errichten lassen.
Der künftige Vater versuchte die Abendzeitung zu lesen, doch die Worte ergaben keinen Sinn. Er war nervös, sogar ein klein wenig besorgt. Sie (fast alle Menschen waren für ihn »sie«) konnten nicht wissen, wie bedeutsam es war, dass sein Erstgeborener ein Junge werden musste, ein Junge, der eines Tages seinen Platz als Präsident und Vorstand der Bank einnehmen würde.
Er blätterte im Evening Transcript. Die Boston Red Sox hatten die New York Highlands geschlagen – andere Menschen würden feiern. Dann sah er die Schlagzeile auf der ersten Seite: das schlimmste Erdbeben in der Geschichte Amerikas. Verheerungen in San Francisco, mindestens vierhundert Tote – dort würde man trauern. Das war ihm zuwider. Es würde die Aufmerksamkeit von der Geburt seines Sohnes ablenken, die Menschen würden sich erinnern, dass an diesem Tag noch etwas anderes geschehen war.
Er wandte sich den Finanznachrichten zu und studierte die Börsenberichte – alles war ein paar Punkte gefallen. Dieses verdammte Erdbeben hatte den Wert seiner Anteile an der Bank um hunderttausend Dollar vermindert; da sich sein persönliches Vermögen jedoch komfortablerweise auf mehr als sechzehn Millionen Dollar belief, würde es mehr als ein Erdbeben in Kalifornien brauchen, um auf seiner Richterskala angezeigt zu werden. Schließlich konnte er inzwischen von seinen Zinseszinsen leben, sodass die sechzehn Millionen unangetastet bleiben und auf seinen noch ungeborenen Sohn warten würden. Er ging weiter auf und ab und tat so, als lese er den Transcript.
Der Frauenarzt kam im Smoking durch die Tür des Kreißsaales, um die Neuigkeit zu verkünden. Er hatte das Gefühl, zur Rechtfertigung seines stattlichen Honorars irgendetwas tun zu müssen, überdies war er für die Mitteilung am passendsten gekleidet. Die beiden Männer sahen sich einen Moment lang an. Auch der Arzt war ein wenig nervös, wollte es sich dem Vater gegenüber aber nicht anmerken lassen.
»Ich gratuliere, Sir, Sie haben einen Sohn, einen hübschen, kleinen Sohn.«
Was für dumme Bemerkungen die Menschen machen, wenn ein Kind geboren wird, dachte der Vater; wie sollte es denn sonst sein, wenn nicht klein? Die Neuigkeit war ihm noch nicht ganz ins Bewusstsein gedrungen – ein Sohn. Er dachte darüber nach, sich bei einem Gott zu bedanken, an den er nicht glaubte. Der Frauenarzt riskierte eine Frage, um das Schweigen zu brechen.
»Wissen Sie schon, wie er heißen soll?«
Ohne Zögern antwortete der Vater: »William Lowell Kane.«
3
Lange nachdem sich die Aufregung über das Baby gelegt hatte und die übrige Familie zu Bett gegangen war, blieb die Mutter mit dem Kind im Arm noch wach. Helena Koskiewicz glaubte an das Leben, und sie hatte neun Kinder zur Welt gebracht, um es zu beweisen. Obwohl drei von ihnen noch im Säuglings- oder Kleinkindalter gestorben waren, hatte sie um jedes von ihnen getrauert.
Heute, mit fünfunddreißig Jahren, wusste sie, dass ihr einst so kräftiger Jasio ihr keine Söhne und Töchter mehr schenken würde. Gott hatte ihr dieses Kind hier geschickt, gewiss war es dazu bestimmt zu leben. Helena war eine anspruchslose Frau, was gut war, denn das Schicksal sollte ihr nie mehr als ein einfaches Leben bescheren. Sie war mager und grau, eine Folge von Unterernährung, harter Arbeit und ständigem Geldmangel und sah viel älter aus, als sie war. Nicht ein einziges Mal in ihrem Leben hatte sie ein neues Kleid getragen. Es fiel ihr nicht ein, sich über ihr Los zu beklagen, aber die Furchen in ihrem Gesicht ließen sie eher wie eine Großmutter als eine Mutter aussehen.
Obwohl Helena ihre Brüste fest presste, sodass um die Warzen blassrote Flecken erschienen, traten doch nur kleine Milchtropfen aus. Wir alle haben mit fünfunddreißig, nach einer halben Lebensspanne, nützliche Kenntnisse weiterzugeben; und diejenigen Helena Koskiewiczs waren jetzt besonders wertvoll.
»Matkas Kleinstes«, flüsterte sie zärtlich und fuhr mit der milchigen Brustwarze über den Mund des Kindes. Die Augen öffneten sich, als es zu trinken versuchte. Schließlich versank die Mutter gegen ihren Willen in tiefen Schlaf.
Als Jasio Koskiewicz, ein schwerfälliger, langsamer Mann mit einem üppigen Schnurrbart – das einzige Zeichen der Selbstbehauptung in einer ansonsten servilen Existenz – um fünf Uhr morgens aufstand, fand er seine Frau und das Baby schlafend im Schaukelstuhl vor.
Dass sie in dieser Nacht nicht in ihr Bett gekommen war, hatte er gar nicht mitbekommen.
Er starrte auf den kleinen Kerl, der zum Glück zu wimmern aufgehört hatte. War er bereits tot? Es war ihm gleich. Sollte sich die Frau um Leben und Tod kümmern, er hatte bei Tagesanbruch auf dem Gut des Barons zu sein. Er trank ein paar Schluck Ziegenmilch. Dann nahm er in die eine Hand ein Stück Brot, in die andere seine Fallen und schlich leise aus dem Haus, um das Kind nicht zu wecken, sodass es wieder zu weinen anfing. Ohne an den kleinen Eindringling einen weiteren Gedanken zu verschwenden – außer, dass er ihn vermutlich zum letzten Mal gesehen hatte –, schritt er auf den Wald zu.
Als Nächste kam Florentyna in die Küche, kurz bevor die alte Uhr sechsmal schlug. Die Uhr war nur eine ungefähre Hilfe für jene, die wissen wollten, ob es Zeit war, aufzustehen oder zu Bett zu gehen; schon seit vielen Jahren zeigte sie die ihr genehme Zeit an. Zu Florentynas täglichen Pflichten gehörte das Zubereiten des Frühstücks, an und für sich eine leichte Aufgabe, die nur im Verteilen der Ziegenmilch und eines Laibes Brot an die achtköpfige Familie bestand. Trotzdem erforderte sie salomonische Weisheit, damit sich niemand über eine zu kleine Portion beklagte.
Sah man Florentyna zum ersten Mal, so wirkte sie wie ein hübsches, zartes, etwas schäbiges Mädchen. Dass sie seit drei Jahren nur ein einziges Kleid zum Anziehen hatte, war betrüblich, doch wer das Kind sah und es sich in einer anderen Umgebung vorstellen konnte, verstand, warum sich Jasio in ihre Mutter verliebt hatte. Florentynas langes blondes Haar glänzte, und die haselnussbraunen Augen funkelten, ihrer Herkunft und Umgebung zum Trotz.
Auf Zehenspitzen näherte sie sich dem Schaukelstuhl und schaute ihre Mutter und den kleinen Jungen an, den sie vom ersten Moment an ins Herz geschlossen hatte. Mit ihren acht Jahren hatte sie noch nie eine Puppe besessen. Ja, sie hatte nur ein einziges Mal eine Puppe gesehen, als die Familie zu einer Nikolaus-Feier ins Schloss des Barons eingeladen worden war.
Selbst damals hatte sie den schönen Gegenstand nicht zu berühren gewagt, aber jetzt empfand sie das unerklärliche Verlangen, dieses Baby im Arm zu halten. Sie beugte sich hinab, nahm das Kind auf, schaute ihm in die blauen Augen – so blaue Augen – und begann leise zu summen. Der Wechsel von der Wärme der Mutter zu den kalten Händen des Mädchens ließ das Baby zu schreien anfangen. Das weckte die Mutter, die sich sofort schuldbewusst fühlte, weil sie eingeschlafen war.
»Guter Gott, er lebt noch«, sagte sie zu Florentyna. »Mach das Frühstück für die Jungen, ich will versuchen, ihn noch einmal zu stillen.«
Widerwillig gab ihr Florentyna das Baby und schaute zu, wie die Mutter erneut versuchte, etwas Milch aus ihren schmerzenden Brüsten zu pressen. Das kleine Mädchen war wie gebannt.
»Mach deine Arbeit, Florcia«, schalt die Mutter, »die andern wollen auch was essen.«
Florentyna gehorchte widerstrebend, als die Brüder einer nach dem anderen vom Dachboden kamen, wo sie schliefen. Sie küssten zur Begrüßung die Hände ihrer Mutter und starrten den kleinen Neuankömmling ehrfürchtig an. Sie wussten nur, dass er nicht aus dem Bauch der Mutter gekommen war. Florentyna war zu aufgeregt, um zu frühstücken, also teilten die Brüder ihre Portion unter sich auf und ließen das Frühstück der Mutter auf dem Tisch stehen. Niemand bemerkte, dass sie seit der Ankunft des Babys keinen Bissen gegessen hatte.
Helena Koskiewicz war froh, dass ihre Kinder schon frühzeitig gelernt hatten, sich allein um alles Nötige zu kümmern. Sie wussten, wie man die Tiere fütterte, Kühe und Ziegen molk und den Gemüsegarten betreute, ohne besondere Aufforderung oder Hilfe. Als Jasio abends heimkam, hatte Helena ihm kein Abendbrot gemacht. Florentyna hatte die drei Kaninchen genommen, die ihr Bruder Franck, der Jäger, am Vortag gefangen hatte, und damit begonnen, sie zu häuten. Sie war stolz, für das Essen verantwortlich zu sein; sonst war das nur der Fall, wenn ihre Mutter sich nicht wohlfühlte, und diesen Luxus erlaubte sich Helena selten. Ihr Vater hatte sechs Pilze und drei Kartoffeln mitgebracht; heute Abend würde es ein richtiges Festmahl geben.
Nach dem Essen saß der Vater auf seinem Stuhl neben dem Feuer und sah sich das Baby zum ersten Mal eingehend an. Er hielt es unter den Achseln, stützte mit gespreizten Fingern den kleinen Kopf und taxierte den Säugling mit Kennerblick. An dem faltigen, zahnlosen Wesen waren nur die schönen blauen, wenn auch noch blicklosen Augen bemerkenswert. Als Jasio sich den mageren Körper anschaute, fiel ihm etwas auf. Er machte ein finsteres Gesicht und fuhr mit den Daumen über die zarte Brust.
»Hast du das bemerkt, Frau?«, fragte er und deutete auf den Brustkorb des Babys. »Der kleine Bastard hat nur eine Brustwarze.«
Seine Frau runzelte die Stirn und strich ihrerseits mit dem Daumen über die Haut, als könne sie dadurch die fehlende Brustwarze auf wunderbare Weise herbeizaubern. Ihr Mann hatte recht: Links hatte das Kind eine winzige Brustwarze, doch rechts war die flache Brust glatt und gleichförmig rosa.
Sofort erwachte der Aberglaube der Frau. »Er wurde mir von Gott geschenkt«, rief sie aus, »das ist ein göttliches Mal!«
Ärgerlich gab ihr der Mann das Baby zurück. »Du bist eine Närrin, Helena. Dieses Kind wurde seiner Mutter von einem Mann mit schlechtem Blut gemacht.« Er spuckte ins Feuer, um seinen Worten über die Abstammung des Kindes Nachdruck zu verleihen.
»Jedenfalls würde ich nicht einmal eine Kartoffel darauf verwetten, dass der Bastard noch eine Nacht überlebt.«
Jasio war das Überleben des Kindes sogar gleichgültiger als eine Kartoffel. Er war kein hartherziger Mann, aber schließlich war der Junge nicht sein Kind, und noch ein hungriges Maul würde seine Probleme nur noch vergrößern. Doch würde er sich in den Ratschluss des Allmächtigen fügen, und ohne sich noch weiter mit dem Kind zu beschäftigen, sank er in tiefen Schlaf.
Als die Tage vergingen, begann sogar Jasio Koskiewicz an das Überleben des Kindes zu glauben; hätte er gewettet, er hätte seine Kartoffel verloren. Sein ältester Sohn Franck, der Jäger, baute ein Kinderbettchen aus Holz, das er im Wald des Barons gesammelt hatte. Florentyna nähte dem Baby bunte Kleidung aus kleinen Stoffabschnitten aus ihren eigenen Kleidern. Hätten sie die Bedeutung des Wortes Harlekin gekannt, dann hätten sie den Jungen so genannt. Seit Langem hatte in der Familie nichts so große Meinungsverschiedenheiten hervorgerufen wie die Frage, wie man das Kind nennen sollte. Nur der Vater enthielt sich einer Äußerung. Schließlich einigte man sich auf Wladek; am folgenden Sonntag wurde der Junge in der Gutskapelle auf den Namen Wladek Koskiewicz getauft. Die Mutter dankte Gott, dass er das junge Leben erhalten hatte, und der Vater fand sich damit ab, ein weiteres Maul stopfen zu müssen.
An diesem Abend gab es zur Feier der Taufe ein kleines Fest, das durch eine Gans vom Gut des Barons bereichert wurde. Die ganze Familie griff herzhaft zu.
Und von diesem Tag an lernte Florentyna, durch neun zu teilen.
4
Anne Kane hatte die ganze Nacht hindurch friedlich geschlafen. Nach einem leichten Frühstück wurde ihr ihr Sohn William von einer Krankenschwester ins Zimmer gebracht. Sie konnte es kaum erwarten, ihn an sich zu drücken.
»Guten Morgen, Mrs. Kane«, sagte die weiß gekleidete Schwester fröhlich, »Zeit, dass das Baby auch sein Frühstück bekommt.«
Anne setzte sich auf und spürte schmerzhaft ihre geschwollenen Brüste. Ihr war klar, dass Verlegenheit als unmütterlich angesehen werden würde, und starrte unverwandt in Williams blaue Augen, die noch blauer waren als die seines Vaters. Sie lächelte zufrieden. Mit ihren einundzwanzig Jahren war ihr bewusst, dass es ihr an nichts fehlte. Als eine geborene Cabot hatte sie in einen Zweig der Familie Lowell hineingeheiratet und nun einen Sohn geliefert, der jene Tradition fortsetzen würde, die ihre alte Schulfreundin Millie Preston in einem Kartengruß so treffend zusammengefasst hatte:
Das ist das gute alte Boston,
Heimat der Bohne und des Stockfischs,
wo die Lowells nur mit den Cabots reden
und die Cabots nur mit Gott.
Anne versuchte eine halbe Stunde lang, sich mit William zu unterhalten, das Echo war allerdings eher gering. Dann brachte ihn die Oberin auf die gleiche effiziente Art und Weise wieder fort, auf die er gekommen war. Heroisch widerstand Anne den Früchten und Süßigkeiten, Mitbringsel von Freunden und Gratulanten, denn sie war fest entschlossen, pünktlich zur Sommersaison wieder in all ihre Kleider zu passen und den ihr zustehenden Platz auf den Seiten der Modezeitschriften wieder einzunehmen. Hatte der Prince de Garonne nicht erklärt, sie sei der einzig schöne Gegenstand in Boston? Ihr langes goldenes Haar, die fein geschnittenen Züge und die schlanke Gestalt erregten in Städten Bewunderung, die sie nie bereist hatte.
Prüfend schaute sie in den Spiegel und war erfreut über das, was sie dort sah: die Leute würden kaum für möglich halten, dass sie die Mutter eines kräftigen Knaben war. Gott sei Dank, dass es ein Junge ist, dachte sie, und verstand zum ersten Mal, wie Anne Boleyn sich gefühlt haben musste.
Sie nahm ein leichtes Mittagessen zu sich, bevor sie sich für die Besucher zurechtmachte, die in regelmäßigen Abständen am Nachmittag aufkreuzen würden. Jene, die während der ersten Tage kommen durften, mussten entweder Familienangehörige oder Mitglieder der besten Familien von Boston sein; den anderen würde man sagen, dass sie noch nicht bereit sei, sie zu empfangen. Doch da Boston diejenige Stadt in Amerika war, in der jeder seinen Platz in der gesellschaftlichen Hierarchie sehr genau kannte, waren irgendwelche unerwarteten Eindringlinge höchst unwahrscheinlich.
In dem Zimmer, in dem Anne allein lag, wäre noch leicht Platz für fünf weitere Betten gewesen, sah man einmal von den Unmengen an Blumen darin ab. Ein zufällig Eintretender hätte sich in einer Gartenausstellung gewähnt, hätte da nicht die junge Mutter aufrecht im Bett gesessen. Anne knipste das elektrische Licht an, das noch ein Novum in Boston war. Ihr Mann hatte abgewartet, bis die Cabots einen Anschluss hatten, was in Folge ganz Boston als orakelhaftes Zeichen dafür wertete, dass elektrischer Strom gesellschaftsfähig war.
Die erste Besucherin war Annes Schwiegermutter, Mrs. Thomas Lowell Kane, nach dem verfrühten Tod ihres Mannes das Oberhaupt der Familie. Die elegante Sechzigerin hatte die Kunst perfektioniert, so in ein Zimmer zu rauschen, dass sie selbst davon tief befriedigt, alle anderen jedoch verwirrt waren. Sie trug ein langes Seidenkleid, das die Knöchel verhüllte; der einzige Mann, der sie je gesehen hatte, war jetzt tot. Sie war immer schlank gewesen. Ihrer häufig geäußerten Ansicht nach deutete eine übergewichtige Frau auf schlechte Ernährung und eine schlechte Kinderstube hin. Heute war sie die älteste lebende Lowell und auch die älteste Kane.
Daher erwartete sie – und man erwartete es von ihr –, dass sie bei jedem bedeutsamen Ereignis die Erste war. War nicht sie es gewesen, die das erste Zusammentreffen von Anne und Richard arrangiert hatte? Mrs. Kane hielt nicht viel auf Liebe. Reichtum, Ansehen und gesellschaftliche Stellung hingegen verstand sie. Liebe war ja schön und gut, aber zumeist nicht von Dauer; die drei letzgenannten Dinge waren es hingegen zweifellos. Sie küsste ihre Schwiegertochter beifällig auf die Stirn. Anne berührte einen Knopf an der Wand, und ein leises Summen ertönte. Das Geräusch überraschte Mrs. Kane, da sie noch nicht überzeugt davon war, dass sich die Elektrizität jemals durchsetzen würde. Die Schwester erschien mit dem Sohn und Erben im Arm. Mrs. Kane musterte ihn prüfend, schnaubte anerkennend und winkte die Schwester fort.
»Gut gemacht, Anne«, sagte sie, als hätte ihre Schwiegertochter einen unbedeutenden Preis bei einer Regatta gewonnen. »Wir sind alle so stolz auf dich.«
Einige Minuten später traf Annes Mutter, Mrs. Edward Cabot, ein. Ihre Erscheinung war jener von Mrs. Kane so ähnlich, dass Leute, die die beiden nur von Weitem sahen, die beiden Damen gelegentlich miteinander verwechselten. Allerdings musste man ihr zugutehalten, dass sie sich wesentlich länger mit ihrem neuen Enkel und ihrer Tochter beschäftigte als Mrs. Kane. Anschließend wurden die Blumen inspiziert.
»Wie nett, dass die Jacksons daran gedacht haben«, murmelte Mrs. Cabot, die andernfalls schockiert gewesen wäre.
Mrs. Kanes Begutachtung geriet flüchtiger, ihr Blick glitt nur über die Blumenpracht, bevor sie sich die Karten der Absender vornahm. Leise murmelte sie die beruhigenden Namen vor sich hin: Adams, Lawrence, Lodge, Higginson. Keine der Großmütter kommentierte die ihnen unbekannten Namen; sie waren beide über das Alter hinaus, etwas Neues oder jemanden Neuen kennenlernen zu wollen. Einigermaßen befriedigt verließen sie gemeinsam das Zimmer: Ein Erbe war geboren und schien, soweit man das beurteilen konnte, zufriedenstellend zu sein. Sie waren beide der Meinung, ihre letzte familiäre Pflicht erfolgreich erfüllt zu haben und sich von nun an in die Rolle von Zuschauerinnen begeben zu dürfen.
Sie irrten sich alle beide.
Anne und Richards engere Freunde und Verwandte kamen am Nachmittag mit Geschenken und guten Wünschen – erstere in Gold und Silber, letztere im knappen Ton der besseren Gesellschaft.
Als nach Bankschluss ihr Mann erschien, war Anne erschöpft.
Er kam seiner Frau etwas weniger steif vor als gewöhnlich. Er hatte zum ersten Mal im Leben zum Lunch ein Glas Champagner getrunken – der alte Amos Kerbes hatte darauf bestanden, und da der ganze Somerset Club zuschaute, konnte er nicht gut ablehnen. In seinem langen schwarzen Gehrock und der Hose mit Nadelstreifen war er gut einen Meter sechsundachtzig groß; sein dunkles, in der Mitte gescheiteltes Haar glänzte im Licht der großen Glühbirne. Die wenigsten hätten sein Alter richtig geschätzt. Jugend war ihm nie sonderlich wichtig gewesen; einige Witzbolde behaupteten sogar, er wäre bereits als Mann mittleren Alters auf die Welt gekommen. Das kümmerte ihn nicht, Substanz und Reputation waren das Einzige, was im Leben zählte. Wieder wurde nach William Lowell Kane geklingelt, und der Vater inspizierte den Kleinen, als prüfe er am Ende eines Banktages den Kontostand. Alles schien in Ordnung. Der Junge hatte zwei Beine, zwei Arme, zehn Finger, zehn Zehen. Richard entdeckte nichts, was ihn später vielleicht in Verlegenheit bringen konnte. Also wurde William wieder fortgeschickt.
»Gestern Abend habe ich dem Direktor von St. Paul telegrafiert«, informierte er seine Frau.
»William ist für September 1918 angemeldet.«
Anne erwiderte nichts darauf. Richard hatte offenbar bereits lange vor der Geburt begonnen, Williams Zukunft zu planen.
»Nun, meine Liebe, ich hoffe, du hast dich vollkommen erholt«, sagte er, der selbst nur die ersten drei Tage seines Lebens im Krankenhaus verbracht hatte.
»Ja – nein – ich glaube«, antwortete seine Frau zögernd und versuchte jede Gefühlsregung zu unterdrücken, von der sie meinte, dass sie ihm möglicherweise missfallen könnte. Er küsste sie leicht auf die Wange und ging ohne ein weiteres Wort. Roberts kutschierte ihn zurück zum Red House, ihrem Familiensitz am Louisburg Square. Mit dem neuen Baby und seinem Kindermädchen, das zum bereits vorhandenen Personal dazukam, würden jetzt neun Mäuler zu füttern sein, aber darüber verschwendete er keinen zweiten Gedanken.
In Anwesenheit all derer, die in Boston etwas zählten, und einiger weniger, die dies nicht taten, erhielt William Lowell Kane in der Protestant Episcopal Cathedral von St. Paul den Segen der Kirche. Bischof Lawrence hielt den Gottesdienst, J. P. Morgan und A. J. Lloyd, beide hoch angesehene Bankleute, sowie Millie Preston, Annes beste Freundin, waren die Taufpaten. Der Bischof träufelte Weihwasser auf Williams Stirn; und sprach die Worte »William Lowell Kane«.
Der Junge gab keinen Ton von sich. Er lernte bereits, wie man sich in seinen Kreisen zu benehmen hatte. Anne dankte Gott für die Geburt eines gesunden Knaben, während Richard den Kopf senkte – er betrachtete den Allmächtigen als nichts weiter als einen externen Buchhalter, dem es oblag, Geburten und Todesfälle der Familie Kane zu erfassen. Trotzdem, vielleicht sollte er lieber auf Nummer sicher gehen und einen zweiten Sohn bekommen – wie die englische Königsfamilie hätte er so einen Erben und einen weiteren in Reserve. Er lächelte seiner Frau zu, hochzufrieden mit ihr.
Zweiter Teil
1923 – 1928
5
Wladek Koskiewicz wuchs langsam. Schon bald wurde seiner Ziehmutter klar, dass ihm seine zarte Gesundheit immer zu schaffen machen würde. Er bekam alle gängigen Kinderkrankheiten und viele, die die meisten anderen Kinder nicht bekommen. Anschließend gab er sie wahllos an die übrige Familie weiter.
Helena behandelte ihn wie ein eigenes Kind und verteidigte ihn energisch, sobald Jasio nicht Gott, sondern den Teufel für Wladeks Anwesenheit in ihrer winzigen Kate verantwortlich machte. Auch Florentyna bemutterte Wladek, als wäre er ihr Kind. Sie hatte ihn vom ersten Moment an mit einer Intensität geliebt, die ihrer Angst entsprang, als Tochter eines Waldhüters keinen Mann zu finden und kinderlos zu bleiben. Wladek war ihr Kind.
Der älteste Bruder, Franck, der Wladek am Flussufer gefunden hatte, behandelte ihn wie ein Spielzeug. Nie hätte er seinem Vater gegenüber zugegeben, dass er das schwächliche Baby gern mochte, hatte dieser ihm doch erklärt, Kinder wären Weibersache. Jedenfalls würde er nächsten Januar die Schule verlassen, um auf dem Gut des Barons zu arbeiten. Die drei jüngeren Brüder, Stefan, Josef und Jan, bekundeten wenig Interesse für Wladek, während sich die jüngere Tochter Sophia, die gerade einmal sechs Monate älter war als er, sich damit begnügte, ihn einfach nur zu knuddeln.
Worauf Helena jedoch nicht vorbereitet war, waren Wladeks Persönlichkeit und Verstand, die sich so sehr von denen ihrer eigenen Kinder unterschieden. Niemand konnte übersehen, dass er in jeder Hinsicht anders war als sie – körperlich wie geistig. Die Koskiewicz-Kinder waren alle groß und grob gebaut, hatten rotes Haar und außer Florentyna graue Augen. Wladek hingegen war klein, stämmig und dunkelhaarig und hatte tiefblaue Augen. Die Koskiewiczs hatten kein Interesse an Bildung und verließen die Dorfschule, sobald Alter oder Notwendigkeit es erforderten. Wladek dagegen begann zwar spät zu krabbeln, sprach aber mit achtzehn Monaten.
Mit drei Jahren konnte er sich zwar nicht allein ankleiden, dafür aber lesen. Mit fünf Jahren konnte er zusammenhängende Sätze schreiben, machte aber immer noch ins Bett. Er brachte seinen Vater zur Verzweiflung und war der Stolz seiner Mutter. Seine ersten vier Lebensjahre blieben hauptsächlich durch seine zahlreichen Versuche in Erinnerung, mittels einer Krankheit diese Erde zu verlassen. Was ihm auch gelungen wäre, hätten seine Mutter und Florentyna nicht beharrlich alles dafür getan, dies zu verhindern. In seinen Harlekinkleidern lief er in dem kleinen Holzhaus barfuß hinter der Mutter her, und kam Florentyna aus der Schule, so wechselte er seine Gefolgschaft und wich nicht von ihrer Seite, bis sie ihn zu Bett brachte. Wenn Florentyna die Mahlzeit in neun Portionen teilte, gab sie Wladek nicht selten die Hälfte ihres Anteils, und wenn er krank war, die ganze Portion. Wladek trug die Kleider, die sie ihm anfertigte, sang die Lieder, die sie ihn lehrte, und teilte mit ihr die wenigen Spielsachen, die sie besaß.
Da Florentyna beinahe den ganzen Tag über in der Schule war, wollte der kleine Wladek sie schon bald begleiten. Sobald man es ihm erlaubte, marschierte er, Florentyna fest an der Hand haltend, die achtzehn Werst durch moosbedeckte Birken- und Pappelwälder zu der kleinen Schule in Slonim.
Anders als seinen Brüdern gefiel die Schule Wladek vom ersten Unterrichtsläuten an; sie bot ihm ein Entrinnen aus der kleinen Kate, die bislang die ganze Welt für ihn gewesen war. In der Schule wurde ihm auch erstmals schmerzlich bewusst, dass die Russen sein Heimatland besetzt hielten. Er erfuhr, dass seine polnische Muttersprache nur zu Hause gesprochen werden durfte, während die Muttersprache in der Schule Russisch war. Er spürte bei den anderen Kindern den wilden Stolz auf ihre unterdrückte Muttersprache und Kultur. Und auch er begann diesen Stolz zu teilen.
Zu seinem Erstaunen stellte Wladek fest, dass ihn der Lehrer, Herr Kotowski, nicht auslachte, wie es der Vater zu Hause oft tat. Obwohl er, wie zu Hause, der Jüngste war, übertraf er seine Mitschüler sehr bald in allem, außer an Größe. Sein schmächtiger Wuchs verleitete die andern fortwährend dazu, seine Fähigkeiten zu unterschätzen; Kinder glauben häufig, der Größte sei auch der Beste. Mit fünf Jahren war Wladek in jedem Fach Klassenbester, mit Ausnahme beim Bearbeiten von Holz.
Während die anderen Kinder daheim abends Beeren pflückten, Holz hackten, Kaninchen fingen oder nähten, saß Wladek in dem kleinen Holzhaus und las und las, bis er auch die Bücher seines ältesten Bruders und anschließend die seiner ältesten Schwester verschlungen hatte, die die beiden nicht einmal aufgeschlagen hatten. Langsam dämmerte es Helena Koskiewicz, dass sie sich damals, als Franck statt drei Kaninchen dieses kleine Lebewesen nach Hause gebracht hatte, mehr aufgeladen hatte als erwartet. Schon jetzt stellte Wladek Fragen, die sie nicht beantworten konnte. Sie wusste, dass sie sehr bald außerstande sein würde, mit ihm Schritt zu halten, und hatte keine Ahnung, wie sie das Problem meistern sollte. Aber sie besaß einen unerschütterlichen Glauben an das Schicksal und war daher nicht überrascht, als ihr die Entscheidung abgenommen wurde.
Der erste bedeutende Wendepunkt in Wladeks Leben trat an einem Herbstabend des Jahres 1911 ein. Die Familie hatte gerade ihr übliches Abendbrot aus Rote-Beete-Suppe und Kaninchen beendet. Jasio Koskiewicz saß schnarchend am Feuer, Helena nähte, die Kinder spielten, und Wladek hockte lesend zu Füßen seiner Mutter. Während Stefan und Josef sich gerade um einen frisch bemalten Tannenzapfen zankten, ertönte ein lautes Klopfen an der Tür. Sofort verstummten alle. Ein Klopfen war bei den Koskiewicz immer etwas Ungewöhnliches, denn Besucher waren in dem kleinen Häuschen selten.
Ängstlich blickte die ganze Familie zur Tür. Als hätten sie nichts gehört, warteten sie auf ein zweites Klopfen. Diesmal war es etwas lauter. Schlaftrunken erhob sich Jasio von seinem Stuhl, ging zur Tür und öffnete vorsichtig. Als sie sahen, wer da auf der Schwelle stand, sprangen alle auf und senkten alle die Köpfe, außer Wladek, der zu der breitschultrigen, gut aussehenden aristokratischen Gestalt aufschaute, die in einen schweren Bärenfellmantel gehüllt war, und die auf der Stelle Furcht in die Augen des Vaters treten ließ. Doch das freundliche Lächeln des Besuchers beschwichtigte diese Angst, und Jasio bat Baron Rosnovski, einzutreten. Niemand sprach. Der Baron hatte sie noch nie aufgesucht, und so wussten sie nicht recht, was sie als Nächstes tun sollten.
Wladek legte das Buch weg, stand auf, ging auf den Fremden zu und streckte, bevor der Vater ihn zurückhalten konnte, die Hand aus.
»Guten Abend, Herr«, sagte Wladek.
Der Baron nahm seine Hand, und sie starrten einander an. Als der Baron Wladeks Hand losließ, blieb dessen Blick an einem herrlichen silbernen Armreif mit einer Inschrift hängen, die er nicht entziffern konnte.
»Du musst Wladek sein.«
»Ja, Herr«, erwiderte der Junge, anscheinend nicht darüber erstaunt, dass der Baron seinen Namen kannte.
»Ich möchte deinetwegen mit deinem Vater sprechen«, sagte der Baron.
Jasio bedeutete den Kindern mit einer Handbewegung, ihn mit seinem Dienstherrn allein zu lassen; zwei von ihnen machten einen Knicks, vier verbeugten sich, und alle sechs zogen sich schweigend auf den Dachboden zurück. Wladek blieb zurück, weil niemand ihm nahelegte, sich zu den anderen Kindern zu gesellen.
»Koskiewicz«, begann der Baron, immer noch stehend, da ihm niemand einen Stuhl angeboten hatte; erstens, weil sie zu verängstigt waren, und zweitens, weil sie annahmen, er sei gekommen, um einen Tadel auszusprechen. »Ich bin gekommen, weil ich dich um etwas bitten möchte.«
»Was immer Sie wünschen, was es auch ist«, sagte der Vater und fragte sich, was er dem Baron geben könnte, das dieser nicht schon hundertfach besaß.
Der Baron fuhr fort: »Mein Sohn Leon ist jetzt sechs Jahre alt und wird auf dem Schloss von zwei Privatlehrern unterrichtet; der eine ist Pole, der andere kommt aus Deutschland. Sie sagten mir, dass Leon ein aufgeweckter Junge sei, ihm aber der Ansporn fehlt, weil er immer allein ist. Herr Kotowski von der Dorfschule hat mir erklärt, Wladek sei der Einzige, der Leon die Herausforderung bieten könnte, die er so dringend braucht. Ich bin hergekommen, um zu fragen, ob du deinem Sohn erlauben würdest, die Dorfschule zu verlassen, um im Schloss gemeinsam mit Leon unterrichtet zu werden.«
Vor Wladeks innerem Auge tauchte eine wundersame Vision von Büchern und Lehrern auf, die viel klüger waren als Herr Kotowski. Er schaute seine Mutter an. Auch diese blickte auf den Baron in einer Mischung aus Erstaunen und Schmerz. Der Vater wandte sich zu ihr, und der Augenblick schweigender Verständigung zwischen ihnen kam dem Kind vor wie eine kleine Ewigkeit.
Mit rauer Stimme und gebeugtem Kopf murmelte der Waldhüter: »Wir wären sehr geehrt, Herr.«
Der Baron schaute Helena Koskiewicz fragend an.
»Die Heilige Jungfrau verhüte, dass ich meinem Kind jemals im Wege stünde«, sagte sie leise, »obwohl sie allein weiß, wie sehr ich ihn vermissen werde.«
»Seien Sie versichert, dass Ihr Sohn nach Hause kommen kann, wann immer Sie wünschen, Frau Koskiewicz.«
»Ja, Herr. Ich nehme an, dass er das anfangs auch tun wird.« Sie wollte eine Bitte hinzufügen, überlegte es sich aber anders.
Der Baron lächelte. »Gut, dann ist das beschlossene Sache. Bitte bringt den Jungen morgen früh um sieben Uhr ins Schloss. Während der Schulzeit wird Wladek bei uns wohnen, und in den Weihnachtsferien kann er zu euch zurückkehren.«
Wladek brach in Tränen aus.
»Ruhig, Junge«, befahl Jasio.
»Ich will nicht von euch weg«, sagte Wladek und sah seine Mutter an, obwohl er es in Wahrheit wollte.
»Ruhig, Junge«, sagte der Vater, jetzt etwas lauter.
»Warum nicht?«, fragte der Baron, und in seiner Stimme schwang Mitleid mit.
»Ich werde Florcia nie verlassen – nie.«
»Florcia?«, fragte der Baron.
»Meine älteste Tochter, Herr«, warf der Waldhüter ein. »Kümmern Sie sich nicht um sie, Herr. Der Junge wird tun, was man ihm sagt.«
Niemand sprach. Der Baron schwieg einen Moment lang, während Wladek seinen Tränen freien Lauf ließ.
»Wie alt ist das Mädchen?« erkundigte sich der Baron.
»Vierzehn«, erwiderte der Waldhüter.
»Kann sie Küchenarbeit verrichten?«, fragte der Baron, erleichtert, dass Helena Koskiewicz nicht danach aussah, ebenfalls in Tränen auszubrechen.
»Oh, ja, Herr Baron«, erwiderte sie. »Florcia kann kochen und nähen und …«
»Schon gut, dann kann sie mitkommen. Ich erwarte die beiden morgen früh um sieben Uhr.«
Der Baron ging zur Tür, drehte sich zu Wladek um und lächelte. Diesmal erwiderte dieser das Lächeln. Er hatte seine erste Schlacht geschlagen und erlaubte seiner Mutter, ihn zu umschlingen, nachdem der Baron gegangen war. Er hörte sie flüstern: »Ach, Matkas Kleinster, was wird jetzt aus dir werden?«
Das herauszufinden konnte Wladek kaum erwarten.
Bevor sie an diesem Abend zu Bett ging, packte Helena Koskiewicz für die beiden Kinder – nicht dass es lange gedauert hätte, die Habseligkeiten der ganzen Familie zu packen! Um sechs Uhr am nächsten Morgen stand die übrige Familie vor der Tür und sah Wladeks und Florcias Abmarsch zum Schloss zu, jeder von ihnen mit einem Paket unter dem Arm. Florentyna, groß und anmutig, sah sich immer wieder weinend und winkend zu ihnen um. Wladek, klein und unbeholfen, drehte sich kein einziges Mal um. Auf dem Weg zum Schloss hielt Florentyna die ganze Zeit Wladeks Hand fest; ihre Rollen waren jetzt vertauscht: Von diesem Tag an würde sie sich auf ihn verlassen.
Der prunkvoll aussehende Diener in der bestickten, mit Goldknöpfen versehenen grünen Livree, der auf ihr schüchternes Klopfen hin die schwere Eichentür öffnete, hatte sie offensichtlich erwartet. Die beiden hatten schon oft die grauen Uniformen der Soldaten bewundert, die die nahe russisch-polnische Grenze bewachten, aber noch nie hatten sie etwas so Prächtiges gesehen wie diesen Riesen, der sie um mehrere Haupteslängen überragte und bestimmt von allergrößter Wichtigkeit war. In der Halle lag ein dicker Teppich, und Wladek starrte auf das grün-rote Muster, staunend über dessen Schönheit, und überlegte, ob er die Schuhe ausziehen sollte.
Erstaunt stellte er fest, dass seine Schritte kein Geräusch verursachten, als er darüber ging.
Die blendende Erscheinung führte die Kinder zu ihren Schlafzimmern im Westflügel. Getrennte Schlafzimmer – wie sollten sie da jemals einschlafen können? Wenigstens gab es eine Verbindungstür, sodass sie nicht gar so weit voneinander entfernt waren, und tatsächlich schliefen sie anfangs viele Nächte im selben Bett.
Sobald sie ausgepackt hatten, brachte man Florentyna in die Küche und Wladek in das Spielzimmer im Südflügel, wo er Leon, dem Sohn des Barons, vorgestellt wurde. Leon war ein hübscher, für sein Alter großer Junge und seine Begrüßung so warm und herzlich, dass Wladek seine vorbereitete kämpferische Haltung binnen Sekunden nach ihrer ersten Begegnung aufgab.
Leon war einsam gewesen und hatte niemanden zum Spielen gehabt außer seiner Niania, der treu ergebenen litauischen Amme, die ihn gestillt und seit dem vorzeitigen Tod seiner Mutter für alle seine Bedürfnisse gesorgt hatte. Der stämmige Junge aus dem Wald bot Aussicht auf Gesellschaft. Und zumindest in einer Hinsicht wurden sie als gleichrangig erachtet.
Leon bot sofort an, Wladek das Schloss zu zeigen – jedes Zimmer darin war größer als die ganze Kate. Das Abenteuer dauerte den ganzen Vormittag, und Wladek war verblüfft über die schiere Größe des Schlosses, die Möbel und Stoffe und die Teppiche, die in in allen Räumen lagen. Er zeigte sich jedoch nur angenehm berührt. Der Hauptteil des Gebäudes, erklärte ihm Leon, sei frühgotisch, so als wüsste Wladek genau, was Gotik bedeutete. Er nickte. Als Nächstes führte Leon seinen neuen Freund über eine Steintreppe in die riesigen Kellergewölbe, wo in langen Reihen verstaubte, mit Spinnweben überzogene Flaschen lagen. Doch Wladeks Lieblingsraum war der große Speisesaal mit den von Säulen gestützten Gewölben, dem gefliesten Boden und dem größten Tisch, den er jemals gesehen hatte. Er starrte die ausgestopften Tierköpfe an den Wänden an. Leon erklärte ihm, dass es Bären, Bisons, Elche, Eber und Vielfraße waren, die sein Vater im Lauf der Jahre geschossen hatte. Über dem Kamin hing das Familienwappen. »Das Glück ist mit den Tapferen«, war das Motto der Rosnovskis.
Um zwölf Uhr ertönte ein Gong, und livrierte Bedienstete trugen das Mittagessen auf. Wladek aß sehr wenig. Er beobachtete Leon aufmerksam und versuchte sich zu merken, welches der silbernen Besteckteile aus der verwirrenden Vielzahl derselben er benutzte. Nach dem Mittagessen lernte er seine beiden Lehrer kennen, die ihn nicht so willkommen hießen, wie Leon es getan hatte. An diesem Abend kletterte er in das größte Bett, das er je gesehen hatte, und erzählte Florentyna seine Erlebnisse. Sie hing an seinen Lippen und vergaß vor Staunen den Mund zu schließen, besonders als sie von den Messern und Gabeln hörte.
Der Unterricht begann vor dem Frühstück um Punkt sieben am nächsten Morgen und dauerte, nur von kurzen Essenspausen unterbrochen, den ganzen Tag. Anfangs war Leon deutlich besser als sein neuer Klassenkamerad, aber Wladek kämpfte sich mannhaft durch die Bücher, sodass der Abstand im Lauf der Wochen immer geringer wurde. Im gleichen Tempo entwickelten sich Freundschaft und Rivalität zwischen den beiden Jungen. Den Lehrern fiel die Gleichbehandlung ihrer beiden Schüler schwer – der eine der Sohn eines Barons, der andere der illegitime Sohn von Gott weiß wem –, auch wenn sie dem Baron gegenüber widerwillig zugeben mussten, dass er die richtige Wahl getroffen hatte. Ihre unnachgiebige Einstellung kümmerte Wladek jedoch nicht, weil ihn Leon stets als seinesgleichen behandelte.
Der Baron ließ verlauten, dass er mit dem Fortschritt der Jungen zufrieden sei, und schenkte Wladek als Belohnung häufig Kleider oder Spielzeug. Aus Wladeks anfänglich kühler, distanzierter Bewunderung für den Baron wurde rasch Hochachtung.
Als Weihnachten nahte und Wladeks Rückkehr in das kleine Häuschen im Wald anstand, bedrückte ihn der Gedanke, von Leon fort zu müssen. Zwar war er anfänglich froh darüber, seine Mutter wiederzusehen, doch die drei kurzen Monate, die er im Schloss verbracht hatte, hatten ihn mit einer weitaus aufregenderen Welt Bekanntschaft machen lassen. Er wäre lieber Diener im Schloss gewesen, als Herr der Holzhütte zu sein.
Die Ferientage schleppten sich dahin. Wladek fühlte sich eingeengt in dem kleinen Haus mit dem einen Zimmer und dem überfüllten Dachboden, und die kargen Mahlzeiten, die mit bloßen Händen gegessen wurden, missfielen ihm; im Schloss teilte niemand durch neun! Nach ein paar Tagen sehnte er sich danach, ins Schloss zurückzukehren und mit Leon und dem Baron zusammen zu sein. Jeden Nachmittag ging er die sechs Werst bis zum Gut und starrte auf die hohen Mauern, die einen Besitz umgaben, den ohne Erlaubnis zu betreten ihm nie in den Sinn kommen würde. Florentyna, die lediglich in Gesellschaft des Küchenpersonals gewesen war, arrangierte sich leichter wieder mit ihrem früheren einfachen Leben und konnte nicht verstehen, dass die kleine Kate für Wladek nie mehr ein Zuhause sein würde.
Jasio wusste nicht recht, wie er mit dem sechsjährigen Jungen umgehen sollte, der jetzt so gut gekleidet war, ordentlich sprach und von Dingen erzählte, die der Mann weder verstand noch verstehen wollte. Schlimmer noch, Wladek schien nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag mit Lesen zu vergeuden. Was sollte nur aus ihm werden, fragte sich Jasio. Wie durfte er hoffen, ehrlich sein Brot zu verdienen, wenn er weder eine Axt schwingen noch ein Kaninchen fangen konnte? Auch der Vater betete, dass die Ferien rasch vorübergingen.
Helena war stolz auf Wladek und wollte anfangs sogar sich selbst nicht eingestehen, dass zwischen ihm und den anderen Kindern eine Kluft entstanden war. Schließlich ließ es sich jedoch nicht übersehen. Als Stefan und Franck eines Abends Soldat spielten – sie waren feindliche Generäle –, weigerten sie sich, Wladek mitspielen zu lassen.
»Warum werde ich immer ausgeschlossen?«, rief Wladek. »Ich will auch lernen, wie man kämpft.«
»Weil du nicht mehr zu uns gehörst«, erklärte Stefan. »Jedenfalls bist du nicht wirklich unser Bruder.«
Ein langes Schweigen trat ein, bevor Franck fortfuhr: »Vater wollte dich von vornherein nicht haben, nur Matka hat dir erlaubt dazubleiben.«
Wladeks Augen suchten in dem Kreis von Kindern nach Florentyna.
»Was meint denn Stefan, wenn er behauptet, ich wäre nicht euer Bruder?«, wollte er wissen.
Und so erfuhr Wladek von den Umständen seiner Geburt und begriff, warum er immer anders gewesen war als die Brüder und Schwestern. Insgeheim freute er sich darüber, dass nicht das gemeine Blut des Waldhüters in seinen Adern floss, dass er unbekannter Abstammung war, die einen geistigen Keim umfasste, der alles möglich machen würde.
Als die verunglückten Ferien endlich zu Ende gingen, kehrte Wladek noch vor der Morgendämmerung ins Schloss zurück, eine widerwillige Florentyna im Schlepptau. Leon empfing ihn mit offenen Armen; auch für ihn, den der Reichtum des Vaters isolierte wie Wladek die Armut des Waldhüters, waren es trübselige Weihnachten gewesen. Von diesem Augenblick an wurden die Jungen zu engsten Freunden und waren unzertrennlich. Als die Sommerferien kamen, bat Leon seinen Vater, Wladek im Schloss bleiben zu lassen. Der Baron willigte ein, denn auch er hatte den Sohn des Waldhüters liebgewonnen. Wladek war selig. Er sollte nur noch ein einziges Mal in seinem Leben in das Holzhäuschen zurückkehren.
6
William Kane wuchs rasch und galt allen, die mit ihm in Berührung kamen, als ein bezauberndes Kind; in seinen ersten Lebensjahren handelte es sich dabei im Allgemeinen um entzückte Verwandte und vernarrte Bedienstete.
Das oberste Stockwerk des Hauses am Louisburg Square auf Beacon Hill – ein Haus aus dem 18. Jahrhundert – hatte man zur Kinderetage umgebaut und mit Spielzeug vollgestopft. Hier befanden sich auch ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer für das neu eingestellte Kindermädchen. Das Kinderzimmer war mithin so weit von Richard Kane entfernt, dass er von Problemen wie Zahnen, vollen Windeln und ebenso ungeregeltem wie lautem Hungergeschrei unberührt blieb. Der erste Zahn, der erste Schritt, das erste Wort: All das wurde von Williams Mutter in ein Familienbuch eingetragen, ebenso wie Größe und Gewicht des Kindes. Anne war erstaunt, dass sich diese Eintragungen kaum von jenen über andere Kinder unterschieden, die sie in Beacon Hill kannte.
Das aus England importierte Kindermädchen führte ein Regiment, das einem preußischen Kavallerieoffizier gefallen hätte. Jeden Abend um Punkt sechs kam Williams Vater zu Besuch.
Da er sich weigerte, Babysprache zu sprechen, redete er überhaupt nicht mit dem Kleinen; die beiden starrten einander einfach nur an. Manchmal packte William den Zeigefinger des Vaters, den Finger, mit dem dieser die Kontoauszüge durchblätterte, hielt sich daran fest, und Richard gestattete sich ein Lächeln. Nach einem Jahr wurde diese Routine insofern ein wenig verändert, als der kleine Junge zu seinem Vater nach unten gebracht wurde. Richard saß in seinem dunklen Ledersessel mit der hohen Lehne und schaute zu, wie sein Erstgeborener auf allen vieren zwischen den Möbeln umherkroch und immer dort auftauchte, wo man ihn am wenigsten erwartete, woraus Richard schloss, dass sein Sohn bestimmt Politiker werden würde.
Mit dreizehn Monaten machte William, an die Rockschöße seines Vaters geklammert, die ersten Schritte. Sein erstes Wort war »Papa«, worüber man allgemein entzückt war, einschließlich der Großmütter Kane und Cabot, die zu regelmäßigen Begutachtungen vorbeikamen. Sie schoben den Kinderwagen, in dem William durch Boston spazieren fuhr, nicht wirklich, aber sie ließen sich jeden Donnerstagnachmittag dazu herab, einen Schritt hinter dem Kindermädchen herzumarschieren und missbilligend andere Kinder anzufunkeln, die ein weniger diszipliniertes Programm hatten. Während die anderen Kinder in öffentlichen Parkanlagen Enten fütterten, schloss William Freundschaft mit den Schwänen auf dem Teich vor Mr. Jack Gamers extravagantem venezianischem Palais.
Nach zwei Jahren deuteten die beiden Großmütter taktvoll an, dass es an der Zeit für ein zweites Wunderkind sei, einen Spielgefährten für William. Anne, fügsam wie immer, wurde sofort schwanger und war unglücklich, als sie sich vom vierten Monat an immer schlechter fühlte.
Als Anne in der sechzehnten Woche eine Fehlgeburt erlitt, erlaubte ihr Doktor MacKenzie nicht, in Kummer zu versinken. Er notierte »Präeklampsie« und erklärte ihr: »Anne, Sie haben sich so schlecht gefühlt, weil Sie einen zu hohen Blutdruck haben, der mit fortschreitender Schwangerschaft noch höher geworden wäre. Bisher haben die Ärzte leider noch kein Mittel gegen zu hohen Blutdruck gefunden, wir wissen eigenlich nur, dass er gefährlich ist, besonders für schwangere Frauen.«
Anne hielt die Tränen zurück und versuchte sich eine Zukunft ohne weitere Kinder vorzustellen.
»Bei meiner nächsten Schwangerschaft wird sich das doch bestimmt nicht wiederholen?«, fragte sie in dem Versuch, dem Arzt eine günstige Antwort zu entlocken.
»Offen gesagt, würde mich das erstaunen, Mrs. Kane. Tut mir leid, das sagen zu müssen, doch ich muss Ihnen dringend von einer weiteren Schwangerschaft abraten.«
»Aber es macht mir nichts, wenn ich mich ein paar Monate schlecht fühle, solange …«
»Ich spreche nicht davon, sich schlecht zu fühlen, Anne, ich spreche davon, nicht unnötigerweise Ihr Leben aufs Spiel zu setzen.«
Richard war nach sechs Jahren im Vorstand Präsident der Kane and Cabot Bank and Trust Company geworden. Die Bank, die sich als eine Bastion architektonischer und finanzieller Solidität in der State Street befand, hatte Filialen in New York, London und San Francisco. Am Tag von Williams Geburt hatte ihm letztere ein Problem bereitet, als sie ebenso wie die Crocker National Bank, die Wells Fargo und die California Bank zusammenbrach, zwar nicht finanziell, aber im wahrsten Sinn des Wortes: nämlich beim großen Erdbeben von 1906.
Richard, von Natur aus ein vorsichtiger Mann, war bei Lloyds of London hoch versichert, und wie es Gentlemen geziemt, zahlten diese bis auf den letzten Cent, sodass Richard sein Vermögen retten konnte. Trotzdem verbrachte Richard ein unangenehmes Jahr damit, mit dem Zug zwischen Boston und San Francisco hin- und herzupendeln – eine Fahrt, die damals vier Tage in Anspruch nahm –, um den Wiederaufbau zu überwachen. Im Oktober 1907 eröffnete das neue Büro auf dem Union Square, gerade rechtzeitig, um sich neuen Problemen an der Ostküste zuwenden zu können. Es gab einen kleineren Run auf die New Yorker Banken, und viele der weniger bedeutenden Bankhäuser hatten Mühe, ihn zu überleben. J. P. Morgan, der legendäre Vorsitzende der mächtigen Bank, die seinen Namen trug, forderte Richard auf, sich einem Konsortium anzuschließen, um gegen die Krise gefeit zu sein. Richard stimmte zu, der mutige Schritt bewährte sich, und die Krise ging vorüber, hatte ihn allerdings einige schlaflose Nächte gekostet.
William hingegen schlief fest und gut, unberührt von Erdbeben und Bankenbankrotten. Schließlich gab es Schwäne, die gefüttert werden mussten, und endlose Fahrten nach Milton, Brookline und Beverly zu den vornehmen Verwandten.
Im Oktober des darauffolgenden Jahres erwarb Richard ein neues Spielzeug, das im Zusammenhang mit einer vorsichtigen Kapitalanlage bei einem Mann namens Henry Ford stand. Dieser Mann behauptete, er könne ein Auto für jedermann bauen. Die Bank lud Mr. Ford zum Lunch ein, und Richard wurde dazu gebracht, für die stolze Summe von achthundertfünfzig Dollar ein Modell T zu kaufen. Henry Ford versicherte Richard, dass der Preis im Laufe von wenigen Jahren auf dreihundertfünfzig Dollar fallen werde und alle Leute sein Auto kaufen würden, sofern die Bank ihn unterstütze; der Gewinn für die Kapitalgeber würde beachtlich sein.
Richard stieg ein; es war das erste Mal, dass er jemanden finanzierte, der sein Produkt um die Hälfte verbilligen wollte.
Anfangs war Richard etwas besorgt, dass ein Auto, selbst ein dezentes schwarzes, für einen Bankpräsidenten kein seriöses Transportmittel sei, aber die bewundernden Blicke der Fußgänger beruhigten ihn bald. Das Auto fuhr fünfzehn Stundenkilometer und machte mehr Krach als ein Pferd, dafür hatte es den Vorteil, nicht mitten auf der Mount Vermont Street Haufen zu hinterlassen. Richard ärgerte sich nur, weil Henry Ford nicht auf seinen Vorschlag eingehen wollte, das Modell T in verschiedenen Farben zu produzieren. Ford bestand darauf, alle Autos müssten schwarz sein, um den Preis niedrig zu halten. Anne, die mehr auf die gesellschaftlichen Spielregeln achtete als ihr Mann, fuhr erst im Auto mit, als auch die Cabots eins erworben hatten.
William hingegen liebte das »Automobil«, wie es die Zeitungen nannten, abgöttisch und war sofort überzeugt, dass man das Auto nur gekauft hatte, um seinen inzwischen überflüssigen und unmotorisierten Kinderwagen zu ersetzen. Auch zog er den Chauffeur – mit großer Brille und flacher Mütze – seinem Kindermädchen vor. Die Großmütter Kane und Cabot erklärten, eine solche Höllenmaschine niemals zu besteigen, und sie hielten auch Wort, obwohl viele Jahre später Großmutter Kane in einem Auto zu ihrem Begräbnis gefahren wurde, worüber sie allerdings nicht informiert worden war.
Während der folgenden zwei Jahre gewannen sowohl die Bank als auch William an Größe und Stärke. Die Amerikaner investierten wieder, und große Geldsummen fanden ihren Weg zu Kane and Cabot, um in Projekten wie der Lederfabrik in Lowell, Massachusetts, investiert zu werden. Richard nahm das Wachstum seiner Bank und das Wachstum seines Sohnes mit hemmungsloser Befriedigung zur Kenntnis.
An Williams fünftem Geburtstag nahm er das Kind aus der Obhut der Frauen und engagierte für vierhundertfünfzig Dollar im Jahr einen Hauslehrer namens Mr. Munro, den er persönlich aus einer Liste von acht Bewerbern aussuchte, die von seinem Privatsekretär zusammengestellt worden war. Mr. Munro sollte dafür sorgen, dass William mit zwölf Jahren für den Eintritt in St. Paul’s bereit sein würde. Der neue Hauslehrer gefiel William; er fand ihn sehr alt und sehr gescheit. Tatsächlich war er dreiundzwanzig und im Besitz eines Diploms in Englisch der Universität Edinburgh.
Schreiben und Lesen erlernte William ohne Schwierigkeiten, seine Liebe gehörte jedoch den Zahlen. Er beklagte sich einzig darüber, dass von seinen täglichen acht Unterrichtsstunden nur eine einzige Arithmetikstunde war. Schon bald erklärte William seinem Vater, dass ein Achtel des Arbeitstages nicht für jemanden ausreiche, der einmal Präsident und Vorsitzender einer Bank werden wolle.
Um die mangelnde Voraussicht seines Lehrers auszugleichen, quälte William sämtliche in Reichweite befindlichen Verwandten damit, ihm Kopfrechenaufgaben zu stellen. Großmutter Cabot, die man nie davon überzeugen konnte, dass eine Zahl dividiert durch vier dasselbe Resultat ergibt wie ihre Multiplikation mit einem Viertel, wurde binnen Kurzem von ihrem Enkel überflügelt. Großmutter Kane hingegen, die viel gebildeter war, als sie zugab, rang heroisch mit vulgären Bruchzahlen, Zinseszinsen und der Verteilung von acht Kuchen an neun Kinder.
»Großmutter«, sagte William freundlich, aber bestimmt, als sie wieder einmal nicht imstande war, eine Aufgabe zu lösen, »kauf mir einen Rechenschieber; dann muss ich dich nicht mehr belästigen.«
Sie war zwar verblüfft über die Frühreife ihres Enkels, kaufte ihm aber dennoch das Gewünschte und fragte sich, ob er den Rechenschieber wirklich benutzen konnte.
Richards Probleme verlagerten sich derweil ostwärts. Seit der Präsident seiner Londoner Filiale an seinem Schreibtisch einem Herzinfarkt erlag, hatte Richard das Gefühl, dass seine Anwesenheit in der Lombard Street vonnöten sei. Er schlug Anne vor, ihn mit William zu begleiten; eine Reise nach Europa sei erzieherisch bestimmt wertvoll, und William könnte alle die Orte besuchen, von denen ihm Mr. Munro so oft erzählt hatte. Anne, die noch nie in Europa gewesen war, war entzückt ob dieser Aussicht, und sie füllte drei Schrankkoffer mit eleganten neuen Kleidern, um sich der Alten Welt standesgemäß zu präsentieren. William fand es unfair von seiner Mutter, dass sie ihm nicht erlauben wollte, etwas ebenso Unentbehrliches auf die Reise mitzunehmen, nämlich sein Fahrrad.