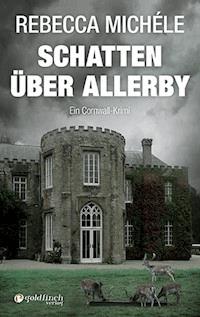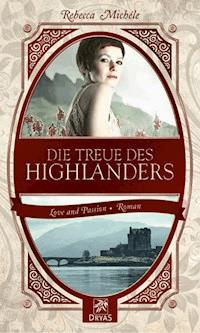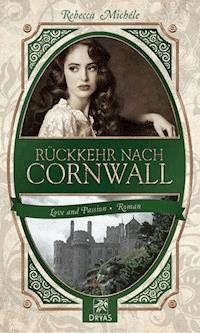11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dryas Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Cornwall, 1905: Emily steht für ihre Überzeugungen als Suffragette ein und muss dafür sogar eine Nacht in der Zelle verbringen. Das wird ihrer Mutter zu viel. Sie schickt ihre Tochter zu einem entfernten Verwandten nach Cornwall aufs Land – in der Hoffnung, dass sie dort die richtige Partie für eine Heirat findet. Bei Emilys Ankunft im Herrenhaus Higher Barton wird die Leiche eines Dieners entdeckt, woraufhin sich die energische junge Frau in die Ermittlungen stürzt. Sehr zum Leidwesen des örtlichen Vikars, dem diese Vorkommnisse in seiner Kirchgemeinde gar nicht gefallen. Doch Emily scheut kein Risiko, um den Todesfall aufzuklären und gerät dadurch bald selbst in Gefahr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 387
Ähnliche
Rebecca Michéle
Miss Emily und der tote Diener von Higher Barton
Ein Cornwall-Krimi
EINS
London – 1905
Die Mittagszeit war längst vorüber, doch die Menschenschlange riss nicht ab. Unablässig drängten Frauen, Kinder und alte, gebrechliche Männer mit der Hoffnung auf ein warmes Essen heran. Zumindest einmal am Tag das ständige nagende Knurren im Magen vergessen können! Vielleicht gab es für die Kinder auch heiße Milch, und die Kleinen hörten auf zu weinen.
Seufzend wischte sich Emily mit dem Ärmel ihres grauen, formlos geschnittenen Kleides über die schweißnasse Stirn und fragte: »Lucy, wie viel Suppe ist noch im Kessel?«
Lucys Bluse klebte ihr ebenfalls am Körper und ihr Gesicht war krebsrot. »Vielleicht noch für zwei Dutzend Portionen. Ein paar mehr, wenn wir etwas Wasser hinzugeben.«
Emily stöhnte. »Zwei Dutzend!« Sie deutete auf die Schlange in der Gasse vor der Suppenküche. »Da stehen gut und gern hundert hungrige Mäuler. Für die meisten ist es die erste Mahlzeit heute, wahrscheinlich sogar das erste warme Essen seit Tagen.«
»Wenn wir nur mehr Geld hätten …«, murmelte Lucy.
Ein Junge, fünf oder sechs Jahre alt, streckte Emily seinen Blechnapf entgegen. Der Blick aus den dunklen Augen in dem spitzen, blassen Gesicht wirkte wie der eines erwachsenen Mannes. Seine schmutzige, zerlumpte Kleidung verriet Emily, dass er keine Familie mehr hatte. Die städtischen und kirchlichen Waisenhäuser waren überfüllt, die dortigen Zustände miserabel, so versuchte der kleine Kerl, sich allein durchzuschlagen. Mit allen Bedürftigen hatte Emily Mitleid, die Kinder aber taten ihr am meisten leid. Ach, wenn sie nur mehr ausrichten könnte, als aus den kargen Spendengeldern warme Suppen zu kochen!
Aus dem Kessel schöpfte Emily eine Kelle des kräftigen Gemüseeintopfes und gab sie in den blechernen Napf des Jungen. Sie zögerte, dann füllte sie eine zweite Portion hinzu.
Die blassen, spröden Lippen des Jungen verzogen sich zu einem dankbaren Lächeln. »Danke, Miss. Gott segne Sie.« Er eilte davon, um seine Suppe zu essen, solange sie noch warm war.
»Ich weiß, Lucy«, raunte Emily der Freundin zu, »nur eine Kelle pro Person. Er sah aber so hungrig aus.«
Lucys Mundwinkel verzogen sich bitter. »Du kannst nicht alle sattbekommen, dafür sind es zu viele …«
»Wenigstens die Kinder …«, murmelte Emily und gab die nächste Ration einem alten, zahnlosen Weib mit gekrümmtem Rücken. Lucy tat das Gleiche bei einem halbwüchsigen Mädchen, dem die Schwindsucht ins Gesicht geschrieben stand.
Die beiden Frauen arbeiteten unermüdlich weiter. Die Suppenküche im East End, wo die Ärmsten der Armen einmal täglich eine warme Mahlzeit erhielten, war eine von vielen im Moloch London, gestiftet von einem Fabrikbesitzer, der seine Arbeiter anständig behandelte und entlohnte. Er war aber nicht so vermögend, alle Hungernden zu unterstützen. Als Emily den letzten Rest aus dem Kessel in den Napf einer Hochschwangeren gefüllt hatte, schlug die Turmuhr der nahen Southwark Cathedral. Emily zählte die Glockenschläge.
»Ach herrje, schon vier Uhr!« Hastig band sie sich die befleckte Schürze ab. »Tut mir leid, Lucy, du musst allein aufräumen. Ich hab’ völlig die Zeit vergessen und muss nach Hause. Mutter erwartet einen wichtigen Gast zum Tee.«
»Geh nur! Heute Abend kommst du doch?«
»Natürlich! Um nichts in der Welt möchte ich mir den Vortrag entgehen lassen!«
Durch enge, verwinkelte und häufig schmutzige Gassen eilte Emily zur London Bridge, überquerte die Themse und stieg am Nordufer in einen Pferdeomnibus. Mit der elektrisch betriebenen Untergrundbahn würde sie zwar schneller zu ihrem Ziel gelangen, die Tube kostete aber das Doppelte als der Bus, und Emily musste ihre Pennys zusammenhalten.
Auf den Straßen herrschte dichter Verkehr: Omnibusse, Kutschen, Pferdefuhrwerke und zahlreiche Automobile. Eine Dunstglocke aus Autoabgasen und Ruß aus hunderten Fabrikschornsteinen lag über der Stadt und erschwerte das Atmen, besonders weil es an diesem Septembernachmittag so warm wie im Sommer war. Je mehr Emily nach Nordwesten kam, desto besser wurde die Luft. Sie verließ den Bus an einer Ecke des Regent‘s Park und hastete an der Grünfläche entlang, bis sie die Chester Terrace erreichte. Ihr Kleid war fleckig und schweißnass, ihr hellbraunes, kräftiges Haar, das kaum zu bändigen war, hatte sich aus dem Knoten gelöst und fiel ihr auf die Schultern, einzelne Strähnen klebten auf ihrem erhitzten Gesicht. Die vier Stufen zur Eingangstür des dreistöckigen, hellen Hauses nahm sie mit zwei großen Schritten. Emily streckte die Hand aus, um zu klingeln, da wurde die Tür von innen geöffnet. Unsanft prallte sie auf einen großen, hageren Mann.
Mit einem verächtlichen Blick aus dunklen, stechenden Augen sah er auf Emily hinab. »Kannst du nicht aufpassen, du dummes Ding?«
»Entschuldigung«, murmelte Emily, drückte sich an dem Hünen vorbei und trat in die kleine, quadratische Halle mit dem hellen Fliesenboden. Hier stand ihre Mutter mit gerunzelter Stirn und einem verärgerten Gesichtsausdruck. »Es tut mir leid«, wiederholte Emily und wollte die Treppe hinaufeilen, um sich frisch zu machen und das Kleid zu wechseln.
»Ich muss doch sehr bitten, Henrietta!«, sagte der Mann von der Tür her mit sonorer Stimme. »Es ist hoffentlich nicht üblich, dass dein Küchenmädchen durch die Vordertür kommt. Mögen die Sitten in London auch lockerer sein als auf dem Land – doch das geht entschieden zu weit! Du darfst so etwas auf keinen Fall dulden, Henrietta!«
Emily eilte die Treppe hinauf, die Erwiderung ihrer Mutter nahm sie nur am Rand wahr. In ihrem Zimmer im zweiten Stock musste sie nicht lange warten. Sie hatte kaum das Wasser in die Waschschüssel gegossen, als Henrietta Tremaine ohne anzuklopfen in den Raum rauschte.
»Emmeline Victoria Martha Abigail …« Oh je, dachte Emily, immer, wenn die Mutter ihren vollständigen Taufnamen verwendete, folgte dem nichts Angenehmes. »Bist du von allen guten Geistern verlassen? Nicht nur, dass du unseren Gast versäumst – du wagst es, schmutzig und übelriechend wie ein Gassenmädchen nach Hause zu kommen!«
»Es tut mir wirklich leid, Mum«, entgegnete Emily. »Ich wollte mich gerade waschen.«
»Weißt du eigentlich, wer das war, den du so brüskiert hast?«
Emily seufzte. »Alwyn Tremaine, mein Großonkel oder so was in der Art. Seit Tagen liegst du mir mit seinem Besuch in den Ohren. Ist es nicht ulkig, dass er mich für eine Bedienstete gehalten hat?«
Mit hochrotem Kopf schnaubte Henrietta Tremaine: »Das ist alles andere als lustig, Emmeline, sondern überaus beschämend! Sir Alwyn hat uns besucht, um dich kennenzulernen. Der Vetter deines seligen Vaters kehrte erst vor einem Jahr aus Indien nach England zurück und hat dich noch nie gesehen.«
»Ich weiß, Mum. Das hast du mir schon oft gesagt und ich wollte wirklich nicht …«
Mit einer Handbewegung unterbrach Henrietta ihre Tochter. »Ich lasse dir wirklich genügend Freiheiten, Emily, und du weißt, wie ich über deine … Arbeit«, sie spie das Wort aus, als sei es anrüchig, »denke, kann dich aber nicht daran hindern, dich unter Gossenpack zu mischen. Ist es zu viel verlangt, wenn ich dich bitte, wenigstens einmal pünktlich zu sein? Vier Uhr war ausgemacht. Und zwar gewaschen und anständig gekleidet.«
»Ich kann nicht mehr tun, als um Verzeihung zu bitten«, sagte Emily mit genervtem Unterton. Wie oft sollte sie sich denn noch entschuldigen? »Heute waren es besonders viele Hungrige. Die Bedürftigen haben sich ihre Lebensumstände nicht ausgesucht, Mum! In den Fabriken schuften Frauen für Hungerlöhne. Den Großteil des verdienten Geldes müssen sie für überteuerte Mieten in heruntergekommenen Häusern ausgeben, die nicht mehr als Bruchbuden sind. Ihre Kinder können sie kaum ernähren, und die Alten und Kranken sind völlig auf die Wohltätigkeit anderer angewiesen. Es ist kaum mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn ich aber helfen kann, das Leid dieser Menschen zu lindern, ist mir dafür alles recht.«
Henrietta Tremaine seufzte und lehnte sich gegen einen Pfosten des Himmelbetts. Sie kannte die Einstellung ihrer einzigen Tochter. Prinzipiell waren Emilys Bemühungen, den Armen zu helfen, durchaus bewundernswert, wenngleich Henrietta mit Schmutz und Armut auf keinen Fall etwas zu tun haben wollte. Sie machte eine raumgreifende Handbewegung und sagte, einen versöhnlicheren Ton anschlagend: »Du weißt, wem wir dies alles hier zu verdanken haben? Wer dafür sorgt, dass du keine der armen Frauen bist, die in den Fabriken arbeiten müssen; dass unser Dach dicht ist, immer warme Speisen auf dem Tisch stehen und wir uns nicht in Lumpen kleiden müssen?«
»Alwyn Tremaine, Vaters Vetter zweiten oder dritten Grades«, murmelte Emily, nun aufrichtig zerknirscht. Sie griff nach der Hand ihrer Mutter. »Es lag nicht in meiner Absicht, unseren Gönner zu verärgern. Ich habe einfach die Zeit vergessen. Ich werde Sir Alwyn schreiben, ihn um Verzeihung bitten und für morgen Nachmittag erneut einladen. Dann werde ich mich dem Onkel wie von dir gewünscht präsentieren und ihn hoffentlich milde stimmen können.«
Als hätte Emily es nicht schon Dutzende Male gehört, sinnierte Henrietta: »Nachdem dein Vater starb und er uns nichts als Schulden hinterlassen hat, war es Ralph Tremaine, Alwyns Vater, der großzügigerweise die Ausstände beglich und dafür sorgte, dass wir das Haus behalten und unseren Lebensstandard fortführen können. Letztes Jahr starb er. Alwyn kehrte aus Indien, wo er über viele Jahre in der Armee gewesen war, zurück, um sein Erbe anzutreten. Seitdem habe ich gebangt, ob Alwyn uns mit dem gleichen Wohlwollen entgegenkommt. Was soll aus uns werden, wenn er die Zahlungen einstellt? Von Rechts wegen gehört das Haus und alles, was sich darin befindet, Alwyn. Er kann uns jederzeit auf die Straße setzen.«
»Tja, dann muss ich eben doch in die Fabrik«, erwiderte Emily sarkastisch. Sie scheute keine harte Arbeit, war aber doch froh, in einer finanziellen Sicherheit leben zu können. »Wie genau ist Sir Alwyn eigentlich mit uns verwandt? Wir tragen schließlich denselben Nachnamen.«
»Sein und der Großvater deines Vaters waren Brüder«, erklärte Henrietta. »Als Jüngster von fünf Söhnen und damit ohne Anspruch auf den Familienbesitz und den Titel kam dein Urgroßvater nach London und wurde zu einem erfolgreichen Geschäftsmann, was sein Sohn fortsetzte.«
Und dessen Sohn, mein Vater, Pedrek Tremaine, investierte sein ganzes Vermögen in dubiose Spekulationen, dachte Emily. Gegenüber der Mutter durfte sie das nicht laut äußern, denn für Henrietta stand der verstorbene Gatte auf einem Podest. Ihre Ehe war ausgesprochen glücklich gewesen. Trotz einer gewissen Sorglosigkeit und der Unfähigkeit, mit Geld umzugehen, war Pedrek Emily immer ein liebevoller Vater gewesen. Sie hatte nicht nur sein langes Gesicht, die etwas breite Nase und sein burschikoses Wesen geerbt, sondern auch dessen soziale Ader. Bereits ihr Vater hatte Suppenküchen und die Armenhilfe unterstützt.
»Nun ist Alwyn durch das Erbe des Besitzes unermesslich reich geworden und zudem ist er verwitwet«, riss die Mutter Emily aus ihren Gedanken.
»Was willst du damit andeuten?«
Henrietta sah ihre Tochter abschätzend an. »Eure Verwandtschaft ist zu weitläufig, als dass sie ein Problem darstellt. Alwyn ist zwar ein paar Jahre älter, reifere Männer sind jedoch von Vorteil. Du bist schließlich auch nicht mehr in deinen Jugendjahren.«
Emily schluckte und stieß dann ungläubig hervor: »Du willst Onkel Alwyn und mich miteinander verkuppeln?«
»Es wäre keine schlechte Verbindung, und es wird langsam Zeit, dass du heiratest, Emily. Du hast nicht mehr lange Zeit, ein Kind zu bekommen. Die Sache mit …«
»Bitte, ich möchte nicht darüber sprechen!«, unterbrach Emily die Mutter und fragte mit einem verschmitzten Lächeln: »Wäre Alwyn Tremaine nicht eher etwas für dich, Mum? Im Alter steht ihr euch wesentlich näher.«
Henrietta schnappte nach Luft, musste aber ehrlich eingestehen: »Ich bin nicht die Art von Frau, die sich Alwyn als künftige Lady Tremaine vorstellt. Außerdem wird er Kinder wollen, die den Besitz fortführen. Wie bedauerlich, dass seine Frau bereits nach wenigen Monaten Ehe am Fieber starb. Indien ist ein schreckliches Land, voller Barbaren, Schmutz und Krankheiten.«
»Im Süden und Osten Londons ist es auch nicht viel besser«, wandte Emily ein. »Abgesehen von den Barbaren, versteht sich. Hilfst du mir bitte beim Umkleiden? Dann muss ich unbedingt einen Tee trinken und eine Kleinigkeit essen.«
Henrietta runzelte die Stirn. »Was soll das heißen? Bist du zum Dinner nicht da?«
Emily nickte. »Ich gehe zu einer Versammlung.« Ihre Augen glänzten, als sie erklärte: »Mrs Pankhurst ist in London. Sie wird heute Abend sprechen.«
»Emmeline Pankhurst?«, wiederholte Henrietta entrüstet. »Die Suffragette?«
»Das ist eine sehr abfällige Bezeichnung, Mum«, tadelte Emily. »Mrs Pankhurst setzt sich für die Rechte der Frauen ein, unter anderem, dass sie für gleiche Arbeit die gleichen Löhne wie Männer erhalten. Daran ist nichts Verwerfliches. Außerdem trage ich ihren Vornamen Emmeline. Das allein ist ein guter Grund, die Lady persönlich kennenzulernen.«
Henrietta Tremaine wusste, wann es sinnlos war, weiter mit ihrer Tochter zu diskutieren. Längst war Emily ihrem Einfluss entglitten, wenn sie jemals Einfluss auf sie gehabt hatte, denn das Mädchen war immer mehr ein »Vaterkind« gewesen. Seit Pedreks Tod vor fünf Jahren war Emily ihren eigenen Weg gegangen und ließ sich kaum etwas vorschreiben. Henrietta sagte jetzt nur noch: »Laden wir Alwyn für morgen ein weiteres Mal zum Tee ein. Emily, sei dann zu Hause und benimm dich, wie es einer Tremaine würdig ist.«
»Selbstverständlich, Mum«, lenkte Emily ein. »Der Onkel wird keinen Grund zum Tadel finden.« Aber heiraten werde ich ihn nicht, fügte sie in Gedanken hinzu.
Der Gemeindesaal in Marylebone war bis auf den letzten Stehplatz gefüllt. Um die hundert Frauen aus allen Gesellschaftsschichten, an ihren Kleidern gut zu erkennen, waren gekommen, einige in Begleitung von Männern. Ob die Herren aus Interesse oder von ihren Frauen gedrängt worden waren, sei dahingestellt. Es fanden sich aber auch ein paar Männer ohne Begleitung ein. Emily stupste Lucy in die Seite und raunte: »Sieh mal, die fünf Kerle dort drüben. Die mit den schwarzen Kappen. Auf mich wirken sie, als wollten sie Ärger machen.«
Lucy sah zu den Männern und winkte ab. »Störenfriede gibt es bei jeder Versammlung. Mrs Pankhurst kann damit umgehen, und wir Frauen sind deutlich in der Überzahl.«
Die Tür an der Stirnseite öffnete sich. Schlagartig wurde es still im Saal. Eine große, schlanke Frau mit vollen dunkelbraunen Haaren und einem langen, schmalen Gesicht trat auf das Podium. Sie trug ein schlichtes, dunkelgraues Kleid mit einem schmalen, elfenbeinfarbenen Spitzenkragen und keinen Schmuck, strahlte aber eine Aura aus, der sich kaum jemand entziehen konnte.
Emmeline Pankhurst räusperte sich, dann sagte sie mit lauter, klarer Stimme: »Einen schönen guten Abend, Ladys und Gentlemen.« Ihr Blick schweifte durch den Saal. »Es freut mich, so viele Herren begrüßen zu dürfen. Das zeigt, dass unsere Sache längst nicht mehr die alleinige Angelegenheit der Frauen ist. Immer mehr Männer teilen die Meinung, dass ein allgemeines Wahlrecht für Frauen und eine soziale Gerechtigkeit überfällig ist. Heute möchte ich Ihnen von einer Reise in die Midlands berichten. Dorthin, wo sich eine Fabrik an die andere reiht, dorthin, wo die Armut wohl im ganzen Land am größten ist …«
Emmeline Pankhurst hatte etwa zehn Minuten gesprochen, als sie einen Schluck Wasser aus dem bereitstehenden Glas trinken musste. Die Pause nutzte einer der Männer mit der Kappe. Er hob einen Arm, ballte die Hand zur Faust und schrie: »Verdammte Blaustrümpfe! Verdammte Suffragetten!«
»Verschwinden Sie und wiegeln Sie nicht unsere treuen Frauen auf, die wissen, wo ihre Plätze sind«, ergänzte einer seiner Kumpane.
»Aber bitte, meine Herren, stören Sie doch nicht!« Laut und durchdringend tönte Mrs Pankhurst’s Stimme durch den Saal. »Wir haben eine friedliche Zusammenkunft, in der es um Informationen und allgemeinen Austausch geht. Niemand zwingt Sie, anwesend zu sein.«
»Ja, verschwinden Sie in das nächste Wirtshaus. Da sind Ihresgleichen, die Sie beleidigen können!«, rief eine ältere Frau verärgert.
Drei der Störenfriede krempelten ihre Ärmel auf. Einige Damen hoben ihre Sonnenschirme und wirkten entschlossen, die Männer, wenn nötig, eigenhändig aus dem Saal zu werfen.
»Mir gefällt das nicht. Wir sollten besser verschwinden«, sagte Emily zu Lucy.
Die Freundin hakte sich bei Emily unter. Die Männer versperrten den Haupteingang, daher drückten sie sich durch die Menge, die immer mehr in Bewegung geriet, in Richtung der Tür hinter dem Podium. Plötzlich ging alles blitzschnell. Trillerpfeifen schrillten und durch beide Türen strömten Polizisten, Gummiknüppel in den erhobenen Händen. Rund zwei Dutzend Frauen stürzten sich auf die Störenfriede und die Polizisten, schlugen mit ihren Schirmen und Handtaschen auf deren Köpfe, und die Männer ließen die Fäuste fliegen. Emily und Lucy wurden voneinander getrennt. Emily hatte bereits das Podium erreicht, als eine Hand sie grob an der Schulter packte und herumriss. Es war ein Gesetzeshüter, der sie zornig musterte und knurrte: »Miststück! Verdammte Suffragette! Ihr gehört alle eingesperrt!«
»Lassen Sie mich los! Ich habe nichts getan!«
Der große, starke Mann griff nach ihrem Arm und drehte ihn auf Emilys Rücken. Der Schmerz raste durch ihren ganzen Körper. Sie schrie laut auf. Reflexartig holte sie mit der freien Hand aus, um dem Mann ins Gesicht zu schlagen. Da sauste sein Gummiknüppel auf ihren Kopf zu. Dann wurde es um Emily herum dunkel …
Gleich einem Häufchen Elend kauerte Emily in dem Ohrensessel vor dem Kamin. In ihrem Kopf pochte und klopfte es, auf ihrer Stirn prangte eine handtellergroße, blau-grüne Beule, und das Licht schmerzte in ihren Augen. Am schlimmsten aber waren die Worte ihrer Mutter, die schrill in ihren Ohren dröhnten. Henrietta saß auf dem Sofa und hatte in der letzten halben Stunde mit ihren nervösen Fingern schon das zweite Taschentuch zerrissen.
»Diese Schande! Diese unglaubliche Schande! Meine Tochter im Gefängnis! Wir können uns nirgendwo mehr blicken lassen! Niemand wird uns jemals wieder einladen, man wird jede Tür vor uns verschließen! Man …«
»Beruhige dich, Henrietta«, sagte Alwyn Tremaine streng. »Das Unglück ist geschehen und nicht mehr zu ändern.« Bisher war er im Zimmer auf- und abgegangen, jetzt blieb er vor Emily stehen. »Was hast du dir dabei gedacht, Nichte?«
»Ich habe nichts Unehrenhaftes getan. Ich bin unschuldig …«
»Das behaupten alle Verbrecher«, warf Henrietta spitz ein.
»Nun übertreibst du aber, Henrietta«, sagte Alwyn. »Ich habe mich erkundigt. Die Versammlung war bei den Behörden als aufwieglerische Zusammenkunft gegen die Krone gemeldet worden. Es ist zu vermuten, dass die derben Männer geschickt wurden, um die Menge aufzumischen, damit die Polizei eine Handhabe zum Einschreiten bekommt. Insgesamt wurden sechsundzwanzig Frauen verhaftet. Gegen keine wird jedoch Anklage erhoben. In den nächsten Tagen werden alle wieder freikommen.«
»Was ist mit Mrs Pankhurst?«, fragte Emily.
»Ihr ist nichts passiert, sie konnte entkommen«, antwortete Alwyn schroff. »Allerdings ist sie für die Polizei kein unbeschriebenes Blatt. Die Suffragette verbrachte schon so manche Nacht in einer Zelle.«
»Onkel Alwyn, ich danke dir, dass du mich so schnell aus dem Gefängnis geholt hast.« Emilys Versuch zu lächeln endete kläglich mit einem stechenden Schmerz hinter ihrer Stirn. Mit Grausen dachte sie daran, wie sie in dem Lastkraftwagen mit den vergitterten Fenstern wieder zu sich gekommen war. Eingepfercht zwischen anderen Frauen, die entweder lauthals schimpften oder weinten. Man brachte sie in die Frauenabteilung des Gefängnisses Wandsworth im Süden Londons. Dort sperrte man zwanzig Frauen zusammen in eine Zelle, in der kaum Platz für zehn war. Ein Wärter stellte ihnen einen Kübel mit Wasser zum Trinken und zwei Laibe trockenes Brot hin und spuckte in hohem Bogen vor den Gefangenen aus. Eine der Frauen riss einen Streifen Stoff von ihrer Bluse ab, tränkte ihn mit dem Wasser und legte ihn auf Emilys Beule. Auch andere hatten Blessuren erlitten, keine war aber ernsthaft verletzt. Den Gesprächen entnahm Emily, dass einige bereits zuvor verhaftet und eingesperrt worden waren.
»Wenn sie uns nicht schnell wieder rauslassen, treten wir in den Hungerstreik«, sagte eine Frau in Emilys Alter. Andere stimmten ihr zu.
Emily hatte davon gehört, dass Frauenrechtlerinnen in den Gefängnissen immer wieder die Nahrungsaufnahme verweigerten und wie sie dann zum Essen gezwungen wurden. Zum ersten Mal in ihrem Leben bekam Emily wirklich Angst. Bisher hatte sie sich für mutig gehalten. Es war aber eine andere Art von Mut, im Armenviertel der Stadt Suppe und abgelegte Kleidung zu verteilen als im Gefängnis in den Hungerstreik zu treten.
Dies blieb Emily erspart. Am nächsten Vormittag wurde die Zellentür geöffnet, ihr Name gerufen und sie in einen nahezu kahlen Raum geführt, in dem sie zu ihrer Erleichterung von Alwyn Tremaine erwartet wurde.
»Ich bringe dich nach Hause«, waren seine einzigen Worte. Während der rund einstündigen Kutschfahrt schwieg er und starrte teilnahmslos durch das Fenster.
Seit über einer Stunde musste Emily nun die Vorwürfe der Mutter über sich ergehen lassen.
»Dein Name wird wohl schon in der Zeitung stehen«, jammerte Henrietta. Behände sprang sie auf und lief jetzt auch nervös auf und ab.
»Morgen wird es neue Schlagzeilen geben, die heutigen Nachrichten sind dann schon wieder Vergangenheit«, bemerkte Alwyn bedächtig. »Außerdem ist es mir gelungen, Emmelines Name herauszuhalten, ebenso, warum ich sie heute aus dem Gefängnis holen konnte.« Vielbedeutend sah er Emily an und rieb Daumen und Zeigefinger aneinander.
»Danke«, wiederholte Emily. »Nun stehen Mutter und ich noch tiefer in deiner Schuld.«
»Wir sind eine Familie, wenngleich weitläufig miteinander verwandt«, erwiderte Alwyn trocken. »Auch mir ist daran gelegen, den Namen Tremaine frei von Skandalen zu halten. Eine Nichte, die einen Vertreter der Staatsgewalt tätlich angreift, ist jedoch eine Angelegenheit, die nicht leicht zu verdauen ist.«
Emily versuchte, die Umstände zu erklären. »Der Polizist hat mich grundlos angegriffen. Lucy und ich wollten den Saal verlassen. Ich war schon fast an der Tür, als er mich packte und mir den Arm auf den Rücken drehte. Ich habe nur versucht, mich zu wehren. Ich überlege, den Mann zu melden.«
Henrietta fuhr auf ihre Tochter los: »Nichts dergleichen wirst du tun! Wage es bloß nicht, sonst ist in meinem Haus kein Platz mehr für dich, Emmeline!«
Emily konnte nicht einschätzen, wie ernst die Mutter es meinte. Im Moment war es auf jeden Fall besser, nicht länger daran zu rühren. Die Tatsache, dass Polizeibeamte unschuldige Frauen angriffen, wollte sie aber nicht für immer auf sich beruhen lassen.
Henrietta stutzte, runzelte die Stirn und fragte: »Alwyn, wann wirst du nach Cornwall zurückkehren?«
»In den nächsten Tagen.«
»Du solltest Emily mitnehmen.«
»Wie bitte?«, riefen Emily und Alwyn unisono, und Emily fuhr hoch. »Du willst mich fortschicken?«
»Nur für ein paar Wochen, vielleicht zwei, drei Monate«, antwortete Henrietta. »Bis Gras über die Sache gewachsen ist.«
»Ich kann meine Freunde nicht im Stich lassen«, begehrte Emily auf. »Die Armenspeisung …«
»Zeigt, wohin dich deine angeblichen Freunde bringen«, schnitt die Mutter ihr scharf das Wort ab. »Nämlich ins Zuchthaus! Ich verbiete dir weiteren Kontakt zu diesen … diesen Subjekten.«
»Aber Mum …«
»Es ist gar kein schlechter Vorschlag«, wandte Alwyn nachdenklich ein. Ihn schien so leicht nichts aus der Ruhe zu bringen. »Wie du weißt, Henrietta, bin ich noch kein Jahr zurück in England. Der Besitz, die Zinnminen und alles, was damit zu tun hat, sind mir noch nicht bis ins Detail vertraut. Der Haushalt wird zwar bestens von einer Haushälterin und einem Butler geführt, eine weitere weibliche Hand, die auf alles ein Auge hat, würde dem Haus sicherlich nicht schaden. Emmeline ist in einem Alter, in dem sie die Haushaltsführung beherrschen sollte.«
»Dann darf Emily dich begleiten?«, fragte Henrietta hoffnungsvoll. »Und in Cornwall wird niemand von ihren seltsamen Umtrieben hier erfahren?«
»Ich kann es mir durchaus vorstellen, ja. Auf dem Land wird meine Nichte auf andere Gedanken und wieder zu sich selbst kommen.«
Emily rang die Hände. »Könnt ihr bitte aufhören, über mich zu sprechen, als sei ich nicht anwesend? Meine Meinung interessiert euch wohl nicht?«
»Nein«, antwortete Henrietta kühl. »Aus der skandalösen Situation müssen wir das Beste machen, und es ist nur von Vorteil, wenn du London verlässt, Tochter.« Sie sah zu Alwyn. »Wann könnt ihr reisen?«
»In zwei Tagen.« Skeptisch musterte er Emily. »Du brauchst nicht viel zu packen. Praktische, einfache Kleidung ist ausreichend. Auf Higher Barton leben wir zurückgezogen. Hin und wieder unvermeidbare Einladungen zum Tee bei den Nachbarn, oder jemand kommt bei uns vorbei. Größere Festivitäten sind nicht geplant.«
Emily wusste, wann jedes weitere Wort Verschwendung war und sie verloren hatte. So blieb ihr nichts anderes übrig, als zustimmend den Kopf zu senken. Den Seufzer, der tief aus ihrem Herzen kam, konnte sie jedoch nicht unterdrücken.
ZWEI
Sir Alwyn Ralph George Arthur, Lord Tremaine, hatte die Kunst der leichten Konversation wahrlich nicht erfunden. Unmittelbar nachdem sie am frühen Morgen an der Station Paddington den Zug gen Westen bestiegen und sich in einem Abteil der ersten Klasse eingerichtet hatten, schlug er die TIMES auf und studierte seitdem deren Finanz- und Wirtschaftsteil. Mit Emily wechselte er kein Wort. Auf ihre Frage, wie lange die Fahrt nach Westen dauern würde, antwortete Alwyn einsilbig: »Sieben bis acht Stunden«, und vertiefte sich wieder in den Börsenteil der Zeitung.
Nachdem die Bahn die westlichen Stadtteile passiert hatte und die Landschaft grüner und hügeliger wurde, nahm Emily ein Buch aus der Tasche. Es war ein Jane-Austen-Roman, ihrer bevorzugten Schriftstellerin. Auch wenn sich Emily in den romantischen Geschichten verlieren konnte und für Stunden in einer anderen Welt weilte, vermischte sie die fiktiven Romane nicht mit der Realität. Emily verstand, warum sich Frauen vor einhundert Jahren derart unterwürfig verhalten hatten und ihr einziges Ziel gewesen war, eine gute Ehe einzugehen. Auch wenn Austens Heldinnen selbstbewusst und im Denken ihrer Zeit weit voraus waren, endete jede Geschichte schließlich mit der Ehe. Diesbezüglich hatte sich die Situation der Frauen aus höheren Gesellschaftsschichten nicht wesentlich verändert, obwohl Damen wie Emmeline Pankhurst und Gleichgesinnte auf einem guten Weg waren. Heute konnte sich Emily auf die Geschichte von Catherine und Henry auf Northanger Abbey nicht konzentrieren und sah immer wieder aus dem Fenster. Der dichte Nebel, der am Morgen London eingehüllt hatte, hatte sich in dunkle, tiefhängende Wolken verwandelt. Immer wieder prasselten Schauer gegen die Fensterscheiben. Die Eisenbahn passierte kleinere Städte und Dörfer mit strohgedeckten Dächern, weitläufige Wiesen, auf denen Schafe und Rinder dem Wetter trotzend weideten, und Äcker, deren Früchte schon abgeerntet waren. Inzwischen war die Zeitung Alwyn aus den Händen geglitten, sein Kopf zur Seite gekippt und er schnarchte durch die geöffneten Lippen. Ungeniert betrachtete Emily den Großonkel. Ihrem Vater sah er kein bisschen ähnlich, dafür war die Verwandtschaft dann doch zu weitläufig. Für sein Alter war Alwyn Tremaine als durchaus attraktiv zu bezeichnen. Die grauen Strähnen in seinem schwarzen Haar gaben ihm ein interessantes Aussehen. Lediglich die Hakennase störte die Harmonie des langen, schmalen Gesichts. Emily fragte sich, ob die Nase des Onkels gebrochen war. Eine Schlägerei passte aber so gar nicht zu dem distinguierten Gentleman. Andererseits: Er hatte lange in Indien gedient. Dabei war er sicher in diverse Gefechte geraten. Sein dunkelgrauer Anzug aus allerbestem Stoff war von schlichter Eleganz, das weiße Hemd makellos rein und die Krawatte dezent gemustert.
Er schlug die Augen auf und sah Emily direkt an. »Gefällt dir, was du siehst, Nichte?«
»Ich wollte nicht …«
Alwyn winkte ab. »Ist schon gut, wir müssen uns ja erst kennenlernen. Allerdings möchte ich hier und heute eine Sache klarstellen: Ich werde dich nicht heiraten, Emmeline.«
Emily verschluckte sich an der eigenen Spucke. Erst nach einem Hustenanfall war sie in der Lage zu fragen: »Wie kommst du denn auf einen solchen Gedanken, Onkel?«
Sein Lächeln war nicht mehr als eine vage Andeutung. »Die Gedanken deiner Mutter stehen ihr auf der Stirn geschrieben. Es ist nur natürlich, dass Henrietta eine passende Ehe für dich möchte. Immerhin hast du die besten Jahre bereits hinter dir, eine große Mitgift hast du auch keine vorzuweisen. Unter solchen Umständen ist es schwer, einen Ehemann aus deinen Kreisen für dich zu finden, wenngleich du trotz deines Alters noch ganz ansehnlich bist.«
Empört schnappte Emily nach Luft. »Ich will gar nicht heiraten! Mein Ziel ist es nicht, die eigene Persönlichkeit aufzugeben, einem Mann den Haushalt zu führen, jedes Jahr ein Kind zu bekommen und mein Leben nach den Bedürfnissen meines Gatten auszurichten. Außerdem war ich schon mal verlobt!«, fügte sie mit Nachdruck hinzu.
Alwyn nickte. »Henrietta erwähnte die unglücklichen Umstände.« Er musterte sie abschätzend. »Wie lange ist dein Verlobter jetzt schon tot?«
»Edward starb vor sechs Jahren an einem Fieber.« Emily senkte den Blick und merkte, wie das Blut ihr in die Wangen schoss. »Ich habe ihm Treue geschworen. Das gilt auch über den Tod hinaus«, fügte sie leise und hoffentlich überzeugend hinzu.
»Ich verstehe, Emmeline. Nun, ich habe deiner Mutter versprochen, mich um dich zu kümmern und dein krauses sozialistisches Gedankengut zu ordnen. Alles Weitere wird sich zeigen.«
Emily sah ihm auffordernd ins Gesicht. »Gerade du solltest mich am besten verstehen, Onkel Alwyn. Deine Frau ist in Indien gestorben und du hast …«
»Meine Privatangelegenheiten haben dich nicht zu interessieren, Nichte!« Alwyns Lippen wurden zu einem schmalen Strich.
»Dann sind wir uns wenigstens in dem Punkt einig«, erwiderte Emily kühl. Sie unterdrückte einen Seufzer. Alwyn Tremaine schien ein überheblicher Hagestolz zu sein. Der Onkel sollte ruhig im Glauben bleiben, sie trauere immer noch um ihren Verlobten und bemühe sich deswegen nicht um einen Ehemann. Natürlich hatte sie Edward gemocht und geschätzt, sonst hätte sie seinen Antrag nicht angenommen, um ihre Pflicht zu erfüllen. Über seinen überraschenden Tod war Emily bestürzt gewesen, nicht jedoch verzweifelt. Sie trauerte aufrichtig um Edward, aber mehr wie um einen guten Kameraden oder Bruder.
»Mag unsere familiäre Beziehung auch weitläufig sein, bist du doch mein Onkel«, sagte sie leise. »Auch wenn Mutter meint, es sei eine gute Verbindung, habe ich keinerlei Ambitionen, dich zu einer Ehe zu überreden. Dafür bist du mir auch zu alt, Onkel Alwyn.«
Seine Augenbrauen zuckten nach oben. »Du nimmst kein Blatt vor den Mund, Emmeline. Ich trage mich nicht mit dem Gedanken, jemals wieder zu heiraten.«
Gerade noch konnte Emily ihre Zunge zügeln, um nicht zu fragen, wer nach seinem Tod den Besitz erben würde. So viel sie wusste, waren ihre Mutter und sie selbst die letzten, die den Namen Tremaine trugen. Doch Emily hatte keine Ambitionen, ein altes Schloss irgendwo im äußersten Westen Englands zu erben. Solche Gemäuer waren marode, in den Wänden saß der Schwamm, die Dächer waren undicht und es zog durch alle Ritzen. Neben den ständigen Renovierungsarbeiten waren auch die Steuern hoch. Emily sah ihre Lebensaufgabe darin, anderen zu helfen und für die Frauenrechte zu kämpfen. Das war nur in London möglich, wohin sie hoffentlich bald zurückkehren würde.
»Darf ich dich um etwas bitten, Onkel Alwyn?«, fragte sie vorsichtig. Er nickte. »Würdest du mich Emily nennen? Immer, wenn Mutter mich mit Emmeline ansprach, hatte sie etwas an mir auszusetzen oder war der Ansicht, ich hätte etwas falsch gemacht.«
Zum ersten Mal seit Emily dem Onkel begegnet war, schmunzelte er. »Unter diesen Umständen kann ich mir vorstellen, dass du deinen Taufnamen aus Henriettas Mund häufig gehört hast.« Er zögerte. »Emily.«
»Das ist leider richtig«, erwiderte Emily erleichtert. Vielleicht war der Onkel gar nicht so streng und borniert. Vielleicht würde die Zeit in seinem Haus gar nicht so schlimm werden.
In Plymouth mussten sie den Zug wechseln und nutzten den Aufenthalt für einen leichten Lunch in einem erstaunlich guten Restaurant in der Bahnhofshalle. Für einen Moment kreuzte sich Emilys Blick mit dem eines großen, breitschultrigen Mannes. Obwohl es angenehm warm war, hatte er den steifen Kragen seines schwarzen Mantels bis zu den Ohrläppchen hochgeschlagen. Sein Gesicht war glattrasiert, seine Nase breit und etwas platt. Auf Emily machte er einen grimmigen, verschlossenen Eindruck. Nach dem kurzen Blickkontakt widmete sich der Reisende wieder seiner Suppe. Emilys Interesse an der dunklen Gestalt erlosch, da jetzt ein Bahnbeamter herumging und den Wartenden mitteilte, der Anschlusszug nach Penzance würde sich um zwei, eher sogar drei Stunden verspäten.
Alwyn seufzte. »Hoffentlich kommen wir noch vor Sonnenuntergang zu Hause an.«
Sie bestellten sich eine zweite Kanne Tee, und Emily aß einen Scone mit Rosinen, den sie dick mit goldgelber Butter bestrich. Als Alwyn wieder zu der Zeitung griff, versuchte sich Emily auf ihren Roman zu konzentrierten, was ihr jetzt auch gelang. Die Verspätung zog sich tatsächlich an die drei Stunden hin, dann fuhr die Bahn endlich ein. Beim Einsteigen bemerkte Emily den dunkelgekleideten Mann. Er fuhr mit demselben Zug ebenfalls gen Westen. Er bestieg ein Abteil der zweiten Klasse, Emily und Alwyn richteten sich wieder in der ersten Klasse ein.
Wenige Minuten, nachdem der Zug den Bahnhof verlassen hatte, kam ein breiter Fluss mit einer mächtigen, grauen Stahlbrücke in Sicht.
Alwyn deutete auf das gegenüberliegende Ufer. »Dort ist Cornwall, von der Grafschaft Devon getrennt durch den Fluss Tamar.« Obwohl er lange Jahre in Indien gelebt hatte, schwang Stolz in seiner Stimme. »Durch den Bau der Brücke, die offiziell Royal-Albert-Bridge heißt, in der Mitte des letzten Jahrhunderts wurde das Herzogtum an das englische Eisenbahnnetz angeschlossen und kann nun von London und anderen Großstädten aus problemlos erreicht werden.«
»Allerdings missfiel vielen die von Isambard Kingdom Brunel entworfene Stahlkonstruktion. Sie fanden sie ausgesprochen hässlich, eine Verschandelung der Landschaft, obwohl die Brücke als ein Wunderwerk der damaligen Technik galt.«
»Du hast dich informiert, Emily?«, fragte Alwyn sichtlich überrascht.
Sie nickte. »Technik interessiert mich. In England und Schottland zeichnet sich Brunel für einige bemerkenswerte Tunnelanlagen und Brücken verantwortlich.«
Langsam, beinahe im Schritttempo, passierte der Zug die Brücke. An einem Pfeiler erkannte Emily ein übermannsgroßes, buntes Schild. Ein schwarzes Wappen mit goldenen Punkten, umrahmt von einem blau-weißen Banner, wurde von zwei Männern gehalten. Einer in der Kluft eines Fischers, der andere ein Bergmann.
»Das Wappen von Cornwall«, erklärte Alwyn. »Die Fischerei und der Bergbau sind die beiden Säulen, auf denen der Wohlstand der Cornishmen ruht. So nennen sich die Einwohner selbst.«
»Vergiss nicht den Schmuggel und die Wrackräuberei, Onkel Alwyn!«
»Du liest zu viele Schauerromane«, erwiderte er und drohte ihr spielerisch mit dem Finger. »Es mag auch heutzutage noch Schmuggler geben, ihre Blütezeit ist aber lange vorüber. Auch derer, welche falsche Positionslichter auf den Klippen entzündeten, um Schiffe auf die Riffe zu locken, und das Strandgut stahlen. Inzwischen geht es in Cornwall ruhig und gesittet zu.«
»Du hast eine Mine, aus der Erz gefördert wird, nicht wahr?«
»Zu Higher Barton gehören zwei Zinnminen, die immer noch florierend arbeiten«, antwortete Alwyn. »Das ist leider nicht mehr bei allen der Fall. In den letzten zehn, zwanzig Jahren mussten viele Minen schließen. Einerseits waren die Erzvorkommen erschöpft, es fehlt aber auch an guten Arbeitskräften.«
»Die Arbeit in den Minen ist nicht gerade gesund und ungefährlich«, gab Emily zu bedenken und fügte beim grimmigen Blick des Onkels schnell hinzu: »Das habe ich zumindest gelesen.«
»Man darf nicht alles glauben, was gedruckt wird. Bereits seit der Bronzezeit wurde Zinn und Kupfer in Cornwall abgebaut und gibt den Menschen Lohn und Brot.«
Da der Zug in der kleinen Stadt Saltash hielt, wurde Emily einer Antwort entbunden. Es war jetzt weder die richtige Zeit noch der Ort, um mit dem Onkel über seine Arbeiter zu sprechen. Emily wollte sich nicht auf die Lektüre verlassen, sondern sich mit eigenen Augen vor Ort ein Bild der Situation machen. Als die Bahn die Fahrt fortsetzte, öffnete der Himmel seine Schleusen. Tropfen, so dick wie Emilys Daumenfingernagel, klatschten gegen die Scheiben.
»In etwa zwei Stunden werden wir Bodmin erreichen«, erklärte Alwyn. »Dort wird uns der Kutscher erwarten. Das Personal habe ich telegrafisch über unser Eintreffen informiert.«
»Du hast kein Automobil?«
Alwyn runzelte unwillig die Stirn. »Ein solch stinkendes und knatterndes Gefährt kommt mir nicht ins Haus. Die hässlichen Blechbüchsen sind lediglich eine vorübergehende Modeerscheinung der Reichen. Niemals werden sie die Pferde und Kutschen ersetzen.«
Emily war anderer Meinung, denn in London gehörten Automobile längst zum Stadtbild. Auch das war kein Thema, das man bei einer Reise besprach. Je weiter sie nach Westen kamen, desto stärker wurde der Regen. Von der grünen, hügeligen Landschaft war kaum etwas zu erkennen, und es war fast so dunkel wie am Abend, dabei war es erst später Nachmittag. Erleichtert atmete Emily auf, als der Zug. Der Bahnhof von Bodmin bestand lediglich aus einem nicht überdachten Gleis. Zum Regen war nun auch ein böiger Wind aufgekommen.
»So starke Regenschauer sind im Herbst in Cornwall üblich«, erklärte Alwyn. »Das Wetter wechselt hier aber schnell. Morgen kann schon wieder die Sonne scheinen. Ich hoffe, die Wege sind nicht zu verschlammt und wir kommen zügig nach Higher Barton.«
Das hoffte Emily ebenfalls. Der Lunch lag schon wieder vier Stunden zurück. Ihr Magen knurrte und sie freute sich auf eine Tasse heißen Tee. Außerdem war sie gespannt auf das alte Haus, das sich seit Generationen im Besitz der Tremaines befand.
Alwyn lugte aus der Tür, hob dann die Hand und winkte. Ein mittelgroßer, kräftiger Mann in der Livree eines Dieners eilte mit einem aufgespannten Schirm zum Abteil.
»Willkommen zu Hause, Mylord. Ich dachte schon, der Zug würde heute nicht mehr ankommen.«
»Wir hatten eine ärgerliche Verspätung. Helfen Sie meiner Nichte, Bugle. Steht die Kutsche bereit?«
»Ja, Sir.«
Bugle hielt den Schirm über Emilys Kopf. Der Wind peitschte den Regen allerdings waagrecht über den Bahnsteig, sodass Emilys Mantel auf dem kurzen Weg zur wartenden Kutsche auf dem Vorplatz durchnässt wurde. Außer ihr und Alwyn war nur noch der dunkelgekleidete Mann aus dem Zug gestiegen. Emily bemerkte, wie sich der Fremde suchend umsah. Offenbar hatte er keinen Schirm zur Hand, und sein altmodischer Hut war binnen kurzer Zeit durchnässt. Emily stieg in die Kutsche. Sie war geräumig und die dunkelroten Samtpolster weich und bequem. Bugle eilte zurück, um Alwyn unter dem Schirm ins Trockene zu bringen, dann kümmerte er sich um das Gepäck. Der dunkle Mann stand immer noch wie verloren auf dem nun menschenleeren Platz.
Emily öffnete das Fenster, winkte und rief: »Können wir Ihnen behilflich sein?«
Langsam kam er näher. Das Wasser rann ihm in den Kragen. »Stehen hier keine Mietdroschken zur Verfügung?« Wie sein düsterer Gesichtsausdruck war auch seine Stimme dunkel.
»An dem kleinen Bahnhof lohnt sich das nicht«, brummte Alwyn aus dem Hintergrund und Emily fragte:
»Wohin möchten Sie denn, Sir?«
Der Fremde zögerte, dann sagte er unwirsch: »Nach Lower Barton.«
»Wir können Sie mitnehmen«, schlug Emily vor und sah, wie Alwyn unwillig die Lippen verzog. »Wir kommen doch durch Lower Barton, nicht wahr, Onkel? Somit ist es kein Umweg. Der gute Herr wird sonst bis auf die Knochen durchweicht und holt sich eine Lungenentzündung.«
»So schnell werde ich nicht krank«, murrte der Mann. Alwyns ablehnendes Verhalten hatte er durchaus bemerkt und antwortete: »Das ist freundlich, aber ich komme zurecht.«
»Ach, papperlapapp!«, rief Emily und stieß den Schlag auf. »Steigen Sie ein, bevor Sie sich auflösen.«
Er sah zum Himmel, der unvermindert seine Schleusen geöffnet hielt, und stieg in die Kutsche. Sein ganzes Gepäck bestand aus einer ledernen Reisetasche, die er unter die Sitzbank schob, dann nahm er gegenüber von Emily Platz. Alwyn klopfte mit dem Griff des Krückstocks, den er nur als Zierde benutzte, gegen das Kutschendach und die Pferde trabten an.
»Ich bin Ihnen sehr zu Dank verbunden.« Der Mann zog seinen Hut. Er hatte dunkelblondes, kurzes Haar und wirkte gleich weniger finster ohne die steife Kopfbedeckung, auch war sein Tonfall jetzt freundlicher. »Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle? Horatio Cranleigh aus Yorkshire.«
Alwyn musterte ihn mit einem abschätzenden Blick, dann sagte er: »Lord Tremaine, und das ist meine Nichte, Miss Emmeline Tremaine.«
»Besuchen Sie Verwandte in Cornwall?«, fragte Emily und wurde von Alwyn harsch unterbrochen:
»Das geht uns nichts an, Emily. Sei nicht so neugierig. Wir sind Mr Cranleigh lediglich behilflich, seinen Bestimmungsort zu erreichen.«
Cranleigh senkte dankend den Kopf. »Wofür ich Ihnen dankbar bin, Mylord«, wiederholte er. »Ich dachte nicht, dass an einer Bahnstation keine Mietdroschken zur Verfügung stehen und es keine andere Verbindung nach Lower Barton gibt.«
Alwyn blickte aus dem Fenster und sah keine Veranlassung zu antworten. Da der Fremde jetzt auf seine Fußspitzen starrte, als sehe er sie heute zum ersten Mal, schwieg auch Emily. Horatio Cranleigh war ihr irgendwie unheimlich, dabei sah er aus der Nähe betrachtet gar nicht übel aus. Der Mantel war aus gutem Stoff, aber alt, an den Ärmelaufschlägen abgestoßen. Der Stehkragen ging bis zum Kinn hinauf, und Cranleigh machte keine Anstalten, die oberen Knöpfe zu öffnen. Wie ein Kaufmann wirkte er nicht, für einen Bankier war er zu armselig gekleidet. Verstohlen musterte Emily seine Hände. Sie waren kräftig, frei von Schwielen, die Finger dünn, die runden Nägel sauber und gepflegt. Er ist also auch kein Bauer oder Handwerker, schloss Emily. Wahrscheinlich besuchte er Verwandte in Lower Barton. Onkel Alwyn hatte recht: Die privaten Hintergründe ihres Reisegefährten hatten sie nicht zu interessieren. Emily verfügte über einige Tugenden, eine davon war ihr ausgeprägter Gerechtigkeitssinn. Ihre größte Untugend aber war die Neugierde, wenngleich sie es selbst als Interesse bezeichnete. Der dunkle Mann würde in Lower Barton aussteigen, und sie würde ihn nie wiedersehen.
Nachdem der Wagen die befestigte Straße verlassen hatte, rumpelte er über Wurzeln und durch Pfützen. Das schmutzige Wasser spritzte bis an die Scheiben hoch. Der Weg war mit übermannshohe Hecken gesäumt, die jeden Blick auf die Landschaft verbargen. Nur vereinzelt wurde das Gestrüpp durch an der Straße liegende Cottages durchbrochen.
Niemand sprach, was Emily unerquicklich fand. Sie spürte, dass die Männer eine geistreiche Unterhaltung nicht wünschten. Durch die tiefhängenden Wolken wurde es immer dunkler und unablässig trommelten die schweren Tropfen auf das Kutschendach.
Nach einer halben Stunde schälte sich eine Ansammlung von zwei- bis dreistöckigen Häusern und niedrigen Cottages aus dem Einheitsgrau. Hinter den meisten Fensterscheiben leuchtete Licht. Die Hauptstraße war gepflastert, und Emily erkannte eine Bäckerei, eine Metzgerei und ein Kolonialwarengeschäft.
Alwyn fand seine Sprache wieder und sagte: »Wir haben Lower Barton erreicht. Wo wollen Sie abgesetzt werden, Mr Cranleigh?« Zumindest hatte sich Alwyn den Namen des Fremden gemerkt, dachte Emily.
»Bei der Kirche, wenn es Ihnen keine Umstände macht.«
Alwyn klopfte wieder mit dem Griff gegen das Wagendach und rief: »Bugle, halten Sie an der Kirche.«
Das Gotteshaus, ein niedriger, rechteckiger Bau aus grauen Quadersteinen mit einem quadratischen Turm, wirkte wie eine Festung aus dem Mittelalter.
Cranleigh setzte sich den Hut auf, öffnete den Schlag, nahm seine abgewetzte Reisetasche und bedankte sich ein weiteres Mal. Alwyn kommentierte es mit der Andeutung eines Nickens und Emily sagte freundlich: »Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Cornwall.«
Der Schlag fiel zu und sie setzten ihre Fahrt fort. Bis zum Haus des Onkels konnte es jetzt nicht mehr weit sein.
»Wir sind da«, sagte Alwyn nach etwa fünfzehn Minuten.
Die Kutsche passierte ein hohes Eingangstor, dessen schmiedeeisernen Flügel weit offenstanden. Durch die regennasse Scheibe erkannte Emily die Umrisse eines dreigeschossigen, rechteckigen Gebäudes mit einem von Zinnen gekrönten flachen Dach. Inzwischen war es nahezu dunkel. Lediglich hinter den Fenstern im Erdgeschoss brannte Licht. Die Kutsche hielt auf dem Kies vor dem Eingangsportal. Zu der geschlossenen, doppelflügeligen Tür aus dunklem Holz führten drei flache Stufen hinauf.
»Was ist hier los?«, fragte Alwyn verwundert. »Warum werden wir nicht erwartet?« Er öffnete den Schlag und rief dem Kutscher zu: »Bugle, wo ist das Personal? Telegrafisch gab ich die Anweisung, unsere Ankunft gebührend zu erwarten. Wo ist Marston mit den Schirmen? Und warum ist es im Haus nahezu dunkel?«
»Bevor ich die Pferde einspannte und zum Bahnhof fuhr, war alles bereit, Sie zu empfangen«, antwortete der Kutscher. »Allerdings sind wir verspätet.«
»Kein Grund, nicht parat zu stehen«, murrte Alwyn. »Sehen Sie nach, Bugle!«
»Es tut mir leid, Sir, aber wegen des Wetters sind die Pferde unruhig. Ich wage es nicht, abzusteigen und sie allein zu lassen, solange Sie sich noch in der Kutsche befinden, Mylord.«
»Onkel …« Emily legte eine Hand auf Alwyns Ärmel. »Du kannst den Schirm nehmen, ich laufe schnell zur Tür und öffne sie. Das Gepäck kann Mr Bugle hereinbringen, wenn er die Pferde ausgespannt hat.«
»Bugle, nur Bugle«, brummte Alwyn. »Das Personal ist nicht gewohnt, tituliert zu werden. Also gut, Nichte. Ich nehme den Schirm. Marston und Mrs Wilton können sich auf eine scharfe Rüge gefasst machen! Ich bin es nicht gewohnt, dass mein Personal nicht pünktlich zur Stelle ist.«
»Es wird sicher einen plausiblen Grund geben«, meinte Emily und sprang aus der Kutsche. Bis zum Eingang waren es nur wenige Schritte. Da Emilys Mantel ohnehin nass war, kam es auf den weiteren Regen auch nicht mehr an. Die Tür führte direkt in eine hohe Halle. Dort war es nahezu dunkel, so erkannte Emily lediglich die Umrisse einiger Möbel.
Alwyn runzelte die Stirn. »Warum brennen hier keine Lampen? Wo sind denn alle?«
Auf der anderen Seite der Halle hörten sie ein schepperndes Geräusch. Emily folgte dem Onkel durch eine offenstehende Tür in einen schmalen, dunklen Gang, der in die Wirtschaftsräume führte. Die Küche indes war hell erleuchtet. Ein junges, stämmiges Mädchen in einem grauen Kleid und einer makellosen, weißen Schürze stellte gerade einen Topf in ein Regal. Beim Anblick ihres Herrn zuckte sie zusammen, wurde dunkelrot und schlug sich eine Hand vor den Mund. Dann besann sich das Mädchen, knickste und murmelte kaum hörbar: »Mylord!«
»Bist du allein?«, herrschte Alwyn das verschüchterte Wesen an. »Wo sind Marston und Mrs Wilton? Nimm die Hand vom Mund weg und antworte gefälligst!«
Der Ton, in dem Alwyn mit dem Küchenmädchen sprach, stieß Emily bitter auf. Jetzt war aber nicht der richtige Zeitpunkt, Kritik zu üben, denn es war befremdlich, dass sonst niemand vom Personal anzutreffen war.
»Sie sind alle draußen«, flüsterte das Mädchen. »Es ist doch wegen dem, was Nell … Sie schrie ganz laut. Es war furchtbar, und dann sind alle raus …«
»Wer ist Nell?«, unterbrach Alwyn sie ungeduldig.
»Das zweite Hausmädchen, Mylord«, antwortete das Küchenmädchen. Sie schien sich langsam zu beruhigen. »Nell heulte und schrie, William sei was passiert. Dann sind alle zum Wald raus. Mr Marston sagte, ich soll hierbleiben und aufpassen, dass das Feuer nicht ausgeht.«
Alwyn griff nach einer der brennenden Öllampen. Er hielt Emily nicht auf, ihm zu folgen. Am hinteren Ende der Wirtschaftsräume führte eine Tür in einen quadratischen, von drei Seiten mit einer hohen Mauer umschlossenen Innenhof, in dessen Mitte ein altmodischer Ziehbrunnen. Eine niedrige, offenstehende Pforte führte in den Garten. Alwyn spannte den Schirm auf und hielt ihn über Emily. Sie folgten dem Pfad durch die angelegten Beete. Im schwachen Lichtschein erkannte Emily üppig wachsende Küchenkräuter, Rüben und das Grün verschiedener Kohlsorten. Hinter dem Garten öffnete sich eine weitläufige Wiese bis zu einem Wald. Kurz, bevor sie die Bäume erreichten, näherten sich Lichter. Aus dem Dunkel schälte sich eine Gruppe von Leuten. Alle trugen Lampen in den Händen, die im Wind hin und her schwankten.
Ein großer, breitschultriger, älterer Mann eilte Alwyn entgegen.
»Sir, es tut mir sehr leid. Einer der Diener hatte einen bedauerlichen Unfall.« Er sprach mit einer sonoren, emotionslosen Stimme.
»Was ist passiert, Marston?«, fragte Alwyn.
»Wir wissen es nicht. Nell, eines der Mädchen, fand ihn und holte uns zu Hilfe.«
Zwei Männer trugen den reglosen Körper eines Menschen. Marston, der Butler, hob seine Lampe. Emily erkannte einen noch jungen Mann, das Gesicht und das rot-blonde Haar blutüberströmt. Sein rechter Arm baumelte in einem unnatürlichen Winkel an der Seite hinab. In Emilys Magen bildete sich ein Klumpen. Instinktiv ahnte sie, dass dem Mann nicht mehr zu helfen war.
Resolut packte Alwyn Emily an den Schultern, drehte sie um und forderte sie auf: »Geh ins Haus.«
Emily machte sich aus seinem Griff frei und fragte mit belegter Stimme: »Ist er schwer verletzt?«
»Ich fürchte, er ist tot, Sir«, erklärte Marston. »Ich habe einen Burschen nach dem Arzt geschickt, der wohl nichts mehr für den armen Kerl wird tun können. Aber jemand muss den Totenschein ausfüllen.«
»Wie konnte das geschehen?« Emily meinte, einen ärgerlichen Unterton in der Frage ihres Onkels zu hören.