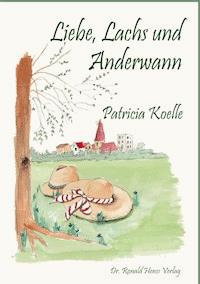9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nordsee-Trilogie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Der wunderbare Abschluss der großen Nordsee-Trilogie! Die Insel im Herzen Amrum, 1932. Der junge Skem Rossmonith liebt das Watt. Als sein Vater stirbt, muss er hart arbeiten, um sich und seine Mutter zu ernähren. Dabei macht er im Watt eine Entdeckung, die sein Leben verändert. Berlin, heute. Kunststudentin Valerie fällt aus allen Wolken, als sie erfährt, dass der Mann, den sie bisher für ihren Vater hielt, das gar nicht ist. Auf der Suche nach ihren Wurzeln begibt sie sich nach Amrum. Dort trifft sie den alten Skem, der ein Geheimnis hütet. Kann Valerie ihm helfen, dieses zu lüften und sich mit der Vergangenheit zu versöhnen? Und kann sie ihren wahren Vater finden? Unerwartet bekommt sie Hilfe … und trifft jemanden, der ihr Herz erobert. Dabei hatte sie sich doch geschworen, sich nie mehr zu verlieben!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 586
Ähnliche
Patricia Koelle
Was die Gezeiten flüstern
Roman
Über dieses Buch
Amrum, 1932. Der junge Skem Rossmonith liebt das Watt. Als sein Vater stirbt, muss er hart arbeiten, um sich und seine Mutter zu ernähren. Dabei macht er im Watt eine Entdeckung, die sein Leben verändert.
Berlin, heute. Kunststudentin Valerie fällt aus allen Wolken, als sie erfährt, dass der Mann, den sie bisher für ihren Vater hielt, das gar nicht ist. Auf der Suche nach ihren Wurzeln begibt sie sich nach Amrum.
Dort trifft sie den alten Skem, der ein Geheimnis hütet. Kann Valerie ihm helfen, dieses zu lüften und sich mit der Vergangenheit zu versöhnen? Und kann sie ihren wahren Vater finden?
Unerwartet bekommt sie Hilfe … und trifft jemanden, der ihr Herz erobert. Dabei hatte sie sich doch geschworen, sich nie mehr zu verlieben!
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Patricia Koelle ist eine Berliner Autorin mit Leidenschaft fürs Meer – und fürs Schreiben, in dem sie ihr immerwährendes Staunen über das Leben, die Menschen und unseren sagenhaften, unwahrscheinlichen Planeten zum Ausdruck bringt. Bei FISCHER Taschenbuch lieferbar ist die Ostsee-Trilogie mit den Bänden ›Das Meer in deinem Namen‹, ›Das Licht in deiner Stimme‹ und ›Der Horizont in deinen Augen‹, außerdem der alleinstehende Roman ›Die eine, große Geschichte‹. ›Wenn die Wellen leuchten‹, ›Wo die Dünen schimmern‹ und ›Was die Gezeiten flüstern‹ sind die drei Bände ihrer Nordsee-Trilogie, die auf Amrum spielt. ›Ein Engel vor dem Fenster‹ ist eine Sammlung von Wintergeschichten, ›Der Himmel zu unseren Füßen‹ ein Weihnachtsroman.
Inhalt
Widmung
Valerie
1 Tagfarben
2 Was in der Tiefe lebt
Skem
3 Skems Skepsis
Valerie
4 Frühstück mit Fragen
Skem
5 Skem und Marta
Valerie
6 Schlüsselfragen
7 Spuren
Schwupps’ wärmende Trostbrühe
Skem
8 Licht und Dunkelheit
Valerie
9 Umbrüche
10 In Afrika gibt es Wüsten
11 Die Bruchkante des Glücks
Skem
12 Skems Entdeckung
Valerie
13 Schritt für Schritt
Valerie
14 Alte Bilder, neue Sonne
Hannas Buchweizentorte
15 Aus dem Nest gefallen
16 Meeressteine
Skem
17 In der Weite
Valerie
18 Ange – Alessa
Alessas Sommerglückmarmelade
19 Nur die halbe Wahrheit
20 Töne an der Straßenecke
21 Schritte im Sand
22 Worte im Wind
23 Spurensuche
Skem
24 Am Fluss
Pommer’sche Schmandklopse
Valerie
25 Einblicke
26 Pinswins Plan und Fennos Frage
27 Im Windfindergarten
Skem
28 Abschied von der Persante
Valerie
29 Suchen und Finden
30 Dem Morgen entgegen
31 Vom Verschwinden der Zeit
Skem
32 Dämmerung in Krössin
33 Maries Glauben
Valerie
34 Kein Kompass
35 Der kleine Bruder des Leuchtturms
36 Familienangelegenheiten
37 Vom Töveree
38 Am Ende des Tages
Rheas überbackener Föhrer Schafskäse mit Salat
39 Der Ruf im Watt
40 Im Auge des Vogels
41 Klares Wasser
42 Erkenntnisse
43 Spurensuche
Epilog
Danksagung
Für alle, die immer wieder neu zu träumen beginnen.
Und für alle, auf die noch Träume warten.
Valerie
Berlin
2009
1Tagfarben
Das Geräusch zerriss die Stille am Ufer und weckte sofort ihre alten Instinkte. Sie hätte es überall erkannt.
Valerie hatte am Kanal gesessen und den Enten zugesehen, die sich von Frühlingsgefühlen umgetrieben auf dem Wasser jagten. Als das verstohlene metallische Klappern an ihre Ohren drang, stand sie auf und spähte den Abhang hinauf. Im Schatten unter dem Brückenpfeiler entdeckte sie ein Mädchen. Ungefähr dreizehn, dünn und mit einem unordentlichen dunklen Zopf. Es war genau, wie Valerie es geahnt hatte. Die Kleine hatte gerade eine Spraydose aus ihrer Schultasche geholt, sah noch einmal nach rechts und links und begann dann auf den Backsteinen eine wilde, trotzige Kritzelei. Valerie sah einen Moment zu, dann blickte sie auf die Uhr. Kopfschüttelnd stieg sie die Böschung hinauf. Das Mädchen war so in sein Werk vertieft, dass es vor Schreck die Dose fallen ließ, als es Valerie schließlich bemerkte. Erst wollte es die Flucht ergreifen, dann fiel ihm die Schultasche ein. Halb trotzig, halb schuldbewusst blieb es stehen. Valerie bückte sich nach der Dose. »Darf ich auch mal?«
Das Mädchen starrte sie nur verblüfft an. Valerie hatte sich längst geschworen, dies nicht mehr zu tun, aber es gab Verführungen, denen man nicht widerstehen konnte. Die Farbdose fühlte sich so vertraut in ihrer Hand an. Schon war der ungebrochene Drang, ihre Stadt bunter zu machen, wieder da. »Du machst es noch nicht ganz richtig«, sagte Valerie. »Erst musst du die Dose gründlich schütteln. Nicht nur so halbherzig.« Sie wies auf die matte Kritzelei. »Sonst ist deine Farbe viel zu wässerig. Ist doch schade drum. Eine Farbe muss leuchten. Siehst du, so! Ganz locker aus der Armbewegung heraus, aber kräftig. Das ist auch ein bisschen feierlich, wie eine Beschwörung. Gute Graffiti verlangen nach einer Zeremonie.« Wahrscheinlich interessierte das die Kleine überhaupt nicht, aber Valerie konnte nicht anders. Das Klappern der Mischkugel in der Spraydose war Musik in ihren Ohren. Als sie in dem Alter des Mädchens gewesen war, hatte ihr dieses Geräusch das Gefühl gegeben, mit der Kugel die ganze Welt bewegen zu können. Sprayen hatte Leben in ihre Tage gebracht und das Gefühl, etwas verändern zu können. Die Macht über das Aussehen von Oberflächen, wenigstens an den grauen Stellen der Stadt. Man fühlte sich so hilflos mit dreizehn. Da war diese kleine Macht aus den Farbdosen wie ein Rausch gewesen. Die Möglichkeit, eine Spur zu hinterlassen, wenn man an einem bestimmten Ort gewesen war. Ein Zeichen, dass man existierte und nicht völlig bedeutungslos war in diesem Gewirr von Menschen, Motoren und Mietshäusern.
»Außerdem macht man es nicht auf der Brücke, denn das ist Sachbeschädigung, sondern zum Beispiel hier«, fuhr Valerie fort und ging einige Schritte nach rechts, wo jemand Möbel an einem Bauzaun abgeladen hatte, darunter eine alte Matratze, in der sich Mäuse häuslich niedergelassen hatten. Hier war nichts mehr kaputtzumachen. Die Matratze lehnte aufrecht an den Brettern und gab eine prima Fläche für ein Bild ab. Valerie betrachtete die Dose in ihrer Hand. »Cadillac Pink«, las sie. »Nicht unbedingt meine Farbwahl, aber warum nicht.«
»Es war die billigste Farbe«, verteidigte sich das Mädchen, das ihr zögernd gefolgt war.
»Verstehe. Nun, es gibt keine Farbe, in der nicht eine Idee steckt. Gib ihr Raum! Du musst deine Hand mit Schwung bewegen, mit Mut, der aus dir herauskommt.« Sie zeichnete einen Flamingo auf die Matratze, während sie sprach, und dann noch einen. Die beiden Vögel sahen sich gegenseitig mit einem Lächeln im Winkel ihres Schnabels an. Ach, wie gut es sich anfühlte, mal wieder den alten Unfug zu machen! Valerie beobachtete aus dem Augenwinkel, wie das Mädchen sie erst verblüfft, dann mit zunehmender Bewunderung betrachtete. Verstohlen musterte die Kleine die zarte grüne Ranke entlang Valeries linker Ohrmuschel. Es war das einzige Tattoo, das sie jemals gewollt hatte, anders als die meisten ihrer Freunde, bei denen ständig eines dazukam. Es stand für Hoffnung und dafür, dass man immer wachsen konnte. Offen sein für den Himmel, egal, was kam. »Hast du noch eine andere Can?«
»Eine was?«
»Eine andere Farbdose.«
Ohne Valerie aus den Augen zu lassen, bückte sich das Mädchen und fischte eine weitere Dose aus ihrer Schultasche. »Manilagrün«, las Valerie. Sie schenkte den beiden Flamingos einen kleinen Wald aus Glücksklee und zwei Frösche als Zuschauer.
»Warum Klee? Warum nicht Palmen?«, wollte das Mädchen wissen.
»Wie heißt du eigentlich?«
»Tine.«
»Palmen hätte ich langweilig gefunden, Tine. Bei Flamingos denkt jeder an Palmen. Graffiti sollen überraschen. Und ausdrücken, was du denkst. Wenn ich Flamingos sehe, fühle ich mich ein bisschen glücklich, weil es so verrückte Vögel sind. Sieh sie dir an. Rosa! Der lange Hals, der komische Schnabel. Sie sind einfach wunderbar seltsam. Deswegen passt für mich der Klee dazu. Aber das kann jeder selbst entscheiden, der eine Farbdose in der Hand hat. Du hast die Macht über dein Werk. Du bist die Künstlerin. Nur denke um Himmels willen daran, deine Dosen richtig zu schütteln! Das bist du der Farbe schuldig. Und deiner Künstlerehre. Aber jetzt sollten wir uns schleunigst vom Acker machen. In ein paar Minuten kommen hier Leute vorbei. Die Schicht ist zu Ende, da vorne in der Fabrik.« Sie konnte nicht anders und signierte die Flamingos mit ihrem alten, geübten Schriftzug, bevor sie Tine die Dose zurückgab.
»Woher kannst du das?« Tine war im Begriff, die Dose in ihre Schultasche zu packen, als sie den Namen las, der da unter den Kleeblättern stand. »Rimo? Bist du etwa die Rimo?«
»Rimo war ich, als ich kaum älter war als du und in der Szene aktiv. Du musst dein Revier kennen, wenn du gut sein willst. Also, los jetzt, weg hier! Du bist zu jung, um dir unnötig Schwierigkeiten zu machen.«
Tine rührte sich nicht. Sie drückte Valerie die Dose wieder in die Hand und streckte ihr die Schultasche hin. »Gibst du mir da drauf ein Autogramm?« Valerie, deren feine Ohren Schritte wahrgenommen hatten, schimpfte unterdrückt vor sich hin, packte Tine am Arm und zog sie unsanft in die Büsche hinter die Reste eines Bauzauns. »Schhhh!«, zischte sie. »Duck dich!« Durch eine Lücke im Holz sahen sie zwei Männer heranschlendern, die stehen blieben.
»Da hat schon wieder ein Idiot Müll abgeladen«, schimpfte der eine. »Wart mal, ich ruf die Polizei. Oder das Ordnungsamt.« »Blödsinn, Franz. Mach dir nich so wichtig.«
»Aber die haben sogar auf die Brücke geschmiert!«
»Mensch, Franz. Die ham doch längst die Fliege gemacht. Außerdem sind die rosa Vögel echt schnieke. Muss ick an Malle denken bei. Saach ma, wat soll ick denn nu mit meene Berta machen? Meinste, det lohnt sich, die alte Karre noch ma flottzumachen?«
»Auf Malle leben keine Flamingos, Olli«, sagte sein Kollege, der sich offenkundig nicht allzu sehr für Berta und ihr Schicksal interessierte. Die Gefahr war vorüber. Sie würden die Polizei nicht rufen.
Valerie liebte dieses Wetter. Der Wind roch nach Aufbruch und Wachstum. Ein sanfter Aprilregen fiel in ihren Kragen und in die aufkommende Dämmerung. Als die Männer um die Ecke verschwunden waren, stand sie auf. Sie fühlte sich einen Augenblick lang selbst wieder jünger. Tine folgte ihrem Beispiel. »Danke. Aber jetzt bin ich schmutzig«, sagte sie und betrachtete finster die schlammigen Knie ihrer Jeans.
»Du wirst es überleben«, sagte Valerie amüsiert.
»Gibst du mir jetzt ein Autogramm? Das glaubt mir sonst kein Mensch.«
»Du bist wirklich neu in der Szene, oder? Das heißt nicht Autogramm. Das heißt Tag.«
»Das lern ich noch. Die andern quatschen alle so komisch, aber ich kapier das schon noch.«
»Das sind englische Begriffe. Die versteht man in der Szene auf der ganzen Welt. Mein Tag auf deiner Tasche bringt dir gar nichts. Ich bin längst ausgestiegen. Aber einen Rat gebe ich dir, davon hast du mehr.« Valerie sah Tine in die Augen. »Den willst du aber nicht hören, stimmt’s?«
Tine schob die Unterlippe vor und klemmte sich die Tasche unter den Arm. »Doch«, sagte sie schließlich.
»Du brauchst keine Autogramme von anderen. Arbeite selbst daran, gute, phantasievolle Sachen zu machen statt wütendes Gekritzel ohne Sinn. Das nennt man übrigens Bombing, wenn es dir nur um viele, schlechte Bilder geht. Dafür bekommst du keine Anerkennung, und es macht auch nicht zufrieden. Bemühe dich, Pieces zu schaffen oder, besser noch, Masterpieces. Bilder von Qualität. Entwickle einen guten Swing, also einen Schwung in deinen Bildern, und deinen persönlichen Style. Dann wird man dich in der Szene bald kennen. Du kannst dir einen eigenen Namen machen, auf den du stolz sein kannst, wenn du ihn unter deine Graffiti setzt. Das heißt, du signierst natürlich nicht mit deinem richtigen Namen, sondern mit deinem Tag, also deinem Künstlernamen. Denk dir einen guten aus.« Tine sah zweifelnd zu ihr auf. Valerie klopfte ihr auf die Schulter. »Das schaffst du. Aber bring dich nicht in Gefahr dabei. Ich hatte Freunde, die das Sprayen ihr Leben gekostet hat. S-Bahn-Gleise und Hochhäuser sind kein Beweis von Mut, sondern von Dummheit! Für Ärger mit der Polizei gilt das Gleiche. Verstanden?« Tine nickte stumm. »Ich werd an dich denken, wenn ich gute Graffiti in einem neuen Style sehe. Tschüs, Tine!«
Es war beinahe gruselig gewesen, dachte Valerie auf dem Heimweg. Das Mädchen hatte sie so sehr an ihre Vergangenheit erinnert, dass es war, als wäre sie sich selbst begegnet. Nur allzu gut wusste sie noch, wie es war, dreizehn zu sein und sich wie ein Nichts zu fühlen. Sie war in Tines Alter gewesen, als der Name entstanden war, unter dem man sie in entsprechenden Kreisen seither kannte. Damals hatte niemand sie gewarnt. Eine Streife hatte sie beim Sprayen erwischt und mit auf die Wache genommen.
»Wie heißt du? Wie alt bist du?« Die Frau hinter dem Tresen trug nicht mal eine Uniform, aber ihre Stimme war streng und viel zu laut in ihren empfindlichen Ohren. Eingeschüchtert hatte Valerie auf den gebohnerten Fußboden gestarrt, in dem sich das kalte Licht der Neonröhren spiegelte. Sie hatte nicht gewagt, den Kopf zu heben, als sie leise ihren Namen sagte.
»Wie bitte? Rimo? Ist das dein Vor- oder dein Nachname?« Die Frau mit dem Notizblock hatte nur die letzte Silbe ihres Vornamens und die erste ihres Nachnamens verstanden. »Valerie Mohagen«, sagte sie jetzt deutlicher.
»Aha.« Die Frau schrieb etwas auf. »Alter?«
»Dreizehn.«
»So. Dann gib mir mal die Telefonnummer deiner Mutter. Hallo! Hörst du mir überhaupt zu? Du sollst mir die Telefonnummer von deiner Mutter geben.« Sie hatte nicht zugehört. Sie war damit beschäftigt, über diesen neuen Namen nachzudenken. Rimo. Vor Freude darüber vergaß sie ihre Angst. Der Klang gefiel ihr. Sie fühlte sich wie eine Rimo. Sie stellte sich vor, in welchen Farben man den Namen zeichnen könnte und mit welchem Schwung. Aber jetzt musste sie erst einmal diese Frau loswerden, bevor sie es ausprobieren konnte.
»Meine Mutter ist tot.«
»Oh.« Die strenge Stimme wurde eine Spur freundlicher. »Dann muss ich mit deinem Vater sprechen.«
Sie nannte die Nummer. Die Frau wies ihr einen Platz auf einer Holzbank im Flur zu. Nach einer Weile kam sie und setzte sich neben Valerie. »Er kommt und holt dich ab«, sagte sie und reichte Valerie ein Bonbon. Anscheinend hatte sie beschlossen, nett zu sein. Vielleicht war es doch kein so schlimmes Verbrechen gewesen, die lila Schildkröte auf die Mülltonne zu sprühen.
»Ist deine Mutter schon lange tot?«, fragte die Frau.
»Schon ewig«, murmelt Valerie um das Bonbon in ihrem Mund herum. Es schmeckte nach Brombeeren. Ein bisschen wie die Marmelade, die ihre Mutter früher gekocht hatte.
»Kannst du dich noch an sie erinnern?«
»’n bisschen. Ja.«
»Woran ist sie denn gestorben?«
Warum dachten Erwachsene eigentlich immer, man fände es nett, wenn sie so neugierig waren? Valerie trommelte mit den Hacken ihrer lilabeklecksten Turnschuhe gegen die Bank. Aber es war wohl besser, höflich zu sein. Am Ende sperrten sie sie doch noch in eine Zelle. Dabei hätte sie am liebsten ihren neuen Namen in die Holzbank gekratzt, nur um ihn geschrieben zu sehen. »Eine Zecke hat sie gebissen. Dann ist sie krank geworden.«
»Das tut mir leid.« Im Zimmer rief jemand. Die Frau stand auf. Endlich. »Bleib hier brav sitzen«, sagte sie, als wäre Valerie ein Hund. Valerie riss einen Zettel von einem Brett ab, das im Flur hing, und malte darauf mit einem Bleistiftstummel aus ihrer Tasche ihren neuen Namen in immer neuen Formen, bis ihr Vater kam. Wenn sie erst Farbe in der Hand hatte, würde sie dafür ein sanftes, aber leuchtendes Blau benutzen, mit einem Rand aus Apricot. Sie mochte diese beiden Farbtöne. Wie der Himmel am Abend eines klaren Tages, kurz nachdem die Sonne untergegangen war. Der Name »Rimo« hatte noch einen anderen Vorteil. Wenn sie damit ihre Bilder signierte, würde niemand wissen, dass sie ein Mädchen war. Es gab nur wenige Mädchen unter den Sprayern, und sie bekamen selten Anerkennung.
In den Jahren danach machte sie diesen Namen in der Szene bekannt.
Das war jetzt lange her. Nur für diesen Augenblick gerade eben, mit der Dose in der Hand, war sie wieder die Rimo von damals gewesen, die bunte, stumme Botschaften in den grauen Tagen der Stadt hinterließ und damit ihre Unsicherheit, Unruhe und Einsamkeit bekämpfte. Die sich einen Platz in der Welt sprayen wollte. Jetzt studierte sie Germanistik und Kunstgeschichte und wunderte sich noch immer darüber. Es fühlte sich fremd an. Sie vermisste das geliebte Geräusch der Mischkugel, mit der man die Ordnung durcheinanderbringen konnte. Aber irgendwann war sie eben zu vernünftig und erwachsen dafür geworden. Valerie seufzte.
Eigentlich hätte sie heute für eine Klausur lernen müssen. Der nasse Apriltag jedoch roch zu gut nach Frühling. Sie hatte einfach nicht stillsitzen können, bis sie am Wasser war. Wasser beruhigte sie stets. Inzwischen war es zu dunkel für Wasserträumereien, obwohl hinter den Silhouetten der Hochhäuser noch eine Ahnung von Orange am Rand des Tages lag. Zeit, nach Hause zu gehen. Sie hatte eingekauft und wollte für ihren Vater kochen. Seit sie in ihre eigene Einzimmerwohnung gezogen war, machte sie sich ein wenig Sorgen, ob er sich gesund genug ernährte. Auch wenn die Wohnung im selben Haus war, nur viele Stockwerke höher, lebte nun doch jeder sein eigenes Leben. Sie gab sich Mühe, wenigstens einmal die Woche mit ihm zu essen, damit er überhaupt ein paar Vitamine zu sich nahm.
Ein Umweg musste aber noch sein.
Das Lied der Amseln behauptete sich frühlingshaft neben dem Verkehrslärm. Sven stand mit seinem Instrument wie immer um diese Zeit in der Unterführung zum U-Bahnhof. In der Radkappe, die er für die Münzen der Vorübergehenden hingestellt hatte, lag nur eine Handvoll Cent. Seine Augen leuchteten auf, als er Valerie sah, aber er hörte nicht auf zu spielen, bis das Stück zu Ende war. Dann schloss er sie in die Arme und küsste sie lange. Sie lehnte sich in seine Umarmung und in das vertraute Gefühl, angekommen zu sein. Seit sie zusammen waren, war es nicht mehr so wichtig gewesen, Spuren in der Stadt zu hinterlassen und ihren Namen in staubige Ecken zu kritzeln, um zu wissen, dass sie am Leben war. Bei Sven fühlte sie sich geborgen. Er roch nach Stadt, nach Teer und Motoröl und Rauch und dem Frittenfett von der Currybude oben auf der Straße. Sven eben.
»Wie war es heute in der Uni?«, fragte er.
»Weiß nicht. Ich war nicht dort.« Kritisch musterte sie sein Instrument. »Du, hier ist Farbe abgegangen. Da muss ich nachlackieren.« Das Instrument hatte er selbst gebaut, aus alten Rohren, durch die er blies wie in ein Didgeridoo der australischen Aborigines. Auch eine kleine Trommel war daran und eine Triangel und einige Saiten aus Draht. Er baute es ständig um. Kein Instrument in der Stadt klang wie dieses, das er »die Stadtröhre« nannte.
»Du, Rimo, ich hab da vielleicht was für dich. Wenn das mit der Uni doch nichts für dich ist. Ein Kumpel von mir, der hat einen Shop für Webdesign aufgemacht. Der braucht noch Hilfe.« Sven nannte sie immer noch Rimo. Sie hatten sich in der Sprayerszene kennengelernt. Es fühlte sich gut an. Bei ihm konnte sie alles sein, was sie war, auch das trotzige, verlorene Mädchen von damals.
»Damit kenne ich mich nicht aus.« Trotzdem horchte sie auf. Sven kannte sie zu gut. Wenn er das sagte, hatte er einen Grund dafür. »Das würdest du fix lernen. Er braucht wen, der sich mit Farben auskennt und mit witziger Gestaltung. Hip, cool und jung. Wie du.« Er lächelte sie voller Liebe an, dass sie sich wieder an ihn schmiegte. Mit fünfundzwanzig würden sie heiraten, hatten sie einmal ausgemacht. Nur so, um irgendwo in die Zukunft eine Markierung zu setzen.
»Kannst du mir ja mal zeigen, den Laden. Aber jetzt gehe ich nach Hause. Heute esse ich mit meinem Vater. Morgen kommst du zu mir, ja? Machst du noch lange?«
»Bisschen noch. Geht klar mit morgen. Tschüs, Süße.« Er blies wieder in das Mundstück. Ein kleiner Junge blieb bewundernd stehen.
Die etwas heiseren, leicht melancholischen Töne hallten im U-Bahn-Tunnel wider und folgten Valerie die Treppe hinauf noch ein Stück die Straße entlang. Sie dachte an Svens Vorschlag. In ihrem Magen kribbelte unterdrückte Aufregung. Der Uni entkommen! Etwas Neues machen. Aber sollte sie wirklich das Studium abbrechen? Nachdem sie es sich so hart erkämpft hatte?
Sie war zufrieden mit ihrem Tag, als sie die Haustür aufschloss. Statt Theorie, Grammatik und klassischer Dichtung endlich wieder einmal Farbgeruch und ein paar knallrosa Flamingos mitten im Gesicht des grauen Alltags. Im Treppenhaus roch es nach Kohl und Katzen. Valerie drückte auf den Lichtschalter an der Wand mit den zweiundzwanzig Briefkästen, aber nichts passierte. Egal, die Treppe hätte sie auch blind laufen können. Im ersten Stock sprang die trübe Birne plötzlich doch an. Gerade rechtzeitig, sonst wäre sie über ihren Vater gefallen, der auf dem zweiten Treppenabsatz saß, einen Brief in der Hand. »Pani? Was ist denn? Warum sitzt du hier?« Sie hockte sich neben ihn und beugte sich vor, um sein Gesicht sehen zu können. Er starrte nur auf das Kuvert. »Ich weiß nicht. Ich meine, ich warte auf dich. Es ist was passiert. Oder nein, doch nicht. Nicht jetzt.« Er hatte ihr einmal erzählt, wie es dazu kam, dass sie ihn Pani nannte. Er hieß eigentlich Kuno. Valeries Mutter hatte ihn »Kuni« gerufen. Ihrer kleinen Tochter hatte sie dagegen vorgesprochen: »Sag Papa. P-a-p-a!« Die kleine Valerie hatte schließlich »Pa-Ni« herausgebracht. Und das war hängengeblieben.
Pani neigte aber nicht dazu, konfus zu reden. Valerie war beunruhigt. »Was ist das für ein Brief? Soll ich den lesen?«
Aber er hielt ihn fest umklammert mit der Hand, an der ein Ringfinger fehlte. Seit damals. »Valerie, es sieht aus, als ob meine Angelika … deine Mutter …« Er holte tief Luft, versuchte es noch einmal. »Anscheinend hat sie noch gelebt. Hier steht, sie wäre erst im Sommer 2008 gestorben!« Jetzt hob er den Kopf, und sie sah Ungläubigkeit, Trauer und Verzweiflung in seinen Augen. Und noch etwas anderes. Was war das? »Valerie, das ist nicht einmal ein Jahr her!«
Sie versuchte vergeblich zu verstehen, was er meinte. In ihrem Kopf war nur Nebel. »Mama ist gestorben, als ich sechs war. Im Krankenhaus Moabit. Kinder durften nicht auf die Station, deshalb hast du mir das Haus von außen gezeigt. Damals war es schmutzig. Jemand hatte Blumen und Katzen auf die Wand gemalt. Das war vor sechzehn Jahren. Inzwischen haben sie es neu verputzt.«
Wortlos schüttelte er den Kopf, als könnte er nicht mehr damit aufhören. Im Treppenhaus ging das Licht aus.
2Was in der Tiefe lebt
Valerie wickelte sich enger in die alte Decke und drückte sich an den Schornstein. Er bot Windschutz und auch ein wenig Wärme, die aus dem Inneren des Hauses heraufstieg und durch die brüchigen Backsteine sickerte. Sie war tröstlich, fühlte sich an wie eine Ahnung der gesammelten Menschlichkeit all jener, die dort unten in den verschiedenen Wohnungen ihr buntes, zerrissenes, merkwürdiges Leben lebten. Valerie war in diesem Haus aufgewachsen und kannte doch nicht einmal alle, die darin wohnten. Sie kamen aus aller Herren Länder. Die Gesichter wechselten ständig. Und doch verband sie alle, dass sie an genau dieser Stelle auf der Welt und in diesen Tagen versuchten, mit sich selbst und miteinander zurechtzukommen und in dieser wirren, lebendigen Stadt Spuren von Glück zu finden. Manchmal auch nur die nächste Mahlzeit.
Hier oben war einer von Valeries Lieblingsplätzen. Noch lieber saß sie auf einer Brücke über der Spree und blickte hinunter in das dunkle Wasser, aber jetzt, mitten in der Nacht, hatte sie sich lieber hier herauf geflüchtet. An Schlaf war nicht zu denken.
Aus Pani war gestern Abend nichts mehr herauszubekommen gewesen. Sie hatte ihn schließlich in die Wohnung geleitet, vorsichtig wie einen Kranken. Sie hatte ihm einen Tee gemacht und Abendessen gekocht und viel zu viel Muskat in das Kartoffelpüree gemahlen, weil sie sich nicht konzentrieren konnte. Aber das war nicht der Grund, warum Pani fast nichts aß. Den Brief hatte er in sein Schlafzimmer mit der leeren Doppelbetthälfte getragen.
»Morgen, Valerie. Morgen erkläre ich dir, was ich weiß. Ich muss es selbst erst begreifen«, sagte er schließlich und schob seinen Teller fort. »Ich bin furchtbar müde. Gute Nacht.« Die Worte klangen verlegen und leer. Sie wussten beide, dass es keine gute Nacht werden konnte. Langsam und gebeugt war er aus dem Zimmer gegangen, als hätte der Briefumschlag alle Jahre seines Lebens enthalten, die plötzlich auf seinen Schultern lagen.
Mit Sicherheit konnte er ebenso wenig schlafen wie sie. Aber Valerie hatte früh gelernt, dass man den Menschen ihre Geheimnisse nur entlocken konnte, wenn man ihnen die Zeit gab, sie von selbst preiszugeben. Auf den Berliner Straßen schleppte jeder Geheimnisse mit sich herum und wusste sie mit einer scharfen Zunge, Berliner Witz und Galgenhumor ausgezeichnet zu übertünchen. So wie Valerie es durch ihre Farben auf hässlichen Wänden versucht hatte.
Hier auf dem Dach hatte sie ihr erstes Graffiti gemalt. Mit bunter Kreide. Für alles andere war sie noch viel zu klein gewesen, aber Kreide hatte sie immer in der Tasche, beinahe seit sie laufen konnte.
Sie erinnerte sich an den ersten Tag, als Pani sie mit auf das Dach genommen hatte. Er tat dies nur, weil es seine Arbeit war und er an diesem Morgen auf sie aufpassen musste. »Du bleibst in meiner Nähe!«, befahl er ihr mit seiner strengsten Stimme. Sie sah an seinen zusammengekniffenen Augen, wie ernst er es meinte. »Siehst du diesen dunklen Strich aus Teer, zwischen diesen beiden Bahnen Dachpappe? Wenn du auch nur mit dem großen Zeh darübertrittst, sperre ich dich unten ein, und du wirst mich nie wieder bei der Arbeit begleiten.« Sie begriff, dass er sich Sorgen um sie machte, und hielt sich darum diesmal an seine Anweisung. Nicht weil ihr die Abgründe um sie herum Angst machten, sondern weil sie unbedingt wieder mit heraufwollte. Sie fühlte sich vom ersten Augenblick an wohl auf dem Dach. Es war leiser als unten auf den Straßen. Staunend erkannte sie von oben ihr Revier wieder, das aus dieser neuen Perspektive erst fremd und dann vertraut erschien. Irgendwie verzaubert. Sie wusste, wie es sich anhörte, wenn man in der Sommerhitze unter den Linden stand und die Blätter raschelten. Aber sie hatte nicht gewusst, wie es von oben aussah, wenn die Sonne darauf funkelte und aus einem einzigen Grünton so viele machte, dass man sie nicht zählen konnte. Das Gurren der Tauben war hier lauter und die Möwen, die unter den Wolken segelten, weil der Wind sie von der Spree herübergelockt hatte, viel näher.
Pani arbeitete hier oben, weil er Rolltreppen und Aufzüge wartete und reparierte. Damit die Leute nicht darin stecken blieben oder wenigstens rasch befreit wurden, wenn sie doch hängen geblieben waren.
Nur wenn sie selbst im Leben steckenblieben, Pani und sie, dann konnte er nicht immer helfen, dachte Valerie. Dann hatte sie sich selbst wieder befreien müssen. Über die Jahre war das immer wieder vorgekommen. Aber noch nie hatte sie sich so hilflos und erstarrt gefühlt wie heute.
Damals hatte ihr der Vater erklärt, was er tat. »Ich mag meine Arbeit«, sagte er. »Ich bin immer zwischen Himmel und Erde unterwegs, jeden Tag.«
»Ich will aber nicht, dass du in den Himmel kommst wie Mama«, sagte Valerie.
»Keine Sorge! Immer, wenn ich dem Himmel näher komme, muss ich wieder runter«, hatte Pani gesagt. »Die Aufzüge und Rolltreppen fahren ja nur so weit, wie das Haus hoch ist, allerhöchstens bis aufs Dach.« Auch um seiner kleinen Tochter zu beweisen, dass der Aufzug nicht weiter durch das Dach hindurchfuhr, wie sie zuvor immer geglaubt hatte, hatte er sie mit hinauf genommen. Während er an einer Luke herumschraubte, die irgendetwas mit dem Aufzugsschacht zu tun hatte, malte Valerie eine Blume an den Schornstein. Mit grüner und roter Kreide. Vielleicht würde ihre Mama die von oben bemerken. Hier sah man sie von oben bestimmt viel besser als unten in den Wirren der Straßenschluchten.
Da sie die Blume auf der wetterabgewandten Seite gezeichnet hatte, waren noch Jahre später Spuren davon zu sehen, ehe der Regen auch den Rest abwusch. Ebenso wie die Blume fühlte sich Valerie fortan auf den Dächern der Stadt zu Hause. Pani ahnte zum Glück nicht einmal von der Hälfte der luftigen Orte etwas, an denen sie sich heimlich herumtrieb, später oft mit den falschen Leuten, die sich über jede Teerlinie in der Dachpappe hinauswagten. Sie waren damals keine Kinder mehr und auch noch keine Erwachsenen, und ihr eigenes Leben war ihnen nicht viel wert, so dachten sie jedenfalls. Das Ansehen unter den Kumpels galt ihnen mehr.
Aber Valerie war nie hinuntergestürzt, und darum fürchtete sie sich hier oben nicht. Von diesem Dach kannte sie jede Handbreit, auch im Dunkeln. Außerdem war es nie ganz finster über der Stadt, die keine Nacht kannte.
Der Regen von heute Nachmittag hatte auf der Dachpappe eine breite Pfütze hinterlassen, in der sich ein dünner Mond spiegelte, zusammen mit den Lichtern der Hochhäuser rundherum. Rot-, Grün- und Gelbtöne zitterten im Wind auf der Wasseroberfläche. Valerie beobachtete sie eine ganze Weile und dachte an gar nichts. Ins Wasser zu blicken half ihr immer. Nach einer Weile fühlte sie sich leichter. Man konnte nicht innerlich erstarrt bleiben, wenn man lange genug in dieses bewegte Bild sah. Selbst in der größten Verzweiflung oder dem, was sie dafür hielt, war dies immer ihre Rettung gewesen.
Das hatte sie ihrer Mutter zu verdanken und der einzigen Reise, die sie jemals mit ihr gemacht hatte.
»Ach, Mama«, sagte sie zu den schweigenden Wolken, die mondsilbern über ihr entlangsegelten, »wenn du gar nicht im sogenannten Himmel warst, konntest du meine Blume auch nicht sehen. Was ist nur geschehen? Was ist dein Geheimnis?« Sie sagte es laut, denn hier oben hörte sie niemand, und es war eine alte Gewohnheit von ihr. Sie glaubte schon lange nicht mehr daran, dass Tote in den Himmel kamen. Trotzdem war ihre Mutter immer eine feste Größe in ihren Gedanken gewesen. Angelika Mohagen hatte gelebt, und dann war sie gestorben, aber die Erinnerung an sie blieb lebendig. Und manchmal, wenn Valerie danach war, hatte sie sich hier oben mit ihrer Mutter unterhalten, weil es gelegentlich half, die Dinge auszusprechen. Solange man sich an jemanden erinnerte, war er auch noch irgendwie da, das hatte sie von Pani gelernt und auch von ihrem alten Freund Josef.
Aber jetzt war alles anders. Wenn ihre Mutter bis vor kurzem noch gelebt hatte, wo war sie denn die ganze Zeit geblieben? Das fühlte sich entsetzlich falsch an! Dann hätte sie doch hier sein müssen. Bei Pani und bei ihrer Tochter.
Valerie fühlte sich betrogen. Da hatte sie all die Jahre hier oben mit ihrer Mutter gesprochen, und ihre Mutter war gar nicht da gewesen, sondern hatte sich irgendwo herumgetrieben! Warum? Oder hatte sie wie im Film ihr Gedächtnis verloren? Sie glaubte nicht an solche Filme.
Es gab keine Antworten. Valerie musste darauf warten, dass der Morgen hinter den Fabrikschornsteinen über den Himmel schlich und Pani endlich mit ihr sprechen würde. Valerie blies in ihre Hände, um sie aufzuwärmen, und versuchte ein Bild ihrer Mutter heraufzubeschwören. Ihre Erinnerungen zumindest waren nicht falsch. Die waren unverrückbar und wirklich. Damals war alles in Ordnung gewesen, jedenfalls hatte sie das geglaubt. In jenem Sommer, als ihre Mutter sie mit an die Nordsee nahm und Valerie begann, das Wasser zu lieben.
Pani kam nicht mit. Er musste arbeiten.
Die Oma hatte sie eingeladen. Es war das erste und einzige Mal, dass Valerie ihre Oma traf, die ganz woanders wohnte und sich nie besonders für ihre Familie interessiert hatte. Dieses eine Mal wollte Oma offenbar nicht alleine Urlaub an der Nordsee machen, oder vielleicht hatte sie geahnt, dass es ihr letzter Sommer sein würde. Einen Opa hatte es nie gegeben, nicht für Valerie. Daran war etwas schuld, das sie Krieg nannten.
Die Oma war in Valeries Erinnerung eine große, hagere Gestalt ohne Gesicht, ein Schatten nur. Die wenigen Worte, die sie für Valerie hatte, waren spitz und lästig wie Mücken, die einem abends um die Ohren summten. »Sitz gerade, Kind.« »Die linke Hand gehört auf den Tisch!« »Schling nicht wie eine Wilde.« »Kannst du nicht lernen, dir die Haare ordentlich zusammenzubinden?« Irgendwann hatte Valerie heimlich die Schere geklaut und sich die Haare abgeschnitten. Das war der Oma dann auch nicht recht, aber ihre Mutter hatte nur gelacht. Valerie fand das Gefühl herrlich, wie der Wind durch die kurzen Stoppeln fuhr und sie lustig hochstehen ließ. Sie fühlte sich frei, frei von der Oma, frei von dem Gewicht und dem ewigen Bürsten, um die Knoten herauszubekommen.
Doch es war nicht nur wegen der kurzen Haare, dass sie sich so frei fühlte und leicht und ein bisschen wie ein Schmetterling, der über Wiesen flatterte. Es war vor allem dieser viele weite Raum um sie her. Dass man rennen konnte, ohne irgendwo gegen eine Mauer zu stoßen oder an eine Straße zu kommen, über die Lastwagen donnerten. Das endlose leuchtende Grün der Salzwiesen, der lange Weg oben auf dem Deich mit Schafen wie flauschige Punkte rechts und links, der Sand, der an den Füßen so weich und warm war.
»Zieh die Schuhe aus!«, ermunterte sie ihre Mutter, als sie zum ersten Mal zum Strand hinuntergingen, und tat es selbst. Verwundert sah Valerie ihr zu. Sie kannte Sand aus den dreckigen Kisten auf dem Spielplatz. Aber sie war noch nie barfuß gelaufen. Daran war in der Stadt nicht zu denken. Da gab es überall Glasscherben, Kaugummis, Zigarettenstummel, Hundehaufen und Schlimmeres. Aber wie herrlich war es hier, auf einmal auch an den Füßen zu spüren, was sie sonst nur sehen konnte!
So viel Platz zum Herumtoben und Denken und Atmen hatte Valerie noch nie erlebt. Es erschien ihr wie eine Welt aus einem Buch, eine Zauberwelt, ein Traum, der nicht wirklich sein konnte. Nur wenn ein Krebs sie in den großen Zeh zwickte oder sie sich an einer Muschelschale schnitt, fühlte sie, dass alles wirklich und diese fremde, unglaubliche Welt nicht nur ein Streich ihrer Phantasie war.
Das Schönste, von dem sie sich am allermeisten verzaubert fühlte, war das Wasser. Es war nicht dunkel wie das in der Spree oder im Teltowkanal, wenn man von der Brücke blickte. Es war flach und hell und glitzerte. Hier gab es nicht nur Tag und Nacht, hier gab es auch Ebbe und Flut. Wenn Flut herrschte, rauschten hohe Wellen und erzählten Geschichten. Wenn Ebbe war, reichte dasselbe Wasser Valerie nur bis zu den Knöcheln. Dann war es warm und sanft und glasklar, wenn sie darin herumwatete und auf dem Sandboden das Funkeln der Lichter tanzen sah, die die Sonne hineinstreute. Valerie entdeckte winzige Seesterne, huschende durchsichtige Garnelen, kleine Quallen wie aus Glas und seltsame Blumen, die lebendig schienen. Sie hatten einen Fuß und konnten sich fortbewegen! Das konnte doch nicht sein? »Was ist das, Mama?«
»Das sind Seeanemonen. Es sind Tiere, auch wenn sie wie Blumen aussehen und heißen. Man sagt auch Blumentiere.«
Blumentiere! Sie konnte nur in ein Märchen geraten sein.
Glück und Wasser waren für sie fortan eins.
Ihre Mutter hatte hier mehr Zeit für sie als sonst und las ihr, wenn sie im Strandkorb saßen, aus den Büchern vor, die sie im Hotel gefunden hatten. Da kamen Seeungeheuer vor, die Matrosen zu Tode erschreckten. Riesenkraken, die ganze Schiffe in die Tiefe zogen, Haifische, die Schiffbrüchige verspeisten, und Mördermuscheln, die Taucher einklemmten, bis diese ertranken.
»Aber Mama, warum ist in den Geschichten alles böse, was in dem schönen Meer lebt?«
»Sicher, weil die Geschichten sonst nicht spannend wären. Außerdem, was ist mit den Meerjungfrauen? Die sind doch nett.«
Aber mit den Meerjungfrauen, die sich im Mondlicht die Haare kämmten, sehnsüchtige Liebeslieder sangen und davon träumten, laufen zu können, weil sie an Land irgendeinen Prinzen küssen wollten, konnte Valerie nichts anfangen. »Mama, die nützen doch keinem was. Und das mit den langen Haaren glaub ich nicht. Wenn man an Land schon immer Knoten drin hat, dann ist das im Wasser viel schlimmer. Da wären auch immer Algen und so ’n Zeug drin.«
»Es sind ja bloß Geschichten.« Ihre Mutter verstand das Problem nicht, aber Valerie war es ernst. Sie grollte diesen Geschichten, die das Meer beleidigten und nichts Gutes darin fanden.
Einmal gingen sie ins Kino und sahen sich »Die unendliche Geschichte« an. Valerie verstand nicht alles, aber der fliegende Glücksdrache gefiel ihr. »Siehst du, das war ein guter Drache, der den Menschen hilft. So wie Engel. Warum gibt es dann so was nicht im Wasser?«
»Keine Ahnung, Kind. Das musst du dir eben einfach selber vorstellen.«
Genau das tat sie, als die Stadt sie wieder in Empfang nahm und umschloss, als wäre sie nie weg gewesen. Manchmal zog sie heimlich die Schuhe aus, oben auf dem Dach oder im Park auf dem Rasen, aber als sie in eine Rasierklinge trat, gab sie es wieder auf. Dafür saß sie oft auf der Brücke, baumelte mit den Beinen und starrte in die dunkle Spree, bis sie meinte, unter der Oberfläche hätte sich etwas bewegt. Bestimmt würde ihr Wasserglücksdrache irgendwann auftauchen. Wie er genau aussah, wusste sie nicht. An der See war es nicht so laut gewesen. Hier, in der vertrauten, lärmenden, ewigen Melodie der Stadt, die wieder über ihr zusammenschlug wie eine andere Art von Flut, fiel es ihr schwerer, sich Dinge auszudenken.
Für Valerie stand fest, dass sie im nächsten Sommer wieder an diese Nordsee wollte. Und sie mochte nie wieder lange Haare haben.
Doch im Winter starb die Oma und im Frühjahr Valeries Mutter, und es gab nie wieder einen Sommer an der See. Valerie wagte nicht, danach zu fragen. Pani hatte andere Sorgen, es war kein Geld da, und außerdem konnte sie sich das Meer ohne ihre Mutter nicht vorstellen.
Bald war sie sich nicht mehr sicher, ob der weiche Sand und das glasklare Wasser mit den Blumentieren nicht auch nur eine Geschichte gewesen waren, ein Film im Kino, den sie noch nicht ganz verstanden hatte.
Und jetzt, so viele Jahre später, nachts hier oben auf dem Dach, ging es ihr genauso. Pani hatte ihr stets gesagt, ihre Mutter wäre tot. Offenbar hatte er es selbst angenommen, denn der Schock und Unglaube in seinem Gesicht gestern waren unzweifelhaft echt gewesen.
Was nur hatte sie diesmal nicht verstanden?
Skem
Amrum
1927
3Skems Skepsis
»Aber Vater, warum musst du wieder auf ein Schiff?« Zweifelnd blickte Skem auf die aufgewühlte See und klammerte sich fest an die große, raue Hand seines Vaters. Es war Frühling, aber mit dem Frühling kamen auch Stürme. Heute wirbelten sogar noch einmal Schneeflocken über die Gischt, die Dünen und in den Kragen von Skems dickem, grobgestricktem Pullover. Sie blieben auch in Vaters Bart und seinen Augenbrauen hängen. Skem traute dem Frühling nicht, dem Sturm nicht und den Wellen auch nicht. Hatte er doch schon so oft gehört, dass Schiffe, wenn sie einmal so erschreckend klein hinter dem Horizont verschwunden waren, nie mehr wiederkehrten. Er hatte Frauen um ihre Männer oder Söhne weinen sehen und Kinder um ihre Väter. Er wusste, wie gefährlich es war, zur See zu fahren, und er wusste, dass auch vor Amrum schon Schiffe gestrandet waren. Da hatte der Leuchtturm nichts genützt, der hinter ihnen wie ein Schatten im Schneegestöber stand.
»Ich bin doch jedes Mal heil heimgekommen«, sagte Vater mit seiner beruhigend tiefen Stimme und hielt Skems Hand noch fester. »Und du weißt, dass ich den Lohn für uns verdienen muss.«
»Aber du könntest im Hotel arbeiten wie Großvater und Tante Beeke.«
Unwillkürlich blickte sein Vater nach Norden, wo in der Ferne hinter den Dünen der Schornstein von Alriks Kwaas zu sehen war. Skems Großvater Alrik hatte das Hotel gegen den Willen seines eigenen Vaters, des alten Garrelf Rossmonith, gebaut. Die Seefahrt war eine Familientradition der Rossmoniths, doch Alrik war aus der Art geschlagen. Er fürchtete sich vor dem Meer. Dass jetzt immer mehr Feriengäste zur Erholung nach Amrum reisten, kam ihm gerade recht. Zum Erstaunen der Familie bescherte ihm der Betrieb ein gutes Auskommen. »Das Hotel ist wie ein Schiff an Land. Es trägt meine Familie durch das Leben«, pflegte er zu sagen. »Und wenn ein Sturm kommt, so hat es nicht mehr zu verlieren als ein Stück seines Daches.«
»Weißt du, Sohn, ich schlage nun einmal mehr meinem Großvater nach und allen, die davor waren«, sagte Skems Vater. »Du weißt, ich vertrage mich nicht so gut mit meinem Vater, und ich wüsste auch nicht, was es für mich im Hotel zu schaffen gäbe. Kannst du dir vorstellen, dass ich mit der Köchin in der Suppe rühre oder gar die Nachttöpfe der Gäste leere?«
Nein, das konnte Skem sich nicht vorstellen. Vielleicht befürchtete sein Vater ja auch, dass Urgroßvater Garrelf ihn einen Feigling schimpfen würde, wenn er nicht aufs Meer fuhr. Skem hatte einmal gehört, wie Garrelf über Großvater Alrik gewettert hatte, den er einen Hasenfuß nannte, und das, obwohl er im Krieg gekämpft und einen Orden bekommen hatte. Aber alles, was an Land geschah, bedeutete Urgroßvater Garrelf nichts. »Wir Rossmoniths sind Seeleute, merk dir das, Junge«, erklärte er oft und schlug dabei Skem auf die schmale Schulter, dass er Mühe hatte, aufrecht stehen zu bleiben.
»Komm, Sohn, lass uns ein Stück am Strand entlangwandern. Vielleicht finden wir noch ein wenig Brennholz oder angeschwemmtes Gut.«
Die Erwähnung des angeschwemmten Guts beruhigte Skem nicht gerade. Ja, es half, wenn Dinge angeschwemmt wurden, die man noch gebrauchen konnte. Einmal war es ein Fass Schmalz gewesen und ein andermal ein Ballen Tuch, der nach dem Waschen und Trocknen noch verwendbar gewesen war. Eigentlich musste man solche Funde dem Strandvogt melden, doch damit nahm man es nicht immer so genau. Das Schmalz hatte wunderbar geschmeckt. Nur wenn Dinge angeschwemmt wurden, bedeutete dies, dass irgendwo ein Schiff untergegangen war.
Auch seinem Vater war aufgefallen, dass seine Bemerkung unglücklich gewesen war. Er hockte sich vor Skem hin und sah ihn ernst an. »Junge, habe ich dir nicht oft genug vom Töveree erzählt?«
»Doch, Vater. Es ist eine schöne Geschichte. Aber ich bin kein Kind mehr, das an Seemannsgarn glaubt.«
Sven Rossmonith öffnete den Mund, wohl um zu entgegnen, dass sein Sohn sehr wohl noch ein Kind sei, doch dann schloss er ihn wieder. »Ich weiß, mein Sohn. Es ist nicht leicht für dich, die Verantwortung für Mutter zu übernehmen, wenn ich so lange Zeit fort bin«, sagte er schließlich.
Skem war alt genug, um zu wissen, dass seine Mutter nicht wie manche anderen Mütter war, die tagaus, tagein resolut ihrer Arbeit nachgingen, egal, wie hart die Zeiten waren. Greetje Rossmonith war kränklich und ängstlich, und wenn ihr Mann nicht auf der Insel war, verließ sie sich auf Skem, als sei er schon ein Mann.
Manches Mal, wenn der Vater zu lange fort war, kam nicht genug Essen auf den Tisch, egal, wie viele Kaninchen Skem fing und Möweneier er sammelte. So hatte er früh aufgehört, an Märchen zu glauben. Das mit dem Tischlein, deck dich war nur eine dumme Geschichte. Es funktionierte nicht. Auch die Geschichte vom Töveree erschien ihm lächerlich, obwohl das die einzige war, welche ihm auch sein Vater erzählte, nicht nur Greetje, die gern aus alten Büchern vorlas. Gewiss diente sie nur dazu, kleine Kinder zu beruhigen.
Ein Fisch, so groß wie ein kleiner Wal, mit einem flachen Körper, einem spitzen Kiefer und obendrein noch Schwingen wie ein Rochen? Ein Fisch, der auf diesen gewaltigen flügelartigen Flossen angeblich aus dem Wasser steigen und ein Stück segeln konnte und auf dessen Haut große kreisförmige Schuppen ein bläuliches Licht von sich gaben? Das konnte ihm niemand weismachen. Immer wieder, so erzählte man sich, hätte dieses zauberhafte Wesen Schiffe, die in Stürmen in Not geraten waren, in sichere Gewässer geleitet. Vorwiegend im Winter glaubte man, diesen sagenhaften Fisch gesehen zu haben, je kälter es war und je größer die Not, desto häufiger.
Es war eine schöne Geschichte, aber sie überzeugte Skem nicht im Geringsten davon, dass dieses angebliche Wundertier seinem Vater in gefährlichen Gewässern zu Hilfe kommen würde, wäre es einmal notwendig.
Sein Vater legte ihm die Hände auf die Schultern. »Ich verrate dir ein Geheimnis, Sohn. Aber erzähle es nicht deiner Mutter. Es ist deinem Urgroßvater peinlich, es zuzugeben. Du weißt, er ist ein Mann, der sich gerne an die Fakten hält. Doch wenn du ihn danach fragst, wird er es dir bestätigen. Als dein Urgroßvater noch zur See gefahren ist, hat er den Töveree einmal höchstpersönlich gesehen. Zuvor glaubte er ebenso wenig an seine Existenz wie du jetzt.«
Skem machte große Augen. »Urgroßvater Garrelf hat den Töveree gesehen? Wirklich?«
»Mein Wort darauf.«
Skem zweifelte nicht am Wort seines Vaters, und doch wollte er dies von Urgroßvater Garrelf selbst hören. Bei nächster Gelegenheit würde er ihn danach fragen.
»Still, mein Junge! Nicht so laut!« Garrelf saß auf einem Fass im Hafen und pulte Krabben. Sein Alter und die Gicht waren daran schuld, dass er nicht mehr zur See fahren konnte, aber Krabben pulen konnte er noch. Die Großstädter, die neuerdings in Scharen hier einfielen wie die Zugvögel, um sich von dem Dreck und Lärm zu erholen, den sie selbst verursachten, waren ganz verrückt nach den Krabben und zahlten gutes Geld dafür. Außerdem konnte er dabei den Hafen im Auge behalten, wo er sich am wohlsten fühlte. Geniert sah er sich um. »Wenn dich jemand hört! Willst du, dass sie den Respekt vor mir verlieren? Schlimm genug, dass ich die Schiffsjungen nicht mehr herumjagen kann.« Er zwinkerte Skem zu.
»Aber ist es die Wahrheit, Urgroßvater?«, beharrte Skem mit gedämpfterer Stimme, obwohl er sich nicht vorstellen konnte, dass jemals einer den Respekt vor Garrelf Rossmonith verlieren könnte.
»Hilf mir mit den Krabben.« Garrelf schob ihm eine Schale hinüber. Er hielt nichts davon, wenn jemand untätig herumsaß. »Natürlich ist es wahr! Ich habe es damals in meinem Logbuch notiert, wie es sich für alle Wahrheiten gehört, ordentlich zwischen die Eintragungen über Seemeilen und Wassertiefe und Windstärken. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich es herumposaunen und mich lächerlich machen muss! Vor jenem Tage habe ich ebenso wenig an das Tier geglaubt wie du jetzt, und den meisten anderen Seeleuten geht es ebenso, ganz gleich, wie viel Seemannsgarn sie erzählen.«
»Wann war das, Urgroßvater?« Skem widmete sich eifrig den Krabben, um seinen guten Willen zu zeigen.
»Das war im Jahre 1879. Ich weiß es noch wie gestern.« Garrelf blickte in die Ferne und ließ die Hände ruhen, ein sicheres Zeichen, wie sehr ihn das Thema bewegte. »Es war ein harter Winter, und wir kamen von einer beschwerlichen Fahrt aus dem Norden zurück. Wir waren alle erschöpft und hungrig, da die Vorräte zur Neige gingen. Es herrschte keine unmittelbare Gefahr in jener Nacht, aber ich weiß, dass mich eine ungewohnte Schwermut und Kraftlosigkeit gepackt hatte. Es war noch vor Mitternacht, und mir war, als würde die Sonne womöglich nie wieder aufgehen. Ein eisiger Wind pfiff durch meine Kleidung, und die Gischt durchnässte mich. Ich fror bis auf die Knochen. Fragen quälten mich. Würde die karge Fracht, die wir geladen hatten, am Ende ausreichen, um den Männern ihren wohlverdienten Lohn auszuzahlen? Würden wir überhaupt noch den Heimathafen erreichen? Hatte sich diese ganze Plage gelohnt? War es nicht ein Jammer, dass die Zeiten des Walfangs vorbei waren, als man noch sein Glück machen konnte? Ich dachte an jene Seeleute, die einst als reiche Männer zurückgekehrt waren, da der Tran damals noch ein Vermögen wert war, und deren Geschichten man noch heute auf den Grabsteinen eingemeißelt sieht. Tja, an diesem Abend war ich voller Selbstmitleid, sosehr ich mich schäme, es zuzugeben.« Garrelf hob einen mahnenden Finger. »Schreibe dir das hinter die Ohren, Junge, Selbstmitleid ist nichts für Männer! Es führt nur ins Verderben und ist ein Zeichen von unverzeihlicher Schwäche. Ich weiß nicht, welcher Teufel mich an jenem Abend ritt, dass ich mich solchen Gedanken hingab. Doch gerade als die Nacht am tiefsten und der Wind am schärfsten war, gewahrte ich kurz vor Sylt in der Ferne ein seltsames blaues Schimmern unter der Oberfläche und dann etwas, das sich zunächst wie ein Buckel aus dem Wasser erhob.«
Skem vergaß, weiter die Krabben zu pulen. »Urgroßvater, war das wirklich der Töveree?«
»Ich wüsste nicht, was es sonst gewesen sein sollte. Die Beschreibung passte haargenau. Groß wie ein kleiner Wal erhob er sich über das Wasser, schnellte hoch wie ein Delphin und segelte auf seinen Flossen ein kurzes Stück, bevor er wieder eintauchte. Das blaue Leuchten wurde immer heller, so hell, dass es sich auf den Eisschollen spiegelte und auch das Wasser noch erleuchtete, als er bereits wieder untergetaucht war. Ich muss sagen, bis auf die Nordlichter habe ich niemals einen schöneren und großartigeren Anblick erlebt. Daran muss es wohl gelegen haben, dass meine Mutlosigkeit von einem Augenblick auf den anderen verflogen ist. Es schien mir sogar, als hätten sich der Wind gelegt und die Wellen geglättet, obgleich das gewiss nur Einbildung war. Und dennoch, obwohl es ein unvergessliches Erlebnis war, habe ich mir am nächsten Morgen den Kopf zerbrochen, ob ich nicht am Vorabend zu viel Grog getrunken hatte. Nur war das nicht möglich.«
»Warum nicht, Urgroßvater?«
»Weil die Vorräte an Rum längst aufgebraucht waren. Kein Tropfen mehr an Bord. Also trug ich das Vorkommnis pflichtgemäß ins Logbuch ein. Trotzdem quälten mich Zweifel, bis mir Jahre später in der Dachkammer die Aufzeichnungen meines Ururgroßvaters Brin Rossmonith untergekommen sind. Sie waren stark vergilbt, die Seiten brüchig und die Tinte verblichen, und doch konnte ich einiges entziffern. Laut seiner Eintragungen war er 1748 als Steuermann mit dem Frachter Thalea unterwegs gewesen, als das Schiff in einem Sturm bei Nacht und Nebel zwischen die Inseln getrieben wurde und drohte, auf Grund zu laufen. Brin war überzeugt, sie wären verloren gewesen, wäre nicht in der größten Not ein wundersamer Fisch, groß wie ein kleiner Wal, aufgetaucht und hätte den Wind zum Abflauen gebracht, die Wellen beruhigt und das Meer so tief erleuchtet, dass man den Grund sehen und um die Untiefen herum in sichere Gewässer steuern konnte.« Garrelf räusperte sich. »Du ahnst nicht, wie erleichtert ich war, das zu lesen! Hätte ich nicht meine eigene Begegnung mit dem Töveree gehabt, so hätte ich nun meinen Ururgroßvater für jemanden gehalten, der selbst gerne zu viel Seemannsgarn erzählt hat und mit seinen Abenteuern prahlte. So aber – nun ja. Ich weiß seitdem, was ich gesehen habe. Ob du deinen Vorvätern glaubst, bleibt dir überlassen. Es zeugt durchaus von deinem gesunden Menschenverstand, dass du an den Dingen zweifelst, die man dir weismachen will. Und nun lauf nach Hause, deine Mutter wird dich schon vermissen.« Er schlug eine Handvoll Krabben in einem Papier ein. »Bring ihr dies, sie wird es brauchen können.«
Von jenem Tag an trieb sich Skem oft heimlich nachts am Strand herum. Sein Vater war fort, und seine Mutter legte sich stets früh ins Bett und bemerkte nicht, wenn er sich aus dem Haus schlich. Er hatte die Hoffnung, selbst einmal den Töveree zu Gesicht zu bekommen. Wenn es seinen Vorvätern gelungen war, warum sollte ihm das nicht auch vergönnt sein? Vielleicht hatten die Rossmoniths eine besondere Gabe, das Wunderwesen aufzuspüren, oder hegte der Töveree etwa eine Vorliebe für seine Familie?
Womöglich musste man aber erst erwachsen und in Not sein, damit der Fisch sich zeigte, wer wusste das schon.
Wenn er ihn doch nur einmal wenigstens von weitem sehen würde, zumindest das blaue Licht, dann würde er sich nicht so verzweifelt um seinen Vater sorgen! Wenn Skem wüsste, dass es dieses Tier wirklich gäbe, dann würde er darauf vertrauen, dass es den Vater beschützen würde. So wie es Brin Rossmonith gerettet und Garrelf wieder Mut geschenkt hatte. Ein Wesen, das den Wind zum Schweigen bringen und die Wellen beruhigen konnte, würde nicht zulassen, dass Skems Vater ertrank.
Aber die Nächte waren dunkel, oft tobte der Wind und tosten die Wellen, und die einzige Helligkeit kam vom Mond und dem unermüdlichen Lichtfinger des Leuchtturms, der sich durch die Finsternis über das Wasser tastete.
Und doch hatte der Töveree, ohne jemals aufzutauchen, etwas für Skem getan. Denn ohne die Hoffnung auf eine Begegnung mit ihm hätte sich Skem nicht nachts draußen herumgetrieben und auch nicht bei Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Nun aber, da er es tat, begann er, das Meer zu lieben, wenn er in dieser Einsamkeit allein mit ihm war. Er lernte die Vögel kennen, wenn sie abends ihren Schlafplatz suchten und sich morgens in der aufgehenden Sonne wach plusterten; er wurde sich der Sterne bewusst und schloss Freundschaft mit ihnen; und er entdeckte, wie viele Gesichter der Mond hatte und auf wie unterschiedlichen Bahnen er unterwegs war. Skem lernte, sich den Seehunden zu nähern, ohne sie zu erschrecken, und glaubte zu verstehen, was die Möwen ihm zuriefen. Weit wagte er sich auf den Kniepsand hinaus und entdeckte, welche Wege durch das Watt bei Ebbe sicher waren. Manchmal war ihm dabei, als gäbe es schon so viele Wunder in dieser geheimnisvollen Weite zwischen Himmel und Erde, dass ein Töveree gar nicht gebraucht würde.
Nur um seines Vaters willen sehnte er sich nach Gewissheit.
Im Herbst kam der Frost früh. Meistens hätte man den Töveree im Winter gesehen, hatte Garrelf gesagt. Skem wanderte noch eifriger am Strand auf und ab, egal, wie sehr es ihn an den Füßen und den Ohren fror.
Doch niemals sah er blaues Licht.
Einmal aber, als er ganz weit draußen auf dem Kniepsand am Meer stand, näherte sich unter der Wasseroberfläche gemächlich ein riesiger dunkler Schatten. Skem hielt den Atem an. Es war ein windstiller Abend, die Dämmerung lag wie Glas in der Luft, und es gab kaum Wellen. Der Schatten war deutlich zu sehen, jedoch anders als seinen Vorvätern wurde es Skem bei diesem Anblick nicht leichter ums Herz. Im Gegenteil, eine kalte Beklommenheit bemächtigte sich seiner. Er wagte nicht, sich zu rühren. Bildete er es sich ein, oder verhielt die dunkle Form einen Augenblick direkt vor Skem, bevor sie weiterzog? Er atmete erst auf, als die eigenartige Silhouette in der Ferne mit der Dunkelheit der See verschmolz. Seine Beklommenheit aber blieb. War seine Angst so groß geworden, dass sie sich in ein sichtbares Wesen zu verwandeln vermochte?
Wenn es aber der Töveree gewesen war, so hatte er für Skem nicht geleuchtet.
Valerie
Berlin
2009
4Frühstück mit Fragen
In einem Schleier aus feurigem Dunst stieg die Sonne hinter der Fabrik empor. Der Wasserdampf aus den Schornsteinen trieb in bizarren Wolken in die Höhe, als wären es die Gedanken der Menschen aus der Nacht, erst dunkel, dann silbergrau. Schließlich wehten sie pfirsichfarben Richtung Norden. Aus den Straßenschluchten hallte das Erwachen der Stadt gedämpft zu Valerie hinauf. Das Rattern der S-Bahn, das Rauschen der Busse durch die Pfützen des letzten Abends, das brüchige Singen der Betrunkenen, die aus den Kneipen nach Hause wankten. Eiliges Klappern von Stöckelschuhen auf dem Weg zur Arbeit. Ungeduldiges Hupen an der Ampel. Es war Zeit für den Tag und Zeit für Antworten. Valerie rappelte sich auf, legte ihre Decke zusammen und führte ein paar flüchtige Dehnübungen aus, um ihre vor Kälte steif gewordenen Glieder zu wecken.
Ohne etwas Tröstendes wollte sie nicht bei ihrem Vater auftauchen, der bestimmt schlecht geschlafen hatte, wenn überhaupt. Dies war eindeutig ein Fall für frische Brötchen. Valerie verspürte zwar keinen Appetit, aber erfahrungsgemäß änderte sich das, sobald sie die Bäckerei betrat und von dem warmen Duft nach frisch Gebackenem umfangen wurde.
»Morgen, Hotte.«
»Morjen, Rimo. Wat kann ick für dir tun?«
Sie hatte früher manchmal bei ihm ausgeholfen und sich ein paar Mark verdient.
»Zwei Aufwachbrötchen, zwei Schusterjungen und zwei Schokocroissants, bitte.«
»Die Croissants inne Extratüte, Kleene, wie imma?«
»Ja, danke, Hotte. Und zwei Kaffee zum Mitnehmen. Schönen Tag noch.«
»Dir ooch, Kleene, und bleib sauber.«
»Klaro, Hotte.« Fast sehnte sie sich nach den Tagen, als diese Mahnung durchaus angebracht gewesen war. Manches Mal hatte sie die Farbdosen wieder eingepackt, anstatt an einer riskanten Stelle zu sprayen, nur weil sie Hotte nicht enttäuschen wollte. Er hatte ihr den Job nicht gegeben, weil sie sich so geschickt in der Backstube anstellte, sondern um sie von der Straße zu holen. Und um ihrem Vater einen Gefallen zu tun.
Die Aufwachbrötchen, Hottes Spezialität, die er selbst erfunden hatte, dufteten jedenfalls tröstlich nach Geborgenheit. Sie hießen so, weil sie tatsächlich irgendwie munter machten.
Die Brötchentüten in der Hand, lief sie einen Umweg durch den kleinen Park, von dem niemand mehr wusste, wie er hieß. Es gab einen Findling in der Mitte, der ein Denkmal für irgendjemanden war, aber die metallenen Buchstaben hatte schon lange jemand vom Stein geklaut. Oder sie waren einfach abgefallen und mit dem Herbstlaub unbemerkt von einem der Wagen der Straßenreinigung verschlungen worden. Zu Ehren Herrn …, der…« stand noch daran, mit ein paar Taubenklecksen davor und dahinter. Valerie stellte sich gern vor, das Denkmal gälte Josef.
Herrn Josef, der keinen Nachnamen und keine feste Adresse besaß, aber Sommer wie Winter in diesem Park nächtigte, sich selbst und das Leben niemals aufgab und immer ein offenes Ohr für Straßenkinder hatte.
Zu Ehren Herrn Josefs, der im Winter, wenn alles zugefroren ist, für die Vögel über seinem Campingkocher warmes Wasser macht, damit sie bei strengem Frost nicht verdursten.
Zu Ehren Herrn Josefs, der das Unkraut aus den Blumenrabatten rupft. Der die Stiefmütterchen rettet, die er selbst zur Freude der alten Leute dort ausgesät hat, von den wenigen Cent, die man ihm schenkt.
Zu Ehren Herrn Josefs, der auf einer Parkbank schläft, nachdem er geduldig jeden Abend die Kaugummis herunterpult, die man tagsüber draufgeklebt hat.
Josef war schon wach, hatte den Schlafsack ordentlich zusammengelegt und rieb sich gerade die kältesteifen Hände. Sein warmes Lächeln breitete sich aus, als er Valerie sah. »Hallo, meine Sonne! Was für ein schöner Anfang eines Tages.« Er rückte auf der Bank beiseite. Valerie reichte ihm eine dampfende Tasse und die Tüte mit den Croissants. Als sie sein Gesicht sah, wie er den ersten Schluck und den ersten Bissen genoss und dann bedächtig jeden darauffolgenden, wurde es ruhiger in ihr. Josef lebte immer ganz im Hier und Jetzt, betrachtete alles, was der Augenblick ihm bot, als etwas Kostbares.
In einträchtigem Schweigen sahen sie zu, wie der Teich, den man im Kiez nach den Kröten, die darin ablaichten, Paddenpfuhl nannte, das silberblaue Licht des Morgens einfing und immer heller wurde.
»Es riecht nach Frühling«, sagte Josef zufrieden. »Wieder einen Winter überlebt.«
»Josef, ich wünschte wirklich, du würdest in der kalten Zeit bei mir wohnen.«
»Danke, Kleene, meine Sonne, aber ich habe es dir oft genug erklärt. Ich habe diese Art Freiheit nicht gesucht, aber nachdem sie mich gefunden hat, sind wir gute Freunde geworden. Mit siebzig mag ich mich nicht mehr umgewöhnen. Wenn es nicht mehr anders geht, sehen wir weiter.«
»Lass ihn, Rimo«, hatte auch Sven gesagt, als sie mit ihm darüber sprach. »Josef braucht das so. Genau wie ich.«
Ja, Sven benötigte auch seine Freiheit. Er reagierte komisch, wann immer er sich eingeengt fühlte oder jemand ihn auf etwas festnageln wollte. Anders als Josef war er gelegentlich seltsam gelaunt. Manchmal balancierte er wagemutig auf Dächern und jubelte, scheinbar ohne Anlass, oder sprang ein Stück auf Lastwagen oder die Bahn auf, bis Valerie es mit der Angst bekam. Zu anderen Zeiten war es, als ob eine unsichtbare Wolke um ihn hing. Er starrte lange ins Nichts, sagte kaum ein Wort. Aber Valerie gelang es dann immer, ihn aufzuheitern.
»Josef, was macht man, wenn auf einmal alles anders ist?«
Josef hob eine Augenbraue. »Du sprichst jetzt nicht von Freiheit oder Frühling, nicht?«
Valerie knüllte die leere Brötchentüte zusammen. »Nö.«
Josef wartete. Als nichts mehr kam, deutete er auf die zweite, noch pralle Brötchentüte. »Hast du die nur zum Vergnügen gekauft oder wolltest du mit jemand Bestimmtem frühstücken?«
»Schon. Mit Pani.«
»Und wie lange soll der hungern?«
»Es ist kompliziert.«
»Seit wann ist dein Vater kompliziert? Darüber hast du dich noch nie beschwert. Ganz im Gegenteil.«
»Eben. Deshalb weiß ich jetzt nicht, was ich machen soll.«
»Dann frage ihn. Alles, was dich durcheinanderbringt, verdient deine Neugier«, sagte Josef und lehnte sich behaglich zurück. »Also auf in den Tag, und stelle dich dem Rätsel, was immer es ist.«
Fragen. Ja. Aber sie wusste ja nicht einmal, was genau für eine Frage sie Pani stellen sollte.
»Wann genau, glaubst du, sind die Schnipsel klein genug?«, erkundigte sich Josef.