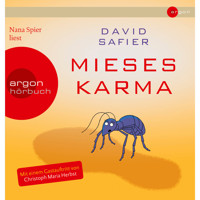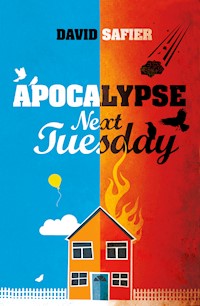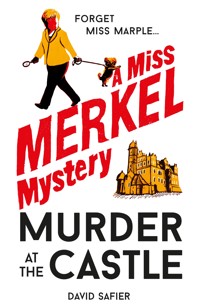Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: argon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was für ein Mensch willst du sein? Die sechzehnjährige Mira schmuggelt Lebensmittel, um im Warschauer Ghetto zu überleben. Als sie erfährt, dass die gesamte Ghettobevölkerung umgebracht werden soll, schließt sich Mira dem Widerstand an. Der kann der übermächtigen SS länger trotzen als vermutet. Viel länger. Ganze 28 Tage. 28 Tage, in denen Mira Momente von Verrat, Leid und Glück erlebt. 28 Tage, in denen sie sich entscheiden muss, wem ihr Herz gehört. 28 Tage, um ein ganzes Leben zu leben. 28 Tage, um eine Legende zu werden.schließt sich dem Widerstand an. Der kann der übermächtigen SS länger trotzen als vermutet. Viel länger. Ganze 28 TAGE lang. 28 TAGE, in denen Mira sich entscheiden muss, wem ihr Herz gehört: Amos, der noch möglichst viele Nazis mit in den Tod nehmen will, oder Daniel, der sich um die Waisen in den Bunkern kümmert. 28 TAGE, in denen sie sich immer wieder der Frage stellen muss: Was für ein Mensch willst du sein?
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
David Safier
28 Tage lang
Roman
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Was für ein Mensch willst du sein?
Die sechzehnjährige Mira schmuggelt Lebensmittel, um im Warschauer Ghetto zu überleben. Als sie erfährt, dass die gesamte Ghettobevölkerung umgebracht werden soll, schließt sich Mira dem Widerstand an. Der kann der übermächtigen SS länger trotzen als vermutet. Viel länger. Ganze 28 Tage.
28 Tage, in denen Mira Momente von Verrat, Leid und Glück erlebt.
28 Tage, in denen sie sich entscheiden muss, wem ihr Herz gehört.
28 Tage, um ein ganzes Leben zu leben.
28 Tage, um eine Legende zu werden.
Über David Safier
David Safier, 1966 geboren, zählt zu den erfolgreichsten Autoren der letzten Jahre. Seine Romane «Mieses Karma», «Jesus liebt mich», «Plötzlich Shakespeare», «Happy Family» und «Muh» erreichten Millionenauflagen. Auch im Ausland sind seine Bücher Bestseller. Als Drehbuchautor wurde David Safier für seine TV-Serie «Berlin, Berlin» mit dem Grimme-Preis sowie dem International Emmy (dem amerikanischen Fernseh-Oscar) ausgezeichnet. David Safier lebt und arbeitet in Bremen, ist verheiratet, hat zwei Kinder und einen Hund.
Weitere Informationen zum Autor
Erfahren Sie mehr über David Safier und entdecken Sie spannende Hintergrundinformationen und spannende Aktionen auf www.davidsafier.de
Inhaltsübersicht
Für meine Mutter, meinen Vater und meine Schwester
Vorwort
Liebe Leser,
dies ist ein Buch für meine Kinder, aber gewissermaßen auch für meine Großeltern, die im Holocaust gestorben sind. Dieses Buch soll eine Brücke zwischen den Generationen schlagen. Ich möchte mit ihm auch Menschen erreichen, die normalerweise nicht so ohne weiteres zu einem Roman über den Holocaust greifen würden. Deswegen habe ich «28 Tage lang» mit den Mitteln des Spannungsromans geschrieben. Man soll es – trotz all des Fürchterlichen, das geschehen ist – gerne lesen. Vor allen Dingen aber ist «28 Tage lang» ein Buch, in dem es nicht nur um die Vergangenheit geht, sondern um uns. Um die ewigen, universellen Fragen, die uns alle bewegen: Was würdest du tun, um zu überleben? Würdest du dein Leben für andere opfern, oder würdest du andere für dein Leben opfern? Kurzum, es geht darum: Was für ein Mensch willst du sein?
David Safier
1
Sie hatten mich entdeckt.
Die Hyänen hatten mich entdeckt!
Und sie hefteten sich an meine Fersen.
Das spürte ich instinktiv. Ohne sie gesehen oder gehört zu haben. So wie ein Tier spürt, dass es in großer Gefahr ist, selbst wenn es den Feind in der Wildnis noch gar nicht erblickt hat. Dieser Markt, dieser für die Polen ganz gewöhnliche Markt, auf dem sie ihr Gemüse, ihr Brot, ihren Speck, ihre Kleidung, ja, sogar ihre Rosen kauften, war für Menschen wie mich die Wildnis. Eine, in der ich als Beute galt. Eine, in der ich sterben konnte, wenn man herausfand, wer oder besser gesagt was ich wirklich war.
Jetzt nur nicht schneller werden, dachte ich. Oder langsamer. Oder die Richtung wechseln. Schon gar nicht zu meinen Verfolgern schauen. Noch nicht mal unregelmäßig atmen. Nichts tun, was ihren Verdacht bestätigt.
Es fiel mir unglaublich schwer, einfach so weiter über den Markt zu schlendern, als genösse ich die Sonne dieses überraschend warmen Frühlingstages. Alles in mir wollte weglaufen, aber dann wäre den Hyänen klar gewesen, dass ihr Verdacht stimmte. Dass ich keine normale Polin war, die gerade ihre Einkäufe erledigt hatte und ihre vollen Taschen nun zu den Eltern nach Hause trug, sondern eine Schmugglerin.
Ich hielt kurz inne, prüfte zum Schein die Äpfel an dem Stand einer Bäuerin und überlegte, ob ich mich nicht vielleicht doch umschauen sollte. Immerhin konnte es ja sein, dass ich mir alles nur einbildete, dass mich doch niemand verfolgte. Doch jede Faser meines Körpers wollte fliehen. Und ich hatte schon vor langer Zeit gelernt, meinen Instinkten zu vertrauen. Sonst hätte ich es wohl nicht geschafft, sechzehn Jahre alt zu werden.
Ich entschied mich gegen eine Flucht und ging langsam weiter. Die alte Bäuerin, die widerlich dick war – sie hatte anscheinend nicht nur genug, sondern sogar zu viel zu essen –, krächzte mir hinterher: «Das sind die besten Äpfel von ganz Warschau!»
Ich verriet ihr nicht, dass für mich jeder Apfel großartig war. Für die meisten Menschen, die innerhalb der Mauern leben mussten, wäre selbst ein angefaulter Apfel ein Genuss gewesen. Noch mehr die Eier, die ich in meinen Taschen trug, die Pflaumen und erst recht die Butter, die ich auf unserem Schwarzmarkt für viel Geld verkaufen würde.
Wenn ich jedoch überhaupt eine Chance haben wollte, hinter die Mauern zurückzukehren, musste ich erst einmal herausfinden, wie viele Verfolger ich hatte. Ganz sicher konnten sie ihrer Sache ja nicht sein, denn sonst hätten sie mich schon längst angehalten. Ich musste mich endlich nach ihnen umsehen. Irgendwie. Unauffällig. Ohne noch mehr Verdacht zu erregen.
Mein Blick fiel auf das Kopfsteinpflaster unter meinen Füßen. Ein paar Meter vor mir war ein Kanalgitter, und mir kam eine Idee. Zunächst ging ich ganz normal weiter. Dabei klackerten die Absätze meiner blauen Schuhe auf das Kopfsteinpflaster, die so wunderbar zu dem blauen Kleid mit den roten Blumen passten. Immer wenn ich schmuggelte, trug ich diese Sachen, die mir meine Mutter geschenkt hatte, als wir noch Geld hatten. Alle anderen Anziehsachen, die ich besaß, waren inzwischen schäbig, einige gar unzählige Male gestopft. Hätte ich sie getragen, hätte ich keine fünf Meter weit über den Markt gehen können, ohne aufzufallen. Doch dieses Kleid und diese Schuhe, die ich hütete wie meinen Augapfel, waren meine Arbeitskleidung, meine Tarnung, meine Rüstung.
Ich ging direkt auf das Kanalgitter zu und verfing mich absichtlich mit dem Absatz darin. Ich knickte leicht um, fluchte theatralisch «Au Mist, verdammter!», stellte meine Taschen ab und beugte mich runter, um den Absatz, der zwischen zwei Gitterstäben steckte, zu befreien. Dabei blickte ich mich verstohlen um und sah sie: die Hyänen.
Mein Instinkt hatte nicht getrogen. Das tat er leider nie. Oder dankenswerterweise, je nach Sichtweise.
Es waren drei Männer. Ein kleiner unrasierter Stämmiger mit brauner Lederjacke und grauer Schlägermütze ging voran. Er war so um die vierzig und offensichtlich der Anführer. Ihm folgten ein großer Bärtiger, der aussah, als könne er Felsbrocken werfen, und ein Junge in meinem Alter. Er trug ebenfalls Lederjacke und Schlägermütze und sah aus wie eine kleine Version des Anführers. War der womöglich sein Vater? Jedenfalls ging der Junge nicht zur Schule, sonst würde er sich ja nicht vormittags auf dem Markt herumtreiben, um auf Menschenjagd zu gehen.
Verrückt, innerhalb der Mauern durften wir nicht mehr zur Schule gehen, weil die Deutschen uns jeglichen Unterricht verboten. Es gab zwar noch illegale Schulen im Untergrund, aber nicht für alle, und ich besuchte sie schon lange nicht mehr. Ich hatte nun mal eine Familie durchzubringen.
Dieser polnische Junge jedoch durfte lernen, konnte was aus sich machen, wollte es aber nicht. Es brachte ja auch eine Menge Geld ein, mit so einer Bande von Schmalzowniks, wie wir diese Hyänen nannten, auf die Jagd nach Juden zu gehen und sie gegen Belohnung an die Deutschen auszuliefern. Es machte den Schmalzowniks, von denen es so viele in Warschau gab, auch nichts aus, dass die Deutschen jeden Illegalen, der jenseits der Mauern gefasst wurde, erschossen.
In diesem Frühjahr 1942 galt die Todesstrafe für alle, die sich unerlaubt im polnischen Teil der Stadt aufhielten. Und der Tod war noch nicht mal das Schlimmste; es kursierten die furchtbarsten Geschichten, wie die Deutschen ihre Gefangenen folterten, bevor sie sie an die Wand stellten. Egal, ob Mann, Frau oder Kind. Ja, manchmal quälten sie sogar Kinder zu Tode. Allein der Gedanke an so ein Foltergefängnis schnürte mir die Kehle zu. Aber noch war ich nicht geschlagen, gefoltert und erschossen. Noch war ich am Leben! Und ich musste es bleiben. Für meine kleine Schwester Hannah.
Es gab keinen Menschen auf der Erde, den ich so sehr liebte wie dieses kleine zarte Wesen. Hannah war durch die schlechte Ernährung viel zu klein für ihre zwölf Jahre und eigentlich unscheinbar wie ein kleiner Schatten, wären da nicht ihre Augen. Die waren so groß, so wach, so neugierig und hätten verdient, etwas anderes zu sehen als den Albtraum innerhalb der Mauern.
In diesen Augen leuchtete die Kraft einer unglaublichen Phantasie. In der Szułkult-Untergrundschule war sie zwar in allen Fächern, von Mathematik über Biologie bis Geographie, mäßig bis schlecht, aber wenn es um Geschichten ging, die sie in den Pausen den anderen Kindern erzählte, machte ihr niemand was vor: Sie fabulierte von der Waldläuferin Sarah, die ihren geliebten Prinzen Josef aus den Klauen des Dreiköpfigen Drachens befreite, von dem Hasen Marek, der für die Alliierten den Krieg gewann, und von dem Ghettojungen Hans, der Steine zum Leben erwecken konnte, es aber nicht so gerne tat, weil die Steine so griesgrämig waren. Für jeden, der Hannah zuhörte, wurde die Welt bunter und schöner.
Wer nur sollte für die Kleine sorgen, wenn ich mich hier erwischen ließ?
Gewiss nicht meine Mutter. Sie war so gebrochen, dass sie das kleine schäbige Loch, das wir bewohnten, nicht mehr verließ. Und erst recht nicht mein Bruder. Der war viel zu sehr damit beschäftigt, an sich selbst zu denken.
Ich blickte von den Schmalzowniks weg, zog meinen Absatz aus dem Gitter und berührte kurz mit der Hand das Kopfsteinpflaster. Oft, wenn mich die Angst überwältigt, berühre ich die Oberfläche von etwas, um mich zu beruhigen: von Metallen, Steinen, Stoffen – egal, Hauptsache, ich merke, dass es noch etwas anderes auf dieser Welt gibt als meine Furcht.
Der helle Stein, auf dem meine Hand für eine Sekunde lag, war ganz warm von den Sonnenstrahlen. Ich atmete tief durch, griff nach meinen Taschen und ging weiter.
Die Schmalzowniks verfolgten mich, das wusste ich. Ich konnte ihre schneller werdenden Schritte deutlich hören, dabei gab es hier auf dem Markt noch so viele andere Geräusche: die Stimmen der Händler, die ihre Waren anpriesen, die Käufer, die über die Preise feilschten, Vogelgezwitscher oder den Lärm von Autos, die auf der Straße hinter dem Markt entlangfuhren.
Menschen schlenderten im gemächlichen Tempo an mir vorbei. Ein junger blonder Mann im grauen Anzug, wie ihn viele polnische Studenten trugen, pfiff fröhlich ein Liedchen vor sich hin. All das nahm ich zwar wahr, aber irgendwie traten diese Geräusche in den Hintergrund. Laut hörte ich nur meinen Atem, der hektischer wurde, obwohl ich kein bisschen schneller ging, und mein Herz, das von Sekunde zu Sekunde rasender pochte. Am lautesten aber hörte ich die Schritte meiner Verfolger.
Sie kamen näher.
Immer, immer näher.
Bald hätten sie mich eingeholt und würden mich stellen. Wahrscheinlich würden sie versuchen mich zu erpressen, all mein Geld verlangen für das Versprechen, mich nicht auszuliefern. Und wenn ich sie bezahlt hätte, würden sie mich dennoch verraten und von den Nazis zusätzlich das Kopfgeld kassieren.
Mir war schon lange klar, dass so etwas früher oder später passieren würde, eigentlich seit ich mit dem Schmuggeln angefangen hatte. Das war wenige Wochen, nachdem Papa sich entschieden hatte, uns im Stich zu lassen. Wir besaßen kein Geld mehr, um auf dem Schwarzmarkt Essen zu kaufen, und die Ration, die die Deutschen uns zuteilten, betrug pro Person gerade mal 360 Kalorien am Tag. Außerdem war das, was man uns Juden bei den Essensausgaben aushändigte, oftmals auch noch verdorben. Alles, was für die deutschen Soldaten an der Ostfront zu schlecht war, ging an uns. Verrottete Rüben, faule Eier oder gefrorene Kartoffeln, die man nicht mehr kochen konnte und aus denen man mit ein bisschen Geschick gerade noch genießbare Puffer machen konnte. An manchen Tagen im letzten Winter roch das ganze Ghetto nach diesen Kartoffelpuffern.
Wenn ich wollte, dass meine Familie zu essen hatte, musste ich also etwas unternehmen. Meine Freundin Ruth verkaufte ihren Körper im Britannia-Hotel und hatte mir angeboten, mich zu vermitteln, selbst wenn ich, wie sie grinsend anmerkte, eher eine knabenhafte Figur besaß. Doch bevor ich so etwas machte, setzte ich lieber mein Leben als Schmugglerin aufs Spiel.
Für den Fall, dass ich von den Schmalzowniks erwischt würde, hatte ich mir eine Geschichte zurechtgelegt: Ich wäre Dana Smuda, eine polnische Schülerin, die in einem anderen Stadtteil Warschaus wohnt, aber hier immer gerne einkauft, weil es nur auf diesem Markt diesen einen besonders süßen Blätterteigkuchen mit der großartigen Apfelfüllung gab. Dass meine erlogene Adresse weit weg lag, war wichtig, denn sonst würden die Hyänen mich direkt zu meinem angeblichen Zuhause führen und merken, dass ich log. Um meine Geschichte notfalls beglaubigen zu können, kaufte ich auf dem Markt jedes Mal ein Stück von dem Kuchen und legte es in meine Tasche.
Bei meinen Ausflügen trug ich um den Hals auch immer eine Kette mit dem Kreuz Jesu. Zudem hatte ich viele christliche Gebete auswendig gelernt, damit ich mich als gute Katholikin ausgeben konnte. Gebete wie Rosenkranz, Sanctus oder Magnificat: «Meine Seele preiset die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott …» – als ob ein gesunder Geist in diesen Zeiten über Gott jubeln könnte.
Wenn der auf einer Bühne vor mir stünde, würde ich ihn mit Eiern bewerfen. Auch wenn sie im Ghetto sehr viel Geld kosteten. Ich glaubte nicht an Religion. Nicht an Politik. Und erst recht nicht an die Erwachsenen. Ich glaubte nur ans Überleben.
«Halt!», rief einer meiner Verfolger, vermutlich der Anführer der Bande.
Ich tat so, als ob er nicht mich meinte. Ich war ja ein ganz normales polnisches Mädchen, wieso sollte ich mich da umdrehen, wenn ein Wildfremder «Halt!» ruft?
In meinen Gedanken ging ich noch mal hastig alles durch: Ich war Dana Smuda, wohnte in der Miodawa Straße 23, liebte Blätterteigkuchen …
Die Hyänen schnitten mir den Weg ab und bauten sich vor mir auf.
«So leicht wirst du uns nicht los, jüdisches Dreckstück», grinste der Anführer.
«Was?», fragte ich gespielt irritiert. Es war jetzt überlebenswichtig, nicht ängstlich dreinzuschauen.
«Glaubst du, wir gehen zum Vergnügen mit dir spazieren? Wenn du willst, dass wir dich gehen lassen, gib uns zweitausend Złoty», antwortete der Anführer, während sein Sohn – es musste sein Sohn sein, die beiden hatten die gleiche leicht geduckte Körperhaltung – mich von oben bis unten musterte, als ob er einerseits von mir, der Jüdin, angewidert wäre, andererseits sich in seinem dreckigen Hirn vorstellte, wie ich wohl ohne mein Kleid aussähe.
«Das ist ein einmaliges Angebot: Zweitausend, und wir lassen dich in Ruhe.»
Mit einem Mal spürte ich Schweiß an meinem Nacken. Es war kein gewöhnlicher Schweiß, den man schon mal bekam, weil die Sonne gegen Mittag stärker schien. Nein, es war Angstschweiß. Der, der so beißend riecht und von dem ich, weil ich so behütet aufgewachsen war, vor wenigen Jahren noch gar nicht wusste, dass es ihn gab.
Solange mir der Schweiß lediglich am Nacken und unter den Achseln runterlief, war er noch nicht verräterisch, aber er durfte mir auf keinen Fall auf die Stirn treten. Diese Hyänen erkannten jedes noch so kleine Zeichen der Schwäche.
«Hast du nicht verstanden, Judenhure?»
Ich brachte kein Wort raus.
In diesem Augenblick verstand ich, warum Menschen in so einer Lage Verbrechern all ihr Geld gaben, selbst wenn sie eigentlich wussten, dass sie danach dennoch ausgeliefert wurden. Sie klammerten sich an die absurde Hoffnung, dass die Schmalzowniks sich an den von ihnen vorgeschlagenen Handel halten würden. Hätte ich so viel Geld, vermutlich hätte ich auch sofort zugegeben, dass ich eine Jüdin war, und es ihnen gegeben. Aber ich hatte noch nie so viel besessen. Daher rang ich mir ein Lächeln ab und sagte: «Das ist ein Irrtum.»
«Verkauf uns nicht für dumm», zischte der Anführer. Er war sich seiner Sache ganz sicher.
Instinktiv wusste ich, dass meine hübsch zurechtgelegte Geschichte ihn nicht überzeugen würde. Seinen Sohn und den grobschlächtigen großen Kerl hätte ich damit vielleicht täuschen können, aber nicht ihn. Er hatte bestimmt schon viele Juden in den letzten Jahren aufgespürt und garantiert noch bessere Lügengeschichten gehört als meine von der Schülerin mit dem Blätterteigkuchen. Viel bessere. Und sicher hatte er auch genug Ketten mit Jesus-Kreuzen gesehen.
Meine Lügen würden nichts bringen. Rein gar nichts. Wie hatte ich nur so naiv sein können, so schlecht vorbereitet? Meinetwegen würde meine Mutter in unserem Zimmer in der Miła-Straße 70 in wenigen Wochen verenden, und Hannah würde auch nicht viel länger am Leben bleiben. Vielleicht würde sie sich als Bettlerin auf den Straßen des Ghettos durchschlagen, das könnte eine Weile gutgehen. Aber spätestens wenn der Winter kam, erfroren die bettelnden Kinder in den Nächten.
Ich durfte nicht zulassen, dass Hannah das passierte. Auf gar keinen Fall!
Ich besann mich darauf, dass die Kette und meine Lügen nicht alles waren, was mir helfen konnte. Ich hatte noch etwas, auf das ich setzen konnte: Ich sah nicht allzu jüdisch aus.
Sicher, ich hatte dunkle Haare wie die meisten Jüdinnen – aber auch wie viele Polinnen. Dafür hatte ich eine kleine Stupsnase und vor allen Dingen etwas, das so überhaupt nicht zum Bild einer Jüdin passte: grüne Augen.
Mein Freund Daniel hatte mir mal in einem seiner wenigen romantischen Augenblicke gesagt, sie sähen aus wie zwei Bergseen, die in der Sonne funkelten. Ich selbst hatte in meinem ganzen Leben noch keine Bergseen gesehen, von daher wusste ich nicht, ob sie wirklich grün funkeln. Und ich würde es vermutlich auch nie herausfinden.
Immer wenn mir Menschen in die Augen sahen, wurden sie unsicher. Aus der Ferne konnte man mich für eine Polin halten oder für eine Jüdin. Von nahem aber machte mich die Farbe meiner Augen zu etwas Seltenem auf beiden Seiten der Mauer.
Ich kämpfte gegen meine Angst an und sah dem Anführer der Schmalzowniks direkt in die Augen. Das Grün irritierte ihn. Und dann tat ich etwas völlig Irres, ohne vorher darüber nachzudenken: Ich lachte. Lauthals. Die wenigen Menschen, die mich gut kennen, wissen, dass ich fast nie lache, und wenn, dann garantiert nicht so. Für die Schmalzowniks aber klang es echt, und es verunsicherte sie noch mehr.
Dann spottete ich: «Ihr irrt euch gewaltig.»
Ich schob mich an den verdutzten Männern vorbei, die ganz offensichtlich noch nie von einer, die sie für eine Judenschlampe hielten, ausgelacht worden waren, und ging mit meinen Taschen einfach weiter. Es war kaum zu glauben: Ich schien mit meiner Frechheit tatsächlich durchzukommen. Beinahe hätte ich gegrinst.
Doch mit einem Mal rannte der kleine Anführer los, gefolgt von den anderen beiden, und schnitt mir erneut den Weg ab. Mir stockte der Atem. Noch mal frech zu lachen, würde mir nicht gelingen.
«Du bist eine Jüdin, das riech ich genau», blaffte der Mann und schob sich dabei die Mütze etwas in den Nacken: «Ich bin der Beste, wenn es darum geht, euch Ungeziefer aufzuspüren.»
«Der Allerbeste», sagte der Junge stolz.
Ja, da war jemand stolz darauf, dass sein Vater Menschen erpresste und in den Tod schickte.
Es war so ungerecht: Mein Vater hatte die Menschen geheilt, Polen, Juden, egal wen. Sogar einen deutschen Soldaten, der in den letzten Tagen des Einmarsches in unserer Straße angeschossen wurde, hatte er versorgt. Doch egal wie viele Menschen er auch gerettet hatte, wie angesehen er als Arzt auch gewesen war, jetzt, wo wir ihn am meisten brauchten, war mein Vater nicht für uns da, und ich konnte nicht mal ansatzweise stolz auf ihn sein.
«Hört auf mich zu belästigen», drohte ich wütend, «oder ich hole die Polizei!»
Den Jungen und den bärtigen Riesen beeindruckte ich mit meiner leeren Drohung. Die polnische Polizei mochte die Schmalzowniks nicht, sie waren Konkurrenten, wenn es darum ging, mit Juden, die sich illegal auf der anderen Seite der Mauer rumtrieben, Kopfgeld zu verdienen. Und wenn Schmalzowniks zu allem Überfluss sogar noch unschuldige polnische Mädchen drangsalierten, würden sie richtig Ärger bekommen. Das wussten die Kerle hier auch.
Doch der Anführer ließ sich nicht einschüchtern. Er starrte nur in meine Augen, deren Grün ihn nicht mehr von seinem Verdacht abbringen konnte, und versuchte Unsicherheit in ihnen zu entdecken, irgendein noch so kleines Flackern.
Ich hielt seinem Blick stand. Mit aller Macht.
«Ich meine es ernst», wiederholte ich.
«Nein, das tust du nicht», erwiderte er seelenruhig.
«Und wie!»
«Dann lass uns gemeinsam zur Polizei gehen», schlug er vor und zeigte auf einen Polizisten in blauer Uniform, der am Stand der dicken alten Frau in einen Apfel biss und die Miene säuerlich verzog, weil der Apfel wohl nicht halb so gut war wie versprochen.
Was sollte ich nur tun? Wenn ich zu dem Polizisten ging, war ich verloren. Wenn ich nicht ging, ebenso. Jetzt trat mir der Angstschweiß auch noch auf die Stirn. Der Anführer sah die Schweißperlen und lächelte. Weiteres Lügen war sinnlos.
Wieder hörte ich den Studenten pfeifen. Ich würde bald sterben, spätestens morgen würde ich an die Wand gestellt. Meine Mutter und meine kleine Schwester würden ohne mich nicht überleben. Und der Kerl pfiff fröhlich eine kleine Melodie!
Sollte ich jetzt wegrennen? Ich hätte kaum eine Chance zu entkommen. Selbst wenn ich trotz meiner Absätze schneller gewesen wäre als die Schmalzowniks, würden sie rufen und schreien, und unter diesen ganzen Menschen, die auf dem Markt ihre Besorgungen erledigten, würde es genug Judenhasser geben, die mich festhielten. So viele Polen verabscheuten uns. Sie wollten zwar ohne die Besatzung der Deutschen leben, aber sie waren dankbar, dass die ihnen die Juden vom Hals schafften.
Sogar für den komplett unwahrscheinlichen Fall, dass ich allen auf dem Markt entkommen könnte, würde ich es nie im Leben unbemerkt zurück zur Mauer schaffen, um ins Ghetto zu gelangen. Wegrennen war also zwecklos. Und doch war es meine einzige Chance. Ich wollte gerade die Taschen mit meiner wertvollen Ware zu Boden werfen und um mein Leben laufen, da sah ich vor meinen Augen plötzlich eine Rose.
Es war wirklich eine Rose!
Direkt vor meinem Gesicht.
Ihr intensiver Duft verdrängte in meiner Nase sogar für einen Augenblick den beißenden Gestank meines Angstschweißes. Wann hatte ich das letzte Mal den Duft einer Rose gerochen? Im Ghetto gab es keine. Und wenn ich auf dem polnischen Markt meine Ware besorgte, hatte ich nie die Muße, um an Blumen zu schnuppern. Ich hatte noch nicht einmal daran gedacht. Und jetzt, wo ich kurz davor war, an die Deutschen ausgeliefert zu werden, hielt mir jemand eine Rose hin?
Es war der Student.
Er stand direkt neben mir und lächelte mich aus seinen hellen blauen Augen an, als sei ich das schönste und großartigste Wesen, das er je erblickt hatte.
Bei näherem Hinsehen sah dieser strahlende Kerl jünger aus als ein Student, eher nach siebzehn, achtzehn Jahren als nach Anfang zwanzig.
Noch bevor ich oder einer der Schmalzowniks etwas sagen konnte, nahm er mich schwungvoll in die Arme und lachte: «Eine Rose für meine Rose!»
Ein völlig alberner Satz. Aber so überzeugt verliebt, wie er ihn vortrug, wirkte es ganz und gar nicht lächerlich.
Der Groschen fiel bei mir: Dieser Junge wollte mein Leben retten. Indem er vorspielte, dass ich seine große polnische Liebe war. War er auch ein Jude? Eher ein Pole. Er hätte mit seinen blonden Haaren, Sommersprossen und blauen Augen sogar als Deutscher durchgehen können. Jedenfalls war er ein großartiger Schauspieler. Egal, was er auch war, er riskierte für mich – eine Wildfremde – sein Leben.
«Du bist die Rose meines Lebens!», strahlte er.
Die Hyänen wussten immer noch nicht, wie sie sein Verhalten einschätzen sollten. Würde jemand, der Liebe nur vorspielte, es ausgerechnet auf so eine übertriebene Art und Weise tun?
Wenn ich sie überzeugen und uns beide retten wollte, musste ich auf das Spiel eingehen.
Doch ich war zu durcheinander. Ich wollte seine Rose in die Hand nehmen, aber ich war wie blockiert. Als hätte mich die Giftraupe Xala gelähmt, die sich Hannah ausgedacht hatte für ihre Geschichte von den dummen Raupen, die die Schmetterlinge hassten.
Der Junge spürte, wie verkrampft ich war, und zog mich noch mehr zu sich heran. Sein Griff war fest, seine Arme viel kräftiger, als man es von so einem dünnen Kerl hätte vermuten können. Ich war immer noch nicht in der Lage zu reagieren. Vor lauter Angst und Überraschung lag ich wie eine Schaufensterpuppe in den Armen des Jungen. Um das zu überspielen, intensivierte der die Scharade noch: Mit einem Mal küsste er mich.
Er küsste mich!
Seine rauen, leicht aufgesprungenen Lippen drückten sich auf meine, und seine Zunge drang in meinen Mund, ganz selbstverständlich, als ob sie dies schon tausend Mal getan hätte. Mir war klar: Ich musste seinen Kuss erwidern. Das war meine letzte Chance. Wenn ich es nicht tat, war endgültig alles aus. Für uns beide.
Diese Gewissheit, garantiert zu sterben, wenn ich jetzt nicht endlich reagierte, riss mich aus meiner Verkrampfung. So küsste ich genauso leidenschaftlich zurück.
Ob mir der Kuss gefiel, konnte ich in diesem Moment gar nicht sagen.
Als der Junge wieder von mir abließ, spielte ich die Glückselige.
«Danke für die Rose, Stefan», dachte ich mir schnell einen Namen für ihn aus.
«Ich danke dir, dass es dich gibt, Lenka», gab er mir ebenfalls einen Namen und war gewiss zutiefst erleichtert, dass ich auf sein Spiel einging.
Jetzt erst wagte ich, zu den Hyänen zu sehen. Die waren von unserer Vorstellung schwer beeindruckt. Der junge Schmalzownik war sogar sichtlich neidisch, sicherlich hätte er auch gerne mal ein polnisches Mädchen so geküsst.
«Belästigen dich diese Kerle etwa?», fragte Stefan, der so tat, als ob er sie jetzt erst wahrnähme.
«Sie halten mich für eine Jüdin.»
Stefan sah die Männer an, als seien sie völlig verrückt geworden, auf so einen Gedanken zu kommen. Aber er lachte nicht wie ich bei meinem ersten Versuch, sie loszuwerden. Sein Gesicht verzog sich zu einer zornigen Grimasse: «Wollt ihr meine Freundin beleidigen?»
Er gab jetzt den stolzen Polen, dessen Mädchen in seinem Ehrgefühl verletzt wurde. Jüdin? So etwas durfte man zu der Freundin eines aufrechten Polen doch nicht zu sagen wagen!
«Nein … nein», stammelte der Anführer. Er trat einen Schritt zurück. Seine Leute taten es ihm nach.
«Doch, das wollten sie», widersprach ich in einem wütenden Tonfall. Auch wenn ich die Rolle als gekränkte Polin nur spielte, war mein Zorn auf diese Hyänen doch echt.
Stefan ballte die Faust und hob sie den Schmalzowniks entgegen. Die wichen noch etwas mehr zurück. Gewiss, sie hätten ihn einfach verprügeln können, drei gegen einen, das wäre kein Problem gewesen. Aber sie vergriffen sich nicht an Polen, das hätte ihnen nur Ärger mit der Polizei eingebracht. Sie schämten sich sogar etwas, mit ihrem Verdacht gegen mich so danebengelegen zu haben. Zu einer Entschuldigung reichte es zwar nicht, aber der Anführer wandte sich wortlos von uns ab und bedeutete den anderen beiden Hyänen, ihm zu folgen.
Stefan nahm meine beiden schweren Taschen in eine Hand wie ein Kavalier, der seiner Freundin das Tragen abnimmt, und legte den freien Arm um mich. Verliebt begann er mit mir über den Markt zu schlendern. Dabei hielt ich seine Rose.
Für einen kurzen Augenblick bekam ich Angst, dass er sich mit meinen Sachen davonmachen könnte. Vielleicht war er ja auch ein Schmuggler. Aber würde ein gewöhnlicher Schmuggler sein Leben für einen anderen riskieren? Und selbst wenn er meine Sachen stahl, wäre das nicht ein kleiner Preis für mein Leben? Für die Möglichkeit, weiter meine Familie ernähren zu können? Meine kleine Schwester durchzubringen?
«Danke», sagte ich zu ihm.
«Es war mir ein Vergnügen», lachte er so, dass man es ihm fast glaubte. Und er fügte hinzu: «Du küsst wirklich gut.»
Er sagte das mit der frechen Autorität eines Jungen, der viele Mädchen und vermutlich auch viele Frauen geküsst hatte, um das auch wirklich beurteilen zu können.
«Es ging um mein Leben», erwiderte ich flüsternd, damit die Passanten es nicht hören konnten. Das war weder die Zeit noch der Ort, um von Komplimenten angetan zu sein. «Um unser Leben. Du hast deins für mich riskiert.»
Ich konnte es immer noch nicht richtig glauben. In einer Welt, in der jeder nur an sich dachte, hatte jemand alles für mich aufs Spiel gesetzt.
«Ich wusste, dass es klappt», antwortete er ebenfalls leise. Dabei lächelte er weder gespielt noch frech, sondern ehrlich.
«Da wusstest du mehr als ich», grinste ich gequält.
«Es gab zwei Dinge, die dafürsprachen», erklärte er.
«Und welche?»
«Zum einen deine grüne Augen …»
Er lachte, sie schienen ihm zu gefallen. Und ich war überrascht, dass mir das schmeichelte.
«Was war das andere?», fragte ich ihn.
«Jemand, der in diesen Zeiten schmuggelt, muss sehr, sehr flink im Kopf sein. Sonst wäre er schon längst tot. Oder sie.»
Diese Anerkennung schmeichelte mir noch mehr. Sie machte mich sogar etwas stolz. Natürlich wollte ich mir das nicht anmerken lassen, darum sagte ich schnell: «Flink im Kopf oder sehr, sehr verrückt.»
Er lachte. Es war ein schönes, freies Lachen. Nicht so bedrückt wie das von vielen Juden. War er doch ein Pole? Nachher hieß er sogar wirklich Stefan.
«Schmuggelst du auch?», fragte ich.
Er blieb stehen, wurde ernst und zögerte etwas, ob und wie viel er von sich preisgeben sollte. Schließlich antwortete er: «Nicht so wie du.»
Was sollte das bedeuten? Schmuggelte er für die Schwarzmarktkönige im Ghetto? War er ein polnischer Verbrecher, der diesen Leuten half?
Stefan nahm seinen Arm von mir.
«Es ist besser für dich, wenn du nicht mehr von mir weißt», sagte Stefan und wirkte plötzlich viel älter als siebzehn.
«Och, ich halt schon einiges aus», hielt ich dagegen.
«Das habe ich früher auch von mir gedacht», erwiderte er. Das freche Funkeln war jetzt komplett aus seinen Augen verschwunden. Auch wenn ich gern gewusst hätte, worüber er sprach, es ging mich nichts an. Er gab mir meine Taschen zurück. Ich war erleichtert; ich würde nicht ohne Lebensmittel ins Ghetto zurückkehren. Außerdem hätte es mich schwer getroffen, wenn mein Retter mich bestohlen hätte.
«Wir sollten uns jetzt verabschieden», sagte Stefan.
Mir gefiel das nicht. Ich hätte gerne noch mehr über ihn erfahren. Dennoch nickte ich: «Das sollten wir wohl.»
Er sah mich ganz kurz wehmütig an, als ob auch er es bedauern würde, dass sich unsere Wege hier trennten. Als er sich von mir ertappt fühlte, knipste er sein Lächeln wieder an: «Wenn du zu Hause bist, musst du dich waschen.»
«Was?», fragte ich erstaunt.
«Du riechst nach Angstschweiß», grinste er breit.
Ich wusste nicht, ob ich lachen sollte oder ihm eine langen. Ich entschied mich für beides.
«Aua», lachte er auf.
«Pass auf, was du sagst», antwortete ich, «es könnten sonst noch viele Auas folgen.»
Er lachte noch mehr: «Ich sag es ja immer, attraktive Frauen sind eine Gefahr.»
Verdammt, ich war schon wieder geschmeichelt.
Stefan gab mir noch einen frechen Kuss auf die Wange und verschwand in der Menschenmenge. Und damit womöglich für immer aus meinem Leben, ohne dass ich seinen richtigen Namen erfahren hatte oder er wusste, dass ich eigentlich Mira hieß.
Wenn man etwas Aufregendes erlebt, erreichen einen die Gefühle dazu manchmal erst viel später, wenn man zur Ruhe kommt. Ein spitzer Dorn der Rose pikste leicht in meine Fingerkuppe, und mit einem Mal spürte ich ganz intensiv den Kuss. Die Leidenschaft, die Stefan hineingelegt hatte. Und die, mit der ich seinen Kuss erwidert hatte.
Ich war völlig aufgewühlt. Dieser Kuss hätte gar nicht unterschiedlicher sein können zu dem ersten, den ich damals von Daniel bekommen hatte.
Daniel.
Ich fühlte mich plötzlich schuldig. Wie konnte ich mich überhaupt von dem Kuss eines Fremden so beeindrucken lassen?
Daniel war der Einzige auf der Welt, bei dem ich Kraft schöpfen konnte. Er war der anständigste Mensch, den ich kannte. Und er war immer für mich da. Im Gegensatz zu allen anderen.
Stefan würde ich wohl nie wieder sehen. Und selbst wenn …
Daniel und ich. Wir würden zusammen nach Amerika gehen. Irgendwann. Wir würden mit Hannah über den Broadway in New York flanieren. Diese wundervolle Stadt in Farbe erleben. Ich kannte sie nur in Schwarz-Weiß aus den amerikanischen Filmen, die man bei uns in den Kinos hatte sehen dürfen, bevor die Nazis einmarschierten.
Daniel und ich hatten uns New York geschworen.
Ich riss mich zusammen, verdrängte alle Gefühle, die mit dem Kuss zu tun hatten. Ich schob sie auf die ganze Aufregung, auf die Lebensgefahr, in der ich mich befunden hatte, und zwang mich, nicht mehr an Stefan zu denken. Noch hatte ich den Tag nicht überlebt. Das Schwierigste lag noch vor mir. Ich musste wieder zurück ins Ghetto. Ohne von den deutschen Wachen erwischt zu werden.
2
Die Mauer, die jüdische Zwangsarbeiter auf Befehl der Nazis errichtet hatten – ja, die Juden hatten sich ihr Gefängnis selber bauen dürfen –, war drei Meter hoch. Auf ihr lagen Scherben, und darüber war noch mal fast ein halber Meter Stacheldraht angebracht. Bewacht wurde sie gleich von drei verschiedenen Einheiten: von Wachleuten, von polnischen Polizisten und auf unserer Seite des Walles zudem auch noch von den jüdischen Ghetto-Polizisten. Diese Schweine taten alles, was die Deutschen von ihnen verlangten, um ein etwas besseres Leben zu haben als wir anderen. Keinem von ihnen konnte man vertrauen, auch nicht meinem reizenden großen Bruder.
Die professionellen Schmuggler schmierten an den wenigen Übergängen, die ins Ghetto führten, die Wachen – Geld steckten sich nun mal alle Ordnungshüter gerne ein, egal zu welchem Volk sie gehören. Hatten die Wachen kassiert, konnten die Karren mit Waren die Grenze passieren. Oft war das Essen in doppelten Böden versteckt, manchmal waren aber auch die Tiere, die die Karren zogen, selbst die Ware. Beim Reinkommen ins Ghetto waren noch Pferde vor den Karren gespannt, herausgezogen wurde er wenig später von Menschen.
Für mich war es nicht so einfach, in das Ghetto rein- oder rauszukommen. Ich hatte kein Geld, um wie so viele die Wachen zu bestechen, und war – obwohl eher schmächtig – doch zu groß, um wie viele kleine Kinder, die ihre Familien durchbringen mussten, durch eines der kleinen Löcher unterhalb der Mauer zu kriechen. Diese kleinen zerlumpten Gestalten, die sich bei Hitze, Kälte, Regen durch Mauerspalten zwängten, Kanalrohre durchkrabbelten oder waghalsig über die Mauer kletterten und sich dabei an den Scherben die Hände aufschlitzten, waren die traurigen Helden des Ghettos. Die meisten von ihnen waren jünger als zehn Jahre, einige gerade mal sechs. Doch wenn man in ihre Augen sah, schienen sie schon tausend Jahre auf dieser Erde zu wandeln. Immer wenn ich eines dieser jungen, alten Wesen sah, war ich froh, Hannah ein anderes Leben bieten zu können.
Todgeweiht waren die kleinen Schmuggler alle. Früher oder später wurden sie von jemandem wie Frankenstein erwischt. Frankenstein, so nannten wir einen besonders brutalen deutschen Wachmann. Kalt lächelnd schoss er die kleinen Schmuggler von der Mauer, als seien sie Spatzen.
Um in den polnischen Teil der Stadt zu gelangen, ohne wie ein Spatz zu verenden, nutzte ich einen Ort, der angeblich viele Menschen von einer Welt in eine andere führte – einen Friedhof.
Im Tod waren wir Menschen alle gleich – auch wenn die Religionen etwas anderes behaupteten –, und so lagen der katholische und der jüdische Friedhof direkt nebeneinander, lediglich von der Mauer getrennt. Wie man sie überwinden konnte, hatte mir Ruth verraten. Einer ihrer Lieblingsfreier, der berüchtigte Ghettogangster Schmul Ascher, hatte vor ihr mit seinen Schmuggeleien geprahlt.
Ich verließ den Markt, ging ein paar Straßen und betrat den katholischen Friedhof. Hier waren selten Menschen anzutreffen, und heute war er ebenfalls menschenleer. In diesen Zeiten hatten auch die Polen nicht viel Zeit für ihre Toten. Vielleicht hatten die Menschen das aber auch nie.
Ich ging zügig in Richtung Mauer. Mein Blick fiel dabei auf die Gräber, und ich war erstaunt, wie opulent einige waren. Manche Grabstellen waren größer als das Zimmer, das ich mit meiner Familie bewohnte. Vermutlich gab es in diesen Kammern auch weniger Ungeziefer.
Während ich meinen Gedanken nachhing, erkannte ich in der Ferne einen blauen Polizisten bei seiner Wachrunde. Er durfte mich auf keinen Fall ansprechen und nach meinen Papieren fragen. Einen gefälschten Ausweis, wie sie die professionellen Schmuggler besaßen, hatte ich mir nicht leisten können und würde daher sofort auffliegen.
Ich ging ein paar Schritte weiter, ohne zu eilen, und hielt vor dem nächstbesten Grab. Dort stellte ich meine Taschen ab, legte meine Rose neben einem Kranz nieder und betete leise vor mich hin. Ich war ein braves katholisches Mädchen, das sich nach den Markteinkäufen die Zeit nahm, der Toten zu gedenken. Der Mann, an dessen Grab ich stand, hieß Waldemar Baszanowski, war geboren am zwölften März 1916 und gestorben am dritten September 1939. Vermutlich war er Soldat in der polnischen Armee gewesen und gleich in den ersten Tagen des Krieges von den Deutschen erschossen worden. Nun war ich also die kleine Schwester Waldemars, Gott hab ihn selig.
Der Polizist ging an mir vorbei, ohne mich anzusprechen. Er respektierte mein Gedenken an den Toten. Als er wieder verschwunden war, atmete ich tief durch. Leider würde ich die Rose auf dem Grab dieses fremden Mannes zurücklassen müssen. Schließlich hatte Stefan mir mit ihr das Leben gerettet. Ich nahm die Rose noch mal in die Hand und spielte mit dem Gedanken, sie doch mit ins Ghetto zu nehmen. Aber das wäre verrückt. Falls ich dem Polizisten noch mal begegnen sollte, würde die Rose mich verraten. Wie hätte ich erklären sollen, dass ich sie nicht am Grab gelassen hatte? Ich konnte wohl kaum sagen: «Ach, der Tote sieht sie ja doch nicht.»
Ich ärgerte mich über mich selber – ich durfte mich nicht mehr von den Gedanken an diesen Jungen ablenken lassen! Ich ließ die Rose liegen, sagte leise «Danke, Waldemar» und ging zu der Mauer, die an den jüdischen Friedhof grenzte. Dort blickte ich mich um, aber nirgendwo waren Soldaten oder Polizisten zu sehen. Ich hastete zu einer ganz bestimmten Stelle mit präparierten Steinen. Die konnte man herauslösen, bis ein großes Loch entstand, das die organisierten Schmuggler benutzten, um tonnenweise Waren, darunter sogar Kühe und Pferde, ins Ghetto zu schaffen. Ich entfernte den kleinsten Stein und blickte vorsichtig durch das Loch. Soweit ich sehen konnte, war auf der anderen Seite niemand. Sofort begann ich weitere Steine aus der Mauer zu nehmen. Dieser Moment war der gefährlichste: Während ich die Steine lockerte, konnte ich auf beiden Seiten entdeckt werden und hätte keine Chance, mich herauszureden oder gar zu entkommen.
Mein Herz schlug vor Aufregung bis zum Hals, und der Angstschweiß trat wieder auf meine Stirn. Jederzeit konnte ich erwischt und erschossen werden. Wenigstens hätte ich es dann nicht weit zu meinem Grab.
Als das Loch gerade groß genug war, zwängte ich mich hindurch und machte mich sofort daran, die Steine wieder einzusetzen. Einerseits, damit die Wachen die Lücke in der Mauer nicht bei einem Rundgang bemerkten und für immer verschließen würden. Andererseits, damit die Schmuggler nicht Verdacht schöpften, dass jemand anderes ihre Passage nutzte, und sie mir bei meinem nächsten Gang auf die polnische Seite auflauerten. Vielleicht hätten sie mich nicht gleich umgebracht, aber ich hatte es, so hatte Ruth mich gewarnt, mit äußerst brutalen Menschen zu tun.
Meine Hände zitterten immer mehr, ich war nervöser als sonst, wahrscheinlich wegen der Begegnung mit den Schmalzowniks. Ein Stein fiel mir aus der Hand, halb auf den Fuß. Ich biss die Zähne zusammen, um keinen verräterischen Laut von mir zu geben. Am liebsten wäre ich weggelaufen, aber ich musste die Mauer wieder schließen.
Um mich zu beruhigen, ertastete ich das Moos vor den Steinen. Es war weich und feucht. Wieder spürte ich, dass es auf der Welt noch etwas anderes gab als meine Angst. Etwas ruhiger hob ich den Stein wieder vom Boden auf, meine Hand zitterte dabei nicht mehr ganz so sehr, und setzte ihn in die Lücke. Nur noch fünf Steine: Aus der Ferne hörte ich plötzlich laute Gebete, irgendwo auf dem Friedhof war eine Beerdigung. Im Ghetto wurde andauernd gestorben. Nur noch vier Steine: Einer der Trauernden nieste. Nur noch drei Steine: Aus einer anderen Richtung hörte ich schwere Schritte. Wachen? Ich drehte mich nicht um. Umdrehen würde wertvolle Zeit kosten. Nur noch zwei Steine: Kamen die Schritte näher? Nur noch ein Stein: Nein, sie entfernten sich. Das Loch war wieder geschlossen. Endlich.
Ich blickte mich um und erkannte: Die Schritte gehörten zu zwei deutschen SS-Soldaten. Sie gingen zu der Trauergemeinde, die ungefähr zweihundert Meter entfernt von mir war, vielleicht um die Trauernden zu quälen. So etwas taten sie gern.
Geduckt huschte ich mit meinen Taschen von der Mauer weg. Drei Gräber nach links, dann zwei nach rechts. Ich hielt kurz an, nahm die Kette mit dem Jesus-Kreuz vom Hals und warf sie zu den Einkäufen in die Tasche. Danach griff ich in einen kleinen Busch, ertastete darin ein kleines Stückchen Stoff und holte es heraus. Es war meine Armbinde mit dem Davidstern, die ich dort deponiert hatte. Ich streifte sie mir über.
Jetzt war ich nicht mehr Dana, die Polin.
Jetzt war ich wieder Mira, die Jüdin.
Mit mir durfte jeder Deutsche machen, was er wollte. Und jeder Pole. Sogar jedes Mitglied der Judenpolizei.
Immer wenn ich diese Armbinde anzog, erinnerte ich mich an den Tag, an dem ich sie das erste Mal hatte tragen müssen. Ich war damals dreizehn, es gab das Ghetto noch nicht, aber bereits jede Menge Schikanen gegen die Juden. Schon im November 1939 befahlen die Nazis, dass jeder Jude den Stern tragen musste. Natürlich wurden die Binden nicht etwa an uns verteilt, wir Juden mussten sie uns selber nähen oder von Händlern kaufen.
Gleich am ersten Tage des Erlasses gingen mein Vater, mein Bruder und ich gemeinsam durch den eisigen Novemberregen zum Markt. Damals trugen wir alle noch gute Mäntel, sodass uns die Kälte nichts anhaben konnte.
Bis der deutsche SS-Soldat kam.
Er trat uns auf dem Bürgersteig entgegen, und wir Kinder wussten nicht genau, was wir tun sollten, ihm ausweichen oder ihn grüßen. Mein Vater hatte von einem Freund noch am Abend zuvor geschildert bekommen, dass er geschlagen worden war, weil er es gewagt hatte, einen deutschen Soldaten ergeben zu grüßen. So warnte Papa uns: «Schaut nach unten.»
Wir gingen weiter, den Blick zu Boden, an dem Deutschen vorbei. Doch der Soldat hielt uns an und schrie: «Was ist Jude, grüßt du nicht?»
Ehe mein Vater antworten konnte, wurde er geschlagen. Mein Vater wurde geschlagen! Der ehrwürdige Mann, der angesehene Arzt, der Vater, zu dem wir immer aufsahen, der in seiner Strenge uns gegenüber so stark, gar übermächtig schien, wurde geschlagen.
«Entschuldigung», sagte er, während er sich mühsam aufrappelte und das Blut von seiner Lippe in den grauen Bart tropfte.
Mein starker Vater entschuldigte sich? Dafür, dass er geschlagen wurde?
«Und was geht ihr auf dem Bürgersteig?», blaffte der Deutsche. «Ihr habt auf der Straße zu gehen!»
«Selbstverständlich», antwortete Papa und zog uns auf die Straße.
«Barfuß!», befahl der Soldat.
Wir schauten ihn fassungslos an. Er nahm sein Gewehr von der Schulter, um seinem Befehl Nachdruck zu verleihen. Ich sah zu den tiefen Pfützen vor uns.
«Kinder, zieht euch die Schuhe aus», drängte mein Vater, «und die Socken.»
Er machte es vor und stellte sich mit nackten Füßen in die kalte Pfütze. Ich war zu schockiert, um überhaupt zu reagieren, aber mein Bruder Simon, der damals so alt war wie ich jetzt, wurde wütend. Die Demütigung Papas trieb ihm die Zornesröte ins Gesicht. Er baute sich vor dem Soldaten auf, obwohl er – wie alle in unserer Familie – eher schmächtig war, und schrie: «Lassen Sie ihn in Ruhe!»
«Maul halten!»
«Mein Vater hat einem deutschen Soldaten das Leben gerettet!»
Anstatt zu antworten, nahm der Soldat den Gewehrkolben und schlug Simon damit ins Gesicht. Mein Bruder stürzte zu Boden, Papa und ich liefen sofort zu ihm. Seine Nase war gebrochen, ein Zahn herausgeschlagen.
«Schuhe ausziehen!»
Simon konnte gar nichts tun, er musste vor Schmerz weinen. Es war das erste Mal, dass eines von uns Kindern geschlagen wurde. Und dann auch noch so brutal.
Mein Vater zog ihm die Schuhe aus, damit der Soldat nicht noch mal zuschlug. Ich hatte so viel Angst, dass ich ebenfalls Schuhe und Socken auszog. Mein Vater und ich halfen Simon, der immer noch weinte, wieder auf die Beine. Papa nahm uns beide an den Händen und quetschte sie ganz fest, als könne er uns damit Halt geben. So gingen wir barfuß durch die eiskalten Pfützen.
Und der Soldat rief: «Ich hoffe, ihr habt eure Lektion gelernt.»
Das hatten wir. Vater hatte begriffen, dass die Deutschen keine Regeln aufstellten, auf die man sich verlassen konnte: Grüßen, nicht grüßen, es war einerlei, die Regeln wurden immer so ausgelegt, dass sie einen quälen konnten. Und Simon wusste von diesem Augenblick an, dass er sich nie wieder mit einem Deutschen anlegen würde. Ein Schlag, ein herausgeschlagener Zahn, eine gebrochene Nase, und sein Wille zum Widerstand war für immer gebrochen. Auch ich begriff etwas, während ich mit nackten Füßen durch die eiskalten Pfützen ging, meine Zehen vor Kälte erst weh taten, dann taub wurden und mein Vater mich voller Scham ansah: Die Erwachsenen konnten mich nicht mehr schützen.
Papa wusste das auch. Ich sah es in seinen traurigen Augen. Er litt noch so viel mehr darunter als ich. Am liebsten hätte ich ihn in den Arm genommen, so wie er es mit mir als kleines Kind nach einem Albtraum getan hatte. Doch das hier war kein böser Traum, aus dem man erwachen konnte. Der deutsche Soldat wollte, dass wir weiter durch die Pfützen marschierten. Auf und ab. Als Spektakel für alle Umstehenden. Die polnischen Passanten sahen betreten zur Seite. Jedenfalls die meisten. Einige von ihnen lachten aber auch. Einer grölte sogar: «Endlich sind die Juden in der Gosse!» Während wir so erniedrigt wurden, drückte ich die Hand von Papa und flüsterte ihm zu: «Ich liebe dich, egal was passiert.»
Damals hatte ich ja auch noch nicht geahnt, was alles passieren kann.
Vom Begräbnis her hörte ich das Gelächter der deutschen Soldaten. Anscheinend machten sie sich tatsächlich irgendeinen Spaß mit den Trauernden. Vielleicht ließen sie sie fröhlich tanzen. Ich hatte von solch widerlichen Scherzen gehört.
Was auch immer da los war, ich durfte keine Zeit verlieren. Ich nahm meine Taschen und lief gebückt von Grabstein zu Grabstein, Richtung Ausgang.
Da rief einer der Soldaten: «Lacht gefälligst mit!»
Gleich darauf hörte ich das gequälte Lachen der Menschen am Grab. Ich konnte ihnen nicht helfen. Das hier war das Ghetto. Meine Heimat.
3
Ignorieren. Ignorieren. Ignorieren.
Ich hastete durch die Straßen des Ghettos und musste wie immer alles um mich herum ausblenden, um das Leben hier ertragen zu können. Die Enge. Den Lärm. Den Gestank.
Es lebten so viele Menschen hier, ständig wurde ich angerempelt. Und das, obwohl ich wie alle anderen Ghettobewohner darauf bedacht war, die anderen möglichst nicht zu berühren. Die Angst, sich mit Typhus anzustecken, war einfach riesengroß.
Es war auch unglaublich laut, nicht etwa wegen des Verkehrs – im Ghetto durften keine Autos fahren –, sondern wegen der vielen Menschen, die hier lebten, sich unterhielten und stritten. Immer wieder hörte ich jemanden brüllen, entweder weil ihm etwas gestohlen wurde, oder weil er sich von einem Händler betrogen fühlte, oder schlicht und einfach, weil er wahnsinnig geworden war.
Am schlimmsten aber war der Gestank. In mehreren Hauseingängen lagen Leichen. Ein Anblick, an den ich mich nicht gewöhnen konnte. So viele Angehörige hatten weder das Geld noch die Kraft, ihre Liebsten bestatten zu lassen. Stattdessen legten sie die Toten nachts einfach auf die Straße, damit sie wie Abfall am nächsten Tag abtransportiert werden konnten. Über Nacht wurden den Leichen die Klamotten gestohlen. Eine Fledderei, die ich sogar nachvollziehen konnte: Die Lebenden benötigten Jacken, Hosen und Schuhe viel dringender.
Ich ignorierte auch die vielen bettelnden Kinder, an denen ich vorbeiging. Einige hockten apathisch am Straßenrand, andere, die noch die Kraft aufbrachten, zupften an meiner Kleidung. Für ein Stück Brot aus meinen Taschen hätten sie sich gegenseitig die Augen ausgekratzt.
Hannah durfte einfach nicht bei ihnen landen!
Vor allen Dingen aber ignorierte ich die schreiende Ungerechtigkeit im Ghetto. Neben all den armen und verzweifelten Menschen in ihren zerlumpten Kleidern gab es auch einige Reiche, die sich in Fahrrad-Rikschas zu den Delikatessläden fahren ließen. Eine Frau, die an mir vorbeifuhr und dabei ihren ausgemergelten Fahrer anbrüllte, er solle doch ein bisschen schneller machen, trug sogar einen edlen Pelz. Und das an diesem warmen Tag.
Trotz des Gestanks konnte ich im Ghetto wieder etwas freier atmen. Trotz der Enge konnte ich mich bewegen, ohne ständig Angst zu haben. Hier, auf diesen überfüllten, stinkenden und lauten Straßen wurde ich nicht von Hyänen gejagt. Hier war ich unter meinesgleichen. Darunter verstand ich die vielen, vielen Menschen, die versuchten, ihre Würde in dieser Hölle zu bewahren. Sie trugen gepflegte Kleidung, waren gewaschen und gingen ohne gesenkten Blick durch die Straßen. Gewillt, den Alltag zu meistern, ohne anderen zu schaden. Ohne zum Tier zu werden.
Das Ghetto hatte eben bei weitem noch nicht alle von uns gebrochen. Es gab sogar richtig gute Menschen. Zu denen gehörte ich selbstverständlich nicht. Die Guten, das waren die Lehrer, die Freiwilligen, die in den Suppenküchen arbeiteten, und Menschen wie Daniel. Vor allen Dingen Menschen wie Daniel.
Durch das Gedränge ging ich zu dem kleinen Laden von Jurek, einem bärtigen Alten, der die meiste Zeit gute Laune hatte und einer der wenigen war, die kaum unter den Umständen litten. Und das nicht nur, weil er gute Geschäfte machte mit den Waren, die er von mir und anderen Schmugglern ankaufte, sondern auch, weil er sein Leben schon gelebt hatte. «Ich hatte siebenundsechzig gute Jahre auf der Erde», hatte er einmal zu mir gesagt, «das ist mehr, als die meisten Menschen jemals haben werden. Egal ob Jude, Deutscher oder Kongolese. Wenn dann die letzten Jahre mühsam sind, fällt das in der Endabrechnung nicht so ins Gewicht.»
Als ich seinen Laden mit meinen Taschen betrat und dabei die kaputte Türklingel mehr schepperte als klingelte, rief er freudig: «Mira, mein Liebling!»
Dass er mich immer Liebling nannte, gefiel mir, obwohl mir selbstverständlich klar war, dass er jeden so nannte, der ihm gute Ware brachte. Mein Blick fiel in die Auslage, und ich registrierte die aktuellen Preise für Nahrungsmittel: ein Ei – drei Złoty, ein Liter Milch – zwölf Złoty, ein Kilo Butter – 115 Złoty, ein Kilo Kaffee – 660 Złoty … irgendwann musste ich anfangen, Kaffee zu schmuggeln. Die Gewinnspanne war unglaublich. Doch dazu brauchte ich mehr Geld, um welchen auf der polnischen Seite einkaufen zu können.
Selbstverständlich waren die Waren in Jureks Laden für Normalsterbliche unerschwinglich. Ein Arbeiter, der in den deutschen Fabriken des Ghettos knechtete, verdiente im Monat in etwa 250 Złoty. Er könnte sich also gerade mal zwei Kilo Butter und einen Liter Milch davon kaufen. Jurek sah in meine Taschen und lachte zufrieden: «Du bist wirklich mein Liebling.»
Jetzt sagte er es so, dass ich etwas unsicher wurde: Vielleicht war es ja doch nicht einfach nur charmantes Gerede. Womöglich schätzte er mich wirklich am meisten.
Nachdem wir geklärt hatten, was ich für meine Familie behalten wollte – Eier, Karotten, etwas von der Marmelade, aber auch ein Pfund Butter –, biss er in den Blätterteigkuchen und überlegte, wie viel er mir zahlen würde. Normalerweise gab er mir die Hälfte von dem Geld, für das er die Sachen später selbst verkaufte. Ob das gerecht war? Jedenfalls hatte ich niemanden gefunden, der mir mehr gab. Und die Waren selbst zu Geld zu machen, war gar nicht so einfach. Je länger ich sie besaß, desto größer wurde die Gefahr, dass man sie mir stahl.
Jurek nahm Geld aus seiner Kasse, auf der eine dicke Schicht Staub lag – er hielt nicht allzu viel vom Saubermachen –, und drückte mir die Scheine in die Hand. Ich zählte nach, ob er mich auch nicht übers Ohr gehauen hatte, und war erstaunt: Das war mehr Geld als sonst. Bestimmt zweihundert Złoty zu viel! Mit dem Geld konnte ich beim nächsten Gang tatsächlich Kaffee besorgen. Hatte Jurek sich verrechnet? Ausgerechnet der schlaue Jurek? Sollte ich nachfragen? Ich beschloss, es nicht zu tun. Ich konnte jeden Złoty gebrauchen. Wenn er sich verrechnet hatte, war er selber schuld. Außerdem konnte er den Verlust verkraften.
«Ich hab mich nicht verzählt», lachte er. «Das stimmt schon so.»
Mist! In meinem Gesicht konnte man einfach viel zu leicht lesen, was ich dachte. Jedenfalls waren durchtriebene Menschen wie Jurek oder der Anführer der Schmalzowniks dazu in der Lage. Das musste sich ändern!
«Du gibst mir freiwillig mehr?», fragte ich irritiert.
«Ja, weil ich dich wirklich sehr mag, Mira …», antwortete der Alte und strich mir dabei mit seiner Hand über die Wange. Das hatte ganz und gar nichts Anzügliches, es war freundschaftlich, fast schon väterlich. Er erwartete keine Gegenleistung für sein Geld. Abgesehen davon hatte ich mal das Gerücht gehört, dass Jurek sich nie etwas aus Frauen gemacht hatte und eher auf Männer stand.
«Und ich tue es, weil Geld bald sowieso nichts mehr bedeutet.»
Wie kam er denn darauf? «Du meinst, wegen der Inflation?», fragte ich irritiert.
Tatsächlich stiegen die Preise im Ghetto von Monat zu Monat. War Anfang des Jahres das Ei noch für einen Złoty zu haben, musste man jetzt das Dreifache zahlen.
«Nein, das meine ich nicht», lachte Jurek und sagte etwas, was mich erschreckte: «Du sollst es noch ein bisschen gut haben.»
Das klang fast so, als ob ich bald sterben würde. Was sollte das? Sicher setzte ich bei jedem Gang auf die andere Seite mein Leben aufs Spiel, und heute war es wirklich knapp gewesen, aber so leicht würde ich nicht sterben. Ich würde noch mehr aufpassen, mich noch besser vorbereiten, mich nie erwischen lassen.
«Mir wird beim Schmuggeln schon nichts passieren», widersprach ich Jurek.
«Darum geht es nicht», seufzte er. «Es wird hier bald sehr übel werden.»
«Was meinst du damit? Hast du etwas gehört?», fragte ich besorgt.
«Ja, ich hab da Dinge gehört, keine guten Dinge …» Mehr wollte er nicht sagen.
«Was für Dinge?», hakte ich nach. «Von wem?»
«Von einem SS-Mann, mit dem ich Geschäfte mache.»
Ich mochte Jurek, aber es widerte mich an, dass er auch mit SS-Männern handelte. Doch das war jetzt nicht der Punkt: «Was genau hat er erzählt?»
«Er hat nur Andeutungen gemacht, aber er erwähnte, dass unser friedliches Leben hier ab morgen vorbei ist.» Mit einem Mal lachte der sonst so joviale Jurek bitter: «Als ob man das hier ein friedliches Leben nennen könnte.»
«Was kann der SS-Mann damit meinen?»
«Ich weiß es nicht … aber ich rechne mit dem Schlimmsten.»
Dass der optimistische Jurek das Gerede ernst nahm, beunruhigte mich. Es gab immer wieder Gerüchte, die Deutschen würden uns allesamt töten. Dass es ihnen nicht ausreichte, wenn nur ein Teil von uns verhungerte. Aber das waren eben nur Gerüchte. Und Jurek war normalerweise keiner, der darauf etwas gab.
«Das wird nicht passieren», widersprach ich, «die Deutschen brauchen uns doch als Arbeiter.»
So viele Juden arbeiteten als billige Sklaven in den Fabriken des Ghettos und produzierten alles Mögliche für die Deutschen: Möbel, Teile für Flugzeuge, sogar Uniformen für die Wehrmacht. Es wäre doch verrückt, darauf zu verzichten.
«Ja, sie brauchen Zwangsarbeiter», gab Jurek mir recht. «Aber nicht über vierhunderttausend.»
«Sie bringen doch auch lauter Juden aus den anderen Ländern hierher», argumentierte ich weiter. «Wenn sie die töten wollten, hätten sie das doch schon längst in deren Heimat getan.»
Aus Tschechien und auch aus Deutschland waren in den letzten Wochen viele Juden in das Ghetto gebracht worden. Besonders die deutschen Juden wollten mit uns polnischen nichts zu tun haben. Sie hielten sich für etwas Besseres. Viele von ihnen sahen mit ihrer großen Statur, den blonden Haaren und den blauen Augen aus wie Deutsche, einige von ihnen waren sogar Christen, die nur das Pech hatten, dass irgendein Großvater, den sie vielleicht noch nicht mal kannten, Jude war. Die Deutschen hatten diesen jüdischen Christen sogar erlaubt, einen Pfarrer mitzubringen, der für sie im Ghetto den Gottesdienst abhielt. Wie musste das alles für diese Christen sein? Sie waren jeden Sonntag in die Kirche gegangen und wurden mit einem Mal aus ihren Häusern vertrieben, mussten Armbinden mit dem Stern tragen und wurden in diese Hölle verschleppt –, alles nur, weil sie einen jüdischen Großvater oder eine jüdische Großmutter hatten. Jedenfalls besaß dieser Jesus, an den sie immer noch glaubten, einen merkwürdigen Sinn für Humor.
«Logisch wäre es schon», stimmte mir Jurek zu, «die Menschen dort zu töten, wo sie leben.»
«Aber?», hakte ich nach.
«Die Nazis haben ihre ganz eigene Logik.»
Unwillkürlich musste ich daran zurückdenken, wie mein Vater von dem Soldaten geschlagen worden war, weil er ihn nicht gegrüßt hatte, und genauso geschlagen worden wäre, wenn er es getan hätte. Ja, die Nazis hatten wirklich ihre eigene, kranke Logik.
Dennoch überstieg es meine Vorstellungskraft, dass etwas Katastrophales geschehen könnte. Daher sagte ich zu Jurek, und vor allen Dingen zu mir selbst: «Es wird schon nicht so schlimm werden.»
Jurek rang sich ein Lächeln ab: «Das heißt, du willst mir das zusätzliche Geld zurückgeben?»
«Dafür kauf ich auf der polnischen Seite Kaffee», antwortete ich und ging zur Tür.
Da konnte der alte Mann sogar wieder richtig lachen: «Mira, du bist und bleibst mein Liebling.»
Ich verließ Jureks kleinen Laden und stürzte mich wieder nach draußen ins Gedränge. Auf seine ganz eigene Weise war dieses Ghetto mit seinem Gestank, der Enge und dem Lärm so lebendig, dass ich es mir einfach nicht ausmalen konnte, dass es je sterben würde. Einzelne Menschen sicherlich. Vielleicht sogar viele. Doch für jeden, der starb, wurden drei neue von den Deutschen in das Ghetto gepfercht. Solange es Juden gab, würde es auch das Ghetto geben.
Ich beschloss, Gerüchte Gerüchte sein zu lassen und mich nicht auf den Tod, sondern auf das Leben zu konzentrieren: Gleich würde ich meiner Familie ein großartiges Omelette mit frischen Eiern zubereiten!
4
Ich war keine fünf Meter gegangen, da sah ich einen kleinen, dreckigen Mann in Lumpen auf der Straße herumspringen. Es war Rubinstein.
Hunderttausende Menschen lebten im Ghetto, aber es gab nur drei, die jeder kannte. Einer von ihnen wurde verachtet, einer hochverehrt und einer belächelt. Der, der von allen belächelt wurde, war Rubinstein. Er hüpfte vor mir auf der Straße herum wie ein Kind. Oder wie ein Verrückter, der er vermutlich auch war. Oder wie ein Clown, der er ganz gewiss war. Der kleine Lumpenmann sprang auf mich zu und blieb direkt vor mir stehen. Dabei machte er eine ausladende Verbeugung, als ob er ein Adeliger wäre und ich eine Prinzessin. Und er begrüßte mich mit seinem Lieblingsspruch: «Alle gleich!»
Mein gesunder Menschenverstand wusste natürlich, dass im Ghetto nicht alle gleich waren. Doch jedes Mal, wenn ich Rubinstein das sagen oder laut rufen hörte, fragte ich mich, ob er womöglich nicht doch recht hatte. Auch und vor allem vor dem Hintergrund von Jureks Worten eben: Waren wir angesichts unserer Ghettohölle und unseres angeblich nahenden Todes nicht wirklich alle gleich? Egal ob wir reich oder arm waren? Jung oder alt? Bei gesundem Menschenverstand oder verrückt?
Und waren nicht selbst die Deutschen uns gleich, selbst wenn sie so viel Macht über uns besaßen? Schließlich konnten sie in diesem Krieg, der noch lange nicht zu Ende war und bei dem sie die Welt noch nicht komplett erobert hatten, ebenfalls jederzeit sterben.
Jedenfalls hatte Rubinstein als Einziger im Ghetto vor den Deutschen keine Angst. Wenn er SS-Männern begegnete, sprang er genauso um sie herum wie um uns. Dabei zeigte er erst auf sie, dann auf sich und lachte: «Alle gleich!» So lange, bis die SS-Leute zurücklachten und erwiderten: «Alle gleich.» Entweder weil sie es lustig fanden, oder weil sie tief in ihrem Inneren spürten, was sie uns gegenüber niemals zugeben würden: dass sie genauso zerbrechlich in dieser Welt waren wie wir.