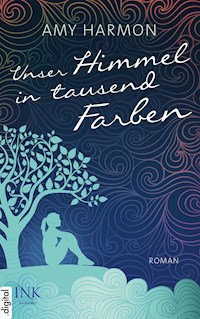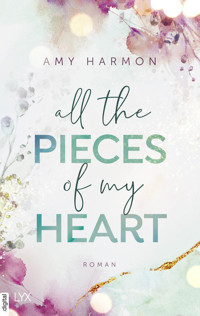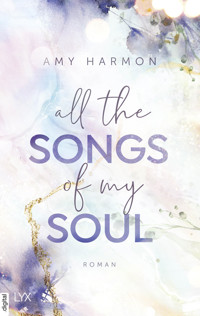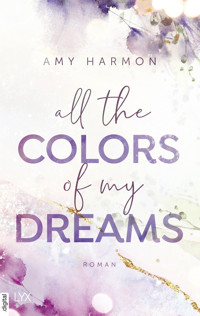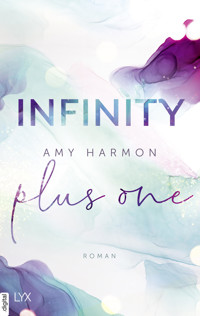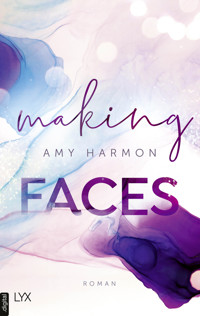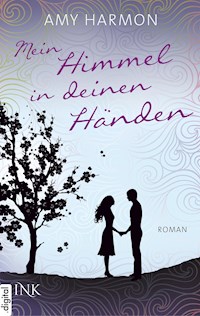9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Manchmal können genau die Dinge uns retten, vor denen wir gerettet werden möchten."
Die 19-jährige Blue Echohawk hat nur ein Ziel: herausfinden, wer sie wirklich ist. Von ihrer Mutter als Kleinkind am Straßenrand zurückgelassen, ist Blue in dem schmerzhaften Glauben aufgewachsen, ganz allein auf der Welt zu sein. Sie spürt, wie ihr Leben ihr jeden Tag ein bisschen mehr zu entgleiten droht. Doch dann trifft sie auf ihren neuen Geschichtslehrer Darcy Wilson. Er ist jung, hat einen coolen britischen Akzent und eine ansteckende Leidenschaft für sein Unterrichtsfach. Darcy ist der erste Mensch, der an Blue glaubt und hinter ihre abweisende Fassade blickt. Aber Blue und Darcy wandern auf einem schmalen Grat. Denn während sich die beiden einander immer mehr öffnen, wissen sie auch, dass eine Liebe zwischen ihnen unmöglich ist ...
"Alles an diesem Buch ist einfach nur wunderschön." ALL ABOUT ROMANCE BLOG
Remake von FÜR IMMER BLUE
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 580
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nachwort
Die Autorin
Die Romane von Amy Harmon bei LYX
Leseprobe
Impressum
Amy Harmon
A Different Blue
Roman
Ins Deutsche übertragen von Frauke Lengermann
ZU DIESEM BUCH
Blue Echohawk weiß nicht, wer sie ist. Von ihrer Mutter als Kleinkind am Straßenrand zurückgelassen, ist Blue in dem schmerzhaften Glauben aufgewachsen, vollkommen allein auf der Welt zu sein und nirgends richtig dazuzugehören. Ihre Pflegemutter hat sich nie sonderlich für sie interessiert, und an der Highschool ist die Neunzehnjährige eine Außenseiterin. Blue kleidet sich anders als die anderen, schminkt sich auffällig und umgibt sich mit den falschen Menschen. Es ist, als ob ihr Leben ihr Stück für Stück entgleitet. Doch all das ändert sich, als sie ihren neuen Geschichtslehrer kennenlernt. Darcy Wilson ist jung und gut aussehend. Er hat einen coolen britischen Akzent und eine Leidenschaft für sein Unterrichtsfach, die ansteckend ist, egal wie sehr Blue sich dagegen wehrt. Darcy ist der erste Mensch, der hinter ihre Fassade blickt und sie darin bestärkt, an sich selbst und ihr künstlerisches Talent zu glauben. Er zeigt ihr, dass es keinen Sinn hat, vor der Vergangenheit davonzulaufen, und dass es sich lohnt, für das Leben zu kämpfen. Das, was zwischen ihnen ist, geht schon bald über eine normale Lehrer-Schüler-Beziehung hinaus. Blue spürt, wie sie ihr Herz, das so lange Zeit verschlossen war, jeden Tag ein bisschen mehr für Darcy öffnet. Auch wenn sie weiß, dass eine Liebe zwischen ihnen unmöglich ist …
Für Mom und Dad
Dank euch habe ich immer gewusst, wer ich bin.
PROLOG
August 1993
Die Hitze war erdrückend, und das kleine Mädchen warf sich unruhig auf dem Rücksitz hin und her. Sein Gesicht war gerötet. Da die Decke, die ihm als Unterlage diente, zerschlissen war, ruhte die Wange des Mädchens auf dem Plastiksitz. Für ein so winziges Wesen schien die Kleine erstaunlich zäh. Sie weinte nur selten und klagte nie. Ihre Mutter hatte sämtliche Fensterscheiben heruntergekurbelt, was aber wenig nützte. Immerhin war die Sonne inzwischen untergegangen und brannte nicht länger auf das Auto herab. Die Dunkelheit machte die Hitze erträglicher, auch wenn draußen immer noch über fünfunddreißig Grad herrschten. Außerdem fielen sie und ihre Tochter in der Dunkelheit weniger auf. Die Klimaanlage arbeitete nur zufriedenstellend, wenn das Auto in Bewegung war. Inzwischen aber saßen sie seit zwei Stunden in einer durch einen dürftigen Schatten geschützten Ecke, behielten den Truck im Auge und warteten darauf, dass der Mann wieder herauskam.
Die Frau hinterm Steuer kaute an ihren Fingernägeln und dachte daran aufzugeben. Was sollte sie ihm sagen? Dennoch, sie brauchte Hilfe. Das Geld, das sie ihrer Mutter geklaut hatte, hatte nicht lange gereicht. Ethans Eltern hatten ihr zweitausend Dollar gegeben, aber das Geld war schneller für Benzin, Motels und Essen draufgegangen, als sie je für möglich gehalten hätte. Also hatte sie in den letzten Monaten ein paar Dinge getan, auf die sie nicht besonders stolz war, doch sie redete sich ein, keine Wahl gehabt zu haben. Sie war jetzt Mutter und musste sich um ihr Kind kümmern, selbst wenn das bedeutete, Sex als Gegenleistung für Geld oder Gefälligkeiten anzubieten. Oder für Drogen, flüsterte eine kleine Stimme in ihrem Kopf. Doch dann schob sie den Gedanken beiseite, sie würde es ohnehin nicht mehr lange aushalten. Sie brauchte unbedingt einen neuen Schuss.
Bis hierher war sie also gekommen, nicht besonders weit weg von zu Hause. Ein paar Stunden. Dabei war sie durch das halbe Land und wieder zurück gereist – und hatte trotzdem nichts vorzuweisen.
Und dann war er plötzlich da und marschierte zurück zu seinem Pick-up. Er zog den Autoschlüssel aus der Tasche und versuchte die Beifahrertür aufzuschließen. Dabei wurde er von einem räudigen grauschwarzen Hund begrüßt, der unter dem Fahrzeug ein Nickerchen gemacht hatte, während er – genauso wie sie – darauf gewartet hatte, dass er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte. Der Hund umkreiste seine Beine, während der Mann am Türgriff rüttelte und leise fluchte: »Verdammtes Ding. Muss mich endlich mal drum kümmern.«
Schließlich gelang es ihm, die Tür aufzureißen, und der Hund sprang auf den Beifahrersitz. Man merkte ihm an, dass er sich seines Platzes in der Welt sicher war. Nachdem der Mann die Tür hinter dem Hund geschlossen hatte, ruckelte er ein weiteres Mal an dem Griff. Er bemerkte nicht, dass er beobachtet wurde. Seelenruhig ging er um den vorderen Teil seines Trucks herum, kletterte hinter das Steuer und manövrierte Auto und Wohnwagen aus der Parklücke, die er die letzten paar Stunden besetzt gehalten hatte. Zwar streiften sie seine Augen beim Vorbeifahren, blieben aber keine Sekunde an ihr hängen, kein Zögern lag in seinem Blick. War das nicht typisch? Er nahm sich nicht mal eine Sekunde Zeit, um genauer hinzusehen. Verschwendete keinen Gedanken an sie. Wut stieg in ihr auf. Sie war es leid, ständig übersehen zu werden, war es leid, dass man an ihr vorbeiging, ohne sie zu bemerken, sie ignorierte und abwies.
Sie startete den Motor und folgte ihm, hielt aber genügend Abstand, um kein Misstrauen zu erregen. Aber warum hätte er auch misstrauisch werden sollen? Er wusste ja nicht einmal, dass sie existierte. Also war sie für ihn unsichtbar, nicht wahr? Wenn nötig, würde sie ihm die ganze Nacht folgen.
5. August 1993
Der Anruf kam kurz vor vier Uhr nachmittags herein. Officer Moody war absolut nicht in der Stimmung für solche Geschichten. Doch obwohl er seine Schicht fast beendet hatte, versprach er, sich darum zu kümmern, und fuhr raus zum Stowaway. Dem Namen des schmuddeligen Motels nach zu urteilen – »Blinder Passagier« – nahmen sich nur Leute, die unter dem Radar bleiben wollten, dort ein Zimmer. Das Logo der Unterkunft – ein neonfarbener Schrankkoffer, aus dessen geöffneter Klappe ein Kopf ragte – brutzelte in der Nachmittagshitze. Officer Moody hatte jedes einzelne seiner achtundzwanzig Lebensjahre in Reno verbracht und wusste genauso gut wie jeder andere, dass die Leute das Stowaway nicht in erster Linie zum Schlafen aufsuchten. Er hörte das Heulen einer Krankenwagensirene. Die Motelangestellte hatte offenbar mehr als einen Anruf getätigt. Schon den ganzen Nachmittag rumorte es unangenehm in seinem Magen. Diese verdammten Burritos. Er hatte sie mittags gierig heruntergeschlungen, mit einer ordentlichen Ladung Käse, Avocadocreme, klein geschnittenem Schweinefleisch, saurer Sahne und grünen Chilischoten, und jetzt zahlte er den Preis dafür. Er musste dringend nach Hause und hoffte inständig, dass die Angestellte vom Empfang sich irrte, was den Gast in einem der Zimmer im oberen Stockwerk anging. Moody wollte hier möglichst schnell Schluss machen.
Doch die Angestellte hatte sich nicht geirrt. Die Frau war tot. Kein Zweifel. Vermutlich lag sie schon seit achtundvierzig Stunden in Zimmer 246. Es war August, ein trockener heißer Monat in Reno, Nevada. Der Leichnam stank. Die Burritos kamen Officer Moody hoch, und er schlüpfte eilig aus dem Zimmer, ohne etwas anzufassen. Im Vorübergehen informierte er die Sanitäter, die die Treppe hinaufgerannt kamen, dass ihre Hilfe nicht mehr gebraucht wurde. Sein Vorgesetzter würde ihn einen Kopf kürzer machen, wenn er zuließ, dass sie in dem Zimmer herumtrampelten und den Tatort verunreinigten. Also schloss er die Tür zu Zimmer 246 hinter sich und teilte der neugierigen Empfangsdame mit, in dem Motel würde es in Kürze nur so von Polizisten wimmeln, die ihre Hilfe brauchten. Danach rief er seinen Vorgesetzten an.
»Martinez? Wir haben hier eine Frau, ganz offensichtlich tot. Ich habe den Tatort gesichert und die Sanitäter nach Hause geschickt. Ich brauche Verstärkung.«
Eine Stunde später machte der Kriminaltechniker Fotos vom Tatort. Die Polizisten durchkämmten die Umgebung und befragten sämtliche Gäste, die Betreiber und Mitarbeiter umliegender Geschäfte und sämtliche Motelangestellte. Detective Stan Martinez, Officer Moodys Vorgesetzter, hatte die Überwachungskamera beschlagnahmt. Denn, Wunder über Wunder, das Stowaway-Motel war tatsächlich mit einer Überwachungskamera ausgestattet. Der Gerichtsmediziner befand sich auf dem Weg zum Tatort.
Bei der Befragung gab die Empfangsdame an, Zimmer 246 würde wegen der kaputten Klimaanlage zurzeit nicht vermietet. Seit zwei Tagen hätte es niemand betreten oder verlassen. Man hätte zwar einen Termin mit einem Reparaturservice gemacht, aber die defekte Klimaanlage habe nicht besonders weit oben auf der Prioritätenliste gestanden. Niemand wusste, wie die Frau in das Zimmer gelangt war, aber es stand fest, dass sie kein Zimmer gebucht und etwas so Hilfreiches wie eine Kreditkarte hinterlassen hatte, um für ihren Aufenthalt zu bezahlen. Außerdem trug sie keinerlei Dokumente bei sich, mit denen sich ihre Identität hätte bestimmen lassen. Dass die Frau bereits seit zwei Tagen oder länger tot war und das Motel nur selten Gäste hatte, die länger als eine Nacht blieben, bedeutete ebenfalls keine Hilfe bei den Ermittlungen. Das Stowaway lag am Stadtrand direkt an der Schnellstraße, und falls es jemanden gab, der in der Nacht ihres Todes etwas gehört oder gesehen hatte, war er längst weitergezogen.
Als Officer Moody um acht Uhr abends endlich nach Hause kam, hatte sich seine Stimmung kein Stück gebessert – sie waren nicht in der Lage gewesen, die Frau zu identifizieren. Die einzigen Anhaltspunkte bei ihren Ermittlungen waren die Klamotten, die sie am Leibe getragen hatte. Moody beschlich ein ungutes Gefühl, was diesen Fall anging, und er glaubte nicht, dass das an den Burritos lag.
6. August 1993
»Konnte die Leiche inzwischen identifiziert werden?« Die Tote ging Officer Moody einfach nicht aus dem Kopf. Sie hatte ihn die ganze Nacht beschäftigt. Streifenpolizisten führten keine Ermittlungen durch. Aber Martinez war sein Vorgesetzter und hatte offenbar nichts dagegen, über den Fall zu sprechen, insbesondere, da es so aussah, als wäre er ohnehin schnell abgeschlossen.
»Der Gerichtsmediziner hat ihre Fingerabdrücke genommen«, sagte er.
»Ach wirklich? Ist was dabei herausgekommen?«
»Jep. Sie war vorbestraft, die meisten Delikte hatten mit Drogenbesitz zu tun. Wir haben jetzt einen Namen und eine alte Adresse. Die Tote ist gerade neunzehn geworden, am dritten August hatte sie Geburtstag.« Detective Martinez schüttelte sich unbehaglich.
»Soll das heißen, dass sie an ihrem Geburtstag gestorben ist?«
»Das ist jedenfalls das, was der Gerichtsmediziner gesagt hat.«
»Überdosis?« Officer Moody war sich nicht sicher, ob er eine Antwort auf diese Frage bekommen würde. Detective Martinez konnte ziemlich verschlossen sein.
»Das dachten wir zuerst. Aber als der Gerichtsmediziner sie umdrehte, konnte man sehen, dass ihr Hinterkopf eingedrückt war.«
»Verdammt«, stöhnte Officer Moody. Dann suchten sie also einen Mörder.
»Wir wissen nicht, ob es die Drogen oder die Kopfwunde war, die ihr den Rest gegeben hat, aber irgendjemand wollte sie auf jeden Fall um die Ecke bringen. Es sieht so aus, als hätte sie von allen gängigen Drogen der Szene ein bisschen was eingeschmissen. Sie hatte genug von dem Zeug im Blut, um eine ganze Cheerleadermannschaft niederzustrecken«, klärte ihn Martinez auf.
»Cheerleadermannschaft?«, fragte Moody mit einem kleinen Lachen.
»Ja. Sie gehörte zum Cheerleaderteam ihrer kleinen Schule in Süd-Utah. Das stand in dem Polizeibericht. Ganz offensichtlich teilte sie ein paar Ecstasytabletten mit ihren Mannschaftskameradinnen, wurde erwischt und wegen Drogenbesitzes angeklagt. Man hat sie nur deshalb nicht eingesperrt, weil sie minderjährig und es ihr erster Gesetzesverstoß war. Und sie hat die Pillen nur mit den anderen geteilt, nicht verkauft. Wir haben mit der dortigen Polizeidienststelle Kontakt aufgenommen. Sie werden ihre Familie informieren.«
»Hat die Überwachungskamera nützliche Informationen geliefert?«
»Jep. Die Bilder sind absolut eindeutig. Ungefähr um Mitternacht durchquerte sie die Eingangshalle und kletterte durch das Rezeptionsfenster und über den Schreibtisch in den Empfangsbereich, sodass sie mitten im Büro stand. Die Angestellte behauptet, dass sie normalerweise alles abschließt, wenn sie den Schreibtisch verlässt, aber in jener Nacht hatte sie mit einer Magen-Darm-Infektion zu kämpfen und rannte zum Klo, ohne die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.«
Officer Moody musste kurz an seinen Kampf mit dem Burrito zurückdenken, während Martinez weitersprach.
»Die Kamera zeigt, wie das Mädchen das Büro durchsucht und sich einen Schlüssel schnappt. Sie benutzen dort immer noch richtige Schlüssel, Sie wissen, was ich meine. Keine modernen Schlüsselkarten für das Stowaway. Die Empfangsdame sagt, der Schlüssel sei wegen der Probleme mit der Klimaanlage an einen separaten Platz gelegt worden. Die Schlüsselvergabe funktioniert nach einem bestimmten System, und das Mädel war kein Dummkopf. Sie wusste, dass sie mit diesem Schlüssel höchstwahrscheinlich eine Nacht in dem Zimmer verbringen konnte, ohne aufzufallen. Und das ist noch nicht alles. Die Kamera zeigt, wie sie mit dem Auto auf den Motelparkplatz fuhr. Als sie den Parkplatz eine Stunde später wieder verließ, saß ein Mann hinter dem Steuer. Wir haben den Wagen zur Fahndung ausgeschrieben.«
»Großartig. Wie’s aussieht, ist der Fall so gut wie gelöst«, kommentierte Moody mit einem erleichterten Aufseufzen.
»Jep. Sieht so aus, als hätten wir gute Chancen, den Täter bald zu erwischen«, stimmte Martinez zu.
7. August 1993
»Na schön. Ruhe bitte.« Detective Martinez hob die Hände und gab den Mitarbeitern des Polizeireviers, die sich zum morgendlichen Briefing zusammengefunden hatten, ein Zeichen, still zu sein. »Wir sind soeben von den Behörden in Süd-Utah darüber informiert worden, dass die Frau, die am letzten Freitag tot im Stowaway aufgefunden wurde, ein zweijähriges Kind hatte. Auf dem Flugblatt, das vor Ihnen liegt, sehen Sie eine Beschreibung und ein Foto von der Frau. Momentan gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass in den Stunden vor ihrem Tod ein Kind bei ihr gewesen ist. Auf der Kameraaufzeichnung lässt sich keine Spur von einem Kind entdecken, und es gibt auch keine Anzeichen dafür, dass sich eins in dem Motelzimmer aufgehalten hat. Die Familie der Verstorbenen hat die Frau und ihre Tochter seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Aus diesem Grund haben wir keine Möglichkeit herauszufinden, seit wann die beiden nicht mehr zusammen unterwegs gewesen sind.«
»Wir haben bereits mit der Presse Kontakt aufgenommen. Außerdem wurden alle zuständigen Bundesbehörden in Kenntnis gesetzt und alle wesentlichen Informationen an den NCIS weitergegeben. Wir müssen unsere Befragungen unter Zuhilfenahme des Flugblattes wiederholen und das Foto von der Frau so schnell wie möglich an die Öffentlichkeit bringen. Es gilt herauszufinden, ob es Zeugen gibt, die die Frau gesehen haben und bezeugen können, ob sie ein Kind bei sich hatte. Wir haben leider keine aktuellen Fotos von dem Kleinkind, aber die Großmutter hat uns eine recht genaue Beschreibung geben können. Das Mädchen hat wahrscheinlich dunkles Haar und blaue Augen. Ethnische Zugehörigkeit: amerikanischer Ureinwohner. Allerdings ist der Vater möglicherweise weiß, was auch eine Erklärung für die blauen Augen wäre. Die Mutter ist inzwischen seit fünf Tagen tot. Wir alle wissen, dass die Gäste des Stowaway sich in der Regel nur kurz dort aufhalten. Somit haben wir kostbare Zeit verloren und müssen uns beeilen. Also an die Arbeit.«
1
Knallblau
September 2010
Die Schulglocke hatte schon vor zehn Minuten geläutet, was mich aber nicht weiter kratzte. Tatsächlich war es mir ziemlich egal, warum also hätte ich mir Gedanken machen sollen? Der erste Schultag war ohnehin nutzlos. Die meisten Lehrer haben an diesem Tag Nachsicht mit Nachzüglern und stauchen einen nicht vor der ganzen Klasse zusammen. Es war der letzte Kurs des ersten Schultags, und meine Gedanken hatten das Gebäude bereits verlassen und wanderten auf der Suche nach Konturen und Formen durch die Wüste hinaus in die Hügel. Ich konnte das Holz bereits unter meinen Händen spüren. Aber dann zwang ich meinen Geist widerwillig in meinen Körper zurück und straffte die Schultern, um beim Betreten der Klasse möglichst viel Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Das war mir wichtig. Zum Teil deshalb, weil ich die Aufmerksamkeit genoss, aber in erster Linie, um die Leute einzuschüchtern, damit sie mich in Ruhe ließen. Die Lehrer ließen mich dann genauso in Frieden wie diese übertrieben freundlichen Mädels, die unbedingt deine beste Freundin sein wollen. Die Jungs hingegen reagierten normalerweise auf jeden Wink von mir.
Beim Betreten der Klasse warf ich mit einer aufreizenden Kopfbewegung mein langes schwarzes Haar über die Schulter. Mein Augen-Make-up wirkte ziemlich dramatisch, und in meinen engen Jeans konnte ich mich kaum hinsetzen. Immerhin hatte ich die Kunst des Lässig-auf-dem-Stuhl-Fläzens so weit perfektioniert, dass sie nicht kniff … zumindest nicht allzu sehr. Knallend ließ ich meine Kaugummiblase platzen und sah mich nach einem leeren Sitzplatz um. Während ich den Mittelgang hinunterschlenderte und auf einen Stuhl zusteuerte, der genau in der Mitte der ersten Reihe stand, starrten mich alle an. Verdammt. Zu spät zu kommen hatte seine Nachteile. In aller Ruhe zog ich meine Jacke aus und ließ meine Handtasche auf den Boden fallen. Den neuen Lehrer, dessen Stimme bei meinem Hereinkommen leiser geworden und der dann gänzlich verstummt war, hatte ich bisher keines Blickes gewürdigt. Ein paar Mitschüler kicherten über meinen lässigen Auftritt, was ich mit einem höhnischen Lächeln in ihre Richtung quittierte. Das Gelächter verstummte. Dann endlich sank ich auf den leeren Stuhl und richtete den Blick auf die Tafel, wobei ich tief und unüberhörbar seufzte.
»Machen Sie ruhig weiter«, brummte ich und warf mit einer lässigen Kopfbewegung das Haar nach hinten.
Auf der Tafel stand in Großbuchstaben »Mr Wilson«. Ich nahm »Mr Wilson« in Augenschein. Er wiederum musterte mich mit gerunzelter Stirn und einem angedeuteten Lächeln. Er hatte dunkles Haar, das sich an seinen Ohren zu Locken ringelte und ihm in die Stirn fiel und dringend einen Haarschnitt nötig hatte. Es sah aus, als hätte er versucht, es zu zähmen, aber ganz offensichtlich hatten sich seine widerspenstigen Locken irgendwann im Verlauf seines ersten Tags an der Boulder-Highschool durchgesetzt. Erstaunt die Augenbrauen hochziehend unterdrückte ich ein belustigtes Schnauben. Mr Wilson sah aus wie ein Student. Hätte er zu seinem blauen Anzughemd und den Khakihosen keine hastig geknotete Krawatte getragen, hätte ich ihn für eine Art Aushilfslehrer gehalten.
»Hallo«, begrüßte er mich höflich und mit britischem Akzent. Was macht ein Typ mit einem britischen Akzent in Boulder City, Nevada? Sein Ton klang warmherzig und freundlich, und mein offensichtlicher Mangel an Respekt schien ihn nicht weiter zu stören. Stattdessen sah er auf eine Liste, die zu seiner Rechten auf einem Notenständer lag.
»Sie müssen Blue Echohawk sein …« Sein Gesichtsausdruck drückte Überraschung aus. Mein Name haut die meisten Leute um. Ich hab zwar dunkles Haar, aber knallblaue Augen und sehe nicht wirklich aus wie eine Indianerin.
»Und Sie müssen Mr Wilson sein«, entgegnete ich.
Die anderen lachten. Mr Wilson lächelte. »Das bin ich. Und wie ich Ihren Klassenkameraden bereits sagte, Sie können mich gern Wilson nennen. Es sei denn, Sie kommen zu spät oder verhalten sich respektlos – in diesem Fall bevorzuge ich das Mr«, endete er mit sanftem Tonfall.
»Na schön, in diesem Fall halte ich mich wohl besser an das Mr Wilson. Denn ich komme häufig zu spät und bin praktisch immer respektlos«, erklärte ich mit einem zuckersüßen Lächeln.
Mr Wilson zuckte mit den Achseln. »Wir werden sehen«, sagte er und musterte mich eine weitere Sekunde lang. Seine grauen Augen verliehen ihm einen leicht traurigen Ausdruck und erinnerten an diese Hunde mit dem wässrig-treuen Blick und der langen Schnauze. Ein Spaßvogel schien er mir nicht gerade zu sein. Ich seufzte noch einmal. Eigentlich hatte ich diesen Kurs gar nicht belegen wollen. Geschichte war das Fach, das ich am wenigsten mochte. Und etwas Schlimmeres als europäische Geschichte konnte ich mir kaum vorstellen.
»Mein Lieblingsfach ist Literatur«, erklärte Mr Wilson und wandte den Blick von mir ab, während er mit der Einführung in seinen Kurs begann. Das Wort Literatur hatte bei ihm zu wenig Silben, sein Akzent war wirklich komisch. Ich zappelte herum, bis ich die bequemste Sitzposition gefunden hatte, und starrte den jungen Lehrer missmutig an.
»Möglicherweise fragen Sie sich jetzt, warum ich dann Geschichte unterrichte.«
Auch wenn ich nicht glaube, dass einer der anderen Mitschüler genügend Interesse aufbrachte, sich diese Frage zu stellen, schienen doch alle ziemlich gefangen genommen von seinem Akzent. Wilson fuhr fort.
»Hängen Sie einfach noch einen Buchstaben an. Ein ›n‹. Was haben wir dann?«
»Geschichten«, zwitscherte ein eifriges Vögelchen hinter mir.
»Genau.« Mr Wilson nickte weise. »Und genau daraus besteht Geschichte. Aus einzelnen Geschichten. Der Geschichte einzelner Personen. Als Junge stellte ich fest, dass ich lieber ein Buch las, als mir einen Vortrag anzuhören. Literatur erweckt Geschichte zum Leben. In ihr findet sich möglicherweise die genaueste Darstellung historischer Verhältnisse, insbesondere in der Literatur, die in derselben Epoche geschrieben wurde, von der sie erzählt. Meine Aufgabe in diesem Schuljahr besteht darin, Ihnen Geschichten nahezubringen, die Ihren Horizont erweitern – eine lebendige, farbenfrohe europäische Geschichte zu präsentieren, die es Ihnen ermöglicht, eine Verbindung zu Ihrem eigenen Leben zu entdecken. Ich verspreche, Sie nicht zu langweilen, wenn Sie mir im Gegenzug versprechen, mir zuzuhören und etwas zu lernen.«
»Wie alt sind Sie eigentlich?,« fragte eins der Mädchen kokett.
»Sie klingen wie Harry Potter«, knurrte irgendein Typ im hinteren Teil des Klassenzimmers. Ein paar Schüler kicherten, und Mr Wilsons Ohrspitzen, die aus seinen Locken herauslugten, verfärbten sich rot. Er ignorierte die Frage und die Bemerkung und fing an, Zettel zu verteilen. Ein paar Schüler stöhnten. Zettel bedeuteten Arbeit.
»Sehen Sie sich das Blatt Papier an, das vor Ihnen liegt«, forderte uns Mr Wilson auf, als er mit dem Verteilen fertig war. Er ging wieder nach vorn und lehnte sich mit verschränkten Armen gegen die Tafel. Dann musterte er uns mehrere Sekunden lang, um sicherzugehen, dass alle zuhörten. »Es ist leer. Darauf steht kein einziges Wort. Ein unbeschriebenes Blatt Papier. Vergleichbar mit dem Rest Ihres Lebens. Leer, unbekannt, unbeschrieben. Aber Sie alle haben eine Geschichte, hab ich nicht recht?«
Ein paar Schüler nickten zustimmend. Ich warf einen Blick auf meine Armbanduhr. Noch eine halbe Stunde, bis ich diese verdammte Jeans ausziehen konnte.
»Sie alle haben eine Geschichte. Die bis zu diesem Tag reicht, bis zu dieser Sekunde. Und ich möchte sie gern erfahren. Ich möchte IHRE Geschichte kennenlernen. Und ich möchte, dass Sie selbst sie ebenfalls kennen. Deshalb haben Sie nun den Rest der Stunde Zeit, sie mir aufzuschreiben. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Perfektion ist langweilig. Genauso wenig stören mich Schachtelsätze oder falsch geschriebene Wörter. Darum geht es hier nicht. Stattdessen wünsche ich mir eine ehrliche Erzählung – in der Sie so viel preisgeben, wie Sie wollen. Am Ende der Stunde werde ich die Zettel wieder einsammeln.«
Stühle machten scharrende Geräusche auf dem Boden, Reißverschlüsse wurden auf der Suche nach Stiften geöffnet, und einige Schüler jammerten laut, während ich auf das Blatt Papier starrte. Mit der Fingerspitze fuhr ich darüber und stellte mir vor, die Linien ertasten zu können, die in horizontalen blauen Streifen über das Blatt verliefen. Das Papier unter meinen Fingerkuppen zu spüren beruhigte mich, und ich dachte darüber nach, welche Verschwendung es war, es mit Schnörkeln und Zeichen zu füllen. Stattdessen legte ich den Kopf auf Tisch und Papier, schloss die Augen und atmete tief ein. Das Papier roch sauber und ein klein wenig nach Sägemehl. Ich konzentrierte mich auf den Duft und stellte mir vor, es sei eine meiner Schnitzereien, stellte mir vor, wie meine Hände über die Wölbungen und Kerben fuhren, die ich beim Abschmirgeln herausgearbeitet hatte, Schicht um Schicht, um die Schönheit des Holzes hervorzulocken. Es zu verunstalten wäre eine Schande. Genauso wie es eine Schande wäre, ein makelloses Blatt Papier zu ruinieren. Ich richtete mich auf und betrachtete das jungfräuliche Papier vor mir auf dem Tisch. Ich wollte meine Geschichte nicht erzählen. Jimmy sagte einmal, dass man die Geschichte von etwas kennen muss, um es wirklich zu verstehen. Allerdings hatte er damals von einer Amsel gesprochen.
Jimmy hatte Vögel geliebt. Wenn Holzbildhauerei seine Begabung war, dann war Vogelbeobachtung sein Hobby. Jimmy besaß ein Fernglas und wanderte oft zu hochgelegenen Aussichtspunkten, an denen er Vögel beobachten und dokumentieren konnte, was er sah. Er sagte, Vögel wären Botschafter, aus deren Verhalten man bei genauer Beobachtung alle möglichen Dinge herauslesen könnte. Wechselnde Windrichtungen, heraufziehende Stürme, fallende Temperaturen. Man konnte sogar sehen, ob in der Nähe Gefahr lauerte.
Als ich noch ganz klein war, fiel es mir schwer, still zu sitzen. Tatsächlich ist das heute noch so. Vögel lange zu beobachten fiel mir schwer, deshalb fing Jimmy an, mich zurückzulassen, sobald ich alt genug war, um allein im Camp zu bleiben. Holzschnitzerei gefiel mir schon deshalb besser, weil es eine sehr körperbetonte Tätigkeit war.
Ich muss sieben oder acht Jahre alt gewesen sein, als ich zum ersten Mal mitbekam, wie Jimmy bei einer Vogelsichtung richtig aufgeregt wurde. Wir befanden uns in Süd-Utah, aber daran erinnere ich mich nur, weil Jimmy eine Bemerkung darüber machte.
»Wie ist er nur in diese Gegend gekommen?«, hatte er verwundert gefragt, ohne den Blick von einer verkrüppelten Kiefer zu wenden. Als ich seinem Blick folgte, sah ich einen kleinen schwarzen Vogel, der auf halber Höhe auf einem dünnen Ast balancierte. Jimmy holte sein Fernglas, und ich rührte mich nicht von der Stelle, während er den kleinen Vogel beobachtete. Ich konnte nichts Besonderes an ihm entdecken. Er sah einfach nur aus wie ein Vogel – tiefschwarze Federn, kein Aufblitzen von Farbe, das den Blick angezogen hätte. Und auch sonst besaß er keine auffälligen Merkmale, die man hätte bewundern können.
»Jep. Eine ganz gewöhnliche eurasische Amsel. In Nordamerika gibt es keine Amseln. Jedenfalls nicht solche. Genau genommen handelt es sich um eine Schwarzdrossel.« Jimmy war zurückgekehrt und hatte die S timme zu einem Flüstern gesenkt, während er durch das Fernglas blickte. »Entweder ist er sehr weit weg von zu Hause, oder er ist irgendwo ausgebüxt.«
Ich flüsterte ebenfalls, da ich den Vogel nicht erschrecken wollte, schließlich schien Jimmy ihn für etwas Besonderes zu halten.
»Wo leben Amseln denn normalerweise?«
»Europa, Asien, Nordafrika«, murmelte Jimmy, ohne den Vogel mit dem orangefarbenen Schnabel aus den Augen zu lassen. »Inzwischen findet man sie auch in Australien und Neuseeland.«
»Woher weißt du, dass die Amsel ein Er ist?«
»Weil die weiblichen Vögel nicht solche glänzenden schwarzen Federn haben. Sie sind nicht so hübsch.«
Die kleinen gelben Augen blickten auf uns herab, er wusste genau, dass wir ihn beobachteten. Plötzlich flog der Vogel ohne jede Vorwarnung auf. Jimmy sah ihm hinterher und beobachtete ihn so lange durch das Fernglas, bis er verschwunden war.
»Seine Flügel sind genauso schwarz wie dein Haar«, bemerkte Jimmy und wandte sich von dem Vogel ab, der Leben in unseren Vormittag gebracht hatte. »Vielleicht bist du genau das … eine kleine Amsel, weit fort von zu Hause.«
Ich warf einen Blick auf unseren Wohnwagen, der zwischen den Bäumen stand. »Aber wir sind doch gar nicht weit weg von zu Hause, Jimmy«, sagte ich verwirrt. Wo immer Jimmy war, war auch mein Zuhause.
»Amseln werden im Gegensatz zu Raben, Krähen und anderen schwarzen Vögeln nicht als Unglücksbringer betrachtet. Dennoch geben sie ihre Geheimnisse nicht leicht preis. Sie wollen, dass man herausfindet, wer sie sind. Man muss sich ihre Weisheit verdienen.«
»Und wie stellt man das an?«, fragte ich und musterte ihn verblüfft und mit krausgezogener Nase.
»Man muss ihre Geschichte kennenlernen.«
»Aber er ist ein Vogel. Wie können wir seine Geschichte lernen? Er kann nicht sprechen.« Ich nahm zu jener Zeit alles wörtlich, so wie Kinder es nun mal tun. Es hätte mir wirklich gefallen, wenn das Amselmännchen in der Lage gewesen wäre, seine Geschichte zu erzählen. Dann hätte ich es als Haustier gehalten, und es hätte mir den ganzen Tag Geschichten erzählt. Stattdessen versuchte ich dauernd, Jimmy dazu zu bringen, mir eine Geschichte zu erzählen.
»Als Erstes muss man wirklich den Wunsch haben, sie zu erfahren.« Jimmy sah auf mich hinunter. »Und dann muss man genau hinsehen und ihm zuhören. Nach einer Weile lernt man ihn immer besser kennen und fängt an, ihn zu verstehen. Dann wird er dir auch seine Geschichte erzählen.«
Ich kramte einen Bleistift heraus und ließ ihn um meine Finger kreisen. Dann schrieb ich »Es war einmal …« ganz oben auf das Blatt, einfach um ein bisschen besserwisserisch zu sein. Grinsend betrachtete ich die drei Wörter. Als ob meine Geschichte ein Märchen wäre. Aber dann verging mir das Lächeln. »Es war einmal … eine kleine Amsel«, schrieb ich. Ich starrte hinunter auf das Blatt. »… die aus dem Nest gestoßen worden war, weil niemand sie wollte.«
Bilder füllten meinen Kopf. Langes dunkles Haar. Ein verkniffener Mund. Meine einzige Erinnerung an meine Mutter. Ich ersetzte die verkniffene Mundpartie durch ein sanft lächelndes Gesicht. Ein ganz anderes Gesicht. Jimmys Gesicht. Bei diesem Anblick durchzuckte mich jäher Schmerz, und ich wanderte mit meinem inneren Auge weiter zu seinen Händen. Seine braunen Hände mit dem Meißel darin glitten über einen schweren Holzscheit. Späne sammelten sich zu seinen Füßen, wo ich saß und ihnen beim Fallen zusah. Die Späne schwebten hinunter auf meinen Kopf, und ich schloss die Augen und stellte mir vor, dass es kleine Kobolde wären, gekommen, um mit mir zu spielen. Das waren die Dinge, an die ich mich gern erinnerte. Die Erinnerung daran, wie er zum ersten Mal meine kleine Hand in seiner gehalten und mir dabei geholfen hatte, die schwere Rinde von einem alten Holzstumpf zu entfernen, tauchte wie ein willkommener Freund in meinem Kopf auf. Dabei sprach er sanft über die Skulptur, die unter der Rinde und den oberen Holzschichten darauf wartete, freigelegt zu werden. Während ich seiner Stimme in meinem Kopf lauschte, ließ ich meinen Geist durch die Wüste und in die Hügel wandern, erinnerte mich an die gekrümmte Klaue aus Mesquiteholz, die ich am vergangenen Tag gefunden hatte. Das Holz war so schwer gewesen, dass ich es zu meinem Pick-up hatte schleifen müssen. Dort angekommen hatte ich es mühsam auf die Ladefläche gehievt. Es juckte mich in den Fingern, endlich die verkohlte Rinde abzuziehen, um zu sehen, was sich darunter befand. Ich hatte da so ein Gefühl und in meinem Kopf entstand bereits eine Form. Mit dem Fuß auf den Boden klopfend und die gegen das Papier gedrückte Hand zu einer Faust ballend, träumte ich davon, was ich aus dem Holz erschaffen könnte.
Die Schulglocke klingelte. Der Lärmpegel im Klassenzimmer schwoll an, als wäre ein Schalter umgelegt worden, und ich schreckte aus meinem Tagtraum hoch und starrte hinunter auf das Blatt. Meine armselige Geschichte wartete darauf, zu Ende geschrieben zu werden.
»Geben Sie mir nun bitte Ihre Geschichten. Und stellen Sie sicher, dass Ihr Name auf dem Zettel steht! Ich kann Ihre Geschichten nicht in die Benotung mit einfließen lassen, wenn ich nicht weiß, wer sie geschrieben hat.«
Es dauerte keine zehn Sekunden, bis sich das Klassenzimmer geleert hatte. Mr Wilson mühte sich damit ab, die einzelnen Blätter sauber zu stapeln, die die Schüler ihm in die Hände gedrückt hatten, bevor sie eifrig aus dem Klassenzimmer gestürmt waren, um sich angenehmeren Dingen zu widmen. Der erste Schultag war offiziell beendet. Als er bemerkte, dass ich immer noch reglos dasaß, räusperte er sich.
»Miss … ähem … Echohawk?«
Ich stand mit einer abrupten Bewegung auf und griff nach dem Blatt. Nachdem ich es zu einem Ball zusammengeknüllt hatte, versuchte ich damit den Mülleimer unter der Tafel zu treffen. Ich traf daneben, ließ das Papierbällchen aber trotzdem liegen. Stattdessen schnappte ich mir meine Handtasche und meine Jacke, die angesichts der mehr als vierzig Grad, die draußen herrschten, unnötig war. Ohne meinen neuen Lehrer anzusehen, durchquerte ich das Klassenzimmer und schlang mir meine Handtasche um die Schulter.
»Später, Wilson«, rief ich ihm über die Schulter zu, ohne mich nach ihm umzudrehen.
Als ich auf den Schülerparkplatz kam, wartete Manny bereits bei meinem Pick-up. Sein Anblick ließ mich unwillkürlich aufstöhnen. Manuel Jorge Rivas-Olivares aka Manny wohnte im selben Apartmentkomplex wie ich. Er und seine kleine Schwester hatten mich adoptiert. Die beiden waren wie Straßenkatzen, die tagelang vor deiner Tür herumlungern und dabei kläglich miauen, bis man am Ende aufgibt und ihnen etwas zu essen gibt. Und sobald man das getan hatte, war man verloren. Dann waren es offiziell deine Katzen.
Genauso verhielt es sich mit Manny und Graciela. Sie hatten sich einfach so lange in meiner Nähe herumgetrieben, bis ich mich ihrer erbarmt hatte. Und jetzt glaubten sie, dass wir zusammengehörten, und ich wusste nicht, wie ich sie vom Gegenteil überzeugen sollte. Manny war sechzehn und Graciela vierzehn, beide zierliche Gestalten mit hübschen Gesichtszügen, gleichzeitig bezaubernd und nervtötend. Eben genau wie Katzen.
Es gab einen Schulbus, auf dessen Route unser Apartmentkomplex lag, und ich hatte sichergestellt, dass Mannys Mutter alles darüber wusste, und ihr sogar dabei geholfen, Manny und Graciela für die Busfahrt registrieren zu lassen. Ich hatte wirklich geglaubt, dass sich dieses Jahr etwas ändern würde, schließlich besuchte Graciela inzwischen die neunte Klasse und konnte nun ebenfalls mit dem Highschool-Bus fahren. Offenbar war es nicht so. Manny erwartete mich mit einem strahlenden Lächeln und dem Arm voller Bücher.
»Hey, Blue! Wie war dein erster Schultag? Wahnsinn, das letzte Jahr ist eine große Sache, stimmt’s, Chica? Ich wette, dass du dieses Jahr Abschlussballkönigin wirst. Die schönsten Mädchen in der Schule sollten Abschlussballkönigin werden, und du bist definitiv die Allerschönste!« Absolut bezaubernd und absolut nervtötend. Manny redete eine Minute lang wie ein Wasserfall. Er hatte einen leichten spanischen Akzent und lispelte ein wenig, was möglicherweise an seinem Akzent lag. Vielleicht war es aber auch einfach nur eine seiner Eigenheiten.
»Hey, Manny. Hast du den Schulbus verpasst?«
Sein Lächeln verblasste ein wenig, und ich fühlte mich schlecht, weil ich gefragt hatte. Aber er wedelte nur abwehrend mit den Händen und zuckte mit den Achseln.
»Ich weiß, ich weiß. Ich habe Gloria gesagt, dass ich den Bus nehmen würde, und dafür gesorgt, dass Graciela drinsitzt … aber am ersten Schultag wollte ich gern mit dir nach Hause fahren. Hast du den neuen Geschichtslehrer gesehen? Ich hab ihn gleich in der allerersten Stunde gehabt und bin mir sicher, dass er sich als der beste Lehrer entpuppen wird, den ich je hatte … außerdem ist er wirklich wahnsinnig süß!«
Manny hatte erst vor Kurzem damit angefangen, seine Mutter Gloria zu nennen. Ich war mir nicht ganz über den Grund dafür im Klaren. Ich überlegte, ob ich ihn darauf hinweisen sollte, dass es etwas seltsam war, wenn er Mr Wilson als ›süß‹ bezeichnete. Zumindest glaubte ich, er redete von ihm. Andererseits erschien es ziemlich unwahrscheinlich, dass zwei neue Geschichtslehrer an unsere Schule angefangen hatten.
»Ich liebe seinen Akzent. Er ist so faszinierend, dass ich kaum mitbekommen habe, was er gesagt hat!« Sobald ich meinen Wagen aufgeschlossen hatte, glitt Manny anmutig auf den Beifahrersitz. Der Junge bereitete mir Sorgen. Sein Auftreten war weiblicher als meins.
»Ich frage mich, was er hier in Boulder macht? Ivy und Gabby sind davon überzeugt, dass er im Auftrag des MI-6 hier ist. Oder so.« Manny hatte unzählige Freundinnen. Tatsächlich liebten ihn die Mädchen, weil er harmlos und witzig war – was mich ein weiteres Mal zu der Frage brachte, warum er nicht einfach den Bus nehmen konnte. Es war ja nicht so, dass er keine Freunde gehabt hätte.
»Was zum Teufel ist der MI-6?«, knurrte ich, während ich mir einen Weg zwischen den übrigen Fahrzeugen hindurch bahnte, die das Schulgelände verließen. Im nächsten Moment musste ich unvermittelt bremsen, weil mir jemand die Vorfahrt nahm und dann den Stinkefinger zeigte, als hätte ich ihm den Weg abgeschnitten und nicht umgekehrt. Manny streckte die Hand aus und betätigte meine Hupe. »Manny, hör sofort damit auf! Ich bin die Fahrerin, okay?«, blaffte ich und schlug seine Hand weg, was ihn nicht im Geringsten beeindruckte.
»Du weißt nicht, was der MI-6 ist? Der verdammte James Bond? Chica, du solltest wirklich mehr ausgehen!«
»Und was sollte jemand, der beim MI-6 arbeitet, an der Boulder-Highschool wollen?«, fragte ich lachend.
»Keinen Schimmer, aber er ist Brite und außerdem sexy und jung.« Manny zählte die einzelnen Punkte an seinen schmalen Fingern ab. »Was will man mehr?«
»Du findest ihn tatsächlich sexy?«, fragte ich zweifelnd.
»Oh ja, auf jeden Fall. Der Typ total versauter Buchhalter.«
»Das ist wirklich krank, Manny. Und funktioniert nur bei Frauen. Buchhalterinnen, Sekretärinnen oder so.«
»Na schön, dann ist er eben ein versauter Professor. Er hat tolle Augen, weiche Locken und ziemlich muskulöse Unterarme. Der Mann ist ein verkappter Herzensbrecher. Absolut MI-6-würdig. Musst du heute Abend arbeiten?« Nun, da er zweifelsfrei bewiesen hatte, dass Mr Wilson für den Geheimdienst arbeitete, wechselte Manny das Thema.
»Es ist Montag. Ich arbeite montags immer, Manny.« Ich wusste, worauf er hinauswollte und widerstand der Versuchung. »Hör auf, die Kätzchen zu füttern«, sagte ich mir energisch im Geiste.
»Ich könnte jetzt gut eine Portion von Bevs Quesadillas gebrauchen. Neben dir sitzt ein halb verhungerter Mexikaner«, sagte Manny und trug akzentmäßig ziemlich dick auf. Auf seine ethnische Herkunft wies er nur dann hin, wenn es um Essen ging. »Ich hoffe, Gloria hat an den Einkauf gedacht, bevor sie zur Arbeit gegangen ist. Wenn nicht, müssen meine kleine Schwester und ich nachher wieder Nudelsuppe essen«, seufzte Manny traurig.
Mit der kleinen Schwester war er zwar etwas übers Ziel hinausgeschossen, dennoch spürte ich, wie ich weich wurde. Manny war der Mann im Haus, was bedeutete, dass er für Graciela sorgen musste. Diese Aufgabe erledigte er mit Leidenschaft, selbst wenn es bedeutete, mich dazu zu bringen, ihre Versorgung zu übernehmen. Ich arbeitete an mehreren Abenden in der Woche in Bevs Café und brachte Manny und Graciela mindestens einmal die Woche etwas zum Abendessen mit. »Na schön. Ich bringe dir und Gracie ein paar Quesadillas vorbei. Aber das hier ist das letzte Mal, Manny. Das wird mir alles vom Lohn abgezogen«, schimpfte ich. Manny lächelte mich strahlend an und klatschte in die Hände, so wie Oprah, wenn sie aufgeregt ist.
»Ich schau mal, ob mein Onkel vielleicht noch mehr Mesquiteholz für dich hat«, versprach er im Gegenzug. Ich nickte, und wir besiegelten den Handel mit einem Handschlag.
»Deal.«
Mannys Onkel Sal arbeitete bei einem Forstwirtschaftsunternehmen. Gelegentlich wurde ihnen aufgetragen, Farmen in Staatsbesitz von Unterholz und Gestrüpp zu befreien, damit die Mesquitebäume nicht alles überwucherten. Nach dem letzten Anruf von Sal hatte ich genug Holz für zwei Monate. Der Gedanke brachte mich förmlich zum Sabbern.
»Dafür schuldest du mir natürlich was«, behauptete Manny mit unschuldiger Stimme. »Einen Monat lang jeden Montag Abendessen, in Ordnung?«
Sein Verhandlungstalent brachte mich zum Lachen. Tatsächlich schuldete er mir zwei Monate Abendessen. Aber wir wussten beide, dass ich zustimmen würde. Denn das tat ich immer.
2
Eierschalenblau
Oktober 2010
Vielleicht lag es an seinen Geschichten, dass ich mich von ihm angezogen fühlte. Jeden Tag gab es eine neue. Sie handelten häufig von Frauen oder wurden aus der weiblichen Perspektive erzählt. Vielleicht war es auch nur Mr Wilsons offenkundige Leidenschaft für sein Unterrichtsfach. Oder sein cooler Akzent und seine Jugend. Sämtliche Schüler versuchten, ihn zu imitieren. Die Mädchen scharten sich um ihn, und die Jungs beobachteten ihn voller Faszination, als wäre er ein Rockstar, der sich plötzlich in unserer Mitte manifestiert hatte. Er war das Gesprächsthema der Schule, eine unerwartete Sensation, von allen geliebt, weil er neu war. Noch dazu ein sehr attraktiver Neuling – wenn man leicht zerzaustes Haar, graue Augen und einen britischen Akzent toll fand; wobei ich mir einredete, dass ich das nicht tat. Wilson war definitiv nicht mein Typ. Nichtsdestotrotz ertappte ich mich dabei, wie ich mit ärgerlicher Ungeduld die letzte Schulstunde herbeisehnte, und verhielt mich in seinem Unterricht aufmüpfiger, als ich es wahrscheinlich getan hätte, wenn mich die Faszination, die er auf mich ausübte, nicht so aus der Fassung gebracht hätte.
Dem antiken Griechenland widmete Mr Wilson einen ganzen Monat. Wir sprachen über epische Schlachten, Philosophen, Architektur und Kunst. An jenem Tag stellte er uns detailliert die griechischen Götter vor und erklärte uns ihre jeweilige Bedeutung. Das war zwar spannend, aber auch unglaublich unwichtig, und ich ließ es mir natürlich nicht nehmen, diese Ansicht laut herauszuposaunen.
»Echte Geschichte ist das aber nicht«, erklärte ich.
»Diese Mythen geben zwar keine historischen Fakten wieder, Tatsache ist aber, dass die alten Griechen an sie glaubten«, erklärte Wilson geduldig. »Dabei muss man begreifen, dass die griechischen Götter ein wesentlicher Bestandteil der griechischen Mythologie sind. Dieses Wissen über die antike griechische Götterwelt kann historisch bis zu den Schriften von Homer in der Ilias und der Odyssee zurückverfolgt werden. Tatsächlich glauben viele Gelehrte, die Mythen seien von der mykenischen Kultur beeinflusst worden, die zwischen 1700 und 1100 v. Chr. in Griechenland existierte. Es gibt außerdem Belege dafür, dass die Anfänge der griechischen Mythologie bis zu antiken Kulturen des mittleren Ostens wie Mesopotamien und Anatolien zurückverfolgt werden können. Vor allem, weil es so viele Ähnlichkeiten zwischen der Mythologie der uralten Kulturen des Mittleren Ostens und jener der alten Griechen gibt.«
Die Klasse starrte ihn sprachlos an. Wir verstanden nur Bahnhof. Die Ratlosigkeit in unseren Gesichtern schien ihm nicht entgangen zu sein. »Die alten Griechen hatten für alles Götter und konnten mit ihrer Hilfe die ganze Welt um sich herum erklären.« Wilson ließ sich nicht beirren, sondern folgte weiter seiner Argumentation. »Die Sonnenaufgänge, die Sonnenuntergänge, die Tragödien und Triumphe der alten Griechen – all diese Dinge hatten mit den Göttern zu tun und verliehen so einer sinnlosen Welt Sinn. Ein seltsam geformter Fels konnte ein als Stein getarnter Gott sein, dasselbe konnte für einen ungewöhnlich hochgewachsenen Baum gelten. Dieser Baum wurde dann möglicherweise angebetet, um zu verhindern, dass der Gott die Menschen bestrafte. Die Götter waren in allen Dingen gegenwärtig, und alles konnte als Beweis für ihre Existenz angeführt werden. In ihrem Namen wurden Kriege geführt, das Orakel befragt und seine Ratschläge befolgt, ganz gleich, wie schmerzhaft oder seltsam oder bizarr sie auch sein mochten. Selbst Stürme wurden zu leibhaftigen Wesen. Man hielt sie für Harpyien – diese geflügelten Frauen trugen wie der Wind Dinge mit sich fort, die danach nie wieder gesehen wurden. Sowohl Stürme als auch die Wetterphänomene, die sie begleiteten, schrieb man diesen geflügelten Wesen zu.«
»Ich dachte immer, dass Harpyie ein altmodisches Wort für Hexe wäre«, kommentierte ein pickeliger Junge namens Bert. Ich hatte zwar dasselbe angenommen, war aber froh, dass ich nicht diejenige gewesen war, die es ausgesprochen hatte.
»In frühen Schriften der griechischen Mythologie werden Harpyien als Wesen mit herrlichem Haar beschrieben, als schöne Frauen mit Flügeln. Das änderte sich mit der Zeit, und in der römischen Mythologie werden sie als Monster mit hässlichen Gesichtern, Krallen und sogar Schnäbeln beschrieben. Unansehnliche bösartige Vogelfrauen. Dieses Bild hat sich über die Jahrhunderte gehalten. Im ersten Teil der Göttlichen Komödie, im Inferno, beschrieb Dante den siebten Höllenkreis als einen Ort, in dem Harpyien in den Wäldern lebten und jene quälten, die dorthin geschickt wurden.« Wilson begann ein Gedicht zu zitieren, ganz offensichtlich aus der Erinnerung.
»Hier baun die scheußlichen Harpyen ihr Nest,
Trojaner scheuchten sie von den Strophaden
mit trauriger Kunde künftgen Unheils weg.
Mit weiten Flügeln, Hals und Antlitz menschlich,
Füße mit Kralln, den großen Bauch befiedert,
so schrein sie klagend von den knorrigen Bäumen.«
»Ein zauberhaftes Gedicht, das Sie da auswendig gelernt haben«, kommentierte ich sarkastisch, auch wenn ich in Wahrheit ziemlich verblüfft war. Wilson prustete unwillkürlich los, woraufhin sein ernsthaftes Gesicht einen völlig anderen Ausdruck annahm. Sogar ich konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen. Wenigstens war dieser Typ in der Lage, über sich selbst zu lachen. Wow! Wilson gab dem Wort »Nerd« eine ganz neue Bedeutung. Jemand, der nach Belieben Dante zitieren konnte? Und ich war überzeugt, dass er auf jede meiner Fragen »Das ist absolut elementares Grundwissen, Miss Echohawk« antworten würde. Und das mit diesem unverwechselbaren, pedantischen englischen Akzent. Als er weitersprach, lächelte er immer noch.
»Um Ihre Frage zu beantworten, Miss Echohawk: Der Einfluss, den unsere Überzeugungen auf unsere Welt haben, ist sehr real. Woran wir glauben, hat Einfluss auf unsere Entscheidungen, unsere Handlungen und damit letzten Endes auch auf unser Leben. Die Griechen glaubten an ihre Götter, und dieser Glaube beeinflusste alles andere. Die Geschichtsschreibung spiegelt das wider, was die Menschen glauben, ganz gleich, ob es wahr ist oder nicht. Als der Autor oder die Autorin Ihrer eigenen Geschichte hat das, woran Sie glauben, großen Einfluss darauf, für welchen Weg Sie sich entscheiden. Vielleicht glauben Sie an etwas, das man als Mythos bezeichnen könnte. Ich spreche hier nicht unbedingt von Religion. Ich spreche von Dingen, die Sie sich selbst sagen, oder Dingen, die andere in Ihrem Leben so oft wiederholt haben, dass Sie sie für wahr halten.« Mr Wilson drehte sich um und hob einen Papierstapel hoch. Er teilte die Blätter in der Klasse aus, während er weiterredete.
»Ich möchte, dass Sie darüber nachdenken. Was ist, wenn das, was Sie über sich selbst oder Ihr Leben denken, nichts weiter als ein Mythos ist, der sie behindert?«
Mr Wilson legte ein zerknittertes Blatt auf meinen Tisch und ging kommentarlos weiter. Es war meine Geschichte. Die Geschichte, die ich am ersten Schultag in den Müll geworfen hatte. Das Blatt war glattgestrichen und -gepresst worden, dennoch sah man ihm an, dass es zuvor zu einer Kugel zusammengeknüllt worden war. Es würde nie wieder dasselbe sein. Ganz gleich, wie sehr man es glättete, man würde immer erkennen, dass es jemand aus dem Müll gefischt hatte.
»Es war einmal eine kleine Amsel, die aus dem Nest gestoßen worden war, weil niemand sie wollte.«
Ich fügte fünf weitere Worte hinzu. »Man hatte sie achtlos weggeworfen.« Dann las ich mir selbst vor, was ich geschrieben hatte.
»Es war einmal … eine kleine Amsel, die aus dem Nest gestoßen worden war, weil niemand sie wollte. Man hatte sie achtlos weggeworfen.«
Weggeworfen wie ein Stück Müll. Und wie sehr ich mir auch einredete, dass ich kein Müll war, es würde nichts ändern. Mädchen wie ich verdienten ihren schlechten Ruf. Ich hatte an meinem gearbeitet. Wahrscheinlich hätte ich mich mit meiner Kindheit herausreden können, aber es lag nicht in meiner Natur, mich für meine Person zu rechtfertigen. Ich mochte Jungs, und die Jungs mochten mich. Oder zumindest mochten sie mein Aussehen. Wahrscheinlich wäre es eine Lüge gewesen zu behaupten, dass sie mich mochten, denn mein wahres Ich kannte niemand außer mir selbst. Die echte Blue kannten sie nicht. Aber darin bestand wenigstens zum Teil wohl auch meine Anziehung. An meinem Look hatte ich ebenfalls gearbeitet. Ich hatte tolles Haar und trug grundsätzlich zu enge Jeans, hautenge Shirts und aufwändiges Augen-Make-up. Wenn ein Junge mich in den Armen hielt, mich küsste oder berührte, dann fühlte ich mich stark und geliebt. Ich wusste, als was mich manche Leute bezeichneten. Ich wusste, was sie hinter vorgehaltener Hand flüsterten. Und ich wusste, was die Jungs über mich sagten. Für sie war ich ein Flittchen. Mir vorzumachen, keins zu sein, wäre eine Lüge gewesen. Ein Mythos, so wie die blöden Götter der Griechen.
Für Jimmy war ich eine Blaumeise. So lautete sein persönlicher Spitzname für mich. Dabei hatte ich keine Ähnlichkeit mit einer Blaumeise … hübsch, bunt und fröhlich. Ich hatte mehr Ähnlichkeit mit einer modernen Harpyie. Einer Vogelfrau. Einem weiblichen Monster mit krummen, scharfen Krallen. Leg dich mit mir an, dann trage ich dich in die Unterwelt, bestrafe und quäle dich bis in alle Ewigkeit. Vielleicht war es ja nicht meine Schuld, dass ich so geworden war. Cheryl hatte mich im Alter von elf Jahren bei sich aufgenommen, und in ihrem Leben hatte es keinen Platz für ein Kind gegeben. Es passte einfach nicht zu ihrem Lebensstil, sich um ein Kind zu kümmern. Sie war nicht besonders liebevoll und die meiste Zeit unterwegs, aber trotzdem ganz in Ordnung. Als ich klein war, stellte sie sicher, dass ich etwas aß und ein eigenes Bett hatte.
Damals lebten wir in einer Zweizimmerwohnung in einem klobigen Wohnkomplex am Rand von Boulder City. Die Wohnung lag nur zwanzig Minuten entfernt von den grellen Lichtern von Las Vegas. Cheryl arbeitete in Vegas im Golden Goblet Hotel Casino als Croupière, tagsüber schlief sie, und die Nächte verbrachte sie unter Zockern und Zigarettenqualm, ein Leben ganz nach ihrem Geschmack. Normalerweise hatte sie einen Freund. Aber je älter sie wurde, mit desto zwielichtigeren Typen ließ sie sich ein. Und je älter ich wurde, desto mehr interessierten sich ihre Eroberungen für mich. Die Probleme waren quasi vorprogrammiert. Ich wusste, dass ich nach dem Schulabschluss allein dastehen würde, denn die Zahlungen für meinen Unterhalt hatten mit meinem achtzehnten Geburtstag geendet, und im August war ich neunzehn geworden. Es war nur eine Frage der Zeit.
Am Ende der Stunde knüllte ich das Blatt ein zweites Mal zusammen und warf es wieder in den Mülleimer. Wo es hingehörte. Dass Mr Wilson es mitbekam, störte mich nicht. Als ich den Parkplatz erreichte, saßen sowohl Manny als auch Graciela auf meiner Ladeklappe und unterhielten sich mit einer Gruppe von Mannys Freundinnen. Ich seufzte. Zuerst Manny und jetzt auch noch Graciela. Ich verwandelte mich in ihren Chauffeur. Sie lachten und plapperten, und mein Kopf fing auf der Stelle an wehzutun. Eins der Mädchen rief einer kleinen Gruppe von Jungs, die sich um einen altmodischen gelben Camero versammelt hatte, etwas zu.
»Brandon! Mit wem gehst du zum Abschlussball? Ich könnte einen Begleiter gebrauchen, wie wär’s?«
Die Mädchen um sie herum begannen aufgeregt zu schnattern, und Brandon sah zu ihnen hinüber, um zu sehen, welche von ihnen das Angebot gemacht hatte. Brandon war der kleine Bruder von Mason, einem Typen, mit dem ich hin und wieder Zeit verbrachte. Doch im Gegensatz zum muskulösen, dunklen Mason, war Brandon mager und blond; in jedem Fall sahen die beiden Brüder besser aus, als gut für sie war. Mason hatte schon vor drei Jahren seinen Abschluss gemacht, und Brandon befand sich genau wie ich im Abschlussjahr. Ich war reifer als die Jungs meines Alters, und obwohl ich gutes Aussehen schätzte, langweilte ich mich schnell und hielt damit auch nicht hinterm Berg. Was wahrscheinlich den Grund dafür darstellte, warum ich nicht Abschlussballkönigin werden würde – trotz Mannys Hoffnungen und Intrigen.
»Tut mir leid, Sasha. Ich habe letzte Woche Brooke gefragt, ob sie mit mir hingeht. Aber wir sollten auf jeden Fall demnächst mal Zeit miteinander verbringen.« Brandon lächelte, was mich daran erinnerte, wie anziehend Mason sein konnte, wenn er sich Mühe gab. Vielleicht war es Zeit, ihn mal wieder anzurufen. Das letzte Mal war schon ein Weilchen her. »Dieser Wagen ist verdammt sexy, Brandon«, rief Manny, wobei er die Stimme hob, um das Geschnatter seiner Freundinnen zu übertönen.
»Ähem, ja, danke, Alter.« Brandon schnitt eine Grimasse, und seine Freunde blickten ungehaglich zur Seite. Ich wand mich innerlich, sowohl Brandons als auch Mannys wegen. »Manny, Gracie, lasst uns gehen.« In der Hoffnung, dass sich das Grüppchen hinter meiner Ladefläche zerstreuen würde, sobald ich den Motor startete, öffnete ich die Fahrertür meines Pick-ups. Im Rückspiegel beobachtete ich, wie Mannys Freunde ihn zum Abschied umarmten und ihm das Versprechen abnahmen, sich per SMS bei ihnen zu melden. Gracie schien unfähig, den Blick von Brandon und seinen Freunden abzuwenden. Selbst als sich die Kids in alle Richtungen verstreut hatten, saß sie immer noch auf der Ladefläche und starrte ihnen nach. Manny zog an ihrem Arm, um sie aus ihren Tagträumen zu wecken, dann stiegen beide in meinen Wagen. Auf Gracies Gesicht lag ein verträumter Ausdruck, während Manny beleidigt den Mund verzog.
»Ich glaube, Brandon kann mich nicht leiden«, murmelte er nachdenklich und sah mich fragend an.
»Brandon ist so sexy«, seufzte Graciela.
Ich fluchte, wobei ich nicht mit Kraftausdrücken sparte. Na toll. Brandon war viel zu alt für Graciela, und das war nicht nur eine Frage des Alters. Graciela war klein und hübsch, aber sehr unreif, sowohl körperlich als auch emotional. Außerdem lebte sie mit dem Kopf in den Wolken. Es war wirklich ein Glück, dass sie Manny hatte. Sonst hätte sie die rosarote Brille wahrscheinlich niemals abgesetzt. Sowohl Manny als auch Graciela ließen sich von meiner Ausdrucksweise nicht beeindrucken und redeten weiter, als hätten sie mich gar nicht gehört.
»Tatsächlich«, schnaubte Manny, »habe ich das Gefühl, dass Brandons Freunde mich genauso wenig mögen. Dabei bin ich doch so ein netter Mensch!« Das Ganze schien ihn wirklich zu verwirren.
»Glaubst du, dass Brandon mich mag, Manny?«, erkundigte sich Gracie mit träumerischer Stimme.
Manny und ich ignorierten sie, und ich hielt die Zeit für gekommen, Manny einen kleinen Rat zu geben.
»Ich kann mir vorstellen, dass die Jungs nicht so richtig wissen, wie sie mit dir umgehen sollen, Manny. Du bist zwar ein Junge, hängst aber ausschließlich mit Mädchen ab, du trägst Nagellack und Eyeliner und hast immer eine Handtasche dabei …«
»Das ist eine Umhängetasche!«
»Na schön, wie viele deiner Klassenkameraden tragen Umhängetaschen, die in allen Regenbogenfarben glitzern?«
»Das ist nichts weiter als ein Rucksack mit Reflexlicht.«
»Na schön. Also gut. Vergiss den Rucksack. Du machst in aller Öffentlichkeit Bemerkungen darüber, wie sexy dieser oder jener Junge ist … wobei du nicht mal diesen seltsamen Wilson auslässt … und einen Atemzug später flirtest du mit der Anführerin der Cheerleaderteams. Bist du schwul? Bist du hetero? Was ist los mit dir?«
Dass ich diese Frage so unverblümt stellte, schien Manny zu verblüffen. Er starrte mich mit offenem Mund an.
»Ich bin Manny!«, blaffte er und verschränkte die Arme vor dem Oberkörper. »Der und kein anderer. Ich bin Manny! Ich verstehe nicht, warum ich nicht sowohl einem süßen Typen als auch einem süßen Mädchen Komplimente machen darf! Jeder braucht positive Bestätigung, Blue. Es würde dir nicht wehtun, es auch mal zu versuchen!«
Frustriert über meine offensichtliche Unfähigkeit, zu ihm durchzudringen, schlug ich leicht den Kopf gegen das Steuerrad und fragte mich, ob Manny möglicherweise die einzige Person in unserer Highschool war, die keine Angst davor hatte, sie selbst zu sein. Vielleicht waren wir diejenigen, die herausfinden mussten, wer sie wirklich waren.
»Du hast recht, Manny. Und du kannst mir glauben, ich würde nicht die kleinste Kleinigkeit an dir ändern. Ich habe nur versucht, dir zu erklären, warum manche Leute Probleme damit haben, dich zu verstehen.«
»Du meinst, warum manche Leute Probleme damit haben, mich zu akzeptieren«, schmollte Manny und blickte aus dem Fenster.
»Ja. Das auch«, seufzte ich und startete den Motor. Zehn Sekunden später hatte er mir vergeben und plapperte den ganzen Nachhauseweg über dies und das. Manny war nicht in der Lage, auf jemanden sauer zu sein, es sei denn, dieser jemand behandelte Graciela schlecht. Dann drehte er völlig durch. Seine Mutter sagte scherzhaft, er führe sich dann auf wie ein aufgebrachter Chihuahua. Ich hatte das nur wenige Male erlebt, aber es hatte ausgereicht, um mich davon zu überzeugen, mir niemals einen Chihuahua zuzulegen. Doch solange ich nur auf seine Macken hinwies, wurde mir offensichtlich im Nullkommanichts vergeben, und ich stand wieder in seiner Gunst, ohne auch nur eine böse Bemerkung abzubekommen.
Als ich nach Hause kam, herrschte in unserem Apartment eine Hitze wie im Inneren der Hölle, und es roch auch nicht besonders gut. Alter Zigarettenrauch und verschüttetes Bier ergaben keine besonders angenehme Mischung in der zurzeit herrschenden Oktoberhitze von über dreißig Grad. Die Tür zu Cheryls Zimmer war geschlossen. Ich staunte über ihre Fähigkeit, trotz solcher Temperaturen zu schlafen, leerte seufzend die Aschenbecher und wischte die Bierpfütze auf dem Couchtisch auf. Cheryl war offensichtlich nicht allein. Auf dem Boden lag eine zerknitterte schwarze Männerjeans. Daneben entdeckte ich Cheryls schwarzen BH und ihren Arbeitsdress. Na toll. Je schneller ich hier wegkam, desto besser. Ich schlüpfte aus meiner Jeans, zog eine abgeschnittene Jogginghose und ein Tanktop an und band mein Haar zu einem lockeren Pferdeschwanz zusammen. In meinen Flipflops verließ ich die Wohnung nur zehn Minuten nach meiner Ankunft.
Für fünfzig Dollar im Monat hatte ich mir direkt hinter dem Apartmentkomplex einen Lagerraum gemietet. Der Raum verfügte über Licht und Strom und fungierte als meine eigene kleine Werkstatt. Darin standen ein paar Arbeitstische, die ich aus Sägeböcken und langen Sperrholzplatten zusammengezimmert hatte. Ich besaß nicht nur ein Multifunktionsgerät von Dremel, sondern auch Holzhämmer und Meißel in verschiedenen Größen. Außerdem Feilen und Schleifmaschinen sowie einen beweglichen Ventilator, der die heiße, mit Sägemehl geschwängerte Luft träge im Lagerraum kreisen ließ. Überall standen angefangene Projekte in verschiedenen Stadien, sie reichten vom Müllhaufen bis hin zu fertigen gewundenen, glänzenden Skulpturen. Am Tag zuvor hatte ich bei einem Ausflug einen dicken, gekrümmten Mesquiteast gefunden und war gespannt darauf zu sehen, was sich unter der mehrschichtigen dornigen Rinde verbarg, die ich erst noch entfernen musste. Die meisten Leute, die mit Holz arbeiten, bevorzugen weiche Hölzer, weil sie besser mit dem Schnitzmesser und dem Meißel zu bearbeiten sind und es einfacher ist, sie nach eigenen Vorstellungen zu formen. Niemand mühte sich wegen des harten Holzes gern mit Mesquite, Bergmahagoni oder Kriechwacholder ab. Für die Rancher im Westen war Mesquiteholz nichts weiter als Unkraut. Mithilfe eines scharfen Messers etwas daraus zu schnitzen erschien unmöglich, so viel war sicher. Ich musste einen großen Meißel und einen Holzhammer benutzen, um die Rinde zu entfernen. Sobald ich das Holz von ihr befreit hatte, verbrachte ich in der Regel viel Zeit damit, mir das freigelegte Holz in Ruhe anzusehen. Erst dann legte ich los. So hatte ich es von Jimmy gelernt.
Jimmy Echohawk war ein stiller Mann gewesen, so still, dass er manchmal tagelang kein Wort gesagt hatte. Es kam einem Wunder gleich, dass ich überhaupt sprechen gelernt hatte, als ich zu Cheryl kam. Das hatte ich PBS zu verdanken, einem nichtkommerziellen amerikanischen Fernsehnetwork. Im Alter von zwei Jahren ließ mich meine Mutter – zumindest wird davon ausgegangen, dass es meine Mutter war – auf dem Vordersitz seines Trucks zurück und fuhr weg. Ich kann mich fast überhaupt nicht mehr an sie erinnern, da ist nichts außer der vagen Ahnung von dunklem Haar und einer blauen Decke. Jimmy gehörte zum Stamm der Pawnee-Indianer und verfügte über nur sehr wenige Besitztümer. Er hatte einen alten Pick-up und einen Wohnwagen, den man hinten anhängen konnte und in dem wir lebten. Wir blieben nie besonders lange an einem Ort und bekamen nie Besuch, wir hatten nur einander. Jimmy sagte, dass seine Familie in einem Reservat in Oklahoma lebe, aber ich habe sie nie kennengelernt. Er lehrte mich, wie man Holz bearbeitet, und diese Fähigkeit hat mich sehr oft gerettet, sowohl in finanzieller als auch in emotionaler Hinsicht. Inzwischen neigte ich dazu, mich darin zu verlieren und bis in die frühen Morgenstunden zu arbeiten – so lange, bis ich sicher sein konnte, dass Cheryl zusammen mit ihrem unbekannten Begleiter zur Arbeit gegangen war und ich das Apartment leer vorfinden würde.
3
Himmelblau
»Als Julius Cäsar den Rubikon überquerte, wusste er genau, was das bedeutete.« Mr Wilson musterte uns mit ernster Miene, als wäre Julius Cäsar sein Kumpel und hätte den Rubikon erst gestern überschritten. Ich seufzte, warf das Haar über die Schulter und ließ mich noch tiefer in meinen Stuhl sinken.
»Eine Streitmacht ins Innere Italiens zu führen wurde als Verrat betrachtet. Die Senatoren in Rom waren eingeschüchtert von Cäsars Macht und Popularität. Sie wollten ihn kontrollieren. Alles war gut gewesen, solange er für Rom Schlachten gewonnen und die keltischen und germanischen Stämme besiegt hatte. Aber sie wollten nicht, dass er zu reich oder zu beliebt beim Volk wurde – und genau das war passiert. Wenn man zu diesen beiden Ingredienzen Julius Cäsars politischen Ehrgeiz hinzufügt, dann hat man das Rezept für kommendes Unheil … oder wenigstens für einen drohenden Bürgerkrieg.«
Während Mr Wilson den Mittelgang hinunterschlenderte, stellte ich überrascht fest, dass meine Klassenkameraden ihm aufmerksam zuhörten. Sie beobachteten ihn ganz genau und warteten darauf, was er als Nächstes sagen würde. Er benutzte weder Notizen, noch las er aus einem Text- oder Handbuch ab. Er redete einfach nur, als würde er die Highlights eines Krimis erzählen.
»Cäsar hatte ein paar Freunde in einflussreichen Positionen. Die schnüffelten herum, flüsterten den richtigen Ohren die richtigen Dinge zu und versuchten ganz offen, den Senat zu beeinflussen. Aber der Senat wollte sich nicht einmischen. Stattdessen forderte er Cäsar dazu auf, seine Armee aufzulösen und von seinem Amt zurückzutreten, ansonsten würde er riskieren, zum ›Staatsfeind‹ erklärt zu werden. Die US-Regierung benutzt heute denselben Begriff. Er bedeutet in erster Linie, dass die Regierung einen beschuldigt, ein Verbrechen gegen den Staat begangen zu haben. Menschen, die nationale Geheimnisse verraten, für ein anderes Land spionieren oder sich etwas Ähnliches zu Schulden kommen lassen, werden als Staatsfeinde bezeichnet. Das Ganze hat große Ähnlichkeit mit einem James-Bond-Film, aber ohne die tollen Stunts und die durchtrainierten Bond-Girls.«
Ich musste unwillkürlich lächeln. Auch der Rest der Klasse lachte, und ich wunderte mich darüber, eine Sekunde lang vergessen zu haben, wie wenig ich Mr Wilson leiden konnte.
»Können Sie sich vorstellen, was solch eine Bezeichnung mit einem Menschen anstellt? Manche Leute behaupten, dass man diesen Begriff als politisches Werkzeug benutzen kann – ein Werkzeug, mit dem man andere unterdrücken oder einschüchtern kann. Wirf jemandem vor, sein Land zu verraten, ein ›Staatsfeind‹ zu sein – und er ist erledigt. Das ist so, als würde man jemandem vorwerfen, Kinder zu missbrauchen. Und das war auch im antiken Rom nicht anders. Aber zurück zum ehrgeizigen Julius Cäsar, der wütend darüber ist, dass man ihn dazu auffordert, seine Armee aufzulösen, und ihm damit droht, ihn als Staatsfeind und als Verräter anzuklagen.