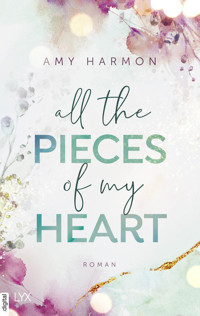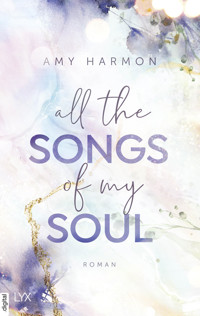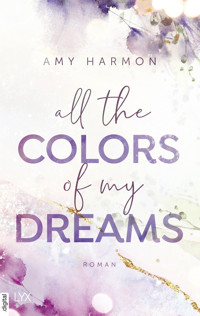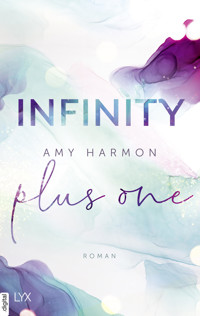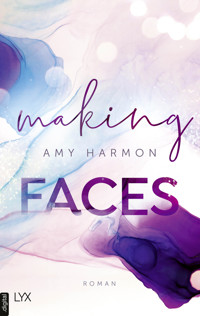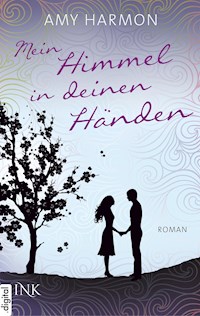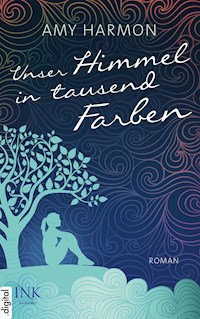
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ink.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Laws of Love
- Sprache: Deutsch
JEDE LIEBE VERDIENT EINE ZWEITE CHANCE
Moses ist gefährlich. Alle warnen Georgia vor dem geheimnisvollen Jungen, dessen Geschichte jeder kennt. Es heißt, er mache nur Ärger. Doch Moses ist auch aufregend, exotisch und wunderschön. Als er in das Haus nebenan einzieht, kann Georgia ihn nicht ignorieren, selbst wenn sie es noch so sehr versucht. Noch nie hat jemand solche Gefühle in ihr hervorgerufen. Und obwohl sie spürt, dass sie mit dem Feuer spielt, lässt Georgia sich auf Moses ein ...
Dies ist eine Geschichte über Schmerz und Hoffnung.
Über Leben und Tod. Eine Geschichte über das Davor und das Danach.
Über Neuanfänge und nie Endendes.
Aber vor allem ist es eine Geschichte über die Liebe.
»Mitreißend und tiefgründig!« WDR 1Live über Für immer Blue
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2016
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
Prolog
Teil 1
Teil 2
Epilog
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Amy Harmon bei INK
Impressum
AMY HARMON
Unser Himmel in tausend Farben
Roman
Ins Deutsche übertragen von
Corinna Wieja
Zu diesem Buch
Georgia kennt Moses, obwohl sie ihm noch nie begegnet ist. Sie kennt seine Geschichte: Als Baby wurde er von seiner Mutter in einem Waschsalon ausgesetzt. Als Kind wollte ihn niemand haben, und er wurde von einem Verwandten zum nächsten abgeschoben. Als Teenager machte er nichts als Ärger. Als Moses zu seiner Großmutter zieht, in das Haus neben der Ranch von Georgias Familie, warnen ihre Eltern sie vor dem geheimnisvollen Jungen, um den sich so viele Gerüchte ranken. Doch Georgia ist siebzehn und kann Moses nicht ignorieren, selbst wenn sie es noch so sehr versucht. Er ist anders, aber auch aufregend, exotisch und wunderschön. Noch nie hat ein Mann solche Gefühle in ihr hervorgerufen. Obwohl Georgia spürt, dass sie mit dem Feuer spielt und Moses ein dunkles Geheimnis verbirgt, lässt sie sich auf ihn ein und verliebt sich rettungs los, Hals über Kopf in ihn. Doch dann geschieht etwas, das niemand hätte vorhersagen können. Etwas, das alles verändert und die beiden voneinander trennt. Und als sie sich sieben Jahre später wieder gegenüberstehen, älter und reifer, muss Georgia sich fragen, ob sie damals die richtige Entscheidung getroffen hat …
Für Mary Sutorius, meine Nana, der es gefallen hätte,dass ich Autorin geworden bin.
PROLOG
Die ersten Worte einer jeden Geschichte sind immer die schwierigsten. Es ist fast so, als verpflichte man sich durch das Finden und Aufschreiben der ersten Sätze, die Sache auch durchzuziehen. Als ob man, wenn man erst mal angefangen hat, alles auch beenden müsste. Aber wie soll man etwas beenden, das kein Ende hat? Diese Geschichte handelt von endloser, ewiger Liebe … allerdings hat es eine Weile gedauert, bis ich so weit war.
Wenn ich dir gleich von vornherein sage, dass ich ihn verloren habe, wirst du es sicher leichter ertragen können. Du weißt, was auf dich zukommt, und es wird schmerzlich sein. Du wirst trotzdem dieses Ziehen in deiner Brust und ein mulmiges Gefühl im Magen verspüren. Aber immerhin weißt du Bescheid und kannst dich darauf vorbereiten. Und das ist mein Geschenk an dich. Mir hat man diesen Gefallen nicht getan. Ich war nicht darauf vorbereitet.
Und nachdem er fort war? Da wurde es schlimmer statt besser. Es wurde schwieriger, den Tag zu überstehen, nicht leichter. Das Bedauern war ebenso intensiv, der Kummer ebenso herzzerreißend, die Aussicht auf die endlos langen Tage, die vor mir lagen – Tage ohne ihn –, war nur schwer zu ertragen. Seit ich mir bewusst darüber bin, dass mir mehr als das nicht geblieben ist, würde ich ehrlich gesagt nur zu gern alles über mich ergehen lassen. Alles, nur nicht das. Aber das habe ich nun mal bekommen. Und ich war nicht darauf vorbereitet.
Ich kann dir nicht beschreiben, wie es sich angefühlt hat. Wie es sich immer noch anfühlt. Es geht einfach nicht. Worte erscheinen mir billig, und sie klingen hohl in meinen Ohren. Sie lassen alles, was ich sage, alles, was ich fühle, wie einen kitschigen Liebesroman voller blumiger Phrasen wirken, der Mitleidstränen und eine unmittelbare Reaktion hervorrufen soll. Eine Reaktion, die nichts mit der Realität zu tun hat, sondern nur auf oberflächlichen Gefühlen gründet, die man mit dem Zuschlagen des Buchs sofort wieder abschalten kann. Man wischt sich über die Augen, stößt ein wohliges Seufzen aus und denkt sich, dass es ja bloß eine Geschichte ist. Und zum Glück nicht deine Geschichte. Aber in diesem Fall ist das anders.
Denn es ist meine Geschichte. Und ich war nicht darauf vorbereitet.
TEIL 1
Vorher
1
Georgia
Man fand Moses in ein Handtuch gewickelt in einem Wäschekorb im Quick Wash. Er war erst wenige Stunden alt und dem Tode nahe. Eine Frau im Waschsalon hörte sein Weinen, hob ihn hoch und wärmte ihn an sich gedrückt unter ihrem Mantel, bis sie Hilfe organisieren konnte. Sie wusste nicht, wer seine Mutter war und ob sie zurückkommen würde, aber ihr war klar, dass er ungewollt war und im Sterben lag und dass alles zu spät sein würde, wenn sie ihn nicht schleunigst in ein Krankenhaus brachte.
Man bezeichnete ihn als »Crackbaby«. Meine Mutter hat mir erklärt, dass so Babys genannt werden, die mit einer Kokainsucht zur Welt kommen, weil ihre Mütter während der Schwangerschaft Drogen genommen haben. Crackbabys sind gewöhnlich kleiner als andere Babys, denn ihre Mütter sind krank und sie kommen meist zu früh auf die Welt. Das Kokain verändert den Stoffwechsel im Gehirn, und sie leiden unter Krankheiten wie ADHS und Impulskontrollstörungen. Mitunter bekommen sie Krampfanfälle oder haben psychische Störungen. Manchmal haben sie Halluzinationen oder eine erhöhte Reizempfindlichkeit. Man nahm an, dass Moses auch einige dieser Krankheiten haben würde, vielleicht auch alle.
Die Zehn-Uhr-Nachrichten brachten einen Bericht über ihn, groß aufgemacht und ergreifend – ein kleines Baby, das in einem schäbigen Waschsalon in einem üblen Viertel in West Valley City in einem Korb ausgesetzt worden war. Meine Mutter erzählte mir, dass sie sich noch gut an den Bericht erinnerte, vor allem an die mitleiderregenden Aufnahmen des Babys, das mit einer Ernährungssonde im Magen und einer winzigen blauen Mütze auf dem winzigen Kopf im Krankenhaus um sein Leben rang.
Drei Tage später fand man auch die Mutter, allerdings nicht in einem Waschsalon. Natürlich hatte man nicht vor, ihr das Baby zurückzugeben. Das wäre ohnehin nicht gegangen. Sie war tot. Die Frau, die ihr Baby in einem Waschsalon ausgesetzt hatte, wurde bei der Ankunft in demselben Krankenhaus, in dem ihr Kind ein paar Stockwerke höher um sein Leben kämpfte, für tot durch eine Überdosis erklärt.
Ihre Mitbewohnerin, die noch am selben Abend wegen Prostitution und Drogenbesitzes verhaftet wurde, erzählte der Polizei in der Hoffnung auf mildernde Umstände alles, was sie über die Frau und ihr Baby wusste. Die Autopsie der Leiche ergab, dass die Frau tatsächlich kürzlich ein Kind zur Welt gebracht hatte. Ein späterer DNS-Test bestätigte den kleinen Jungen als ihren Sohn. Was für ein kleiner Glückspilz.
Die Presse nannte ihn das »Wäschekorbbaby«, und das Krankenhauspersonal taufte ihn Moses. Aber Baby Moses wurde nicht von der Tochter des Pharaos gerettet wie der biblische Moses. Er wuchs auch nicht in einem Palast auf. Er hatte keine Schwester, die sich im Schilf wartend vergewisserte, dass sein Korb aus dem Nil gefischt wurde. Aber er hatte Familie – Mom sagte, die ganze Stadt geriet in Aufruhr, als herauskam, die Mutter des kleinen Moses stammte aus unserer Gegend. Sie hieß Jennifer Wright und hatte in den Sommerferien immer ihre Großmutter besucht, die in derselben Straße wohnte wie wir. Die Großmutter lebte immer noch hier, Jennifers Eltern in der Nachbarstadt, und auch an ihre weggezogenen Geschwister erinnerten sich viele immer noch gut. Der kleine Moses hatte also im Grunde genommen eine Familie, obwohl die kein krankes Baby wollte, das aller Wahrscheinlichkeit nach alle möglichen Probleme haben würde. Jennifer Wright hatte ihren Angehörigen das Herz gebrochen und sie resigniert und am Boden zerstört zurückgelassen. Mom hatte mir gesagt, Drogen könnten solche Auswirkungen haben. Die Nachricht, dass man ihr ein Crackbaby hinterlassen hatte, war also keine große Überraschung für die Familie. Mom erzählte, Jennifer sei früher ein ganz normales Mädchen gewesen. Hübsch, nett, sogar klug. Aber offensichtlich nicht klug genug, um sich von Meth, Kokain und dem ganzen anderen Zeug fernzuhalten, von dem sie abhängig war. Als ich den Ausdruck »Crackbaby« damals hörte, stellte ich mir vor, durch Moses’ Körper verliefe ein riesiger Riss, so als wäre er bei der Geburt mit einem Krack-Geräusch auseinandergebrochen. Ich wusste natürlich, dass der Ausdruck etwas anderes bedeutet, dennoch ist mir das Bild im Gedächtnis hängen geblieben. Vielleicht fühlte ich mich überhaupt erst zu ihm hingezogen, weil er einen Knacks hatte.
Von meiner Mutter weiß ich, dass damals die ganze Stadt die Geschichte von Baby Moses Wright aufmerksam in den Nachrichten verfolgt hat. Alle haben so getan, als wüssten sie aus erster Hand darüber Bescheid, und was sie nicht wussten, haben sie einfach erfunden, um sich wichtigzumachen. Ich hingegen wusste nichts von Baby Moses, denn all das passierte vor meiner Geburt. Er wuchs heran und war für mich schlicht und einfach Moses – ein Kind, das in Jennifer Wrights Familie herumgereicht, und jedes Mal, wenn er zu anstrengend wurde, bei anderen Verwandten untergebracht wurde, die ihn eine Weile ertrugen, bis sie ein weiteres Familienmitglied überreden konnten, sich um ihn zu kümmern. Als ich ihn schließlich kennenlernte und meine Mom mir das alles über ihn erzählte, damit ich »ihn besser verstehe und nett zu ihm bin«, war die Geschichte schon kalter Kaffee, und niemand wollte mehr etwas mit ihm zu tun haben. Die Menschen lieben Babys, sogar kranke. Selbst Crackbabys. Aber Babys wachsen zu Kindern heran. Und niemand mag verkorkste Problemkinder.
Und Moses war ein verkorkstes Problemkind.
Ich kannte mich mit Problemkindern bereits gut aus, als wir uns zum ersten Mal begegneten. Schon mein ganzes Leben lang hatten meine Eltern Pflegekinder mit schwieriger Vergangenheit aufgenommen. Ich hatte zwei ältere Pflegeschwestern und einen älteren Pflegebruder, die auszogen, als ich sechs war. Ich stellte so was wie einen Ausrutscher dar und wuchs mit Kindern auf, die nicht meine Geschwister waren und die, wie Menschen durch eine Drehtür, mein Leben zeitweise betraten und auch wieder verließen. Vielleicht haben sich meine Eltern und Kathleen Wright, Jennifer Wrights Großmutter und Moses’ Urgroßmutter deshalb an unserem Küchentisch so oft über Moses unterhalten. Ich hörte eine Menge Dinge, die mich vermutlich nichts angingen. Vor allem in diesem Sommer.
Die alte Dame wollte Moses für immer bei sich aufnehmen. In einem Monat wurde er achtzehn, und der Rest seiner Familie konnte es kaum erwarten, die Verantwortung für ihn los zu sein. Seit seiner Kindheit hatte er seine Urgroßmutter jeden Sommer besucht, und sie war zuversichtlich, dass sie gut miteinander auskommen würden, wenn sich alle raushielten und sie schalten und walten ließen, wie sie es für richtig hielt. Sie schien sich keine Sorgen darüber zu machen, dass sie im selben Monat, in dem Moses achtzehn wurde, selbst achtzig werden würde.
Ich wusste, wer er war, und behielt ihn Sommer für Sommer in Erinnerung, obwohl wir nie etwas zusammen unternommen hatten. Die Stadt war klein und Kinder bemerken einander. Kathleen Wright hatte ihn an den wenigen Sonntagen, die er zu Besuch weilte, immer zum Gottesdienst mitgenommen. Er gehörte meiner Sonntagsschulklasse an, und wir alle starrten ihn genüsslich an, während der Lehrer versuchte, ihn zum Mitmachen zu überreden. Er beteiligte sich jedoch nie. Als hätte man ihm eine große Belohnung fürs Stillsitzen versprochen, saß er wie festgeklebt auf seinem kleinen Metallfaltstuhl, knetete die Hände im Schoß und schaute sich mit seinen sonderbar gefärbten Augen um. Nach dem Gottesdienst rannte er jedes Mal gleich zur Tür hinaus in den Sonnenschein und lief schnurstracks nach Hause, ohne auf seine Uroma zu warten. Manchmal bin ich mit ihm um die Wette gelaufen, aber er war immer schneller vom Stuhl aufgesprungen und draußen als ich. Selbst damals bin ich ihm nachgelaufen.
Gelegentlich unternahm Moses mit seiner Uroma Fahrradausflüge und Spaziergänge. Beinahe täglich fuhr sie mit ihm zum Schwimmbad in Nephi, was mich immer rasend eifersüchtig machte. Ich konnte mich glücklich schätzen, wenn ich mehr als nur einmal im Sommer ins Schwimmbad gehen durfte. Wenn ich schwimmen wollte, fuhr ich mit dem Rad zu einem Angelplatz im Chicken Creek Canyon. Meine Eltern hatten mir das zwar verboten, weil das Wasser kalt, tief, trübe und sogar gefährlich war. Aber ich wäre lieber ertrunken, als darauf zu verzichten, und bisher war auch immer alles gut gegangen.
Als Moses älter wurde, kam er in manchen Sommern nicht mehr nach Levan. Vor zwei Jahren war er das letzte Mal in der Stadt gewesen, obwohl Kathleen ihn schon lange zu überreden versuchte, zu ihr zu ziehen. Die Familie vertrat die Ansicht, dass sie mit ihm nicht klarkommen würde. Sie behauptete, er sei »zu emotional, zu explosiv, zu launisch und temperamentvoll«. Aber schließlich waren sie alle wohl erschöpft und gaben nach. Und so kam es, dass Moses nach Levan zog.
Wir waren beide im Abschlussjahr, obwohl er ein ganzes Jahr älter war als ich, aber ich gehörte auch zu den Jüngsten in meiner Jahrgangsstufe. Wir hatten beide im Sommer Geburtstag – Moses wurde am 2. Juli achtzehn und ich am 28. August siebzehn. Moses sah allerdings nicht aus wie achtzehn. In den vergangenen zwei Jahren seit unserer letzten Begegnung war er sozusagen in seine Füße und Augen hineingewachsen – groß, breitschultrig und gut gebaut. Seine Muskeln zeichneten sich deutlich auf seinem schlanken Körper ab. Durch seine hellen Augen, die ausgeprägten Wangenknochen und das kantige Kinn wirkte er eher wie ein ägyptischer Prinz statt wie ein Gangmitglied, was er Gerüchten zufolge sein sollte.
Moses hatte Probleme mit den Schulaufgaben und konnte sich nicht lange konzentrieren und still sitzen. Seine Familie behauptete sogar, er hätte Krampfanfälle und Halluzinationen, die sie mit verschiedenen Medikamenten in den Griff zu bekommen versuchten. Ich hatte gehört, wie seine Großmutter meiner Mutter erzählte, wie launisch und reizbar er sein konnte, dass er Einschlafschwierigkeiten hatte und sich gedanklich oft einfach ausklinkte. Sie hielt ihn für extrem intelligent, ein Genie sogar, und erzählte, wie unglaublich gut er malen konnte. Aber die ganzen Medikamente, die er zur Konzentration und Beruhigung einnehmen musste, würden ihn langsam und träge machen und seine Bilder düster und Angst einflößend. Deshalb wollte Kathleen Wright die Medikamente absetzen, wie sie meiner Mutter erzählte.
»Sie verwandeln ihn in einen Zombie«, hörte ich sie sagen. »Ich bin bereit, das Risiko in Kauf zu nehmen und mich mit einem Kind auseinanderzusetzen, das weder still sitzen noch aufhören kann zu malen. Zu meiner Zeit war das nichts Schlechtes.«
Ich fand, dass die Zombiesache doch etwas sicherer klang. Trotz seiner Schönheit wirkte Moses Wright unheimlich. Mit seinem v-förmigen goldbraunen Körper und den kurios hellen Augen erinnerte er mich an eine Raubkatze. Geschmeidig, gefährlich, leise. Ein Zombie bewegt sich wenigstens langsam. Eine Raubkatze schlägt blitzschnell zu. In der Nähe von Moses Wright hatte ich immer das Gefühl, als würde ich versuchen, Freundschaft mit einem Panther zu schließen. Ich bewunderte die alte Dame dafür, dass sie ihn aufnehmen wollte. Sie besaß in der Tat mehr Mut als alle, die ich kannte.
Da es nur zwei weitere Mädchen in meinem Alter in der Stadt gab, war ich öfter allein, als mir lieb war, vor allem, weil keines der anderen Mädchen Pferde und Rodeos so sehr liebte wie ich. Wir grüßten einander höflich und saßen nebeneinander in der Kirche, waren aber nicht so gut befreundet, dass wir viel Zeit miteinander verbrachten oder die langweiligen Sommertage gemeinsam ertrugen.
In diesem Sommer herrschte extreme Hitze. Daran erinnere ich mich noch gut. Wir hatten den trockensten Frühling aller Zeiten, was im Sommer im ganzen Westen zu Flächenbränden führte. Die Farmer beteten um Regen, die Nerven lagen blank, und die Backofentemperaturen sorgten für kurze Geduldsfäden und machten alle reizbar. Außerdem waren zwei Mädchen verschwunden. Die beiden stammten aus zwei verschiedenen Städten ganz in der Nähe. Bei einem der beiden nahm man an, sie sei mit ihrem Freund durchgebrannt, und das andere war fast achtzehn und hatte ein katastrophales Familienleben gehabt. Die Leute vermuteten, dass es beiden gut ging, aber in den vergangenen zehn oder fünfzehn Jahren hatte es ähnliche, bisher ungeklärte Vermisstenfälle in verschiedenen Countys von Utah gegeben, weshalb alle Eltern ein wenig nervöser und wachsamer waren als gewöhnlich. Meine Eltern bildeten da keine Ausnahme.
Ich war rastlos und genervt, fühlte mich total kribbelig und konnte es kaum erwarten, endlich mit der Schule fertig zu werden und mein Leben zu beginnen. Ich war Barrel Racer – eine Rodeodisziplin, bei der Reiter und Pferd in der schnellstmöglichen Zeit kleeblattförmig um drei Tonnen galoppieren müssen. Und ich wollte nichts lieber tun, als mit dem Pferdeanhänger an meinem Pick-up dem Rodeozirkus zu folgen und meine Freiheit mit meinen Pferden und erhofften Rodeosiegen zu genießen. Nichts wünschte ich mir mehr. Doch ich war erst siebzehn, und da zudem auch die vermissten Mädchen in den Köpfen meiner Eltern herumspukten, wollten sie mich nicht allein losziehen lassen. Begleiten konnten sie mich allerdings auch nicht. Sie versprachen mir jedoch, sich nach meinem Schulabschluss und achtzehnten Geburtstag eine Lösung einfallen zu lassen. Der Abschluss lag jedoch noch in weiter Ferne, und der Sommer erstreckte sich wie eine trockene, verlassene Wüste vor mir. Ich hungerte nach Abwechslung. Vielleicht lag es daran. Vielleicht habe ich mich deshalb zu weit vorgewagt und jegliche Vernunft vergessen.
Woran es auch lag, als Moses nach Levan kam, war er wie das Wasser – kalt, tiefgründig, unberechenbar – und ebenso gefährlich wie der See am Canyon, weil man nicht sehen konnte, was unter der Oberfläche vor sich ging. Und wie schon mein ganzes Leben lang sprang ich kopfüber hinein, obwohl man es mir verboten hatte. Dieses Mal ertrank ich allerdings.
»Was schaust du denn so?«, fragte ich schroff und gab Moses damit das, was er meiner Meinung nach wollte – meine Aufmerksamkeit. Alle Pflegekinder meiner Eltern sogen Aufmerksamkeit auf wie die Luft zum Atmen, als würden sie ohne sie ersticken. Mir ging das auf die Nerven. Und damit meine ich nicht die Tatsache, dass sie die Aufmerksamkeit meiner Eltern brauchten, sondern vielmehr dass sie diese Beachtung auch von mir einforderten. Ich war am liebsten allein mit den Pferden. Sie stellten keine Anforderungen an mich, während alle anderen so viel von mir forderten, dass ich befürchtete, den Verstand zu verlieren. Und nun stand Moses dort im Stall, beobachtete mich, drängte sich in meine ungestörte Zeit mit meinen Pferden Sackett und Lucky und saugte den Sauerstoff aus dem Raum wie die Pflegekinder.
Kathleen Wright hatte meine Eltern gefragt, ob Moses seine neu gewonnene, nicht durch Medikamente gedrosselte Energie austoben könnte, indem er ein paar Arbeiten für uns erledigte. Sie schlug vor, ihn die Ställe ausmisten, Unkraut jäten, Rasen mähen oder auch die Hühner füttern zu lassen – ganz gleich was, Hauptsache, er war den Sommer über beschäftigt und möglichst auch im neuen Schuljahr, falls ihr Plan funktionierte. Die genannten Arbeiten gehörten zu meinen Pflichten, und ich wäre froh gewesen, wenn er sie mir abgenommen hätte. Mein Dad fand jedoch andere Aufgaben für ihn. Moses arbeitete hart – so hart, dass meinem Dad allmählich die zu erledigenden Aufgaben ausgingen. Es schien unmöglich, Moses den ganzen Sommer über zu beschäftigen.
Offensichtlich hatte mein Dad das Aufräumen der Stallungen mit auf die Erledigungsliste gesetzt. Moses hatte den ganzen Morgen über wie ein Wilder Heuballen gestapelt, gekehrt, gemistet und Sattel- und Zaumzeug geputzt. Ich war mir nicht sicher, ob ich ihn in der Nähe haben wollte oder nicht. Vor allem, als er plötzlich stehen blieb und wie gelähmt, die Hände in die Hüften gestützt, in meine Richtung starrte. Allerdings fixierte er nicht mich, sondern irgendetwas über meiner Schulter, seine gelbgrünen Raubtieraugen groß wie Untertassen. Er stand so reglos wie nie zuvor. Kein einziges Mal zuvor hatte ich ihn derart still erlebt. Moses antwortete nicht auf meine Frage, aber er bewegte die Finger. Er schloss und öffnete die Hand, als ob er seinen Blutkreislauf in Schwung bringen wollte. Das tat ich auch immer, wenn ich auf den Bus wartete und meine Handschuhe vergessen hatte. Aber da es Juni war und noch dazu ungewöhnlich heiß, bezweifelte ich, dass er fror.
»Moses!«, blaffte ich, in dem Versuch, ihn aus seiner Trance zu wecken. Sonst würde er womöglich gleich noch zuckend vor Krämpfen am Boden liegen und ich musste Mund-zu-Mund-Beatmung oder so was machen. Der Gedanke, seinen Mund mit meinem zu berühren, löste ein seltsames Ziehen in meinem Bauch aus. Ich fragte mich, ob ich es überhaupt schaffen würde, meine Lippen auf die von Moses zu drücken, selbst wenn es nur dem Zweck diente, Luft in seine Lungen zu pusten. Er war nicht hässlich. Wieder verspürte ich das seltsame, nicht gänzlich unangenehme Flattern. Nein, Moses war ganz und gar nicht hässlich. Er war auf eigentümliche Art schön – er sah anders aus, vor allem durch seine merkwürdigen Wolfsaugen, und ich musste mir eingestehen, dass »anders« im Falle von Moses »gut« bedeutete. Irgendwie cool. Zu schade, dass er einen Knacks hatte.
Mit den Pferden therapierten meine Eltern die Pflegekinder. Die Behandlungsmethode war weltweit bekannt und funktionierte ganz ohne Worte, weil Pferde nun mal nicht reden können. So drückten es meine Eltern in ihrer Werbung aus, um die Leute zum Lachen zu bringen und ihnen die Angst zu nehmen. Pferde können nicht reden, und manchmal können Kinder das auch nicht. Mit therapeutischem Reiten – ein schicker Ausdruck für die Freundschaft zu einem Pferd, bei der man durch Beobachtung des Pferdes einiges über sich selbst erfährt – verdienten meine Eltern ihren Lebensunterhalt. Außerdem war mein Dad Tierarzt, und früher wollte ich das auch werden. Unsere Pferde waren gut ausgebildet und an Kinder gewöhnt. Sie wussten, dass sie stillstehen mussten, wenn ein Kind sich ihnen näherte oder sich in der Nähe befand. Sie waren stets geduldig. Sie ließen sich sogar von Fremden problemlos das Zaumzeug anlegen und öffneten freiwillig das Maul dafür. Die Kinder reagierten auf die Pferde in einer Weise, die Erwachsene als »Wunder« und »Durchbruch« bezeichneten, wann immer ein Kind in seine Familie zurückkehrte oder unsere verließ.
Moses hing seit zwei Wochen hier herum, arbeitete, jätete Unkraut, aß – heiliger Strohsack konnte der essen – und ging mir im Allgemeinen auf die Nerven, weil er so verstörend wirkte. Er hatte nichts Falsches gemacht. Er machte mich nur nervös. Er redete nicht mit mir, meiner Ansicht nach das Einzige, was für ihn sprach. Das und seine coolen Augen. Und sein muskulöser Körper. Angewidert von mir selbst verzog ich das Gesicht. Er war seltsam. Was dachte ich mir bloß?
»Bist du schon mal geritten?«, fragte ich, in dem Versuch, mich abzulenken.
Moses riss sich aus seinem Tagtraum und hörte auf, geistesabwesend in die Ferne zu starren.
Sein Blick blieb kurz auf mir haften, aber er antwortete nicht. Also wiederholte ich meine Frage.
Er schüttelte den Kopf.
»Nein? Warst du schon mal in der Nähe eines Pferdes?«
Wieder schüttelte er den Kopf.
»Na, komm schon. Komm näher«, forderte ich ihn auf und deutete mit dem Kopf zu Sackett. Ich hoffte, dass ich ihm durch den Kontakt mit Pferden helfen konnte, so wie Mom und Dad den Kindern. Ich hatte ihnen oft bei der Arbeit zugesehen. Also dachte ich mir, ich könnte das tun, was sie taten. Vielleicht konnte ich sein angeknackstes Gehirn heilen.
Moses machte einen Schritt rückwärts, als hätte er Angst. In den ganzen Wochen, die er auf unserer Farm arbeitete, hatte er sich niemals in die Nähe eines Tiers gewagt. Kein einziges Mal. Er beobachtete sie nur. Er beobachtete mich. Und er sprach kein Wort.
»Los, trau dich. Sackett ist das tollste Pferd überhaupt. Streichle ihn doch wenigstens mal.«
»Ich jage ihm nur Angst ein«, antwortete Moses. Wieder war ich überrascht. Es war das erste Mal, das ich ihn sprechen hörte, und seine Stimme klang nicht kieksig wie die meines Pflegebruders Bobbie und die so vieler anderer Jungen, als ob sie zwischen zwei Tonlagen auf dem Weg zum Keller hin- und herschwankte, ehe sie schließlich ihre endgültige Position fand und einrastete. Moses’ Stimme klang tief und warm und so samtig, dass mein Herz unwillkürlich einen kleinen Hüpfer machte.
»Nein, machst du nicht. Sackett lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Nichts jagt ihm Angst ein oder macht ihn nervös. Er würde sich von dir den ganzen Tag umarmen lassen, wenn du das willst. Lucky andererseits könnte dir die Hand abbeißen und dir einen Tritt verpassen. Aber Sackett nicht.«
Lucky umschmeichelte ich nun schon seit Monaten. Ein Kunde hatte meinen Vater damit für seine Dienste bezahlt, die er sich sonst nicht hätte leisten können. Mein Dad hatte keine Zeit für Luckys Sperenzchen und ihn mir mit den Worten übergeben: »Sei vorsichtig.«
Ich hatte gelacht. Ich war nie vorsichtig.
Er hatte auch gelacht, aber mich dann gewarnt: »Ich meine es ernst, George. Dieses Pferd heißt nicht ohne Grund Lucky. Du kannst von Glück sagen, wenn du je auf ihm reiten wirst.«
»Tiere mögen mich nicht.« Moses sprach so leise, dass ich nicht sicher war, ob ich ihn richtig verstanden hatte. Ich verdrängte den Gedanken an Lucky und tätschelte meinen treuen Begleiter, das Pferd, das ich schon so lange besaß, wie ich reiten konnte.
»Sackett liebt jeden.«
»Mich sicher nicht. Oder vielleicht liegt es nicht an mir. Vielleicht liegt es an ihnen.«
Verwirrt sah ich mich um. Außer Sackett, Moses und mir war niemand hier. »Wen meinst du?«, fragte ich. »Wir sind unter uns, Mann.«
Moses antwortete nicht.
Also schaute ich ihn abwartend an und hob herausfordernd die Augenbrauen. Ich streichelte über Sacketts Nase und seinen Hals. Er zuckte nicht mal mit dem kleinsten Muskel.
»Siehst du? Er ist wie eine Statue. Er saugt die Liebe förmlich auf. Jetzt komm schon.«
Moses machte einen Schritt nach vorne und streckte zaghaft eine Hand nach Sackett aus, worauf der Hengst nervös wieherte.
Sofort ließ Moses die Hand sinken und wich zurück.
Ich lachte. »Was war das denn?«
Hätte ich besser mal auf Moses gehört, als er sagte, dass Tiere ihn nicht leiden konnten. Das habe ich aber nicht. Ich habe ihm schlicht nicht geglaubt. Und das keineswegs zum letzten Mal.
»Du machst doch jetzt keinen Rückzieher, oder?«, frotzelte ich. »Berühr ihn. Er wird dir nicht wehtun.«
Moses richtete die goldgrünen Augen auf mich, verharrte einen Moment unschlüssig und ging dann erneut mit ausgestreckter Hand auf das Pferd zu.
Wie aus heiterem Himmel bäumte sich Sackett auf, als wäre er zu lange mit Lucky zusammen gewesen und sein schlechtes Benehmen hätte auf ihn abgefärbt. Das sah dem Pferd, das ich mein ganzes Leben lang kannte, so gar nicht ähnlich. Nicht ein einziges Mal in all den Jahren, in denen ich ihn schon liebte, hatte er gebuckelt. Mir blieb nicht einmal die Zeit, vor Schreck aufzuschreien, etwas zu rufen oder gar nach seinem Halfter zu greifen. Von jetzt auf gleich bekam ich einen Huf an die Stirn und ging zu Boden wie ein umgefallener Sack Mehl.
Blut stach mir in den Augen, als ich sie öffnete und auf die Dachbalken des alten Stallgebäudes blickte. Ich lag auf dem Rücken und mein Kopf tat so weh, als hätte mich ein Pferd getreten – ach ja, mich hatte tatsächlich ein Pferd getreten, wie mir plötzlich bewusst wurde. Und zwar Sackett. Der Schock darüber war beinahe größer als die Schmerzen.
»Georgia?«
Verschwommen nahm ich das Gesicht über mir wahr, das mir den Blick auf die Dachbalken und die Staubkörnchen verdeckte, die im streifigen Sonnenlicht herumwirbelten.
Moses bettete meinen Kopf in seinen Schoß und presste mir sein T-Shirt auf die Stirn. Selbst in meinem benommenen Zustand bewunderte ich seine breiten Schultern und seinen nackten Oberkörper und spürte, wie sein seidig glatter Bauch gegen meine Wange strich.
»Ich muss Hilfe holen, okay?« Er rutschte unter mir weg und legte meinen Kopf behutsam auf den Boden, wobei er immer noch das Shirt an meine blutige Stirn presste. Ich gab mir größte Mühe, den riesigen Blutfleck auf dem Shirt zu ignorieren.
»Nein! Warte! Wo ist Sackett?«, rief ich und versuchte, mich aufzusetzen. Moses drückte mich wieder nach unten und sah zur Tür, als hätte er keine Ahnung, was er tun sollte.
»Er … ist durchgegangen«, antwortete er bedächtig.
Ich erinnerte mich, dass Sackett nicht angebunden gewesen war. Dazu hatte es bisher nie einen Grund gegeben. Ich wusste nicht, was in mein Pferd gefahren war, dass es sich plötzlich aufbäumte und aus dem Tor preschte. Mein Blick suchte erneut den von Moses.
»Wie schlimm ist es?« Ich versuchte wie Clint Eastwood zu klingen, oder zumindest wie jemand, den eine heftig blutende Kopfwunde nicht aus der Fassung brachte. Aber meine Stimme zitterte ein wenig.
Moses schluckte, sein Adamsapfel hüpfte in seiner braunen Kehle auf und ab. Auch seine Hände zitterten. Er war eindeutig ebenso durcheinander wie ich, das konnte man ihm ansehen.
»Ich weiß es nicht. Die Wunde ist nicht groß, aber sie blutet stark.«
»Tiere mögen dich wohl wirklich nicht, was?«, flüsterte ich.
Moses tat nicht so, als hätte er mich nicht verstanden. Er schüttelte den Kopf. »Ich mache sie nervös. Alle Tiere. Nicht nur Sackett.«
Mich machte er auch nervös. Aber auf eine gute Art. Auf eine Weise, die mich faszinierte. Und obwohl mein Kopf vor Schmerzen dröhnte und Blut in meinen Augen schwamm, wollte ich, dass er blieb. Und ich wollte, dass er mir all seine Geheimnisse anvertraute.
Als ob er die Veränderung in mir gespürt hätte und nicht guthieß, stand Moses abrupt auf und lief davon. Mit seinem T-Shirt auf meiner Stirn und einem neu erwachten, unbändigen Interesse an dem neuen Jungen in der Stadt blieb ich allein zurück. Wenig später kehrte Moses mit meiner Mutter im Schlepptau zurück. Moses’ Urgroßmutter folgte ihr auf den Fersen. Sorge stand ihr breit ins Gesicht geschrieben, ebenso wie meiner Mom, und ich fragte mich unwillkürlich, ob die Verletzung vielleicht doch schlimmer war, als ich annahm. Ich verspürte einen Stich weiblicher Eitelkeit, was mir ebenfalls neu war. Würde bald eine große Narbe meine Stirn verunstalten? Vor einer Woche noch hätte ich das wohl für eine coole Sache gehalten. Nun aber schreckte mich die Aussicht auf eine Narbe eher. Ich wollte, dass Moses mich für schön hielt.
Er hielt sich im Hintergrund und überließ den Erwachsenen das Feld, die wie aufgescheuchte Hühner um mich herumwuselten. Als entschieden war, dass ich auch ohne teuren Ausflug in die Notaufnahme wieder auf die Beine kommen würde, und meine klaffende Wunde mit ein paar Klammerpflastern versorgt war, verschwand Moses. Therapeutisches Reiten würde die Risse in Moses Wright wohl nicht heilen, aber ich schwor mir, dass ich mich irgendwie in diesen Rissen einnisten und sie kitten würde, und wenn es das Letzte war, was ich tat. Die Sommerwüste war gerade zum Regenwald geworden.
2
Georgia
Ungefähr eine Woche, nachdem Moses mein Pferd erschreckt und ich einen Tritt an den Kopf bekommen hatte, entdeckten Dad und ich ein Gemälde auf dem Stallgebäude. Irgendwann in der Nacht hatte jemand ein erstaunlich realistisches Bild von einem Sonnenuntergang über den Bergen von Levan auf die Seitenwand gemalt. Vor dem zartrosa Hintergrund stand ein Pferd, das fast so aussah wie Sackett, und neigte leicht den Kopf. Ein Reiter saß lässig im Sattel. Er war im Profil dargestellt und durch die untergehende Sonne in Schatten getaucht, dennoch kam er mir bekannt vor. Mein Dad betrachtete das Bild ziemlich lange mit wehmütiger Miene. Ich dachte, er würde wütend werden, weil jemand den Stall als Leinwand benutzt hatte … ungefähr so, wie Gangs in meiner Vorstellung in Großstädten einfach alles vollschmierten. Aber hier handelte es sich nicht um geometrische Gangsignaturen oder fette Graffiti-Buchstaben in grellen Farben. Das Bild war cool. Und so gut, dass man sogar dafür bezahlen würde. Und zwar viel.
»Der Mann sieht aus wie mein Dad«, flüsterte mein Vater.
»Das Pferd sieht aus wie Sackett«, sagte ich, unfähig, den Blick abzuwenden.
»Opa Shepherds Pferd war Sacketts Urgroßvater. Er hieß Hondo. Erinnerst du dich an ihn?«
»Nein.«
»Ja, du warst damals wohl noch zu klein. Hondo war ein gutes Pferd. Opa liebte ihn so sehr wie du Sackett.«
»Hast du ihm ein Bild gezeigt?«
»Wem?« Dad drehte sich verwundert zu mir um.
»Moses. Er hat das doch gemalt, oder? Ich habe gehört, wie Mrs Wright Mom erzählt hat, dass Moses wegen Vandalismus oder Sachbeschädigung oder so was im Jugendknast gesessen hat. Offenbar malt er gerne. Mrs Wright sagt, es ist zwanghaft. Was auch immer das bedeutet. Ich dachte, du hättest ihm Arbeit geben wollen.«
»Was? Nein. Ich habe ihn nicht gebeten, den Stall zu bemalen. Aber es gefällt mir.«
»Mir auch«, stimmte ich aus vollem Herzen zu.
»Wenn er das gemalt hat, und ich wüsste nicht, wer sonst, besitzt er ein Riesentalent. Dennoch kann er nicht nach Lust und Laune alles bemalen. Sonst haben wir womöglich bald ein Elvisbild auf der Garage.«
»Mom würde das gefallen.«
Dad lachte zwar über meine Bemerkung, aber er machte keinen Spaß. Am Abend verkündete er, dass er Moses und Kathleen Wright besuchen wollte, und ich bettelte ihn an, mich mitzunehmen.
»Ich möchte mit Moses reden.«
»Ich will ihn nicht in Verlegenheit bringen, George. Und es wird ihm definitiv peinlich sein, wenn du dabei bist, während ich ihn zur Rede stelle. Dieses Gespräch sollte ohne Publikum stattfinden. Ich will ihm nur klarmachen, dass er nicht einfach ohne Erlaubnis überall malen kann, wo er will, ganz egal, wie talentiert er ist.«
»Ich möchte, dass Moses ein Bild auf meine Schlafzimmerwand malt. Ich habe Geld gespart und werde ihn dafür bezahlen. Du kannst ihm also sagen, dass er nicht überall malen kann, wo er will, und ihm dann eine Stelle anbieten, wo er malen kann. Wäre das in Ordnung?«
»Was willst du ihn denn malen lassen?«
»Erinnerst du dich an die Geschichte, die du mir früher immer erzählt hast, als ich noch klein war? Die über den blinden Mann, der sich jeden Abend bei Sonnenuntergang in ein Pferd verwandelt und wieder zum Mann wird, als die Sonne aufgeht?«
»Ja. Die Geschichte hat mir mein Vater schon erzählt.«
»Ich muss immerzu daran denken. Ich hätte die Geschichte gern an meiner Wand. Oder wenigstens das weiße Pferd, das in die Wolken galoppiert.«
»Frag deine Mom. Wenn sie einverstanden ist, bin ich es auch.«
Ich seufzte tief. Mom war eine härtere Nuss. »Es ist doch nur Farbe«, grummelte ich.
Überraschenderweise störte meine Mom die Farbe relativ wenig; sie machte sich weitaus mehr Gedanken darüber, dass Moses sich in meinem Zimmer aufhalten würde.
»Er ist so intensiv, Georgie. Er jagt mir ein wenig Angst ein. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich von deiner Freundschaft mit ihm halten soll. Ich weiß, das klingt ziemlich hartherzig, aber du bist meine Tochter, und Gefahr hat dich schon immer angezogen wie das Licht die Motte.«
»Er malt doch nur, Mom. Und ich werde ganz bestimmt nicht in einem Spitzennachthemd auf dem Bett sitzen und ihm dabei zuschauen. Mir wird schon nichts passieren.« Ich zwinkerte ihr zu.
Mom gab mir einen Klaps auf den Po und gab lachend nach. In Wahrheit war ihre Warnung jedoch vorausschauend gewesen. Sie hatte recht. Moses faszinierte mich, und ich konnte mir nicht vorstellen, dass diese Faszination so bald abebben würde.
Kurz nach Sonnenuntergang liefen Dad und ich zu Kathleen Wright hinüber und klopften an ihre Hintertür. Moses aß am Küchentisch die größte Schüssel Cornflakes, die ich je gesehen hatte. Seine Urgroßmutter saß ihm gegenüber und schälte einen Apfel, dessen Schale sich wie ein langes rotes Band kringelte. Ich fragte mich unwillkürlich, wie viele Äpfel sie in ihren achtzig Jahren schon geschält hatte, um diese Fähigkeit so gut zu beherrschen.
»Ich werde nie wieder auf Ihrem Grundstück malen«, versprach Moses mit ernster Miene, als ihn mein Dad behutsam ermahnt hatte, unsere Sachen nicht ohne Erlaubnis zu bemalen. Kathleen wirkte beunruhigt, bis Dad ihr versicherte, das Gemälde sei wunderschön und Moses müsse es nicht entfernen. Erst da entspannte sie sich. Ich schien die Einzige zu sein, der auffiel, dass Moses nicht versprochen hatte, nie wieder auf einem fremden Grundstück zu malen. Sondern nur nicht mehr auf unserem.
»Du hast meinen Vater gut getroffen, die Ähnlichkeit ist verblüffend«, schob Dad nach. »Ihm hätte das Bild sicher gefallen.«
»Ich habe versucht, Sie zu malen«, sagte Moses und wich dem Blick meines Vaters aus. Ich war mir ziemlich sicher, er log, auch wenn es mir ein Rätsel war, warum. Auf jeden Fall klang es logischer, dass er meinen Dad als Inspiration verwendet hatte, denn meinen Opa hatte er bestimmt nicht gekannt.
»Also, Moses«, brachte ich mich ins Gespräch ein, »ich wollte dich fragen, ob du mir ein Bild auf meine Schlafzimmerwand malen könntest. Ich bezahl dich auch dafür. Vermutlich kann ich dir nicht so viel Geld geben, wie es wert ist, aber immerhin etwas.«
Er sah mich an und wendete den Blick gleich wieder ab. »Ich weiß nicht, ob ich das kann.«
Verblüfft startten seine Urgroßmutter, mein Dad und ich ihn an. Der Beweis, dass er es konnte, prangte groß und deutlich sichtbar auf unserem Pferdestall.
»Ich muss dazu … inspiriert sein«, meinte er ausweichend und hob die Hände, als wolle er mich von sich stoßen. »Ich kann nicht einfach irgendwas malen. So funktioniert das nicht.«
»Moses wird dir gern ein Bild malen, Georgia«, mischte sich Kathleen nachdrücklich ein und schenkte ihrem Urenkel einen warnenden Blick. »Er kommt morgen Nachmittag vorbei, dann kannst du ihm sagen, was du gerne hättest.«
Moses schob die leere Schüssel von sich und stand auf. »Das kann ich nicht.« Er wandte sich an meinen Dad. »Keine Gemälde mehr auf Ihrem Grundstück, das verspreche ich«, sagte er und verließ die Küche.
Erst zwei Wochen später lief mir Moses wieder über den Weg, und die Umstände waren dieses Mal noch unangenehmer als beim ersten Mal. Für die meisten Leute aus der Gegend ist das Ute Stampede in Juab County ein größeres Fest als Weihnachten. Drei Tage und Nächte mit Paraden, Jahrmarkt und natürlich dem Rodeo. Es fand immer am zweiten Juliwochenende statt und markierte den Höhepunkt des Sommers. Jedes Jahr zählte ich die Tage, bis es endlich soweit war. Sozusagen als Sahnehäubchen hatte ich mich dieses Jahr obendrein für das Barrelrennen qualifiziert. Meine Eltern bestanden zwar hartnäckig darauf, dass ich mich erst nach dem Highschool-Abschluss dem Rodeozirkus anschließen durfte, aber sie erlaubten mir zumindest die Teilnahme an den landesweiten Veranstaltungen in Utah, für die ich mich qualifiziert hatte. Am Donnerstagabend hatte ich gewonnen, was mich in die Championshiprunde am Samstag katapultierte, bei der ich ebenfalls gewann. Mein erster Abend als professionelles Cowgirl, und ich räumte auf ganzer Linie ab.
Um meinen Sieg zu feiern, beschloss ich, noch eine Weile auf der Kirmes herumzuhängen. Leider hatte meine Freundin Haylee, die in Nephi, etwa fünfzehn Minuten nördlich von Levan, wohnte, ihren Freund Terrence mitgebracht, den ich nicht ausstehen konnte. Er spielte ständig fiese Streiche und trug statt eines Cowboyhuts eine Truckermütze viel zu hoch auf dem Kopf.
»Du schiebst das Cap extra so weit nach oben, weil du nur so größer als wir Mädchen wirkst«, stellte ich fest.
»Große Mädchen sind nicht mein Fall«, antwortete er und schubste mich leicht.
»Na ja, in dem Fall bin ich echt froh, ein großes Mädchen zu sein.«
»Und ich erst«, erwiderte er.
»Mit dir könnte ich sowieso nicht ausgehen, Terrence. Jeder würde dich für meinen kleinen Bruder halten«, gab ich frotzelnd zurück. Dann warf ich seine dämliche Mütze in den nächsten Mülleimer und tätschelte ihm den Kopf.
Im Gegenzug feuerte er immer wieder gemeine Sticheleien auf mich ab. Ich konnte Haylee ansehen, dass sie sich wünschte, wir würden aufhören, uns zu zoffen. Mir war eh langweilig, also schob ich Hunger und das Bedürfnis nach größeren Männern vor, und machte mich vom Acker. Wie von selbst führten mich meine Schritte vom Kirmesplatz weg in Richtung der Pferche, in denen die Tiere an den drei Rodeotagen untergebracht waren.
Es war dunkel und niemand in der Nähe, doch ich wollte mir die Bullen etwas genauer ansehen. Ich hatte schon immer mal einen reiten wollen und glaubte, dass ich das auch schaffen würde. Ich kletterte auf die Stangen der Umzäunung, bis ich hinunter in die Boxen sehen konnte, die Mensch von Tier trennten. Die Arena strahlte immer noch beleuchtet, und obwohl die Boxen im Schatten lagen, konnte ich den muskulösen Rücken des Stiers ausmachen, auf dem Cordell Meecham vor wenigen Stunden geritten war. Er hatte 90 Punkte erzielt und an diesem Abend den Sieg errungen. Er hatte eine Leistung wie aus dem Bilderbuch abgeliefert – die Knie hoch angezogen, die Fersen fest an die Seiten gedrückt, den Rücken gebeugt, den rechten Arm zum Himmel gereckt, als ob er nach den Sternen greifen wollte. An diesem Abend war er der Star gewesen. Die Menge hatte gejohlt. Ich hatte gejohlt. Und als der Bulle, der Satans Alias hieß, Cordell schließlich abwarf, war der Gong bereits erklungen, und der Bulle hatte verloren. Bei der Erinnerung musste ich lächeln und stellte mir vor, ich wäre an seiner Stelle gewesen.
Die Disziplin eines Cowgirls war jedoch das Barrelrennen. Ich liebte es, auf Sacketts Rücken, die Hände in seine Mähne gekrallt, auf der Zielgeraden durch die Arena zu fliegen, als hätte mich eine Welle mitgerissen, von der ich mich ans Ufer spülen ließ. Manchmal fragte ich mich jedoch, wie es wohl wäre, ein Erdbeben zu reiten statt einer Welle. Hoch und runter, von rechts nach links, buckelnd, zitternd, eben unberechenbar wie ein Erdbeben.
Satans Alias interessierte sich nicht für mich. Ebenso wenig wie die anderen Bullen im Pferch. Der Dung roch so frisch wie das Stroh, und ich holte tief Luft. Mir machte der Geruch, bei dem andere die Nase rümpften, nichts aus. Eine Weile beobachtete ich die Tiere, dann kletterte ich vom Zaun herunter. Es war spät. Ich musste Haylee finden und zusehen, dass ich nach Hause kam. Mir ging es auf die Nerven, zu einer bestimmten Zeit zu Hause sein zu müssen, und meine Gedanken schweiften sofort in die Zukunft, in der ich tun und lassen konnte, was ich wollte, und nur mir selbst Rechenschaft schuldig war.
Als sich die dunkle Gestalt aus den Schatten löste, geriet ich nicht in Panik. Ich hatte keine Angst. Bisher hatte ich auch noch nie Grund gehabt, mich vor einem Cowboy zu fürchten. Cowboys waren die besten Menschen der Welt. Auf jedem Rodeo, ganz egal wo in Amerika, bekommt man unweigerlich den Eindruck, dass die Männer und Frauen dort im Alleingang die Welt retten könnten. Nicht, weil sie die klügsten, reichsten oder schönsten Menschen der Welt waren, sondern weil es gute, großherzige Menschen sind. Sie lieben ihre Nächsten. Sie lieben ihr Land. Sie lieben ihre Familien. Sie singen die Nationalhymne und stehen hinter jedem Wort. Sie ziehen den Hut, wenn die Flagge gehisst wird. Sie leben und lieben mit Hingabe. Also, nein. Ich war nicht beunruhigt. Ich hatte keine Angst, bis ich mit dem Gesicht auf den mit Huf- und Schuhabdrücken übersäten Boden gestoßen wurde.
Einen Moment lang war ich wie gelähmt, lange genug, damit er mir die Hände auf dem Rücken fesseln konnte wie bei einem Rodeokalb. Der Mann kannte sich offensichtlich damit aus. Ich strampelte und versuchte zu schreien. Mein Mund füllte sich mit Dreck, der nach Kuh stank und schmeckte, und ich wusste, dass ich tief in der Scheiße saß. Mein Hirn registrierte das Wortspiel sogar noch, als ich seine Hände an meiner Jeans spürte. Und das war der Moment, in dem ich total ausrastete. Der Schock wandelte sich in jenem Moment in Wut, als seine Finger Stellen berührten, an denen sie nichts zu suchen hatten. Ich schoss nach oben und knallte mit dem Hinterkopf gegen sein Gesicht. Fluchend drückte er meine Nase zurück in den Schmutz und verschnürte meine Beine mit meinen Händen, ehe er mich umdrehte. Ich befand mich in einer unmöglichen Lage, meine gebeugten Beine und Arme lagen unter mir und mein ganzes Gewicht lastete auf meinem Kopf und Nacken. Meine Oberschenkelmuskeln ächzten vor Anstrengung. Dann warf er mir auch noch Dreck in die Augen und legte mir die Hände übers Gesicht. Meine Augen brannten wie Feuer, meine Nase war mit Erde verstopft, und da seine Hände über meinem Mund lagen, bekam ich keine Luft mehr. Keuchend zappelte ich herum und versuchte, ihm in die Finger zu beißen. Der Schmerz in meinen Lungen war schlimmer als die Angst, und ich dachte, ich würde sterben. Mit einem Grunzen warf der Mann mich über seine Schulter und wollte mich forttragen. Dann schlug ganz in der Nähe eine Autotür zu, worauf er unschlüssig stehen blieb. Jemand rief meinen Namen.
Der Mann ließ mich fallen. Einfach so. Gleich darauf war er weg. Ich glaubte, ihn fluchen zu hören, als er davonrannte, und vernahm das Geräusch seiner Stiefel, die hart auf den Boden trafen. Seine Stimme konnte ich allerdings nicht erkennen. Von dem Moment, in dem er aus dem Schatten getreten war, bis zu dem Moment, in dem er verschwand, waren vielleicht sechzig Sekunden vergangen. Ganz sicher ein weiterer Rodeorekord.
Das Seil um meine Handgelenke und Füße hatte sich jedoch nicht gelockert, als er mich fallen ließ, und der plötzliche Sturz und der harte Aufprall pressten mir die Luft aus den Lungen. Keuchend und hustend rollte ich auf die Seite und spuckte Dreck. Meine Gürtelschnalle schnitt mir dabei in die Hüfte. Als er an meiner Jeans zog, hatte er meinen Gürtel gelöst. Ich konnte nicht aufstehen. Ich konnte mir nicht mal über die Augen wischen. Ich lag da wie ein Rodeokalb, gefesselt und hilflos. Mit der Schulter versuchte ich mir übers Gesicht zu wischen, um wenigstens etwas Schmutz aus den Augen zu bekommen, damit ich wieder sehen konnte. Ich musste etwas erkennen können, damit ich ihn bei einem Wiedersehen identifizieren und mich vor ihm schützen konnte. Damit ich in der Lage war, ihn anzugreifen. Ich weiß nicht, wie lange ich auf dem Boden lag. Es hätte eine Stunde sein können. Vielleicht auch nur zehn Minuten. Es kam mir jedenfalls wie eine Ewigkeit vor.
Ich hätte schwören mögen, dass jemand meinen Namen gerufen hatte. Deswegen war der Mann doch weggerannt, oder? Und dann, als hätte ich ihn durch meine Gedanken herbeigezaubert, war er wieder da. Adrenalin schoss mir erneut durch den Körper und ich wiegte und wand mich, versuchte mich zentimeterweise wegzubewegen. Ich schrie und bekam gleich darauf einen Hustenanfall. Der Schmutz, der immer noch meinen Mund bedeckte, gelangte in meine Luftröhre. Der Mann blieb stehen, als hätte er nicht erwartet, mich hier zu finden.
»Georgia?«
Er war es nicht. Das war nicht derselbe Mann.
Mit schnellen Schritten lief er auf mich zu, der Abstand zwischen uns wurde immer kleiner. Ich kniff die Augen zusammen wie ein Kind, das versucht, sich unsichtbar zu machen. Oh nein, nein, nein. Ich kannte die Stimme. Bitte nicht Moses. Bitte nicht Moses. Warum musste mich ausgerechnet Moses finden?
»Soll ich jemanden holen? Soll ich den Rettungswagen rufen?« Er wischte mir übers Gesicht, dann spürte ich ein Ziehen an den Seilen um meine Handgelenke und Knöchel und plötzlich konnte ich die Beine ausstrecken. Blut strömte mit freudig stechendem Kribbeln zurück in meine Füße, und ich fing an zu weinen. Die Tränen fühlten sich gut an, und ich blinzelte heftig, um etwas sehen zu können, während Moses das Seil um meine Hände entfernte. Und dann waren sie wieder frei, und ich stöhnte auf. Meine Arme fühlten sich völlig taub an, meine Schultern brannten vor Schmerz.
»Wer war das? Wer hat dich gefesselt?«
Ich sah überall hin, nur nicht in sein Gesicht. Aus dem Augenwinkel bemerkte ich, dass er ein schwarzes T-Shirt trug, das in einer Cargohose steckte, und dazu ein paar Armeestiefel, die kein Cowboy mit Selbstachtung auf der Ute Stampede tragen würde. Der Angreifer hatte ein Westernoutfit angehabt. Ein Hemd mit Druckknöpfen. Cowboykleidung. Ich hatte die Druckknöpfe am Rücken gespürt. Ich zitterte, und mir wurde schlecht.
»Mir geht’s gut«, log ich und schnappte nach Luft. Ich wünschte mir sehnlichst, dass Moses sich umdrehte, damit er nicht mit ansah, wenn ich kotzen musste. Mir ging’s gar nicht gut. Mir war total übel. Ich rieb mir über die Wangen und sah zu ihm auf. Suchend schweifte mein Blick zu seinen Augen, um festzustellen, ob er mir glaubte oder nicht. Aber ich schaute sofort wieder weg.
Er fragte, ob ich aufstehen könnte, und half mir, auf die Füße zu kommen. Schließlich stand ich dank seiner Hilfe auf den Beinen, allerdings so wackelig wie ein neugeborenes Fohlen.
»Du kannst gehen. Mir geht’s gut«, schwindelte ich erneut verzweifelt. Aber er ging nicht.
Ich drehte mich um und lief auf zittrigen Beinen ein paar Schritte bis zum Zaun, wo ich mich übergab. Erde, Dung und mein Rodeoburger sprudelten in einem Schwall Pepsibrühe aus mir heraus, während meine Knie nachgaben. Ich klammerte mich am Geländer fest, damit ich nicht fiel, während ich ächzend spuckte, aber Moses ging nicht. Das Schnauben und Stampfen der Bullen auf der anderen Seite erinnerte mich wieder daran, wo ich mich befand. Satans Alias und seine Freunde waren ganz in der Nähe, und ich konnte mir mühelos vorstellen, dass ich durch ein Kaninchenloch direkt in die Eingeweide der Hölle gefallen war.
»Du bist von oben bis unten schmutzig, und dein Gürtel hängt runter.« Die Feststellung kam leise, fast vorwurfsvoll. Der Ton verriet mir, dass Moses ganz und gar nicht glaubte, es ginge mir gut. Wow, welche Überraschung. Ich blieb mit dem Rücken zu ihm gekehrt stehen und schob mit steifen Fingern die Gürtelschnalle an ihren Platz zurück und dann den Gürtel durch die Schlaufen, ohne mich darum zu kümmern, dass auch der Knopf offenstand und der Reißverschluss heruntergezogen war. Das T-Shirt hing mir über die Taille, vielleicht war ihm die offene Jeans ja nicht aufgefallen. Ganz bestimmt wollte ich keine Aufmerksamkeit darauf lenken. Der Gürtel würde meine Hose schon halten. Ich schauderte.
»Jemand hat dich gefesselt.«
»Mir hat wohl jemand einen Streich gespielt«, stammelte ich, immer noch hustend und heiser und mit wunder Kehle. »Ich glaube, das war Terrence. Er hat sich vorhin über mich geärgert und vielleicht gedacht, ich würde darüber lachen oder kreischen, statt zu kämpfen. Und ich habe mich heftig gewehrt. Vielleicht wollte er mir gar keine Angst einjagen. Vielleicht wollte er mich nur wie ein Päckchen verschnüren, damit sie anschließend alle über mich lachen können. Mir geht’s gut. Wirklich.« Ich glaubte selbst nicht recht an das, was ich da von mir gab, aber ich wollte es so gern glauben.
Es war seltsam, dass ausgerechnet Moses mich befreit hatte. Irgendwie ironisch. Ein Cowboy hatte mir wehgetan und ein Unruhestifter hatte mich gerettet. Meine Mom hielt Moses für die Gefahr. Sie hatte mich vor ihm gewarnt. Dabei hatte er mich gerettet.
»Ich bin okay«, beharrte ich und richtete mich zu voller Größe auf. Ich wischte mir über die Augen und die zitternden Lippen und schämte mich für das, was Moses gesehen hatte, völlig erschüttert von der Vorstellung, was hätte passieren können. Was beinahe passiert wäre. Dass es überhaupt passiert war. Falls es wirklich ein fieser Streich gewesen sein sollte, war er fürchterlich schief gelaufen. Denn Georgia Shepherd hatte nun Angst. Und im Angsthaben bin ich nicht besonders gut. Ich wollte nach Hause. Ich wusste nicht, wo Haylee sich herumtrieb, und ich wollte auch nicht nach ihr suchen, denn immerhin bestand die Möglichkeit, dass sie in dieser Sache mit drinsteckte.
»Kannst du mich nach Hause bringen, Moses? Bitte?« Meine Stimme klang seltsam. Erschrocken wurde mir klar, dass ich mich wie ein kleines jammeriges Kind anhörte.
»Dafür muss jemand bezahlen.«
»Was?«
»Jemand muss dafür bezahlen, Georgia.« Es war merkwürdig, meinen Namen aus seinem Mund zu hören, als ob wir die besten Freunde wären und er mich ganz genau kannte. Dabei kannte er mich überhaupt nicht. Plötzlich kannte ich mich ja selbst kaum wieder. Dieselbe Stadt, dieselbe Straße. Dieselbe Welt. Aber es fühlte sich nicht mehr wie dieselbe Welt an. Und ich war definitiv nicht mehr dasselbe Mädchen. Kurz fragte ich mich, ob ich unter Schock stand. Eigentlich war nichts passiert. Mir ging es gut. Zumindest würde es mir wieder gut gehen. Wenn ich erst zu Hause war.
»Ich muss nach Hause. Mir geht’s gut«, wiederholte ich laut. »Bitte.« Jetzt flehte ich. Bettelte. Und die Tränen strömten mir erneut über die Wangen.
Er sah sich hektisch um, als wolle er um Hilfe rufen, als brauche er einen Rat, wie er mit dieser Situation umgehen sollte. Die Situation war ich. Er wusste nicht, wie er mit mir umgehen sollte. Mich nach Hause zu bringen war die einfachste Lösung, aber offenbar reichte ihm das nicht aus.
»Bitte«, drängte ich. Mit dem Ärmel meines Shirts wischte ich mir die Tränen ab. Der Schmutz hinterließ dunkle feuchte Streifen auf dem Top, das ich mir speziell für diesen Tag gekauft hatte. Ich besorgte mir immer neue Klamotten für die Stampede. Neue Jeans, neue Shirts, manchmal sogar neue Stiefel. Ein neues Outfit für das große Fest.
In der Ferne drehte das Riesenrad seine Runden; es ragte über den im Dunkeln liegenden Gebäuden auf, die die Tiere und die Arena vom Kirmesplatz trennten. Eine Brise strich mir die Haare von den Wangen und brachte den süßen Rummelplatzduft nach Zuckerwatte und Popcorn mit sich, der sich gleich darauf mit dem Geruch von Erbrochenem und Dung mischte und seine Süße verlor.
Ich schwankte leicht, der Horror der vergangenen Minuten dämmerte mir allmählich, grub sich immer tiefer in mich hinein. Ich musste nach Hause.
Moses spürte offensichtlich, dass ich allmählich in einen seelischen Abgrund stürzte, denn ohne ein weiteres Wort streckte er die Hand aus, packte mich leicht am Arm und stützte mich. Ich liebte ihn in diesem Moment mehr als ich es für möglich gehalten hätte. Weitaus mehr als unsere kurzen Begegnungen rechtfertigten. Der Unruhestifter, der Bad Boy, das Crackbaby. Er war jetzt mein Held.
Langsam ging er neben mir her und ließ es zu, dass ich mich an ihn lehnte. Als wir sein Auto erreichten, starrte ich wie blind darauf. Ich hatte seinen Jeep tagein tagaus gesehen, seit Moses vor sechs Wochen nach Levan gezogen war. Ich war neidisch auf seine coole Karre gewesen, weil ich nur einen alten Pick-up hatte, der nicht schneller fuhr als vierzig Meilen die Stunde. Doch nun war ich nicht mehr neidisch, sondern wäre vor Dankbarkeit am liebsten auf die Knie gefallen. Moses half mir sanft auf den Beifahrersitz und schnallte mich an. Ich war froh über die relative Sicherheit, die mir der Hosenträgergurt bot, obwohl ich mir schon Sorgen machte, weil der Jeep weder Dach noch Türen hatte.
»Moses, Jeep, Sitzgurt, Zuhause, Moses«, listete ich auf und merkte nicht mal, dass ich die Wörter laut aussprach. Es war mir auch egal, dass ich seinen Namen zwei Mal nannte. Er hatte sich heute zwei Listenpunkte verdient.
»Was?« Moses beugte sich zu mir und hob mein Kinn an. In seinen Augen stand Sorge.
»Nichts. Eine Gewohnheit. Wenn ich … gestresst bin, liste ich Dinge auf, für die ich dankbar bin.«
Darauf sagte er nichts, sondern sah mich nur an, während er einstieg und den Motor anließ. Immer wieder spürte ich seinen Blick auf mir, als Moses über den Schotterweg um die Pferche und Pferdeanhänger herumfuhr und dann über den Parkplatz auf die Straße.
Der Wind blies uns ins Gesicht, zerzauste mir die Haare und drückte sich gegen meinen Körper, während wir über den Highway rasten. Schnell ließen wir die Kirmes, das beleuchtete Riesenrad und das fröhliche Treiben, das mich in falscher Sicherheit gewiegt hatte, hinter uns zurück. Mein ganzes Leben lang hatte mich diese Fröhlichkeit eingelullt und angelockt. Jetzt fragte ich mich, ob ich mich jemals wieder dort hineinwagen würde.
3
Moses
Ich war wegen Georgia zum Rodeo gegangen. Nicht, weil ich eine dunkle Vorahnung hatte, dass sie mich brauchen würde, oder auch nur die leiseste Hoffnung, dass sie mich dort sehen wollte. Und ganz bestimmt hatte ich nicht damit gerechnet, sie verschnürt, voller Dreck und weinend auf dem Boden liegend zu finden, weil jemand sie verletzen oder verängstigen wollte. Oder Schlimmeres. Sie hielt das Ganze für einen Streich. Ich fragte mich, welche Art von Freunden solche miesen Streiche spielte. Aber was wusste ich schon. Ich hatte keine Freunde.
Meine Oma hatte mir am Nachmittag das Ticket mit Zugang zum gesamten Gelände mit den Worten übergegeben, dass »Georgia am Barrelrennen teilnimmt, was du bestimmt nicht verpassen willst.« Sofort schoss mir das Bild von Georgia in den Kopf, die mit fliegenden Füßen auf einem rollenden Fass balanciert, bemüht, nicht runterzufallen, während sie die Ziellinie vor den anderen Teilnehmern zu überqueren versucht.
Ich war zuvor noch nie bei einem Rodeo gewesen und hatte nicht die leiseste Ahnung, wie verrückt Weiße sich aufführen können. Allerdings hätte mir das angesichts der Tatsache, dass ich von einer weißen drogensüchtigen Mutter ausgesetzt worden war, klar sein sollen.
Eigentlich hatte ich sogar Spaß. Es herrschte eine gewisse Wohlfühlatmosphäre – es waren viele Familien anwesend, und es gab reichlich Flaggengeschwenke und Musik, bei der ich mir wünschte, ich hätte einen Cowboyhut aufgesetzt, ganz egal, wie dämlich ich damit aussah. Ich verdrückte sechs Rodeoburger, die vielleicht das Beste waren, was ich je gegessen hatte. Oma johlte, als hätte man sie gerade für »Der Preis ist heiß« ausgewählt, trampelte mit den Füßen und benahm sich generell wie eine Achtzehnjährige statt wie eine Achtzigjährige, was mir richtig gut gefiel. Lassowerfen, Reiten, Cowboys, die wie Schlenkerpuppen von buckelnden Pferden und sich im Kreis drehenden Bullen geworfen wurden, und Mädchen wie Georgia, die ritten, als seien sie im Sattel geboren worden. Ich glaubte fest, das sei bei Georgia der Fall. Ich hatte ihr viele Male beim Reiten zugesehen, wenn sie sich von mir unbeobachtet fühlte.
Seit dem Vorfall im Pferdestall war ich Georgia aus dem Weg gegangen. Ich wusste nicht, was ich von ihr halten sollte. Sie war für mich wie ein unbeschriebenes Blatt und völlig unberechenbar. Ein Kleinstadtmädchen mit einer schlichten Ausdrucks- und Denkweise, einer sehr freimütigen und direkten Art, die mich gleichermaßen an- und abtörnte. Ich wollte nicht in ihrer Nähe sein und dachte trotzdem die ganze Zeit an sie.
Mein Blick folgte Georgia, als sie auf ihrem Pferd in die Arena preschte. Sand wirbelte auf, und ihre Haare wehten im Wind. Sie umrundete die strategisch platzierten Fässer so dicht und mit einem so breiten Grinsen im Gesicht, dass ich wusste, sie genoss den Flirt mit dem Tod. Pferde bedeuteten für sie das Gleiche wie für mich die Malerei, und als sie vor meinen Augen förmlich dahinflog, stieg in mir der heftige Wunsch auf, sie zu malen. Genau so, voller Leben und Bewegung, völlig frei. Gewöhnlich malte ich, wenn die Bilder in meinem Kopf zu intensiv wurden, sich nicht länger einsperren lassen wollten und in wildem Frust aus mir heraussprudelten. Nur selten hatte ich Bilder aus purer Freude gemalt, weil mir etwas gefiel. Und Georgia, die vor dem grölenden Publikum durch die staubige Arena galoppierte, gefiel mir irgendwie.
Ich ging noch vor dem Schluss. Oma hatte mir versichert, sie könnte mit den Stephensons fahren und ich müsste nicht ihretwegen bleiben. Ziellos fuhr ich durch die Gegend und verspürte nicht den geringsten Wunsch, mich unter die Leute auf dem Rummelplatz zu mischen, Riesenrad zu fahren oder Georgia bei der Siegesfeier mit ihren Freunden zu beobachten. Ich war mir sicher, dass sie Freunde hatte. Und ebenso sicher, dass ich mich von ihnen gründlich unterschied.
Keine Ahnung, wie lange ich schon fuhr, als ich das warnende Kribbeln spürte, das immer stärker wurde, bis mein Hals und meine Ohren vor Hitze vibrierten. Ich stellte das Radio lauter und versuchte, mithilfe von Musik die Vision auszublenden. Es funktionierte nicht. Nach wenigen Sekunden tauchte ein Mann am Straßenrand auf. Er stand einfach da, sah mich an. Ich hätte ihn gar nicht sehen dürfen. Es war dunkel, die Landstraße wurde nur vom Mondlicht und den Scheinwerfern meines Jeeps beleuchtet. Dennoch stand er in einem hellen Lichtstrahl, als hätte er sich den Mondschein geborgt und sich wie mit einer Decke darin eingehüllt.
Ich erkannte ihn beinahe sofort. Und die Bilder überfluteten mich. Alle zeigten Georgia: Georgia mit ihrem Pferd, Georgia beim Überspringen von Zäunen, Georgia, die im Stall zu Boden stürzt, als ich ihr Pferd erschreckt hatte.
Immer und immer wieder sah ich Georgia fallen. Das erschreckte mich nicht. Ich hatte sie stürzen sehen. Das alles lag in der Vergangenheit. Es ging ihr gut. Dann jedoch bekam ich Zweifel, ob es ihr wirklich gut ging. Ich fragte mich, ob dieser Mann – der Mann am Straßenrand – derselbe Mann war, den ich in Georgias Stall gesehen hatte, als Sackett sich aufbäumte und Georgia mit dem Huf erwischte. Der Mann, den ich auf die Gebäudewand gemalt hatte, weil er immer wiederkam. Und ich fragte mich, ob er versuchte, mir etwas mitzuteilen. Nicht über sein Leben, sondern über das von Georgia.
Kurz entschlossen wendete ich den Jeep und fuhr zurück zum Rummelplatz. Ich stellte das Auto nicht auf dem Parkplatz ab, sondern fuhr langsam weiter, um die Außengebäude und Pferdetrailer herum, als wüsste ich genau, wohin ich wollte. Ich bildete mir ein, den Schattenmann noch einmal zu sehen – vielleicht war es aber auch nur ein kurzes Aufblitzen eines Lichtscheins. Möglicherweise ein Cowboy, der sich eine Zigarette anzündete. Jedenfalls hielt ich an, stieg aus und rief nach Georgia. Ich kam mir ziemlich dumm dabei vor und wartete einen Augenblick unschlüssig ab. Ich hatte keine große Lust, mich unter die Massen zu mischen, die sich nur hundert Schritte entfernt unter den bunten Lichtern des Rummels drängten. Als Beobachter im Dunkeln fühlte ich mich wohler.