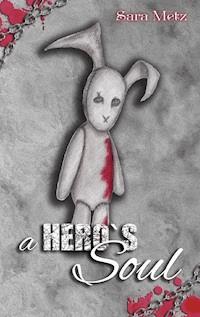
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: A Hero's Soul
- Sprache: Deutsch
Als der fünfzehnjährige Stanley von einem Halbaffen gesagt bekommt, dass er eine "besondere Seele" hat, ist die Verwirrung groß. Das Schicksal hat Stanley eine geheime Kraft verliehen, die erst zum Vorschein kommt, wenn er sich an den Ort begibt, an dem er sein Abenteuer erleben soll. Er soll den skrupellosen Geschäftsmann Boundarin aufhalten. Doch was sind Boundarins Pläne? Was haben sie mit Joghurt zu tun? Welche Kräfte wird Stanley entwickeln? Und wer ist der geheimnisvolle Mann mit den braunen Locken, der jeden seiner Schritte bereits eingeplant hat?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für alle Menschen, Tiere, Tiermenschen und sonstige Lebensformen, die das hier lesen.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
4 Tage später
7 Tage später
Preview zu Teil 2
Kapitel 1
Es hatte sich eine dünne Schicht aus zähflüssiger Schokolade am Boden des Glases abgesetzt, die Stanley lustlos mit dem Löffel hin und her schob. Er mochte keine Feiern. Aber wenn seine Eltern beschlossen, dass es einen guten Grund gab, musste Stanley durchhalten. Wenn es doch wenigstens etwas Unbedeutendes wäre! Aber der Geburtstag seiner Mutter war nicht unbedeutend, schon gar nicht für sie selbst. Die ganze Verwandtschaft war gekommen, um sich über das prallgefüllte Buffet herzumachen und zu lachen. Zum Glück musste Stanley nicht viel mehr tun, als die Zeit totzuschlagen. Ab und zu wurde er auch gezwungen, über einen schlechten Witz zu lachen, aber ansonsten musste er nur brav aussehen und fleißig Hände schütteln. Das gehörte sich schließlich so. Man darf das nicht falsch verstehen – Stanley verbrachte gerne Zeit mit seiner Familie! Doch solche Feiern waren für fünfzehnjährige Jungs einfach nicht das Richtige. Am liebsten hätte er mit seinen Eltern allein den Tag verbracht. Das tat er oft, da er keine Geschwister hatte, und er fand es eigentlich ganz gut. Sein Vater sagte ihm immer wieder, dass es unhöflich sei, während einer lustigen Feier in seinem Zimmer zu verschwinden. Stanley hatte sich die Antwort verkniffen, dass diese Familienfeiern alles andere als lustig waren. Was sollte er schon tun? Es war ja nur bis um sechs Uhr abends, dann würden die Gäste wieder ganz schnell verschwinden. Hoffentlich.
Er hatte sich ein Glas Schokoladen-Milchshake geholt und getrunken, und das, obwohl er überhaupt keinen Milchshake mochte. Wenn man ihn kannte, dann merkte man schnell, dass er Sachen aß, die er eigentlich nicht mochte, oder Sachen tat, die ihm keinen Spaß machten, wenn es ihm schlecht ging. So wie heute. Auf dieser Familienfeier. Er mochte einfach keine Familienfeiern.
Seine Mutter kam durch das Gedränge der Erwachsenen auf ihn zu. Es gab auch, abgesehen von ihm, keine Kinder oder junge Erwachsene hier, was die Sache noch ein bisschen öder machte. Er hatte aufgegeben die ganzen Verwandten zu zählen. Es kam ihm vor, als hätte er mindestens zwanzig Tanten, was eigentlich gar nicht sein konnte, weil seine Mutter überhaupt keine Geschwister hatte und sein Vater nur zwei Brüder und drei Schwestern. Wobei ‚nur‘ hier relativ war. Das war schließlich nicht gerade wenig.
Stanleys Mutter scheuchte den alten Mann, von dem Stanley überhaupt nicht wusste, wer er überhaupt war, vom Platz neben ihm und setzte sich. Sie legte einen Arm um Stanleys Schultern und tätschelte ihn am Arm.
„Gefällt es dir hier?“
Er zuckte mit den Schultern, wobei er sein mit Schokolade verschmiertes Glas nicht aus dem Blick ließ. „War die Frage ernst gemeint?“
Sie lachte und schüttelte den Kopf. „Das ist eben nichts für Teenies wie dich!“
„Ich mag es nicht, wenn man mich einen Teenie nennt“, meinte er und zwang sich zu einem Lächeln.
„Das hört sich irgendwie so… ich weiß auch nicht. Nicht richtig an, oder? Als würde ich euch alle irgendwie nervig finden und verabscheuen.“
„Und? Verabscheust du uns?“ fragte sie und runzelte in gespieltem Entsetzen die Stirn.
„Natürlich nicht. Werd’ nicht albern!“ Sie mussten beide lachen. „Allerdings ist mir langweilig. Ich verstehe kaum ein Wort von dem, was ihr redet. Sonst würde ich vielleicht mitreden. Und ich kenne die meisten der Leute hier gar nicht. Aber alle kennen sie mich! Ist das nicht gruselig?“
Sie lachte und tätschelte ihm wieder den Arm. „Nicht mehr lange, halt noch durch, ja?“ Damit verschwand sie wieder in den Massen und überließ Stanley seinem Schicksal.
Er seufzte und strich sich das honigblonde Haar von der schweißnassen Stirn. Nicht einmal einen Comic durfte er lesen, wenn Besuch da war. Das Essen durfte er auch nicht selbst kochen, was ihm einen Riesenspaß gemacht hätte. Nein, es gab nur Schnittchen mit Frischkäse und Lachs von irgendeinem Lieferanten, an die Stanley sich mittlerweile gar nicht mehr herantraute. Das Brot war ganz nass, da es anscheinend aufgetaut und halbherzig auf eine silberne Platte geklatscht worden war, die auch noch nicht einmal richtig abgespült worden war, sodass noch die Reste von Hamburgerbrötchen daran klebten.
Stanley hätte das besser gemacht, das wusste er. Er hatte so etwas schon oft gemacht, und immer hatte es frischer geschmeckt. Wenn er so darüber nachdachte, fragte er sich, wie man so etwas überhaupt verhauen konnte. Es war ihm ein Rätsel.
Es war ein warmer Sonntagnachmittag und Stanley langweilte sich. Gab es eigentlich irgendetwas, was er hätte tun können?
Er spielte mit dem geflochtenen Lederband um sein linkes Handgelenk. Stanley hatte eine ganze Reihe solcher Bänder in allen Farben und Variationen. Sein heutiges war leuchtend blau.
„Stanley!“, rief sein Vater aus der Menge zu ihm herüber. Er saß auf dem Sofa, von mindestens zehn Onkeln eingekesselt. „Könntest du losgehen und noch etwas Schokolade kaufen? Der Supermarkt hat heute Jubiläum und geöffnet.“ Er sprach es nicht aus, aber Stanley wusste, dass sein Vater ihm etwas Freiraum verschaffen wollte, ohne dass die Gäste ihn für unhöflich hielten. Er dankte ihm im Stillen und der anderen Leute wegen nickte er eifrig und stand auf.
Er zog sich sein altes, kaputtes Paar Turnschuhe an und wühlte sich mit unzähligen Entschuldigungen durch die Gäste hindurch in den Hausflur, wo er schnell die Haustür öffnete und somit den Menschenmassen entkam.
Das Haus war zwar groß und schön, lag aber etwas abseits vom Geschehen. Es stand an einer Straße, die nur von ihren Einwohnern befahren wurde, und der Supermarkt befand sich auch am anderen Ende der Stadt. Wenn Stanley ein Auto bekommen würde, wäre das kein Problem, aber natürlich war er noch zu jung, und so musste er sich mit der Bahn abfinden, zu der man ebenfalls erst einmal zehn Minuten laufen musste.
Alles in allem war die Gegend aber besser als das Stadtzentrum. Dort war es laut und schnell und überhaupt nicht nach Stanleys Geschmack. Er hätte sich kein besseres Zuhause wünschen können als sein jetziges.
Außerdem war der Fußmarsch zum Bahnhof gar nicht so schlecht. Er kam an den gepflegtesten und blühendsten Vorgärten vorbei, in denen Hummeln herumbrummten und Schmetterlinge flatterten. Es gab Blumen in allen erdenklichen Farben und Formen. Hier kam er gerne vorbei und ließ sich von dem Geruch berauschen. Manchmal riss er hier und da ein paar Blütenblätter ab und zerrieb sie zwischen seinen Fingern. Die Hummeln hatte er in der Grundschulzeit immer eingefangen und in kleinen Gläsern gehalten. Seine Mutter hatte ihm immer wieder gesagt, er solle die Hummeln freilassen. Einmal hatte er heimlich eine behalten und war todtraurig gewesen, als diese gestorben war. Jedes Mal, wenn er hier unterwegs war, dachte er daran, weil er damals so oft an diesem Ort gewesen war. Einfach nur er und ein paar alte Schulkameraden, die anschließend nacheinander alle weggezogen waren. Vielleicht kam er auch der Erinnerungen wegen so gerne her. Den genauen Grund kannte er nicht.
Der kleine Bahnhof lag genauso da, wie ein grauer, alter Schuhkarton in einer blühenden Blumenwiese. Die Wände waren bröckelig, es lag Müll herum und überhaupt schien es an diesem Ort keine Farben zu geben.
Stanley kickte ein altes, weggeworfenes Taschentuch vor seinen Füßen weg, als er, die Hände in den Hosentaschen seiner Jeans vergraben, zum Fahrkartenautomaten schlenderte. Er kramte nach Münzen und der Automat schluckte das Geld und ratterte.
Und dann hörte er hinter sich ein Geräusch, dass sich ein wenig anhörte wie ein… Er konnte es nicht anders beschreiben: ein Schnüffeln, wie das eines Hundes.
Er drehte sich reichlich verwirrt um, doch da war kein Hund. Da stand ein großer, muskulöser Mann mit einem dunkelgrauen Kapuzenpulli, von dem er die Kapuze so aufgesetzt hatte, dass sein Gesicht im Schatten lag. Stanley konnte nur einen strubbligen Backenbart, oder so etwas Ähnliches, erkennen.
„Bin gleich weg“, nuschelte Stanley, doch der Fremde lachte freundlich.
„Mach dir keinen Stress, ich habe alle Zeit der Welt.“
Stanley nickte. „Das ist gut, ich nämlich auch.“ Er holte die Karte aus dem Fach und wollte gerade schon gehen, als der Fremde ihn ansprach: „Gehst du hier zur Schule?“
Er wusste nicht, was er antworten sollte, deshalb nickte er einfach. Solange der Mann nicht mehr wissen wollte, war das in Ordnung, aber Stanley wurde misstrauisch. Wollte ihn der Mann einfach in ein Gespräch verwickeln, oder etwas anderes? Das Erste, was man im Kindergarten beigebracht bekommt, ist doch, dass man nie einem Fremden vertrauen soll. Und dazu hatte Stanley noch das Gefühl, dass ihn dieser Fremde neugierig musterte, obwohl er seine Augen nicht sehen konnte.
„Oh“, machte der Mann. „Meine Nichte geht auch hier zur Schule, vielleicht kennst du sie ja.“
„Vielleicht.“ murmelte Stanley und war heilfroh, als in diesem Moment seine Bahn eintraf und er auf die Gleise zuging. „Ich muss los“, brachte er noch hervor, bevor die Türen aufglitten und er in den Zug schlüpfte, um den Fremden hinter sich zu lassen.
Er setzte sich auf den nächstbesten Platz, auf den rauen Stoff des Sitzes, und ärgerte sich. Er ärgerte sich über sich selbst, dass er dem Fremden verraten hatte, auf welche Schule er ging. Es gab schließlich nur eine Schule in der Gegend. Aber wer weiß? Vielleicht steckte gar nichts dahinter und der Mann hatte sich bloß aus reiner Neugier erkundigt, das war schließlich nichts Ungewöhnliches. Und wenn das der Fall gewesen war, hätte er mit einer unsicheren Reaktion rechnen müssen.
Die Bahn ruckelte voran und Stanley schaute nachdenklich aus dem Fenster. Er schüttelte alle Gedanken über den Fremden ab und versuchte, an etwas anderes zu denken.
Er hatte für den nächsten Tag schon seine Hausaufgaben erledigt, wenn auch nicht alle. Physik war nichts für ihn. Weder der mürrische Lehrer, noch das Fach, und die Hausaufgaben verstand er ohnehin nicht. Abgesehen von Physik war er recht gut in der Schule und kam problemlos mit.
Als er im Supermarkt ankam, war der Fremde schon fast vollkommen aus seinen Gedanken verschwunden und er machte sich keine Sorgen mehr. Er fühlte sich so sicher, wie man sich nur in einem öffentlichen Supermarkt fühlen konnte, und ihm ging es fantastisch. Wenn er Glück hatte, waren die ersten Gäste schon am Gehen, wenn er mit der Schokolade ankam.
Stanley mochte Schokolade nicht besonders, aber sein Vater nahm immer die mit Nougatcreme: besonders klebrig auf der Zunge. Für die anderen Gäste steckte er noch einmal die normale Milchschokolade in den Einkaufskorb, nur falls diese noch da waren, was höchstwahrscheinlich der Fall war. Und die Gäste waren hungrig! Das komplette Buffet mit den ungenießbaren Schnittchen war bei jeder Feier hinterher wie leergefegt. Und nicht nur das. Der Kühlschrank war immer geplündert und von den Süßigkeiten gab es auch keinen einzigen Krümel mehr.
Er zahlte die Schokolade und kaufte nebenbei noch Pappförmchen für Muffins. Das letzte Mal hatte er sich geärgert, weil keine da gewesen waren, und das war ihm gerade auf dem Weg zur Kasse glücklicherweise noch rechtzeitig eingefallen.
Auf dem Rückweg geschah nichts Ungewöhnliches. Selbst der Mann mit dem Kapuzenpulli ließ sich nicht blicken, was Stanley aufgefallen wäre, hätte er ihn nicht längst wieder vergessen. Die Hummeln brummten und die Bienen summten und es war alles wie immer.
An der Haustür klingelte er. Er hatte extra keinen Schlüssel mitgenommen, weil er sicher sein konnte, dass jemand zu Hause war.
Ihm öffnete diesmal leider kein Unbekannter, sondern jemand, den er nur zu gut kannte. Auch wenn er ihren Namen nicht wusste, wollte die füllige Tante mit der großen Klappe und den verschwitzten Händen einfach nicht aus seinem Gedächtnis. Und er musste ihr immer, wie auch jetzt, eben diese verschwitzten Hände schütteln. Aber Stanley sagte nichts, schließlich waren seine nicht weniger verschwitzt.
„Stan! Da bist du ja wieder! Leider ist der Wackelpudding ausgegangen, den du so gern magst!“ Ihn nannte eigentlich niemand Stan und Wackelpudding mochte er auch nicht wirklich gern. Er kochte lieber selbst.
Er ließ sich nichts anmerken, lächelte und zuckte mit den Schultern. „Das geht schon in Ordnung. Ich habe sowieso keinen großen Hunger.“
„Ach, du bist so ein guter Junge!“ Sie winkte ihn herein. Im Großen und Ganzen war sie ja nett.
Er betrat das Wohnzimmer, suchte sich einen Platz, an dem er einen guten Überblick über die Menge hatte, und lehnte sich unter einem bunten Bild an die Wand.
Die Schokolade holte sein Vater nach einigen Minuten ab.
„Danke, Stanley!“ Und etwas leiser fügte er hinzu:
„Du kannst ja mal rüberkommen. Ich könnte ein Gespräch über… sagen wir Comics einfädeln, da kannst du doch mitreden, nicht wahr?“
Stanley hob die Augenbrauen. „ Das wäre echt nett.“
„Super!“ Sein Vater klatschte in die Hände. „Komm gleich zum Sofa, bis dahin ist das Gespräch in vollem Gange und Schokolade habe ich auch genug.“ Er freute sich wie ein kleines Kind, worüber Stanley laut lachen musste, und dann schwirrte er ab und Stanley brachte die Förmchen in die Küche und stopfte sie in den Schrank. Die Küche war der einzige Ort, an dem sich niemand aufhielt, mit Ausnahme von seinem Zimmer, welches er vor der Feier abgeschlossen hatte.
In die Küche drangen nur gedämpft die lachenden Stimmen durch die geschlossene Tür und Stanley hatte Zeit, um noch einmal durchzuatmen. Da er das aber zuvor schon bei dem Einkauf getan hatte, ging es ihm relativ gut und er räumte noch ein, zwei dreckige Teller in die Spülmaschine, bevor er sich auf die Socken machte und ins Getümmel stürzte.
Bis zum Sofa war das schwerer, als man denken mochte, denn es standen und saßen wirklich überall nur Gäste herum, lachten, aßen und tranken. Sie standen wie eine riesige Mauer zwischen Stanley und dem Sofa und machten keine Anstalten sich zu bewegen, egal wie oft Stanley sich entschuldigte und sagte, er müsse mal durch. Er versuchte, den Leuten auf die Schulter zu tippen, was auch funktionierte. Allerdings kippte eine Frau vor Schreck nach vorne und stieß gegen ihre Gesprächspartner. Alle lachten und er nutzte den Moment und bahnte sich seinen Weg zum Sofa. Sein Vater saß da am ausgeschalteten Fernseher und plauderte mit drei Männern. Einer war noch jung, ein anderer etwa so alt wie sein Vater und der dritte sah ungewöhnlich alt und faltig aus. Stanley setzte sich zu ihnen.
„Da ist er ja! Das ist mein Sohn Stanley. Stell dir vor, wir haben gerade über dich geredet!“ rief sein Vater.
Der Jüngste runzelte die Stirn. „Haben wir nicht gerade über meinen Sommerurlaub gesprochen?“
„Ach, das wirst du dir nur eingebildet haben. Wusstet ihr, dass Stanley eine große Sammlung von Comics hat? Er liest sie sehr gerne. Ist das nicht toll?“ Er klopfte Stanley auf die Schulter und lächelte in die Runde.
Der Jüngste hob die Hände. „Von Comics verstehe ich gar nichts. Machst du Sport? Mit Sport kenne ich mich aus!“
„Nicht wirklich…“, sagte Stanley.
„Comics. Immer diese jungen Leute mit ihren Comics! Als ich noch jung war, da bin ich am liebsten Fahrrad gefahren, das war Kindheit!“, grunzte der Alte.
Sein Vater schaute hilflos in die Runde. Da meldete sich der Zweitälteste: „Meine Tochter liebt Comics!“
Endlich lächelte sein Vater. „Na, das ist doch prima! Eine andere Comicliebhaberin! Worin liegen denn ihre Vorlieben, was Comics betrifft? Stanley würde das sicher gerne hören.“
Der andere Mann lächelte nun auch freundlich und faltete die Hände in seinem Schoß. „Sie liest immer die Comics in den Pferdezeitschriften, die man im Supermarkt kaufen kann. Sie ist ganz wild darauf!“
Stanleys Vater runzelte die Stirn und sah Stanley an. Dieser zuckte nur mit den Schultern, drehte sich um und ging, um sich noch einen Milchshake zu holen.
Kapitel 2
Der nächste Tag war, bis auf eine klitzekleine Ausnahme, ein ganz normaler Schultag. Es war ein guter Tag, vielleicht ein besserer als sonst.
In der Mathearbeit hatte er eine Zwei geschrieben und sein Stundenplan war für einen Montag ziemlich gut. Zum Mittagessen gab es Quarktaschen, wofür er sehr dankbar war. Die Quarktaschen schmeckten in der Cafeteria immer gut.
Er saß alleine an seinem Lieblingstisch nahe der Essensausgabe, das leere Tablett stand auf dem Tisch. Er saß auf der Bank, hatte aber dem Tisch den Rücken zugekehrt, und las in einem Comic. Er saß oft so da, aber das fand er gar nicht langweilig oder so. Er wurde auch fast nie angesprochen, deswegen wunderte es ihn, als sich jemand vor ihn stellte und seinen Schatten auf die bunten Seiten des Comicheftes warf.
„Was liest du da?“, lispelte die Person. Stanley schaute auf.
Da stand ein asiatisch aussehender Junge, vielleicht Japaner. Er war nur etwa zwei oder drei Jahre jünger als Stanley, doch er war recht klein. Er hatte eine Stupsnase und lispelte sehr stark beim Sprechen.
„Nur einen Comic“, antwortete Stanley.
Der Junge nahm ihm den Comic ab und schaute auf das Titelbild. „Bist du nicht ein bisschen zu alt für so etwas?“
Stanley zuckte mit den Schultern. „Ist man je zu alt dafür?“
„Wahrscheinlich nicht.“ Der Junge grinste und gab ihm den Comic wieder. „Ich bin Jakey.“
„Stanley. Ich habe dich hier nie gesehen, tut mir leid.“
„Nein, nein, ich bin doch neu hier. Erst seit heute.“ Er grinste noch immer. „Sag mal, liest du so was sehr gerne? Find ich cool! Ich muss hier erst einmal die Leute kennenlernen, alle meine Kumpels sind nicht auf dieser Schule. Und Franklin, das Genie, ist schon fertig und will lieber zu Hause bleiben.“
„Kenn ich“, murmelte Stanley.
„Na, du kennst ja jetzt mich, oder?“
Jakey ließ sich neben Stanley auf die Bank fallen. „Magst du Eis? Ich liebe Eis. Willst du ein Eis? Ich kann dich nach der Schule mitnehmen und dir ein Eis spendieren. Willst du?“
Er konnte nicht anders, er mochte Jakey irgendwie. Jakey war gesprächig. Er nickte. „Klar.“
„Okay. Warte dann einfach vor dem Chemieraum auf mich.“ Als er ‚Chemieraum‘ sagte, hatte Stanley das Gefühl, als würde Jakey ihn anspucken. Es hörte sich in etwa an wie ‚Shemieraum‘.
„Klar, mach ich. Danke, ist echt nett von dir.“
„So bin ich halt!“ Er klopfte sich auf die Brust. Das Lispeln macht ihn irgendwie sympathisch, dachte Stanley, das hört sich immer spaßig an.
„Was machst du denn hier den ganzen Tag?“, fragte Jakey. „Hast du Geschwister? Und schaust du gerne Fernsehen? Ich mag Fernsehen. Aber Franklin mag kein Fernsehen, kannst du dir das vorstellen? Mein Kumpel Franklin, der sagt doch tatsächlich, dass Fernseher nur zum rumbasteln gut sind. Ich kann das nicht verstehen. Wie stehst du dazu?“
„Ich kenne deinen Kumpel zwar nicht, aber er wird seine Gründe haben, oder?“, meinte Stanley.
„Ja, bestimmt. Der Kerl bastelt immer. Du würdest ihn aber bestimmt mögen! Franklin redet auch so wenig wie du. Oder rede ich zu viel? Na, kann beides sein. Ich muss euch zwei unbedingt mal einander vorstellen! Aber erst, wenn ich die Gelegenheit dazu habe.“
An dieser Stelle schrillte die Schulglocke und Jakey sprang auf. „War nett, dich kennengelernt zu haben! Bis später!“
„Bis später.“ erwiderte Stanley und unterdrückte ein Grinsen, als Jakey weghoppelte. Was für ein eigenartiger Junge! Er würde ihn heute Nachmittag wiedersehen und aus irgendeinem unerklärlichen Grund freute er sich schon wie ein Schneekönig.
Er machte sich auf zu seiner Englischstunde im Klassenraum, der, wie auch die Cafeteria, im Erdgeschoss lag. Er brachte sein leer gefuttertes Tablett weg und von da an waren es nur noch zwei Minuten, bis er an der Tür zum Klassenraum ankam und sich drinnen auf seinen Platz in der ersten Reihe setzte. Er holte sein Heft und sein Buch heraus und lehnte sich zurück, bis sein Lehrer, Mr Vent, ins Zimmer trat.
Mr Vent war noch sehr jung und so gut wie immer im Stress. Er sah immer müde aus und seine blonden Haare machten den Anschein, als würde er sie sich morgens stundenlang raufen. Stanley mochte Mr Vent und Mr Vent sah in Stanley einen sehr guten Schüler und war genauso freundlich zu Stanley, wie Stanley zu ihm. Nur der Rest der Klasse nutzte Mr Vents Verwirrung aus, um sich um die Hausaufgaben zu schummeln oder Arbeiten von selbst zu verschieben, indem sie ihm weismachten, er habe sie eine Woche später angekündigt als es normal der Fall war. Und da der Lehrer genau wusste, dass er zerstreut und schusselig war, glaubte er es. Stanley machte da nicht mit. Er fand, so etwas war pures Ausnutzen. Doch er wies Mr Vent auch nicht darauf hin, dass die anderen nicht die Wahrheit sagten. Das hatte er anfangs immer getan, doch seine Mitschüler hatten sich wie die Raubtiere über ihn hergemacht und ihn die gesamte Woche lang nur angeschwindelt. Seitdem erzählte er dem Englischlehrer nur von den Lügen der anderen, wenn diese gerade nicht hinsahen oder hinhörten, was reichlich selten geschah. Das war etwas, was sie ebenfalls mit Raubtieren gemeinsam hatten. Wenn es um ihre Beute ging, hatten sie ihre Augen und Ohren überall.
Mr Vent legte seine Unterlagen auf das Lehrerpult. Heute trug er ein rosafarbenes Hemd mit mittellangen Ärmeln und einer locker gebundenen Krawatte.
Mehr als die Hälfte der Klasse war noch gar nicht da. In der letzten Reihe saß ein Mädchen namens Miyu und kaute mit gelangweilter Miene einen Kaugummi. In der ersten Reihe ganz rechts an der Tür saß Ole, ein Typ wie ein Schrank, und bohrte in der Nase. Und direkt links neben Stanley saß sein Schulranzen, sonst niemand. Er selbst saß direkt vor dem Pult.
„Guten Tag, Mr Vent“, grüßte er.
Sein Lehrer schaute auf. „Oh, hallo Stanley! Hattest du ein schönes Wochenende?“
Er zuckte die Schultern. „Es ging. Aber es war immerhin ein Wochenende. Dafür, dass es nicht perfekt war, war es einfach viel zu schnell vorbei.“
„Oh ja.“ Mr Vent nickte. „Ich hatte, so wie es aussieht, gar kein Wochenende. Aber ich freue mich, dass dir deines einigermaßen gefallen hat.“ Man sah ihm an, dass er wohl bis spät in die Nacht noch Arbeiten korrigiert hatte. Er hatte dunkle Schatten unter den Augen.
„Das können Sie bestimmt irgendwann noch nachholen, Mr Vent.“
Der Lehrer seufzte lächelnd. „Das hoffe ich. Wo sind eigentlich die anderen Schüler?“
„Wahrscheinlich haben sie sich selbst die Mittagspause verlängert.“
„Schon wieder? Hab ich das eigentlich schon beim Direktor angesprochen? Das weiß ich gar nicht mehr. Vielleicht sollte ich heute hingehen. In dieser Klasse sind echt nur Problemkinder. Oh, natürlich nicht du, Stanley. Du bildest die Ausnahme.“
Stanley lächelte. „Danke, Sir.“
Die Schüler kamen erst zwanzig Minuten später und damit war die Stunde schon halb rum. Am Ende lasen sie nur einen Sachtext über Überbevölkerung in Indien und beantworteten schriftlich Fragen dazu.
Das hatte Stanley relativ schnell erledigt, noch bevor die anderen überhaupt angefangen hatten. Doch da war die Stunde schon wieder vorbei und die Schüler sprangen johlend auf die Tische, als Mr Vent den Raum verließ. Nur Stanley nicht. Der saß nur da und vergrub das Gesicht in den Händen, als seine Mitschüler anfingen zu tanzen und zu kreischen.
Die Schule war noch nicht aus. Das war normalerweise der Punkt des Tages, an dem jeder normale Mensch in so einer Klasse die Nerven verlieren würde, doch Stanley war an das Theater gewöhnt. Früher fand er das alles ganz lustig, wie optimistisch seine Mitschüler waren, doch dann wurde ihm immer mehr bewusst, dass unter den Taten eben dieser Schüler andere Menschen litten. Und das waren meist Lehrer, die versuchten, den wilden Haufen zu bändigen und sich höchstwahrscheinlich nach der Schule in den Schlaf weinten. Und die Eltern, die schon die Bilder vor sich hatten, was einmal aus ihren Kindern werden würde. Und das waren keine guten Bilder.
Die letzte Stunde hatten sie Geschichte bei einer Lehrerin mit sehr starkem spanischen Akzent, sodass sie meist keiner verstand. Ihren Namen hatte sie zu Anfang mal gesagt, aber auch den hatte keiner verstanden und sich somit auch nicht gemerkt. Aber das war kein Problem, alles Notwendige stand schon irgendwo im Buch, im Notfall lasen die Schüler vor Arbeiten einfach darin ein paar Seiten.
Die Stunde endete mit einer zehnminütigen Standpauke der Lehrerin, weil in der letzten Reihe ein paar Mädchen schwätzten. Jedes zweite Wort war auf Spanisch, sodass man noch weniger verstand als sonst. Aber es klang auf jeden Fall wütend.
Danach war es vorbei und alle stürmten hinaus. Stanley hatte seine Hefte und sein Buch schon in den letzten Minuten eingepackt, sodass er jetzt ganz gemütlich aufstehen und gehen konnte. Er stieg die Treppe am anderen Ende des Ganges hoch, wo es zu den Räumen für Naturwissenschaften ging, also auch zu dem Chemieraum, der so ziemlich am Anfang des Flures lag. Dort ging gerade erst die Tür auf und einige jüngere Schüler als Stanley, trotteten heraus. Unter ihnen musste auch Jakey sein, das hatte er ja selbst gesagt.
Stanley wartete, doch irgendwann kamen keine Schüler mehr nach. Er spähte durch die halb offenstehende Holztür, doch der Raum war leer, außer der jungen Chemielehrerin mit den dunklen Haaren, die gerade Blätter sortierte. Sie schaute auf. „Nanu? Kann ich etwas für dich tun?“
Stanley überlegte. „Also, ein Schüler hat mir gesagt, dass er nach der letzten Stunde beim Chemieraum ist. Ich sollte ihn hier treffen.“
„Wie heißt er denn? Vielleicht ist er an dir vorbei gegangen?“
„Jakey.“
Die Frau runzelte die Stirn. „In dieser Klasse war kein Jakey.“
„Aber was-…“, setzte Stanley an, doch weiter kam er nicht. Hinter ihm im Flur schlug eine Tür zu. Er drehte sich um und sah Jakey auf dem Gang, der sofort wieder grinste. „Hallihallo!“
Stanley verabschiedete sich von der Lehrerin und schloss die Tür. Dann wandte er sich an Jakey. „Hattest du Biologie?“
„Nö, ich hatte Chemie, das habe ich doch vorhin gesagt! Hast du dir heute Morgen die Ohren nicht geputzt? Wir haben Oxidationen durchgenommen!“
„Aber du kommst aus dem Biologieraum…“
„Oh…“ Er drehte sich um und betrachtete das Schild neben der Tür. Dann zuckte er mit den Schultern. „Dann hatten wir wohl Bio. Mein Fehler.“
„Aber du hast doch gerade gesagt, dass ihr Oxidationen-…“
„Dann haben wir eben das Thema Innenohr durchgenommen. Das war in Bio, richtig? Ja, das hatten wir dann halt.“
Stanley hob eine Augenbraue. „Aber…“
„Was?“ Jakey zeigte nicht die geringste Spur von Unsicherheit. Er stand da und lächelte frech.
„Ach, nichts“, murmelte Stanley schließlich. „Kommst du?“
„Na klar!“ Sie gingen zurück zur Treppe, dann verließen sie das Schulgebäude, gingen über den Schulhof mit der bunten Kletterwand und verließen das Gelände. Erst, als sie die Straße überquerten, fiel Stanley etwas anderes Irritierendes auf.
„Wo ist eigentlich deine Schultasche?“, fragte er.
„Keine Ahnung. Verloren, oder so?“
„… oder so?“
„Na, es treiben sich genug Kriminelle hier rum, sie könnte doch auch gestohlen worden sein, oder?“
„Und das weißt du nicht?“
„Nö“, meinte Jakey knapp. Stanley überkam das komischste Gefühl der Welt. Er misstraute diesem netten Jungen. Er war sich nun sicher, dass er gar nicht auf seine Schule ging. Stanley wollte wegrennen, aber er war überhaupt nicht schnell und sportlich. Jakey war zwar etwa einen Kopf kleiner, hätte ihn aber mit zwei kleinen Sprüngen eingeholt und sich wie ein Äffchen an ihn geklammert, wenn er tatsächlich irgendetwas von Stanley gewollt hätte. Aber was würde er schon wollen? Jakey war nur ein netter Junge, der Stanley zu einem Eis einladen wollte, weil sie sich so gut verstanden. Nichts weiter. Kein Überfall, keine Entführung – nichts. … Oder?
Die Eisdiele war bei Schülern sehr beliebt. Sie war komplett im amerikanischen Stil eingerichtet und die Bedienungen fuhren auf Rollschuhen.
Die Jungen betraten das Eiscafé und suchten sich einen Platz am Fenster. Stanley bestellte sich eine Kugel Zitroneneis im Becher, Jakey hingegen nahm die dreifache Portion mit Schokolade und Sahne dazu. Er sah viel zu dünn aus, für eine Person, die so viel aß. Ganz im Gegenteil zu Stanley, der in Sachen Essen sehr wählerisch und doch etwas kräftiger war. Nicht dick, aber kräftig, das ist ein Unterschied, so sagte Stanley immer.
„Na, was hast du denn? Du siehst so verkrampft aus?“
Stanley konnte tatsächlich keinen Muskel rühren, als er den großen Mann sah, der sich da hinter Jakey an den Nachbartisch setzte. Ein muskulöser Mann mit einem grauen Kapuzenpulli, dessen Kapuze er sich über den bärtigen Kopf geschlagen hatte. Es war derselbe Mann, den Stanley am vorigen Tage am Bahnhof getroffen hatte. Er erinnerte sich sofort wieder und bekam eine Gänsehaut. Irgendetwas war hier mächtig faul.
„Stanley? Stimmt was nicht?“
„Ich muss hier raus“, stieß er hervor und wollte aufstehen, doch Jakey hielt plötzlich sein Handgelenk umklammert und lehnte über den Tisch.
„Was soll das?“, zischte Stanley. „Lass mich los!“
„Warte doch mal!“
Der große Mann stand von seinem Tisch auf und stellte sich neben Jakey. „Das ist er. Dank dir, Jakey. Sein Name?“
„Er heißt Stanley“, antwortete Jakey.
Stanley wurde blass. „Was… was soll das?“, krächzte er tonlos.
„Keine Sorge, wir tun dir nichts. Jakey hier hat mir nur geholfen, dich wiederzufinden. Wir müssen dich mitnehmen und mit dir reden!“
„Wieso hier? Hier sind überall Leute! Die werden nicht zulassen, dass ihr mich entführt!“
Der Mann seufzte. „Zum einen ist das hier keine Entführung. Zum anderen… schau dir die Leute an. Macht auch nur irgendjemand den Eindruck, dir helfen zu wollen?“ Die Stimme des Mannes klang überhaupt nicht bedrohlich, gar nicht böse, kein bisschen.
Stanley sah sich um. Einige der Gäste schauten mit gerunzelter Stirn zu ihnen herüber, doch niemand kam zu ihnen. Kein einziger. Niemand würde Stanley helfen. Gegen den großen Mann hatte er keine Chance zu entkommen, und so entspannte er sich und Jakey lockerte seinen Griff.
„Wenn das keine Entführung sein soll, was ist es dann?“, fragte er leise.
Jakey lächelte freundlich. Nicht fies oder böse, was Stanley überraschte. „Wir reden nur. Wir lassen dich natürlich wieder gehen. Es ist nur sehr wichtig.“
„Woher weiß ich, dass ihr nicht lügt?“
Er war sich sicher, dass der Mann ihn unter der Kapuze ansah. „Du bist doch ein schlauer Junge, oder? Dann sag uns mal, was würde es uns nützen, wenn wir dich belügen? Du würdest es doch sowieso merken, wenn wir dich nicht gehen ließen, oder?“
Das machte Sinn. „Ich komme mit. Aber nur, wenn ich heute Abend wieder gehen kann!“
„Nützen dir die Forderungen etwas?“
„Wahrscheinlich nicht, ihr würdet mich einfach mitnehmen, oder?“
Der Mann lachte leise. „Ja. Aber gut, wir versichern dir, dass du heute Abend wieder gehen kannst.“
Jakey ließ los und Stanley betastete sein Handgelenk. Für einen so kleinen Jungen hatte Jakey einen erstaunlich festen Griff.
„Mein Wagen parkt auf der anderen Straßenseite“, meinte der Mann. Er rief eine Bedienung heran, die bei ihnen schlitternd zum Stehen kam und er bezahlte die Eisbecher der beiden Jungen. Er nickte ihnen zu und sie verließen alle drei das Café.
Der Wagen auf der anderen Straßenseite war ein grauer Lieferwagen, nicht besonders groß, aber dafür ziemlich hässlich. Stanley musste nach hinten, wo er sich in den Lagerraum setzte und nervös durch die Frontscheibe starrte. Der Mann setzte sich hinter das Steuer und Jakey hüpfte neben ihn auf den Beifahrersitz.
„Wie ist dein ganzer Name?“, fragte der Große, als er sich anschnallte.
„Stanley Shewster“, murmelte er.
„Ich heiße Saul. Saul Baxter. Du darfst mich Bax nennen, das macht fast jeder, außer den Leuten, die ich nicht mag. Die mögen mich nämlich auch nicht und haben sich lieber eine Reihe nervtötender Beleidigungen als Anrede für mich einfallen lassen. Nicht wahr, Jakey?“
Stanley sah, wie dieser nickte. „Das ist echt lustig! Ich mag deinen Spitznamen von Aruso. Der nennt dich Dschungelmensch, oder?“
„Oder der von Boundarin. Der sagt immer Yeti zu mir.“
„Yeti? Wie kommt der denn auf Yeti?“
„Das musst du ihn selbst fragen. Hey! Ich hatte Vorfahrt!“
Jakey lachte ironisch. „Ja, das werde ich ganz bestimmt. Weil man mit dem Typen immer so viel Spaß hat, ja? Ich werde mich dem nicht mehr bis auf zweihundert Meter nähern! Das kannst du vergessen!“
„Wer sind denn diese Leute?“, fragte Stanley von hinten.
Bax seufzte. „Ich hoffe, die wirst du nie kennenlernen.“
Natürlich war er durch die Antwort nicht schlauer als vorher. Doch jetzt fragte er erstmal: „Und wieso?“
„Die sind nicht nett. Und wir mögen sie nicht, wie du ja schon weißt. Und da sie uns auch nicht mögen, läuft es zwischen ihren und unseren Leuten nicht so gut.“
„Nicht so gut?“, wiederholte Jakey. „Ich glaube da läuft gar nichts. Die hassen uns und wir hassen sie. Du musst hier übrigens links fahren.“
„Sicher?“
„Du fährst hier schon wie lange herum? Und du kennst noch immer nicht den Weg?“
„Weil du mich immer zwingst, dir auf dem Weg einen Burger mitzubringen. Dann muss ich nämlich nach rechts.“
Er winkte mit der Hand ab und lispelte: „Ja, gut, ich bin schuld. Da sind wir doch schon!“
Der Lieferwagen kam ruckelnd zum Stehen. Bax öffnete die Fahrertür und Stanley konnte nur noch sehen, wie er sich die Kapuze vom Kopf nahm. Er versuchte einen Blick auf sein Gesicht zu erhaschen, doch er sah Saul Baxter erst zum ersten Mal von vorne, als dieser Stanley die große Tür am anderen Ende des Wagens öffnete. Unwillkürlich fuhr Stanley zurück und stieß ungläubig die Luft aus.
Baxters Gesicht war etwas… ungewöhnlich. Der Backenbart war dunkelbraun, genauso, wie das Haar auf seinem Kopf, an den Seiten seines Kopfes und eigentlich überall. Sein Gesicht blieb frei. Seine Augen waren dunkel und irgendwie sahen sie aus, wie die Augen eines Hundes und schienen nur aus Pupille und Iris zu bestehen. Er hatte sehr schmale Lippen und eine flache Nase mit dünnen Nasenlöchern.
„Keine Panik, ich bin die Reaktion gewöhnt.“
„Nimm das bitte nicht persönlich, aber du siehst aus wie…“
„… ein Affe“, lispelte Jakey den Satz zu Ende. „Was gar nicht so falsch ist, denn Bax ist so etwas wie ein Affe.“
„Ich bin nicht komplett Affe, Jakey.“
„Dann eben nur halb. Aber keine Sorge, er ist doch ganz nett, oder? Er ist sogar so nett, dass er mir das nächste Mal bestimmt wieder einen Burger mitbringen wird. Oder, Bax?“
Bax ignorierte seine Frage. „Stanley, hab keine Angst und komm einfach mit. Ich tu dir nichts. Vertrau mir ruhig.“ Er streckte seine kräftige Hand aus. Oben drauf wuchs auch dunkles Haar. Stanley nahm die Hand. Er sprang aus dem Lieferwagen und Bax lächelte ihm mit schmalen Lippen zu. „Komm einfach mit. Siehst du das Haus da drüben? Da gehen wir hin und wenn du zugehört hast, darfst du wieder gehen. Wir wollen nur mit dir reden.“
Stanley nickte unsicher und folgte den beiden zu einem schönen Wohnhaus. Der Teil einer Außenwand dieses Hauses bestand aus Glas, der Rest aus Holz und man konnte die gemütlichen Möbel sehen. Ein weißes Sofa, ein weißer Sessel, ein schöner, hölzerner Couchtisch.
Es stand an einer Landstraße mitten im Feld. Hier fuhren nicht viele Autos vorbei, deshalb hatte Bax auch seine Kapuze abgezogen.
So nett Bax auch war, Stanley hielt sich lieber an Jakey. Er hatte ein wenig Angst vor Baxters Äußerem, vor der Situation und vor dem, was ihm gleich noch bevorstand. Alleine in einem großen Haus mit einem Angst einflößenden Ungeheuer! Und einem Halbaffen auch. Aber zu Jakey hatte Stanley irgendwie auch das Vertrauen verloren, Bax war wenigstens gleich zur Sache gekommen. Auch, wenn er noch immer sehr… seltsam wirkte. Stanley hatte noch nie gehört, dass es so etwas wie Halbaffen gab und das verwirrte ihn reichlich. Er war ein schlauer Junge, und man konnte schließlich nicht alles wissen, aber von Halbaffen hätte er sicher gehört. Das war so ungewöhnlich, dass er sich fragte, wieso nicht jeden Tag eine Dokumentation über Halbaffen im Fernsehen lief, oder Artikel in der Zeitung standen.
Sie gingen bis zur Haustür und Bax zauberte einen Haustürschlüssel aus seiner Hosentasche. Er schloss auf und gebot Stanley mit einer Geste einzutreten. Mit kurzem Zögern ging er in den Hausflur.
Das Haus war von innen mindestens genauso schön wie außen. Bunte Teppiche lagen auf den Holzfliesen, einige farbenfrohe Bilder hingen an den Wänden und es war die pure Gemütlichkeit. Im ersten Stock gab es eine Küche mit Esstisch. Das konnte Stanley sehen, weil er vom Sofa aus nur nach oben zu schauen brauchte. Dort fehlte ein Stück der Decke des Erdgeschosses und am Essbereich war ein Geländer angebracht, an dem man nach unten sehen konnte. Die Decke darüber war hoch und ebenfalls aus Holz, die Dachbalken spannten sich darunter wie ein riesiges Netz. Und natürlich gab es da noch die Glaswand. Sie war nicht besonders breit, nur etwa drei Meter, doch sie zog sich bis unter das Dach und ließ das Wohnzimmer und die Küche darüber im hellsten Tageslicht erstrahlen.
Stanley merkte, dass er vor Begeisterung den Mund offen hielt. Er wandte sich an Bax. „Das ist… der Wahnsinn!“
„Schön, oder? Es ist ein wirklich sehr hübsches Haus und ich glaube, das ist einer der Orte, an dem ich am liebsten bin.“
„Ich auch!“, meinte Jakey. „Der Kühlschrank ist immer voll!“
„Aber nur, weil Minnie so oft einkaufen geht, um deinen Magen zu stopfen.“
„Wer ist Minnie?“, fragte Stanley.
Jakey nickte ihm zu. „Minnie Wesser, die kleine Schwester von Franklin. Ich habe dir von ihm erzählt, weißt du noch. Ist Franklin eigentlich zu Hause?“
Bax antwortete mit einem Schulterzucken.
„FRANKLIN!“ Jakeys Stimme hallte durch das riesige Haus und die anderen Beiden zuckten zusammen.
„Musste das sein?“, fragte Bax ihn genervt.
„Ja. Franklin!“
Und dann rumpelte es von einer Tür im Flur her. Sie öffnete sich und Stanley sah, wie ein Junge gerade die Treppenstufen zum Keller hinter sich ließ und zu ihnen kam. Er war groß und dünn wie ein langgezogener Kaugummi. Der Teenager war etwa siebzehn Jahre alt, hatte ein pickliges Gesicht und kurzes, mausbraunes Haar. „Was gibt‘s?“, brummte er und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er hielt inne, als er Stanley sah. „Ist er das?“
„Ja!“, antwortete Jakey selbstbewusst und stemmte mit übertriebenem Stolz die Hände in die Seiten. „Wir haben ihn wiedergefunden. Was sagst du jetzt? Jetzt schuldest du mir fünf Mäuse!“
„Wir haben überhaupt nicht gewettet“, sagte der Junge namens Franklin und schüttelte Stanley die Hand. „Hi.“
„Hi“, antwortete dieser unsicher. Das „Ich bin Stanley.“ kam automatisch danach, weil ihn bis jetzt immer alle von diesen Leuten zuerst nach seinem Namen gefragt hatte. Von Franklin kam nur ein wenig interessiertes: „Cool.“ Danach wandte er sich an Baxter. „Hast du schon mit dem geredet?“
„Noch nicht. Stanley? Am besten setzen wir uns auf das Sofa, in Ordnung?“
Stanley nickte. Dann setzten sich alle vier hin, Franklin in einen Sessel und die anderen drei auf das Sofa. Dann fing Bax an zu erzählen:
„Weißt du, als ich dich gestern getroffen habe, – Du erinnerst dich doch sicher? – da ist mir etwas aufgefallen. Und zwar an dir. Ich musste dich unbedingt irgendwie wiederfinden, deswegen habe ich mich nach deiner Schule erkundigt und Jakey eine Beschreibung von dir gegeben, damit er dich zu mir führt. Weißt du, ich sehe komisch aus und ich bin auch komisch. Denn ich kann Auffälligkeiten riechen. Meine Sinne sind äußerst stark und… als ich dich gestern traf, nahm ich einen sehr komischen Geruch war. Ich stand direkt hinter dir und war ganz sicher, dass dieser besondere und auffällige Geruch direkt von dir kam.“
„Ich schwöre, ich hab morgens geduscht!“, warf Stanley ein.
„Nein, ich meine gar keinen körperlichen Geruch. Eher einen… seelischen. Und bis jetzt ging das für Leute mit einer besonderen Seele noch nie gut aus.“
„Ich versteh das nicht. Du… riechst Seelen?“
„Ja, weil ich besondere Sinne habe klappt das. Doch am Ende ist für Rückfragen noch genug Zeit. Ich musste mich also vergewissern, dass ich mich nicht geirrt hatte, deshalb lockte Jakey dich aus der Schule in das Café und ich habe es noch einmal versucht. Und natürlich hatte ich mich nicht geirrt, das passiert selten. Auf meinen Riecher kann ich mich verlassen. Menschen mit besonderen Seelen sind meist zu Großem bestimmt. Und nicht selten sterben sie einen heldenhaften Tod, aber ich will dir keine Angst machen. Im Moment gibt es Probleme. Es gibt da einen Mann, der macht nur Stress, hält sich für den Allergrößten. Du kennst solche Leute bestimmt, oder? Ja, und wegen ihm stecken wir alle in Schwierigkeiten. Wir wissen nicht, was er ausgefressen hat, aber er verhält sich so ungewöhnlich, dass er nur etwas vorhaben kann, was uns höchstwahrscheinlich alle umbringen wird oder so. Ich habe dir von Menschen erzählt, die uns nicht mögen? Dieser Mann ist ein Beispiel, und ein sehr gutes obendrein. Und wir vermuten, dass nur jemand besonderes uns da rausbringen kann. Du weiß, was ich meine?“
Stanley schluckte. „Ich?“
Und Bax nickte langsam. „Wir wollen dich zu nichts zwingen. Du kannst zurück nach Hause und das alles vergessen, wenn du das willst. Aber wir bitten dich um deine Hilfe. Eine Sache gibt es da noch, die mich verwirrt: Du bist doch ein ganz gewöhnlicher Junge, oder Stanley? Natürlich nicht langweilig oder so, sondern normal. Da unterscheiden wir uns von dir. Mir sieht man das an, den anderen weniger, aber wir sind alle etwas anders. Die anderen, wie Jakey und Franklin sind auch anders. Etwa auf diesem Halbaffen-Niveau. Hast du gewusst, dass wenn Franklin wütend ist, das Wetter schlecht wird? Und Jakey hat die Macht der Gedanken, wenn er gewöhnliche Menschen um etwas bittet, tun diese das für gewöhnlich, da er ihren Verstand manipulieren kann. Weil Jakey diese Kraft besitzt. Und da ist das Problem. Denn bis jetzt waren nur solche übernatürlich begabten Menschen diejenigen, die eine starke Seele hatten. Du bist ein gewöhnlicher Mensch, wenn ich mich nicht irre, und bist trotzdem so besonders. Dieser Sache muss ich noch auf den Grund gehen. Bis dahin hast du Zeit zum Nachdenken. Willst du uns helfen? Überdenke deine Entscheidung gut.“
Stanley hatte Bax schweigend zugehört und runzelte nun die Stirn. Ihm nicht zu glauben wäre absurd, schließlich hatte Stanley Bax mit eigenen Augen gesehen, auch wenn so etwas eigentlich unmöglich klang, wie in einem Märchen.
Er nickte langsam. Bax hatte ihm die Chance auf Rückfragen gegeben, doch er sagte nur: „Ich denke darüber nach.“
Baxter trommelte mit seinen Fingern auf dem Couchtisch. „Wenn du dich bis in ein paar Tagen noch nicht gemeldet hast, heißt das für uns, dass du nicht dabei bist. Alles klar?“
„Alles klar.“
Stille fiel nieder im Raum. Das Ticken der Uhr an der Wand war lauter als zuvor, wie Trommelschläge gegen die Luft.
Irgendwann rief Jakey unpassenderweise: „Ich hab Hunger!“
„Schon wieder?“, fragte Bax genervt.
Stanley betrachtete Jakey. Hatte dieser ihn nur wegen dieser übernatürlichen Überzeugungskunst gegen gewöhnliche Menschen bis ins Café gelockt? Man hätte fast schon Angst um seinen eigenen Willen haben können. Jakey manipulierte schließlich Menschen.
„Ich habe schon wieder Hunger, ja. Das ist nicht zum Lachen, ich verhungere noch!“
„Ich denke, Marlece wird, wie immer, wenn sie vorbeikommt, ein paar saure Gummibärchen mitbringen. Zufrieden damit?“
„Marlece kommt? Wie, jetzt?“, fragte Jakey beunruhigt. „Dann muss ich mir noch schnell die Haare kämmen!“
„Nicht jetzt, sie ist auf einer Besprechung. Gegen Abend kommt sie vorbei, du hast noch eine gute Stunde. Zieh dir ein frisches Hemd an und wasch dich, wenn du Eindruck schinden willst. Ich bin noch immer der Meinung, dass du etwas zu jung für sie bist.“
„Ich bin zwölfeinhalb!“
„Und sie dreiundzwanzig.“
Jakey streckte ihm die Zunge heraus, sprang vom Sofa und hüpfte auf die Treppe in den ersten Stock zu.
„Ich habe das Gefühl, du wirst Marlece auch mögen. Jeder mag Marlece. Bleibst du noch bis zum Abend?“
Stanley lächelte. „Es kann mir nicht schaden, euch alle ein bisschen besser kennen zu lernen, oder?“
„Schön!“, sagte Bax und klatschte in die Affenhände. Er beugte sich vor und öffnete eine Schublade am Couchtisch. Kurze Zeit später zog er eine Packung Kekse heraus. Er hielt sie Stanley hin.
„Versprich mir, dass du Jakey nichts davon verrätst, ja?“ Er zwinkerte.
Der nun gar nicht mehr verunsicherte Junge nahm sich einen Keks und grinste. „Versprochen.“
Kapitel 3
Das Hochhaus aus Glas und Stahl ragte majestätisch in den Himmel und durchbrach die Wolken. Auf den Namensschildern vor dem Eingang standen die Namen lauter uninteressanter Firmen, damit auch ja niemand Gewöhnliches auf die Idee kam, hier hereinzukommen. Es war alles nur Tarnung.
Die junge Frau, die auf die Schiebetüren zuging, hieß Marlece Dawn. Sie hatte sich für die Versammlung gar nicht schicker anziehen brauchen, als sonst auch. Sie trug am liebsten Anzüge für Frauen.
An diesem Tag hatte sie sich für einen Hellgrauen entschieden, mit langen Ärmeln und passender Hose, die unten weit geschnitten war. Sie trug hohe, schwarze Schuhe.
Hübsche Frauen verdienen hübsche Kleidung, das hatte ihr Vater immer gesagt.
Die Tür glitt geräuschlos auf und sie betrat das Gebäude. In der Eingangshalle gab es Aufzüge, die Tür zum Treppenhaus und einen Empfangstresen, an dem eine junge Sekretärin etwas in einen Computer eingab. Ansonsten war niemand da. Marlece ging auf die Sekretärin zu.
Sie lächelte und die Frau lächelte zurück. „Kann ich etwas für Sie tun?“
„Ja, bitte. Ich bin eingeladen worden von Mr… “ – Sie blickte unbemerkt auf die Visitenkarte in ihrer Hand – „… Mandrush. Wo findet das Treffen statt?“
Die Sekretärin wies mit einem Kugelschreiber auf die Aufzugtüren. „Achtzehntes Stockwerk, Raum Nummer 1803.“
„Vielen Dank!“ Sie rauschte zu den Fahrstühlen, drückte auf den Knopf nach oben und wartete. Es ertönte ein leises Bing! und die Türen öffneten sich. In der engen Kabine drückte sie den Knopf mit der Nummer Achtzehn und fuhr nach oben.
Sie überprüfte ihre Frisur in der Spiegelwand des Fahrstuhls. Kinnlang, offen und dunkelbraun. Die Haare hatte sie sich am Morgen kunstvoll über den Schultern gedreht. Sie saßen gut so, auf dem Weg her hatte sich nicht die kleinste Strähne verheddert. Alles war gut und darüber war sie froh. Für so ein Treffen musste man sich angemessen kleiden, sonst wurde man nicht respektiert.
Das Bing! ertönte wieder, die Tür öffnete sich und Marlece trat in einen schlichten Flur mit dunkelgrauem Teppich. Auf dem Weg zum richtigen Zimmer begegnete sie einem Mann mittleren Alters, der ihr entgegenkam.
Sie lächelte und er lächelte natürlich zurück.
Sie fand das richtige Zimmer schnell, die Tür stand offen. Drinnen saßen einige wichtig aussehende Herrschaften an einem langen Tisch.
Hinten, an der kurzen Seite des Tisches, waren die großen Fenster, die einen beeindruckenden Blick auf die Stadt freigaben. Seitlich von der anderen kurzen Seite befand sich die Tür und parallel dazu war ein Whiteboard an der Wand befestigt, passende Stifte lagen bereit.
Es waren nur noch drei Plätze frei, einen davon besetzte in genau diesem Moment ein fülliger Mann mit Halbglatze. Marlece entschied sich für den Platz neben ihm, da sie ihm schon einmal begegnet war und sie sich gut verstanden hatten. Sie ging um den Tisch herum und grüßte auf dem Weg den Mann, der vor dem Whiteboard stand. Da er sich nicht setzte, musste es sich um Mr Mandrush handeln. Ebenfalls ein älterer Herr. Marlece war eindeutig die Jüngste im Raum.
Sie lächelte ihm zu und er lächelte – natürlich – zurück.
Als sie sich setzte, sortierte der füllige Mann neben ihr gerade seine Papiere. Marlece hatte nichts dabei, abgesehen von ihrer teuren schwarzen Handtasche.
Sie lächelte und sagte: „Guten Tag!“ und er lächelte zurück. Wie erwartet.
Mr Mandrush hustete einmal, um die Aufmerksamkeit der Anwesenden zu erlangen. „Wie es aussieht ist Miss Dawn nun als letztes eingetroffen und wir können beginnen.“
„Da ist aber noch ein Platz frei“, meldete sich eine ältere Frau vom Fenster her.
Mandrush nickte. „Ich weiß, doch es war, wie üblich, auch einer von Mr Boundarins Leuten eingeladen. Doch Boundarin interessiert sich nicht für wichtige Versammlungen und hält es auch nicht für nötig, einen seiner Leute zu schicken. Ich kann davon ausgehen, dass dieser Platz, wie auch sonst immer, leer bleiben wird. Können wir nun beginnen?“ Als kein Widerspruch kam fuhr er fort. „Wie Sie sicherlich alle schon vermuten, ist der Grund unserer Zusammenkunft der, dass es zwischen einigen von uns zu Komplikationen gekommen ist, die wir nicht ignorieren können.“
Er sprach es nicht aus, aber alle wussten, dass es sich bei der Komplikation um Carl Boundarin handelte. Der Herr, der es nie für wichtig befand, einen seiner Leute zu der Versammlung zu schicken.
„Allerdings gab es auch einige Unterstellungen, die sich nicht als wahr erwiesen haben, was zu weiteren Streitigkeiten geführt hat. Ich möchte hier andeuten, dass –… “
Ein Klicken von seiner Seite des Tisches unterbrach ihn. Neben ihm war eine Gegensprechanlage in den Tisch eingelassen. „Entschuldigen Sie mich bitte.“ Er drückte auf den Knopf und sprach in den Lautsprecher:
„Wieso stören Sie?“
„Entschuldigen Sie, Mr“, erklang die Stimme der Sekretärin aus dem Gerät. „Hier hat sich ein junger Mann bei mir gemeldet, der behauptet, von Ihnen eingeladen worden zu sein. Doch Sie haben eben erst die Versammlung geschlossen. Soll ich ihn nach oben lassen?“
„Hat er seinen Namen genannt?“
„Nein, Sir.“
Mandrush seufzte. „Können Sie ihn beschreiben?“
„Oh ja, Sir. Sein Haar ist sehr auffällig. Es –…“
„Ah ja“, unterbrach er sie. „Ich kenne ihn. Er hat nicht gelogen, Sie können ihn nach oben schicken.“
„In Ordnung“, erklang die verwirrte Stimme der Sekretärin. Dann klickte es und war still. Zumindest bis plötzlich alle anfingen nervös zu tuscheln.
Dem Mann neben Marlece brach der Schweiß aus. „Oh, nein… nicht er.“
Marlece fand es recht merkwürdig, dass jeder zu wissen schien, um wen es ging, außer ihr. Ihr sagte das gar nichts. Vermutlich kannte sie den Mann nicht.
Ihre Theorie bestätigte sich, als es an der Tür klopfte und sie den Mann kurz darauf zum ersten Mal sah.
Die Leute im Raum waren noch immer angespannt und nervös. Mandrush zögerte sogar ganz kurz, ob er die Tür aufmachen sollte, das sah man ihm an.
Marlece hatte natürlich verstanden, dass Boundarin zum ersten Mal einen seiner Leute geschickt hatte und sie kannte keinen von seinen Leuten. Sie kannte nur Boundarin selbst.
Mandrush ging zur Tür, öffnete und der Mann betrat den Raum.
Und dann ging Marlece doch tatsächlich das Wort Oha durch den Kopf.
Er war tatsächlich noch jung, etwa so alt wie sie, und stand gerade wie eine Eins. Er trug eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und einen langen, schwarzen Mantel. Er war schlank und seine Haut war so blass wie unbeschriebenes Papier. Er schaute finster aus einem sehr schönen Gesicht mit blitzenden strahlend grünen Augen, die wohl das einzige Farbige an ihm waren. Und sein Haar war wirklich das Auffälligste an ihm. Es war schwarz und locker nach hinten gekämmt und auf der rechten Seite zog sich eine breite, schlohweiße Strähne von seiner Stirn nach hinten.
„Entschuldigen Sie die Verspätung, ich wurde aufgehalten“, sagte er.
Mandrush bemühte sich um ein Lächeln. „Mr Morween! Wir haben auf Sie gewartet“, log er. „Setzen Sie sich doch.“
Das tat er. Er setzte sich auf den letzten freien Platz, der ausgerechnet gegenüber von Marlece war.
„Hallo“, grüßte sie und lächelte. Er grüßte nicht und lächelte nicht zurück.
„Dann wollen wir einmal beginnen“, wiederholte Mandrush. Marlece hatte das Gefühl, dass dieser Morween genau wusste, dass sie ohne ihn angefangen hatten, obwohl sie sein Gesicht nicht lesen konnte. Es zeigte keine Regung in seiner undurchdringlichen Düsterkeit.
„Der Grund unserer Versammlung ist dieser, dass es ein paar Probleme unter einigen von uns gibt. Dazu gehören sowohl Meinungsverschiedenheiten als auch falsche Unterstellungen. Es gingen von einigen Anwesenden Beschwerden über andere von uns ein. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass wir uns versprochen hatten, uns gegenseitig zu respektieren und uns das tun zu lassen, was wir tun sollen. Im Notfall sollte man mir melden, dass sich einer nicht an diesen Pakt hält, damit ich etwas dagegen tun kann. Allerdings konnte diesmal tatsächlich nichts bewiesen werden. Bauchgefühle können falsch sein, das muss jeder von Ihnen verstanden haben. Will irgendjemand etwas dazu anmerken?“
Die ältere Dame am Fenster hob die Hand.
„Ja, bitte?“
„Ich denke, dass wir alle wissen, dass es um Mr Boundarin geht. Ich gebe zu, dass ich eine der Personen bin, die sich beschwert haben. Das Verhalten des Herrn hat sich stark verändert. Ich habe ihn überprüfen lassen und mir ist aufgefallen, dass Mr Boundarin die Zahl seiner Mitarbeiter verdoppelt hat. Können Sie sich das vorstellen? Was veranlasst ihn dazu, so viele Leute einzustellen?“
Mandrush sah den jungen Mann namens Morween auffordernd an. Dieser wandte sich an die Dame: „Sie müssen wirklich sehr beunruhigt sein, wenn Sie uns hinterher spionieren. Ich versichere Ihnen, dass es keinen Grund zur Sorge gibt. Die Verdopplung unserer Mitarbeiter ist volle Absicht. Vor einiger Zeit hatten wir bei uns einen kleinen Tiefpunkt und mussten viele unserer Leute entlassen. Die Zeiten sind vorbei und es geht wieder bergauf. Das ist unser Grund und wenn Sie glauben, dass dies irgendein Verstoß gegen den Pakt war, dann sollten Sie mal überlegen, ob nicht Sie es sind, die langsam dagegen verstoßen, indem Ihr Vertrauen gegenüber uns nachlässt.“
Die Frau sah aus, als würde sie gleich platzen. Ihr Kopf war rot und sie presste die Lippen aufeinander. Mit so einer Antwort hatte sie wohl nicht gerechnet. Jetzt war sie es, die in einem schlechten Licht stand. Marlece wusste nicht, woher sie kam, aber ihre war wohl mit Boundarins beruflicher Stellung zu vergleichen. Sie konnte es sich nicht leisten, dass ihr Ruf zerstört wurde.
Die Stimmung war so angespannt, als würde gleich ein Gewitter losbrechen. Marlece räusperte sich leise in die vorgehaltene Faust. „Ich bin sicher, dass die Dame ihre guten Gründe hatte, sich über Mr Boundarin zu erkundigen.“ Sie versuchte, in etwa so geschwollen zu reden, wie der junge Mann ihr gegenüber. Sonst tat sie das nicht gerne, aber auf diesem Treffen bedeutete so etwas Wichtigkeit.
Morween sah sie an und verzog keine Miene. „Und Sie sind…?“
Marlece lächelte wieder probeweise, um zu sehen, ob er diesmal darauf ansprang. Nichts. „Marlece Dawn. Ich gehöre weder selbst diesem Kreis an, noch habe ich einen speziellen… Meister, für den ich hier bin. Ich vertrete die komplette Wohngemeinschaft von Saul Baxter.“
„So, so.“ war das einzige, was er sagte. Und das in einem so abfälligen Ton, dass sie spürte, wie sehr er sie nun für eine Witzfigur hielt. Sie hatte sich noch nie im Leben für Baxter und die anderen geschämt, und das tat sie auch jetzt nicht, doch sie wünschte sich plötzlich irgendetwas herbei, womit sie erfolgreich angeben konnte.
Mandrush seufzte. „Nur, damit es nicht zu Missverständnissen kommt: Die Gemeinschaft von Saul Baxter ist wirklich eine große Unterstützung für uns. Ohne Miss Dawn liefe einiges hier sehr verkehrt. Außerdem setzt sich die Gemeinschaft für Halbaffen ein und spendet jedes Jahr an den weltweiten Halbaffen-Schutzverband. Sie können froh sein, Miss Dawn, Sie haben da eine echt tolle Truppe.“ Er zwinkerte.
Das wusste sie. Sie hatte wunderbare Freunde. Doch zu diesem Zeitpunkt fühlte sie sich fehl am Platz. Wieso war sie eigentlich auf dieser wichtigen Versammlung, wenn Bax und seine Freunde doch gar nicht so wichtig bei der Regierung waren? Sie wünschte, dass die Zeit schneller vergehen würde und sie endlich gehen könnte. Dann würde sie sofort zu Bax und Jakey und Franklin und den anderen fahren, um dort ihre freie Zeit zu verbringen. Sie wollte sofort los, nicht mehr hier sitzen, sondern zu den Leuten, die sie Familie nannte. Wieso war sie auf dieser Versammlung? Ganz einfach: Weil sie eingeladen worden war. Und wenn man sie eingeladen hatte, musste sie etwas bedeuten.
Sie straffte die Schultern und sah auf. Eigentlich hätte sie sauer auf Morween sein müssen, doch das war sie komischerweise nicht. Sie hatte die ganze Zeit sich selbst die Schuld gegeben und war nicht auch nur auf die Idee gekommen, Morween zu beschuldigen, weil dieser anscheinend Baxter und die anderen für wertlosen Dreck hielt. Und so sehr sie sich auch bemühte, sie konnte das nicht.
Sie lächelte wieder, doch es klappte auch diesmal nicht. Sein Gesicht blieb unbewegt. „Jetzt wissen Sie, wir sind nicht einfach nur aus Spaß hier oder um unsere Leute zu vergleichen, sondern um eine Lösung für das Problem zu finden, dass hier ja wohl eindeutig Ihren Chef und Meister betrifft. Sie sollten sich ernsthaft am Gespräch beteiligen, dann werden wir am Ende eine Abmachung treffen und Mr Boundarin wird von niemandem mehr in ein schlechtes Licht gestellt. Das wollen Sie doch auch, oder?“
„Ich bin hier, damit sich niemand von Ihnen in unsere Sachen einmischt, weil Sie anscheinend nichts Besseres zu tun haben. Das soll ein Ende haben. Doch anscheinend sind viele nur hier, um ihre Theorien zu bestärken, was Boundarin betrifft. Und ich habe das Gefühl, dass damit jeder hier im Raum gemeint ist, da sich niemand auf meiner Seite befindet.“
„Ich bin auf keiner Seite“, sagte sie freundlich: „Ich bin hier, um sicherzugehen, dass es keine Komplikationen unter den Anwesenden gibt, worauf es leider hinausläuft.“
„Das reicht“, fuhr Mandrush dazwischen. Beide wandten den Blick voneinander ab und sahen ihn an. „Ich glaube, wir werden heute zu keinem Ergebnis mehr kommen, so wie es aussieht. Ich muss hiermit die Versammlung beenden. Kommen Sie alle gut nach Hause.“ Er klopfte auf den Tisch und verschwand mit leicht verärgertem Gesichtsausdruck nach draußen. Es war, als wolle er sagen, dass er auf diesen Konkurrenzkampf zwischen Kindern gut verzichten konnte.
Die plötzliche Schließung der Sitzung hatte alle überrascht, doch Marlece war als Erste wieder auf den Beinen, da sie es gar nicht erwarten konnte, endlich weg zu kommen. Außerdem mussten die anderen noch ihre kompletten Unterlagen einpacken, die sie unnötigerweise mitgebracht hatten.
Allerdings hatte auch Morween nichts dabeigehabt, weswegen er jetzt elegant hinter Marlece herging, was sie nur nervös machte. Sie überlegte, ob sie vielleicht die Treppe nehmen sollte, aber das hätte wahrscheinlich nur den Eindruck gemacht, dass sie sich zu fein sei, um mit dem komischen Typen Fahrstuhl zu fahren. In Wahrheit hatte sie ein wenig Angst.
Und dass nicht einmal lustige Fahrstuhlmusik lief, machte es nicht besser. Nur Totenstille und ihre Atemzüge, ihr Blick ging nach unten und sie umklammerte ihre Handtasche.
Es schien eine halbe Ewigkeit zu dauern, bis sie unten ankamen und noch nie war Marlece über dieses leise Bing! so froh gewesen.
Er schritt an ihr vorbei durch die Eingangshalle und sie lief extra langsam, um ihn sich noch einmal genau anzuschauen.
Das war ein Fehler, das wurde ihr dann bewusst. Denn ihr wurde eine Sache klar.
Sie hatte gar keine Angst gehabt.
Am liebsten hätte sie laut aufgelacht. Stattdessen seufzte sie nur und lächelte beim Verlassen des Gebäudes ein letztes Mal der Sekretärin zu, die gerade wieder in ihrem Computer herum tippte und nur einmal kurz aufsah, um Marlece mit einem letzten Lächeln zurück zu verabschieden.
Das Treffen war ein großer Flop gewesen. Dafür war sie nun umso neugieriger, was aus dem Jungen geworden war, den Bax aufsammeln wollte.
Sie ging zu ihrem silbernen Wagen, öffnete die Fahrertür, ließ sich auf den Sitz fallen und startete den Motor.
Die anderen warteten sicher schon.
Kapitel 4
Stanley lernte bei seinem Aufenthalt noch weitere Leute kennen. Nacheinander trafen sie ein, die kompletten Bewohner des großen Hauses, alle Freunde. Einige, die ebenfalls kamen, wohnten außerhalb, konnten aber nicht darauf verzichten, den Abend dort zu verbringen. Die Abende in diesem Haus schienen etwas Großes zu sein. Alle waren bester Laune und da konnte sich Stanley nur anschließen. Er hatte seine Eltern angerufen und gesagt, dass er wahrscheinlich etwas später nach Hause kommen würde, da er noch mit zu einem Klassenkameraden ginge, um ein Projekt für die Schule vorzubereiten. Diese waren ganz aus dem Häuschen und sagten, sie sollten sich ruhig Zeit lassen.
Bax wollte den anderen Leuten Stanley vorstellen. Doch Stanley stellte sich lieber selbst vor, somit hatte er die Chance, die anderen ein wenig besser kennenzulernen.
Am besten verstand er sich noch immer mit Jakey. Dazu kam Franklins Schwester Minnie Wesser, etwa so alt wie Jakey, vielleicht ein bisschen jünger. Sie trug, genau wie Minnie Maus,
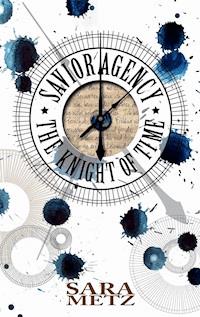













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














