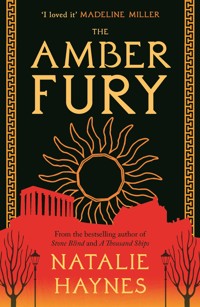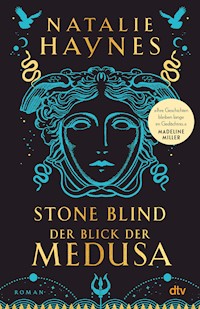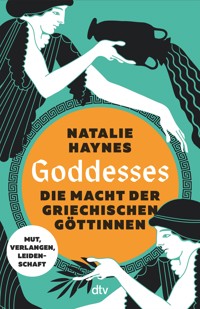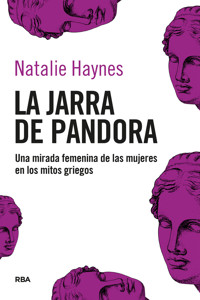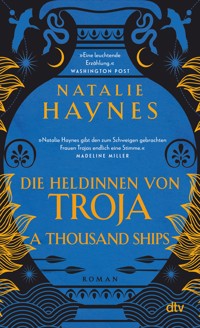
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alles ist so gekommen, wie sie es vorausgesagt hatten… … nur noch schlimmer! Troja brennt, der Krieg ist verloren. Warum hat Hektor nicht auf die weisen Worte seiner Frau gehört? Doch Andromache empfindet keine Genugtuung darüber, dass sie recht hatte – sondern stetig wachsendes Grauen. Denn während die Männer im Krieg ihr Leben verlieren, verlieren die Frauen alles andere. Doch sie zeigen ihren Tränen nicht. Vielmehr erzählen sie ihre Geschichte, als wäre sie ein Gedicht: melodisch, klug und unterhaltsam. Ihre Erinnerungen sind schmerzhaft, doch ihr Kampfgeist ist ungebrochen. ›A Thousand Ships – Die Heldinnen von Troja‹ füllt eine Leerstelle: Endlich hören wir von den Frauen, deren Leben, Lieben und Rivalitäten durch den tragischen Krieg für immer verändert wurden – eindrucksvoll übersetzt von Lena Kraus »Elegant und intelligent … Haynes verbindet ihr umfassendes Wissen über die griechische Mythologie mit der Gabe, fesselnd zu erzählen« - The Times Für alle Leser*innen von Madeline Miller Lesen Sie auch ›STONE BLIND – Der Blick der Medusa‹ von Natalie Haynes. Poetisch und klug erzählt Natalie Haynes darin die Geschichte einer Frau, die von anderen zum Monster gemacht wird – und sich doch selbst behauptet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Natalie Haynes
DIE HELDINNEN VONTROJAA THOUSAND SHIPS
Roman
Aus dem Englischen von Lena Kraus
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für Keziah, selbstverständlich
Ihr Ruhm besteht für immer fort, und die ewigen Gottheiten schreiben Lieder über sie, damit sich die Sterblichen an Penelopes Intelligenz erfreuen können.
Sie ist so anders als meine Frau – die ihren eigenen Mann umbrachte!
Agamemnon, Die Odyssee, 24.196-9
Dramatis Personae
Agamemnon, König von Mykene bei Argos, auf dem griechischen Festland. Sohn des Atreus, Ehemann von:
Klytaimnestra, Königin von Mykene und Mutter von:
Iphigeneia, Orestes, Elektra
Menelaos, Bruder von Agamemnon, Ehemann von:
Helena von Sparta, später bekannt als Helena von Troja. Helena war sowohl Schwägerin als auch Schwester von Klytaimnestra. Sie und Menelaos hatten eine Tochter:
Hermione
Zusätzlich:
Aigisthos, Sohn von Thyestes (dem Bruder von Atreus), Cousin von Agamemnon und Menelaos
Odysseus, König von Ithaka, Sohn von Antikleia und Laertes. Ehemann von:
Penelope, Königin von Ithaka, Webeexpertin, Mutter von:
Telemachos
Zu ihrem Haushalt gehörten auch:
Eurykleia, Odysseus’ Amme
Eumaios, ein treuer Schweinehirte
Odysseus wurde auf dem Nachhauseweg von Troja aufgehalten von (unter anderem):
Polyphemos, einem einäugigen Riesen oder Zyklopen. Sohn des Poseidon, Gott der Meere
Circe, einer Zauberin, die auf der Insel Aiaia lebt
Den Laystrigonen (kannibalischen Riesen)
Den Sirenen: halb Frauen, halb Vögel, mit einem Gesang, der Seefahrer in den Tod lockte
Skylla einem Hunde-Frauen-Hybrid. Viele Zähne.
Charybdis einem Schiffe zerstörenden Strudel
Kalypso, einer Nymphe, die auf der Insel Ogygia lebt
Peleus war ein griechischer König und Held, der verheiratet war mit:
Thetis, einer Meeresnymphe. Sie hatten einen Sohn:
Achill, den größten Krieger, den die Welt je gesehen hatte. Sein engster Freund und vielleicht auch Geliebter war:
Patroklos, ein griechischer Krieger und Kleinadliger. Während des Trojanischen Krieges nahmen sie gefangen:
Briseis, Prinzessin von Lyrnessos, einer kleineren Stadt unweit von Troja
Achill hatte auch einen Sohn:
Neoptolemos
Zu den anderen Griechen, die in den Trojanischen Krieg verwickelt waren, gehören:
Sinon, ein Krieger
Protesilaos, König von Phylake, einer kleinen griechischen Siedlung. Ehemann von:
Laodameia, seiner Königin
Priamos, König von Troja, Vater von zahllosen Söhnen und Töchtern und Ehemann von:
Hekabe, auch Hecuba genannt (von den Römern und später von Shakespeare). Mutter von:
Polyxena, Heldin von Troja
Kassandra, Priesterin des Apollo, dem Gott des Bogenschießens, der Heilung und der Krankheit
Hektor, der große Held von Troja
Paris, trojanischer Krieger und Verführer der Frauen anderer Männer
Polydoros, der jüngste Sohn von Priamos und Hekabe
Hekabe und Priamos waren auch Schwiegereltern von:
Andromache, Frau von Hektor, Mutter von Astyanax
Am Krieg beteiligt waren auch:
Aeneas, ein trojanischer Adliger, Sohn von Anchises und Ehemann von:
Krëusa, Mutter von Euryleon (später römisch als Ascanius bekannt)
Theano, Frau von Antenor (einem Berater Priamos’) und Mutter von Crino
Chryseis, ein trojanisches Mädchen und Tochter von Chryses, einem Priester des Apollo
Penthesilea war eine Amazonenprinzessin, Schwester von
Hippolyte. Sie war keine Trojanerin, kämpfte aber im letzten Jahr des Krieges als ihre Verbündete
Oinone, eine Bergnymphe, lebte in der Nähe von Troja
Kalliope, Muse der epischen Dichtkunst
Zeus, König der Gottheiten des Olymps. Vater zahlloser weiterer Götter, Göttinnen, Nymphen, Halbgöttinnen und Halbgötter. Mann und Bruder von:
Hera, Königin der Gottheiten des Olymps und Hasserin aller, die Zeus verführte
Aphrodite, Göttin der Liebe und vor allem der Lust
Verheiratet mit dem Schmiedegott, Hephaistos, und gelegentliche Liebhaberin des Kriegsgottes Ares
Athene, Göttin der Weisheit und der Verteidigung. Unterstützerin von Odysseus, Schutzgöttin von Athen. Liebt Eulen
Eris, Göttin der Zwietracht. Macht Ärger
Themis, eine der alten Göttinnen. Steht für Ordnung, im Gegensatz zum Chaos
Gaia, eine weitere alte Göttin. Wir stellen sie uns als Mutter Erde vor
Die Moiren, die Schicksalsgöttinnen. Drei Schwestern – Klotho, Lachesis und Atropos –, die unsere Schicksale in ihren Händen halten
1Kalliope
Sing, Muse, sagt er, und sein Ton macht deutlich, dass das keine Bitte ist. Wenn ich Lust hätte, seinem Wunsch nachzukommen, würde ich vielleicht sagen, dass er seine Stimme an meinem Namen schärft wie ein Krieger, der vor der Schlacht seinen Dolch über den Schleifstein zieht. Aber ich habe heute keine Lust, seine Muse zu sein. Vielleicht hat er nie darüber nachgedacht, wie es ist, ich zu sein. Garantiert nicht: Wie alle Dichter denkt er nur an sich. Was mich allerdings überrascht, ist, dass ihm gar nicht bewusst ist, wie viele Männer genau wie er sind. Jeden Tag fordern sie ständige Aufmerksamkeit und Unterstützung. Wie viel epische Dichtkunst kann die Welt schon brauchen?
Jeder gelöste Konflikt, jeder gefochtene Krieg, jede belagerte Stadt, jede geplünderte Ortschaft, jedes zerstörte Dorf. Jede unmögliche Reise, jedes Schiffsunglück, jede Rückkehr: Diese Geschichten sind alle schon erzählt worden, unzählige Male. Glaubt er denn wirklich, dass er etwas Neues zu sagen hat? Und denkt er, dass er mich braucht, um den Überblick über all seine Figuren zu behalten oder um die unzähligen leeren Momente zu füllen, in denen das Metrum nicht zum Inhalt passen will?
Ich schaue nach unten und sehe, dass er den Kopf und seine breiten Schultern hängen lässt. Seine Wirbelsäule zeigt den Ansatz eines Buckels. Er ist alt, dieser Mann. Älter, als seine messerscharfe Stimme erahnen lässt. Ich bin neugierig. Normalerweise sind es eher die Jungen, für die die Dichtung so dringlich ist. Ich gehe in die Hocke, um ihm ins Gesicht zu sehen. Er hat die Augen geschlossen, mit der Intensität eines Betenden. Solange er die Augen geschlossen hält, kann ich ihn nicht ergründen.
Er trägt eine wunderschöne Goldbrosche aus winzigen Blättern, die sich zu einem glänzenden Knoten verweben. Also wurde er in der Vergangenheit schon einmal reichlich für seine Dichtkunst entlohnt. Er hat Talent, und er ist erfolgreich gewesen, zweifellos mit meiner Hilfe. Aber er hat noch nicht genug. Ich wünschte, ich könnte sein Gesicht richtig sehen, im Licht.
Ich warte darauf, dass er die Augen wieder öffnet, aber ich habe mich schon entschieden. Wenn er meine Hilfe haben will, wird er mir ein Angebot machen. So läuft das bei den Sterblichen: Erst bitten, dann betteln sie, und zuletzt kommt der Handel. Ich werde ihm seine Worte geben, wenn er mir diese Brosche gibt.
2 Krëusa
Ein ohrenbetäubendes Krachen schreckte sie aus dem Schlaf, und sie schnappte nach Luft. Sofort schaute sie sich nach dem Baby um. Doch dann wurde ihr klar, dass ihr Sohn längst kein Baby mehr war, sondern schon fünf Sommer gesehen hatte, während der Krieg um die Stadtmauern tobte. Er war natürlich in seinem eigenen Zimmer und nicht hier bei ihr. Ihr Atem verlangsamte sich, und sie wartete darauf, dass er aus Angst vor dem Gewitter nach seiner Mutter schrie. Aber der Schrei kam nicht: Er war mutig, ihr kleiner Sohn. Zu mutig, als dass ein Blitz ihn aufschreien ließe, auch wenn Zeus selbst diesen geschmettert hätte. Sie wickelte sich eine Decke um die Schultern und versuchte, zu erraten, um welche Nachtstunde es sich handelte. Das Trommeln des Regens wurde lauter. Es musste früher Morgen sein, denn sie konnte sich im Zimmer umsehen. Aber das Licht war merkwürdig: Es hatte eine fette, gelbe Farbe, die die dunkelroten Wände glänzen ließ wie frisches Blut. Wie konnte das Licht so gelb sein, ohne dass die Sonne aufgegangen war? Und wie konnte Sonnenlicht in ihre Kammer strömen, wenn sie doch den Regen aufs Dach trommeln hörte? Sie war noch halb in ihren Träumen gefangen, und so dauerte es einige Augenblicke, bis ihr klar wurde, dass der beißende Geruch, der ihr in die Nase stieg, echt war und sich nicht nur in ihrer Vorstellung befand. Das Krachen war kein Donner am Firmament gewesen, sondern stammte von einer Zerstörung auf Erden; das Trommeln kam nicht von Regentropfen, sondern von trockenem Holz und Stroh, das in der Hitze knackte und knisterte. Und das flackernde, gelbe Licht ging nicht von der Sonne aus.
Mit einem Mal wurde ihr klar, in welcher Gefahr sie sich befand, und sie sprang aus dem Bett, um die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Sie musste nach draußen, weit weg vom Feuer. Schon jetzt hatte sich der Rauch wie eine Fettschicht auf ihre Zunge gelegt. Sie rief nach ihrem Mann, Aeneas, und ihrem Sohn, Euryleon, doch sie bekam keine Antwort. Sie verließ ihre Schlafkammer – mit der schmalen Pritsche und der rot-braunen Decke, die sie zu Beginn ihrer Ehe selbst gewoben hatte und auf die sie immer so stolz gewesen war – aber sie kam nicht weit. Durch das schmale, hohe Fenster direkt vor ihrer Schlafzimmertür sah sie das Feuer, und jegliche Entschlossenheit sackte aus ihren Füßen in den Boden. Es war nicht ihr Zuhause, das in Flammen stand. Es war die Zitadelle: der höchste Punkt der Stadt Troja, der bisher nur von Wach- oder Opferfeuern erleuchtet worden war oder von Helios, dem Sonnengott, wenn er mit seinem Pferdewagen darüber schwebte. Jetzt tanzte das Feuer zwischen den steinernen Säulen, die sich sonst immer so kühl angefühlt hatten. Wie angewurzelt beobachtete Krëusa, wie dort oben ein Teil des Daches in Flammen aufging und ein Funkenregen aus den Holzbalken stob: winzige, wirbelnde Glühwürmchen im Rauch.
Aeneas musste aufgebrochen sein, um bei der Bekämpfung der Flammen zu helfen, dachte sie. Sicher war er losgelaufen, um seinen Brüdern und seinen Cousins zu helfen, um Wasser zu tragen und Sand und alles, was sie finden konnten. Es war nicht das erste Feuer, das die Stadt heimsuchte, seit die Belagerung begonnen hatte. Die Männer würden alles tun, alles, um die Zitadelle zu retten, in der sich die wertvollsten Besitztümer der Stadt befanden: die Schatzkammer, die Tempel, das Zuhause von Priamos, ihrem König.
Die Furcht, die sie aus dem Bett getrieben hatte, verebbte. Sie und ihr Sohn waren außer Gefahr, ganz im Gegensatz zu ihrem Mann, der sich – wie so oft seit Beginn dieses endlosen Krieges – wieder einmal in Lebensgefahr befand. Krëusas unmittelbare, stechende Überlebensangst wurde von der altbekannten, dumpfen Sorge um ihren Mann abgelöst. Sie war so daran gewöhnt, dass er loszog, um die griechische Plage zu bekämpfen, die sich bereits seit zehn langen Jahren vor den Toren der Stadt breitmachte. Sie war so daran gewöhnt, von lähmender Angst ergriffen zu werden, wenn sie auf seine Rückkehr wartete – so sehr, dass das Gefühl sie jetzt fast schon beruhigte; wie ein großer, schwarzer Vogel, der sich auf ihrer Schulter niederließ. Bisher war er jedes Mal wieder nachhause gekommen. Immer. Und sie versuchte, den Gedanken zu ignorieren, den der Vogel ihr völlig ungefragt ins Gehirn krächzte: Warum sollte die Vergangenheit eine Garantie für die Zukunft sein?
Sie zuckte zusammen, als sie ein weiteres monströses Krachen hörte, das sicherlich noch lauter war als dasjenige, das sie zuvor geweckt hatte. Sie spähte am Fensterrahmen vorbei über die niedrigeren Teile der Stadt. Und jetzt sah sie, dass dies kein Feuer war wie andere, und zwar nicht nur wegen der Bedeutung des Ortes, an dem es brannte: Die Flammen waren nicht auf die Zitadelle begrenzt. Brandherde aus rasendem orangerotem Licht flackerten in der ganzen Stadt. Krëusa murmelte ein Gebet zu den Gottheiten ihres Haushaltes. Aber für Gebete war es längst zu spät. Ihre Lippen formten zwar die Worte, aber ihr war klar, dass die Götter Troja im Stich gelassen hatten. Überall in der Stadt brannten die Tempel.
Sie rannte den kurzen, dunklen Gang entlang, dann durch den geliebten überdachten Innenhof mit den hohen, filigran verzierten Wänden, bis zur Vorderseite des Hauses. Es war niemand da, selbst die Sklaven waren fort. Sie stolperte über ihr Gewand und drehte ihre linke Faust in den Stoff, um den Saum anzuheben. Wieder rief sie nach ihrem Sohn – war es möglich, dass Aeneas ihn mitgenommen hatte, um ihren Schwiegervater zu holen? War er vielleicht dorthin unterwegs? – und öffnete die große, hölzerne Haustür zur Straße. Leute aus der Nachbarschaft rannten an ihr vorbei, nicht mit Wassereimern, wie Krëusa zuerst angenommen hatte, sondern mit Taschen und Beuteln, die nur das enthielten, was sie vor der Flucht zusammenraffen konnten. Manche hatten gar nichts dabei.
Krëusa konnte einen Aufschrei nicht unterdrücken. Aus allen Richtungen kamen verzweifelte Rufe und gellendes Stimmengewirr. Der Rauch sank jetzt in die Straßen, als wäre die Stadt schon ruiniert und schämte sich, ihrem Blick zu begegnen.
Krëusa stand auf der Türschwelle und wusste nicht, was sie tun sollte. Sicher wäre es das Beste, wenn sie im Haus bliebe, damit ihr Mann sie fand, wenn er wiederkam. Vor vielen Jahren hatte er ihr versprochen, dass er, falls die Stadt fiel, sie, ihren Sohn, seinen Vater und andere Überlebende aus Troja mitnehmen, zu neuen Ufern segeln und dort eine neue Stadt gründen würde. Sie hatte ihm damals die Finger auf die Lippen gelegt, um ihn zum Schweigen zu bringen. Wenn man solche Dinge nur aussprach, konnte das eine boshafte Gottheit dazu animieren, sie in die Tat umzusetzen. Sein Bart hatte sie an den Händen gekitzelt, aber sie hatte nicht gelacht. Er war ebenfalls ernst geblieben: Es ist meine Pflicht, hatte er gesagt. Priamos befiehlt es mir. Jemand muss die Verantwortung dafür übernehmen, ein neues Troja zu gründen, falls das Schlimmste passiert. Wieder versuchte sie, die Gedanken, die auf sie einstürmten, zu unterdrücken: Dass er nicht zurückkehren konnte. Dass er vielleicht schon tot war. Dass die Stadt noch vor dem Morgengrauen ausgelöscht sein würde. Dass ihr Zuhause – wie das von so vielen anderen – dann nicht mehr existierte.
Aber wie hatte das alles passieren können? Sie drückte ihre Stirn an die Holztür. Die schwarzen Metallaufsätze fühlten sich warm an. Sie schaute an sich herunter und sah, dass sich in den Falten ihres Gewandes bereits jetzt der ölige, schwarze Staub gesammelt hatte.
Was gerade in der ganzen Stadt passierte, war unmöglich. Troja hatte den Krieg gewonnen. Endlich waren die Griechen geflohen, nachdem sie sich ein Jahrzehnt lang getreu ihrer Pläne vor den Stadtmauern aufgerieben hatten. Vor all den Jahren waren sie mit ihren großen Schiffen angekommen und hatten – ja, was eigentlich? – nicht viel erreicht. Schlachten waren geschlagen worden, mal in der Nähe der Stadtmauern, mal weiter entfernt. Einst hatte sich das Schlachtfeld bis zu den gestrandeten Schiffen erstreckt und sich dann wieder näher an die Stadt zurückgezogen. Es hatte Einzelkämpfe gegeben und den kompletten Kriegszustand. Es hatte Krankheit und Hunger gegeben, und zwar auf beiden Seiten. Großartige Krieger waren gefallen, während Feiglinge mit dem Leben davongekommen waren. Aber Troja, ihre Stadt, war am Ende siegreich gewesen.
War das nicht erst drei Tage her, oder vier? Krëusa war sich nicht mehr sicher, wie viel Zeit vergangen war. An den Fakten hatte sie allerdings keinen Zweifel. Sie hatte beobachtet, wie die griechische Flotte davongesegelt war, war auf die Akropolis gestiegen, um es mit eigenen Augen zu sehen. Wie alle anderen in der Stadt hatte sie schon Tage vorher die Gerüchte gehört: Die griechische Armee packte zusammen. Sie hatten sich definitiv in ihr Lager zurückgezogen. Aeneas und die anderen Männer – Krëusa würde sie nie als Krieger bezeichnen, denn das waren sie nur vor den Mauern der Stadt, nicht in ihrem Inneren – hatten darüber diskutiert, ob sie das Lager angreifen sollten, um herauszufinden, was los war, und einfach auch um ein wenig Chaos zu verbreiten. Letztendlich hatten sie sich aber zurückgehalten und geduldig innerhalb der Stadtmauern abgewartet. Und nach einem weiteren Tag, an dem weder Speere geworfen noch Pfeile geschossen wurden, begann man in Troja zu hoffen. Vielleicht war im griechischen Lager wieder eine Krankheit ausgebrochen. Das war schon einmal passiert, vor ein paar Monaten, und die Trojaner hatten gejubelt und sämtlichen Gottheiten Dankesopfer dargebracht. Die Griechen wurden für ihre anmaßende Arroganz bestraft, dafür, dass sie einfach nicht einsehen wollten, dass Troja nicht fallen würde, von Sterblichen gar nicht besiegt werden könnte – Sterblichen wie ihnen, diesen eingebildeten Griechen, mit ihren großen Schiffen und ihren Rüstungen, die bronzefarben in der Sonne glänzen mussten, weil keiner von ihnen die Schmach ertragen könnte, im Verborgenen zu arbeiten, nicht gesehen und nicht bewundert.
Wie alle anderen hatte auch Krëusa für eine Pest gebetet. Sie hatte nicht geglaubt, dass es etwas Größeres gab, für das man beten könnte. Aber dann war ein weiterer Tag vergangen, und die feindlichen Schiffe begannen sich zu bewegen. Ihre Masten bebten, als die Griechen aus der Bucht heraus ins tiefe Fahrwasser des Ozeans ruderten. Und immer noch schwieg man in Troja und wagte es nicht, den eigenen Augen zu trauen. Das Lager war schon so lange ein Schandfleck auf der Westseite der Stadt gewesen, dass es sich jetzt seltsam anfühlte, die Küste hinter der Mündung des Flusses Skamandros wieder frei zu sehen – als wäre eine Gliedmaße mit Wundbrand endlich amputiert worden: Die verlassene Bucht war weniger furchterregend als vorher, aber dennoch ein beunruhigender Anblick.
Einen Tag später stieß selbst das letzte und langsamste der Schiffe in See. Es ächzte unter dem Gewicht der unrechtmäßig erworbenen Schätze, die aus all den kleinen Städten in Phrygien zusammengerafft worden waren, deren Stadtmauern niedriger waren als die Trojas. Die Griechen ruderten in den Wind, ließen die Segel hinunter und glitten davon.
Nachdem die Schiffe fort waren, standen Krëusa und Aeneas noch lange auf der Stadtmauer und schauten der Gischt und den Wellen zu, die sich an der Küste brachen. Sie hielten einander fest, während sie flüsternd die Fragen stellte, die er nicht beantworten konnte: Warum sind die Griechen abgezogen? Kommen sie wieder? Sind wir in Sicherheit?
Ein lautes, dumpfes Krachen riss Krëusa wieder in die Gegenwart zurück. Sie konnte jetzt nicht zur Akropolis hinaufsteigen, um nach Aeneas Ausschau zu halten. Selbst von zuhause aus sah sie die Rauchwolke, unter der das Dach der Zitadelle in sich zusammengestürzt war. Alle, die sich darunter befunden hatten, waren jetzt tot. Sie versuchte, sich nicht vorzustellen, wie Euryleon zwischen den Beinen seines Vaters hindurchschlüpfen könnte, um dabei zu helfen, das unersättliche Feuer zu löschen. Aber Aeneas hätte ihren einzigen Sohn niemals einer solchen Gefahr ausgesetzt. Er musste zu Anchises gegangen sein, um den alten Mann in Sicherheit zu bringen. Aber würde er noch einmal zurückkommen, um Krëusa zu holen, oder erwartete er, dass sie ihn auf der Straße fand?
Sie kannte Aeneas’ Herz besser als ihr eigenes. Er war losgezogen, um seinen Vater zu holen, bevor das Feuer sein volles Ausmaß erreicht hatte: Anchises wohnte in der Nähe der Akropolis, dort, wo die Flammen am hellsten loderten. Aeneas musste gewusst haben, dass der Weg zum Haus seines Vaters schwer sein würde. Bestimmt hatte er vorgehabt, zurückzukommen und musste jetzt einsehen, dass das unmöglich war. Er würde sich zu den Stadttoren durchschlagen und annehmen, dass sie dasselbe tat. Sie würde ihn draußen auf der Ebene wiederfinden; er würde dort warten, wo sich bis vor kurzem das griechische Lager befunden hatte.
Krëusa zögerte noch einen Moment lang auf der Schwelle und dachte darüber nach, was sie mitnehmen konnte. Aber das Geschrei der Männer kam näher, und der Dialekt war ihr fremd. Die Griechen waren in der Stadt, und ihr blieb keine Zeit, nach Wertsachen zu suchen, nicht einmal nach einem Mantel. Sie überblickte noch einmal kurz die rauchgefüllten Gassen und lief los.
Am Vortag war Krëusa ganz in der festlichen Stimmung aufgegangen, die in der Stadt geherrscht hatte: Zum ersten Mal seit zehn Jahren waren Trojas Tore geöffnet. Als sie zuletzt durch die Ebene des Skamandros gewandelt war, war sie fast noch ein Kind gewesen, zwölf Jahre alt. Ihre Eltern hatten ihr erzählt, dass die Griechen Piraten waren, Söldner, die über die schimmernden Meere segelten und sich die leichteste Beute suchten. Sie würden nicht lange in Phrygien bleiben, hatten alle gesagt. Warum sollten sie? Niemand glaubte ihrem Vorwand: Sie seien gekommen, um irgendeine Frau zurückzuholen, die mit einem von Priamos’ Söhnen davongelaufen war. Das war doch lächerlich. Unzählige Schiffe, gar tausende, sollten nur wegen einer Frau diesen weiten Weg auf sich genommen haben? Selbst als Krëusa sie gesehen hatte – Helena, deren langes, blondes Haar über ihr rotes Kleid hinabfiel und mit den goldenen Saumstickereien und den Kordeln um die Wette glänzte, die sie um Hals und Handgelenke trug –, selbst da konnte Krëusa nicht glauben, dass eine ganze Armee so weit gesegelt war, nur um sie nach Hause zu holen. Die Griechen fuhren aus denselben Gründen zur See wie alle anderen auch: um ihre Kisten mit Schätzen zu füllen und ihre Häuser mit Sklaven. Aber dieses Mal, als sie nach Troja gesegelt waren, hatten sie sich zu viel vorgenommen. Ignorant, wie sie waren, hatten sie nicht gewusst, dass Troja nicht nur reich, sondern auch gut befestigt war. Das war typisch für die Griechen, hatten Krëusas Eltern gesagt: Für die Hellenen waren alle Nicht-Griechen gleich, alles Barbaren. Es war ihnen einfach nicht in den Sinn gekommen, dass Troja Mykene, Sparta, Ithaka und alle anderen Städte, in denen sie zuhause waren, übertrumpfte.
Troja würde ihre Tore nicht für die Griechen öffnen. Krëusa hatte beobachtet, wie sich der Ausdruck ihres Vaters verfinsterte, als er mit ihrer Mutter darüber sprach, was Priamos nun entschieden hatte. Die Stadt würde kämpfen und weder die Frau noch ihre goldenen Gewänder zurückgeben. Die Griechen waren opportunistisch, sagte er. Sie würden wieder fort sein, bevor die ersten Winterstürme ihre Schiffe durchrüttelten.
Um Trojas Glück rankten sich Legenden: über König Priamos mit seinen fünfzig Söhnen und fünfzig Töchtern, über den grenzenlosen Reichtum, die hohen Mauern und die treuen Verbündeten der Trojaner. Es war den Griechen unmöglich, von einer solchen Blütestadt zu hören, ohne sie zerstören zu wollen. Das lag in ihrer Natur. In Troja wusste man, dass das der eigentliche Grund für ihren Angriff war – Helena war nur ein Vorwand. Der König der Spartaner – so murmelten die trojanischen Frauen, wenn sie sich am Wasser versammelten, um ihre Kleider zu waschen – hatte Helena wahrscheinlich absichtlich mit Paris mitgeschickt, um ihm und den anderen Griechen einen Vorwand dafür zu geben, die Segel zu setzen.
Was immer auch der Grund gewesen sein mochte: Als die Griechen ihr Lager aufgeschlagen hatten, war Krëusa noch ein Kind gewesen. Und als sie das nächste Mal vor die Stadttore trat, hielt sie bereits die Hand ihres eigenen Sohnes, der zwar eine ganze Stadt zur Kinderstube gehabt hatte, aber noch nie über die Ebenen vor ihren Mauern gelaufen war. Selbst Aeneas, der nach Jahren des Kampfes völlig erschöpft war, war, als sich die Tore knarrend öffneten, von einer gewissen Leichtigkeit gewesen. Er trug natürlich nach wie vor sein Schwert, aber den Speer hatte er zuhause gelassen.
Späher hatten berichtet, dass keine griechischen Soldaten zurückgeblieben waren. Die Küste war menschenleer, die Schiffe waren fort. Einzig eine Opfergabe war zurückgeblieben: ein riesiges, hölzernes Ding, sagte man. Es war unmöglich, zu erkennen, wem die Griechen es gewidmet hatten oder warum. Poseidon wahrscheinlich, für eine sichere Rückreise, vermutete Krëusa im Gespräch mit ihrem Mann, während ihr kleiner Sohn auf der matschigen Erde hin und her rannte. Das Gras würde wieder nachwachsen, sagte sie zu Euryleon, als sie zum ersten Mal nach draußen traten. Sie hatte an ihre eigene Kindheit gedacht und zu viel versprochen. An all die trampelnden Füße, die stampfenden Wagenräder und das fließende Blut hatte sie nicht gedacht.
Aeneas nickte, und einen Moment lang sah sie unter den dichten, dunklen Brauen das Gesicht ihres Sohnes in seinem. Ja, mit Sicherheit war das Opfer für Poseidon bestimmt. Oder vielleicht auch für Athene, die die Griechen schon so lange beschützte, oder für Hera, die die Trojaner hasste, ganz gleich, wie viele Rinder sie ihr zu Ehren schlachteten.
Sie gingen um das ehemalige Schlachtfeld herum, in Richtung Bucht. Euryleon würde endlich Sand unter den Füßen spüren, statt immer nur Staub und Stein. Krëusa sah die Veränderung schon jetzt. Der Matsch wurde gröber, und dicke Seegrasbüschel sprossen überall um sie herum aus dem Boden. Tränen wärmten ihre Wangen, als ihr der weiche Westwind in die Augen blies. Ihr Mann streckte seine vernarbte Hand aus und wischte sie mit dem Daumen ab.
»Ist es zu viel?«, fragte er. »Möchtest du zurück?«
»Noch nicht.«
Auch jetzt spürte Krëusa Tränen auf ihrem Gesicht, aber sie weinte nicht aus Angst, obwohl sie natürlich Angst hatte und Aeneas nicht da war, um sie zu trösten. Rauchschwaden erfüllten die Straßen, und sicherlich bildeten die Tränen rußige Rinnsale auf ihren Wangen.
Sie bog auf einen Pfad ab, von dem sie glaubte, dass er sie zum unteren Teil der Stadt führen würde, von wo aus sie an der Stadtmauer entlang zum Tor gelangen könnte. Zehn Jahre lang war sie im Inneren der Stadt eingeschlossen gewesen und war jeden kleinen Pfad, jede Gasse tausende Male entlanggelaufen. Sie kannte jedes Haus, jede Ecke, jede Windung und Biegung. Aber obwohl sie sich ihres Weges so sicher gewesen war, war er ihr plötzlich versperrt: eine Sackgasse. Sie spürte, wie Panik in ihrer Brust aufstieg, und schnappte nach Luft, wobei sie sich an der öligen Schwärze in ihrer Kehle verschluckte.
Die Männer, die an ihr vorbeiliefen, hatten sich gegen den Rauch Tücher vor den Mund gebunden. Waren es Griechen? Trojaner? Sie konnte es nicht mehr erkennen. Verzweifelt schaute sie sich nach etwas um, mit dem sie sich auch ein wenig vor dem beißenden Rauch schützen konnte. Aber ihre Stola war zuhause, unerreichbar, selbst wenn sie den Weg zurückfinden würde.
Krëusa wollte innehalten und versuchen, etwas zu erkennen, das ihr erlauben würde, sich zu orientieren und den besten Weg aus der Stadt heraus zu finden. Aber sie hatte keine Zeit. Sie bemerkte, dass der Rauch an ihren Füßen dünner war, und ging kurz in die Hocke, um wieder zu Atem zu kommen. Die Feuer breiteten sich in alle Richtungen aus und schienen rasch näher zu kommen, auch wenn das durch den Rauch schwer einzuschätzen war. Sie ging wieder zurück zur ersten Kreuzung und spähte erst nach links, wo es ein bisschen heller zu sein schien, und dann nach rechts, wo schwärzeste Dunkelheit herrschte. Sie erkannte, dass sie sich vom Licht entfernen musste. Denn dort, wo es hell war, tobten die Feuer am wildesten. Also machte Krëusa sich auf den Weg in die Dunkelheit.
Die Sonne hatte sie geblendet, als sie und Aeneas auf der tiefer gelegenen Landzunge angekommen waren, auf der das griechische Lager gelegen hatte. Nur von den höchsten Punkten Trojas – der Zitadelle und dem Wachturm – war das Lager zu sehen gewesen.
Jedes Mal, wenn ihr Mann außerhalb der Stadtmauern kämpfte, war Krëusa dorthin hinaufgestiegen. Wenn sie ihn auf der Ebene beobachtete, konnte sie ihn beschützen. Das hatte sie sich zumindest eingeredet, selbst wenn sie ihn inmitten von Schlamm, Blut und glänzenden Klingen nicht erkennen konnte. Und jetzt war er hier und ging neben ihr her, die Hand auf ihrem Arm. Sie hatte erwartet, eine riesige Erleichterung zu spüren, wenn sie die geräumte Bucht und das verlassene Lager sehen würde. Aber als sie und Aeneas um die staubige Ecke bogen, bemerkte sie kaum, dass die Trümmer und Boote am Ufer fehlten. Wie bei den anderen Trojanern vor ihnen wanderten ihre Blicke nach oben, zu dem riesigen Pferd.
Es war die größte Opfergabe, die sie alle je gesehen hatten. Selbst die trojanischen Männer staunten, die zu friedlichen Zeiten schon in Griechenland gewesen waren. Immer mussten die Griechen so prahlen. Ihre Opfergaben an die Gottheiten waren unermesslich extravagant. Warum eine Kuh opfern, wenn es auch eine Hekatombe sein konnte? Der Geruch von brennendem Fleisch hatte die Straßen von Troja erfüllt, damals, als Krëusa selbst nichts zu essen gehabt hatte, außer einer kleinen Tasse Gerstenmalz mit ein wenig Milch. Das machten die Griechen mit Absicht, das wusste sie natürlich: Sie präsentierten die Kadaver vor der belagerten Stadt. Aber um die Trojaner zu brechen, brauchte es mehr als Hunger. Und während der Krieg sich von einem Jahr ins nächste zog, hatte Krëusa den Verdacht, dass die Griechen ihre frühere Großzügigkeit gegenüber den Göttern bereuten. Hätten sie stattdessen ein paar Rinder behalten, hätten sie mittlerweile bestimmt eine gute Herde gehabt. Das Seegras hätte die Herde ernährt und die Herde wiederum die Soldaten, die jedes Jahr dünner wurden.
Aber die Opfergabe jetzt war so groß, dass sie der Wahrnehmung einen Streich spielte. Krëusa schaute einen Moment lang weg und war, als sie den Blick wieder auf die Holzplanken richtete, aufs Neue schockiert: Die Skulptur türmte sich über ihnen auf, viermal so groß wie ein Mann. Und auch wenn die Konstruktion sehr einfach war – was hätte man auch sonst von den Griechen erwarten können –, war die Figur doch sofort als Pferd zu erkennen: Sie hatte vier Beine und einen langen Grasschwanz, ein Maul, wenn auch keine Mähne. Das Holz war mit einer groben Axt geschnitten worden, aber die Teile waren immerhin ordentlich zusammengenagelt. Das hölzerne Tier hatte Bänder um die Stirn, um es als Opfergabe zu kennzeichnen.
»Hast du so etwas schon einmal gesehen?«, flüsterte Krëusa ihrem Mann zu. Er schüttelte den Kopf. Natürlich nicht.
Die Trojaner traten vorsichtig an das hölzerne Pferd heran, als könne es plötzlich zum Leben erwachen und mit den Zähnen nach ihnen schnappen. Es war dumm, vor einem Abbild Angst zu haben, aber warum war es das Einzige, was die feindliche Armee zurückgelassen hatte?
Die trojanischen Männer begannen, darüber zu beraten, was damit passieren sollte. Die Frauen blieben zurück und unterhielten sich murmelnd über das seltsame Wesen. Vielleicht sollten sie darunter Gräser und Zweige aufschichten und es verbrennen? Wenn es ein Opfer an eine Gottheit war, die bei der Rückreise nach Griechenland für guten Wind sorgen sollte – was ja wahrscheinlich der Fall sein dürfte, auch wenn Krëusa gehört hatte, dass die Griechen schon hässlichere Opfer dargebracht hatten –, konnte Troja dann den Feinden einen letzten Schlag zufügen, indem sie deren Opfergabe zerstörten? Würde das dafür sorgen, dass die Gottheiten die Griechen im Stich ließen? Oder sollten sie das Pferd nehmen und es den Gottheiten in eigenem Namen darbringen?
Was als geflüstertes Gespräch begonnen hatte, artete bald in Geschrei aus. Männer, die Seite an Seite gekämpft hatten, Waffen- und Blutsbrüder, schnauzten sich nun gegenseitig an. Das Pferd müsste verbrannt oder gerettet werden, es solle ins Meer gestürzt oder hinauf in die Stadt gebracht werden.
Krëusa wünschte, sie könnte ihnen Ruhe gebieten. Sie wollte sich einfach in die Dünen legen, Arme und Beine ausstrecken und den Sand auf der Haut spüren. Es war schon so lange her, dass sie frei gewesen war. Was kümmerten Troja die Opfer der Griechen? Sie griff nach Euryleons Hand und zog ihn näher an sich heran, als Aeneas vortrat, kurz Krëusas Arm drückte und davonging. Er wollte zwar nicht in einen Streit verwickelt werden, aber er wollte sich seiner Verantwortung als Verteidiger Trojas auch nicht entziehen.
Die Männer hatten den Krieg ganz anders erlebt als die Frauen, die Tag für Tag auf die Männer gewartet, sich um sie gekümmert und ihnen jeden Abend etwas zu essen gemacht hatten. Krëusa wurde klar, dass der Ort, an dem sie jetzt standen – und den sie am liebsten, ohne all die anderen Trojanerinnen und Trojaner, nur mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Frieden genießen wollte –, für Aeneas immer noch ein Schlachtfeld war.
Plötzlich verstummte das Geschrei, als eine gebeugte Gestalt mühevoll an Krëusa vorbeischlurfte. Ein dunkelrotes Gewand gab den Blick auf knorrige Füße frei. Priamos hatte den Gang eines alten Mannes, der er ja auch war, aber den Kopf hielt er nach wie vor erhoben wie ein König. Seine stolze Königin, Hekabe, ging neben ihm bis in die Mitte der Menge. Sie blieb nicht zurück wie die anderen Frauen.
»Genug!«, sagte Priamos. Seine Stimme schwankte ein wenig. Euryleon begann, an Krëusas Kleid zu zupfen. Er wollte ihre Aufmerksamkeit für etwas, das er gesehen hatte – einen Käfer, der sich langsam und schwerfällig seinen Weg durch den Sand zu ihren Füßen bahnte –, aber sie gab ihm ein Zeichen, leise zu sein. Nichts an diesem ersten Tag außerhalb der Stadtmauern entsprach der Vorstellung, die ihr so oft Licht in die dunklen Tage gebracht hatte. Sie hatte sich nach dem Tag gesehnt, an dem ihr Sohn zum ersten Mal die Tiere an der Küste sehen würde. Stattdessen musste sie ihn nun zum Schweigen bringen, damit der König mit seinen aufgebrachten Untertanen sprechen konnte.
»Wir streiten nicht miteinander«, sagte Priamos. »Nicht heute. Ich werde mir eure Gedanken anhören, einen nach dem anderen.«
Krëusa hörte die Argumente für jedes nur mögliche Schicksal, das das Pferd ereilen könnte, und stellte fest, dass sie sich herzlich wenig dafür interessierte, für was sich Priamos entscheiden würde. Das Pferd verbrennen, das Pferd behalten, was machte das schon für einen Unterschied? Der Letzte, der zu Wort kam, war der Priester. Laokoon war ein beleibter Mann mit geölten schwarzen Locken, der sich immer viel zu gerne selbst reden hörte. Er wollte unbedingt, dass das Pferd gleich hier, wo es stand, verbrannt wurde. Das wäre die einzige Möglichkeit, die Gottheiten, die Troja so viele Jahre lang gebeutelt hatten, zu besänftigen, sagte er. Alles andere wäre ein katastrophaler Fehler.
Der Rauch unzähliger Feuer waberte um Krëusa, während sie sich stolpernd einen Weg zur Stadtmauer bahnte. Sie glaubte, dass sie in die richtige Richtung lief, konnte sich aber nicht sicher sein. Ihre Lungen schmerzten, als würde sie bergauf rennen. Sie konnte nichts erkennen, also streckte sie die Hände aus, eine nach vorne, um sich im Falle eines Sturzes abzufangen, und eine zur Seite, um sich an der Mauer entlangzutasten. Nur so konnte sie sicherstellen, dass sie vorwärtskam.
Krëusa versuchte, den Gedanken nicht an sich heranzulassen, hielt ihn auf Distanz, bevor sie ihn ganz von sich wegschleuderte. Aber er war nicht abzustreiten: Die Stadt war nicht mehr zu retten. Überall tobten Brände. Immer mehr hölzerne Dächer fingen Feuer, und der Rauch wurde immer dicker. Wie viele Flammen konnten aus einer steinernen Stadt hervorgehen? Sie dachte an all das, was bei ihr zuhause verbrennen könnte: ihre Kleider, ihr Bettzeug, die Wandteppiche, die sie gewoben hatte, als sie mit Euryleon schwanger war. Das plötzliche Gefühl des Verlustes brannte sich in sie ein, als wäre sie in die Flammen gefallen. Sie hatte ihr Zuhause verloren. Zehn Jahre lang hatte Krëusa gefürchtet, dass die Stadt fallen würde, und jetzt fiel sie um sie herum, während sie floh.
Aber wie konnte das sein? Troja hatte den Krieg gewonnen. Die Griechen waren davongesegelt, und als die Trojaner das Holzpferd gefunden hatten, hatten sie genau das getan, was der Mann ihnen aufgetragen hatte. Und plötzlich stürmte alles auf sie ein, und Krëusa wusste, was ihre Stadt in Flammen gesetzt hatte. Es waren die zehn Jahre eines Konfliktes gewesen, dessen Helden bereits Eingang in Lieder und Dichtung gefunden hatten. Doch der Sieg gehörte keinem der Männer, die vor den Stadtmauern gekämpft hatten, weder dem Achill noch dem Hektor, beide waren sie längst tot. Stattdessen gehörte der Sieg dem Mann, den sie im Schilf gefunden hatten, in der Nähe des Holzpferdes, und der gesagt hatte, sein Name wäre – Krëusa konnte sich nicht erinnern. Es war ein Zischlaut gewesen, wie der einer Schlange.
»Sinon«, hatte der Mann geschluchzt. Er war auf die Knie gefallen. Zwei Speere waren auf seinen Nacken gerichtet. Die trojanischen Wachen hatten ihn in dem niedrigen Gebüsch am anderen Ufer des Skamandros gefunden, dort, wo der Fluss sich weitete und ins Meer mündete. Sie hatten ihn – einer an jeder Seite, mit Messern und Speeren bewaffnet – in die Mitte der Trojaner getrieben. Die Hände des Gefangenen waren an den Handgelenken zusammengebunden, und an seinen Fußknöcheln waren bösartige rote Striemen zu sehen, als hätten ihn auch dort die Riemen gebissen.
»Wir hätten ihn fast nicht gesehen«, sagte einer der Späher und gab dem Gefangenen mit seinem Speer einen Stoß. Der Mann unterdrückte einen Aufschrei, obwohl die Waffe seine Haut nicht verletzt hatte. »Nur wegen seiner roten Stirnbinde haben wir ihn überhaupt entdeckt.«
Der Gefangene bot einen seltsamen Anblick: Sein mausgraues Haar kräuselte sich in seinem Nacken, und wenn es je geölt gewesen sein sollte, so war es jetzt bloß noch mit dem Schlamm verfilzt, der so viel von seiner nackten Haut bedeckte. Er trug einen Lendenschurz, sonst nichts. Selbst seine Füße waren nackt. Und dennoch war um seine Schläfe ein rotes Band gebunden. Es schien kaum möglich zu sein, dass ein solch schmutziger Mann – eher Tier als Mensch, dachte Krëusa – etwas an sich trug, das so hübsch und sauber war. Der Gefangene stieß ein klägliches Heulen aus.
»Was mich damals umbringen sollte, wird jetzt mein Tod!«
Krëusa konnte ihre Abscheu über den schmutzigen, weinenden Griechen nicht verbergen. Warum hatten ihn die Späher nicht gleich an Ort und Stelle umgebracht?
Priamos hob zwei Finger seiner linken Hand. »Ruhe«, sagte er. Die Menge verstummte, und selbst die rasselnden Schluchzer des Gefangenen wurden leiser.
»Du bist ein Grieche?«, fragte Priamos. Sinon nickte. »Und sie haben dich trotzdem zurückgelassen?«
»Nicht mit Absicht, König.« Sinon hob die Hände, um sich Schleim vom Gesicht zu wischen. »Ich bin ihnen davongelaufen. Ich weiß, die Götter werden mich bestrafen. Aber ich konnte es nicht ertragen …« Wieder fing er an zu schluchzen.
»Reiß dich zusammen«, sagte Priamos. »Sonst töten dich meine Männer direkt dort, wo du jetzt kniest, und dein Blut wird Futter für die Möwen.«
Sinon schluchzte ein letztes Mal laut auf und holte Luft. »Vergebt mir.«
Priamos nickte. »Du bist ihnen davongelaufen?«
»Ja, obwohl ich als Grieche geboren wurde und mein ganzes Leben lang an der Seite der Griechen gekämpft habe«, antwortete Sinon. »Ich kam mit meinem Vater hierher, als ich noch ein kleiner Junge war. Er ist vor vielen Jahren in den Schlachten umgekommen, getötet von Eurem großen Krieger, Hektor.«
Ein Raunen ging durch die Menge.
»Bitte.« Sinon schaute sich zum ersten Mal um. »Ich möchte nicht respektlos sein. Wir kämpften für gegnerische Lager. Und Hektor tötete meinen Vater nicht auf bösartige Weise. Er schlug ihn auf dem Schlachtfeld und stahl nichts von seinem Leichnam, nicht einmal seinen Schild, der fein geschmiedet war. Ich hege keinen Groll gegen Hektors Familie.«
Hektors Verlust war so schrecklich und noch so frisch, dass sich Schatten auf Priamos’ Gesicht legten. Für Krëusa sah es fast so aus, als hätte sich der König einen Moment lang selbst verloren. Vor ihr, vor ihnen allen, stand kein König, sondern ein gebrochener alter Mann, dessen gebrechlicher Hals kaum noch die goldenen Ketten tragen konnte, die ihn noch immer schmückten. Vielleicht hatte der Gefangene das auch bemerkt, denn er schluckte, und als er fortfuhr, war seine Stimme leiser. Er sprach jetzt nur mit dem König. Krëusa musste sich Mühe geben, um ihn zu verstehen.
»Aber mein Vater hatte Feinde, mächtige Feinde unter den Griechen«, sagte Sinon. »Und leider zogen wir besonders die Feindschaft von zwei Männern auf uns, auch wenn ich schwöre, dass weder mein Vater noch ich das in irgendeiner Weise verdient hätten. Trotzdem waren Kalchas und Odysseus gegen ihn und damit auch gegen mich, von Anfang an.«
Bei dem verhassten Namen Odysseus konnte Krëusa ein Schaudern nicht unterdrücken.
»Wer Odysseus zum Feind hat, hat mit uns etwas gemein«, sagte Priamos langsam.
»Danke, König. Er ist der meistgehasste aller Männer. Die gewöhnlichen griechischen Soldaten verabscheuen ihn. Er führt sich auf, als wäre er ein mächtiger Krieger oder ein edler König. Aber im Kampf ist er nicht besonders gut, und Ithaka – sein Königreich, wie er es nennt – ist nicht mehr als ein Felszipfel, um den ihn niemand beneidet. Und dennoch wird er von unserem Anführer Agamemnon und den anderen immer wie ein Held behandelt. Und so ist seine Arroganz ins Unermessliche gewachsen.«
»Ohne Zweifel«, sagte Priamos. »Aber nichts davon erklärt, warum du hier bist oder warum deine Landsleute alle so unerwartet verschwunden sind. Auch der Name Kalchas sagt mir nichts.«
Sinon blinzelte mehrere Male. Er erkannte, dachte Krëusa, dass er schnell zur Sache kommen musste oder sein Recht, zu sprechen, für immer vertan hatte.
»Die Griechen wussten schon seit einer Weile, König, dass sie fortmüssen. Kalchas ist ihr oberster Priester, und er hat die Götter um bessere Nachrichten gebeten. Aber deren Antwort war schon seit letztem Winter immer dieselbe: Troja wird an keine griechische Armee fallen, die vor den Toren lagert. Agamemnon wollte das natürlich nicht hören, und sein Bruder, Menelaos, auch nicht. Aber irgendwann konnten sie es nicht mehr verleugnen. Die Griechen hatten genug davon, so weit weg von zu Hause zu sein. Sie konnten den Krieg nicht gewinnen, also war es besser, zu nehmen, was sie schon erbeutet hatten, und in See zu stechen. Dafür sprachen sich viele der Männer aus …«
»Auch du?«, fragte Priamos.
Sinon lächelte. »Nicht in den offiziellen Diskussionen«, sagte er. »Ich bin kein König. Ich würde nie das Wort bekommen. Aber unter den gewöhnlichen Soldaten schon: Da war ich auch dafür, dass wir fahren sollten. Ich war der Meinung, dass wir nie hätten kommen sollen. Doch damit machte ich mich unbeliebt. Nicht beim einfachen Fußvolk, die sahen das genauso. Aber bei den Anführern, bei den Männern, deren Ruf von diesem Krieg abhing, wie Odysseus. Und dennoch: An einer Nachricht, die direkt von den Göttern kam, war nicht zu rütteln. Also stimmten sie widerwillig zu, die Segel zu setzen und nach Hause zu fahren.«
»Und dich haben sie zur Strafe zurückgelassen?«, fragte Priamos. Seine Wachen hatten ihre Speere ein wenig gesenkt, sodass Sinon deren Spitzen nun nicht mehr direkt an der Kehle hatte, wenn er sprach.
»Nein, König.« Er saugte für einen Moment seine schlamm- und tränenverschmierten Wangen ein. »Ihr kennt die Geschichte von der Reise der Griechen nach Troja? Wie wir unsere Flotte in Aulis versammelt hatten, aber dann nicht segeln konnten, weil die Winde ausblieben?«
Die Trojaner um ihn herum nickten. Diese Geschichte hatten sie alle schon gehört und selbst erzählt: wie die Griechen die Göttin Artemis so beleidigt hatten, dass diese ihnen den Wind nahm, bis sie sie wieder besänftigen konnten. Das Schreckliche daran war, dass sie dies mit einem Menschenopfer erreicht hatten. Wer in Troja wusste nicht von dieser furchtbaren, so typischen Grausamkeit?
»Als es Zeit wurde, nach Griechenland zurückzukehren, haben Kalchas und Odysseus zusammen einen Plan ausgeheckt«, fuhr Sinon fort. »Der König von Ithaka wollte sich die Gelegenheit, mich loszuwerden, nicht entgehen lassen.«
Krëusa blickte wieder auf die rote Stirnbinde des Gefangenen und spürte ein Prickeln hinter ihren Augenlidern. Er würde doch sicher nichts derart Schreckliches sagen?
»Ich sehe, Ihr versteht, was ich meine, König«, sagte Sinon. »Kalchas hat in der Versammlung der Griechen verkündet, dass die Götter ein Opfer gewählt hatten: Es wäre mein Blut, das sie von einem provisorischen Altar trinken wollten. Die anderen Soldaten protestierten zwar ein wenig, aber letztlich waren sie froh, dass es nicht sie selbst getroffen hatte.«
»Ich verstehe«, sagte Priamos. »Sie wollten dich opfern wie ein Tier.«
»Sie waren nicht nur fest dazu entschlossen, sie haben mich auch schon dementsprechend vorbereitet. Sie fesselten mir die Hände.« Sinon hob seine Arme, damit sie die schmutzigen Riemen sehen konnten, die seine Handgelenke immer noch zusammenhielten. »Und die Füße. Sie salbten mein Haar und banden mir die Stirnbinde um. Denn natürlich musste alles an ihrer Opfergabe perfekt sein. Aber meine Fußfessel war nicht ganz so fest wie diese«, er schüttelte seine erhobenen Hände, »und als die Wachen mich einen Moment aus den Augen ließen, konnte ich mich befreien.« Das erklärte die roten Striemen an seinen Fußgelenken.
»Ich wusste, dass die Wachen mich bald zum Opferaltar schleppen würden. Also bin ich geflohen. Zuerst konnte ich nur kriechen, doch dann lief ich, so schnell ich konnte, so weit wie möglich vom Lager weg. Als ich die Schreie der Wachen hörte, hatte ich es fast bis zum Ufer geschafft und versteckte mich im Schilf.«
Wieder rannen dem Mann Tränen über die Wangen, und eine derartige Nässe spiegelte sich auch auf dem Gesicht des trojanischen Königs wider. Krëusa bemerkte, dass sie ebenfalls weinte. Das war eine furchtbare Geschichte, selbst für diejenigen, denen die Grausamkeit der Griechen nicht unbekannt war. Priamos’ Frau Hekabe sah kommentarlos zu: Ihre Lippen hatten sich zu einer schmalen, dünnen Linie verformt, ihre grauen Augenbrauen waren zusammengezogen.
»Ich hörte, wie die Männer nach mir suchten«, sagte Sinon. »Ich hörte, wie sie das Gras mit ihren Speeren und Peitschen niederdroschen, und wünschte mir verzweifelt, weiter weglaufen zu können. Doch ich wusste, dass ich nicht riskieren durfte, gesehen zu werden. Also wartete ich ab, während der längsten Nacht meines Lebens, und betete zu Hera, die schon immer meine Beschützerin gewesen war. Und am nächsten Morgen waren meine Gebete erhört worden. Die Griechen hatten beschlossen, diese hölzerne Opfergabe zu bauen und den Göttern nun das Pferd darzubringen und nicht mich. Sie bauten die Holzfigur, opferten sie und setzten dann die Segel ohne mich. Trotz meines Unglückes habe ich also ein paar Tage länger gelebt, als mir eigentlich vergönnt waren. Jetzt werdet Ihr mich töten, König, und zu Recht: Ich bin einer der Männer, die herkamen, um Eure Stadt auszulöschen, und ich habe es verdient, wie ein Feind behandelt zu werden, auch wenn ich erst ein kleiner Junge war, als ich hierhergebracht wurde. Ich habe keine Familie, die ein Lösegeld für mich zahlen könnte. Ich bitte Euch daher auch nicht, meinen Leichnam zu trauernden Verwandten nach Hause zu schicken, denn ich habe keine. Ich habe nur eine einzige Bitte an Euch.«
»Und die wäre?«, fragte Priamos.
»Nehmt das Pferd.«
Krëusa war schwer gestürzt und spürte, wie das Blut Zentimeter für Zentimeter an ihren Schienbeinen hinablief, als sie sich wieder aufrappelte. Vor sich konnte sie nun fast nichts mehr erkennen. Aber die Hitze in ihrem Rücken sagte ihr, dass sie den einzig richtigen Fluchtweg gewählt hatte. Stand hinter ihr alles in Flammen? Sie brachte es nicht über sich, sich umzudrehen und nachzuschauen, wusste sie doch, dass der Feuerschein sie blenden und ihr eine Weile die Sicht nehmen würde, wenn sie sich wieder der Dunkelheit vor ihr zuwandte. Genau das – an die pragmatischen Dinge zu denken, die sie tun oder nicht tun konnte – war es, das sie auf den Beinen hielt, obwohl sie nichts in ihrem Leben auf das vorbereitet hatte, was gerade geschah. Auch wenn sie lieber ihr Kleid anheben und wegrennen wollte, machte sie kurze, schnelle Schritte, um es weniger wahrscheinlich zu machen, dass sie wieder stolperte oder mit irgendwas zusammenstieß.
Sie war fast froh, als sie meinte, wieder in einer Sackgasse gelandet zu sein. Kurz davor, sich ihrer Verzweiflung hinzugeben, starrte sie in den Rauch und glaubte, weiter links einen schmaleren Durchgang zwischen zwei Hauswänden ausmachen zu können. Sie versuchte, sich in Erinnerung zu rufen, wer dort wohnte, sich zu orientieren, als eine Gruppe Soldaten aus dem am weitesten entfernten Haus drängte. Sie drückte sich an die gegenüberliegende Hauswand und blieb so unentdeckt. Die Männer lachten, als sie den schmalen Durchgang hinunterliefen, durch den auch Krëusa entkommen wollte. Sie musste nicht hören, was die Soldaten sagten, um zu wissen, dass die Männer alle, die sie im Haus vorgefunden hatten, umgebracht hatten. Krëusa wartete, bis die Krieger verschwunden waren, bevor sie wagte, ihnen zu folgen. Während sie eben noch krampfhaft versucht hatte, sich zu erinnern, an wessen Haus sie gerade vorbeikam, so war sie jetzt froh, dass ihr das nicht gelungen war. Sie wollte nicht wissen, wem die Männer gerade die Kehle aufgeschlitzt hatten.
Sie strich mit den Fingern an der Wand entlang und ging jetzt langsamer, damit die Männer sie nicht hinter sich bemerkten. Als der Durchgang sich endlich zur Straße hin öffnete, sah sie, dass sie es geschafft hatte. Sie hatte den Weg zur Stadtmauer gefunden.
»Nehmt das Pferd«, sagte Sinon. »Wenn ihr das tut, so nehmt ihr ihnen dessen Wirkmacht. Sie haben es hier gebaut und es der Athene geweiht, der Schutzgöttin der Griechen. Sie glaubten, es sei zu groß, als dass ihr Trojaner es in eure Stadt ziehen könntet. Sie haben gesehen, wie weit die Ebene ist und wie hoch eure Akropolis, und sie lachten bei der Vorstellung, dass ihr es euch nehmen könntet.«
»Woher weißt du das?«, fragte Hekabe. Ihr Griechisch war rudimentär, aber klar.
»Vergebt mir, Königin, ich verstehe nicht, was Ihr meint«, antwortete der Gefangene.
»Woher weißt du, was sie über das Pferd dachten?«, wiederholte sie. »Wenn du dich in Todesangst im Schilf versteckt hieltst. Du sagtest, sie hätten das Pferd gebaut, nachdem du fortgelaufen bist. Woher weißt du dann, worüber sie gesprochen haben?«
Krëusa glaubte, einen Anflug von Ärger auf dem Gesicht des Mannes aufflackern zu sehen. Aber als er den Mund wieder öffnete, zitterte seine Stimme immer noch vor Kummer.
»Es war ihr ursprünglicher Plan, Herrscherin. Bevor Kalchas und Odysseus gegen mich intrigiert haben. Die Griechen wollten ein riesiges Pferd bauen und es mit der größtmöglichen heiligen Macht ausstatten. Dann wollten sie es vor euren Mauern zurücklassen, um euch zu verspotten: ein Zeichen der Göttin, die sie sicher nach Hause geleitete. Eine arrogante Geste, wie sie Agamemnon nur zu ähnlich sieht.« Hekabe runzelte die Stirn, sagte aber nichts weiter.
»Also, bitte, König«, fügte Sinon hinzu. »Beraubt sie ihrer sicheren Heimreise. Bringt das Pferd vor Einbruch der Dunkelheit in Eure Zitadelle. Eure Männer könnten es ziehen. Ich werde meine eigene Schulter in die Seile stemmen, wenn Ihr es mir nur erlaubt. Alles, um es diesen niederträchtigen Griechen, die mir ohne zu zögern mein Leben genommen hätten, ein wenig heimzuzahlen. Wenn Ihr mich dabei helfen lasst, das Pferd zum höchsten Punkt Eurer Stadt zu ziehen, werde ich mich ins Schwert eines Eurer Männer stürzen, sobald die Aufgabe vollbracht ist.«
»Nein.« Laokoon, der Priester, konnte nicht länger an sich halten. »Ich flehe Euch an, König. Das Pferd ist verflucht, und wir werden ebenso verflucht sein, wenn wir es in unsere Stadt holen. Der Mann spricht mit falscher Zunge. Entweder er betrügt, oder aber er wird selbst betrogen. Das Pferd darf nicht ins Innere der Stadt gelangen. Lasst es uns verbrennen, wie ich vorgeschlagen habe.« Er hob seinen kräftigen Arm und warf den Speer, den er in der Hand gehalten hatte, auf die Flanke des Pferdes. Dort blieb die Waffe stecken und vibrierte einen Moment lang summend in dem schockierten Schweigen, das den Worten des Priesters gefolgt war.
Krëusa wusste nicht genau, was als Nächstes passiert war. Sie sah die Schlangen nicht selbst, wie viele andere es von sich behaupteten. Sie hatte nicht zum Schilf geschaut. Sie schaute den Mann an, Sinon, und sein schmutziges, ausdrucksloses Gesicht. Das einzige Anzeichen dafür, dass er Laokoons Worte verstanden hatte, war das Zittern seines Bizeps gegen die Riemen, mit denen er immer noch gefesselt war. Laokoons Kinder mussten einfach hinaus ins Wasser gelaufen sein. Warum auch nicht? Sie hatten längst keine Lust mehr darauf gehabt, den Männern beim Streiten zuzuhören, und waren – genau wie alle anderen Kinder Trojas –noch nie am Ufer gewesen, hatten noch nie im Sand gespielt. Es war also nur natürlich, dass sie davongeschlendert und dem Fluss ein kleines Stück gefolgt waren, bis sie die Wellen am Strand erreicht hatten. Von dort waren die beiden unbemerkt ins flache Wasser hinausgewatet, bevor auch nur irgendjemand ihr Verschwinden entdeckt hatte.
Der Seetang wuchs in langen, dichten Strängen, das wusste Krëusa. Als Kind hatte ihre Amme sie davor gewarnt, die dunkelgrünen Tentakel im Wasser zu berühren. Denn selbst wenn die Spitzen der Pflanze so dünn waren, dass ein Kind sie zerreißen konnte, war ihr Körper dick und faserig. Es wäre nur allzu leicht gewesen, zu stolpern und den Kontakt zum Boden zu verlieren. Und das war sicher das, was Laokoons Söhnen passiert war. Einer der beiden musste mit dem Fuß in einer Schlinge aus Seegras hängengeblieben und hingefallen sein. Der andere, der zu seinem Bruder gestürzt war, um diesen aus dem Wasser zu befreien, fand sich in derselben misslichen Lage wieder. Seine schwachen Hilferufe wurden von der Meeresbrise davongetragen.
Als Laokoon – viel zu spät – loslief, um seine Kinder zu retten, hatten die Wasserpflanzen eine bösartige Gestalt angenommen. Diese riesigen Seeschlangen, so sagte jemand, waren von den Gottheiten geschickt worden, um den Priester dafür zu bestrafen, dass er die Opfergabe mit seinem Speer geschändet hatte. Kaum waren diese Worte ausgesprochen, schenkte man ihnen Glauben.
Während der Priester auf dem Sand kniete und weinend seine ertrunkenen Kinder an sich drückte, hätte Priamos’ Wahl kaum anders ausfallen können. Die Götter hatten den Priester bestraft. Diese Warnung mussten die Trojaner ernst nehmen und folglich den Worten des Gefangenen, den Worten Sinons, Folge leisten. Sie legten Baumstämme unter das Pferd und zerrten es so über die Ebene, wobei die Männer abwechselnd an den langen Seilen zogen. Anschließend rollten sie die Statue durch die Stadt, wobei ihre Konstruktion kaum in die Furchen passte, die die Wagenräder mit der Zeit in die Straßen gegraben hatten. Sie zogen das Pferd bis zur Zitadelle hinauf und jubelten, als sie endlich den höchsten Punkt erreichten. Dort krempelten die Männer die Ärmel hoch und rieben sich die schmerzenden Muskeln. Priamos verkündete, dass den Göttern ein Opfer dargebracht werden müsse, worauf ein Festmahl folgen würde. Wieder jubelte ganz Troja, als die Feuer entzündet und das Fleisch gebraten wurde. Sie schenkten Wein aus, erst für die Götter, dann für sich selbst. Endlich hatte Troja den Krieg gewonnen.
Krëusa drehte sich um und schaute zurück auf ihre brennende Stadt. Sie hatte es bis zu den Festungsmauern geschafft, sah aber jetzt, dass das Feuer schon vor ihr dort angekommen war. Sie konnte nicht an der Mauer entlang zum Tor laufen, so wie sie es ursprünglich geplant hatte: Der Weg stand in Flammen. Hätte sie genau dort, wo sie jetzt gerade stand, die Mauer erklimmen können, wäre sie vielleicht entkommen. Aber die Mauer war zu hoch und zu steil, und Krëusa sah keine Unebenheiten, wo sie mit Händen oder Füßen Halt gefunden hätte. Die Männer, denen sie gefolgt war, stellten keine Bedrohung mehr für sie dar: Erstickt im dichten Rauch hatten sie in ihrem Drang nach Zerstörung ihr Leben verloren. Ihre Leichen lagen vor Krëusa auf dem Boden, wo sie bereits vom Feuer verzehrt wurden.
Krëusa verstand die Misslichkeit ihrer Lage sehr viel schneller als die Vögel, die über ihrem Kopf sangen – auf Dächern, die noch nicht abgebrannt waren –, obwohl der Himmel schwarz und der Mond von dichtem, grauem Rauch verdeckt war. Die Feuer in der Stadt strahlten so hell, dass die Vögel dachten, es sei schon Morgen geworden, und Krëusa wusste, dass sie sich an diese seltsame Begebenheit – an das Feuer, die Vögel und die Nacht, die zum Tag geworden war – erinnern würde, solange sie lebte.
Und das tat sie, auch wenn das kaum Bedeutung hatte, denn Krëusa war tot, lange bevor der Morgen dämmerte.
3Die Frauen von Troja
Die Frauen warteten am Ufer, starrten mit leerem Blick aufs Meer hinaus. Der salzig-säuerliche Geruch nach getrockneten, grünen Wasserpflanzen und den abgeknickten, braunen Schilfstängeln kämpfte gegen den Rauchgestank, der ihrer Kleidung und ihrem verfilzten Haar anhaftete. Nach zwei Tagen stellten die Griechen endlich die systematische Plünderung der verkohlten Stadt ein. Während die Frauen darauf warteten, herauszufinden, wem sie jetzt gehörten, drängten sie sich um ihre Königin, als könnte deren letzte Glut sie wärmen.
Königin Hekabe, eine kleine, runzlige Gestalt mit halb versunkenen Augen, saß auf einem von Wasser und Salz geschliffenen Felsblock und versuchte, nicht an ihren Mann zu denken. Priamos hatte sich an den Altar geklammert, während ihm ein bösartiger Grieche die Kehle durchgeschnitten hatte. Das dunkle Blut war ihm über die Brust gelaufen, als sein Kopf von der Klinge seines Mörders zurückfiel. Noch etwas, das Hekabe gelernt hatte, während ihre Stadt brannte: Die Alten starben anders als die Jungen. Sogar ihr Blut floss langsamer.
Ihr Mund verhärtete sich. Der grobe Kerl, der Priamos abgeschlachtet hatte – einen alten Mann, der um den Schutz eines Gottes flehte –, würde für seine Respektlosigkeit, seine Grausamkeit, seine Pietätlosigkeit bezahlen. Das war das Einzige, woran sie sich festklammern konnte, jetzt, wo alles andere verloren war: Ein Mann konnte unmöglich die Heiligkeit eines Tempels missachten und weiterhin ein blühendes Leben führen. Es gab Regeln. Selbst im Krieg gab es Regeln. Menschen mochten sie ignorieren, aber die Gottheiten würden sie wahren. Und einen Mann niederzumetzeln, der auf seinen alten, schmerzenden Knien um Verschonung flehte? Ein solches Betragen war unverzeihlich, und die Gottheiten – das wusste die Königin der qualmenden Überreste von Troja nur allzu genau – verziehen äußerst ungern.
Sie biss sich auf die Innenseite ihrer Wange und hieß den metallischen Geschmack willkommen. Im Kopf ging sie erneut die Listen durch: die Listen der Söhne, die im Gefecht gefallen waren, der Söhne, die bei Angriffen getötet worden waren, der Söhne, die vor zwei Nächten ums Leben gekommen waren, als die Stadt geplündert wurde. Mit dem Tod eines jeden Einzelnen vertrocknete ein weiterer Teil in ihr, wie eine Tierhaut, die zu lange in der Sonne gelegen hatte. Als Hektor starb, als der Schlächter Achill ihren tapfersten Krieger-Sohn geholt hatte, hatte Hekabe gedacht, dass nichts mehr übrig geblieben wäre, was noch vertrocknen konnte. Aber eine Göttin – sie wagte es nicht, Heras Namen auszusprechen – musste selbst diesen lästerlichen Gedanken gehört und dann beschlossen haben, sie noch weiter zu bestrafen. Und das alles nur wegen einer Frau, wegen dieser einen berechnenden spartanischen Hure. Hekabe spuckte das Blut in den Sand. Ihr Wunsch nach Rache war allumfassend und vergeblich.
Ihr Blick blieb an einem Vogel hängen, der sich im Wind drehte und zurück ans Ufer flog. War das ein Zeichen? Die Flugbahn der Vögel brachte oft Nachrichten von den Gottheiten, aber nur geübte Priester und Priesterinnen wussten die Sprache der Flügel zu deuten. Dennoch war sie sich sicher, dass es sich gerade um eine einfache Nachricht gehandelt hatte: Es gab noch einen Jungen – einen einzigen, von all ihren wunderschönen Söhnen, so groß, so stark –, der nach wie vor am Leben war.
Und zwar nur, weil die Griechen nicht wussten, wo er sich befand, oder überhaupt, dass er existierte. Sie hatten ihren jüngsten Sohn im Schutz der Nacht aus der Stadt geschmuggelt und bei einem alten Freund in Thrakien versteckt, den sie gut dafür bezahlt hatten. Selbst Verbündete mussten dazu ermutigt werden, die verlierende Seite zu unterstützen, hatte Priamos gesagt. Und Troja war schon lange am Verlieren gewesen: Nur die starken Mauern und die Unnachgiebigkeit der Stadtbewohner hatten den Angriffen der Griechen zehn Jahre lang standgehalten.
Zusammen mit Priamos hatte sie des Jungen Hab und Gut um vier gewundene Goldadern gewickelt und das Bündel fest zugebunden, bevor sie ihn ziehen ließen. »Gib deinem Gastgeber zwei davon, wenn du ankommst«, rieten sie ihm. »Die anderen beiden versteckst du, und niemand darf wissen, dass du sie hast.« »Was nützen sie mir dann?«, hatte der ehrliche, zutrauliche Junge gefragt.