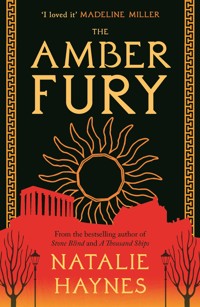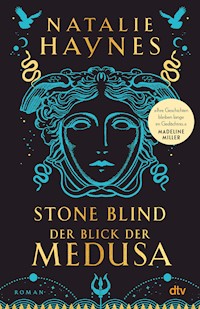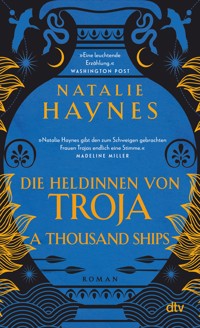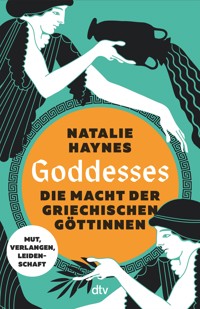
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Unsterbliche Frauen der klassischen Antike, neu entdeckt Die Bestsellerautorin Natalie Haynes nimmt uns mit in die Welt der griechischen Mythologie, zu den Göttinnen des Olymps. Missverständnisse und falsche Darstellungen in Kunst, Literatur und Popkultur verzerren unseren Blick, doch mit diesem Buch sehen wir Frauenfiguren, die wir schon zu kennen meinen, plötzlich in einem ganz neuen Licht. So ist Athene die Göttin des Krieges, wird aber auch für ihren weisen Rat geschätzt. Aphrodite ist die schönste aller Göttinnen, hat jedoch eine rachsüchtige Seite und bestraft jeden hart, der ihr missfällt. Und die drei Furien, die meist auf blutige Vergeltung aus sind, lehren uns überraschenderweise viel über das heutige Leben. Ein feministisches Retelling antiker Erzählungen, das überrascht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
»Homer beschreibt ausgiebig, wie Hera sich auf die Begegnung mit Zeus vorbereitet: wie sie badet, sich hübsch macht, ihre besten Kleider anzieht. Das alles tut sie – so legt er uns nahe – mit Hintergedanken. Natürlich können wir dies als frühes Beispiel des uralten Topos’ sehen, dass Männer Sex wollen und Frauen dieses Verlangen benutzen, um zu bekommen, was sie wollen. Doch es handelt sich hier nicht um eine Sitcom, und Heras Wünsche sind wirklich gewaltig. Sie ist nicht hinter einem neuen Wintergarten her, sie setzt die unleugbare Macht der Sexualität ein, um die Griechen im größten Konflikt der Epoche zu unterstützen – einem der größten Konflikte der Literaturgeschichte.«
Natalie Haynes
Goddesses
Die Macht der griechischen Göttinnen
Aus dem Englischen von Lena Kraus
Für meine Mum, die Demeter das Wasser reichen kann;
und meinen Dad, bei dem ich Blitz und Donner entfesseln durfte.
Einleitung
Wenn Ochsen und Löwen und Pferde menschliche Hände hätten, wenn sie zeichnen könnten und andere Kunst schaffen, so würden Pferde Gottheiten zeichnen, die wie Pferde aussehen, und Ochsen wie Ochsen, und alle würden die Gottheiten mit Körpern wie ihren abbilden.
Der Philosoph Xenophanes schrieb diese Worte im späten 6. oder frühen 5. Jahrhundert v.d.Z., und seit ich sie als Studentin zum ersten Mal hörte, muss ich immer wieder daran denken. Zuerst interessierte es mich vor allem, der Vorstellung, Gott habe die Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen, zu widersprechen. Hier zeigte nun jemand ein Szenario auf, das mir sehr viel wahrscheinlicher erschien: Wir erschaffen Gottheiten, die uns und den Blick auf uns selbst widerspiegeln. Wenn man Homer gelesen hat, was auf Xenophanes als gebildeten Griechen sicherlich zutraf, war das keine besonders kontroverse Ansicht. Homerische Gottheiten sind kleinlich, aggressiv und generell ziemlich unsympathisch. Sie sind unsterblich, unfassbar mächtig und besitzen in etwa das emotionale Gebaren und den Sinn für Verhältnismäßigkeit eines Kleinkinds, dem jemand sein Lieblingsspielzeug weggenommen hat. Die kleinste Beleidigung und der kleinste Fehlschlag rufen eine schillernde Wut hervor; Gottheiten zögern nicht lange, Menschen und anderen Gottheiten mit Gewalt zu begegnen. Im alten Griechenland hat man die Gottheiten nicht nur ans Ebenbild der Sterblichen angelehnt, man hat sich dabei anscheinend auch noch die schlimmsten Exemplare zum Vorbild genommen.
Für Lesende im 21. Jahrhundert kann es erfrischend sein zu erfahren, wie schlecht sich diese Gottheiten benommen haben: Sie vergewaltigten, mordeten, forderten Kindesopfer und mehr. Ich werde oft gefragt, warum und wie die Leute solche lasterhaften oder sogar unmoralischen Gottheiten verehrten. Warum – wenn sie schon Gottheiten nach menschlichem Ebenbild erschufen – haben die alten Griechen keine besseren erschaffen? Meine Antworten auf diese Frage variieren stark, aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass griechische Gottheiten unberechenbar und zerstörerisch sind, weil sie in direkter Verbindung zur Natur stehen, der man oft ebendiese Eigenschaften zuschreibt. In vorwissenschaftlichen Zeiten war das noch stärker ausgeprägt als heute. Wenn ein Blitzschlag oder ein Erdbeben innerhalb eines einzigen Augenblicks Häuser und Familien zerstört, wenn eine Hungersnot oder eine Seuche Landwirtschaft und Vieh vernichtet, fällt es vermutlich schwer, an wohlwollende Gottheiten zu glauben. Versucht man also, der Welt, in der man lebt, einen Sinn zu geben, kann man sich vermutlich sehr gut vorstellen, dass eine Gottheit einen ab und an bestraft, dass sie Rache an einem Volk oder Land nimmt, richtig? Wenn die Ernte verdorben ist, sucht man nach einer Erklärung, nach jemandem, den man vielleicht besänftigen könnte. Artemis und Apollo wurden mit dem plötzlichen – und ansonsten unerklärlichen – Tod kleiner Mädchen und Jungen in Verbindung gebracht. In der antiken Welt war die Kindersterblichkeit hoch: Kein Wunder, dass man sich Erklärungen herbeiwünschte. Natürlich hatten die Männer einen Kriegsgott und die Frauen eine Göttin der Geburt. Nur weil viele Leute jung starben, hieß das nicht, dass man es klaglos hinnehmen wollte.
Man darf auch nicht vergessen, dass es nicht zwingend nötig war, eine Gottheit in vollem Umfang gutzuheißen, um ihr zu huldigen. Manche Menschen empfanden vielleicht Liebe oder Hingabe, wenn sie Wein und Vieh opferten. Andere wiederum zollten einfach nur einer Autorität, die Macht über sie hatte, den nötigen Respekt – ähnlich, wie man einem Despoten oder einer korrupten Kirche Steuern zahlt: weil man Angst hat oder weil man gesellschaftlichem Druck unterliegt, nicht aber aus Liebe oder Hingabe.
Die Frage, wie wir auf Geschichten über Gottheiten mit schlechtem Benehmen reagieren, ist keine, die ich der Vergangenheit aufdränge. In einem Dialog von Platon namens »Euthyphron« spricht Sokrates – Platons Mentor und Inspirationsquelle – mit dem namensgebenden Euthyphron. Euthyphron ist stolz darauf, dass er weiß, was sich für eine Gottheit ziemt und was fromm ist. Sokrates steht – im Alter von siebzig Jahren – kurz davor, für das Verbrechen der asébeia verurteilt zu werden, der Gottlosigkeit (Asebie). Der Rat von jemandem, der behauptet, Experte in diesen Dingen zu sein, kommt ihm also gerade recht. Aber Sokrates stellt bald erschrocken fest, dass der Grund für Euthyphrons Besuch in Athen seine Mordklage ist – gegen den eigenen Vater. In Athen gab es keine Strafverfolgung, Verbrechen mussten also von Privatpersonen angeklagt werden. Dass Klagen gegen die eigenen Eltern äußerst selten waren, muss man vermutlich nicht eigens erwähnen.
Sokrates ist noch verwirrter, als er hört, dass Euthyphron mit dem Mordopfer nicht einmal verwandt ist. Wir sehen hier – auch wenn Platon das nicht gewusst haben kann – ein bemerkenswertes Beispiel von moralischem Relativismus. Sokrates mag ja das fehlende Pflichtgefühl gegenüber dem Vater schockiert haben; uns dagegen überrascht es vielleicht nicht so sehr. Wie Euthyphron erklärt, spielt es keine Rolle, ob er mit dem Opfer verwandt ist oder nicht. Mord ist Mord. Das ist sicher eine Position, die wir ebenfalls vertreten können: Ein Leben ist nicht mehr wert als ein anderes, nur weil Familienbande im Spiel sind.
Je mehr wir von der Geschichte erfahren, desto stärker wird unser Mitgefühl mit Euthyphron: Ein Mann geriet während der Feldarbeit in eine trunkene Auseinandersetzung mit einem anderen Mann und erstach ihn schließlich. Euthyphrons Vater fesselte den betrunkenen Feldarbeiter an Händen und Füßen und warf ihn in einen Graben. Der Mann starb an Unterkühlung. Das machte Euthyphron noch unbeliebter bei seiner Familie: Sein Vater hatte schließlich nur einen betrunkenen Mörder getötet, und das nicht einmal mit Absicht (er ignorierte ihn lediglich, bis er verdurstete oder erfror). Für Euthyphrons Familie – und anscheinend auch für Sokrates – ist es Euthyphron, der pietätlos handelt, weil er seinen Vater für ein Verbrechen anklagt, das dieser kaum wirklich begangen hat. Für ein modernes Publikum sieht Euthyphrons Position wahrscheinlich moralisch richtig aus.
Als Sokrates seine Vorstellungen von Moral und Amoral hinterfragt, führt Euthyphron an, dass seine Informationen von keinem Geringeren stammen als von Zeus persönlich. Alle seien sich darin einig, dass Zeus der ariston kai dikaiotaton aller Gottheiten sei – der beste und gerechteste. Und das, obwohl Zeus seinen eigenen Vater (der es im Übrigen verdient hatte) in Ketten legte. Andere mögen die Fügsamkeit gegenüber dem Vater als ethisch korrekt ansehen, Euthyphron aber hat eine völlig andere Lektion aufgezeigt.
Das Thema wird immer schwammiger, je länger die beiden diskutieren. Das kommt ziemlich häufig vor, wenn Sokrates beteiligt ist. Er stellt aber auch Fragen, die nicht leicht zu beantworten sind: Wenn man mehrere Gottheiten hat, die sich nicht einig sind, woher weiß man dann, was richtig und was falsch ist? Zwei gleich mächtige Gottheiten könnten gleich starke Argumente für gegensätzliche Haltungen vorbringen. Es könnte also ohnehin sein, dass man sich nicht sicher ist, welches Verhalten korrekt ist – und dann verwirrt Xenophanes uns noch mehr, indem er sagt, dass wir an allem selbst schuld sind, weil wir solch chaotische Gottheiten erschaffen haben.
Xenophanes führt sein Argument, dass Gottheiten kulturspezifisch sind, noch weiter aus (wobei seine Werke uns nur noch in frustrierend kurzen Fragmenten vorliegen). Er geht von den Tieren zu den Menschen über, um seinen Standpunkt zu verdeutlichen: In Äthiopien haben die Gottheiten schwarze Haut, in Thrakien rotes Haar. Für jemanden, der vor zwei Jahrtausenden geschrieben hat, ist das eine ziemlich radikale Ansicht: Wenige Jahrzehnte später wurden Arbeiten des Philosophen Protagoras auf der Athener Agora verbrannt, weil er darauf bestand, dass man nicht wissen könne, ob die Gottheiten existieren oder nicht. Während Xenophanes sich nicht in solch kontroversem Agnostizismus ergeht – die Existenz der Gottheiten hinterfragt er nicht –, macht er doch die Beobachtung, dass die Darstellung unserer Gottheiten sich mehr an unserer eigenen Wahrnehmung und unseren Werten orientiert als an jenen der Gottheit, die wir zu definieren versuchen.
Wenn ich diese Textfragmente jetzt lese, finde ich einen weiteren Punkt ebenso interessant. Xenophanes lädt uns ein, uns vorzustellen, was passieren würde, wenn die Tiere Hände hätten und zeichnen könnten – wenn sie wie wir Menschen Kunst schaffen könnten. Aber er verwendet dazu nicht den Begriff ánthrōpos – Mensch, wie die Menschheit: Menschen im Gegensatz zu Gottheiten oder Tieren. Er schreibt andres. Und dieses Wort bedeutet Mann, im Gegensatz zur Frau. Im alten Griechenland wurde alles gerne in binäre Systeme geteilt: sterblich und unsterblich, versklavt und frei. Xenophanes denkt also nicht etwa darüber nach, wie Menschen im Allgemeinen ihre Gottheiten darstellen, er bezieht sich in seiner Fragestellung speziell auf Männer.
Wie gesagt, die Arbeit ist nur noch in Fragmenten vorhanden und ich behaupte nicht, dass Xenophanes ein radikaler Protofeminist war. Dennoch kehre ich immer wieder zu dieser Zeile zurück, frage mich, was es bedeutet, wenn Männer – und zwar nur Männer – die Abbilder der Götter – und der Gottheiten –, die sie verehren, anfertigen. Würde es einen Unterschied machen? Ein kurzer Blick auf die Kunstgeschichte und die Fülle an (aus Männersicht) begehrenswerten Frauenkörpern legt nahe, dass dem so ist. Aber würde das auch den Charakter dieser Figuren verändern oder nur ihr Aussehen? Und – das finde ich am interessantesten – würden männliche und weibliche Figuren unterschiedlich angefertigt werden?
Schauen wir uns an, was passierte, als ungefähr zur Mitte des 20. Jahrhunderts neue Gottheiten erschaffen wurden. Superman tauchte 1938 auf dem Cover des ersten Action-Comics-Heftes auf. Er trägt einen blauen Einteiler mit dem uns mittlerweile wohlbekannten gelben Wappen mit dem schwarzen S auf der Brust. Er hat rote Schuhe, Shorts und Umhang an. Er ist sehr muskulös, und falls uns das entgangen sein sollte, ist uns trotzdem klar, wie stark er ist, weil er nämlich ein Auto über seinem Kopf erhoben hält.[1] Im nächsten Jahr stellt Detective Comics uns den Batman vor.[2] Dieser Held (dessen Superkraft vor allem in seinem unglaublich großen Vermögen besteht) schwingt an einem Tau, und seine großen Fledermausflügel flattern hinter ihm in der Luft. Sein Gesicht wird von einer Maske mit zwei spitzen Ohren verdeckt, sein enger Einteiler ist grau, er trägt schwarze Schuhe und Shorts. Die Insignien auf seiner Brust können wir nur gerade eben ausmachen, weil er einen Bösewicht am Kragen gepackt hält: Der Hut dieses Mannes fällt zu Boden, während sie durch die Luft sausen. Auch hier sehen wir eine mächtige Figur, die ihre Kraft demonstriert. Zwei zwielichtige Männer am unteren Bildrand – von denen einer eine Schusswaffe halbherzig in der rechten Hand hält – beobachten das Ganze entgeistert.
Diese Superhelden waren so beliebt, dass in rascher Folge viele weitere auf der Bildfläche erschienen. Im Herbst 1941 entstand bei All Star Comics Wonder Woman. Aber man musste das Heft schon kaufen, um das herauszufinden, denn sie ist keinesfalls auf dem Cover abgebildet.[3] Wir entdecken sie schließlich im Innenteil mit dem berühmten roten Bustier und dem blauen Faltenminirock mit den weißen Sternen darauf. Sie sieht stark und majestätisch aus, trägt wadenhohe Stiefel, ein kleines, diamantenbesetztes Diadem und zwei unzerstörbare Armbänder. Und das ist auch ganz richtig so, sie ist schließlich eine Amazone.
Doch als mit der Zeit immer mehr Charaktere hinzukamen, trieb die seltsame Parallelwelt der Comichefte – in der es deutlich mehr (männliche) Autoren und Künstler gibt – ein paar eher seltsame Blüten. Batman ist immer der starke Mann, ganz wie wir es von einem, der in ein Kostüm schlüpft, um Kriminalität zu bekämpfen, erwarten. (Männliche) Superhelden verfügen generell über eine immense Power: Superman kommt von einem anderen Planeten und ist quasi unverwundbar, Wolverine kann seine Adamantiumkrallen ausfahren und seine Wunden heilen superschnell, der Hulk ist unglaublich, sowohl was seine Kraft als auch seine Körpergröße angeht. Als (männlicher) Superheld bedeutet Macht grobe, körperliche Stärke – oder zumindest, dass man dieser mit einem Batmobil so nahe wie möglich kommt. Auch Spiderman – ein beherzter junger Held – ist nach einer Begegnung mit einer radioaktiven Spinne superstark, schnell und wendig ist er ohnehin.
Held*innen brauchen als Gegengewicht das Böse, wobei griechische Gottheiten häufig beides in sich vereinten: Sie unterstützten den einen und vernichteten den anderen Menschen. Die Verkörperung des Bösen, dem Batman gegenübersteht, ist oft ebenso eindrucksvoll wie er selbst: der Joker, der Pinguin und die unvergessliche Catwoman. Batmans (männliche) Gegner können ebenfalls körperlich bedrohlich sein, so wie Bane. Interessanter ist allerdings der Aspekt, dass sie verrückt sind. Der Joker ist dafür das beste Beispiel, doch Dutzende weitere Verrückte bevölkern Arkham Asylum – die Einrichtung, in der zahlreiche von Batmans Feinden letztendlich landen. Wahrscheinlich sollten wir uns fragen, warum psychische Erkrankungen so oft mit dem Bösen in Verbindung gebracht wurden. Auch entstellte Gesichter sind in der Comicwelt ein Markenzeichen des Bösewichts: Eine Figur wie der Joker vereint praktischerweise beides in sich.
Doch Batmans Gegnerinnen – die sich, was ihre psychische Gesundheit angeht, ebenfalls auf einem schmalen Grat bewegen – werden normalerweise hauptsächlich als sexy dargestellt, auch wenn ihre beruflichen Qualifikationen sehr beeindruckend sind. Poison Ivy – Botanikerin und Biochemikerin – kann Pflanzen kontrollieren und setzt diese Fähigkeit dazu ein, dass jeder Mann sich in sie verliebt. Harley Quinn – Psychiaterin – sieht aus wie eine vom rechten Weg abgekommene Cheerleaderin: Ihr zuckerwattefarbenes Haar ist zu süßen Zöpfchen geflochten, sie trägt winzige Shorts, ein enges T-Shirt und einen Baseballschläger. Und was Catwoman angeht, so fällt einem in der gesamten Kinogeschichte wohl kaum eine andere Figur ein, die von so vielen extrem sexy Frauen gespielt wurde, von Eartha Kitt bis Michelle Pfeiffer. Und dann ist da ja auch noch ihr hautenger Latexanzug mit den süßen Katzenöhrchen.
In der hypermaskulinen Welt der Superhelden stellen männliche Charaktere vor allem körperliche Kraft zur Schau, alles andere kommt später. Vielleicht stehen wir auch auf Wolverine oder Aquaman (um jetzt einfach willkürlich zwei Namen aus dem Internet zu fischen), doch Attraktivität ist für diese Helden und Bösewichte zweitrangig. Weibliche Charaktere hingegen werden stets als Erstes darüber definiert, dass sie sexy sind. Wonder Woman war genauso stark wie Superman, aber sie musste auch – in den Worten ihres Schöpfers – den Reiz einer schönen Frau haben.[4] William Moulton Marston erfand Wonder Woman bewusst mit Blick auf die griechische Mythologie und schrieb in seinen Büchern über weibliche Superheldinnen wohlinformiert über die homerische Tradition. Er wollte eine Heldin, die Männern an Stärke überlegen war, die aber auch über eine außergewöhnliche weibliche Anziehungskraft verfügte. Jungs, die eine Geschichte über eine attraktive Frau lesen, die stärker ist als sie selbst, wären »stolz darauf, zu ihren willigen Sklaven zu werden!«, schrieb Marston in seinem Pitch für den Verlag. Attraktivität war – zumindest für ihren Schöpfer – von Anfang an zentral für diese Figur.
Wenn also – um auf Xenophanes zurückzukommen – Löwen Hände hätten wie Männer und zeichnen könnten, dann würden ihre Gottheiten wie Löwen aussehen. Aber wie würden Löwinnengöttinnen aussehen? Würden sie männlichen Weiblichkeitsidealen entsprechen, wie es Frauen in menschlicher Kunst so oft tun? Und wenn diese Löwen im 21. Jahrhundert Comics zeichnen würden, würden diese Geschichten denselben Mustern folgen wie unsere? Vielleicht würden auch die Löwen hypermaskuline Figuren mit superlöwenhafter Kraft und sexy Löwinnen in spärlichem Fell zeichnen? Das werden wir wohl nie wissen. Gerade fällt mir allerdings ein, dass im Film König der Löwen von 1994 der Held, sein Vater, sein böser Onkel, seine beiden witzigen Kumpel und sein Berater alle männlich sind. Die weiblichen Figuren sind: seine Freundin, ihre Mutter und eine Hyäne.
Ich mag Comichefte übrigens trotzdem. Ich mag Catwoman und Wonder Woman, obwohl sie aus Männerfantasien entstanden sind. Batman ist auch eine Männerfantasiefigur – auch wenn es bei ihm mehr um seine vielen Gadgets und sein Geld geht als um seine Muskeln. Das Gleiche gilt natürlich für James Bond: Sein Lifestyle ist begehrenswert, nicht sein Körper (auch wenn man den natürlich auch begehren kann). Ich will damit nicht sagen, dass Männer schlechte Kunst machen. Ich will sagen, wenn Kunst allein von Männern gemacht würde, sollten wir das bei unserer Bewertung dieser Kunst auch berücksichtigen. So erkennen wir an James Bond, wer Ian Fleming (und vielleicht auch so mancher seiner Leser) eigentlich sein wollte, an Pussy Galore erkennen wir nur, wen er flachlegen wollte.
Um dieses lückenhafte Bild zu vervollständigen, gibt es eine einfache Lösung. Frauen können jetzt Kunst machen, und wir brauchen dazu keinerlei Erlaubnis. Wir können unsere eigenen Geschichten über diese Gottheiten und Monster schreiben, und – wenn wir das denn wollen – sie nach unserem Ebenbild erschaffen.
Es gibt dafür kein besseres Beispiel als Lizzo und Cardi B im Video zu Rumors: Zwei Frauen auf dem Zenit ihres Erfolgs holen zu einem Gegenschlag aus gegen die Hater, die im Internet Lügen über sie verbreiten. Sie zitieren einige der verrückten Anfeindungen, um dann – mit völlig ernstem Gesichtsausdruck – zuzustimmen, dass all dieser Unsinn wahr ist. Sie weisen außerdem die endlose Kritik an ihren Körpern und ihrem Benehmen zurück: Sie seien zu fett, zu anzüglich, zu forsch. Im Video sind sie als griechische Göttinnen verkleidet. Lizzo schreitet in einem goldenen Lamékleid durch ihr Set – ein computergenerierter Ort voller riesiger Vasen mit frechen, animierten Malereien. Ihr Kleid wird in der Taille von einem goldenen Gürtel zusammengehalten, und sie trägt goldene Stiefel, goldenen Schmuck und glitzernde, goldene Nägel. Ihre Backgroundtänzerinnen stehen, ebenfalls in Gold gekleidet, auf ionischen Säulen. Lizzo zwinkert uns kess zu, während sie zwischen ihnen umhertanzt. Der Subtext dieser Empowerment-Bildsprache, unterlegt mit den verletzenden Kommentaren, die gegen sie gerichtet wurden, ist klar. Wer Lizzo jetzt nicht als moderne griechische Göttin erkennt, hat nichts verstanden.
Schnitt zu Cardi B, die auf einem Thron sitzt und eine Pergamentrolle liest. Sie trägt einen weißen Schlitzrock und einen goldenen Brustpanzer, um ihren schwangeren Körper ranken sich zierliche Goldketten. Goldene Sandalen sind bis zu ihren Waden hinauf geschnürt sind. Eine Schlangenskulptur kriecht die Rückenlehne ihres Throns hinauf. Falls ihr den Freud’schen Unterton überhört habt – sie trägt außerdem riesige goldene Auberginenohrringe. (Für diejenigen unter euch, die keine Dating-Erfahrung in der Emoji-Ära haben: Das Cartoonbild einer Aubergine steht symbolisch für einen Penis. Nutzt diese Erkenntnis weise.)
Als Nächstes präsentieren sich die Frauen gemeinsam in all ihrer Pracht: Lizzo trägt einen weißen Bodysuit und einen fantastischen Kopfschmuck, der an ihren Schläfen Vasenhenkel bildet. Sie ist nicht nur eine Göttin, sie ist auch ein Kunstwerk. Cardi B trägt einen ebenso spektakulären Kopfschmuck: ein ionisches Kapitell – das Kopfstück einer Säule – aus funkelndem Gold. Die Hater können ihr noch so oft entgegenschleudern, dass ihre Brüste nicht echt sind: Sie ist reine Architektur, sie braucht ihre Anerkennung nicht. Sollte mich jemand fragen, ob ich auch der Meinung bin, dass die Beschäftigung mit der klassischen Antike stark elitär ist – pale, male and stale (weiß, männlich und langweilig, so die Unterstellung), werde ich die fragende Person ab jetzt immer auf dieses Video verweisen. Und ich werde es mir zur Sicherheit auch selbst noch einmal ansehen. So habe ich noch einen anderen Blickwinkel im Kopf, wenn ich mich das nächste Mal mit Dichtung, Gemälden und Skulpturen befasse, die über Jahrtausende hinweg nur von (männlichen) Künstlern erschaffen wurden. Das also ist meine Antwort auf Xenophanes’ Frage. Wenn Frauen Kunst schaffen wie Männer, sehen ihre Göttinnen göttlich aus.
DIE MUSEN
Wir befinden uns in einem Museum voller Ausstellungsstücke, aber ohne Besuchende. Ist es geschlossen? Sind wir zu früh da? Wir laufen an Skulpturen von Athene und anderen Göttern und Göttinnen vorbei, es strömt Tageslicht durch ein Rundfenster im Dach der Galerie vor uns. Die strahlende Lichtsäule verdrängt die Dunkelheit, die uns eben noch umgeben hat. Sie beleuchtet eine einzelne Vase, ein riesiges Kunstwerk der schwarzfigurigen Keramik. Abgebildet ist eine der beliebtesten Szenen der griechischen Mythologie: Herkules (Herakles, um ihm seinen griechischen Namen zu geben) im Kampf mit dem Nemeischen Löwen. Der Löwe bäumt sich auf, steht auf den Hinterpfoten. Sein Maul ist weit aufgerissen, und eine Pfote ist ausgestreckt und krallt nach Herkules. Den Helden scheint das nicht zu kümmern: Sein rechter Arm ist erhoben, bereit zum Angriff. Vielleicht will er nach der dichten Mähne greifen.
Über diesem Bild befindet sich ein geometrischer schwarzer Musterrand, und darüber, am Hals des Kruges, ein zweites Figurenbild. Fünf Musen, alle in weiße, aber leicht unterschiedlich drapierte Kleider gewandet, die in der Taille mit einem Gürtel zusammengehalten werden. Jede hat eine andere Frisur: Oben auf dem Kopf hochgesteckt, über den Rücken wallend, zu einem hohen Knoten gebunden. Fünf ist für Musen eine eher ungewöhnliche Anzahl – dem Geografen Pausanias (2. Jahrhundert) zufolge ist in antiken Schriftstücken (die leider nicht erhalten sind) zuerst von drei Musen, dann von vier die Rede. Zu Hesiods Zeiten, im 8. oder vielleicht 9. Jahrhundert v.d.Z. – und damit in unserer ältesten Quelle –, waren es neun.
Die Musen sind uns zugewandt. Wir wissen es noch nicht, werden aber später herausfinden, dass es sich um Kalliope, die Muse der epischen Dichtung, Klio, die Muse der Geschichtsschreibung, Thalia, die Muse der Komödie, Terpsichore, die Muse des Tanzes, und Melpomene, die Muse der Tragödie, handelt. Klio hat eine Pergamentrolle in der Hand, die für die Geschichtsschreibung stehen soll, Melpomene trägt eine tragische Maske. Vielleicht fallen uns die Musen nicht gleich bei der ersten Betrachtung der Vase ins Auge, doch schon bald können wir nicht mehr wegschauen und werden daran erinnert, dass das Wort »Museum« »Heimat der Musen« bedeutet. Dieser Raum gehört ihnen, und wir sind nur das Publikum.
Das ist die Eröffnungssequenz zum Disney-Film Herkules (1997). Es ertönt Musik, und die Musen tun das, was seit Jahrtausenden in ihrer Natur liegt: Sie tanzen und singen. Sie treten als Chor der antiken Komödie auf, indem sie die Handlung kommentieren (am genialsten als Backgroundsängerinnen zu »Nein, ich bin nicht verliebt«, ungefähr in der Mitte des Films). Sie versorgen uns auch zu Beginn mit Hintergrundinformationen, in diesem Fall zur Geschichte der Titanomachie: dem Krieg zwischen den Göttern des Olymps, angeführt von Zeus, und den Titanen, einem älteren Göttergeschlecht, das sich gegen sie erhob. Obwohl Zeus zunächst den Sieg davonträgt, erfahren wir bald, dass die Titanen nur darauf warten, aus ihrem unterirdischen Gefängnis befreit zu werden, um es noch einmal zu versuchen. Hades – der Gott der Unterwelt – plant bereits den Angriff, doch dann stellt sich ihm ein mickriger Sterblicher in den Weg.
Damit ist der Grundstein für eine unglaublich witzige und raffinierte Version der Herkulesgeschichte gelegt. Nicht nur das, die Musen greifen auch eine Tradition auf, die bereits mit Hesiods Lehrgedicht, der Theogonie, begann. Darin berichtet uns eine Gruppe wunderschöner Göttinnen in Liedform von den frühesten Gottheiten. Die Disney-Musen tun genau dasselbe: Gleich im ersten Lied erzählt Kalliope, dass die Geschichte der Gottheiten lange vor Herkules begann, vor Äonen. Es ist eine ziemlich wirre Geschichte. Können wir ihr also vertrauen? Nun ja, Hesiod jedenfalls tut das in seinem Gedicht. Und wir sollten es auch tun. Schließlich sagt uns schon der Titel des Liedes, dass wir den Musen vertrauen können: »Jedes Wort ist wahr.«
Die Theogonie ist die Entstehungsgeschichte der Gottheiten, der Ursprung der griechischen Mythologie. Hesiod beschreibt die Erschaffung der ersten Mächte – Chaos, Himmel und Erde – und wie dann nach und nach weitere wohlbekannte Gottheiten auftauchen: Nymphen, Riesen, Titanen. Gaia und Uranos – Erde und Himmel – bringen ziemlich viel Nachwuchs hervor, unter anderem Kronos, den zukünftigen Vater von Hestia, Demeter, Hera, dann Hades, Poseidon und Zeus. Ihre Mutter, die Göttin Rhea, hilft Zeus, Kronos zu besiegen, der zuvor Uranos bezwungen hatte.
Doch bevor Hesiod uns von diesem so zerstörerischen Kampf unter den Gottheiten erzählen kann, muss er zum Anfang zurückkehren. Das ist – für uns wie auch für Hesiod – eine ontologische Frage, die es in sich hat. Beginnt er mit der ersten göttlichen Macht – mit Chaos (oder Chasma, um eine genauere Übersetzung zu bemühen)? Eine echte Herausforderung, denn es geht um eine klaffende Leerstelle, die unser Geist kaum begreifen kann. Und was befähigt Hesiod dazu, diese Geschichte zu erzählen? Warum sollten wir ihm vertrauen? Es geht nicht nur um die Frage, woher man überhaupt Kenntnis über die ersten Gottheiten erlangen konnte, es geht auch darum, wie verlässlich unser Erzähler ist. Hesiod muss sein Gedicht auf eine Weise beginnen, die sein Publikum versteht, und er muss beweisen, dass er der Richtige ist, um uns diese Geschichte zu erzählen. Und wie ginge das besser als mit einem Hilferuf an die Musen?
Das erste Wort des Gedichts ist mousaōn – die Musen sind also von Anfang an Teil dieser Geschichte. Und weil Hesiod betonen möchte, wie nahe sie ihm stehen, erzählt er uns zuerst ein bisschen von ihnen, zum Beispiel, wo sie leben. Es sind die Musen des Berges Helikon,[5] erklärt er, in Böotien in Zentralgriechenland. Laut Hesiod, der in der Nähe lebt, ist das ein großer, heiliger Berg, und die Musen tanzen um einen blütenreichen Bach und einen Kronos-Altar herum. Sie baden in einem der vielen Flüsse, dann tanzen sie in den höheren Lagen des Helikon ihre schönen Tänze. Hesiod erwähnt zweimal, wie weich ihre Haut ist: als er beschreibt, wie sie baden, und als er von ihren Füßen beim Tanzen erzählt. Die Erwartung, dass Frauenkörper weich zu sein haben, gibt es anscheinend schon, seit man über Frauen schreibt: Man stelle sich nur nicht vor, dass diese barfuß tanzenden Musen Hornhaut an den Füßen haben könnten. Sie könnten direkt Werbung für Bodylotion machen. Die weiche Haut bedeutet allerdings nicht, dass die Musen nicht stark sind. Hesiod schreibt ebenfalls, dass sie mit starken Füßen tanzen.[6] Es ist außerdem irgendetwas Verhaltenes an diesen Musen: Sie kommen bei Nacht von den hohen Hängen des Helikon, in Nebel gehüllt. Erst jetzt, wo sie so gut wie unsichtbar sind, stimmen sie ihr Lied an.
Was singen die Musen also in diesem Gedicht, das Hesiod geschrieben hat? Die gute Nachricht für ihn ist, dass sie über Zeus singen und Hera, Athene, Apollo, Artemis und das ganze unsterbliche Geschlecht der Gottheiten.[7] Mit anderen Worten, die Musen decken dieselben Inhalte ab, über die Hesiod schreiben möchte, mit denselben Figuren. Einen anderen Dichter würde das vielleicht einschüchtern, aber nicht Hesiod. Weil es die Musen selbst waren, die ihm kalēn aoidēn beigebracht haben – die Sangeskunst. Bevor er den Musen begegnete, war Hesiod kein Dichter, kein Sänger. Er war Schäfer, und seine Herde graste am Fuße des heiligen Berges Helikon.
Dieser schöne poetische Kniff verleiht Hesiod in zweifacher Hinsicht Glaubwürdigkeit. Zum einen müssen wir ihm schlicht glauben, dass er die Musen wirklich kennt, denn er war Augenzeuge. Er hat mit eigenen Augen gesehen, wie sie tanzen oder in Nebel gehüllt durchs Dunkel der Nacht gleiten. Und falls jemand Zweifel hatte, ob Hesiod der Richtige ist, um zu erzählen, was danach kommt – die Schöpfung der allerersten Gottheiten, die er definitiv nicht selbst gesehen hat –, dann werden auch diese Zweifel schnellstens ausgeräumt. Denn Hesiod hatte diesbezüglich Kontakt zur verlässlichsten Quelle überhaupt: zu den Musen. Und falls nun jemand denkt, dass es ziemlich selbstgefällig rüberkommt, wie er diese Geschichte erzählt: Gleich danach muss Hesiod herbe Kritik einstecken. Denn als er den Musen begegnet, gratulieren diese ihm nicht etwa zu seiner großen Dichtkunst. Sie bewundern auch nicht seine Schafe. Im Gegenteil, sie kritisieren ihn: Schäfer, so behaupten sie, sind furchtbare Menschen mit dicken Bäuchen. Ein Glück, dass die Musen niemals Wollsocken brauchen werden.
Doch dann enthüllen sie etwas wirklich Beunruhigendes, jedenfalls für diejenigen unter uns, die in Hesiods Beschreibung von der Entstehung der Welt Sicherheit suchen. Wenn wir lügen, klingt es, als würden wir die Wahrheit sagen, erklären die Musen. Wir können aber auch – wenn wir wollen – die Wahrheit singen.[8] Aber woher soll Hesiod wissen, woran er ist? Und infolgedessen auch wir? Der Mythograf Pseudo-Apollodor[9] erzählt uns, wie die Musen der Sphinx ihr berühmtes Rätsel aufgeben (das Ödipus löst, bevor er Jokaste begegnet und sie heiratet). Es kann also sein, dass sie einfach gerne geheimnisvoll sind.
Je öfter ich den Anfang der Theogonie lese, desto besser gefällt er mir: von der vorgetäuschten Bescheidenheit zur Beteuerung der Echtheit. Und wahrscheinlich ist der Anfang sogar mein Lieblingsteil. Wir werden einfach nie wissen, ob Hesiods Musen die Wahrheit sagen oder nicht. Für uns hört sich beides genau gleich an, und sie haben gerade gestanden, dass sie manchmal lügen. Sie haben seiner Erzählung die Glaubwürdigkeit genommen, während sie so taten, als würden sie sie bestätigen, und zwar gleich zu Beginn. Wenn alle antiken Texte zu Gottheiten mit solchen Erklärungen versehen wären, würde man vielleicht nicht mehr so einfach Gründe für den nächsten Krieg finden. Das denke ich zumindest manchmal.
Die Musen geben Hesiod einen Gehstock aus Lorbeer und schenken ihm dann eine annähernd göttliche Stimme. Jetzt sind jegliche Spuren von Bescheidenheit wie weggeblasen: Die Musen machen Hesiod mit Geschenken und Talent zu ihrem Liebling. Der französische Künstler Gustave Moreau malte 1891 eine Version dieser Szene. Melpomene tröstet Hesiod befindet sich heute im Musée d’Orsay. Doch dieser Hesiod hat keinen dicken Bauch, und er sieht auch nicht wie ein gewöhnlicher Schäfer aus. Diese Version des Dichters ist jung, androgyn und sehr gut aussehend. Er ist nackt, sein fein bemuskelter Körper wird nur an der Hüfte von einem schmalen Streifen schweren, edelsteinfarbenen Stoffes bedeckt. Sein Gewicht ruht auf seinem rechten Bein, der linke Fuß und das Bein sind angewinkelt. Unter seinen Füßen befinden sich zertrampelte Blumen – Narzissen vielleicht. Er hält nicht den Lorbeerstab, den wir aus der Theogonie erwarten würden, sondern eine Laute, reich verziert und rot, weiß und grün bemalt. Die Saiten sind goldfarben. Seine schlanken Finger halten das Instrument an seinen nackten Körper. Sein Gesichtsausdruck ist recht ernst, er schaut mit leicht geschürzten Lippen auf die Laute hinab. Sein ganzer Fokus liegt auf der Laute: Dieser junge Mann ist seiner neu entdeckten Kunst komplett ergeben.
Eine Muse schmiegt sich an seinen Rücken. Ihr goldenes Haar ist zu einem komplizierten Knoten zurückgebunden, und auch sie schaut die Laute an. Vielleicht ist das Instrument der Grund, warum sie sich an diesen nackten jungen Mann kuschelt. (Ich muss ihn mir als einen völlig anderen Hesiod vorstellen als den, der die Gedichte geschrieben hat, weil ich die Verse des einen einfach nicht mit dem hübschen, nackten Erscheinungsbild des anderen in Einklang bringen kann. Ich frage mich häufig, ob ich in meinen Prüfungen zu griechischen Gedichten wohl besser abgeschnitten hätte, wenn ich dieses Bild damals schon gekannt hätte.) Sie trägt ein lose drapiertes rotes Kleid über einer weißen Tunika, und ihre goldene Laute hängt an ihrem Rücken, damit sie sie nicht daran hindert, Hesiod mit seiner zu helfen.
Und sie gibt sich wirklich Mühe. Ihr ausgestreckter rechter Arm – der auf Hesiods Handgelenk liegt, weil sie ihm die Griffe zeigt – ist genauso muskulös wie seiner. In der linken Hand hält sie goldene Lorbeerblätter, und Hesiod trägt einen grünen Lorbeerkranz auf dem Kopf. Dieser ist fast unsichtbar, weil die Blätter beinahe mit den Federn der schönen, anthrazitfarbenen Flügel, die die Muse über ihm ausbreitet, verschmelzen. In der Ferne, über dem Bogen der Flügel, sehen wir einen hellen Stern, der einen Tempel auf einem schwindelerregend steilen Felsen erleuchtet. Musik ist nicht nur das Geschenk einer Göttin an einen Sterblichen, sie ist auch eine Art, das Göttliche zu feiern, in gewisser Weise ein Tempel. Die Szene ist intim und sexy, sie erinnert uns daran, dass Kunst – und das Schaffen von Kunst – eine sehr erregende Erfahrung sein kann.
In der Theogonie fordert die Muse Hesiod auf, von dem zu singen, was kommt, und von dem, was war. Sein Fokus – daran gibt es nie einen Zweifel – muss das gesegnete Geschlecht der unsterblichen Wesen sein. Aber zuerst und zuletzt muss er von den Musen selbst singen. Hesiod fügt hinzu, dass sie für Zeus, ihren Vater, singen und die folgenden Begebenheiten preisen wollen: den Anbeginn der Gottheiten, dann des Zeus und dann der Menschen und Riesen.
Doch Hesiod hatte gesagt, dass er als Erstes von den Musen singen würde – und nicht über das, worüber die Musen singen –, also tut er das auch: Geboren wurden sie in Pieria, im Norden Griechenlands. Ihre Mutter war Mnemosyne – die Göttin der Erinnerung.[10] Hier sollten wir uns in Erinnerung rufen, dass die frühesten griechischen Dichtungen komponiert und nicht geschrieben wurden (Hesiod selbst komponierte die Verse: Die Texte zu seinen Werken kamen erst später dazu). Erinnerung war also zentral für einen Dichter wie Hesiod oder Homer, der seine Werke aufführte, statt sie zu veröffentlichen.
Im 4. Jahrhundert v.d.Z. schrieb bereits kein Geringerer als Platon in seinem Dialog Phaedrus darüber, wie wichtig ein gutes Erinnerungsvermögen ist.[11] Sokrates ordnet die Erfindung des Schreibens einem ägyptischen Gott namens Theuth zu (der Name sieht auf Griechisch unglaublich toll aus, wie ein Regal mit dicken Buchstützen: Θευθ). Aber auch wenn Theuth sich für die Schreibkunst ausspricht, behauptet, dass sie Gedächtnis und Weisheit verbessert, erwärmt sich niemand dafür. König Thamus, der über Theuths zahlreiche Erfindungen urteilt, beeindrucken seine Behauptungen kein bisschen. Es sei sogar das Gegenteil der Fall, sagt er. Die Leute werden sich aufs Schreiben verlassen, eine externe Fertigkeit, und ihr Gedächtnis nicht mehr nutzen. In Wahrheit wird das Schreiben uns also alle vergesslich machen. Es ist typisch für Platon – der dazu die Figur seines trickreichen Mentors Sokrates einsetzt –, eine schriftliche Argumentation aufzusetzen, die das Schreiben kritisiert. So reaktionär wir Platon auch finden mögen, er scheint hier zumindest in einem Punkt recht zu haben: Die Erinnerungskunst rückt in den Hintergrund, wenn Schreiben zur Norm wird. Wir würden es heutzutage sicher ganz außergewöhnlich finden, wenn jemand große Teile der Ilias oder der Odyssee auswendig könnte. Und doch war es genau das, womit Rhapsoden (Männer, die epische Dichtung aufsagten) ihr Brot verdienten. Das Lesen mag ja unseren Horizont erweitern – für unser Gedächtnis tut es aber nichts.
Also deckt Hesiod die intime, mütterliche Beziehung zwischen dem Gedächtnis und jeglicher Form von Kreativität auf. Die Musen stammen von zwei mächtigen Gottheiten ab: Zeus, dem König des Olymps, und Mnemosyne, einer Titanin aus der Generation vor ihm. Mnemosyne gebiert auf dem Olymp neun Töchter, die Musen haben also gleich zwei heilige Heimatstätten: Olymp, wo sie zur Welt kamen, und Helikon, wo sie sich Hesiod offenbarten. Sie sind – seit ihrer Geburt – homophronas,[12] von einem Geiste.
Und dann, nachdem er noch ein bisschen mehr ihr Singen und Tanzen und ihre allgemeine Lieblichkeit beschrieben hat, verrät Hesiod uns ihre Namen. Es ist das erste Mal, dass sie in einer uns heute noch vorliegenden Quelle erwähnt werden. Homer erwähnt bereits früher neun Musen, allerdings nicht mit Namen. Er spricht jedoch mehrmals von einer einzelnen Muse (Singular) und mehreren Musen (Plural). Die erste Zeile der Odyssee ist dafür vielleicht das beste Beispiel: »Erzähl mir von dem Mann, Muse, der in jedwede Richtung gesandt wurde.« Homer erzählt die Geschichte des schiffbrüchigen Odysseus nicht alleine, er braucht die Hilfe einer Muse. Wenn sie ihm die Geschichte nicht zuerst erzählt, kann er sie nicht mit uns, seinem Publikum, teilen. Auch wenn diese Zeile sehr herrisch klingt, so steckt doch echte Besorgnis dahinter. Dichter brauchen Musen, sonst können sie nicht schreiben. Wie Homer in der Ilias schreibt,[13] sind diese Göttinnen stets anwesend und wissen alles. Kein Dichter könnte auch nur hoffen, all diese Begebenheiten selbst erlebt zu haben. Sie liegen sowohl zeitlich als auch räumlich weit voneinander entfernt und finden teilweise in der sterblichen, teilweise in der unsterblichen Welt statt. Ohne die Musen kann er also keine Geschichten erzählen.
Im letzten Gesang der Odyssee schreibt Homer, dass alle neun Musen bei Achilles’ Beerdigung gesungen haben.[14] Agamemnon erzählt Achilles – aus dem Jenseits –, was passiert ist, nachdem er starb. Es ist typisch für ihre Beziehung, dass Agamemnon sogar nach Achilles’ Tod noch findet, dass dieser immer unverschämtes Glück hat. Du hattest Glück, verkündet er, dass du in Troja starbst, weit weg von Argos. Ihr könnt euch sicher denken, wo Agamemnon gestorben ist, denn die Bedeutung dieser Aussage lässt sich kaum als Subtext bezeichnen. Seine Missbilligung liegt direkt an der Oberfläche, wo man sie sehen kann. Warum Agamemnon wohl so verärgert ist? Nun ja, seinen Erzählungen zufolge wurde er vom mörderischen Liebhaber seiner Frau getötet, von Aigisthos. Seine Bestattung wird nicht erwähnt, wir können also annehmen, dass sie rein funktionell war, wenn sie überhaupt stattfand. Achilles hingegen – wie Agamemnon sehr ausführlich schildert – hatte ein riesiges Abschiedsfest, bei dem Gottheiten wie die Meeresnymphen und die Musen anwesend waren. Und sämtliche neun Musen sangen Klagelieder für ihn. Das passiert also, wenn man der Sohn einer Göttin ist und einen Heldentod stirbt: Die Musen höchstpersönlich singen bei der Beerdigung.
Aber die Namen dieser Musen sind uns unbekannt, bis Hesiod sie uns in einer tollen Liste verrät.[15] Klio und Euterpe und Thalia und Melpomene und Terpsichore und Erato und Polymnia und Urania und Kalliope, die Wichtigste: Sie begleitet Könige, fügt er hinzu. Auf dieser Liste sind den Musen noch keine Spezialgebiete zugeordnet worden – das passiert erst in späteren Berichten –, aber sie werden irgendwann sehr viele Bereiche abdecken, von der Geschichtsschreibung über antike Gesänge und Tanz bis hin zu epischer Dichtung. Terpsichore ist also noch nicht die Muse des Tanzes und Polymnia (auch Polyhymnia genannt) ist noch nicht für heilige Lieder zuständig. Sie alle teilen die Verantwortung dafür, Männern zu einer überzeugenden, beruhigenden und geschickten Ausdrucksweise zu verhelfen. Hesiod schreibt, dass sie wortwörtlich süßen Tau auf ihre Zungen träufeln.[16] Es ist das göttliche Geschenk der Musen an die Menschheit, weil es trauernde Herzen tröstet. Wer schon einmal ein gebrochenes Herz mit einem traurigen Lied besänftigt hat (oder vielleicht sogar mit einem fröhlichen, auch wenn ich mir das kaum vorstellen kann), weiß, dass Hesiod zumindest damit goldrichtig liegt.
An dieser Stelle bekommen wir endlich einen echten Einblick in die Macht der Musen. Hesiod hat sie schon als charmant und wunderschön, weichhäutig und stets tanzend beschrieben. Doch musste Homer wirklich seine Odyssee mit einem Appell an eine schöne, tanzende Göttin beginnen? Er braucht – genau wie Hesiod – Talent, Charme, Überzeugungskraft und die Fähigkeit, die Herzen seiner Zuhörenden allein mit seinen Worten, seinem Gesang leichter schlagen zu lassen. Und diese Göttinnen können ihm das alles geben, falls sie gewillt sind, ihn zu beschenken. Kein Wunder, dass Dichter sich im Laufe der Jahre immer wieder an sie gewandt haben.
Hesiod beendet diesen kurzen Abschnitt über die Musen, indem er sie anfleht, ihre göttliche Gabe mit ihm zu teilen. Er möchte sein großes Gedicht über die Gottheiten verfassen, und dazu braucht er ihre Hilfe. Erzählt mir die Geschichte von Anfang an, bittet er. Sagt mir, welche der Gottheiten es als Erstes gab. Und nachdem er also sein Gedicht mit diesem Appell an sie als Göttinnen des Berges Helikon eröffnet hat, nach dieser hingebungsvollen Lobeshymne – der eines unscheinbaren Jungen, dem sie zur Größe verholfen haben –, in der er ihren Gesang und ihr Zuhause, ihre Talente und ihre Großzügigkeit preist und schließlich leidenschaftlich um ihre Hilfe ersucht, wie könnten sie ihn da abweisen?
Es ist natürlich interessant, dass wir nur dann von den Musen hören, wenn sie so großzügig sind, einem Dichter seinen Wunsch zu gewähren. Wir könnten um göttliche Inspiration bitten, aber sie könnten uns das verwehren. Sie können schließlich nicht zu allen Ja sagen. Doch dann bliebe es uns natürlich verwehrt, die Worte oder Ideen für ein episches Gedicht (oder eine Historie, eine Tragödie etc.) zu finden, das Werk würde also nie entstehen. Mit anderen Worten, es kann niemand behaupten, ohne ihre Hilfe etwas erschaffen zu haben: Allein die Existenz eines Werkes beweist, dass sie uns wohlgesinnt waren. Wenn sie unserer Bitte nicht stattgeben, gibt es dafür kein Zeugnis. Nur eine leere Seite oder eine leere Bühne, eine schweigende Laute. Dichter und Künstler haben die Musen immer und immer wieder um Hilfe gebeten, weil die Alternative eine göttlich verfügte Schreibblockade ist.
Das passiert in einer Geschichte im zweiten Gesang der Ilias.[17] Als Homer einen Ort auf dem Peloponnes beschreibt – Dorion –, bemerkt er, dass die Musen genau dort den Gesang von Thamyris, dem Thraken, unterbrachen – pausan aoidēs. Thamyris (in anderen Quellen auch Thamyras genannt) begeht eine unglaublich dumme Prahlerei. Er ist so sehr von seiner Sangeskunst überzeugt, dass er behauptet, die Musen in einem Gesangswettbewerb schlagen zu können. Es ist noch nie gut ausgegangen, wenn Sterbliche sich anmaßten, sie könnten die Gottheiten in irgendetwas übertrumpfen. Doch der arme Thamyris hat diese grundlegende Lektion noch nicht gelernt, und die Rache folgt auf dem Fuße. Verärgert, so schreibt Homer, lähmten sie ihn und nahmen ihm seine liebliche Stimme, ließen ihn vergessen, wie man die Kithara (ein lautenähnliches Saiteninstrument) spielt. In seiner Bibliotheke erzählt Pseudo-Apollodor dieselbe Geschichte, nur dass hier noch mehr auf dem Spiel steht. Die Konsequenzen eines Versagens sind furchtbar. Auch in dieser Version fordert der schöne Thamyris die Musen zu einem musikalischen Wettstreit heraus. Die Wortwahl im Griechischen zeigt sehr genau, dass das eine unglaublich schlechte Idee ist – mousikēs ērise mousais.[18] Natürlich gehört die Musik den Musen – die Worte sind im Griechischen genauso nah verwandt wie im Deutschen. Und nur das Verb – das »herausfordern« bedeutet, aber auch »zanken« oder »Zwietracht säen« – trennt sie voneinander. Das kann ja nicht gut ausgehen.
Bei Wettkämpfen geht es in griechischen Mythen – und damit auf gewisse Weise auch in der griechischen Geschichte – häufig um die Ehre, nicht um materiellen Gewinn. Es gibt natürlich Ausnahmen: Die gesamte Handlung von Sophokles’ Ajax rankt sich um die Scham, die Ajax empfindet, als er den Wettstreit um die Rüstung des verstorbenen Achilles verliert. Odysseus schlägt ihn im physischen und intellektuellen Wettstreit, und Ajax wendet sich gegen seine Kameraden und schließlich gegen sich selbst. Aber bei Theater- und Sportwettkämpfen – von den Dionysien bis hin zu den Olympischen Spielen – gab es selten Gold oder Schätze zu gewinnen. Der beste Theaterschriftsteller gewann, wenn es hochkam, einen Lorbeerkranz. Über die beeindruckende sportliche Leistungsfähigkeit eines siegreichen Athleten schrieb Pindar vielleicht eine Ode.
Es gibt allerdings einige interessante Ausnahmen, vor allem Wettkämpfe, in denen es darum geht, eine attraktive Frau heiraten zu dürfen. Penelope richtet im einundzwanzigsten Gesang der Odyssee einen solchen Wettkampf aus. Weil sie nicht wieder heiraten möchte, sagt sie, dass sie nur denjenigen zum Mann nehmen wird, der Odysseus’ Bogen spannen und einen Pfeil durch zwölf Äxte schießen kann.[19] Sie bezeichnet die Ehe mit ihr, der Königin von Ithaka (wodurch der betreffende Mann den Status des Königs erreichen würde), explizit als den aethlon – den Preis. Die Freier sind zu schwach oder zu ungeschickt, um den Bogen zu spannen, was dem verkleideten Odysseus die Gelegenheit verschafft, dies selbst zu tun und die Männer, die seine Frau nicht in Ruhe lassen, zu erschießen.
Thamyris will aber mehr als eine Ehe mit der perfekten Frau aus der Odyssee. Der Preis, den er in seinem Wettstreit mit den neun Musen verlangt, ist die Gelegenheit, mit jeder von ihnen Sex zu haben. Ich mag ja normalerweise ehrgeizige Männer, aber auch dafür gibt es Grenzen, und der arme Thamyris hat sie leider überschritten. Er kann das Risiko, das er eingeht, anscheinend nicht einschätzen und stimmt ihren Bedingungen zu: Ja, wenn er ein besserer Musiker ist als sie, darf er Sex mit allen Musen haben (das Griechische lässt keine Rückschlüsse darauf zu, ob dies nacheinander oder gleichzeitig passieren soll). Aber falls er weniger gut ist als sie, können sie ihm nehmen, was immer sie wollen. In dieser Geschichte gibt es so gut wie keine Spannung. Wie auch? Thamyris hat eine Hybris an den Tag gelegt, wie sie im Buche steht, als er glaubte, Göttinnen überlegen zu sein. Die Musen sind bessere Musikantinnen, fährt Pseudo-Apollodor fort, und sie nehmen ihm die Augen und das Lautespiel. Mit Musen sollte man sich besser nicht anlegen.
Sophokles schrieb ein auf dieser Geschichte basierendes Stück, von dem nur ein paar Fragmente erhalten sind. Thamyris ist wahrscheinlich dasselbe Stück, das in einigen antiken Quellen als Die Musen betitelt wird. Leider wissen wir nicht, ob die Musen individuelle Figuren waren oder ob sie den Chor bildeten (wobei diese Chöre typischerweise zwölf oder fünfzehn Mitglieder haben und es nie mehr als neun Musen gibt). Aber wir wissen, dass Sophokles selbst in der ersten Produktion auftrat und die Khitara spielte. Einer antiken Biografie des Theaterschriftstellers[20] zufolge ist das der Grund, weswegen sein Porträt in der Stoa Poikile – einer Säulenhalle, die im 5. Jahrhundert v.d.Z. an der Nordseite der Agora (des Marktplatzes) erbaut wurde – ihn mit einer Laute zeigt. Die Ruinen dieses »bunten Säulenganges« (des großen Portikus) kann man heute noch in Athen besichtigen, wobei Sophokles’ Porträt natürlich längst fort ist.
Es wird oft vergessen, dass der Großteil der Tragödien und der Dichtung von Hesiod und Homer nicht nur auf der Bühne aufgeführt wurde, sondern auch gesungen. Die Musen hatten also gleich in mehreren Bereichen Einfluss auf die Künstler: Es reicht nicht, schöne Verse verfassen zu können, auch bei der musikalischen Umsetzung braucht man die Hilfe der Musen. Und Sophokles’ Version von Thamyris’ Geschichte – auch wenn uns nur so wenige Fragmente vorliegen – demonstriert das perfekt. Diese Dichter, die die Musen bei der Arbeit beschreiben, brauchen eben jene Musen, um zu schreiben und das, was sie geschrieben haben, auf die Bühne zu bringen. Für sie wäre es fatal, Bühnenkunst oder Schreibkraft zu verlieren. Ist der Verlust seines Sehvermögens für Thamyris ein deutlich schlimmerer Verlust als der seines Lautespiels? Wie würde das funktionieren: Würde man nur vergessen, wie man spielt, oder gänzlich vergessen, dass man überhaupt einmal spielen konnte? Oder wäre man einfach nur kein Genie mehr, könnte sich aber daran erinnern, dass man einmal eins war? Würde man zum Salieri des ehemaligen Mozart werden? So oder so ist es ein schweres Schicksal.
Es haben vergleichsweise wenige Geschichten über die Musen aus der antiken Welt überdauert, und die, die uns vorliegen, erzählen häufig von ähnlichen Erfahrungen: sofortige und erbarmungslose Rache für Hybris und anmaßende Wetten und Wettbewerbe. Die Sirenen – das wichtigste Beispiel für zerstörerisch schönen Gesang, denn »Sirenengesang« ist einer der wenigen Ausdrücke, der es direkt aus der Mythologie in den alltäglichen Sprachgebrauch geschafft hat – verlieren ihre Flügelfedern, wenn sie einen Wettstreit mit den Musen vorschlagen und nicht gewinnen.[21] Die Musen nehmen den Sirenen nicht nur ihre Schwungfedern, sie schmücken sich auch damit: ein mit Leichtigkeit, aber auch mit Nachdruck zur Schau gestellter Triumph.
Doch die Musen könnten gute Gründe für diese Unnachgiebigkeit haben. Im fünften Gesang von Ovids Metamorphosen, seinem ausladenden Werk über Verwandlungen in der griechischen Mythologie, besucht Minerva (das ist der römische Name für Athene) die Musen auf dem Helikon. Sie möchte die Quelle sehen, die sich an der Stelle gebildet hat, wo Pegasus – das geflügelte Pferd, Nachwuchs von Medusa und Poseidon – mit den Hufen gescharrt hat. Die Musen sind begeistert und zeigen ihr die Quelle nur zu gerne – eine von ihnen macht Minerva ein Kompliment. Sie sagt, dass sie auch eine Muse sein könnte, wenn sie das wollte, weil sie die Künste so schätzt. Und das Leben der Musen wäre einfach wunderbar, wenn sie nur, so sagt diese hier namenlos bleibende Muse, in Sicherheit wären.[22] Doch ihrem unbefleckten Geist mache alles Angst, fährt sie fort. Pyreneus’ schreckliches Gesicht erscheine ihnen immer noch, und ihre Gedankenwelt habe sich noch nicht von diesem Schreck erholt. Wir sind jetzt vielleicht versucht, diese Aussage als Übertreibung abzutun, mit der die Muse einen bestimmten Effekt erreichen will, doch dafür gibt es eigentlich keinen Grund. Die Muse beschreibt sehr klar etwas, das nach posttraumatischem Stress klingt: Sie lebt in ständiger Angst und sieht immer wieder das Gesicht eines Mannes vor sich, der sie bedroht hat.
Sie fährt mit ihrer Geschichte fort. Die Musen waren auf dem Weg zu ihrem Tempel auf dem Parnassus (ebenfalls ein Berg) und mussten dazu durch Ländereien reisen, die von Pyreneus beherrscht werden. Er nähert sich ihnen fallaci … vultu – wortwörtlich mit einem falschen Gesicht. Er spricht sie als Töchter der Erinnerung an. Er wusste, wer wir sind, fügt sie hinzu. Er fleht sie an, bei ihm zu bleiben, weil es regnet. Gottheiten haben schon geringere Häuser aufgesucht, sagt er. Die Musen lassen sich von seinen Worten und dem Wetter überzeugen und gehen mit ihm ins Haus. Als der Wind dreht und der Regen aufhört, wollen die Musen gehen. Doch Pyreneus sperrt sie ein und vimque parat[23] – bereitet sich darauf vor, Gewalt einzusetzen, das heißt, sie zu vergewaltigen. Die Musen nutzen ihre Flügel, um ihm zu entkommen. Pyreneus verfolgt sie, er klettert auf einen sehr hohen Turm. Wo ihr auch hingeht, sagt er, ich wähle denselben Weg.
Sowohl seine Sprache als auch sein Betragen lassen ihn zu diesem Zeitpunkt ziemlich gestört wirken, wie den Bösewicht in einem melodramatischen Thriller. Und die Musen beschreiben ihn als vecors – verrückt. Es ist offensichtlich, dass er keine neun geflügelten Göttinnen verfolgen kann, weder einzeln noch zusammen. Er fällt auf die Nase – wortwörtlich und aus großer Höhe – und bricht sich beim Aufprall sämtliche Knochen. Im Sterben verschmutzt er den Boden mit seinem bösen Blut.
Die Musen sind von dieser Begegnung offensichtlich traumatisiert. Es wird in der gesamten Erzählung nie daran gezweifelt, dass sie ihrem Angreifer überlegen sind: Sie sind unsterblich, sie können fliegen, sie sind in der Überzahl. Doch der versuchte Übergriff wird dadurch nicht weniger verstörend für sie. Selbst zu diesem (unspezifisch späteren) Zeitpunkt hindert die Erinnerung die Musen daran, sich vollständig ihrer göttlichen Existenz zu erfreuen. Stattdessen leben sie in der ständigen Angst, vielleicht nicht in Sicherheit zu sein oder ihre Sicherheit zu verlieren. Die Konsequenzen eines versuchten Übergriffs sind vielschichtig, selbst für eine Göttin. Die Muse wird nun von Flügelflattern und Stimmengewirr unterbrochen. Neun Elstern haben sich in den Baumwipfeln über ihnen niedergelassen. Minerva ist ziemlich überrascht, weil ihre Stimmen so menschlich klingen. Aber die Musen erklären ihr, dass diese Elstern ganz neu sind.[24] Sie waren sterbliche Frauen, Töchter des reichen Großgrundbesitzers Pierus und seiner Frau, Eurippe. Sie sind in dieser misslichen Lage, weil sie – wie so viele andere – einen Wettstreit mit den Musen verloren haben. Diese dummen Schwestern (die Musen haben nie einen unvoreingenommenen Bericht versprochen) eilten zum Parnassus und erklärten den Göttinnen den Krieg. Der Begriff, den sie verwendet, lautet committit proelia – einer Schlacht beitreten. Was sie meint, wird offensichtlich, als eine von Pierus’ Töchtern den Mund aufmacht. Hört auf, die unwissenden Massen mit eurer leeren Lieblichkeit zu täuschen, sagt sie. Wenn ihr euren Fähigkeiten vertraut, werdet ihr gegen uns antreten. Unsere Talente und unsere Stimmen sind unübertrefflich. Und wir sind zu neunt, genau wie ihr. Wenn ihr verliert, gebt ihr uns zwei heilige Quellen. Und wenn wir verlieren, werden wir unser Zuhause und unser Land aufgeben. Die Nymphen können als Kampfrichterinnen fungieren.
Wo ich herkomme – und ja, Birmingham hat mit dem Parnassus ansonsten recht wenig gemeinsam –, ist das eine eindeutige Herausforderung. Woran liegt es, dass Männer und Frauen denken, sie könnten mit den Musen konkurrieren, sie besiegen? Sie werden sowohl hochgeschätzt (von den Dichtern schon in ihren ersten Zeilen) als auch unterschätzt (von Musikerinnen, Sirenen, Schwestern und anderen). Und sie sind nicht die einzigen Göttinnen, die mit dieser Überheblichkeit behandelt werden: Niobe vergleicht sich mit Leto, Arachne mit Athene. In den folgenden Kapiteln werden wir noch häufiger solche Geschichten über unkluge Sterbliche und ihre Versuche, die Gottheiten zu besiegen, hören. Den Musen aber scheint das außergewöhnlich oft zu passieren. Ich frage mich, ob das so ist, weil ihre Qualitäten so leicht zu unterschätzen sind: Sie sind hübsch, sie tanzen, sie singen. Das sind alles Dinge, die auf andere Gottheiten oder sogar auf Sterbliche auf viel fatalere Weise zutreffen: Wir hören häufig, dass die Schönheit von Aphrodite und ihrer liebsten Halbsterblichen Helena von Sparta (später Helena von Troja) etwas Zerstörerisches hat – oder dass sie zumindest zerstörerische (oder selbstzerstörerische) Tendenzen in den Männern, die sie begehren, hervorruft. Die Mänaden oder Bacchien – die Frauen, die mit religiöser Besessenheit dem Gott Dionysos huldigen – sind ebenfalls zerstörerisch, jedenfalls wenn sie tanzen. Sie stürmen durch die wilden Berge und Wälder, und jeder vernünftige Mann hält sich von ihnen fern. Die Alternative ist nämlich der so gut wie sichere Tod. Diese starken, von einem Gott besessenen Frauen würden ihn in Stücke reißen. Die Sirenen unterdessen sind dermaßen tödlich für Seefahrer, dass es nur einen Mann gibt – Odysseus –, der es je überlebt hat, ihren Gesang zu hören. Und das nur, weil er dem Rat von Circe, der Göttin der Zauberei, Folge geleistet und seinen Männern befohlen hat, ihn am Mast seines Schiffes festzubinden, damit es ihm physisch unmöglich ist, sich ins Meer zu stürzen, auch wenn der Drang dazu überwältigend wird.
Die Musen wirken nicht gerade gefährlich schön, sondern – jedenfalls nach Hesiods Darstellung – einfach nur sehr hübsch, passend zur bukolischen Idylle. Ihr Gesang sorgt nicht dafür, dass sich Männer ertränken, weil sie mehr hören wollen, er inspiriert sie, selbst Gedichte zu schreiben und Lieder zu komponieren, zu spielen und zu singen. Ihr Tanz sorgt nicht einmal dafür, dass sie Hornhaut an den Füßen bekommen, geschweige denn, dass sie irgendjemanden in Stücke reißen würden. Auch wenn die Musen bei Pindar – dem lyrischen Dichter, der im frühen 5. Jahrhundert v.d.Z. in Theben wirkte – ioplokamōn[25] sind (das bedeutet, dass ihr Haar veilchenfarben ist), also zumindest ein bisschen schaurig aussehen.
Falls wir also versuchen, die Musen im Vergleich zu diesen anderen Figuren zu beschreiben, sind sie eher auf konstruktive Art schön als auf destruktive. Sie machen uns durch ihre bloße Existenz zu besseren Wesen. Wir dürfen uns von ihrem Talent fürs Singen, Tanzen, Musikmachen und Komponieren etwas abschauen, jedenfalls, wenn wir sie zu Beginn unseres kreativen Vorhabens sehr höflich fragen. Doch manche können sich nicht zurückhalten, eine solche Großzügigkeit auch gleich besitzen zu wollen (wie Thamyris), zerstören (wie Pyreneus) oder übertrumpfen zu wollen (wie Pierus’ Töchter). Und wenn man sie bedroht – entweder ihre körperliche Unversehrtheit oder ihren Ruf –, verlieren die Musen die Geduld und nehmen Rache.
Die Musen wollen keinen Wettkampf mit Pierus’ Töchtern, sie finden es turpe – unanständig[26] –, sich darauf einzulassen, aber noch schlimmer, sich geschlagen zu geben. Die Nymphen lassen sich auf ihr Amt als Schiedsrichterinnen ein und schwören bei ihren Flüssen (für sie das Äquivalent zu einem heiligen Buch), die Darbietungen fair zu beurteilen. Die erste Pieride fängt an zu singen, und zwar die Geschichte der Gigantomachie, des Krieges zwischen Gottheiten und Giganten. In ihrer Version – anders als in der Standardversion, die die Musen wahrscheinlich kennen würden – besiegen die Giganten die Gottheiten. Auch dies ist leicht zu erkennen als frühes Säbelrasseln in einem Krieg, in dem man keine Hoffnung auf den Sieg hat. Sie befinden sich nicht nur im Revier der Musen, sie singen auch noch über unsterbliche Götter und Göttinnen, die gegen sterbliche Riesen verlieren.
Als Reaktion auf diese Darbietung tritt Kalliope auf, um ihre göttliche Revanche zu liefern. Sie erinnert als Erstes das Publikum daran, dass einer der Giganten – sie benennt Typhon, wobei andere Quellen besagen, dass es Enkelados war – unter dem Ätna in Sizilien gefangen ist. Sein unterirdisches Zappeln und seine Wut sind es, die die unregelmäßigen Ausbrüche des Ätna auslösen. Danach beschreibt sie Proserpinas Entführung (Proserpinas griechischer Name ist Persephone) durch Pluto oder Dis. Das ist eine altbekannte Geschichte, in der ein Gott ein Sexualtäter ist und eine Göttin – in diesem Fall Proserpinas Mutter Ceres oder Demeter – eine unermüdliche Heldin. In Demeters Kapitel werden wir uns das genauer ansehen.
Eine der Fähigkeiten, die eine gute Performerin braucht, ist es, ihr Publikum einschätzen zu können. Kalliope fügt eine ganze Passage darüber hinzu, wie die Nymphe Kyane versucht, Pluto daran zu hindern, Proserpina zu entführen. Kyane lässt ihn nicht so einfach gewähren – sie stellt ihn zur Rede, erinnert ihn daran, dass er Proserpina und auch ihre Mutter Ceres um Erlaubnis hätte fragen sollen. Die Nymphe weigert sich dann, ihn durchzulassen. Pluto nutzt seine göttliche Macht, um einen neuen Weg durch den Hades zu sprengen. Kyane ist von diesem Verhalten so verletzt, dass sie in das Wasser, in dem sie lebt, hineinschmilzt.
Es ist kaum nötig zu betonen, dass es nicht schaden kann, in einem von Nymphen beurteilten Wettbewerb eine Geschichte über eine mutige Nymphe zu erzählen, die versucht, einer unschuldigen Göttin das Leben zu retten – und sie vor den unerwünschten sexuellen Annäherungen ihres Onkels zu bewahren. Kyanes Verhalten Proserpina gegenüber ist schwesterlich, vielleicht werden die Nymphen, die den Wettbewerb beurteilen, Kalliope ja ebenso behandeln. Die Muse führt daraufhin das Thema weiblicher Solidarität fort.
Ceres sucht nach ihrer verschwundenen Tochter, und – wer hätte das gedacht – eine weitere Nymphe, Arethusa, bietet an, ihr zu helfen. Sie hat gesehen, wie die verängstigte Proserpina in die Unterwelt geschleift wurde, um zur Königin gemacht zu werden. Mit dieser Information kann Ceres sich an Jupiter, den König der Gottheiten, wenden, und ihre Tochter zurückverlangen. Jupiter ist dabei keine Hilfe – er definiert Plutos langfristige sexuelle Belästigung als Liebesakt.[27] Aber Ceres gibt nicht auf, sogar, als alles längst verloren scheint. Der Kompromiss, auf den Jupiter sich einlässt – dass Proserpina jeweils für einen Teil des Jahres zurückkehren kann, weswegen wir jetzt kalte, dunkle Monate im Winter haben –, ist die widerwillige Reaktion männlicher Gottheiten, die eine Göttin, die einfach nicht lockerlässt, besänftigen wollen.