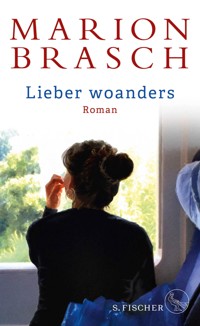9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ab jetzt ist Ruhe« – dieser Spruch, den die unruhigen Kinder mit ihrer Mutter aufsagten und der sie in den Schlaf geleiten sollte, liegt wie ein Motto über dem Familienroman von Marion Brasch. Die jüdischen Eltern, die sich im Exil in London kennenlernten, gründeten die Existenz ihrer jungen Familie in Ostberlin, wo der Vater nach dem Krieg seine Ideale als Politiker verwirklichen wollte. Die drei Söhne – zwei davon wurden Schriftsteller, der mittlere Schauspieler – revoltierten gegen die Autorität der Vätergeneration und scheiterten an der Wirklichkeit, während die kleine Schwester Versöhnung und Ausgleich suchte und oft genug damit an Grenzen stieß, auch an die eigenen. Marion Brasch ist mit diesem Roman ein bewegender, oft witziger Rückblick auf die Geschichte ihrer Familie gelungen, gleichzeitig erzählt sie ihr eigenes Leben in einem Land, das es heute nicht mehr gibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Marion Brasch
Ab jetzt ist Ruhe
Roman meiner fabelhaften Familie
FISCHER E-Books
Inhalt
Für Lena
Prolog
Ich war vier Jahre alt, als ich das erste Mal von zu Hause fortlief. Ich kann mich nicht daran erinnern, doch mir wurde diese Geschichte immer wieder und von verschiedenen Seiten auf sehr widersprüchliche Weise kolportiert. Mein Vater erzählte, man habe an jenem Sonntagnachmittag mein Verschwinden erst bemerkt, als der Anruf der Bahnhofsaufsicht gekommen sei. Man habe mich im Süßwarenladen der Bahnhofspassagen Alexanderplatz aufgegriffen, wo ich auf der kostenlosen Herausgabe einer Tüte Schokolinsen bestanden hätte.
Meine Mutter berichtete, sie habe das Kinderbett leer vorgefunden, als sie die Bügelwäsche in den Schrank legen wollte. Glücklicherweise habe es in genau diesem Augenblick an der Tür geklingelt. Es sei die Nachbarin gewesen, die mich weinend und orientierungslos im Bahnhof habe herumirren sehen. Meine Mutter pflegte ihre Erzählung mit allerhand interessanten, wenngleich auch variierenden Details auszuschmücken: Mal trug ich einen Schlafanzug, mal war ich komplett angezogen. Mal hatte ich ein Eis in der Hand, mal war’s ein Lutscher. Aber immer stand die Nachbarin aus dem vierten Stock vor der Tür.
Und dann gab es noch die Version meines damals neunjährigen jüngsten Bruders. Er behauptete beleidigt, nicht ich sei abgehauen, sondern er. Und es sei auch kein Süßwarenladen gewesen, sondern ein Tabakgeschäft.
Dies ist eine der Geschichten, die in meiner Familie immer wieder erzählt wurden. Und sie ist wahr – genauso wahr wie alle folgenden Geschichten.
Eins
Ich war also vier Jahre alt, als ich das erste Mal von zu Hause fortlief. Ich kann mich daran erinnern, weil meine Mutter mich früher als sonst zum Mittagsschlaf ins Bett schickte. Normalerweise durfte ich sonntags nach dem Essen noch eine halbe Stunde bei den Erwachsenen spielen. Für normale Sonntage wie diesen hatte ich ein wechselndes Arsenal an Spielsachen, das ich in meiner Spieldecke ins Esszimmer zu schleifen und unter dem Esstisch auszubreiten pflegte. An normalen Sonntagen wie diesem saßen meine Eltern und meine beiden größeren Brüder um diesen Tisch. Diesmal war sogar mein dritter und ältester Bruder da, der sich immer seltener blicken ließ.
Er war neunzehn, sah toll aus und trug eine Lederjacke, die unglaublich gut roch und bei jeder seiner Bewegungen knarzte wie ein alter Baum. Je erregter das Gespräch am Tisch wurde, desto schneller und lauter schien auch die Jacke zu sprechen. Ein faszinierender, aber irgendwie auch beunruhigender Vorgang, den ich gebannt verfolgte, bis das Gesicht meiner Mutter unter dem Tisch erschien und mir mit großer Bestimmtheit bedeutete, dass ich diesen Ort ganz schnell in Richtung Kinderzimmer zu verlassen hätte.
Ich ließ mir Zeit. Denn sosehr ich es auch hasste, wenn sie sich stritten – noch mehr hasste ich es, ihnen aus der Verbannung dabei zuhören zu müssen. Doch es nutzte nichts, irgendwann war ich allein in meinem blöden Bett im Kinderzimmer. Allerdings nicht sehr lange, denn bald wurde auch mein jüngster Bruder rausgeschmissen. Er, der mit neun Jahren eigentlich schon lange keinen Mittagsschlaf mehr machen musste. Er, der immer so tat, als würde er die Erwachsenen verstehen. Er, der im Doppelstockbett immer oben schlafen durfte.
Fluchend schmiss er die Kinderzimmertür zu, klärte mich über »die Spießigkeit der Alten« auf und ließ seine Wut mit kindlicher Grausamkeit an meiner Lieblingspuppe aus, indem er ihr mit den Worten »Die sieht doch so viel besser aus!« das Gummigesicht eindrückte. Danach kletterte er in sein Bett und schwieg beleidigt.
An normalen Sonntagen hätte ich nach der Sache mit der Puppe etwas nach ihm geworfen und wäre petzen gegangen. Doch dieser Sonntag war anders. Vielleicht war ich erwachsener geworden, vielleicht fiel auch einfach nur eine Tür zu viel zu – es spielte keine Rolle. Ich wollte weg. Türmen.
Türmen. Das war das Wort, das meine Mutter benutzte, wenn sie von England sprach. »Wir sind getürmt«, sagte sie und erzählte mir irgendwann auch von der Zahnbürste, mit der sie und ihre Schwester in Wien unter Aufsicht der Nazis die Straße putzen mussten. Sie erzählte diese Geschichte beiläufig. Wie eine Episode, die sie normalerweise vergessen hätte. Wie eine Anekdote, an die man sich nur wegen einer Nebensächlichkeit erinnert: eine Zahnbürste, die danach zu nichts mehr zu gebrauchen war.
Ich dachte damals, das sei ein Spiel gewesen: Wer verliert, putzt eben die Straße mit der Zahnbürste, na und? Und Nazis – das Wort klang aus ihrem weichen wienerischen Mund so, als handelte es sich um eine putzige Hunderasse. Doch türmen – das Wort war toll.
Ich stellte mir meine Mutter vor, wie sie sich mit ihren Habseligkeiten verwegen von einem Turm zum nächsten schwang und irgendwann in London ankam. So was wollte ich auch versuchen. Doch die Zeit schien einfach noch nicht reif, und es gab in meiner Gegend auch irgendwie nicht genügend Türme. Deshalb kam ich nur bis zum Bahnhof Alexanderplatz.
Den Weg dorthin hätte ich mit geschlossenen Augen gehen können. Das hatte ich oft an der Hand meines Vaters geübt, wenn er mich am Wochenende zum Zigarettenholen mitnahm. Wir hatten einen Geheimcode. Einmal die Hand drücken: Bürgersteig runter, zweimal die Hand drücken: Bürgersteig rauf. Anfangs blinzelte ich noch manchmal, irgendwann nicht mehr. Ich öffnete die Augen erst, wenn ich den Laden roch, in dem mein Vater sich Zigaretten und mir Süßigkeiten kaufte. Das Geschäft duftete nach Tabak und Kaffee. Ich mochte diesen Duft, konnte ihn aber nicht genießen, weil die Verkäuferin eine fette Idiotin war. Sie behandelte mich, als sei sie mit mir verwandt, und tätschelte mit ihren dicken Wurstfingern mein Kinn, als wollte sie es mir bei nächster Gelegenheit klauen, weil sie selbst keins mehr hatte. Das alles hätte ich leicht ertragen, wäre sie nicht so scharf auf meinen Vater gewesen: »Na, Herr Stellvertretender Minister?«, pflegte sie zu schleimen. »Die Guten, wie immer?« Mein Vater nickte. »Und für die Kleine: Schokolinsen!«, schrie sie, als sei ich begriffsstutzig oder taub. Ich hasste die Dicke. Und sie war immer da. Vielleicht war sie zu fett, um diesen Ort zu verlassen. Vielleicht war sie so fett wie der dicke Herr Bell, von dem mein ältester Bruder mir mal erzählt hatte.
Der dicke Herr Bell war irgendwann so dick, dass er nicht mehr durch seine Wohnungstür passte. Er saß den ganzen Tag auf dem Teppich und wartete auf seine Nachbarin, die ihm etwas zu essen brachte. Der dicke Herr Bell wurde immer trauriger, weil er gar nicht mehr wusste, was in der Welt passierte. Doch irgendwann kam ihm eine Idee.
Er bat seine Nachbarin, ihm einen langen Draht, dünnes Blech, einen Hammer und zwei Zangen zu besorgen. Jetzt hat er den Verstand verloren, dachte die Nachbarin. Doch sie brachte ihm, was er wollte. Und der dicke Herr Bell erfand das Telefon und wurde irgendwann wieder fröhlich, weil er Leute anrufen konnte, die ihm erzählten, was in der Welt passierte.
Die dicke Frau im Tabakladen war nicht fröhlich. Sie war nur fett und laut. Auch als sie mich an diesem Sonntagnachmittag durch die Schlange erspähte und meine Pläne durchkreuzte. Sie stemmte ihre Oberschenkelarme in die Hüfte und schrie: »Na, was macht denn die kleine Motte hier?! Wo ist denn der Vati?!« Das Wort »Vati« erreichte nur noch durch den Hall der Bahnhofspassage mein Ohr, wo ich der Nachbarin aus dem vierten Stock in die Arme lief.
»Was machst du denn hier so ganz allein?«
»Ich bin getürmt«, erklärte ich.
»Soso«, sagte sie, kaufte mir ein Eis und brachte mich nach Hause. Meine Mutter war kreidebleich, als sie die Tür öffnete. Sie bedankte sich kleinlaut bei der Nachbarin und zog mich in die Wohnung.
»Was hast du dir dabei gedacht?«
»Ich bin getürmt. Genau wie du!«
»Unser Schwesterchen ist getürmt«, feixte mein mittlerer Bruder, der plötzlich hinter ihr stand. »Alle wollen es, und sie macht’s einfach.« Er war vierzehn, und ich sah ihn nur am Wochenende, wenn er aus dem Internat nach Hause kam.
Meine Mutter fuhr herum. »Geh sofort in dein Zimmer, wir sprechen uns noch!«, herrschte sie ihn an.
»Wir sprechen uns noch«, äffte mein Bruder sie nach und verschwand in seinem Zimmer. Meine Mutter schimpfte mit mir, und ich musste ihr versprechen, dass ich so etwas nie wieder tun würde.
»Bilde dir bloß nichts drauf ein!«, sagte mein jüngster Bruder, als wir abends im Bett lagen. »Ich bin schon abgehauen, da lagst du noch als Quark im Schaufenster.«
»Gar nicht.«
»Du hast doch überhaupt keine Ahnung.«
»Und du bist doof.«
»Schnauze.«
»Selber.«
Meine Mutter kam herein.
»Schluss jetzt«, sagte sie streng und zog die Vorhänge zu. Sie kam an unser Bett, küsste uns, und wir sagten unseren Gutenachtspruch auf, jeder immer ein Wort.
Ab – jetzt – ist – Ruhe.
Dann machte sie das Licht aus und ging.
Wenn es nach meinem ältesten Bruder ging, war jenem spektakulären Fluchtversuch bereits ein anderer vorausgegangen. Damals war ich zehn Monate alt und er sechzehn Jahre. Wir bewohnten ein Haus am Stadtrand und verfügten sowohl über einen Hund namens Fred als auch über eine ältliche Haushälterin mit Überbiss: Agnes.
Es war ein gewöhnlicher Vormittag im Sommer. Meine Eltern arbeiteten, meine beiden jüngeren Brüder waren im Kindergarten und in der Schule. Ich war mit meinem ältesten Bruder, Hund Fred und Agnes allein. Agnes rauchte in der Küche, mein Bruder war in seinem Zimmer, Fred lungerte im Garten herum, und ich spielte auf dem Wohnzimmerteppich.
Ob aus Langeweile oder Neugier – unbeobachtet und mit nicht mehr als ein paar lässig um die Hüften geschwungenen Stoffwindeln kroch ich irgendwann aus dem Haus, durch den Garten und auf die Straße. Der Hund entdeckte mich, rannte mir hinterher, trug mich an den Windeln im Maul zurück und legte mich schweigend in den Flur, worauf ich in gellendes Geschrei ausbrach. Mein ältester Bruder stürzte aus seinem Zimmer, setzte mich ins Laufgitter, rief nach der nutzlos in der Küche rauchenden Agnes und knallte ihr eine. Agnes wurde noch am selben Tag gefeuert, und auch der Hund muss kurz darauf gestorben sein, denn ich kann mich beim besten Willen an kein Hundegesicht erinnern. Wir verließen das Haus am Stadtrand und zogen in eine Neubauwohnung am Alexanderplatz.
Von da an ging ich in die Wochenkrippe – eine fabelhafte Einrichtung: Montagfrüh wurde man frisch gewindelt abgegeben und Freitagabend im gleichen Zustand wieder abgeholt. Dazwischen galt meine ganze Aufmerksamkeit vermutlich der Aufnahme und dem Ausscheiden von Nahrung.
Auf die Wochenkrippe folgte der Kindergarten. Und für den Kindergarten hatte ich einen Fahrer, der mich dorthin brachte, nachdem er meinen Vater bei der Arbeit abgesetzt hatte. Das Auto war ein schwarz glänzender Tatra, und der Fahrer hieß Herr Wolf. Herr Wolf war ein großer, breitschultriger Mann und hatte immer nasse Haare, die er an jeder roten Ampel mit einem braunen Kamm akkurat nach hinten kämmte, so dass sie am Hinterkopf eine Art Scheitel bildeten.
Herr Wolf brachte mich zu der kleinen pudelköpfigen Tante Ritter und der strengen, hässlich bebrillten Tante Liebig. Die beiden ergänzten sich vortrefflich. Was das weiche Herz der einen durchgehen ließ, rückte die andere mit mahnender Stimme und fester Hand wieder zurecht.
Einmal gab es zum Mittag Sülze, also Fleischfetzen mit Fettaugen in Aspik. Tante Ritter ging um den Tisch herum und versuchte uns das eklige Essen irgendwie schmackhaft zu machen. »Guck mal, das da hat ein Gesicht, es lacht dich an. Es will gegessen werden, mmmh.« Die meisten machten gute Miene zum bösen Spiel und schoben sich den Fraß in homöopathischen Dosen irgendwie rein. Wenn Tante Liebig hingegen ihre Runde drehte, waren große Gabeln angesagt. Auch bei mir. Sie beugte sich mit ihren schweren Brüsten über meine Schulter und zeigte mit noch schwererem Finger auf meinen jungfräulichen Teller: »Was ist denn das? Da liegt ja noch alles drauf! Jetzt aber ganz schnell weg damit!« Sie griff nach dem unberührten Besteck, spießte ein großes Stück des fleischfarbenen Glibbers auf und hielt es mir vor die Nase. Nicht sehr lange, weil ich kotzen musste und damit das eklige Zeug auf meinem Teller endgültig ungenießbar machte.
Ebenso ungern erinnere ich mich an die Faschingsfeiern im Kindergarten. Während die anderen jedes Jahr in neuer Gestalt erschienen, war ich das Blumenmädchen, und zwar immer: Sommerkleid, Kopftuch und ein kleines Körbchen mit Kunstblumen. Einmal gab mir meine Mutter ein rotes Kopftuch und legte in das Körbchen eine leere Rotweinflasche und zwei Stücke Marmorkuchen: Rotkäppchen – es war demütigend.
Für den letzten Fasching im Kindergarten wollte ich das Blatt wenden. Und Oma Potsdam sollte mir dabei helfen. Sie war die Mutter meines Vaters, und wir nannten sie Oma Potsdam, um sie von Oma London zu unterscheiden.
Oma Potsdam ging mit mir in einen Laden, wie ich ihn vorher und auch nachher nie wieder gesehen habe. Von außen ein Geschäft für »Textilien und Kurzwaren«, drinnen eine bunte Wunderhöhle, vollgestopft mit Farben. Es konnten sich höchstens zwei oder drei Kunden gleichzeitig darin aufhalten, so eng war es dort. Die Tische bogen sich unter der Last großer, vielfarbiger und glänzender Stoffballen, in den Regalen türmten sich Garnrollen und Wollknäuel, von der Decke hingen lange bunte Bänder in allen Materialien und mit verschiedensten Mustern. Es gab große Holztruhen mit Tausenden Stoffresten und Kisten voller Knöpfe, Pailletten und Strass.
Die Besitzerin des Ladens hieß Eva, meine Oma duzte sie. Eva war ungefähr vierzig und unglaublich schön. Sie hatte feuerrotes lockiges Haar und graue Augen, deren Lider halb geschlossen waren, so dass sie immer irgendwie müde aussah. Meine Oma nannte es »Schlafzimmerblick«. Dass dieses Wort eine andere Bedeutung hatte, als ich ihm gab, lernte ich erst später. Auch erzählte sie mir irgendwann, dass Evas rotes Haar gar nicht echt sei und sie eigentlich das mittelblonde glatte Haar ihres Vaters habe – eines asthmatischen Bäckermeisters, bei dem ich immer unsere Brötchen holte.
Wir zwängten uns durch Evas Laden und suchten aus, was man für eine morgenländische Prinzessin brauchte. Eva nahm meine Maße und bestellte uns für den nächsten Tag in ihre Wohnung, deren Wände mit Stoffen tapeziert und mit Bildern geschmückt waren, die nur ein einziges Motiv hatten: Eva.
Eva schneiderte mir einen paillettenbesetzten Traum aus dunkelblauer Kunstseide, mit Schleier und langer Schleppe. Die Lebenszeit dieses Traumes betrug exakt zwei Stunden und endete im Hausflur meiner Oma als rußiges Nichts mit zerrissener Schleppe, einem verstauchten Knöchel und schlimmen Tränen. Völlig unbemerkt hatte sich die Prinzessin aus der Wohnung geschlichen, um ihre Großmutter mit einem Eimer Kohlen aus dem Keller zu überraschen. Scheherazade sollte den Hinterhof in Potsdam niemals verlassen.
Ich liebte es, zu Oma Potsdam zu fahren. Ich durfte aufbleiben, so lange ich wollte, ich durfte Westfernsehen gucken und dabei meiner Oma Zigaretten drehen. Sie besaß eine silberne Tabakdose und eine Zigarettenspitze aus Elfenbein, an der sie elegant wie ein Filmstar zog, während sie mir Geschichten von früher erzählte. Geschichten aus einer Welt, die mit der, in der sie jetzt lebte, nicht das Geringste gemein hatte. Es war die Welt einer wohlhabenden jüdischen Fabrikantenfamilie, die aus einem Kaff bei Breslau nach Berlin gekommen war. Ihr Vater war eines von acht Kindern, hatte einen Zwillingsbruder und starb mit nur einundfünfzig Jahren. »An gebrochenem Herzen«, wie meine Oma immer wieder seufzend und nicht ohne eine gewisse Dramatik betonte. Über ihre strenge Mutter sprach sie kaum.
Sie zeigte mir Fotos von ihrem Bruder, der im Ersten Weltkrieg in die afrikanischen Kolonien ging und dort an Gelbfieber starb. Sie zeigte mir ihre schöne Schwester – eine Sängerin und Tänzerin, die von den Frauen hochrangiger Nazis protegiert wurde, bis man sie dann doch nicht mehr so toll fand und nach Theresienstadt deportierte.
Sie erzählte mir von ihren drei Ehemännern, von denen einer schlimmer gewesen sei als der andere. »Sie haben mich alle betrogen«, seufzte meine Oma. »Aber sie sahen blendend aus!«
Sie zeigte mir das Foto eines jungen Mannes, der meinem Vater zum Verwechseln ähnlich sah. Er trug die Uniform eines Offiziers im Ersten Weltkrieg und lächelte charmant in die Kamera. »Ein schöner Nichtsnutz, ein Schürzenjäger. Er ist leider wahnsinnig geworden.« Bevor das geschah, ließ sie sich von ihm scheiden, um kurz darauf einen Filmkritiker zu heiraten, der ihr das Berlin der zwanziger Jahre zu Füßen legte. Allerdings nur so lange, bis er die Füße anderer Frauen verlockender fand.
Folgte Ehemann Nummer drei: ein Biologe, Kunstliebhaber und Übersetzer. Er war zwanzig Jahre älter als meine Oma und holte sie in das kleine oberbayerische Dorf, in dem er lebte.
»Sie haben sich das Maul zerrissen, wenn wir die Dorfstraße entlangliefen«, erzählte sie mir und zog an ihrer elfenbeinernen Zigarettenspitze. »›Die geschiedene Jüdin‹ haben sie mich genannt. Aber ich war besser als dieses Pack!« Sie stieß den Rauch mit einer Verachtung aus, als befände sich das Dorf vollzählig mit uns im Raum.
Sie war besser und bewies es den Leuten, indem sie katholischer wurde als sie. Sie machte die Religion zu ihrem neuen Hobby. Doch was sie anfangs noch aus einer Mischung aus Trotz, Langeweile und Neugier tat, wurde mehr und mehr zum Lebensinhalt. Irgendwann gab sie nicht nur vor zu glauben – sie glaubte tatsächlich.
Ihren Sohn, der später mein Vater werden sollte, schickte sie auf ein katholisches Internat in den Bergen. Dort wurde er ein fleißiger Ministrant, und wäre er nicht beschnitten gewesen, hätte er wohl bald gänzlich vergessen, dass er Jude war. Er lernte, was ein guter Katholik zu lernen hatte. Pater Richard lehrte ihn Latein, bei Pater Rupert beichtete er, und Pater Martin erklärte ihm die Welt. Allerdings auf eine Weise, die der Gestapo nicht gefiel. Jetzt war er Antifaschist und Jude – das ging gar nicht, er musste weg. Aus dem Internat und aus dem Land. Ein jüdischer Kindertransport brachte ihn nach England.
Seine Mutter durfte bleiben. Sie war durch die Verbindung mit einem nichtjüdischen Mann noch geschützt. Später versteckte er sie, und als der Krieg vorbei war, wurde die Ehe wegen des wiederholten Vorwurfs der Schürzenjägerei geschieden. Meine Oma lebte noch zwei Jahre im Gästezimmer ihres Ex-Mannes und seiner jungen Frau, und als mein Vater aus dem Exil zurückgekehrt war, fand er für sie die kleine Wohnung in Potsdam, in der sie auch jetzt noch lebte.
Meine Oma liebte den Schein und die Welt der schönen Dinge. Sie verlor sich gern in der Vergangenheit, die sie wie einen Schatz in ihrem alten Sekretär verbarg. Manchmal gab sie mir den Schlüssel und erlaubte mir, in die vielen kleinen Schubladen zu schauen, in denen sie die Insignien eines anderen Lebens aufbewahrte.
Sie lebte in der Vergangenheit, ohne zu vergessen, dass ich ein Teil ihrer Gegenwart war. Sie ließ mich in ihrem Bett unter dem hölzernen Kreuz schlafen und nächtigte selbst auf der unbequemen Couch im Wohnzimmer. Wenn ich morgens aufwachte, kroch ich zu ihr unter die Decke, und sie las mir mit ihrer knarzigen warmen Stimme Indianergeschichten vor. Sie kochte mir Grüne Bohnen, buk mir Schokoladenkuchen und kaufte mir kleine Ringe mit leuchtenden bunten Glassteinen.
Nur die Sonntagvormittage waren öde. Da nahm sie mich mit in die Kirche. Eine Stunde elender Langeweile mit ernst dreinblickenden alten Leuten und einem gelbgesichtigen Pfarrer, der schlimm aus dem Mund roch. Wenn er vor dem Gottesdienst am Kirchenportal stand, um seine Gemeinde persönlich in Empfang zu nehmen, holte ich tief Luft und hielt sie an, bis ich drin war. Später begriff ich, dass ich einfach nur durch den Mund atmen musste, um mir das Leben zu retten. Ich drängte Oma Potsdam dazu, sich möglichst weit hinten in die Bank zu setzen, doch selbst da schien mich der stinkende Atem des Gottesmannes zu erreichen.
Mein Vater hatte seiner Mutter strikt untersagt, mich mit in die Kirche zu nehmen. Nicht etwa, weil er mir die endlosen Predigten, Gebete und das Psalmengesinge ersparen wollte. Nein, mein Vater machte sich Sorgen, dass mein zart heranwachsendes Klassenbewusstsein untergraben werden könnte.
Oma Potsdam wiederum hegte keine missionarischen Absichten – ob ich an Gott glaubte oder nicht, war ihr egal. Ihr ging es einzig darum, ihrem Sohn eins auszuwischen. Sie wusste, wie sehr mein Vater ihren Katholizismus hasste. Außerdem machte sie ihn verantwortlich für dieses »Desaster«, wie sie es nannte. Ich wusste damals natürlich noch nicht, was das bedeutete, erkannte aber an dem verächtlichen Blick, den sie bei diesem Wort durch ihre kleine Potsdamer Hinterhofwohnung schickte, dass es irgendetwas mit ihrem jetzigen Leben zu tun haben musste. Dass sie mich in die Kirche schleppte und Westfernsehen gucken ließ, war ihre kleine Rache an ihrem Sohn. Es bereitete ihr diebisches Vergnügen, ihn zu hintergehen.
»Der Schlag soll mich treffen, wenn ich mir das von deinem Vater verbieten lasse«, sprach sie und ließ die Zigarette aufglühen, die ich ihr gedreht hatte.
Eines Tages wurde sie wirklich vom Schlag getroffen. Als sie siebzig Jahre alt war, fiel sie um und war tot. Mein Vater saß in der Küche und rauchte. »Oma ist tot«, erklärte er mit ausdrucksloser Miene. »Morgen ist ihre Beerdigung. Willst du mit? Du musst nicht.« Ich weinte. Er rauchte. Ich war zehn Jahre alt. Natürlich wollte ich mit.
Bei ihrer Beerdigung sprach der mundriechende Priester weihevolle Sätze, und die rothaarige Eva tauschte ihren Schlafzimmerblick durch einen trauerumwölkten. Und mein Vater rauchte.
Mein Vater rauchte immer. Auch wenn Oma London kam, die es nicht leiden konnte, wenn er rauchte. Sie mochte meinen Vater nicht und hatte ihrer Tochter nie verziehen, dass sie sich von einem zum Katholizismus und später Kommunismus konvertierten Juden nach dem Krieg ausgerechnet ins verhasste Deutschland hatte verschleppen lassen. Und dann auch noch in den Osten. Tief in ihrem Inneren verachtete sie ihre Tochter dafür, dass sie sich das hatte bieten lassen, und ließ es meine Mutter auch Jahrzehnte später noch auf sehr subtile Weise spüren.
Oma London hieß Oma London, weil sie und ihr Mann William nach dem Krieg nicht nach Wien zurückgekehrt, sondern in England geblieben waren. Die beiden lebten in einem wohlhabenden Vorort von London, und im Sommer fuhren sie in ihr Ferienhaus auf die milden Scilly-Inseln vor der Küste Cornwalls.
Oma London war schon über siebzig und immer noch eine Schönheit – elegant gekleidet, mit perfekt frisiertem Haar und langen, rot lackierten Fingernägeln. Sie sprach feinstes Wienerisch, das sie sorgsam mit englischen Vokabeln versetzte – eine Dame in Vollendung.
William, den wir nur Willy nannten, war ihr zweiter Mann und stand ihr an Noblesse in nichts nach. Er trug ein sorgsam gestutztes Menjou-Bärtchen, sein dunkles gewelltes Haar war mustergültig nach hinten gekämmt – er war der Inbegriff des perfekten Kavaliers mit dem Charme und der Nonchalance eines Wiener Lebemannes.
Willy war Zeichner und Bildhauer mit einer besonderen Leidenschaft für Tiere. Er schuf große Bronzeplastiken, die gern in diverse Zoos gestellt wurden, und zeichnete Cartoons mit lustigen Hundegeschichten. Uns Kinder beschenkte Willy hauptsächlich mit Bengo. Bengo war ein Hundewelpe, der als Comic- und Zeichentrickfigur oder als Kuscheltier sein kleines widerspenstiges Dasein fristete.
Mein Kinderzimmer wurde von zahllosen Bengos bevölkert. Den Bengo-Mittelpunkt meines Lebens allerdings bildete ein schmaler Teppich, der vor meinem Bett lag, bis er fadenscheinig wurde und in einer gemeinen Nacht-und-Nebel-Aktion von irgendeinem mitleidlosen Mitglied meiner Familie entsorgt wurde.
Die seltenen Besuche meiner Großeltern aus London waren ein Ereignis, denn Oma London verstand es fabelhaft, uns das Gefühl zu vermitteln, nicht sie würde uns besuchen, sondern umgekehrt.
Gemeinsam mit Willy residierte sie meist in einem teuren Hotel im Zentrum der Stadt. Dort gab sie uns Audienzen, die stets nach einem von ihr festgelegten Protokoll abzulaufen hatten. Für gewöhnlich warteten meine Eltern und wir Kinder in der Hotelhalle, bis meine Großmutter und Willy dort erschienen, um von uns ins Restaurant eskortiert zu werden. Oma London begrüßte jedes Familienmitglied mit mondäner Gelassenheit und hauchte kultivierte Küsschen. »Ja schau, Sweetie!«, pflegte sie zu säuseln, wenn ich an der Reihe war. »Look at you, was bist du groß geworden!« Sprach’s, nahm mein Gesicht zwischen ihre kühlen Hände und küsste mich auf die Stirn, während ich ihren kostbaren Duft aufsog. Sie roch gut. Nach erlesenem Parfüm und weiter Welt.
Die Betriebstemperatur von Willy lag um einiges höher als die meiner Oma. »Servus, Kleines!« Er grinste breit und nahm mich in den Arm. Und er war es auch, der mich während des endlos langen Aufenthalts im Hotelrestaurant mehrfach vor dem Tod durch Langeweile rettete.
Willy hatte immer einen Skizzenblock und Stifte dabei und zeichnete mir alles, was ich wollte. Hunde und Katzen, Kellner mit spitzen Gesichtern und Damen mit komischen Hütchen, das Essen auf dem Tisch, die gelangweilten Gesichter meiner Brüder und verschiedenartige Affen.
Die Zeit im Restaurant verging, bis Oma London irgendwann dem Kellner mit einer gnadenvollen Geste bedeutete, er möge die Rechnung bringen. Die Gesichter meiner Brüder entkrampften sich, in die Augen meines Vaters kehrte das Leben zurück, und meine Mutter schaute dankbar ins Nichts. Endlich war es vorbei, und auf die zähen Stunden im Restaurant folgte nun die Übergabe der Geschenke in der Hotelsuite. Für meine Brüder und mich waren das paradiesische Momente. Ich bekam Schokolade und Bengo-Sachen, für meine Brüder gab es die obligatorischen Levi’s, für meinen Vater Orangenmarmelade, Zigaretten und Ingwerstäbchen, und meine Mutter nahm traditionell die nach Mottenkugeln riechenden samtenen Morgenmäntel und seidenen Nachthemden in Empfang, für die meine Oma keine Verwendung mehr hatte. Meine Mutter war eine stolze Frau und verzog keine Miene. Mit einer fast beiläufigen Geste und einem kühlen »Danke, Mama« nahm sie die Sachen entgegen und legte sie sofort beiseite, während sie sich angeregt mit Willy unterhielt. Die Demütigung schien sie nicht nur zu verfehlen, sondern wurde von ihr postwendend an die Absenderin zurückgeschickt. Meine Mutter war ganz die Tochter der ihren. »Ich liebe sie«, sagte meine Mutter einmal. »Doch ich friere, wenn sie da ist.«
Zwei
»Was wolltest du eigentlich mal werden, als du klein warst, Papa?«
Mein Vater saß im Wohnzimmer, las Zeitung und rauchte. Nachdem ich meine Frage gestellt hatte, schlug er die Zeitung zusammen, legte sie beiseite und sah mich mit diesem Blick an, den ich nicht leiden konnte. Ein Blick, der mir verhieß, dass er mich in den nächsten Minuten mit Sätzen langweilen würde, die ich nicht verstand. Ich bereute schon, diese Frage gestellt zu haben, als dieser Blick plötzlich ganz fern und weich wurde. So, als hätte ihm irgendjemand etwas ins Ohr geflüstert, das einen sofortigen Sinneswandel zur Folge hatte.
»Priester«, sagte er. »Ich wollte Priester werden.«
Mir fiel sofort der mundstinkende Pfaffe von Oma Potsdam ein, und ich musste einen Würgereflex unterdrücken.
»Wir glauben doch aber gar nicht an Gott, oder?«
»Nein.«
»Warum wolltest du dann so was werden?«
»Weil ich da noch an Gott geglaubt habe.«
»Und warum jetzt nicht mehr?«
»Das ist eine lange Geschichte.«
Und er erzählte mir, wie er und sein Gott mit einem jüdischen Kindertransport nach England kamen. Sie wurden in einem muffigen, engen katholischen Kinderheim untergebracht, das von einer schwammigen ältlichen Irin geleitet wurde. Sister Margaret war immer schlecht gelaunt und ließ keine Gelegenheit aus, meinem Vater klarzumachen, dass er hier nur geduldet sei. Er war mit sechzehn Jahren der älteste Junge in diesem Heim, was sie gnadenlos ausnutzte, indem sie ihn zu jeder noch so schäbigen Drecksarbeit verdonnerte: Er war Hausmeister, Tellerwäscher, Kloputzer. Ohne Bezahlung, versteht sich. Um sich ein paar Shilling zu verdienen, trat er in den Dienst des Bruders der Heimleiterin – eines Jesuitenpaters. Wenigstens sein Job als Messdiener erinnerte ihn ein bisschen an zu Hause, die Rituale waren vertraut. Doch er fühlte sich einsam. Der Kontakt zu seiner Mutter und seinem Stiefvater war gänzlich abgebrochen, und er hatte keine Freunde. Er fing an zu rauchen. Nachts, wenn alle schliefen, schlich er sich hinaus in den kleinen, schmalen Garten des Heims, drehte sich Zigaretten und versuchte, mit seinem Gott zu reden, aber der machte sich rar. Oder vielleicht ging ihm einfach nur der Gesprächsstoff aus. Also dachte mein Vater darüber nach, was es außer Gott sonst noch geben könnte im Leben. Den Traum, Priester zu werden, hatte er noch nicht aufgegeben. Sein Stiefvater – der kluge, belesene, weltgewandte Mann – hatte ihn jedoch gewarnt, bei aller Liebe zu Gott nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren. Dieser Boden war gerade ziemlich fremd und hart. Doch er folgte dem Rat seines Stiefvaters und entschloss sich, eine Lehre zu beginnen. Werkzeugmacher. Er lernte: Werkzeuge zu machen, besser Englisch zu sprechen, erwachsener zu werden. Ungefähr ein Jahr lang. Bis der Krieg England erreichte.
Mit der Gastfreundschaft der Briten war es von einem Tag zum anderen vorbei, und alle Deutschen, ob Juden oder Kommunisten, galten als feindliche Ausländer und mussten weg. Weit weg. Und so kamen mein Vater und sein Gott in ein Internierungslager in Kanada.
»Die Schule meines Lebens«, erklärte mein Vater mit einer Stimme, die mich schaudern ließ, weil sie so ganz anders war als die, mit der er mir gerade seine Geschichte erzählt hatte. Sein eben noch so weicher, ferner Blick war der Miene gewichen, die ich nicht mochte: fest und streng und autoritär. »Die Schule meines Lebens.« Die Schule, in der die Bibel gegen das »Kommunistische Manifest« eingetauscht wurde und die »Genesis« gegen Darwins »Entstehung der Arten«.
Die Geschichte, wie aus einem katholischen Juden ein Kommunist wurde, erzählte mein Vater am liebsten. Für mich war es die langweiligste Geschichte der Welt. Sie handelte von langen Gesprächen mit alten Kommunisten. Es war eine Geschichte ohne Abenteuer, gespickt mit Worten, die ich nicht verstand: Marxismus, Klassenkampf, Revolution, Mission der Arbeiterklasse. Ich schaltete auf Durchzug. Ich war gerade mal sieben und hatte ganz andere Sorgen: »Papa, ich muss mal!«
Im Sommer fuhren wir auf die Insel Hiddensee und bezogen dort für vier Wochen einen Bungalow in einer Feriensiedlung für höhergestellte Parteifunktionäre. Meine Mutter bekam immer schlechte Laune, wenn wir dort ankamen.
»Seht euch diese Baracken an! Fehlt bloß noch der Lagerkommandant!« Sie wusste genau, dass ihre Sticheleien meinen Vater verletzten. Genauso wie ihr Aktionismus, nachdem wir angekommen waren. Bevor sie nämlich die Koffer auspackte, stellte sie die komplette Einrichtung um. Das war ihre Art, gegen die Uniformierung des Urlaubs zu protestieren und Individualität zu demonstrieren. Viel Spielraum hatte sie allerdings nicht für ihre kleine Rebellion, da die Zimmer des Bungalows so winzig waren, dass man die Wände vermutlich um die Möbel herum gebaut hatte. So konnte sie das Inventar lediglich einmal in Uhrzeigerrichtung verschieben und das Geschirr im Küchenschrank anders einräumen.
Begleitet wurde dieses sich Jahr für Jahr wiederholende Einzugsritual durch schlimme – mal englische, mal wienerische – Flüche, denen mein Vater sich unter dem Vorwand entzog, er werde im Dorf mal nach dem Rechten sehen, während meine Brüder und ich die Badesachen aus den Koffern wühlten und an den Strand flüchteten.
Wenn wir ein paar Stunden später zurückkamen, saß mein Vater rauchend vor dem Bungalow, während meine Mutter erschöpft auf dem Sofa lag und die obligatorische Erklärung abgab, im nächsten Jahr würden sie keine zehn Pferde mehr in dieses elende Lager bringen. Meine Brüder stießen sich grinsend in die Seite, und mein Vater schüttelte mit vorwurfsvoller Miene den Kopf. Und ich? Ich war zu klein, um zu verstehen, dass sie es nicht so meinte. Und es sollte ein paar Jahre dauern, bis ich begriff, dass es dieser Sarkasmus war, der sie lange davor bewahrte, bitter oder depressiv zu werden. Schwarzer Humor als Überlebensstrategie – bis auch das nichts mehr half.
Meine Mutter wollte nicht hier sein. Nicht in dieser tristen Feriensiedlung. Wenn wir spazieren gingen, schaute sie mit sehnsuchtsvollem Blick auf die schönen reetgedeckten Strandhäuser, die von Künstlern und Intellektuellen bewohnt wurden. Diese Leute lebten das Leben, das doch eigentlich ihr Leben hätte sein sollen. Das Leben einer Schauspielerin oder Sängerin. Ein leichtes, schönes, unbekümmertes Leben. So war es geplant. Davon hatte sie schon in London geträumt, als sie sich mit ihrer kleinen Theatertruppe Abend für Abend in eine Welt flüchtete, die mit dem grauen Leben im Exil nichts zu tun hatte. Theater spielen, um das Heimweh und die Fremdheit zu vergessen.
Dort hatte sie meinen Vater kennengelernt. Er kam zu jeder Vorstellung, trug immer denselben Anzug und saß immer in der dritten Reihe. In diesem Teil der Geschichte waren sich beide einig. Doch während mein Vater behauptete, er habe meine Mutter gleich am ersten Abend angesprochen und zum Wein eingeladen, dauerte es in der Version meiner Mutter Wochen, bevor es dazu kam.
Da stand er nach den Theatervorstellungen mit seinen Kumpels in der Ecke und schielte zu ihr hinüber. Schüchtern. Sie kannte ihn schon. Und sie kannte ihn anders. Bei den wöchentlichen Gemeinschaftsabenden der Emigranten stand er vorn und predigte das neue Deutschland, das sie alle nach dem Krieg aufbauen würden. Da war er nicht schüchtern. Er sprach mit fester Stimme und glaubte jedes Wort, das er sagte. Er war sehr überzeugend. Und er war schön mit seinem dunklen Haar, das ihm ins Gesicht fiel, wenn er zu leidenschaftlich gestikulierte. Er hatte Augen, die auch dann zu lächeln schienen, wenn er über ernste Dinge sprach. Und er sprach eigentlich immer über ernste Dinge. Meine Mutter verliebte sich in diesen Mann, der so anders war als die Jungs, die sie kannte. Er war genauso alt wie sie, gerade zwanzig. Doch er hatte die Ernsthaftigkeit eines Erwachsenen, der genau wusste, was er wollte.
Wenn er da vorn stand, sprach er mit großer Leidenschaft von Dingen, die sie eigentlich nicht interessierten. Was hatte sie mit Deutschland zu schaffen? Sie kam aus Wien, die deutschen Nazis hatten sie gedemütigt und ihre Familie auseinandergerissen. Die Träume dieses Mannes da vorn gingen sie nichts an, doch sie fühlte sich zu ihm hingezogen, und irgendwann sprach sie ihn einfach an.
»Hätte ich das nicht getan, wärst du jetzt nicht hier. Und ich auch nicht. Und das wäre vielleicht nicht das Schlechteste.« Sie schickte Scherzen wie diesem manchmal einen gespielten Seufzer hinterher und grinste. Ein Grinsen, das sofort die Dunkelheit aus ihren Worten zog. Das konnte sie gut.
Mein Vater liebte meine Mutter. Er heiratete sie, und ein halbes Jahr später wurde mein ältester Bruder geboren. Aber noch mehr als seine kleine Familie liebte mein Vater seinen Glauben an das Himmelreich auf Erden, das er in dem Land errichten wollte, das ihn um seine Jugend gebracht hatte. Deutschland. Der Krieg war zu Ende. Im Osten war die Sonne aufgegangen. Mein Vater und seine Freunde machten diese Sonne zu ihrem Symbol. Glaube, Liebe, Hoffnung – das ging auch ohne Gott. Der Teufel sollte ihn holen. Und mein Vater sagte zu meiner Mutter:
»Komm mit, wir gehen nach Deutschland.«
»Was soll ich da, ich bin keine Deutsche.«
»Wir sind Kommunisten.«
»Ich komme aus Wien. Ich bin Jüdin. Ich geh nicht nach Deutschland.«
»Ich werde gehen. Und wenn du nicht mitkommst, bleibst du hier allein mit deinem Sohn.«
Sie weinte. Mein Vater ging nach Deutschland und ließ sie allein. Meine Mutter zog mit ihrem kleinen Sohn zu ihrer Schwester und ihrem Schwager. Sie antwortete nicht auf die langen Briefe, die ihr Mann aus Berlin schrieb und in denen er sie bat, doch zu kommen. Es sei so viel Hoffnung hier. Er schrieb ihr, wie schlecht es ihm gehe ohne sie und wie sehr er sie liebe. Ein Jahr ließ sie ihn warten. Ein Jahr litt sie. Dann folgte sie ihm mit ihrem Sohn.
Sie folgte ihm überallhin: in seine neue Partei, in seine neuen Funktionen, in fremde Städte. Mit jedem Umzug ließ sie ein Stück ihres alten Traumes zurück wie ein überflüssiges Möbelstück. Sie lernte mit der Maschine zu schreiben und wurde Sekretärin, sie lernte Französisch und wurde Dolmetscherin, sie lernte Artikel zu verfassen und wurde Journalistin. Etwa alle fünf Jahre schenkte sie ihrem Mann ein Kind. Nach dem ersten noch dreimal.
Sie hatten viel Arbeit, wenig Geld und noch weniger Zeit. Also schickten sie ihre Kinder fort. Zuerst meinen ältesten Bruder. Er war elf, als er auf das Internat einer Kadettenschule kam, die aus wilden und ungestümen Jungen tapfere Soldaten machen sollte.
Mein ältester Bruder hatte anfangs nichts dagegen. Er liebte Uniformen und ging manchmal sogar mit seinem Pioniertuch schlafen. Also zog er stolz die Uniform an, in der er so erwachsen aussah, fuhr in die andere Stadt und hörte zu spät, wie das Anstaltstor schwer ins Schloss fiel.
Bald schon schmerzten seine Glieder vom täglichen Drill und sein Herz vom Heimweh, und er bat seinen Vater, ihn wieder nach Hause zu holen.
»Ich möchte kein Kadett mehr sein.«
»Was willst du dann?«
»Ich möchte Schriftsteller werden.«
»Auch ein Schriftsteller muss lernen und diszipliniert sein.«
»Dazu muss ich aber nicht hierbleiben!«
»Die größten sozialistischen Schriftsteller sind durch die harten Schulen des Lebens gegangen und haben gelernt.«
»Ich will hier weg. Ich halte es nicht mehr aus.«
»Reiß dich zusammen!«
Mein Bruder riss sich zusammen und schrieb. Er baute sich mit Worten eine Welt, in der er leben konnte, und erfand Leute, mit denen er leben wollte. Es war seine einzige Chance. Nach vier Jahren wurde die Kadettenanstalt geschlossen. Er war frei. Und schrieb weiter. Und wurde ein Schriftsteller. Ohne Disziplin.
Drei
An meinem sechsten Geburtstag versprach mir mein ältester Bruder, er würde mich heiraten, wenn ich achtzehn sei. Er trug seine schwere Lederjacke, die tief und warm knarzte, als er mich auf den Arm nahm. Ich wertete dieses vertraute Geräusch als Indiz dafür, dass er es ernst meinte, und glaubte ihm. Mein blöder jüngster Bruder erklärte mir noch am selben Tag, dass ich das vergessen könne, weil Brüder niemals ihre eigenen Schwestern heiraten dürften. Und dass mein ältester Bruder überhaupt ein Idiot sei, wenn er so eine Heulsuse und alte Petze wie mich nehme. Darauf schnappte ich mir den dicken Band »Chinesische Volksmärchen«, den mir meine Eltern zum Geburtstag geschenkt hatten, und zog ihm damit eins über, worauf er mir eine knallte. Ich rannte zu meiner Mutter und petzte, mein Bruder bekam eine Woche Stubenarrest.
Zu meinem siebten Geburtstag erschien mein ältester Bruder nicht. Ich erfuhr erst später, dass genau an diesem Tag sein Sohn geboren worden war. Die Mutter war eine schöne Sängerin mit kurzem Haar und großen dunklen Augen. Sie kam mit dem Baby vorbei, wiegte es im Arm und sang ihm ein Lied vor: »Benjamin, ich hab nichts anzuziehn. Mein letztes Kleid ist hin. Ich bin so arm.« Sie sang so schön – ich glaubte ihr und nahm meinem ältesten Bruder nicht mehr übel, dass er mich wohl nie heiraten würde. Allerdings nahm ich ihm übel, dass er sich offenbar nicht genug um sie kümmerte und sie deshalb nur ein einziges Kleid besaß. Ich konnte ihn nicht zur Rede stellen, weil er nicht kam. Sehr lange nicht.
Den Grund dafür erfuhr ich ausgerechnet von einem Jungen aus meiner Parallelklasse, den niemand leiden konnte. Er hieß Uwe und war ein elender Streber, der keine Gelegenheit ausließ, sich bei den Lehrern anzubiedern und andere zu verpfeifen: »Die Jungs sind mit den Mädchen im Schulgarten, und sie zeigen sich gegenseitig ihre Geschlechtsteile!« Ich hasste ihn. Und ich hasste ihn auch, weil er widerliches fettiges Haar hatte und seine Popel aß. Zu allem Überfluss wohnte Uwe auch noch in unserem Nebenhaus, und so passierte es hin und wieder, dass ich ihn auf dem Weg zur Schule am Hals hatte. So auch am ersten Tag nach den Sommerferien. Ich ging gerade an seinem Hauseingang vorbei, als er herauskam. Ich lief schneller, doch er holte mich ein.
»Warte doch mal!« Ich dachte nicht daran und lief schneller, doch er hielt mit mir Schritt.
»Stimmt das, was mein Vati sagt?«, keuchte er.
»Was denn?«, fragte ich und legte noch einen Zahn zu.
»Dein Bruder sitzt im Kittchen!«
Das war das Dümmste, was ich jemals gehört hatte. Und dass so ein Mist aus dem Mund dieses Idioten kam, wunderte mich nicht im Geringsten.
»So ein Quatsch!«
»Doch! Mein Vati hat das gesagt! Dein Bruder ist ein Landesverräter!«
Das Wort Landesverräter schrie er fast, und sein feistes Gesicht war inzwischen schweißnass und rot. Ob vor Anstrengung, weil er neben mir jetzt fast rennen musste, oder weil er wegen seiner Mitteilung so aufgeregt war, konnte ich nicht sagen. Und es war mir auch egal.
»Lass mich in Ruhe!«, herrschte ich ihn an und lief weg. Er holte mich nicht mehr ein. Vermutlich wollte er das auch gar nicht mehr.
»Landesverräter!« – für den Rest des Schulwegs tobte das Wort in meinem Kopf. Und es hörte auch nicht auf, als ich schon längst mit den anderen auf dem Schulhof stand, wo der Direktor beim obligatorischen Fahnenappell das Schuljahr eröffnete. »Landesverräter!«, rumorte es in meinem Schädel, als unsere Lehrerin in der ersten Stunde die Schulbücher verteilte und den Stundenplan an die Tafel schrieb. Eine quälend lange Stunde.
In der Pause suchte ich meinen jüngsten Bruder, der auch in meine Schule ging. Ich fand ihn im Zeichensaal, wo er mit seinen Freunden in der Ecke stand und die Ferien auswertete. Als er mich sah, verdrehte er die Augen: »Was willst du denn hier?« Ich zog ihn zur Seite und erzählte ihm, was Uwe gesagt hatte.
»Ja, es stimmt. Er ist im Gefängnis. Aber er ist kein Verräter. Das klärt sich alles auf. Und jetzt hau ab in deine Klasse.«
Ich war erleichtert. Der Verräter war weg. Es würde sich aufklären. Ich ging zurück. Als ich nach Hause kam, fragte ich meine Mutter.
»Dein Bruder hat einen schlimmen Fehler gemacht«, sagte sie. »Er hat Flugblätter verteilt und unser Land kritisiert. Das ist verboten.« Ich verstand gar nichts.
»Ist er ein Verbrecher?«
»Nein, aber was er getan hat, ist gegen das Gesetz. Deshalb ist er jetzt im Gefängnis.«
Mein Vater kam mit düsterer Miene von der Arbeit nach Hause, und ich wagte nicht, ihn anzusprechen.
Es war 1968. Die Welt war aus den Fugen. Die Söhne rebellierten gegen ihre Väter. Auch in dem Teil der Welt, wo es einmal die Vision vom schönen weiten blauen Himmel mit der aufgehenden Sonne gegeben hatte. Hier war der Blick der Väter starr geworden. Sie hatten ihre Träume mit der Zeit gegen Parteiprogramme eingetauscht. Sie hatten aufgehört, ihrem eigenen Volk zu trauen und die Türen und Fenster vernagelt. Die Luft war mit der Zeit immer dicker und muffiger geworden.
Im Land nebenan passierte etwas. Dort machten sie plötzlich die Fenster auf und ließen frische Luft herein. Doch die Männer, die ihre Träume vergessen hatten, wollten das nicht dulden und schickten Panzer in das Land. Die Fenster wurden wieder verriegelt. Aus der Traum. Vorbei.
Mein ältester Bruder fand das schlimm, traf sich mit seinen Freunden und schrieb Flugblätter: »Hände weg vom Roten Prag.« Sie hatten nichts gegen den Sozialismus. Sie wollten ihn, aber nicht so.
Nachts verteilten sie die Flugblätter in Berlin und verabredeten, sich gegenseitig nicht zu verraten, wenn einer von ihnen verhaftet würde. Sie trennten sich und warteten auf das Unvermeidliche. Einige von ihnen wurden noch in dieser Nacht festgenommen. Mein Bruder versteckte sich, wartete, ging zwei Tage später nach Hause und erzählte meinem Vater, was geschehen war. Doch der wusste schon Bescheid.
»Du musst dich stellen.«
»Ich weiß, aber das kann ich nicht.«
»Warum nicht?«
»Weil du es bist, der mir das sagt.«
»Dann muss ich dich anzeigen.«
Mein Bruder wurde verhaftet und wegen »staatsfeindlicher Hetze« zu zwei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Dort schrieb er in sein Tagebuch: »In der Einzelhaft muss man sechzehn Stunden am Tag nachdenken, wenn man keine Bücher hat und wenig Gedichte und Lieder auswendig kennt. Man muss nachdenken. Zuerst habe ich über Leute nachgedacht, aber das reichte nur für zwei Tage. Dann habe ich über den Grund nachgedacht, für den ich im Gefängnis war. Märtyrer, Kämpfer, Beleidigter – diese Rollen haben für zwei Tage Denkstoff gegeben. Dann musste ich über mich nachdenken, ich konnte nichts anderes tun auf dem Hocker. Und ich habe gemerkt, dass ich es zum ersten Mal tue.«
Mein Vater ging ihn nicht besuchen, meine Mutter tat es heimlich. Nach zweieinhalb Monaten ließ man meinen Bruder auf Bewährung frei und schickte ihn als Fräser in eine Fabrik. Vorher hatte man ihn schon von der Schule geworfen, an der er Film studierte.
Auch mein Vater musste Buße tun für seinen missratenen Sohn. Seine Partei schubste ihn von der Karriereleiter und schickte ihn für ein Jahr auf eine Schule nach Moskau, wo er gefälligst noch einmal die Grundlagen des Marxismus-Leninismus studieren und aus seinen Fehlern lernen sollte. Aus dem stellvertretenden Kulturminister wurde über Nacht ein ungezogener Schüler, den man nachsitzen ließ. Er schrieb uns lange Briefe und erzählte von der Weite des Himmels und der Herzlichkeit der Menschen. Doch seine Sprache war hölzern.
Mein Vater fehlte mir nicht. Ich genoss die Wochenenden ohne Streit und Türenknallen. Mein ältester Bruder kam wieder öfter nach Hause und brachte seine neue Freundin mit. Mit ihr hatte er die Flugblätter verteilt, und auch sie hatte im Gefängnis gesessen. Sie ging mit mir spazieren und erzählte mir Witze wie einem Erwachsenen, dafür liebte ich sie.
Meine Mutter schien die Abwesenheit meines Vaters zu genießen. Manchmal ging sie abends weg und kam erst spät in der Nacht wieder. Sie räumte das Wohnzimmer um, kaufte neue Gardinen und hielt sich noch seltener als sonst in dem Raum der Wohnung auf, den sie ohnehin am meisten hasste: der Küche. Stattdessen ging sie mit meinem jüngsten Bruder und mir ins Restaurant, und wir konnten uns bestellen, was wir wollten.
Alle zwei Monate kam mein Vater für ein Wochenende nach Hause und brachte uns russisches Konfekt mit. Auch wenn er mir nicht gefehlt hatte, freute ich mich, wenn er kam. Allerdings fürchtete ich auch immer den Tag seiner Ankunft. Mein Vater war alles andere als begeistert vom neuen Aktionismus und der Großzügigkeit meiner Mutter, und es gab Krach. Doch meine Eltern waren klug genug, den Ärger nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Mein Vater gab sich nachsichtig, meine Mutter einsichtig – nach einer Stunde hatten sich die Wolken verzogen, meine Mutter band sich die Schürze um und ging in die Küche.
Mein Vater nutzte diese Wochenenden, um viel Zeit mit meinem jüngsten Bruder und mir zu verbringen. Zu viel Zeit, und einmal sogar die falsche Zeit am falschen Ort, nämlich auf dem Spielplatz vor unserem Haus.
Mein jüngster Bruder war zwölf und besetzte mit seinen Kumpels an den Wochenenden immer die Klettergiraffe, die dadurch zur gesperrten Zone für alle anderen Kinder wurde. So auch an diesem verhängnisvollen Nachmittag. Neben der Klettergiraffe gab es ein Reck, an dem meine Freundinnen und ich herumturnten, als mein Vater angeschlendert kam. Er rauchte und sah uns eine Weile zu. »Das haben wir früher auch gemacht«, sagte er. »Ich will doch mal sehen, ob ich das noch kann.«
Mein Vater war sechsundvierzig Jahre alt und wog etwa fünfundachtzig Kilo, was für seine eher durchschnittliche Körpergröße eindeutig zu viel war. Meine Eltern hatten sich mit dem zunehmend behäbiger werdenden Sozialismus einen gewissen Wohlstandsspeck zugelegt. Er trat seine Zigarette aus, spuckte in die Hände, hängte sich an die Stange und begann, Schwung zu holen. Das jedoch erwies sich als schwieriger, als er erwartet hatte. Begleitet von einem schweren Keuchen, gelang es ihm irgendwann, seine Beine über die Stange zu werfen. Das Gelächter und die Gespräche auf dem Spielplatz waren inzwischen verstummt. Alle Kinder starrten herüber zu meinem dicken, jetzt kopfüber am Reck hängenden Vater. Ich hatte Angst und schaute hilfesuchend zu meinem Bruder, der gelangweilt die Schultern hob.
»Ich konnte sogar mal einen richtigen Abgang«, presste mein Vater mit rotem Kopf hervor und fing wieder bedenklich an zu schwingen. Ich hatte Angst. Ich weiß nicht, wovor ich mich mehr fürchtete: dass meinem Vater etwas zustoßen könnte oder dass er sich zum Gespött der Kinder auf dem Spielplatz machte. Wenige Sekunden später spielte das keine Rolle mehr. Er hatte sehr viel Schwung geholt, und mit einem tiefen Gottvertrauen, das nur jemand wie er haben konnte, löste er sich von der Stange. Doch die Gesetze der Physik ließen sich mit Gottvertrauen nicht außer Kraft setzen. Der schwere Körper schaffte die 180-Grad-Drehung in der Luft nicht, und mein Vater landete auf dem Rücken im Sand.
Die Jungen auf der Giraffe prusteten hinter vorgehaltenen Händen, nur das Gesicht meines Bruders war leichenblass geworden, und sein Mund stand offen. Mein Vater lag auf dem Rücken und rang nach Luft. Ich fing an zu weinen. Ich weinte aus Angst und Scham. Ich wollte zu ihm laufen, doch ich war wie gelähmt. Stöhnend und mit schmerzverzerrtem Gesicht rappelte er sich irgendwann auf, rieb sich den Sand von der Hose und schleppte sich schweigend davon. Ein Bild des Jammers. Demütigend und mitleiderregend zugleich.
Mein Vater thematisierte diesen Vorfall nicht mehr, und mein Bruder kommentierte ihn am Abend im Bett nur mit den Worten: »Der Alte ist ein Idiot!«
Fast ein Jahr nachdem mein Vater zweimal so unfreiwillig den freien Fall erlebt hatte, wurde er erneut von einem seiner Söhne enttäuscht. Diesmal war es mein mittlerer Bruder, sein zweitgeborener Sohn.
Er wäre nach der Geburt beinahe gestorben, so winzig klein und schwach war er. Seine Augen lagen so blank und groß in ihren Höhlen, dass sie fast herausgefallen wären. Dieser Bruder war unser aller Lieblingsbruder. Er war lustig und konnte auf den Händen gehen.
Wenn wir im Sommer an der Ostsee waren, wo Leute aus allen Ecken des Landes Urlaub machten, brauchte er keine fünf Minuten, um ihren Dialekt zu imitieren. Waren wir am Strand, lief er den Mädchen hinterher, als sei er ihr Schatten. Er ahmte ihren Gang und ihre Bewegungen nach und brachte sie und uns zum Lachen. Leute zum Lachen bringen – das war sein großes Talent, und das wollte er machen, wenn er erwachsen war. Doch vorher schickten meine Eltern ihn auf ein Internat. Sechs Jahre lang. Für meinen Vater, der selbst fast immer in Internaten und Heimen gelebt hatte, war das völlig selbstverständlich. Meine Mutter widersprach nicht. Das tat sie ohnehin immer seltener.
»Ich hab keine Lust mehr«, sagte mein mittlerer Bruder irgendwann, ging ohne Abitur von der Schule ab und verließ das Internat. Als er nach Hause kam, hielt ihm mein Vater einen langen Vortrag darüber, dass es im Kommunismus nicht darum gehe, ob jemand gerade Lust habe oder nicht. Es gehe um Verantwortung und Opferbereitschaft. Und er solle in sein Zimmer gehen und darüber nachdenken. Mein Bruder ging aber nicht in sein Zimmer, sondern kam in unseres und spielte für meinen kleinen Bruder und mich die Szene nach. Die Hände auf dem Rücken verschränkt, lief er mit gesenktem Blick hin und her und sprach in jenem leisen und bedrohlichen Ton, den wir von unserem Vater nur zu gut kannten und den wir fürchteten. Wir verstanden zwar nicht, worum es ging, aber wir lachten uns kaputt.
»Ich habe keine Lust mehr«, sagte mein mittlerer Bruder nach einem Monat bei der Armee und führte die Befehle nicht mehr aus. Man brachte ihn vor den Militärstaatsanwalt und verhörte ihn. »Ich habe einfach keine Lust mehr. Es gibt mir nichts«, sagte er. Man verurteilte ihn zu anderthalb Jahren auf Bewährung und versetzte ihn dafür zu den Bausoldaten in eine berüchtigte Kaserne, in der alle Soldaten landeten, die keine Lust mehr hatten.
Er schrieb seinem großen Bruder lange Briefe. Darin erzählte er ihm von seinem Wunsch, Schauspieler zu werden. Er schwärmte von Jean-Paul Belmondo, der im Film »Außer Atem« von einem hübschen amerikanischen Zeitungsmädchen verraten wird. Er schrieb von der süßen kleinen Protokollantin des Untersuchungsrichters, in die er sich verknallt hatte. Und er philosophierte darüber, dass man sich ständig ändern und überwinden müsse, damit das Leben nicht ende wie eine sich abkühlende Tasse Kaffee. »Sich freihändig zu bewegen ist nicht einfach, das sehe ich an Dir«, schrieb er. »Aber es ist das Schönste im ganzen Leben. Deswegen habe ich Dich lieb wie keinen anderen Menschen. Du bist für mich irgendwie ein roter Punkt in diesem scheiß Irrgarten.«