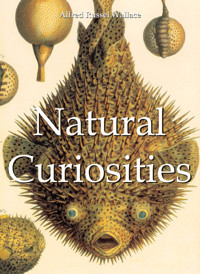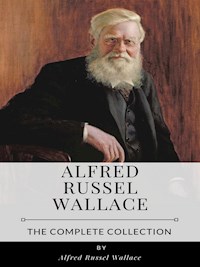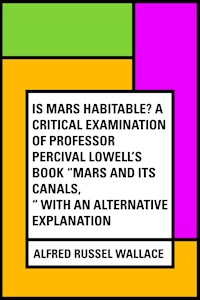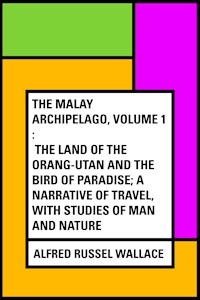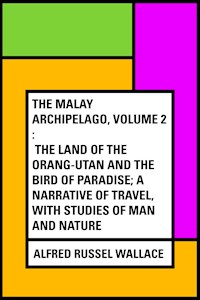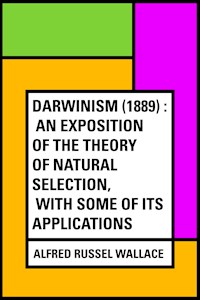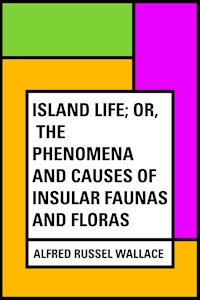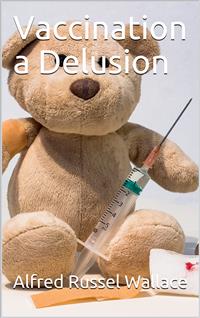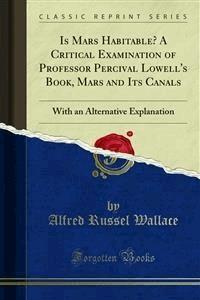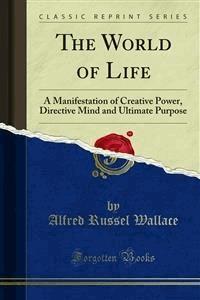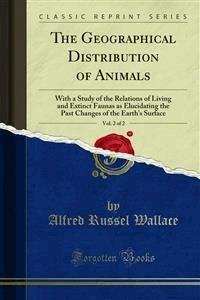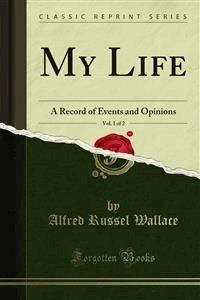21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Sammler des verlorenen Schatzes. Ein waghalsiger Forscher begibt sich auf eine der abenteuerlichsten Expeditionen, die es je gab: Alfred Russel Wallace und seine Forschungsreise ins Amazonasgebiet. Auf eigene Faust bricht der Naturenthusiast Alfred Russel Wallace im Jahr 1848 von England nach Brasilien auf, um die Tier- und Pf lanzenwelt am Amazonas zu erforschen. Wallace schlägt sich von Pará (heute Belém) aus zu den Oberläufen des Rio Negro durch – und gelangt dabei in Gegenden, die noch kein Europäer vor ihm betreten hatte. Die Beobachtung der Affen- und Schmetterlingsarten an beiden Flussufern bringt ihn erstmals auf die Spur der Evolutionstheorie, die er später zeitgleich mit Charles Darwin entwickeln wird. Die Erträge seiner Expedition sind großartig, das Unternehmen endet jedoch in einer Katastrophe: Von Krankheiten, Sandf löhen (die ihre Eier unter seine Zehennägel legen) und den ewigen Kriebelmücken geplagt, ist Wallace am Ende so ausgezehrt, dass er nur mit der Hilfe der Einheimischen überlebt. Die aber trinken den Alkohol, mit dem eigentlich die Fundstücke konserviert werden sollten; und Horden von Ameisen machen sich über die Sammlung her. Auf dem Rückweg setzt Wallace alles auf eine Karte: Er selbst, seine Aufzeichnungen und Zigtausende Sammlungsstücke treten auf dem Zweimaster Helen die Heimreise an. Auf hoher See bricht an Bord ein Feuer aus. Die Besatzung kann sich auf Beiboote retten. Doch für Wallace' Sammlung, auch für die lebenden Affen und Vögel, die in England an Zoos und Sammler verkauft werden sollten, gibt es keine Rettung. Nur einen einzigen Papagei kann Wallace lebend aus dem Wasser fischen. Der gesamte Ertrag seiner Reise versinkt in den Fluten des Ozeans. Zurück in England, rekonstruiert Wallace seine Erlebnisse anhand von wenigen Notizen und Erinnerungen. Seinen Reisebericht, sowohl Abenteuerroman, Forschungsgeschichte und frühes Zeugnis der Suche nach dem Ursprung der Arten, gab es auf Deutsch nur 1855 in einer stark verstümmelten Fassung – nun, nach über 150 Jahren, wird er endlich für die deutschsprachige Leserschaft erschlossen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 912
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Alfred Russel Wallace
Abenteuer am Amazonas und am Rio Negro
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Alfred Russel Wallace
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Alfred Russel Wallace
Alfred Russel Wallace (1832–1913) war einer der einflussreichsten Naturwissenschaftler seiner Zeit. Er entwickelte zeitgleich mit Darwin die Theorie von der Entstehung der Arten und begründete die Biogeografie. Nach ihm sind Mond- und Marskrater, Flugfrösche und ganze geografische Regionen benannt.
Matthias Glaubrecht arbeitet als Evolutionsbiologe am Museum für Naturkunde in Berlin. Neben zahlreichen Artikeln für Zeitungen und Zeitschriften (Die Welt, Geo) und Beratungen bei Filmen über Naturforscher veröffentlichte er mehrere Bücher, zuletzt Am Ende des Archipels. Alfred Russel Wallace bei Galiani.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Auf eigene Faust bricht der Naturenthusiast Alfred Russel Wallace im Jahr 1848 von England nach Brasilien auf, um die Tier- und Pflanzenwelt am Amazonas zu erforschen. Wallace schlägt sich von Pará (heute Belém) aus zu den Oberläufen des Rio Negro durch – und gelangt dabei in Gegenden, die noch kein Europäer vor ihm betreten hatte. Die Beobachtung der Affen- und Schmetterlingsarten an beiden Flussufern bringt ihn erstmals auf die Spur der Evolutionstheorie, die er später zeitgleich mit Charles Darwin entwickeln wird. Die Erträge seiner Expedition sind großartig, das Unternehmen endet jedoch in einer Katastrophe: Von Krankheiten, Sandflöhen (die ihre Eier unter seine Zehennägel legen), Vampirfledermäusen und den ewigen Kriebelmücken geplagt, ist Wallace am Ende so ausgezehrt, dass er nur mit der Hilfe der Einheimischen überlebt. Die aber trinken den Alkohol, mit dem eigentlich die Fundstücke konserviert werden sollten; und Horden von Ameisen machen sich über die Sammlung her. Auf dem Rückweg setzt Wallace alles auf eine Karte: Er selbst, seine Aufzeichnungen und Zigtausende Sammlungsstücke treten auf dem Zweimaster Helen die Heimreise an. Auf hoher See bricht an Bord ein Feuer aus. Die Besatzung kann sich auf Beiboote retten. Doch für Wallace’ Sammlung, auch für die lebenden Affen und Vögel, die in England an Zoos und Sammler verkauft werden sollten, gibt es keine Rettung. Nur einen einzigen Papagei kann Wallace lebend aus dem Wasser fischen. Der gesamte Ertrag seiner Reise versinkt in den Fluten des Ozeans.
Zurück in England, rekonstruiert Wallace seine Erlebnisse anhand von wenigen Notizen und Erinnerungen. Seinen Reisebericht, sowohl Abenteuerroman, Forschungsgeschichte und frühes Zeugnis der Suche nach dem Ursprung der Arten, gab es auf Deutsch nur 1855 in einer stark verstümmelten und fehlerhaften Fassung – nun, nach über 150 Jahren, wird er endlich, mustergültig herausgegeben von Matthias Glaubrecht und erstmals mit eigenhändigen Zeichnungen, die Wallace aus dem brennenden Schiff retteten konnte, verziert, für die deutschsprachige Leserschaft erschlossen!
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Titel der Originalausgabe: A Narrative of Travels on the Amazon and Rio Negro
All rights reserved
Aus dem Englischen von Anonymus und Michael Schickenberg
Verlag Galiani Berlin
© 2014, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Manja Hellpap und Lisa Neuhalfen, Berlin
Lektorat: Wolfgang Hörner
Karte: A. R. Wallace
ISBN978-3-462-30807-5
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Karten
Vorwort
Abenteuer am Amazonas und am Rio Negro
Inhaltsverzeichnis
Porträt von Alfred Russel Wallace
Vorwort
Kapitel I. Pará.
Kapitel II. Pará.
Kapitel III. Der Tocantíns.
Kapitel IV. Mexiana und Marajó.
Kapitel V. Der Guamá- und der Capim-Fluss.
Kapitel VI. Santarem und Montealegre.
Kapitel VII. Barra do Rio Negro und der Solimões.
Kapitel VIII. Der obere Rio Negro.
Kapitel IX. Javíta.
Kapitel X. Erste Fahrt den Fluss Uaupés aufwärts.
Kapitel XI. Am Rio Negro.
Kapitel XII. Die Katarakte des Uaupés.
Kapitel XIII. Von São Jeronymo nach den Downs.
Kapitel XIV. Physische Geographie und Geologie des Amazonas-Tales.
Geologie.
Klima.
Kapitel XV. Vegetation des Amazonas-Tales.
Kapitel XVI. Betrachtungen zum Tierreich des Amazonasgebietes.
A. Mammalia.
B. Vögel.
C. Reptilien und Fische.
D. Insekten.
E. Geographische Verbreitung der Tiere.
Kapitel XVII. Die Eingeborenen des Amazonas.
Von Indianern am Rio dos Uaupés verfertigte Artikel.
Anhang Vokabularien amazonischer Sprachen.
Anmerkungen zu den Vokabularien
Vokabular
Anhang
Am Anfang war der Amazonas
Die Entdeckung Brasiliens und des »Flusses der Amazonen«
Die Vermessung der Neuen Welt
Humboldts Irrtum vom Reichtum tropischer Regenwälder
Wallace’ Expedition am Amazonas und Rio Negro, 1848–1852
Wallace’ Palmen-Buch
»Dem fernen Land, wo ewiger Sommer thront« – Wallace’ Amazonas-Reisebuch
Zur vorliegenden Textausgabe
Glossar und Maßangaben
Zu den Illustrationen der vorliegenden Ausgabe
Danksagung
Zitierte Literatur
Zeitleiste zur Entdeckung und Erkundung Brasiliens und Amazoniens bis 1859
Glossar
Allgemeine, umgangssprachliche Begriffe
Botanik
Zoologie
Vorwort
Humboldt war nie am Amazonas
Es begann mit einer Flucht über den Atlantik – und endete mit der Europäisierung und schließlich Unabhängigkeit der größten Kolonie der Welt. So paradox die Geschichte Brasiliens verlief, so günstig war eines ihrer letzten Kapitel dann doch für die naturkundliche Durchdringung dieses so reichen Landes. Denn am Beginn des 19. Jahrhunderts, als der gesamte portugiesische Hof vor der französischen Invasion unter Napoleon von Lissabon nach Rio de Janeiro floh, war das Land am Amazonas noch weitgehend unerforscht und unerschlossen, wurde es doch drei Jahrhunderte lang von der Kolonialmacht gegenüber der Welt abgeschottet.
Daran scheiterte auch der gemeinhin als zweiter Entdecker Südamerikas gerühmte Alexander von Humboldt. Er hat während seiner Südamerika-Reise von 1799 bis 1804 die heutigen Länder Venezuela, Kolumbien, Ecuador und Peru bereist; aber er hat nie einen Fuß auf brasilianischen Boden setzen können, ja er wäre sogar per Haftbefehl daran gehindert worden. Tatsächlich kam Humboldt nicht bis zum Amazonas. Nachdem der preußische Gelehrte, ausgestattet mit einem Reisebrief der spanischen Krone, gemeinsam mit dem französischen Botaniker Aimé Bonpland im heutigen Venezuela dem Orinoco stromaufwärts gefolgt war, hatte er mit dem Casiquiare dessen Zufluss und zugleich die Verbindung mit dem Rio Negro erkundet. Er war damit an einen der südlich abfließenden Oberläufe des mächtigen Amazonas gelangt. Humboldt fand das Gebiet dieser Wasserscheide zwischen Orinoco und Amazonas, im Grenzgebiet zwischen dem spanischen Venezuela und dem portugiesischen Brasilien, sumpfig und äußerst undurchdringlich, zudem verseucht mit Moskitos. »Mehr Mücken als Luft«, notierte er und kehrte um, ohne dem Lauf des Rio Negro nach Süden zu folgen.
Ein halbes Jahrhundert nach Humboldt macht sich ein angelsächsischer Autodidakt in Sachen Naturforschung, der britische Landvermesser, Käfersammler und Naturenthusiast Alfred Russel Wallace, gemeinsam mit seinem Freund Henry Walter Bates auf, den Amazonas zu erkunden – den mächtigsten Strom der Erde, der sich über 6400 Kilometer bis in die Anden erstreckt, mit einem Einzugsgebiet, das doppelt so groß ist wie der indische Subkontinent. Wallace dringt während seiner vierjährigen Expedition von 1848 bis 1852 an den Oberläufen des Amazonas, dem Rio Negro und dann vor allem dem Rio Uáupes weiter in bis dahin unbekannte Regionen vor als jeder andere Europäer vor ihm.
Warum ausgerechnet Amazonien? Zum einen sei es leicht, schreibt Wallace eingangs in seinem hier nun erstmals vollständig auf Deutsch vorliegenden Reisebericht, in diese Region der Welt zu gelangen; zum anderen sei diese Region eben im Vergleich zu anderen Teilen Südamerikas noch kaum bekannt. Wallace hatte natürlich nicht nur den Bericht Alexander von Humboldts über dessen Reisen in den Tropen des neuen Kontinents gelesen. Nach eigenem Bekunden wurde er durch das kleine Reisebuch eines »Mr. Edwards« – gemeint ist der Amerikaner William Henry Edwards – angeregt, an den Amazonas zu reisen. In dem 1847 erschienenen Reisebericht Voyage Up the River Amazon hatte Edwards einmal mehr beschrieben, wie reich und vielfältig der tropische Regenwald ist, wie freundlich die Menschen dort sind. Die Lektüre gibt dem lange gehegten Wunsch des damals vierundzwanzigjährigen Wallace’ zu einer Tropenreise das konkrete Ziel – den brasilianischen Regenwald.
Zu diesem Zeitpunkt gibt es – wenigstens in unserer retrospektiven Wahrnehmung der damaligen Kenntnis in Europa – gleich zwei Brasilien: Zum einen die weitgehend unberührten und unerforschten Regionen ungeheuren Ausmaßes zu beiden Seiten des Amazonas, die bis zu Wallace’ Reise nur einige wenige Abenteuerlustige und kaum einmal Naturforscher erreicht und bereist haben. Zum anderen ist da jenes Brasilien, dessen Bild vor allem in Deutschland dank gleich mehrerer Darstellungen von Reisenden geprägt wurde, die bis dahin insbesondere die ausgedehnten Küstenregionen und Wälder im Osten Brasiliens erkundet haben. Doch weder Humboldts Reise noch der reich illustrierte Bericht des Maximilian Prinz zu Wied-Neuwied, selbst nicht die wohl bedeutendste Reiseschilderung von Johann Baptist Ritter von Spix und Carl Friedrich Philipp von Martius haben das Fenster zum eigentlichen Amazonasbecken aufgestoßen. Hier betreten Wallace und Bates, als sie Ende Mai 1848 im Mündungsgebiet des Amazonas bei Pará – dem heutigen Belém – ankommen, eine tatsächlich noch weitgehend unerforschte Region.
Und hier beginnt Wallace eine Reise, die zugleich zum lange übersehenen Beginn der Evolutionsforschung und Biogeographie wird. Anders als Charles Darwin, der bei seiner Weltumsegelung auf dem Vermessungsschiff Beagle zwischen 1832 und 1836 eher zufällig auf Beobachtungen und Fakten zur Veränderlichkeit der Arten aufmerksam wird, kommt Alfred Russel Wallace mit einem regelrechten Forschungsprogramm an den Amazonas. Wallace sucht nach jenem »anderen Prinzip …, das für die unendliche Vielfalt des Tierlebens verantwortlich ist« – nach Belegen dafür, dass sich Arten in einem natürlichen Prozess verändern und wandeln, dass sie miteinander in genealogischer Verbindung stehen und dass sie eben nicht jeweils unabhängige Schöpfungen sind, wie seine Zeitgenossen damals überwiegend noch annehmen.
Am Anfang also war der Amazonas. Wallace’ vierjährige Expedition in Südamerika prägt seine kurz darauf unabhängig von Darwin entwickelten Überlegungen zur Evolution durch natürliche Auslese. Zwar endet sein Amazonas-Abenteuer mit einer Katastrophe – Wallace verliert während der Rückreise auf dem Atlantik durch den Untergang seines Schiffes den Großteil seiner Naturaliensammlung und Aufzeichnungen –, doch bereits am Amazonas wird Wallace vom Naturaliensammler zum Naturforscher. Seine Erkundungen vor allem an den Oberläufen des Rio Negro werden zur entscheidenden Weichenstellung für seinen späteren Werdegang als Mitentdecker der Evolutionstheorie und Begründer der Biogeographie.
Bisher lagen diese Anfänge im Dunkeln der Biologiegeschichte. Wallace’ Reisebericht wurde 1853 als A Narrative of Travels on the Amazon and Rio Negro in London veröffentlicht; er erschien bereits zwei Jahre später unter dem Titel Reisen am Amazonenstrom und Rio Negro auch auf Deutsch, wenngleich bizarr verstümmelt und verkürzt, nicht nur um einige seiner naturkundlich interessanten Abschnitte und Kapitel. Mit der hier jetzt erstmals vollständig auf Deutsch vorliegenden Reiseschilderung über die Quellregionen des Amazonas – illustriert durch Zeichnungen und Skizzen von Wallace’ eigener Hand, die der Forscher beim Schiffsuntergang retten konnte und die der englischen Originalausgabe ursprünglich nicht mitgegeben wurden – folgen wir Wallace gleichsam bis zum Ursprung seiner Erkenntnisse zur Entstehung und Entwicklung der Arten. Die Amazonas-Reise veränderte Wallace’ Leben – und letztlich damit auch die Wissenschaft der Naturkunde.
Matthias Glaubrecht, Berlin im Januar 2014
Abenteuer am Amazonas und am Rio Negro
Alfred Russel Wallace
Abenteuer am Amazonas und am Rio Negro
Ankunft in Pará – Äußeres Ansehen der Stadt und ihrer Umgebung – Die Einwohner und ihre Tracht – Vegetation – Sinnpflanzen – Eidechsen – Ameisen und andere Insekten – Vögel – Klima – Nahrung der Einwohner
Feste – Portugiesische und brasilianische Währung – M. Borlaz’ Wohnsitz – Ausflug zu den Reismühlen – Der Urwald, seine Pflanzen und Insekten – Milchbaum – Säge- und Reismühle – Caripé oder Topffruchtbaum – Kautschukbaum – Blumen und Bäume in Blüte – Saüba-Ameisen, Wespen und Sandflöhe – Reise zu Wasser nach Magoary – Die Affen – Der Kommandant von Laranjeiras – Vampirfledermäuse – Der Holzhandel – Boa constrictor und Faultier
Ausrüstung zu unserer Reise – Mojú-Fluss – Igaripé Mirí – Cametá – Senhor Gomez und seine Ansiedlung – Suche nach einem Mittagsmahl – Jambouassú – Ein höflicher Brief – Baião und seine Einwohner – Ein Wespenschwarm – Beginn der felsigen Landschaft – Der Mutuca – Schwierige Beschaffung von Männern – Ein Dorf ohne Häuser – Fang eines Alligators – Entenjagd – Aroyas und die Wasserfälle – Nachtkonzert – Blaue Macaos – Schildkröteneier – Ein kleiner Unfall – Fruchtbarkeit des Landes – Rückkehr nach Pará
Besuch in Olería – Gewohnheiten der Vögel – Reise nach Mexiana – Ankunft – Vögel – Beschreibung der Insel – Bevölkerung – Die Sklaven, ihre Behandlung und Gewohnheiten – Ausflug zum See – Herrlicher Strom – Fische und Vögel am See – Alligatoren fangen – Sonderbare Töne und reichliches Tierleben – Ausflug zurück zu Fuß – Jaguarfleisch – Besuch von Jungcal in Marajó – Verladen des Viehs – Ilha das Frechas
Natterers Jäger Luiz – Vögel und Insekten – Vorbereitung zu einer Reise – Erster Anblick vom Piroróco – São Domingo – Senhor Calistro – Sklaven und Sklavenhaltung – Anekdote – Zuckerrohrfeld – Tagereise in den Wald – Wild – Erklärung des Piroróco – Rückkehr nach Pará – Glockenvögel und gelbe Papageien
Abfahrt von Pará – Einfahrt in den Amazonas – Merkmale des Flusses – Ankunft in Santarem – Die Stadt und ihre Bewohner – Reise nach Montealegre – Moskitoplage und Linderung – Tagereise nach den Serras – Eine Viehzucht – Felsen, Bilderschrift und Höhle – Die Victoria regia – Maniok-Felder – Eine Festa – Rückkehr nach Santarem – Schöne Insekten – Sonderbares Flut-Phänomen – Abfahrt von Santarem – Obydos – Villa Nova – Ein freundlicher Priester – Serpa – Weihnachten am Amazonas
Anblick des Rio Negro – Die Stadt Barra, ihr Handel und Einwohner – Tagereise auf dem Rio Negro – Die Lingoa Geral – Der Schirmvogel – Lebensweise der Indianer – Rückkehr nach Barra – Die Fremden in der Stadt – Besuch des Solimões – Der Gapó – Manaquerey – Landleben – Tollenköpfiger Araçari – Geier und Unzen – Tabak-Pflanzung und Manufaktur – Die Seekuh – Senhor Brandão – Eine Fischpartie mit Senhor Henrique – Briefe aus England
Abfahrt von Barra zum oberen Rio Negro – Boot und Fracht – Große Breite des Flusses – Carvoeiro und Barcellos – Granitfelsen – Castanheiro – Ein höflicher alter Herr – São Jozé – Eine neue Sprache – Die Wasserfälle – São Gabriel – Nossa Senhora da Guía – Senhor Lima und seine Familie – Ausflug nach dem Fluss Cobáti – Ein indianisches Dorf – Die Serra – Felsenhähne – Rückkehr nach Guía – Frei Jozé dos Santos Innocentos
Abreise von Guía – Marabitánas – Serra de Cocoí – Venezuela – São Carlos – Der Cassiquiare – Antonio Dias – Indianische Schiffsbauer – Federarbeit – Maróa und Pimichín – Ein schwarzer Jaguar – Giftige Schlangen – Fischen – Marsch nach Javíta – Aufenthalt dort – Indianische Wegearbeiten – Sprache und Sitten – Beschreibung Javítas – Geflüchtete Indianer – Sammlungen in Javíta – Rückkehr nach Tómo – Eine häusliche Szene – Marabitánas und seine Einwohner – Rückkehr und Ankunft in Guía
Reißende Strömung – Eine indianische Maloca – Die Bewohner derselben – Eine Festlichkeit – Bemalen und Schmuck dieser Indianer – Krankheit –São Jeronymo – Die Katarakte – Jauarité – Der Tuschaúa Calistro – Eine eigentümliche Palmart – Vögel – Wohlfeiler Proviant – Essbare Ameisen und Würmer – Ein großes Tanzfest – Federschmuck – Der Schlangentanz – Der Capí – Eine Staats-Zigarre – Ananárapicóma – Fische – Chegoes – Rückreise über die Wasserfälle stromabwärts – Zahme Vögel – Orchideen – Piums – Erdessen – Vergiftung – Rückkehr nach Guía – Manoel Joaquim – Verdruss über Verzögerungen
Schwierigkeiten, um fortzukommen – Fahrt die Wasserfälle hinab – Fang eines Alligators – Zahme Papageien – Vierzehn Tage in Barra – Frei Jozés Diplomatie – Haltbarmachung einer Seekuh – Ein Sturm auf dem Fluss – Brasilianische Wahrheitsliebe – Wanawáca – Reichtum des Landes – Eine große Schlange – São Gabriel – São Joaquim – Wechselfieber
Aufbruch zum Uaupés – São Jeronymo und Jauarité – Fortlaufen der Indianer – Zahlreiche Katarakte – Ankunft in Carurú – Schwierige Fahrt – Bemalte Maloca – Teufels-Musik – Weitere Wasserfälle –Ocokí – Merkwürdige Felsen – Ankunft in Uarucapurí – Cobeu-Indianer – Ankunft in Mucúra – Haus und Familie eines Indianers – Höhe über dem Niveau des Meeres – Tenente Jesuino – Rückkehr nach Uarucapurí – Gefangene Indianer – Reise nach Jauarité – Kalenderverbesserung – Aufenthalt in São Jeronymo
Reise den Rio Negro hinunter – Ankunft in Barra – Empfang eines Passes – Zustand der Stadt – Portugiesische und brasilianische Unternehmungen – Kreditsystem – Handel – Immoralität und ihre Ursachen – Abreise von Barra – Ein Sturm auf dem Amazonas – Salsaparilha – Eine Erzählung vom Tod – Pará – Das gelbe Fieber – Fahrt nach England – Das Schiff gerät in Flammen – Zehn Tage in den Booten – Rettung – Heftige Stürme – Mangel an Lebensmitteln – Sturm im Kanal – Ankunft in Deal
Porträt Alfred Russel Wallace, im Alter von dreißig (1853).– Aus: Wallace, »My Life« (1905)
Vorwort
Der ernste Wunsch, ein tropisches Land zu besuchen, das Üppige des Tier- und Pflanzenlebens selbst zu sehen und mich mit eigenen Augen von allen den Wundern, die mich in Reisebeschreibungen stets so interessierten, zu überzeugen, waren die Motive, die mich bewogen, die Bande des häuslichen und Geschäftslebens zu brechen und mich aufzumachen nach »dem fernen Land, wo ewiger Sommer thront«.
Durch ein kleines Buch des Mr. Edwards, »A Voyage up the Amazon«, wurde meine Aufmerksamkeit auf Pará und den Amazonas gelenkt, und ich beschloss dorthin zu gehen, teils wegen der Leichtigkeit, mit der man hingelangen konnte, teils, weil es im Vergleich zu allen andern Teilen Süd-Amerikas so wenig bekannt war.
Meinem Wunsch, die Kosten der Reise mit dem Sammeln von naturgeschichtlichen Exponaten zu begleichen, kam man dankenswerterweise nach; seitdem hat mich die Betrachtung der eigentümlichen und schönen Objekte, denen ich begegnete, und das Studium der mannigfachen Menschen-Völker in ihrer wilden Heimat mit steter Freude und höchstem Interesse erfüllt, sodass ich weiterhin entschlossen bin, in meinem begonnenen Streben nicht nachzulassen, und beabsichtige, die üppige Wildnis und das sprudelnde Leben der Tropen bald erneut aufzusuchen.
In den folgenden Blättern habe ich eine Erzählung von meinen Reisen und den Eindrücken, welche sie zur Zeit auf mich gemacht, gegeben. Der erste und letzte Teil ist mit wenigen Änderungen meinen Tagebüchern entnommen; alle in zwei Jahren gemachten Notizen, mit dem größten Teile meiner Sammlungen und Skizzen, gingen mir bei dem Brande des Schiffes auf meiner Rückreise leider verloren. Aus den Fragmenten meiner geretteten Notizen und Papiere habe ich den dazwischenliegenden Teil verfasst, ebenso wie die schließenden vier Kapitel zur Naturgeschichte des Landes und den indianischen Stämmen, welche, wären meine Materialien erhalten geblieben, ein eigenständiges Werk zur Naturgeschichte des Amazonas ergeben hätten.
Im Anhang sind mehrere Vokabularien der indianischen Sprachen enthalten, versehen mit einigen Anmerkungen, deren Verwendung mir freundlichst von Dr. R.G. Latham gestattet wurde.
Ich gebe mich dabei der Hoffnung hin, dass der große Verlust der Materialien, den ich erlitten, und den jeder Naturforscher und Reisende zu würdigen verstehen wird, in Betracht gezogen werden möge, um die Unregelmäßigkeiten und Unzulänglichkeiten der Erzählung zu erklären, ebenso wie die Spärlichkeit des letzten Teils, welcher einem vierjährigen Aufenthalte in einem so interessanten und wenig bekannten Lande kaum angemessen ist.
London, Oktober 1853
Kapitel I.Pará.
Ankunft in Pará – Äußeres Ansehen der Stadt und ihrer Umgebung – Die Einwohner und ihre Tracht – Vegetation – Sinnpflanzen – Eidechsen – Ameisen und andere Insekten – Vögel – Klima – Nahrung der Einwohner
Es war am Morgen des 26. Mai 1848, dass wir, nach einer kurzen neunundzwanzigtägigen Reise von Liverpool, dem südlichen Ausflusse des Amazonas gegenüber vor Anker gingen, und zum ersten Male Süd-Amerika ansichtig wurden. Nachmittags nahmen wir einen Lotsen an Bord und segelten am nächsten Morgen mit günstigem Winde den Strom hinauf, welcher sich auf fünfzig Meilen hin nur durch seine Ruhe und durch seine farblosen Wasser vom Ozean unterscheidet. Die nördliche Küste blieb unsichtbar und die südliche in einer Entfernung von zehn bis zwölf Meilen. Am 28. früh ankerten wir wieder, und als die Sonne am wolkenlosen Himmel erschien, begrüßten wir die Stadt Pará, umgeben von dichten Wäldern und überragt von Palmen und Pisangfeigen, doppelt schön durch die üppigen tropischen Gewächse in ihrer natürlichen Schönheit, die wir so oft in den Treibhäusern von Kew und Chatsworth bewundert hatten. Die Boote, die mit ihrer gemischten Bemannung von Schwarzen und Indianern an uns vorüberfuhren, die Geier, die über unsern Köpfen kreisten oder langsam am Ufer einherspazierten, das Gewimmel der Schwalben auf den Türmen und Dächern, alles dies und noch viel mehr diente dazu, unsere Aufmerksamkeit zu fesseln, bis die Zollbeamten an Bord kamen und es uns erlaubt war, an Land zu gehen.
Pará zählt ungefähr fünfzehntausend Einwohner und erstreckt sich über keinen großen Flächenraum; dennoch ist es die größte Stadt an dem größten Flusse der Welt, dem Amazonas, und ist die Hauptstadt einer Provinz, die in ihrer Ausdehnung so groß wie das ganze westliche Europa ist. Es ist die Residenz eines Präsidenten unter dem Kaiser von Brasilien, und eines Bischofs, dessen Bistum sich zweitausend Meilen ins Innere des Landes erstreckt, welches noch mit unzähligen Stämmen unbekehrter Indianer bevölkert ist. Die Provinz Pará ist der nördlichste Teil von Brasilien, und obgleich es der von der Natur am reichsten ausgestattete Teil dieses enormen Reiches ist, so ist es doch der am wenigsten bekannte und bis jetzt von der geringsten kommerziellen Wichtigkeit.
Die Ansicht der Stadt vom Fluss aus, der schönste Anblick, den man haben kann, ist nicht fremdartiger als der von Calais oder Boulogne. Die Häuser sind im Allgemeinen weiß, und verschiedene schöne Kirchen erheben ihre Türme und Dome über ihnen. Die Kraft der Vegetation ist überall vorherrschend. In den Nischen, Spalten und auf den Gesimsen der Gemäuer sieht man Pflanzen, und auf den Mauern und in den Fensterböschungen der Kirchen entsprossen üppige Gewächse und kleine Bäume. Um die Stadt erstreckt sich ununterbrochener Wald, alle kleinen Inseln des Flusses sind bis zur Wasserlinie bewachsen, und viele Sandbänke, die von der Flut überschwemmt werden, sind mit Sträuchern und kleinen Bäumen bedeckt, von denen jetzt nur noch die Wipfel auf der Oberfläche sichtbar waren. Der Anblick der Bäume im Allgemeinen war von denen Europas nicht sehr verschieden, nur da, wo der »federige Palmbaum« seine graziöse Form erhebt; aber unsere Einbildung malte sich geschäftig die wunderbaren Szenen, die wir in den ferneren Teilen zu sehen erwarteten, und wir sehnten uns nach der Zeit, wo es uns vergönnt sein würde, unsere Forschungen zu beginnen.
Wir gingen beim Landen direkt zum Hause des Mr. Miller, des Agenten unseres Schiffes, von welchem wir sehr freundlich empfangen wurden und der uns ersuchte, bei ihm zu bleiben, bis wir uns passend eingerichtet haben würden. Wir wurden hier den meisten englischen und amerikanischen Einwohnern, welche gering an Zahl und alle Geschäftsleute waren, vorgestellt. Während der vier folgenden Tage beschäftigten wir uns damit, die Umgegend der Stadt zu besuchen, präsentierten unsere Pässe, erlangten die Erlaubnis, uns aufhalten zu dürfen, machten uns mit dem Volke und der Vegetation bekannt und bemühten uns, eine für unser Vorhaben passende Wohnung zu finden. Da eine solche aber nicht gleich zu bekommen war, zogen wir nach Mr. Millers »Rosinha« oder Landhaus, welches ungefähr eine halbe Meile vor der Stadt lag und das er so freundlich war, uns zu unserem Gebrauche zu überlassen, bis wir ein passenderes Quartier gefunden haben würden. Betten und Bettstellen sind hier nicht nötig; gewebte baumwollene Hängematten werden im Allgemeinen zum Schlafen gebraucht, die auch der Leichtigkeit wegen, mit der sie transportiert werden können, hier sehr beliebt sind. Diese Hängematten nebst einigen Tischen und Stühlen und unseren Kästen waren alles, was wir an Möbeln hatten und brauchten. Wir mieteten einen alten Schwarzen namens Isidora als Koch und Diener und fingen nun an, eine regelmäßige Wirtschaft zu führen, lernten Portugiesisch und untersuchten die natürlichen Erzeugnisse des Landes.
Meine bisherigen Reisen hatten sich nur auf England und den Kontinent erstreckt, sodass hier für mich alles den Reiz der vollkommensten Neuheit hatte; dennoch fühlte ich mich im Ganzen enttäuscht. Das Wetter war nicht so heiß, das Volk nicht so sonderbar, die Vegetation nicht so auffallend als das glühende Bild, welches mir meine Phantasie heraufbeschworen und worüber ich während der Anstrengungen der Seereise gebrütet hatte. So wird es aber im Allgemeinen und in allem der Fall sein. Eine schöne Szenerie von einem gegebenen Punkt aus gesehen, kann von einem Maler kaum übertrieben werden, und es gibt deren viele, welche alle Ansprüche des erwartungsvollsten Beschauers befriedigen würden; dann ist es die allgemeine Wirkung, die mit einem Mal die Aufmerksamkeit fesselt; die Schönheiten brauchen nicht gesucht zu werden, sie liegen alle vor uns. Mit einem Distrikt oder einer Gegend ist es anders, da sind individuelle Gegenstände von Interesse, welche gesucht, beobachtet und verstanden werden müssen. Der Zauber eines Distrikts erwächst im Verhältnis, wie die verschiedenen Teile hervortreten, und im Verhältnis, wie unsere Erziehung und Gewohnheiten uns befähigen, sie zu bewundern und zu verstehen. Ganz besonders ist dies in tropischen Gegenden der Fall. Einzelne solcher Plätze werden ohne Zweifel als ganz und gar unvergleichlich erscheinen; aber in den meisten Fällen geschieht es nur nach und nach, dass die verschiedenen Sonderbarkeiten, die Tracht des Volks, die fremdartigen Formen der Vegetation und das Neue in der Tierwelt sich uns zeigen werden, um einen bestimmten und zusammenhängenden Eindruck auf uns zu machen. Daher kommt es auch wohl, dass Reisende mit ihren Beschreibungen der Wunder und unbekannten Dinge, die sie in Wochen und Monaten beobachtet haben, durch das Zusammendrängen beim Leser eine falsche Vorstellung hervorbringen und ihm beim Besuch der Gegend so manche Täuschung verursachen. Als ein Beispiel, was ich hiermit meine, will ich nur angeben, dass ich während der ersten Woche unseres Aufenthaltes in Pará, obgleich ich fortwährend im Walde nächst der Stadt umherwanderte, keinen einzigen Kolibri, Papagei oder Affen bemerkte. Und doch gibt es, wie ich nachher gefunden, Kolibris, Papageien und Affen dort im Überflusse, aber man muss sie suchen und eine gewisse Bekanntschaft mit ihren natürlichen Gewohnheiten ist notwendig, um ihre Schlupfwinkel zu entdecken.
Dennoch hat Pará genug, um sich von dem Vorwurf zu reinigen, den ich, wie man glauben möchte, ihm gemacht. Jeder Tag zeigte uns etwas Neues, irgendein neues Wunder, wie wir es nur in der unmittelbaren Nähe des Äquators zu finden hofften. »Eben jetzt bei dem letzten Schimmer der Dämmerung flattert die Vampirfledermaus in meinem Zimmer und zwischen den Balken des Hauses umher (denn hier haben die Zimmer keine Decken) und schwirrt hin und wieder mit einem fast gespensterartigen Geräusch an meinen Ohren vorüber«. Die Stadt selbst ist nach einem sehr ausgedehnten Plan angelegt; viele der Kirchen und öffentlichen Gebäude sind sehr schön, aber Verfall und nachlässige Reparaturen haben ihnen sehr geschadet. Man erblickt zwischen den Häusern hier und da ein Stückchen Garten und wüsten Grund, mit wucherndem Unkraut und einigen Bananen, von halb verfaulten Zäunen umgeben, was für ein europäisches Auge befremdend schlecht aussieht. Die Märkte und öffentlichen Plätze sind teils der Kirchen und schönen Gebäude, welche sie umgeben, teils der verschiedenartigen sie zierenden Palmen wegen, zu welcher sich die Pisangfeige und Banane gesellt, sehr malerisch; dennoch haben sie mehr das Ansehen eines Dorfplatzes als das einer großen Stadt. Fußpfade kreuzen sich in verschiedenen Richtungen durch eine wild verwachsene Vegetation von kräuterartigen Kassien [der Gattung Cassia], staudenartigen Winden der Gattung Convolvulus und der schönen orangenfarbigen Asclepias curassavica, Pflanzen, welche hier den Platz der Schilfe, Ampfer und Nesseln unseres Vaterlandes einnehmen. Die Hauptstraße Rua dos Mercadores (Straße der Kaufleute) enthält die einzigen bedeutenden Kaufläden der Stadt, die in ihrer Front fast ganz offen sind, im Ganzen recht nett und anziehend, wenn auch mit einem etwas gemischten Warenvorrat ausgelegt und dekoriert. Die meisten Häuser sind nur einen Stock hoch, in der Straße findet man hin und wieder etwas Pflaster, doch so wenig, dass nur dadurch der nächste Weg auf rauen unebenen Steinen und in tiefem Sande noch unangenehmer wird. Die anderen Straßen sind sehr schmal und eng und zeigen meist sehr raue Steine, anscheinend die Überreste des ursprünglichen Pflasters, welches nie repariert worden ist, oder tiefe Sandlöcher und Pfützen. Die Häuser sind außerdem unregelmäßig und niedrig und größtenteils aus einem rauen eisenteiligen Sandsteine, der in der Umgegend gefunden und mit Kalk abgeputzt wird, erbaut. Die Fenster haben kein Glas, der untere Teil ist mit einer Jalousie verhangen, welche beiseitegeschoben werden kann und so einen Blick nach jeder Richtung gestattet. Manches dunkle Auge erschien, um uns nachzublicken, wenn wir vorübergingen. Die gelbe und blaue Farbe sieht man häufig angewandt, um die Säulen, Türen und Fensteröffnungen der Häuser und Kirchen zu dekorieren, welche einen pittoresken, aber gesunkenen Stil Architektur nachweisen. Das Gebäude, welches jetzt als Zollhaus und Kaserne benutzt wird, ist sehr schön und von bedeutendem Umfang.
Hinter den Hauptstraßen der Stadt ist eine große Fläche, die von Straßen und Wegen in rechten Winkeln durchschnitten wird. Auf den Plätzen, die durch diese Wege geformt werden, stehen die Rosinhas oder Landhäuser, eins, zwei oder mehrere auf jedem Platz, sie sind einstöckig mit verschiedenen geräumigen Zimmern und einer großen Veranda, welche gewöhnlich als Speisezimmer benutzt wird und sich auch bestens zum Aufenthalte und Arbeiten eignet. Der dazugehörige Grund ist gewöhnlich ein Sumpf oder eine Wildnis von Kräutern und Fruchtbäumen, nur manchmal sieht man ein Stückchen Blumengarten, doch selten mit viel Geschmack; die europäischen Pflanzen und Blumen werden den herrlichen ornamentalen Erzeugnissen des Landes vorgezogen. Der allgemeine Eindruck der Stadt ist für den, der von England kommt, nicht sehr günstig, es ist hier ein großer Mangel an Ordnung, viel Nachlässigkeit und Verfall sichtbar, aber man söhnt sich zuletzt damit aus, wenn man sieht, dass wenigstens einige dieser Sonderbarkeiten im Klima ihre Veranlassung haben. Die großen und hohen Zimmer mit gedieltem Fußboden und spärlichen Möbeln, ein halbes Dutzend Türen und Fenster in jedem, sehen zuerst ungemütlich aus, sind aber dennoch für eine tropische Gegend passend, in welcher ein deckenbelegtes, mit Gardinen behängtes und gepolstertes Zimmer unerträglich wäre.
Die Einwohner von Pará repräsentieren eine sehr verschiedene und interessante Mischung von Menschen. Da ist der frischfarbige Engländer, welcher hier sowohl als in dem kälteren Klima seines Heimatlandes zu gedeihen scheint, der fahle Amerikaner, der schwärzliche Portugiese, der korpulente Brasilianer, der lustige Schwarze und der schlaffe, aber schön gebaute Indianer zwischen hundert andern Schattierungen und Mischungen, die schon ein geübtes Auge verlangen, um sie zu entdecken. Der weiße Einwohner kleidet sich im Allgemeinen sehr nett in leinene Kleider von blendender Weiße; manche halten noch am schwarzen Rock und Krawatte fest, sehen aber bei der Hitze von 85° bis 90° Fahrenheit im Schatten sehr unbehaglich aus. Der Schwarze oder Indianer trägt nur ein paar gestreifte oder weiß-baumwollene Beinkleider, denen er manchmal ein Hemde von demselben Stoffe hinzufügt. Die Frauen und Mädchen tragen zu den meisten festlichen Anlässen reines Weiß, welches im Kontrast mit ihrer dunklen Hautfarbe einen angenehmen Eindruck macht. Bei einer solchen Gelegenheit erstaunt der Fremde über die massiven goldenen Ketten und Schmucksachen, welche von diesen Frauen getragen werden, von denen doch viele Sklaven sind. Der Grad der Bekleidung bei Kindern ist höchst uneinheitlich und reicht bis zu vollständiger Nacktheit, ein Zustand übrigens, der bei farbigen Jungen unter acht oder zehn Jahren ganz allgemein verbreitet ist. Indianer, die frisch aus dem Landesinnern kamen, sahen manchmal sehr manierlich aus, und außer den Löchern in ihren Ohren, groß genug, eine Waschleine durchzuziehen, und einer sonderbaren Wildheit, mit welcher sie alles anstaunen, würde man sie kaum in dem gemischten Gewimmel der regelmäßigen Einwohner erkennen.
Ich habe schon gesagt, dass die die Natur ausmachenden Erscheinungen des tropischen Klimas meinen Erwartungen nicht entsprachen; dies liegt hauptsächlich an den Berichten der Bilder zeichnenden Reisenden, welche nur das Schöne, Pittoreske, Großartige beschreiben und uns dadurch glauben machen möchten, dass nichts von verschiedenem Charakter unter einer tropischen Sonne existieren könne. Dass wir am Ende der Regenjahreszeit in Pará ankamen, mag übrigens erklären, dass wir zuerst nicht die ganze Glorie der Vegetation sahen. Die Schönheit der Palmbäume kann kaum zu viel beschrieben werden, sie sind besonders dem tropischen Klima charakteristisch, ihr vielfältiges und stattliches Äußeres, ihr herrliches Laubwerk und ihre Früchte, im Allgemeinen dem Menschen nützlich, geben ihnen im Auge des Naturforschers und all derer, welche mit den Beschreibungen des Landes, wo man sie antrifft, vertraut sind, ein nie sich minderndes Interesse. Im Übrigen entsprach die Vegetation kaum meinen Erwartungen; wir fanden manche schönen Blumen und rankenden Pflanzen, aber auch viele Plätze, welche ebenso voller Unkraut erschienen als in unserem eigenen dürren Klima. Sehr wenige der Waldbäume waren in Blüte, und die meisten hatten nichts Besonderes in ihrem Äußeren. Das Auge des Botanikers entdeckt wohl zahllose tropische Formen in der Konstruktion der Stämme und in der Beschaffenheit und Anordnung der Blätter, aber die meisten bringen in einer Landschaft einen ähnlichen Effekt als unsere Eichen, Ulmen und Buchen hervor. Diese Bemerkungen gehören freilich nur der unmittelbaren Umgebung der Stadt, wo der ganze Wald ausgerottet gewesen und die jetzige Vegetation der Nachwuchs ist. Als wir ein paar Meilen von der Stadt in den Wald eindrangen, war der Effekt schon ein ganz anderer: Bäume von enormer Höhe erhoben sich überall, das Laub wechselt von hell und luftig bis zu dunkel und dicht. Ranken und Schmarotzerpflanze mit großen glänzenden Blättern laufen an den Stämmen herauf und klimmen oft bis zu den höchsten Zweigen, während andere mit phantastischen Stängeln wie Stricke und Taue von ihren Wipfeln herabhängen. Man sieht hier viele seltene Früchte und Samen am Boden umhergestreut, und es gibt genug für jeden Naturliebhaber zu staunen und zu bewundern; aber auch hier mangelte etwas, was wir zu sehen erwarteten. Die herrlichen Orchideen-Pflanzen, die in Europa so sehr gesucht werden, glaubten wir in jedem üppigen tropischen Walde zu finden, doch es gibt hier nur einige kleinere Arten mit matten gelben und braunen Blüten. Die meisten Schmarotzerpflanzen, welche die Stämme alter oder umgestürzter Bäume bedecken, sind zumeist ganz verschiedenen Charakters; es finden sich Farnkraut und Arten von Tillandsia, Pothos und Caladium, Pflanzen, die der äthiopischen Lilie sehr ähnlich sehen und gewöhnlich in Häusern gezogen werden. Unter den Kräutern nahe der Stadt, welche unsere Aufmerksamkeit anzogen, waren verschiedene Arten von Solanum, welche mit unseren Kartoffeln verwandt sind. Eine von diesen wächst acht bis zwölf Fuß hoch, mit großen wollartigen Blättern, stachligem Stamm und Blatt und schönen purpurnen Blüten, größer als die unserer Kartoffel; einige andere Arten haben weiße Blüten und sind unserem Bittersüß sehr ähnlich (Solanum dulcamare); viele schöne Convolvulus ranken über die Hecken wie auch verschiedene der schönsten Bignonia mit orangefarbenen, gelben oder purpurnen Blüten. Am meisten fallen die Passionsblumen auf, welche sich in großer Anzahl am Rande des Waldes finden und von den verschiedenartigsten Farben wie Purpur, Scharlach oder Rosa sind. Die purpurfarbigen haben einen außerordentlich schönen Geruch, und alle erzeugen eine angenehme Frucht, die Grenadilla von West-Indien. Es gibt außer den genannten noch viele elegante, aber auch weniger auffallende Blumen. Die Schmetterlings-Blumen, oder Erbsen, sind gewöhnlich, Cassien sind sehr zahlreich, einige sind bloße Kräuter, andere schöne Bäume und haben einen Überfluss von hellen gelben Blüten. Dann sieht man hier die sonderbare Sinnpflanze (Mimosa), die wir in unseren Treibhäusern mit solchem Interesse betrachten und die hier wie Unkraut an jedem Wege steht. Die meisten haben purpurfarbene oder weiße kugelförmige Blütenköpfe. Manche sind sehr empfindlich, und die leiseste Berührung verursacht das Schließen oder Abfallen der Blätter, andere wieder verlangen eine rauere Hand, um ihre sonderbaren Eigenschaften zu zeigen, während wieder andere kaum ein Zeichen von Gefühl geben; sie sind alle mehr oder weniger mit scharfen Dornen bewaffnet, welche teilweise den Zweck haben, ihre zarten Formen gegen die verschiedenen Erschütterungen, welche sie sonst erleiden würden, zu schützen.
Einen interessanten Anblick gewähren die Orangenbäume, welche sich über die ganze Stadt verteilen, wodurch diese deliziöse Frucht stets billig und im Überfluss vorhanden ist. Viele der öffentlichen Straßen sind mit denselben besetzt, in jedem Garten sind sie vorhanden, sodass es nur nötig ist, die Früchte zu sammeln und zu Markte zu bringen. Der Mango ist ebenfalls im Überflusse und abwechselnd mit dem Mangabeira, oder Seidenbaumwollbaum, welcher zu einem ungeheuren Umfange anwächst, auf einigen öffentlichen Wegen gepflanzt; Letzterer ist nicht so geeignet, den hier so nötigen Schatten zu geben als einige immergrüne Bäume, da seine Blätter leicht abfallen. Fast an jedem Wege, Dickicht oder jeder wüsten Stelle sieht man den Kaffeebaum, gewöhnlich mit Blüte oder Frucht und oft mit beiden zugleich; doch sind Arbeiter so knapp oder die Trägheit des Volkes ist so groß, dass außer dem wenigen für den eigenen Gebrauch keiner gesammelt wird, während die ganze Stadt ihren Kaffee aus anderen Teilen Brasiliens bezieht.
Wenden wir unsere Aufmerksamkeit der Tierwelt zu, so fallen uns zuerst die Eidechsen auf, welche überall in großer Menge vorhanden sind. In der Stadt sieht man sie Mauern und Zäune entlanglaufen, sich an den Holzstämmen sonnen oder bis unter die Dächer der niedrigen Häuser heraufkriechen. In jeder Straße, jedem Garten oder sandigen Platze sieht man sie aus dem Wege eilen, den man entlanggeht. Bald kriechen sie um einen Baumstamm, uns beobachtend und sich versteckend, bis wir vorüber sind, wie ein Eichhörnchen unter ähnlichen Verhältnissen; bald kriechen sie eine glatte Mauer oder einen Pfahl ruhig und sicher herauf, als wäre es ebene Erde. Einige haben eine dunkle Kupferfarbe, einige schillern im brillantesten Grün und Blau, und wieder andere sind mit den feinsten Farbenschattierungen von Gelb und Braun gezeichnet. Auf diesem sandigen Boden und unter dieser hellen Sonne gedeihen sie ganz besonders; hier sonnen sie sich in ihrer trägen Zufriedenheit, dann springen sie davon, als wenn jeder Strahl ihrer frostigen Natur Kraft und Leben verliehen hätte. Sehr verschieden von den kleinen europäischen Eidechsen, welche ihren Körper nicht von der Erde bringen können und ihren langen Schwanz wie eine Last hinter sich herschleppen, haben diese Bewohner eines glücklicheren Klimas ihren Schwanz hoch in der Luft und galoppieren mit so viel Freiheit und Muskelkraft wie ein warmblütiger Vierfüßer. Es war deshalb keine Kleinigkeit, ein so lebendiges Geschöpf zu fangen, und alle unsere Versuche scheiterten an ihrer Behändigkeit. Wir beauftragten deshalb die kleinen Knaben der Schwarzen und Indianer, uns einige mit ihrem Pfeil und Bogen zu schießen, und erlangten so einige Arten davon.
Nächst den Eidechsen fallen uns zunächst die Ameisen in die Augen. Sie setzen uns in Erstaunen, da sich kleine Stückchen Papier, verwelkte Blätter und Federn mit einem Male wie aus eigener Kraft bewegen; wimmelnde Prozessionen beladen mit Baumaterial schieben sich auf chaotische Weise quer über Pfade und Wege; und die Blume oder Frucht, welche man pflückt, ist von ihnen bedeckt, und sie breiten sich schnell über die Hand in solchen Schwärmen aus, dass man gern und eilig die Frucht fallen lässt. Bei Mahlzeiten sind sie auf dem Tischtuch, auf den Tellern und der Zuckerdose wie zu Hause, obgleich nicht in solcher Unzahl, dass sie wirklich bei der Mahlzeit hinderlich wären. Dabei sind sie sehr verschiedener Art. Viele Pflanzen haben ihre besondere Ameisenart; ihre Nester sieht man in unförmigen schwarzen Massen, mehrere Fuß im Durchmesser, auf den Zweigen der Bäume. Auf den Waldpfaden und Gärten sahen wir oft eine gigantische schwarze Art einzeln oder in Paaren herumwandern, die fast ein und einen halben Zoll lang war, während andere Arten, die sich in Häusern aufhalten, so klein sind, dass der Deckel eines Kastens sehr genau passen muss, um ihr Eindringen zu verhindern. Sie sind die größten Feinde eines toten tierischen Körpers, insbesondere von Insekten und Vögeln. Beim Trocknen der Insektenarten, die wir sammelten, fanden wir es nötig, die Kästen, welche sie enthielten, aufzuhängen, aber auch da nahmen sie Besitz davon, indem sie an der Schnur herunterkletterten und in wenigen Stunden viele unserer schönsten Insekten vernichteten. Es wurde uns gesagt, dass das Andiroba-Öl des Landes, welches sehr bitter ist, sie abhalte; wir tränkten damit die herabhängende Schnur und befreiten uns so von ihrem ferneren Eindringen.
Nachdem wir uns längere Zeit hauptsächlich mit dem Sammeln von Insekten beschäftigt, bin ich imstande, auch etwas über die andern Familien dieser zahllosen Klasse zu sagen. Keine Ordnung der Insekten war so zahlreich, als ich erwartet hatte, mit Ausnahme der Tagschmetterlinge (Lepidoptera), und ebendiese, obgleich die Zahl der verschiedenen Arten sehr groß war, trat, was die tatsächlichen Exemplare betrifft, nicht in so großer Menge auf, als ich vermutet hatte. In ungefähr drei Wochen hatten Mr. B[ates] und ich ungefähr hundertundfünfzig verschiedene Schmetterlingsarten gefangen; unter ihnen waren acht Spezies der schönen Gattung Papilio und drei Morpho, diese herrlichen großen metall-blauen Schmetterlinge, welche stets von allen Reisenden in Süd-Amerika zuerst bemerkt werden, denn nur hier allein sind sie zu finden. Wenn sie langsam einen Waldpfad abwechselnd im Schatten und in der Sonne einherfliegen, gewähren sie einen der schönsten Anblicke, welche die Insektenwelt hervorbringen kann. Unter den kleineren Arten ist das ausgezeichnete Farbenspiel und die verschiedene Zeichnung wunderbar. Die verschiedenen Arten scheinen unerschöpflich, und wahrscheinlich ist nicht die Hälfte von denen, welche im Lande existieren, bis jetzt bekannt. Wir stießen auf keine der großen bemerkenswerten Insekten Süd-Amerikas wie etwa den Rhinozeros- oder Harlekinbock, sahen aber verschiedene Exemplare einer großen Mantis, oder Gottesanbeterin, und ebenfalls einige der großen Mygales, oder Vogelspinnen, welche hier fälschlich »tarantulas« genannt werden und sehr giftig sein sollen. Wir fanden ein Nest der Letzteren an einem der Seidenbaumwoll-Bäume, das wie das Gewebe unserer Hausspinne war, nur bedeutend stärker und fast wie Seide. Andere Arten leben in Löchern in der Erde. Käfer und Fliegen waren im Allgemeinen sehr selten und mit wenigen Ausnahmen klein; Bienen und Wespen aber, von denen viele groß und schön waren, in Menge vorhanden. Moskitos sind in den niederen Stadtteilen und an Bord der Schiffe sehr lästig, aber in der Umgegend und den höher gelegenen Teilen der Stadt trafen wir keine. Die Moqueen, eine kleine, kaum sichtbare rote Milbe, »Bête rouge« in Cayenne genannt, lebt sehr zahlreich im Grase und ruft eine starke Reizung hervor, so sie auf die Beine gelangt. Doch sind dies Kleinigkeiten, an welche man sich rasch gewöhnt, und ohne sie würde man sich schwerlich in den Tropen wähnen.
Vögel sahen wir in der ersten Zeit nur wenige, und auch diese waren nicht besonders bemerkenswert. Der einzige brillantfarbene Vogel in der nächsten Umgebung ist der gelbe Trupial (Cassicus icteronotus), welcher sein Nest in von den Zweigen herabhängenden Kolonien baut. Ein Baum ist oft mit diesen langen beutelähnlichen Nestern wie bedeckt, und es gewährt einen schönen Anblick, die brillanten schwarzen und gelben Vögel ein und aus fliegen zu sehen. Dieser Vogel hat verschiedene helle und klare Töne und besitzt die außerordentliche Fähigkeit, den Gesang anderer Vögel nachzuahmen, sodass man ihm den Namen des südamerikanischen Spottvogels beilegen könnte. Außer diesem sind die gemeine Silberschnabeltangare (Rhamphopis jacapa), einige blassblaue Tangaren, hier »Sayis« genannt, und der gelbbrüstige Tyrannen-Fliegenfänger die einzigen sich bemerkbar machenden Vögel, welche gewöhnlich in den Außenteilen von Pará vorkommen. Im Walde hört man fortwährend die sonderbaren Töne des Buschschreiers, ihr tuuu-tuu-tu-tu-t-t-t, ein Laut dem anderen schneller und schneller folgend wie das hintereinander fallende Zurückprallen eines Hammers von einem Amboss. In der Abenddämmerung fliegen viele Ziegenmelker umher und lassen ihren eigentümlichen melancholischen Schrei hören. Einer ruft »Whip poor will«, gerade wie der bekannte nordamerikanische Vogel, ein anderer fragt fortwährend mit merkwürdiger Klarheit »Who are you?« (Wer bist du?), und da diese Stimmen sich häufig abwechseln, gewähren sie eine interessante, wenn auch monotone Unterhaltung.
Die Witterung, soweit wir sie jetzt kennenlernten, war sehr schön; das Thermometer stieg des Nachmittags nicht über 87° [Fahrenheit], noch fiel es während der Nacht unter 74°. Des Morgens und Abends war es angenehm kühl, des Nachmittags hatten wir gewöhnlich einen Regenschauer und kühlenden Wind, der die Luft reinigte und sehr erfrischend war. Des Abends bei Mondschein spazieren die Damen ohne Kopfbedeckung und im Ball-Kostüm in den Straßen und Außenteilen der Stadt, und die Brasilianer in ihren Rosinhas sitzen bis neun und zehn Uhr im bloßen Kopfe und Hemdärmeln vor den Türen ihrer Häuser, ganz unbesorgt wegen der Nachtluft und des starken Taues des tropischen Klimas, den wir stets gewöhnt gewesen sind, für so schädlich zu halten.
Wir wollen jetzt einige Notizen über die Nahrung des Volkes einschalten. Rindfleisch ist fast das einzige gebräuchliche Fleisch. Das Vieh wird auf Besitzungen, die einige Tagereisen den Strom hinauf am anderen Ufer liegen, gehalten, von wo es in Booten zur Stadt gebracht wird; da die Tiere während der Fahrt jede Nahrung verweigern, verlieren sie alles Fett und kommen in einem sehr schlechten Zustand an. Die für den Tagesbedarf werden am Morgen geschlachtet und, mit einer förmlichen Verachtung gegen alles appetitliche Aussehen, mit Äxten und großen Messern zerhauen und zerhackt, sodass das Blut über das ganze Fleisch läuft. Um sechs Uhr jeden Morgen sieht man dann eine Anzahl beladener Wagen nach den verschiedenen Schlachterläden fahren, deren Inhalt dem Pferdefleische, das nach einem Hundestalle gebracht wird, so ähnlich sieht, dass sich eine Person mit einem delikaten Magen sehr unbehaglich fühlt, wenn sie mittags nur Rindfleisch auf dem Tische erblickt. Fische kommen manchmal zum Verkauf, sind aber sehr teuer. Schweine werden nur zum Sonntag geschlachtet. Brot aus dem Mehle aus den Vereinigten Staaten, irländische und amerikanische Butter, auch andere fremde Produkte werden von der weißen Bevölkerung im Allgemeinen verbraucht, aber Farinha, Reis, gesalzene Fische und Früchte sind die hauptsächlichen Nahrungsmittel der Schwarzen und Indianer. Farinha ist eine Zubereitung von der Wurzel der Maniok- oder Cassava-Pflanze, von welcher auch Tapioca gemacht wird, es sieht wie grob gemahlene Erbsen oder vielleicht mehr wie Sägespäne aus, wird in Wasser oder Brühe erweicht und gibt dann ein sehr nahrhaftes Nahrungsmittel. Dieses mit ein wenig Salzfisch, Pfefferschoten, Bananen, Orangen und Assai (ein Gericht aus der Palmfrucht) bildet fast den Lebensunterhalt des größten Teils der Bevölkerung der Stadt. Unsere eigene Speisekarte enthielt Kaffee, Tee, Brot, Butter, Rindfleisch, Reis, Farinha, Kürbisse, Bananen und Orangen. Isodora war ein guter Koch und machte alle Sorten Geröstetes und Geschmortes aus unserem täglichen zähen Rindfleisch. Die Bananen und Orangen waren außerdem eine solche Delikatesse für uns, dass wir mit dem guten Appetit, den uns unsere Ausflüge verschafften, über nichts zu klagen hatten.
Kapitel II.Pará.
Feste – Portugiesische und brasilianische Währung – M. Borlaz’ Wohnsitz – Ausflug zu den Reismühlen – Der Urwald, seine Pflanzen und Insekten – Milchbaum – Säge- und Reismühle – Caripé oder Topffruchtbaum – Kautschukbaum – Blumen und Bäume in Blüte – Saüba-Ameisen, Wespen und Sandflöhe – Reise zu Wasser nach Magoary – Die Affen – Der Kommandant von Laranjeiras – Vampirfledermäuse – Der Holzhandel – Boa constrictor und Faultier
Ungefähr vierzehn Tage nach unserer Ankunft in Pará fielen verschiedene Feiertage, »Festas« genannt. Die des »Espirito Santo« und des »Trinidade« dauerten jedes neun Tage. Das erstere Fest wurde in der Kathedrale, das letztere in einer der kleineren Vorstadtkirchen abgehalten. Im Allgemeinen ist der Charakter dieser Feste gleich, doch einige werden eifriger gefeiert und sind beliebter als andere. Sie bestehen gemeinhin darin, dass jeden Abend vor der Kirche ein Feuerwerk abgebrannt wird, dass Schwarzenmädchen »doces«, also Süßigkeiten, Kuchen und Früchte verkaufen und Prozessionen mit Heiligenstatuen und Kruzifixen stattfinden; die Kirchen öffnen sich mit regelmäßigem Gottesdienst, Bilder und Reliquien werden geküsst, und ein gemischter Haufen Schwarzer und Indianer, alle weiß gekleidet, drängt sich untereinander; auch die Frauen in all der Glorie ihrer massiven goldenen Ketten und Ohrgehänge erfreuen sich des herrlichen Spaßes. Außer diesen ist noch eine Anzahl Leute aus den besseren Ständen und Fremder zugegen. Prunkvolle Prozessionen werden zum Beginn und Ende der Festlichkeiten zusammengestellt, und am letzten Abend kommt ein großartiges Feuerwerk zur Aufführung, welches gewöhnlich von einem gewählten oder freiwilligen »Juiz da festa«, oder Gouverneur des Festes, gespendet wird, ein recht teurer Ehrentitel in einem Volke, welches, noch nicht zufrieden mit einem unerschöpflichen Vorrat von Raketen in der Nacht, sich auch tagsüber mit dem Abfeuern großer Mengen derselben amüsiert und sich an dem Zischen und Knallen aufs Höchste ergötzt. Übrigens betrachtet man eine Rakete gewissermaßen als einen Teil der religiösen Zeremonie; als ich einen alten Schwarzen fragte, warum er sie schon des Morgens abbrenne, blickte er gen Himmel und antwortete sehr ernsthaft »Por Deos« (für Gott). Musik, Lärm und Feuerwerk sind die drei wesentlichen Dinge zum Vergnügen der brasilianischen Bevölkerung; während der vierzehn Tage bekamen wir genug davon, denn außer den oben genannten Amüsements feuern sie von morgens bis in die späte Nacht mit Flinten, Pistolen und Kanonen ununterbrochen fort.
Nach manchem Hin- und Hersuchen gelang es uns endlich, ein für uns passendes Haus zu finden. Es lag in Nazaré, ungefähr ein und eine halbe Meile südlich von der Stadt, einer kleinen schönen Kapelle gegenüber, dicht an dem Walde und in der Nähe einiger für das Sammeln von Vögeln, Insekten und Pflanzen sehr geeigneter Stellen. Das Haus enthielt vier Zimmer zu ebener Erde, die von einer Veranda umgeben waren; der dazugehörige Grund enthielt Orangen und Bananen und eine Menge Wald- und Fruchtbäume, außerdem Pflanzungen von Kaffee und Maniok. Wir zahlten monatlich zwanzig Milreys (zwei Pfund, fünf Schilling), was freilich für Pará sehr teuer war, doch ein anderes Haus von gleichem Komfort war nicht zu beschaffen. Isodora nahm die Küche, einen alten aus Lehmmauern bestehenden Schuppen, in Besitz, und wir aßen und arbeiteten auf der Veranda, selten die inneren Zimmer zu etwas anderem als zum Schlafen benutzend.
Es fiel uns bald schon leichter, unseren Wünschen auf Portugiesisch Ausdruck zu verleihen, doch an das portugiesische, oder genauer brasilianische, Geld gewöhnten wir uns lange nicht, da diese Währung sehr eigentümlich und verwirrend ist. Sie besteht aus Papier, Silber und Kupfer. Grundeinheit ist der Rey, allerdings ist der Milrey, also tausend Reys, der Wert der kleinsten Papiernote und die Einheit, in welcher Bücher und Konten geführt werden. Das System ist demnach ein dezimales und sehr einfach zu begreifen, wären da nicht jene Münzen, welche für das Rechnen Anwendung finden und alles komplizieren. Zu nennen sind der Vintem im Werte von zwanzig Reys, der Patac (dreihundertundzwanzig) und der Crusado (vierhundert), welche sämtlich zur Berechnung von Geldsummen benutzt werden und einen Neuling in Verwirrung stürzen, da namentlich der Patac kein glatter Teil des Milrey ist (drei Patacs und zwei Vintems ergeben einen Milrey) und der hier gängige spanische Dollar sechs Patacs entspricht. Früher betrug der Wert des Milrey 5 Schilling, 7½ Pence, jetzt aber schwankt er von 2 Schilling, 1 Penny bis 2 Schilling, 4 Pence, oder ist gar weniger als die Hälfte wert, was wohl der überreichen Ausgabe von Papier und seiner Unwandelbarkeit in Münzen geschuldet ist. Die metallene Währung, vormals von wirklichem und nicht bloß nominellem Werte, erschöpfte sich bald, sodass es unumgänglich wurde, ihren Wert zu erhöhen. Dies geschah, indem man sie neu prägte und ihnen fürderhin den doppelten Wert gab; ein neu geprägter Vintem kommt so zwei Vintems gleich, ein Patac mit 160 darauf zählt für 320, und ein Zweivintemstück ist vier Vintems wert. Mit dem Verfall der Währung wurde auch die Größe der neuen Münzen vermindert, sodass nun erst recht Verwirrung herrscht, denn das Verhältnis von Größe und Wert ist beinahe bedeutungslos geworden; selbst von zwei Stücken des genau gleichen Maßes mag das eine den doppelten Betrag des anderen wert sein. Folglich muss man jedes Münzstück genauestens ins Auge nehmen, wodurch das Zusammenstellen großer Summen zu einer nicht wenig Übung und Aufmerksamkeit verlangenden Tätigkeit gerät.
1. Raphia taedigera. 2. Mauritia flexuosa. 3. Manicaria saccifera. 4. Lepidocaryum tenue. 5. Astrocaryum tucuma. 6. Leopoldinia pulchra.
Tafeln mit Zeichnungen der Früchte von Palmen aus Wallace’ »Palm Trees of the Amazon« (1853)
1. Attalea spectabilis. 2. Maximiliana regia. 3. M. regia (Blütenscheide) 4. Guilielma speciosa. 5. Iriatea exorhiza.
Auf unserem Grundstücke lebten drei Schwarze, welche die Kaffee- und Fruchtbäume und die Maniok-Felder beaufsichtigten; der eine, namens Vincente, war ein schöner stämmiger Bursche, der sich im Fangen der »Bichos«, wie sie hier alle Insekten, Reptilien und kleineren Tiere nennen, berühmt gemacht hatte. Er brachte uns bald verschiedene Insekten, unter anderen eine gigantische haarige Spinne, eine Mygale, welche er geschickt aus ihrem Loche in der Erde herausgegraben und in einem Blatte gefangen hatte. Er erzählte uns, dass er einmal von einem solchen Tiere gebissen worden und dass es ihm darauf lange schlecht ergangen sei. Als wir ihn weiter nach der Sache befragten, bezeichnete er das »Bicho« als »muito mal« (sehr schlecht) und schloss mit einem nachdrücklichen »ju-u-u«, was wohl dem »Und wie!« eines Schuljungen in etwa gleichkommt und verrät, dass kein Zweifel am Gesagten bestehen kann. Es erscheint daher glaubhaft, dass dieses Insekt mit seinen mächtigen Fangzähnen tatsächlich in der Lage ist, vergiftete Wunden zu schlagen.
Bei einem unserer Streifzüge kamen wir zu dem Landhause eines Franzosen, Herrn Borlaz, des Schweizer Konsuls in Pará. Sehr zu unserem Erstaunen wandte er sich auf Englisch an uns, führte uns auf seinem Anwesen umher und zeigte uns die Pfade durch den Wald, die uns das beste Vorankommen ermöglichen würden. Die Vegetation war hier an den Ufern des Flusses, nur eine Meile unter Pará, schon sehr reich. Die Miriti (Mauritia flexuosa), eine schöne Fächerpalme, und eine schlankere Art, die Marajá (Bactris maraja), ein kleiner dorniger Baum, welcher eine kleine Frucht mit dünnem äußerlichem Fleische von säuerlich-angenehmem Geschmack trägt, waren beide in Menge vorhanden. Eine Masse Kaktus, welche nahe am Hause wuchs, aber angepflanzt war, hatte ein recht tropisches Ansehen und war wohl dreißig Fuß hoch. Die Dickichte waren voll der seltensten Bromeliaceen und Vertretern der Aronstabgewächse Arum sowie vieler sonderbarer Bäume und Sträucher, in deren Schatten wir einige schöne Insekten fingen. Der herrliche blaue und orangefarbene Schmetterling (Epicalia ancea) saß hier vielfach an den Blättern und kehrte wiederholt zu demselben Baum, ja zu demselben Blatte zurück, sodass wir fünf verschiedene fingen, ohne dass wir vom Platze gingen.
Bei unserer Rückkehr setzte uns Herr Borlaz verschiedene schöne Früchte vor – die Berribee, eine Art der Annona mit einem angenehmen, säuerlichen, puddingartigen Fleische, geröstete Brotfrucht, sehr ähnlich der spanischen Kastanie, sowie in der Sonne getrocknete Pisangfeigen, den Feigen sehr ähnlich. Die Lage des Hauses war entzückend mit der Aussicht über den Fluss nach den gegenüberliegenden Inseln, und hoch genug, um trocken und gesund zu sein. Das feuchte Gehölz am Ufer des Flusses war so ergiebig, dass wir sehr oft von der Erlaubnis des Herrn Borlaz, sein Grundstück besuchen zu dürfen, Gebrauch machten. Hier möchte ich ein Beispiel für die Gefräßigkeit der Ameisen nicht unerwähnt lassen; ich hatte meinen Sammlungskasten während eines halbstündigen Gespräches auf der Veranda abgelegt, und da ich ihn anschließend öffnete, einen neuen Fang hineinzugeben, erblickte ich mit Entsetzen, dass das Behältnis von kleinen roten Ameisen wimmelte, welche bereits von fast einem Dutzend Insekten die Flügel abgetrennt hatten und diese nun kreuz und quer umherschleppten, während andere noch mit der Zerstückelung beschäftigt waren und wieder andere sich in die fleischigsten Körper eingegraben hatten und ein köstliches Mahl genossen. Nur mit Mühe konnte ich ihnen ihre Beute entreißen, gewann aber immerhin einige nützliche Erfahrungen, wenn auch zum Preise eines halben erfolgreichen Tagesfanges, zu dem auch einige der so gepriesenen Epicalia gehörten.
Am 23. Juni des Morgens brachen wir früh auf, um den Reismühlen in Magoary einen Besuch zu machen, deren Besitzer, Mr. Upton, und dessen Verwalter, Mr. Leavens, beide Amerikaner, uns dahin eingeladen hatten. Ungefähr zwei Meilen von der Stadt betraten wir den Urwald, welcher sich durch höhere Wipfel und tiefere Schatten schon eine Weile angekündigt hatte. Das Charakteristische desselben war die große Anzahl und Verschiedenheit der Waldbäume, deren Stämme oft sechzig bis achtzig Fuß vollkommen gerade und ohne Zweig in die Höhe stiegen, und die kolossalen Schlingpflanzen, welche daran heraufranken, sich manchmal in schräger Richtung wie Streben oder Stage eines Mastes von ihren Wipfeln erstrecken oder sich wie eine enorme Schlange, die ihren Raub erwartet, um den Stamm winden. Hier sind zwei oder drei in sich selbst zusammengedreht und bilden ein förmliches Tau, womit sie diese Könige der Wälder zu binden scheinen; dort bilden sie eine verwickelte Girlande und, selbst wieder mit kleineren Ranken und Schmarotzerpflanzen bedeckt, bedecken sie fast den väterlichen Stamm und verhüllen ihn ganz.
Unter den Bäumen sind diejenigen, die eine Art Strebepfeiler um ihren Stamm haben, die auffallendsten. Einige dieser Strebepfeiler sind weit länger, als sie hoch sind, da sie in einer Entfernung von acht bis zehn Fuß vom Stamme entspringen und nur vier bis fünf Fuß hoch hinaufreichen, während andere bis zur Höhe von zwanzig bis dreißig Fuß steigen und darüber noch wie Rippen am Stamme zu vierzig bis fünfzig unterschieden werden können. Es sind förmliche Palisaden, sechs Zoll bis einen Fuß stark, manchmal in zwei oder drei sich verzweigend und sich gerade und weit genug ausstreckend, sodass eine bequeme Hütte in ihrem Winkel gebaut werden könnte. Ihr Holz ist allgemein sehr leicht und weich, weshalb man häufig große eckige Stücke aus ihnen schneidet, um sie als Paddel und zu anderen Zwecken zu verwenden.
Andere Bäume erscheinen wieder, als wenn sie aus einer Unzahl schlankerer Bäume zusammengewachsen und geformt wären. Sie haben tiefe Furchen und sind bis zu ihrer ganzen Höhe gerippt; an manchen Stellen gehen die Furchen bis durch, was dann wie ein Fenster in einem schmalen Türmchen aussieht, und doch erreichen sie dieselbe Höhe als die höchsten Bäume des Waldes mit einem geraden, gleichmäßig dicken Stamm. Eine andere Form zeigt sich bei denen, welche viele ihrer Wurzeln hoch über der Erde haben, die somit auf vielen Füßen zu stehen scheinen, und Bogen bilden, die groß genug sind, um darunter hindurchzugehen.
Die Stämme dieser Bäume und die Ranken, welche sie umgeben, unterstützen nun noch eine Unzahl kleinerer Pflanzen. Tillandsia und andere Bromeliaceen, der wilden Ananas ähnlich, große rankende Arum, mit ihren großen dunklen grünen, wie ein Pfeil geformten Blättern, verschiedene Pfefferarten und großblättrige Farnkräuter schießen in Zwischenräumen am Stamme bis zu den höchsten Zweigen hinauf. Zwischen diesen ist kriechendes Farnkraut und eine zarte kleine Art ähnlich unserem Hautfarn Hymenophyllum; an feuchten dunklen Plätzen sind deren Blätter wieder mit kleinen kriechenden Moosen und Jungermannien bedeckt, sodass sich Schmarotzer an Schmarotzer-Pflanzen zeigen. Hebt man den Blick, wird man des fein verzweigten, stark gegen den klaren Himmel abgesetzten Laubwerkes gewahr, welches so charakteristisch für tropische Wälder ist, wie auch Humboldt mehrfach bemerkt hat. Viele der größten Bäume haben ähnlich zarte Blätter wie die der zitternden Mimosa, ebenso wie diese zur ausgebreiteten Familie der Leguminosen gehörend, während die großen palmenartigen Blätter der Cecropia und die ovalen glänzenden der Clusia und hundert andere dazwischen fallende Formen eine genügende Mannigfaltigkeit gewähren. Der helle Sonnenschein, der oben alles erleuchtet, während unten dunkle Dämmerung herrscht, trägt viel zur Größe und Feierlichkeit der Szene bei.
Blütenpflanzen fanden sich nur hin und wieder; einige kleine Orchideen und unbedeutende Kräuter am Wegesrand, hier und da ein weiß oder grün blühender Strauch war alles, was wir sahen. Auf der Erde lagen mannigfache verrottende Früchte – die Schoten von sonderbar gewundenen Hülsenfrüchten (Leguminosen), ein Yard lang, große breite Bohnen, Nüsse von verschiedenen Größen und Formen und große Früchte des Topfbaumes, welche Deckel wie das Gerät haben, von dem sie ihren Namen empfingen. An Kräutern gab es hauptsächlich Farne, Scitamineae, einige Gräser und kleine Kriechpflanzen; welke Blätter und faules Holz bedeckten den Boden zum größten Teil.
Wir fanden sehr wenige Insekten, aber nahezu alle, welche wir sahen, waren neu für uns. Unser größter Schatz war ein durchsichtig geflügelter Schmetterling mit einem hellen violetten Fleck auf dem unteren Flügel, der Esmeralda-Augenfalter Haetera esmeralda, welchen wir jetzt zum ersten Mal sahen und fingen. Wir erlangten verschiedene andere seltene Insekten, der gigantische Morpho flog oft an uns vorüber, aber sein wellenförmiger Flug spottete aller unserer Anstrengung, ihn zu fangen. Von Vierfüßern sahen wir gar nichts, auch nur sehr wenige Vögel, doch hörten wir genug der Letzteren, um uns zu überzeugen, dass sie nicht fehlten. Der allgemeinen Ansicht, dass die tropischen Vögel im Verhältnis zu ihrem glänzenden Gefieder des Gesanges entbehren, müssen wir widersprechen. Viele der brillanten tropischen Vögel gehören zu Familien und Gattungen, welche keinen Gesang haben; aber so wie bei uns die farbenfrohsten Vögel, wie der Stieglitz und der Kanarienvogel, keineswegs unmusikalisch sind, finden sich hier auch viele schöne kleine Vögel, welche ebenso vortreffliche Sänger sind. Wir hörten Töne, welche denen unserer Amsel und unseres Rotkehlchen sehr ähnlich waren, und ein Vogel stieß drei oder vier so süße klagende Töne aus, dass sie ganz besonders unsere Aufmerksamkeit auf sich zogen. Viele haben besondere Rufe, denen von phantastisch Veranlagten sehr leicht Worte untergeschoben werden können und welche in der Stille des Waldes einen sehr angenehmen Eindruck machen.
Als wir die Mühlen erreichten, war es bereits ein Uhr, da wir uns auf der Strecke von kaum zwölf Meilen, verzögert durch all das Interessante, dem wir des Weges begegnet, sechs Stunden aufgehalten hatten. Wir wurden vom Herrn Leavens sehr freundlich bewillkommt und hatten bald eine wohlbedeckte Tafel vor uns. Nach dem Essen schlenderten wir ein wenig auf dem Gehöfte umher und erblickten zum ersten Mal Tukane