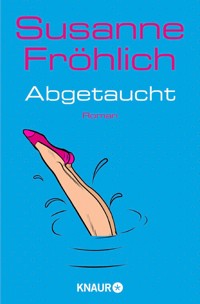
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ein Andrea Schnidt Roman
- Sprache: Deutsch
Zwischen Patchwork-Wahnsinn, Erotikflaute und Liebeschaos: Kult-Heldin Andrea Schnidt ist zurück! Der 11. humorvolle Roman von Susanne Fröhlich um Kult-Alltagsheldin Andrea Schnidt, die unverhofft noch mal das volle Programm des Windel-Wahnsinns erleben darf – die Version 2.0, versteht sich. Fragen über Fragen, die sich vor Andrea auftürmen: Warum ist im heimischen Bett plötzlich so wenig los? Hilft da ein schickes Reizwäscheset oder hat Sex eben auch ein Verfallsdatum? Warum zieht die Ex des Liebsten, die perfekte Bea, ausgerechnet in die nächste Nachbarschaft? Muss man Patchworkfamilie lieben? Warum wird der Lieblingsschwiegervater nachts von der Polizei aufgegriffen und wie fühlt es sich eigentlich an, Oma zu werden? Müssen Babys heutzutage schon die erste Lektion Mandarin im Kreisssaal bekommen? Oder sind die jungen Mütter einfach alle nur ein bisschen wahnsinnig? Von Vaterschaftstests, One-Night Stands und verwöhnten Jung-Erwachsenen, von neuen Freundinnen und Hobbydetektiven. Vom Leben und seinen Wirrungen. Empathisch, lebensklug, zum Tränen Lachen: Zum 11. Mal zeigt Andrea Schnidt dem Leben, was Humor ist . Die humorvollen Romane um Andrea Schnidt von Bestseller-Autorin Susanne Fröhlich sind in folgender Reihenfolge erschienen: Frisch gepresst Frisch gemacht! Familienpackung Treuepunkte Lieblingsstücke Lackschaden Aufgebügelt Wundertüte Feuerprobe Verzogen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Susanne Fröhlich
Abgetaucht
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Zwischen Patchwork-Wahnsinn, Erotikflaute und Liebeschaos: Kult-Heldin Andrea Schnidt ist zurück!
Wie man auf einer Sexmesse Toleranz lernen kann, warum Enkel die großartigsten und praktischsten Kinder überhaupt sind und was Patchworkfamilien einem an Geduld abverlangen. Warum Kinderkriegen heute so anders ist, wann es hilft, die Krallen auszufahren oder wann man manche Kröte eben schlucken muss.
Andrea Schnidt auf der Suche nach Leidenschaft, einem Job, Freundschaft und der perfekten Beziehung.
»Andrea Schnidt, eine sympathische Durchschnittsfrau, ist zweifellos die bekannteste weibliche Romanfigur der gehobenen deutschen Unterhaltungsliteratur.« Ursula März, DIE ZEIT
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
Vor zwei Jahren haben [...]
In drei Wochen etwa [...]
Es ist 4 Uhr 30 [...]
Als ich ihn dann [...]
Um 3 Uhr 30, mitten [...]
In diesem Jahr will [...]
Um Punkt 8 Uhr steht [...]
Noch eine Woche bis [...]
Stehe am Weihnachtsmorgen früh [...]
Anfang März werden wir [...]
Desperately seeking Luis!
Das Highlight der Woche [...]
Es wird ein sehr [...]
Am nächsten Morgen stehen [...]
Tamara und ich treffen [...]
Claudia klingt heiter, als [...]
Auf dem kurzen Weg [...]
Paul lässt das Thema [...]
Endlich ist der Sonntag [...]
So viel Neues: Emil [...]
Danksagung
Trotz allem: Für Matthias.
Und für meine Kinder Charlotte und Robert.
Prolog
Irgendwie sieht meine Tochter fett aus.
Ich weiß, das darf man eigentlich noch nicht mal denken, geschweige denn sagen. Aber ich muss auch gar nichts sagen, sie merkt es an meinem Blick. Ich war schon immer schlecht darin, Gedanken zu verbergen. So auch in diesem Fall.
»Ist was, du guckst so?«, fragt sie mich und ich laufe rot an. Fühle mich erwischt.
»Nein, nichts ist, ich freue mich, dass du da bist, endlich mal wieder. Deshalb schaue ich so. Konnte mich ja kaum mehr erinnern, wie du überhaupt aussiehst. Du warst ja wirklich komplett abgetaucht!«, antworte ich verlegen und versuche zu grinsen, damit es nicht so arg nach Vorwurf klingt. Obwohl der durchaus berechtigt wäre.
Seit drei Monaten habe ich Claudia nicht mehr gesehen und auch selten gesprochen. Sie hätte ausgewandert sein können. Sie verzieht ihr Gesicht, wirkt ärgerlich: »Auf den Kommentar hätte ich gut verzichten können, das braucht man nicht. Jetzt bin ich ja da.« Es tut mir leid. Auch ich hasse es, wenn meine Mutter in diesem ganz bestimmten Ton sagt: dass duuu dich mal meldest. Da muss man den Impuls unterdrücken, das Telefonat sofort zu beenden. Claudia, meine Tochter, räuspert sich: »Ich muss dringend mit dir reden und das geht nun mal, wenn es was Ernstes ist, besser von Angesicht zu Angesicht.«
Oh, mein Gott! Ich bin eine wirklich oberflächliche Person. Wahrscheinlich ist sie so aufgespeckt, weil sie irgendeine grässliche Krankheit hat und Cortison nimmt. Oder ist es Krebs? Aber wird man da nicht eher dünn? Neben meiner Oberflächlichkeit habe ich, wie man merken kann, außerdem einen kleinen Hang zum Drama. Aber nach einer guten Nachricht sieht ihr Gesicht nicht aus. Auch das ist, nebenbei betrachtet, ziemlich rund geworden. Und pickeliger als sonst. Will sie mir mitteilen, dass sie vorhat zu heiraten? Aber wäre eine Hochzeit eine ernste Nachricht? In ihrem Fall würde ich das durchaus so sehen. Sie ist inzwischen zwar vierundzwanzig Jahre alt und seit Jahren mit ihrem Freund Emil zusammen, aber ein bisschen mehr Erfahrung und Abwechslung hätte ich ihr vor der Ehe schon gewünscht. Ich habe prinzipiell nichts gegen ihre Wahl. Emil, er ist der Sohn unserer ehemaligen Nachbarin Tamara, ist kein unsympathischer junger Mann, aber irgendwie alt, obwohl er jung ist. So seriös und auf eine merkwürdige Art gediegen. Spießig könnte man ihn nennen, wenn man es uncharmant ausdrücken möchte. Da meine Tochter schon selbst eine Neigung zur Spießigkeit hat, wäre es gut, sie hätte einen Mann, der das abmildern könnte. Als eine Art Regulativ. Kein Wunder, dass sie so aufgespeckt hat, die beiden sitzen sehr viel zu Hause rum. Und dabei futtern sie wahrscheinlich.
Aber mal ehrlich: Würde sie nicht entspannter und glücklicher aussehen, wenn sie mir die, aus ihrer Sicht, frohe Botschaft einer Verlobung überbringen würde? Selbst wenn sie ahnt, dass ich nur mäßig begeistert sein könnte?
»Was ist los, mein Schatz?«, frage ich ziemlich beunruhigt.
»Ich muss in die Klinik, Mama!«, seufzt sie und ich breite direkt die Arme aus. Sie beginnt zu weinen. Auch mir schießen die Tränen in die Augen. Reiß dich zusammen, Andrea, ermahne ich mich, du musst jetzt stark sein. Das Kind braucht Halt und Trost und keine Mutter, die direkt zusammenbricht.
»Was ist es? Was sagen die Ärzte? Hase, es gibt immer Wege, wir schaffen das!«, bricht es aus mir heraus.
»Ich weiß nicht, ob ich das schaffe«, schluchzt meine Tochter, »ohne dich und euch bestimmt nicht.«
Ich streichle über ihren Kopf. »Wir schaffen das!«, wiederhole ich und fühle mich wie die Kanzlerin. Mantraartig wiederhole ich den Satz. »Was sagt denn Emil?«, will ich dann, als sie mit dem Schluchzen aufhört, wissen.
»Er weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass er mich unterstützen wird.«
Jetzt bin ich verwirrt. Er ist ein junger Superspießer, aber ich habe ihn immer für verdammt verlässlich gehalten. Das ist ja der Vorteil des Spießigseins. »Wir sind alle an deiner Seite, egal was es ist, wir kriegen das hin. Und natürlich musst du es Emil sagen. Das ist wichtig!«, versuche ich, zuversichtlich zu klingen. Dabei habe ich das Gefühl, man hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Mein Kind. Meine Älteste. Krank. Was Ernstes. Ich muss mich zusammenreißen: »Also eins nach dem anderen. Bevor wir einen Masterplan machen, erzählst du mir alles. Zeigst mir deine Befunde. Dann rufen wir Paul an und er schaut sie sich an. Immerhin ist er vom Fach.«
Claudia schnieft: »Na, das kann man so nicht direkt sagen, Paul ist doch Orthopäde.«
»Aber auch wenn es nicht seine Fachrichtung ist, er hat Kontakte, er kann das besser einordnen als wir Nichtmediziner. Soll ich ihn direkt anrufen, damit er nach Haus kommt?«, will ich wissen und immerhin, Claudia hat aufgehört zu weinen. »Ist es Krebs?«, erkundige ich mich ganz leise und vorsichtig.
Sie hebt den Kopf und es wirkt fast so, als würde sie grinsen: »Nein, wie kommst du denn darauf?« Sie schüttelt vehement den Kopf. »Ich bekomme ein Baby«, antwortet sie und guckt mich mit großen Augen an.
Das Erste, was mir durch den Kopf geht, ist: Es ist kein Krebs. »Das ist doch gut, also kein Krebs, keine unheilbare Krankheit.« Ich bin so erleichtert.
Allerdings nur kurz. Was sollte dann dieser seltsame Satz mit »Ich muss in die Klinik«? War das eine kleine Finte, um genau dieses Gefühl in mir auszulösen? Wollte sie mir die Botschaft auf diese Weise schmackhafter machen? »Ein Baby«, sage ich nur. Mein Baby bekommt ein Baby. Ich presse ein »Glückwunsch« heraus. »Freust du dich denn nicht?«, erkundige ich mich.
»Es ist nicht so ganz, wie es jetzt klingt. Also nicht ganz so einfach.«
Natürlich ist Kinderkriegen nicht einfach. Und vor allem: Es ist eine echte Veränderung. Eine Wende im Leben. Sie studiert zwar noch, aber sie hat einen festen Freund und ist schon mal keine Teenieschwangere mehr. Kein Fall für RTL2. Es könnte also alles sehr viel schlimmer sein: »Das kriegt ihr hin! Und wir werden euch helfen. Tamara, deine Fastschwiegermutter, wird vor Begeisterung ausrasten. Weiß sie es schon?« Als ich die Frage ausgesprochen habe, fällt mir eine klitzekleine Ungereimtheit auf. »Warum weiß es Emil denn noch nicht? Er wird sicher verzückt sein. Er will doch Familie. Und nur weil das Timing vielleicht nicht ganz perfekt ist …« Ich komme nicht dazu auszusprechen.
»Das Baby ist nicht von ihm«, schluchzt Claudia, »was soll ich ihm denn bloß sagen?«
Jetzt bin ich kurz vor der Schnappatmung. Was soll das heißen? Da eine unbefleckte Empfängnis wohl kaum infrage kommt, bleibt nicht viel an Deutungsmöglichkeiten. »Seid ihr gar nicht mehr zusammen, also der Emil und du? Und warum ist er nicht der Vater?« Ich bin, gelinde gesagt, ziemlich verwirrt. »Könntest du mir mal verraten, wer dann der Vater ist?«, schiebe ich noch hinterher und versuche, nicht wie eine moralinsaure, angespannte Erziehungsberechtigte zu klingen.
»Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie er heißt. Ich erinnere mich nur so dunkel. Ich glaube Luis. Aber mehr weiß ich nicht. Frag nicht. Ich will gar nicht daran denken.«
Luis heißt der Papa meines Enkels. Oder so ähnlich. »Claudia!«, entfährt es mir.
»Ich weiß, Mama, es war ein langer Abend und Emil war so doof. Und ich war so sauer. Und bin ausgegangen. Mehr so aus Trotz. Und dann war da der Typ. Und der war lustig. Und er sah echt gut aus. Ich meine, soweit ich mich erinnere. Aber er war definitiv an mir interessiert. Sehr sogar.«
Ja, so könnte man es sicher beschreiben, bei dem Ergebnis. Aber habe ich ihr in Gedanken nicht eben noch ein bisschen Abwechslung gewünscht? Ganz so viel Abwechslung hätte es nach meinem Geschmack nicht sein müssen. »Also du hast eigentlich keine Ahnung, wer der Vater ist?«, hake ich nach.
»Nein, also doch. Außer dem kommt keiner infrage. Denn von selbst wird man ja nicht schwanger.«
»Dann könnte es doch auch Emil gewesen sein?«, frage ich vorsichtig. Bei allen Vorbehalten Emil gegenüber wäre er in dieser Konstellation doch meine erste Wahl. So verschieben sich Dinge sehr schnell.
»Nee, das war in der Zeit, als der Emil Hausarbeit geschrieben hat«, stöhnt sie.
»Was hat das denn damit zu tun?« Ich bin erstaunt.
»Wenn der Hausarbeit schreibt, haben wir keinen Sex. Weil ihm das die Energie raubt.«
Jetzt bin ich sprachlos. Solche kruden Schlussfolgerungen kenne ich sonst nur von Leistungssportlern. Bei allem Wohlwollen kann man Emil, der ab und an mal Tischtennis spielt, dazu sicherlich nicht zählen. Energieräuber Sex! Meine arme Tochter. Da ist dieser Luis ja nahezu Notwehr. Für einen kurzen Moment bin ich fast froh, dass nicht Emil der Vater meines Enkelkindes ist. Enkelkind. Ich werde Oma. Es fühlt sich seltsam an. Irgendwie alt. Katapultiert mich ungefragt in eine ganz neue Rolle.
Ein Klingeln unterbricht uns und da fällt es mir ein. Ich bin mit Rudi, meinem Ex-Schwiegervater, verabredet. Seit zwei Jahren lebt Rudi mit seiner Freundin Malgorzata in einer Dreizimmerwohnung bei uns um die Ecke. Malgorzata war mal die Pflegerin meiner Mutter, bevor die ins Seniorenheim kam.
Es ist viel passiert bei uns in den letzten zwei Jahren.
Die Demenz meiner Mutter ist rasant fortgeschritten, mein Ex hat geheiratet, Rudi ist fest mit Malgorzata zusammen, wir sind in die Stadt gezogen und ich bin mal wieder dabei, mich beruflich neu zu orientieren.
»Das ist Opa, der wollte heute Nachmittag vorbeikommen, ist das okay oder soll ich mir eine Ausrede einfallen lassen, damit wir für uns sind?«, frage ich meine Tochter, bevor ich den Türöffner drücke.
Wir leben in einer Altbauwohnung mitten in Frankfurt. Nach vielen Jahren als Familie im Reihenmittelhaus und dann einem Jahr auf dem platten Land sind wir nun räumlich da, wo ich gedanklich schon immer hinwollte. Paul, mein Lebensgefährte, und ich haben eine wirklich hübsche Wohnung in Sachsenhausen gefunden. Altbau, Stuck, Flügeltüren, das ganze Programm. Drei Zimmer, Küche, Bad und Gästeklo. Mehr kann man in guter Lage, selbst mit einem Arztgehalt, kaum zahlen. In Frankfurt nennt man den Stadtteil »Dribbdebach« – und alles von Frankfurt, was nördlich vom Main liegt, heißt im Volksmund »Hibbdebach«. Das bedeutet nicht mehr als hüben und drüben. Wir sind somit die von drüben.
»Der kann das ruhig hören, lange kann ich es eh nicht mehr verbergen, ich meine, ich bin nicht gerade schlanker geworden in den letzten Wochen, hast du doch auch sofort gesehen vorhin, als ich kam«, erklärt meine Tochter.
Zwei Minuten später steht Rudi im Wohnzimmer. »Stör isch euch? Komm isch ungelesche?« Mein Schwiegervater ist nicht nur ein echter Hesse, sondern auch unglaublich höflich.
»Setz dich, ich mache dir einen Kaffee und dann kann Claudia in aller Ruhe ihre Neuigkeiten erzählen. Du wirst dich wundern«, begrüße ich Rudi und er strahlt uns an: »Ach wie uffreschend. Neuigkeite. Isch hab aach einiges zu erzähle. Abä aans nach em annern. Ihr Herzscher, isch bin gespannt.«
Ich bin auch gespannt, wie er reagieren wird. Aber so, wie ich meinen Rudi einschätze, wird er begeistert sein. Er hat die Gabe, alles oder nahezu alles positiv zu sehen. Und er ist offen und neugierig. Vor allem für sein Alter, immerhin ist er inzwischen fast fünfundachtzig. Und diese Neugier hält ihn jung. Ich glaube, seine Anwesenheit jetzt und hier wird zur Entspannung beitragen.
Während ich frischen Kaffee koche, pocht es in meinem Kopf. Meine Hände zittern, als ich die Tassen fülle. Wie soll das werden? Wie soll Claudia das schaffen? Was wird Tamara, die ja indirekt auch zum Kreis der Betroffenen gehört, sagen? Und was ist ihrem Sohn, mit Emil? Und wer zur Hölle ist dieser Luis?
»Wie wärs, du erzählst mal alles von Anfang an, jetzt, wo Opa da ist«, schlage ich meiner Tochter vor.
»Das ist ne lange Geschichte!«, antwortet sie.
Ich denke nur: Das wird noch ne verdammt lange Geschichte. Und Rudi lächelt und sagt: »Isch hab Zeit, Herzscher, alle Zeit der Welt. Des is de Vorteil des Alters.«
»Es ist mir peinlich!«, stöhnt sie.
Für Peinlichkeiten ist es jetzt ein bisschen spät, liegt mir auf der Zunge, aber ausnahmsweise schaffe ich es, den Kommentar runterzuschlucken. »Mir is nix Menschlisches fremd!«, sagt Rudi liebevoll und streicht Claudia über den Kopf. Ganz zart.
»Gut, dann erzähle ich es euch. Also der Emil und ich haben uns eigentlich gut verstanden. Sehr gut sogar.« Sie macht eine kleine Pause und ich denke nur, Sätze, in denen ein »eigentlich« steht, gehen eigentlich nie gut weiter. Fast immer folgt ein fettes »Aber«. Und da ist es auch schon. »Aber mit dem Sex war es echt schwierig. Wir hatten wahrscheinlich weniger Sex als du, Mama, ja, vielleicht sogar weniger als du, Opa.«
Mein Ex-Schwiegervater grinst süffisant. »Des könnt sein, abä mir sin auch vorn debei, wenn de verstehst, was isch mein.«
»Bitte, Rudi, keine Details«, unterbreche ich seine Ausführungen. Ich möchte mir nicht in Bildern vorstellen, was Rudi mit seiner sehr viel jüngeren Freundin Malgorzata, der polnischen Ex-Pflegerin meiner Mutter, da so treibt. Nicht dass ich noch auf einen Fünfundachtzigjährigen neidisch werde.
»Opa!« Claudia rollt mit den Augen. »Das ist eklig!«, ergänzt sie noch.
Für junge Menschen scheint die Vorstellung von Sex jenseits der vierzig etwas beinahe Gruseliges zu sein. Geradezu unappetitlich.
»Regt euch ab, aans nur noch dadezu, es hält fit un beweglich, es macht Spaß un es kost nix. Sach mir en Hobby, des ökonomischer is. Un ma ehrlisch, früher konnt isch noch ganz annerster.« Er lacht.
»Claudia, du wolltest uns alles erzählen, mach weiter. Wir hören einfach nur zu, gell, Rudi!«
Er nickt: »Mein Mund ist zu! Obwohl ich jetzt gedanklich grad woannerster war.«
»Also, jedenfalls der Emil kann nur Sex haben, wenn er keinen Stress hat. Und keine Termine. Und momentan haben wir Hausarbeitsphase. Das stresst den Emil total. Da will er keinen Sex. Er sagt, er kann nicht. Aber wir sind doch jung und Sex ist doch auch was, was den Stress mildert, habe ich ihm erklärt. Aber ihr kennt den Emil ja. Der hat seine Prinzipien. Alles zu seiner Zeit, hat er ständig gesagt und mich auf irgendwann vertröstet. Na ja und so kam eins zum anderen. Er war zu Hause wegen dieser Hausarbeit und ich war mit Annabelle, Mama, du kennst sie, die aus meinem Semester, das Feierbiest, im Club. Wir haben gut was getrunken, Wodka und so, und auf einmal war da Luis. Und dann wollte Annabelle nach Hause und ich hatte so gar keine Lust auf den gestressten Emil. Und ich war auch zu betrunken, um noch mit dem Auto nach Hause zu fahren. Da lag es nah, beim Luis zu schlafen, also nicht direkt bei ihm, sondern in einer kleinen Pension in der Nähe vom Club, das hat er mir auch voll nett angeboten. Zu ihm wollte er nicht, er lebt in einer WG. Das wollte er mir nicht zumuten, da gleich auf seine Mitbewohner zu stoßen.«
Irre nett vom Luis, denke ich nur, und so uneigennützig.
»Du bist mit nem Wildfremden in irschendaane Pension, bist du verrückt, du hättste doch dein Opa anrufe könne. Des weißt de doch, du kannst mich immer anrufe. Da hättste bei der Malgo un mir geschlafen. Für dich is immer Platz, Herzscher. Des hätt mords schiefgehe könne.«
Ist es auch, denke ich.
»Da sin schon schlimme Sache bassiert, eijeijei.« Rudi schüttelt den Kopf und gibt Claudia einen leichten Klaps auf den Hinterkopf. »Soll ja des Denkvermösche erhöhn. Eijeijei.« Er kriegt sich gar nicht mehr ein.
»Rudi, lass sie weitererzählen«, greife ich ein, um dann selbst eine Frage hinterherzuschieben: »Was hast du denn dem Emil gesagt, wo du übernachtest?«
»Ich hab ihm eine Nachricht geschickt, dass ich bei der Annabelle schlafe, was Besseres ist mir in meinem Zustand nicht eingefallen.«
»Du hättest doch auch zu uns kommen können!«, werfe ich ein.
»Da hätte ich allerdings sicherlich nicht so viel Spaß gehabt!«, antwortet meine Tochter grinsend.
»Des tät ich auch denke!«, lacht Rudi. Ich bin nicht sicher, ob das alles Grund zum Lachen bietet. »Aber was erzählst de uns denn dadevon. Isch mein, mer sin ja net de Pfarrer und habe aach kein Beichtstuhl und es is ja aach kaan Kapitalverbreche. Des kann ema bassiern. Hauptsache, er hat dir nix Böses getan.« Diesmal streichelt er ihr über den Arm. »Bist halt doch meine Enkelin!«, kann er einen gewissen Stolz nicht verbergen. So als wäre er der Topexperte für One-Night-Stands.
»Na ja, Opa, ich hätte es garantiert nicht als nette Geschichte zum Besten gegeben, wenn da nicht was draus geworden wäre.«
»Ich bin froh, des de den Emil abgeschosse hast, der war nix för dich, mer hat sich ja mitgelangweilt, wenn mer euch mehr als zehn Minute beobachtet hat. Der hat doch kaan Feuer im Arsch. Ich bin schon gespannt uff de Neue. Wie heißt er denn?«
»Also ganz so einfach ist es nicht, Opa, der Emil und ich sind noch zusammen, also bisher, und ich bin schwanger. Aber nicht vom Emil. Sondern vom Luis oder wie auch immer der hieß.«
Jetzt ist selbst Rudi still. Ein seltener Moment im Leben meines Ex-Schwiegervaters. Aber er berappelt sich schnell. »Herzscher, des is doch insgesamt, also von en paar pikante Kleinischkeite ma abgesehe, e herrlische Nachricht. Isch werd Uropa. Des is en Grund, en Sekt oder en Schampus uffzumache, denkst de net, Andrea?«
Diese Euphorie fällt mir schwer, aber eigentlich hat er ja recht. Vor allem in Anbetracht dessen, was ich zuerst dachte. »Ich hole uns Gläser!«, sage ich deshalb und umarme meine Tochter. Gute Miene machen heißt das Motto. »Hase, ich freu mich, das wird schon.«
Sie scheint froh und überrascht darüber zu sein, dass wir ihr keine Standpauke halten. »Danke, ihr seid so lieb, aber ich sitze in der Scheiße. Was soll ich bloß machen? Ich habe es erst vor drei Wochen gemerkt. Und dann war ich in Schockstarre. Ich will es behalten, aber wie soll ich das machen? Ohne Emil? Ohne Mann?«
»Da bist de net die Erste und sischer aach net die Letzte, die en Kind ohne Kerl hat. Net optimal, aber wozu hat mer denn Familie?«
Claudia schaut mich fragend an. Ich nicke und mir schwant, dass dieser Luis nicht nur ihr, sondern auch mein Leben von Grund auf verändern wird.
»Und was schlagt ihr vor, wie soll ich das jetzt regeln?«, erfragt meine Tochter einen Ratschlag.
»Du musst es Emil sagen, lange kannst du es eh nicht mehr verbergen. Und es wäre auch unfair. Bei aller Kritik, das hat er nicht verdient«, antworte ich.
»Kannst du da mitkommen, ich meine, zu dem Gespräch?«, versucht sie die Gunst der Stunde zu nutzen.
»Hör ma, Herzscher, des mit dem Kind hast de aach allein prima geschafft, da musst de des leidä aach allein erledige. Des geht net, des mer da mitgehe. So viel Schneid musst de dann schon selbst uffbringe«, antwortet Rudi und diesmal nicke ich.
»Scheiße«, stöhnt sie und ich kann wieder nur nicken.
Rudi schüttelt den Kopf: »Scheiße tät ich net sache. Es is ja e gute Nachricht, halt mit en paar verzwickte Details. Abä des kriesche mer schon. Un du musst gucke, des de dem Luis Bescheid gebe tust. Der muss ja wisse, dass er en Bobbelsche krischt.«
»Ach, Opa, ich wollte, ich könnte den einfach so finden. Wo soll ich denn suchen. Ich kann mich doch nicht jeden Abend in den Club stellen! Und es ist ja auch megapeinlich. Eine Nacht und dann schwanger! Ich habe ihm morgens noch eine falsche Telefonnummer gegeben. Er kennt nur meinen Vornamen. Er wollte mich wiedersehen, hat er jedenfalls gesagt, aber ich wollte nicht. Ich meine, es war echt gut. Guter Sex. Aber mein Herz ist halt doch beim Emil. Deshalb tut es mir auch megaleid. Obwohl ich mich irgendwie auch freue.« Sie legt sich die Hand auf den Bauch.
»Zeit zum Anstoße!« Rudi hebt sein Glas und wir prosten uns zu.
»Ich trinke keinen Alkohol, ich bin schwanger«, lehnt meine Tochter ab und redet weiter: »Wenn der Emil das hört, ist Schluss. Treue steht bei Emil ganz oben. Das wird den fertigmachen und das tut mir so leid. Ich könnte mich richtig freuen, wenn es von Emil wäre. Das hat er nicht verdient. Ich meine, wir verstehen uns halt echt gut, bis auf das Sexthema.«
»Du musst es ihm doch net sache, isch mein, wenn daan Luis kaan Schwarzer oder en Chines is, dann merkt der des doch gar net«, macht Rudi einen ziemlich unmoralischen Vorschlag.
»Ach, Opa«, kichert meine Tochter, »das habe ich mir auch schon überlegt, aber stell dir mal vor, das Kind braucht später eine Lebendorganspende und dann kommt das raus, weil die Organe nicht kompatibel sind. Außerdem ist Luis rothaarig, das würde Emil bei einem Kind doch überraschen.«
Wie abgebrüht sind die zwei denn? Ich bin sprachlos, auch weil meine Tochter anscheinend auf Rothaarige steht. Das fällt ja fast schon in den Bereich »Special Interest«. »War ein Witz, Mama, das bringe ich nicht. Wäre ja auch echt fies. Ich habe überlegt, ob ich mich einfach trenne und mir eine Wohnung suche, das trifft ihn sicherlich nicht ganz so hart.«
»Nein, Claudia, stopp, keine gute Idee«, interveniere ich, »du wirst auf die lange Strecke kaum drum herumkommen, es ihm zu sagen, die Tatsachen sind ja ziemlich bald offensichtlich. Bring es hinter dich und dann siehst du weiter. Je nachdem, wie er reagiert.«
»Ich hab dann keine Wohnung mehr, ach, was eine Nacht alles bewirken kann«, stöhnt meine Tochter.
»Ei, Herzscher, ich will net indiskret sein, abä warum habt ihr eischentlisch net verhütet, des wär doch die perfekte Lösung gewese. Spaß ohne Reue quasi, gell.«
Dass ich mir die Frage nicht längst gestellt habe!
»Wir hatten Kondome, aber da ist was schiefgegangen. Hat irgendwie nicht gut gesessen. Mehr will ich dazu nicht sagen!«, versucht sie sich an einer Erklärung.
Ehrlich, mehr will ich dazu auch nicht hören. So oder so, rückwirkend kann man eh nicht verhüten.
Rudi allerdings scheint mit dem Thema noch nicht durch zu sein. »Ei warum nimmst de denn net die Pille, des is doch so entspannt, macht die Malgo aach. Da musst de dir net ständisch en Kopp mache.«
Seine Enkelin lacht: »Dass mir mein Opa mal Vorträge zu Sex und Verhütung hält, hätte ich eigentlich für ausgeschlossen gehalten. Das ist verrückt. Aber davon abgesehen: Da du es ja genau wissen willst, wir verhüten, also Emil und ich, mit Diaphragma. Ich will mich nicht mit Hormonen vollhauen.«
»Für diese Debatte scheint es inzwischen ja ein wenig spät«, beende ich diesen Diskussionsstrang, »wann kommt das Baby, mein Enkel und dein Urenkel, oder Enkelin, denn überhaupt?«
»Der Termin ist am 15. November, also ich bin in der 9. Woche.«
Nächste Woche ist Ostern, geht mir durch den Kopf, da hat sie uns und sich ein schönes Überraschungsei ins Nest gelegt. Ich beginne, mich trotz aller Widrigkeiten zu freuen. Dennoch frage ich sie, so neutral wie möglich: »Dann wäre es rein rechtlich noch Zeit für eine Abtreibung.«
»Oh, Gott, nein«, ruft Rudi empört, »en Kind is en Geschenk. Da derf mer gar net dran denke. Da werde mer doch ewig dran knabbern.«
»Vergesst das. Darüber habe ich lange genug nachgedacht. Ich will das Baby behalten, auch wenn es grad nicht besonders gut passt. Und die Umstände auch scheiße sind«, betont Claudia.
Einerseits – andererseits. Ich hätte es mir für meine Tochter rosiger gewünscht. Vati, Mutti, Kind. Das junge Glück in freudiger Erwartung. Aber manchmal fängt eine Geschichte blöd an und hat dann doch ein Happy End. Umgekehrt geht im Übrigen auch. Ich bin froh über ihre Entscheidung, hätte sie aber auch unterstützt, wenn sie anders ausgefallen wäre. Das Abenteuer Oma kann losgehen.
Vor zwei Jahren haben wir die letzten Tage in Palsdorf verbracht. Einem winzig kleinen Dorf mitten in der Pampa. Nächste »Großstadt«: Fulda. Paul, mein Lebensgefährte, hatte dort eine Praxisvertretung übernommen. Meine demente Mutter ist mitsamt ihrer Pflegerin mit uns dorthin gezogen und nach einer Weile schlug auch mein Ex-Schwiegervater Rudi bei uns auf. Gemeinsam mit seinem Hund Willich. Mehrgenerationen-WG der besonderen Art.
Es war nicht leicht, so weit draußen. So neu und so ohne Freunde. Aber kaum hatte ich das Gefühl, mich eingewöhnt zu haben, hatte Kontakte und sogar zarte Freundschaftsbande geschlossen, kam Horst, der Vorgänger von Paul, wieder und wollte zurück in seine Praxis. Für zwei Ärzte erwirtschaftet die Praxis nicht genug und unser Landleben war sowieso ursprünglich nur für ein Jahr gedacht. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass es mir schwerfallen würde, aus Palsdorf wieder wegzugehen. Aber so war es. Ich brauche Zeit, um mich an Neues zu gewöhnen, aber dann bin ich eine sehr anhängliche Person.
Wir haben uns dann entschieden, dahin zu gehen, wo Paul gut arbeiten kann. Als das Angebot kam, in Frankfurt in einer Orthopädiepraxis einzusteigen, war klar: ab in die Mainmetropole. Nur für meine Mutter war das keine Option. In den letzten Wochen in Palsdorf hatte sich ihre Demenz enorm verschlimmert. Sie mitzunehmen, wieder zu verpflanzen, noch dazu in eine Großstadt, keine gute Idee. Letztlich hat meine Mutter selbst die Entscheidung getroffen. »Ich will zu Egbert!«, hat sie deutlich gesagt. Egbert ist eine Jugendliebe meiner Mutter und lebt im Seniorenheim in Fulda.
Wir haben lange gezögert. Besonders ich. Ich wollte keine Tochter sein, die ihre Mutter ins Heim abschiebt. Wollte sie weiter um mich haben. Mich kümmern. In der Theorie. Aber meine Mutter braucht inzwischen Rundumbetreuung. So selbstlos bin ich nicht, das muss ich zugeben. Auch meine Geschwister haben sofort abgewinkt. Das hört sich grauenvoll an, entspricht aber den Tatsachen: Haben wollte sie keiner. Aber mitreden darüber, wo Mama jetzt leben sollte, jeder.
»Sie kennt Egbert, sie verbindet Glück mit ihm, lasst ihr doch den Willen. Und es ist noch nicht mal sehr teuer.« Das war das Argument, das meine Schwester Birgit letztlich überzeugt hat. Stefan, dem Jüngsten von uns dreien, schien es relativ egal zu sein. »Wenn es ihr da gefällt!«, hat er nur gesagt. Gefallen? Ein großes Wort. Ich weiß nicht mehr, was meiner Mutter gefällt. Aber ich merke, an kleinen Gesten und ihrer Mimik, wenn ihr etwas nicht gefällt. Nicht gefallen hat ihr, dass sie die Hühner aus Palsdorf, Haustiere von Horst, die wir betreut haben, nicht mitnehmen durfte. Sie hat sich an Hannelore, ihr Lieblingshuhn geklammert und sehr bestimmt erklärt: »Ohne die gehe ich nirgends hin.« Horst hat den Ausschlag für das Heim gegeben, als er versprochen hat, dass sie Hannelore jederzeit besuchen kann. Audienz bei einem Huhn. Allein die Vorstellung. Ich besuche meine Mutter zweimal die Woche (ohne Huhn) und habe ein permanent mieses Gewissen. Immerhin: Zumeist erkennt sie mich noch. Aber immer häufiger bemerke ich, wie sie überlegen muss. Nicht weiß, ob ich jemand bin, über den sie sich freuen sollte. Neulich hat sie mich kurz gesiezt. Das ist sehr traurig und das Traurigste daran ist das Unaufhaltsame. Stillstand wäre schon ein großer Schritt, aber die Demenz hat Fahrt aufgenommen und nirgends ist eine Bremse in Sicht.
Egbert, ihre große Jugendliebe, lebt auf einem anderen Stockwerk im Heim. Er ist nicht das, was man topfit nennt, aber sein Kopf und Hirn sind klar. Er geht sehr liebevoll mit Mama um und ich muss sagen, das tröstet mich. Zu wissen, da ist jemand nah bei ihr, der sie lieb hat, dem es nicht egal ist, wie es ihr geht. Auch Birgit, meine ältere Schwester, fährt regelmäßig zu Mama. Jedes Mal ruft sie mich danach an und hält mir Vorträge darüber, dass sie später keinesfalls so enden will. Wer will das schon? Mama hat es sich ja auch nicht ausgesucht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer auf seine Wunschliste schreibt: einmal Demenz, bitte! Mit allem Drum und Dran. »Ich hoffe, dass mir jemand den Stecker zieht, wenn es so weit ist!«, ist ein weiterer ihrer Standardsätze. Ihren Mann kann sie damit nicht mehr beauftragen, denn Birgit lebt in Trennung.
Ich hätte nie gedacht, dass sie meinen Schwager Kurt, den Besserwisser und Korinthenkacker, je verlassen würde, aber es geschehen noch Zeichen und Wunder. Es war laut Birgit eine einvernehmliche Trennung, erstaunlicherweise hatte Kurt aber schon knapp vier Wochen später Asyl bei einer anderen gefunden. Blitzakquise könnte man es nennen. Was auch immer der Grund war, sie sollte froh darüber sein. Man merkt, ich habe meinen Schwager nie wirklich gemocht. Auch das Verhältnis zu meiner Schwester war von ihrer Ehe überschattet. Kurt ist der Typ Mann, der sich gerne und ungefragt in alles einmischt. Wäre es nach ihm gegangen, hätten wir meine Mutter schon vor Jahren in ein Heim gesteckt und ihr Haus verkauft.
Inzwischen ist meine Schwester sehr froh, dass wir damals nicht auf sie und ihren Mann gehört haben, denn nach der Trennung ist meine Schwester ins Haus meiner Mutter gezogen. »Wo hätte ich denn hingesollt?«, hat sie nur gesagt und von Verkauf war auf einmal keine Rede mehr. Seltsam, war sie es doch, die gemeinsam mit dem unerträglichen Kurt schon vor Jahren darauf pochte, das Haus zu versilbern.
»Ich zahle was auf Mamas Konto als Miete ein, damit da keine Missstimmung aufkommt«, hat sie meinem Bruder und mir vorgeschlagen. Mitgeteilt trifft es eher. Meine Schwester ist ein Bestimmertyp. Clever ist sie auch. Das, was sie auf Mamas Konto zahlt, bekommt sie im Erbfall ja zu einem Drittel wieder. Aber noch immer habe ich Hemmungen, ihr zu widersprechen. Das ist albern und ich weiß es. Unsere Rollen sind seit unserer Kindheit klar verteilt. Sie sagt, wo es langgeht, und ich dackle hinterher. In diesem Fall habe ich all meinen Mut zusammengenommen und versucht, ihr das auszureden. Vergebens. »Ihr solltet froh sein, dass ich in das Haus ziehe. Ein Haus wird ja nicht besser, wenn niemand drin wohnt. Es sollte also in eurem Sinn sein. Und zu eurer Beruhigung: Wie schon erwähnt, ich zahle eine symbolische Miete, ich will mir schließlich nichts nachsagen lassen.«
Mein kleiner Bruder hat sofort den Schwanz eingezogen und ich habe es nach einer unseligen Diskussion dann auch gelassen. »Wir verkaufen es, wenn Mama tot ist, da habe ich noch ein bisschen Zeit, um ein adäquates Haus zu finden. Außerdem ist dann auch klar, was Kurt an Unterhalt zahlen wird. Und was glaubt ihr, wie der Garten von Mama aussehen würde, wenn ich da nicht drin rumwerkeln würde!«, beendete meine Schwester das Gespräch. Erstaunlich, dass meine Schwester eine Wohnung für sich gar nicht erst in Betracht zieht. Ein adäquates Haus! Standesgemäß eben.
Ihre Kinder sind, genau wie meine, längst aus dem Haus. Ihr Argument: »Ich ziehe nicht aus einem Haus in eine kleine Butze! Dann bin ich ja total frustriert.« Klar hätte ich das Geld vom Erlös des Hauses gut gebrauchen können, aber noch wäre es sowieso das Geld meiner Mutter. Und das Gefühl, dass meine Schwester mal ein bisschen in der Schuld von meinem Bruder und mir steht, ist auch nicht übel. Ab und an kann ich mir kleine Spitzen nicht verkneifen und nenne sie Frau Mieterin. Aber, das muss ich ihr lassen: Sie trägt es mit Fassung und hält es einfach aus, ohne irgendeine Retourkutsche. Und der Garten von Mama sieht wirklich tiptop aus.
Insgesamt hat sich das Verhältnis zu meiner Schwester seit ihrer Trennung von Kurt verbessert. Was vielleicht auch an einem veränderten Kräfteverhältnis liegt. Sie hat was von ihrer Überheblichkeit abgelegt, ist zugänglicher und weicher geworden. Noch immer blitzt ab und an die »alte« Birgit durch, die große, allwissende »Siehste«-Schwester, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg.
Alles in allem gibt es nicht viel Grund für Beschwerden meinerseits. Aber auch nicht viel Grund zum Jubeln. Mit Paul und mir läuft es. Nicht mehr und nicht weniger. Das große Prickeln und der ständige Zauber sind weg. Aber so naiv zu denken, dass das Beginnerhoch ewig hält, bin ich längst nicht mehr. Ein bisschen Realismus tut jeder Beziehung gut. Angeblich jedenfalls. Paul ist der Umzug nach Frankfurt noch schwerer gefallen als mir. Er mochte es in Palsdorf. Nirgendwo wird einem Arzt eine dermaßene Verehrung zuteil wie auf dem Land. Herr Doktor hier, Herr Doktor da. Außerdem: Paul ist ein Mann, der gerne seine Ruhe hat, der es mag, wenn das Leben in geregelten Bahnen dahindümpelt. Keine besonderen Vorkommnisse sind für ihn eine wunderbare Nachricht. Alles soll sein, wie es immer war. Vielleicht ist er einfach ein durch und durch zufriedener Mensch. Oder ein extrem bequemer Mensch.
Ich würde mir mehr Engagement wünschen. Überhaupt mehr. Mehr Aufmerksamkeit, mehr Leidenschaft und weniger Alltag. Es ist ein bisschen wie damals in meiner Ehe, nur dass Paul und ich nicht verheiratet sind. Aber was macht das auf längere Strecke schon für einen Unterschied? Noch würde ich nicht sagen, dass ich unzufrieden bin, aber es nagt etwas in mir. Vielleicht habe ich auch nur Angst, ich könnte wieder dahin kommen, wo ich mit meinem Ex Christoph war. In diese Phase, in der keiner es dem anderen irgendwie recht machen kann. Ich will, dass es mit mir und Paul gut ausgeht. Ich will mit ihm alt werden. Na ja, alt werden schaffe ich auch ziemlich gut allein. Bin schon gut dabei. Ü fünfzig ist alt. Paul hält das für Quatsch. Wir seien im Spätsommer des Lebens. Das wiederum halte ich für ziemlichen Quatsch. Herbst haben wir zumindest.
Paul mag es gemütlich. Entspannt. Stress habe er genug bei der Arbeit. Ich hingegen wünsche mir ab und an eine Auszeit von der Normalität. Gehe ich zu geringschätzig um mit dem, was man Normalität nennt, Alltag? Und habe ich einfach ein permanent pochendes und klagendes Unzufriedenheitsgen, eines, das in mir immer nach »mehr« schreit? Wahrscheinlich – das liest man auch immer wieder in Frauenzeitschriften – liegt das Problem nicht bei Paul, sondern ist Bestandteil meiner Grundausstattung. Ich weiß, dass in der Anfangsphase der Verliebtheit der Körper tsunamiartig mit Hormonen überschwemmt wird. Dauerhaft könnte man diesen Zustand wahrscheinlich nicht aushalten, aber ab und an mal wieder von einer zarten Welle touchiert zu werden, nur ganz sanft, wäre wundervoll. Ich bin mir bewusst, ich jammere auf sehr hohem Niveau. Aber von selbst wird sich der Zustand sicher nicht ändern. Ich werde aktiv werden, nehme ich mir zumindest vor.
Seit wir in der Stadt wohnen, hat sich einiges verändert. Niemand steht einfach so im Garten wie in Palsdorf. In welchem Garten auch? Wir sind froh, dass wir einen kleinen Balkon haben. Am Anfang hatte ich Angst, in der Anonymität zu versinken. Aber die Stadt ist besser als ihr Ruf. Es hat gedauert, aber jetzt habe ich erste neue Freundinnen. Noch sind es eher Bekannte, aber ich kann mir vorstellen, dass das bei ein oder zweien in einer Freundschaft münden wird. Geht halt alles nicht mehr so schnell wie im Kindergarten, wo man morgens beim gemeinsamen Frühstück nach links oder rechts guckt und fragt: Willst du meine Freundin sein?
In drei Wochen etwa bin ich Oma. Mittlerweile habe ich mich an den Gedanken gewöhnt und finde es sehr schön. Außerdem steht es einem nicht auf der Stirn geschrieben. Oma zu werden ist ein Schritt. Eben noch hatte man eine, jetzt ist man eine. Ich hoffe sehr, dass meine Mutter noch begreifen wird, dass sie Uroma ist.
Der letzte Monat war anstrengend. Claudia hat das mit der Schwangerschaft bisher richtig gut gemeistert. Souverän und entspannt. Und das, obwohl sie allein ist. Emil hat die Nachricht von Claudias Schwangerschaft mit Entsetzen aufgenommen. Das sei das Fieseste, was ihm im Leben je passiert wäre, hat er gesagt. Er würde sofort ausziehen und wolle sie in seinem Leben nie wiedersehen. Sein »sofort« war ein wirkliches Sofort. Er hat noch in derselben Stunde seine Sachen gepackt und die gemeinsame Wohnung verlassen. Immerhin hat er ihr die Wohnung überlassen.
»Ich wusste, er wird sehr traurig sein, ich wusste, dass er ein sehr konsequenter Mann ist, aber das hätte ich irgendwie nicht gedacht. Ich habe gehofft, wir könnten das irgendwie regeln!«, hat meine Tochter damals unter Tränen zu mir gesagt.
Gut, dass er nicht begeistert sein würde, war logisch. Aber dieses Handeln hätte auch ich nicht für möglich gehalten. Bei aller Bewunderung für konsequentes Handeln (ich wollte, ich hätte mehr davon) war sein Verhalten auch hart. Und kalt. Fast emotionsfrei. Claudia hat ihn angebettelt und gefleht. »Lass uns reden, bitte!«, hat sie wieder und wieder gesagt, aber seine Antwort war nur: »Was gibt es da noch zu reden. Du hast eine weitreichende Entscheidung getroffen, mit den Folgen musst du jetzt leben.«
Ich finde, das hat sie, unter den Umständen mit dem Umstand, verdammt gut hinbekommen. Aber jetzt, auf den letzten Metern der Schwangerschaft, ist sie dünnhäutig geworden. Sie hat es noch geschafft, ihre Bachelorarbeit zu vollenden, und beschlossen, den Master zu vertagen oder einfach sein zu lassen. Hat eine Schulung zur Visagistin nebenbei gestemmt. Aber seit die Bachelorarbeit abgegeben ist, hadert sie. Hat große Zukunftsängste. Kein Mann, kein Geld und keinen Job. Ich gebe zu, das hört sich nicht wirklich nach einem Grund für Ekstase an.
Immer wieder habe ich sie getröstet. Du hast doch uns, wir werden dir unter die Arme greifen, deine Eltern sind für dich da. In jeder Hinsicht. Ihr Vater, mein Ex, sieht das allerdings ein wenig anders. Er war alles andere als verzückt, als ihm Claudia ihre Schwangerschaft gestanden hat. Dabei könnte er nun wirklich entspannt sein im fernen Hamburg. Als Babysitter kommt er da von vorneherein nicht infrage.
»Sie verbaut sich ihre gesamte Zukunft!«, hat er am Telefon gestöhnt, als wir über »die doofe Sache«, wie er es nennt, geredet haben.
»Sie ist keine sechzehn Jahre mehr und das haben auch schon andere geschafft«, habe ich immer wieder betont.
Ich glaube, dass sein Problem eigentlich weniger die Schwangerschaft unserer Tochter ist, sondern das, was sie aus ihm macht. Einen Opa. Eine Rolle, in der er sich noch weniger sieht als ich mich in der Omarolle. Ich weiß, dass er und seine Neu-Ehefrau seit Längerem versuchen, Nachwuchs zu zeugen, und jetzt wird er, statt Vater zu werden, Opa.
»Wie soll das alles gehen, Andrea?«, hat er ziemlich streng gefragt, fast so, als wäre ich die Schwangere.
»Keine Ahnung, aber wir sollten sie mit all unseren Kräften unterstützen. Es langt völlig, wenn du einfach deine Brieftasche sehr weit aufmachst und ihr nicht das Gefühl gibst, sie hätte totalen Scheiß gebaut.«
»Hat sie aber, das musst du wohl zugeben!«, antwortet er nur und stöhnt, »sie bekommt ja, genau wie ihr Bruder, schon Geld von mir. Irgendwo habe auch ich ein Limit. Ich meine, ich kann doch nicht all meine Einkünfte nur für meine schon ziemlich erwachsenen Kinder raushauen.« Er war schon immer ein Sparbrötchen. Christoph, mein Ex, ist inzwischen Partner in einer großen internationalen Kanzlei und lebt mit seiner Gattin Annika Luisa, genannt Lu, in einer riesigen, beige-weiß durchgestylten Wohnung. Allein ein Paar seiner Pferdelederschuhe kostet mehr, als er für die Kinder im Monat bezahlt.
Als ich ihn ein wenig spitz genau daran erinnere, wird er sauer: »Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, Andrea. Wir haben unsere Kinder dazu erzogen, dass Handeln Konsequenzen hat. Das hat sie sich nun selbst eingebrockt. Und ich kann mit meinem Geld machen, was ich will.«
»Soll sie mit dem Baby auf der Straße leben, nur weil ihr Vater hartnäckig seinen Erziehungsstil durchhalten will?«, hake ich nach.
»Ach, Andrea! Was soll das denn?«, ist seine Antwort.
»Beweg deinen Hintern von Hamburg hier runter und wir reden zu dritt, wie wir das gemeinsam stemmen können!«, lautet mein Vorschlag und ich finde mich ausgesprochen vernünftig und erwachsen.
Genau das hat er dann auch gemacht. Als er Claudia mit ihrem niedlichen Schwangerenbauch gesehen hat, ist was vom alten Christoph durchgesickert. Man konnte zusehen, wie er weicher wurde. Ein schöner Anblick. Seit Langem habe ich mich ihm nicht mehr so nah gefühlt. So verbunden. Wir haben sehr lange geredet und er hat immer wieder versonnen Claudias Bauch gestreichelt. So wie damals meinen. Ich glaube, es war ein richtiges Déjà-vu für uns beide. Das Ende vom Lied: Er überweist ihr tausend Euro im Monat und ich fünfhundert, dafür greife ich ihr einfach praktisch mehr unter die Arme.
»Ich hoffe, dass es nicht für immer sein wird!«, sagt er zum Abschied und verspricht, zur Geburt herzukommen. Es scheint ihm gut zu gehen. Er wirkt glücklich. Ich gönne es ihm. Trotzdem ist es immer wieder seltsam, uns so zu erleben. Es ist eine Art von Flashback. Er ist im Kern doch ein absolut netter Mann. Ich frage mich noch heute, Jahre nach unserer Trennung, wie wir es geschafft haben, es so zu verkacken. Anders kann man es nicht nennen. Immerhin sind wir in der Lage, miteinander zu kommunizieren. Wenn auch nicht immer besonders gut. Trotzdem packt mich bei seinem Anblick jedes Mal Wehmut. Vielleicht hätten wir es schaffen können. Vielleicht hätten wir uns mehr mühen müssen. Vielleicht. Aber jetzt ist es eben, wie es ist.
Und wäre das nicht passiert, hätte ich auch Paul nie in mein Leben gelassen. Ich sehe Christoph und vergleiche ihn unwillkürlich mit Paul. Mein Paul. Wie anders er ist. Christoph ist ein Mann, dem Status wichtig ist. Aussehen. Stil. Die Meinung anderer. Das alles gibt Paul nichts. Er ist zufrieden mit dem, was er hat. Man könnte es mangelnden Ehrgeiz nennen oder auch, freundlicher formuliert, innere Zufriedenheit.
Der Christoph von heute wäre kein Mann mehr für mich. Ich bin keine Frau, die auf so was wie Einstecktücher abfährt. Ich würde mich freuen, wenn Paul ein wenig mehr Sinn für Klamotten hätte, aber lieber zu wenig als zu viel. Christoph sieht aus, als hätte er in einem teuren Laden gesagt: Einmal von allem, bitte. Es hat etwas von einer Komplettinszenierung, wirkt inzwischen austauschbar. Da ist mir Pauls Lässiglook lieber. Vor allem weil dahinter keine Absicht steckt. Christoph sieht man an, dass er mit seinem Style etwas ausdrücken will. Seine Klamotten rufen: »Ich gehöre dazu.« Ich weiß nicht, ob er immer so war oder so geworden ist. Aber es spielt auch keine Rolle mehr.
»Ich würde dir und Paul gerne endlich meine Lu vorstellen, irgendwann, vielleicht wenn das Baby da ist?«, sagt er noch, als er schon fast zur Haustür raus ist. »Ich meine, sie ist jetzt meine Frau und da wird es doch wirklich Zeit!«
»Gerne! Ich freue mich darauf!«, antworte ich und meine es auch so. Obwohl mich der Gedanke natürlich sofort in eine Art Wettbewerb treibt. Sie ist jünger, besser in Form und sicherlich auch, abgesehen vom Jugendvorteil, sehr viel attraktiver. Ich hätte immer gedacht, dass dieses ewige Vergleichen, diese Konkurrenz, irgendwann einfach aufhört oder wenigstens im Alter stark abgemildert wird, aber nein.




























