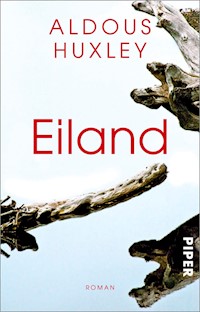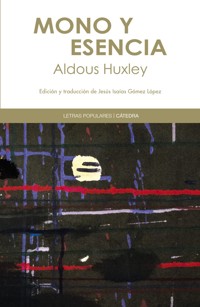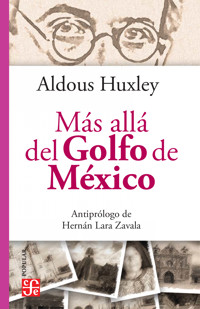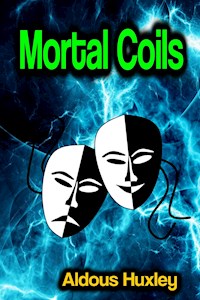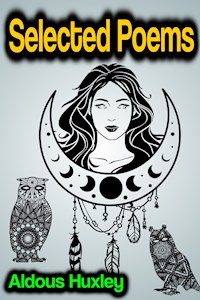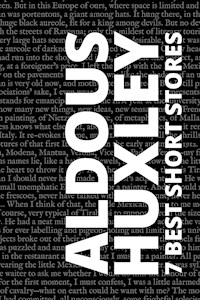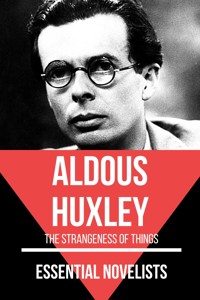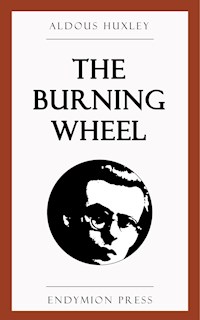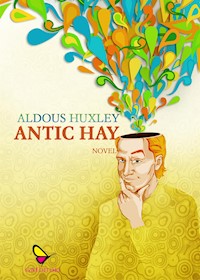9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Affe und Wesen« ist eine Satire, eine moralische Fabel und ein prophetischer Albtraum. Geschrieben in der Form eines Drehbuchs, schildert der Roman das Leben in Kalifornien, hundertfünfzig Jahre nach einem Atomkrieg. Ein Wissenschaftler aus dem verschont gebliebenen Neuseeland, Mitglied einer Expedition zur Wiederentdeckung Amerikas, beschreibt die entsetzliche Hinterlassenschaft des Atom- und Bakterienkrieges. Der Mensch ist zu einem äffischen Wesen pervertiert und hat einen Teufelsstaat errichtet, in dem Belial angebetet wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
I
Tallis
Es war der Tag der Ermordung Gandhis. Aber auf dem Berg Golgatha interessierten sich die Touristen mehr für den Inhalt ihrer Picknickkörbe als für die mögliche Bedeutung eines im Grunde doch recht alltäglichen Ereignisses, um dessentwillen sie hergekommen waren. Da mochten die Astronomen sagen, was sie wollten, Ptolemäus hatte vollkommen recht: Der Mittelpunkt der Welt ist immer da, wo wir sind. Gandhi war tot, aber Bob Briggs sprach, an seinem Schreibtisch im Büro wie beim Lunch in der Studio-Kantine, immer nur von sich selbst.
»Du bist mir stets eine große Hilfe gewesen«, versicherte mir Bob, als er, nicht ohne Behagen, daran ging, mir die bisher letzte Fortsetzung seiner Lebensgeschichte zu erzählen.
Im Grunde aber wollte Bob, wie ich sehr wohl und er selbst noch besser wusste, gar keine Hilfe. Er genoss eine verfahrene Situation, und noch glücklicher machte es ihn, über seine missliche Lage sprechen zu können. Seine Schwierigkeiten und ihre verbale Dramatisierung erlaubten ihm, in sich selbst den Inbegriff aller romantischen Dichter zu sehen: Beddoes, den Selbstmörder, Byron, den Blutschänder, Keats, der an seiner Liebe zu Fanny Brawne, und Harriet, die um Shelleys willen starb. Und daher konnte er für kurze Zeit die beiden wichtigsten Ursachen seines Unglücks vergessen – nämlich dass er über keines der Talente dieser Leute und nur über einen Bruchteil ihrer sexuellen Potenz verfügte.
»Wir waren an einen Punkt gelangt«, sagte er (und das mit so tragischer Stimme, dass mir der Gedanke kam, er wäre als Schauspieler erfolgreicher gewesen denn als Verfasser von Drehbüchern), »wir waren an einen Punkt gelangt, wo wir, Elaine und ich, wie … wie Martin Luther empfanden.«
»Wie Martin Luther?«, fragte ich, nicht ohne Verwunderung.
»Du weißt doch – Ich kann nicht anders. Wir konnten einfach nicht anders, als zusammen nach Acapulco durchbrennen.«
Und Gandhi, dachte ich, konnte nicht anders als gegen die Unterdrückung gewaltlosen Widerstand leisten, sich einsperren und am Ende erschießen lassen.
»So standen also die Dinge«, fuhr er fort. »Wir setzten uns in ein Flugzeug und flogen nach Acapulco.«
»Endlich!«
»Was meinst du mit ›endlich‹?«
»Du hattest es dir doch schon lange überlegt, nicht wahr?«
Bob sah ärgerlich aus. Aber ich erinnerte mich an all die früheren Gelegenheiten, bei denen er mit mir über sein Problem gesprochen hatte. Sollte er – oder sollte er nicht – Elaine zu seiner Geliebten machen? (Das war seine bezaubernd altmodische Art, es zu formulieren.) Sollte er – oder sollte er nicht – Miriam um die Scheidung bitten?
Es wäre die Scheidung von der Frau, die in einem sehr konkreten Sinne geblieben war, was sie von jeher gewesen war – seine einzige Liebe. Doch in einem ebenso konkreten Sinn war auch Elaine seine einzige Liebe – und würde es noch mehr sein, wenn er sich endlich entschloss (und eben darum fiel ihm der Entschluss so schwer), »sie zu seiner Geliebten zu machen«. Sein oder Nichtsein – der Monolog hatte sich nahezu über zwei Jahre hingezogen, und wenn es nach Bob gegangen wäre, hätte es noch zehn Jahre so weitergehen können. Er mochte es, wenn seine Schwierigkeiten chronisch und überwiegend verbaler Natur waren, keinesfalls so eindeutig fleischlich, dass sie seine zweifelhafte Männlichkeit einem weiteren peinlichen Test unterwerfen könnten. Doch unter dem Eindruck seiner Beredsamkeit, des barocken Profils und des von der Zeit schneeweiß gewordenen Haars war Elaine offensichtlich einer nur chronischen und sich platonisch äußernden Problematik überdrüssig geworden. Bob sah sich einem Ultimatum gegenüber: entweder Acapulco oder ein vollständiger Bruch.
So stand es um ihn – verpflichtet und verdammt zum Ehebruch, so unwiderruflich, wie sich Gandhi verpflichtet und verdammt gefühlt hatte zum gewaltlosen Widerstand, zum Gang ins Gefängnis und zum Tod durch Mörderhand, nur vermutlich mit mehr und mit dunkleren Vorahnungen. Vorahnungen, wie sie die Ereignisse dann vollkommen gerechtfertigt hatten. Denn wenn mir auch der arme Bob nicht genau erzählte, was in Acapulco passiert war, so verriet doch der Umstand, dass Elaine sich jetzt, wie er es ausdrückte, »sonderbar benahm« und verschiedentlich in Gesellschaft dieses unsäglichen Balkanbarons zu sehen war, dessen Namen ich glücklicherweise vergessen habe, die ganze lächerliche und klägliche Geschichte. Miriam hatte sich unterdessen nicht nur geweigert, in eine Scheidung einzuwilligen, sondern hatte auch die Abwesenheit Bobs und eine Vollmacht von ihm dazu benutzt, die Ranch, die beiden Wagen, die vier Apartmenthäuser, die Eckgrundstücke in Palm Springs sowie sämtliche Wertpapiere auf sich überschreiben zu lassen. Er dagegen schuldete inzwischen dem Finanzamt dreiunddreißigtausend Dollar Einkommensteuer. Doch wenn er seinen Produzenten an diese zweihundertfünfzig Dollar mehr in der Woche erinnerte, die ihm doch schon so gut wie versprochen waren, folgte nur ein langes, beredtes Schweigen.
»Nun, wie steht es damit, Lou?«
Worauf Lou Lublin mit feierlichem Nachdruck seine Antwort gab.
»Bob«, sagte er, »in diesem Filmstudio würde in diesem Augenblick selbst Jesus Christus keine Gehaltserhöhung bekommen.«
Der Ton war freundlich. Aber als Bob hartnäckig blieb, schlug Lou mit der Faust auf den Tisch und erklärte ihm, sein Verhalten sei unamerikanisch. Damit war der Fall erledigt.
Bob fuhr fort zu reden, während ich bedachte, welch ein Motiv doch hier für ein großes religiöses Gemälde vorlag! Christus vor Lublin, wie er um eine Gehaltsaufbesserung von zweihundertfünfzig Dollar die Woche bittet, und wie ihm diese Bitte rundweg abgeschlagen wird. Ein Sujet, wie es Rembrandt geliebt hätte, als Zeichnung, Radierung, Gemälde, immer und immer wieder. Christus, wie er sich traurig abwendet, in die Dunkelheit einer unbezahlten Einkommensteuer hinein, während Lou im goldenen Scheinwerferlicht, funkelnd von Edelsteinen und metallischen Glanzlichtern und mit einem gewaltigen Turban auf dem Haupt triumphierend in sich hineinlacht im Gedanken an das, was er dem Schmerzensmann angetan hat.
Dann die Breughelsche Version des Themas. Mit einer allumfassenden Ansicht des ganzen Studios, ein Drei-Millionen-Dollar-Musical mitten bei den Dreharbeiten, mit getreuer Wiedergabe aller technischen Einzelheiten; zwei- bis dreitausend Gestalten, jede einzelne vollkommen ausgearbeitet; und in der rechten unteren Ecke würde man nach langem Suchen einen Lublin entdecken, nicht größer als eine Heuschrecke, der einen noch kleineren Christus mit Schimpf und Hohn überschüttet.
»Aber ich habe da eine fantastische Idee zu einem neuen Stoff gehabt«, sagte Bob mit dem optimistischen Enthusiasmus, der die Alternative des Verzweifelten zum Selbstmord ist. »Mein Agent ist ganz verrückt danach. Er meint, ich könnte dafür fünfzig- oder sechzigtausend Dollar bekommen.«
Er begann mir die Story zu erzählen.
Mit meinen Gedanken noch immer bei Christus vor Lublin, stellte ich mir die Szene vor, wie sie Piero della Francesca gemalt hätte – eine Komposition von leuchtender Bestimmtheit, mit einer ausbalancierten Verteilung der Gewichte, in harmonisierenden und kontrastierenden Farbtönen. Die Figuren voll unerschütterlicher Gelassenheit. Lou und seine Regieassistenten würden ohne Ausnahme diese pharaonischen Kopfbedeckungen tragen, diese gewaltigen umgekehrten Kegelstümpfe aus weißem oder farbigem Filz, die bei Piero dem doppelten Zweck dienen, die massiv-geometrische Beschaffenheit des menschlichen Körpers und zugleich die Exotik von Orientalen zu betonen. Ungeachtet ihrer seidigen Weichheit hätten die Falten der Gewänder die Unausweichlichkeit und Präzision einer in Porphyr gemeißelten Logik; und in allem und jedem wäre die alles durchdringende Gegenwart jenes Gottes zu spüren, von dem Platon sprach und der für immer das Chaos mittels der Mathematik in die Ordnung und Schönheit der Kunst überführte.
Aber vom Parthenon und dem Timaios führt eine Scheinlogik zu der Tyrannei, die im Staat als die ideale Regierungsform ausgegeben wird. In der Politik ist das Äquivalent zu einem Lehrsatz eine durch und durch disziplinierte Armee, und das zu einem Sonett oder einem Gemälde ein Polizeistaat unter einer Diktatur. Die Marxisten nennen sich wissenschaftlich, und die Faschisten fügen demselben Anspruch einen weiteren hinzu: Sie sind die Dichter – die wissenschaftlichen Dichter – einer neuen Mythologie. Die einen wie die anderen haben mit ihrem Anspruch recht, denn beide wenden auf menschliche Situationen die zuvor im Laboratorium und im Elfenbeinturm erprobten Verfahren an. Sie simplifizieren, sie abstrahieren, sie eliminieren alles, was für ihre Zwecke ohne Belang ist, und sie ignorieren alles, was sie für unerheblich zu halten belieben. Sie verordnen einen Stil; sie nötigen die Tatsachen, eine bestimmte, bevorzugte Hypothese zu bestätigen, und sie werfen alles in den Papierkorb, was nach ihrer Meinung noch nicht den Grad der Vollkommenheit erreicht hat. Und weil sie sich somit wie gute Künstler, wie tüchtige Denker und erfahrene Experimentatoren verhalten, sind denn auch ihre Gefängnisse voll, finden politische Ketzer den Tod durch Sklavenarbeit, werden die Rechte und Neigungen des Individuums missachtet, die Gandhis ermordet, während Hunderttausende von Lehrern und Rundfunksprechern vom Morgen bis Mitternacht die Unfehlbarkeit der Bonzen verkünden, die sich gerade an der Macht befinden.
»Schließlich sehe ich keinen Grund«, hörte ich Bob sagen, »warum ein Film kein Kunstwerk sein sollte. Nur dieser verfluchte Kommerzialismus –«
Er sprach mit dem ganzen rechtschaffenen Zorn des unbegabten Künstlers, der einen Sündenbock gefunden hat, dem er die Schuld an den bedauerlichen Folgen seiner eigenen Talentlosigkeit geben kann.
»Glaubst du, dass Gandhi sich für Kunst interessiert hat?«, fragte ich.
»Gandhi? Nein, natürlich nicht.«
»Ich glaube, du hast recht«, sagte ich. »Weder für Kunst noch für die Wissenschaften. Und das ist der Grund, warum wir ihn getötet haben.«
»Wir?«
»Ja, wir. Die Intelligenten, die Aktiven, die Fortschrittlichen, die Anhänger von Ordnung und Perfektion. Während Gandhi ein Reaktionär war, der nur an Menschen glaubte. An schmutzige kleine Individuen, die sich, jedes Dorf für sich, selbst regieren, die das Brahma verehren, das zugleich der Atman ist. Es war unerträglich. Kein Wunder, dass wir ihn umgelegt haben.«
Aber in demselben Augenblick, in dem ich diese Worte sprach, überlegte ich, dass dies nicht die ganze Wahrheit sei. Denn die schloss einen inneren Widerspruch, fast einen Verrat ein. Dieser Mann, der nur an Menschen glaubte, hatte sich in den menschenunwürdigen Massenwahn des Nationalismus hineinziehen lassen und die angeblich übermenschlichen, tatsächlich aber teuflischen Institutionen des Nationalstaats akzeptiert. Er hatte sich auf diese Dinge eingelassen in der Meinung, er vermöchte den Wahnsinn alsbald wieder abzuschwächen und alles, was am Staat des Teufels war, in so etwas wie Menschlichkeit zu verwandeln. Doch der Nationalismus und die Machtpolitik hatten sich als zu mächtig für ihn erwiesen. Nicht vom Zentrum her, nicht vom Innern der Organisation aus kann der Heilige unsere staatlich kontrollierte Schizophrenie heilen, sondern nur von außen, von der Peripherie her. Sobald er sich selbst zu einem Teil des Mechanismus macht, in welchem der kollektive Wahnsinn Gestalt annimmt, tritt zwangsläufig von zwei möglichen Entwicklungen die eine oder die andere ein. Entweder er bleibt er selbst; in diesem Fall wird ihn der Apparat so lange wie möglich benutzen und ihn in dem Augenblick, in dem er nutzlos geworden ist, abstoßen oder vernichten. Oder er gleicht sich dem Mechanismus an, mit dem und zugleich gegen den er kämpft, und in diesem Fall werden wir eine Heilige Inquisition und Bündnisse mit jedem Tyrannen erleben, der ihm, dem Heiligen, die ihm zukommenden Privilegien nicht streitig macht.
»Aber um auf ihren ekelhaften Kommerzialismus zurückzukommen«, fuhr Bob endlich fort, »möchte ich dir ein Beispiel nennen –«
Ich aber musste daran denken, dass der Traum von Ordnung die Tyrannei gebiert und der Traum von Schönheit Ungeheuer und Gewalt. Athene, die Schutzgöttin der Künste, ist auch die der wissenschaftlichen Kriegführung und der himmlische Chef eines jeden Generalstabs. Wir haben Gandhi umgebracht, weil er, nachdem er eine kurze Zeit (und in tragischer Weise) das Spiel der Politik mitgespielt hatte, sich weigerte, noch länger unseren Traum von einer nationalen Ordnung zu träumen, von einer sozialen und ökonomischen Harmonie, und weil er versuchte, uns wieder an die konkreten und kosmischen Tatsachen wirklicher Menschen und des inneren Lichts heranzuführen.
Die Schlagzeilen, die ich an diesem Morgen gelesen hatte, erinnerten an Parabeln; das Ereignis, von dem sie berichteten, hatte etwas von Gleichnis und Prophezeiung. Mit diesem symbolischen Akt hatten wir, die wir uns nach Frieden sehnten, den einzig möglichen Weg zum Frieden verworfen und jedem eine Warnung erteilt, der in Zukunft eine andere Politik verfolgen könnte als die, welche unvermeidlich zum Kriege führt.
»Wenn du mit deinem Kaffee fertig bist, können wir gehen«, sagte Bob.
Wir standen auf und traten in den Sonnenschein hinaus. Bob nahm meinen Arm und drückte ihn.
»Du hast mir sehr, sehr geholfen«, beteuerte er noch einmal.
»Ich würde es nur zu gern glauben, Bob.«
»Aber es ist die reine Wahrheit.«
Vielleicht war es sogar die Wahrheit, nämlich in dem Sinne, dass es ihm wohltat, seine Schwierigkeiten vor einem anteilnehmenden Publikum auszubreiten. Er fühlte sich dann den Romantikern näher.
Eine Weile gingen wir schweigend nebeneinander her – an den Vorführräumen vorbei, zwischen den Reihen der pompös bizarren Bungalows der leitenden Angestellten hindurch. Über der Tür des größten Bungalows war eine Bronzetafel mit der Inschrift LOU LUBLIN PRODUCTIONS angebracht.
»Wie steht es mit der Gehaltserhöhung?«, fragte ich. »Sollen wir hineingehen und einen neuen Versuch machen?«
Aber Bob ließ nur ein zaghaftes kurzes Lachen hören, und darauf folgte wieder Schweigen. Als er schließlich sprach, klang es nachdenklich.
»Zu traurig, das mit dem alten Gandhi«, sagte er. »Ich glaube, sein großes Geheimnis war, dass er nichts für sich selbst gewollt hat.«
»Ja, ich glaube, das war eines seiner Geheimnisse.«
»Ich wünsche bei Gott, dass ich nicht so begehrlich wäre.«
»Ich auch«, pflichtete ich ihm voller Überzeugung bei.
»Und wenn man am Ende bekommt, was man sich gewünscht hat, dann ist es immer anders, als man es sich vorgestellt hatte.«
Bob seufzte und verfiel wieder in Schweigen. Gewiss dachte er jetzt an Acapulco und an die furchtbare Notwendigkeit, vom Chronischen zum Akuten überzugehen und vom Unbestimmt-Verbalen zum nur allzu bestimmten und konkreten Fleischlichen.
Wir ließen die Direktorenbungalows hinter uns, überquerten einen Parkplatz und betraten eine Straßenschlucht, die von Tonfilmateliers gesäumt war. Ein Traktor fuhr an uns vorbei; auf dem niedrigen Anhänger stand die untere Hälfte des Westportals einer italienischen Kathedrale aus dem 13. Jahrhundert.
»Das ist für ›Katharina von Siena‹.«
»Was ist das?«
»Hedda Boddys neuester Film. Ich habe vor zwei Jahren an dem Drehbuch gearbeitet. Dann bekam es Streicher. Anschließend wurde es von dem O’Toole-Menendez-Boguslavsky-Team völlig überarbéitet. Es ist miserabel geworden.«
Ein zweiter Anhänger ratterte an uns vorüber, der die obere Hälfte des Portals und eine Kanzel von Niccolò Pisano transportierte.
»Wenn man es sich überlegt«, sagte ich, »ist sie in vieler Hinsicht Gandhi sehr ähnlich.«
»Wer? Hedda?«
»Nein, Katharina.«
»Ach so. Ich dachte, du sprichst von dem Lendenschurz.«
»Ich meine die Heiligen in der Politik«, sagte ich. »Man hat Katharina zwar nicht gelyncht, aber nur deshalb, weil sie zu jung gestorben ist. Die Konsequenzen ihrer Politik hatten sich noch nicht zeigen können. Gehst du in deinem Drehbuch auf diese Dinge ein?«
Bob schüttelte den Kopf.
»Es wäre zu traurig«, sagte er. »Das Publikum will seine Stars erfolgreich sehen. Außerdem: Wie kann man über Kirchenpolitik sprechen? Es würde bestimmt antikatholisch und leicht auch noch unamerikanisch werden. Nein, wir gehen kein Risiko ein – wir konzentrieren uns auf den jungen Mann, dem sie ihre Briefe diktierte. Er ist leidenschaftlich verliebt – aber alles ist sehr spirituell und sublimiert, und nach ihrem Tod wird er Einsiedler und betet vor ihrem Bild. Dann gibt es da noch einen anderen jungen Mann, der ihr gegenüber zudringlich wurde. Es steht in ihren Briefen. Da holen wir natürlich alles raus. Die haben noch immer die Hoffnung, Humphrey engagieren zu können …«
Lautes Hupen ließ uns zusammenfahren.
»Vorsicht!«
Bob packte mich am Arm und zog mich zur Seite. Aus dem Hof hinter dem Archiv für Drehbücher kam ein Zweitonner auf die Straße.
»Können Sie nicht aufpassen?«, brüllte der Fahrer im Vorbeifahren.
»Idiot!«, brüllte Bob zurück. Dann wandte er sich an mich. »Hast du die Ladung gesehen?«, fragte er. »Drehbücher.« Er schüttelte den Kopf. »Die kommen in die Verbrennungsanlage. Wohin sie auch gehören. Literatur im Wert von einer Million Dollar.«
Aus seinem Lachen klang pathetische Bitterkeit.
Nach etwa zwanzig Metern bog der Lastwagen scharf rechts ein. Er musste wohl mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein, denn ein gutes halbes Dutzend der zuoberst liegenden Manuskripte wurde zentrifugal auf die Straße geschleudert. Gleich Gefangenen der Inquisition, dachte ich, die auf dem Weg zum Scheiterhaufen wie durch ein Wunder entkommen.
»Der Mann kann ja nicht fahren«, schimpfte Bob. »Wenn er so weitermacht, bringt er noch mal jemanden um.«
»Aber bis es so weit kommt, wollen wir mal sehen, wer sich da gerettet hat.«
Ich hob das mir zunächst liegende Skript auf.
»›Ein Mädchen ist so gut wie ein Mann‹, Drehbuch von Albertine Krebs.« Bob erinnerte sich daran. Es war hundsmiserabel.
»Aber was ist mit ›Amanda‹?«, fragte ich und blätterte die ersten Seiten durch. »Es muss wohl ein Musical sein. Hier kommen Verse vor:
Amelia braucht etwas zu essen,
Amanda ist auf einen Mann versessen –«
Bob wollte mich nicht weiterlesen lassen.
»Hör auf, ich bitte dich! Es hat vier und eine halbe Million während der Ardennenschlacht eingespielt.«
Ich ließ »Amanda« fallen und hob ein anderes der Drehbücher auf, die da aufgeschlagen herumlagen. Mir fiel auf, dass es nicht in das sonst im Filmstudio übliche Rot, sondern in Grün gebunden war.
»›Affe und Wesen‹«, las ich vom Buchdeckel ab. Der Titel war mit der Hand geschrieben.
»›Affe und Wesen‹?«, wiederholte Bob fragend und ein wenig überrascht.
Ich schlug das Vorsatzblatt auf.
»›Original-Treatment von William Tallis, Cottonwood Ranch, Murcia, Kalifornien.‹ Und hier steht eine Bleistiftnotiz. ›Ablehnungsbescheid am 11.6.47 abgegangen. Da kein frankierter Umschlag mitgesandt, Verbrennungsanlage‹ – dies zweimal unterstrichen.«
»Sie bekommen Tausende von solchen Manuskripten«, erklärte Bob.
Ich blätterte indessen weiter in dem Manuskript.
»Schon wieder Verse.«
»Um Himmels willen!«, sagte Bob angewidert.
»›Das liegt doch auf der Hand‹«, begann ich vorzulesen:
»›Das liegt doch auf der Hand.
Weiß es nicht jeder Schuljunge?
Das Ziel bestimmt der Affe; nur den Weg wählt der Mensch.
Babuins Kuppler, Schatzmeister der Paviane,
Eilt die Vernunft herbei, eifrig bedacht zu ratifizieren;
Kommt, eine Vogelscheuche mit der Philosophie und schmeichelt Tyrannen;
Kommt, ein Kuppler für Preußen, mit Hegels Patentgeschichte;
Kommt, mit der Medizin, mit dem Aphrodisiakum des Affenkönigs;
Kommt, mit Reimen und Rhetorik, um ihm seine Reden zu schreiben;
Kommt, mit ballistischen Berechnungen, um die Raketen in Stellung zu bringen
Genau auf das Waisenhaus jenseits des Atlantiks gerichtet;
Kommt, nachdem das Ziel anvisiert, mit Weihrauch für Unsere Liebe Frau,
Sie inständig um einen Volltreffer zu bitten.‹«
In dem Schweigen, das darauf folgte, blickten wir uns fragend an.
»Was hältst du davon?«, wollte Bob schließlich wissen.
Ich zuckte nur die Achseln. Ich wusste es auch nicht.
»Wirf es jedenfalls nicht weg«, sagte er. »Ich möchte gern sehen, wie es weitergeht.«
Wir setzten unseren Weg wieder fort, bogen noch einmal um eine Ecke, und da lag nun, ein Franziskanerkloster inmitten von Palmen, das Haus der Autoren.
»Tallis«, sagte Bob vor sich hin, als wir eintraten, »William Tallis …« Kopfschüttelnd stellte er fest: »Nie von ihm gehört. Übrigens, wo liegt Murcia?«
Diese Frage konnten wir uns am folgenden Sonntag beantworten. Da wussten wir es nicht nur theoretisch, wo auf der Landkarte es zu finden ist, sondern aus eigener Erfahrung, als wir, mit hundertdreißig Kilometern in der Stunde, in Bobs (genauer gesagt, in Miriams) Buick-Kabriolett hinausfuhren. Murcia, Kalifornien, bestand aus zwei roten Zapfsäulen und einer sehr kleinen Lebensmittelhandlung und lag am Südwestrand der Mojavewüste.
Zwei Tage zuvor war eine lange Dürreperiode zu Ende gegangen. Der Himmel war noch bedeckt, und vom Westen wehte stetig ein kalter Wind. Unter dem schieferfarbenen Wolkendach stand das Gebirge von San Gabriel geisterhaft weiß im frisch gefallenen Schnee. Aber nach Norden zu, weit draußen in der Wüste, schien die Sonne und bildete einen langen schmalen Streifen goldenen Lichts. Um uns herum waren die weichen satten Grau- und Silbertöne, das blasse Gold und Rostbraun der Wüstenvegetation – Beifuß, Eselsstrauch, Büschelgras und Buchweizen und hier und da ein sonderbar gestikulierender Baum, eine Agavenart, mit rauer Borke oder trockenen Dornen überzogen und am Ende seiner durch manche Ellbogen gegliederten Arme mit dicken Büscheln grüner, metallischer Stacheln bewehrt: der Josua-Baum.
Der alte schwerhörige Mann, dem wir unsere Fragen brüllend stellen mussten, verstand endlich, wovon wir sprachen. Die Cottonwood Ranch – selbstverständlich kannte er sie. Da den Weg entlang, eine Meile weiter in Richtung Süden, dann nach Westen abbiegen und dem Bewässerungsgraben eine dreiviertel Meile weit folgen. Da war es. Der Mann wollte uns noch mehr über die Ranch erzählen, aber Bob hatte nicht die Geduld, ihm zuzuhören. Er warf den Motor an, und wir fuhren los.
Die Pappeln und Weiden längs des Bewässerungsgrabens waren inmitten dieser rauen, ja asketischen Wüstenflora gleichsam Exoten, die sich, zäh und gefährdet, an eine andere, leichtere und üppigere Daseinsform klammerten. Jetzt trugen sie kein Laub. Weiß vor dem Hintergrund des Himmels, waren sie nur Baumskelette; aber man konnte sich vorstellen, wie kräftig in drei Monaten unter den Strahlen einer glühenden, von keiner Wolke verhüllten Sonne das Grün der jungen Blätter sein würde.
Der Wagen, von Bob zu schnell gefahren, krachte schwer in eine unvermutete Bodensenke. Bob fluchte.
»Wie jemand, der bei klarem Verstand ist, darauf verfallen kann, am Ende einer solchen Straße zu wohnen, ist mir unbegreiflich.«
»Vielleicht fährt er auf ihr nicht mit diesem Tempo«, wagte ich anzudeuten.
Bob würdigte mich keines Blickes. Mit unverminderter Geschwindigkeit ging es weiter. Ich versuchte mich auf die Aussicht zu konzentrieren.
Dort draußen hatte auf dem Boden der Wüste eine geräuschlose, und doch fast explosive Verwandlung stattgefunden. Die Wolken hatten sich verzogen, und die Sonne schien jetzt auf die vordersten steilen und schroffen Kuppen, die rätselhaft, gleich Inseln, aus der unendlichen Ebene aufragten. Noch einen Augenblick zuvor waren sie schwarz und wie erloschen gewesen. Nun waren sie plötzlich zu Leben erwacht; zwischen einem schattigen Vordergrund und einem Hintergrund von wolkiger Dunkelheit leuchteten sie, als glühten sie innen.
Ich berührte Bob am Arm und wies auf das Panorama.
»Verstehst du jetzt, warum Tallis sich entschlossen hat, am Ende dieses Weges zu wohnen?«
Er blickte kurz auf, fuhr um einen gestürzten Josua-Baum herum, blickte noch einmal für den Bruchteil einer Sekunde auf das Naturschauspiel und wandte dann seine ganze Aufmerksamkeit wieder der Straße zu.