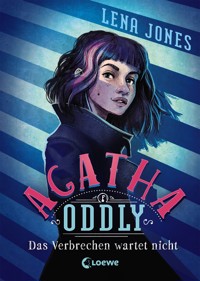
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Agatha Oddly
- Sprache: Deutsch
Smart, smarter, Agatha: Hier kommt Agatha, die Meisterdetektivin mit messerscharfem Verstand! Agatha hätte so gerne einen richtigen Fall! Stattdessen muss sie ihre Zeit in einer Londoner Eliteschule absitzen, wo sie sich fast zu Tode langweilt. Eines Morgens stolpert sie endlich über ein Verbrechen: Eine Dame wird von einem Motorradfahrer angefahren. An ihrem Handgelenk entdeckt Agatha ein geheimnisvolles Tattoo. Sie beginnt zu ermitteln und wird dabei immer tiefer in die dunklen Machenschaften der Londoner Unterwelt hineingezogen. Plötzlich kann sie niemandem mehr trauen: Wer ist Freund, wer Feind? Ein tödliches Spiel hat begonnen … Die neue Detektiv-Reihe mit starker Mädchen Ermittlerin – für Fans von Ruby Redfort und Young Sherlock Holmes. Der Titel ist auf antolin.de gelistet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1. Im Klassenzimmer
2. Belladonna und Fingerhut
3. Das silberne Tattoo
4. Eine schicksalhafte Begegnung
5. Der rote Schleim
6. Die fehlenden Plane
7. Aufschluss
8. Unter dem See
9. London Eye
10. Das Gesicht der Zukunft
11. Blick in den Abgrund
12. Das weisse Labyrinth
13. Wo niemand dich schreien hort
14. Gefangen
Epilog
as ist jetzt das zwölfte«, der Rektor sieht von seinen Unterlagen auf, »nein, ich muss mich korrigieren: das dreizehnte Mal, dass du in diesem Schuljahr Ärger machst, Agatha.«
Wir sitzen in seinem Büro. Die Luft ist stickig, was nicht nur an der Hitzewelle momentan liegt.
Ich blicke zu Boden. Es stimmt und ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Dr.Hargrave (Ronald Hargrave, B.A., M.A., OBE) hört sich selbst gerne reden. Das Beste, was man tun kann, ist abzuwarten, bis er fertig ist. Er ist im Übrigen auch kein echter Doktor, mag es aber, wenn man ihn so nennt. Auf seiner Stirn prangen fünf Muttermale in der Form des Sternbilds Kassiopeia und seine Augen, aus denen er mich gerade unglaublich durchdringend ansieht, entsprechen ungefähr der Abbildung4B auf meiner Augenfarbenbestimmungstafel, die ich zu Hause habe.
Er liest vor: »Erstens: Du wurdest in der Zwischendecke über den Chemielaboren gefunden, wo du dich versteckt hattest, weil du der Meinung warst, MrStamp würde Schwefelsäure stehlen, um sie auf eBay zu verkaufen.«
Das hat er wirklich. Aber weil ich aufgeflogen bin, bevor ich es beweisen konnte, musste ich die Ermittlungen einstellen. Und Dad hat mir noch dazu Hausarrest aufgebrummt.
»Zweitens: Du hast versucht, den Unterricht zu schwänzen, indem du den Gärtner überzeugt hast, dass du Baumchirurgin in Ausbildung bist und dringend auf den Baum an der Grundstücksmauer klettern musst … und das nur, um die Schule zu schwänzen …«
Den Rest blende ich aus. Das ist mir schon immer leichtgefallen – es ist im Grunde, als würde man beim Fernsehen auf einen anderen Sender umschalten. Wenn ich lieber etwas Interessanteres sehen möchte, stelle ich es mir einfach vor. Ich nenne das meine »Wegzappen«-Strategie.
Der Schreibtisch des Rektors hat eine extrem glänzende Oberfläche. Wenn ich genau hinschaue, kann ich mein eigenes Spiegelbild auf der karamellfarbenen Tischplatte erkennen. Ich trage meine rote Baskenmütze (zu diesem Verstoß gegen die Kleiderordnung ist Dr.Hargrave in seinem Vortrag noch gar nicht gekommen), mein Gesicht wird von meinem kinnlangen Bob umrahmt und meine Stirn ist gerunzelt, als würde ich mich voll und ganz auf Dr.Hargraves Vortrag konzentrieren. Im nächsten Moment beginnt mein Spiegelbild zu schimmern und zu flackern und dann verwandelt es sich in jemand anderen. Ein kleiner Mann mit Hut und Fliege blinzelt mir entgegen. Er streicht sich über seinen Schnurrbart, löst sich aus der Tischplatte, hopst zu Boden und stellt sich hinter den Rektor.
»Was denkst du, wie lange wird le docteur Hargrave diesmal brauchen?«, fragt er mit einem leichten belgischen Akzent.
Ich zappe zurück, um zu hören, wo mein Rektor gerade ist – »Viertens: Du hast ein Abhörgerät in der Wand zum Lehrerzimmer versteckt …« –, und sehe dann wieder zu Hercule Poirot, dem berühmten Detektiv, der einen Blick auf seine Uhr wirft.
»Er redet jetzt schon seit zweiundzwanzig Minuten.« Poirot zieht eine Augenbraue hoch, als wolle er, dass ich etwas dagegen unternehme. »Gut möglich, dass er diesmal seinen Rekord von siebenundzwanzig Minuten bricht, non?«
Ich glaube eigentlich, dass er fast fertig ist. Sein Magen hat gerade hörbar geknurrt und die Mittagspause hat schon vor einer Ewigkeit angefangen. Mein Blick huscht durch den Raum und bleibt dabei an allen möglichen Details hängen wie eine Kugel im Flipperautomaten.
»Vierundzwanzig«, sage ich laut.
»Was?« Dr.Hargrave sieht von seinen Unterlagen auf.
»Nichts.« Ich räuspere mich.
Poirot nickt – er nimmt meine Wette an.
»Hörst du mir überhaupt zu, Agatha?«
»Selbstverständlich, Sir. Sie sagten gerade, sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamts auszugeben, sei eine Straftat.«
»Vollkommen richtig. Ich hoffe doch, du nimmst das auch ernst, Agatha.«
Ich nicke. Ernst. »Natürlich, Herr Rektor. Ich fange bloß an, mir Sorgen zu machen.«
»Sorgen? Weshalb?« Dr.Hargrave runzelt die Stirn.
»Dass Sie zu spät zum Mittagessen mit Ihrer Frau kommen.«
Jetzt wirkt er verwirrt. »Mit meiner … Frau?«
»Ja. Sie tragen heute ein besonders schönes Hemd, Sir. Und Rasierwasser. Und ich konnte nicht umhin, die Pralinenschachtel auf Ihrem Schreibtisch zu bemerken, bei der es sich ganz eindeutig um ein Geschenk für eine Dame handelt …« Ich lächle zufrieden. Auf meine Beobachtungsgabe ist Verlass.
»Ach so, ja«, stottert er, »mit meiner Frau.« Er wirft einen Blick auf die Uhr an der Wand. Seine Worte hängen in der Luft wie Glühwürmchen. »Wie du schon sagtest, ich komme zu spät zum Mittagessen … mit meiner Frau.«
»Nun, Sir, ich möchte Sie ganz bestimmt nicht aufhalten«, erwidere ich.
Dr.Hargrave steht auf und streicht sich unsichtbare Krümel vom Anzug. »Genau. Dann mache ich mich wohl besser mal auf den Weg.« Er sieht sich um, als suche er nach dem Ausgang. »Und was dich angeht, Agatha Oddlow: Ich rate dir ganz dringend, dir Gedanken darüber zu machen, was … äh … ich gerade alles gesagt habe.«
»Das werde ich, Sir.«
Dr.Hargrave scheint zu schwitzen, als er mich zur Tür bringt, wo Poirot bereits steht und zustimmend lächelt. Der Detektiv zieht seine kleine Taschenuhr hervor.
»Vierundzwanzig Minuten – du hattest recht, mon amie.«
Ich erwidere sein Lächeln, während Dr.Hargrave mir die Tür aufhält.
»Bien sûr«, sage ich.
»Wie bitte?«, fragt der Rektor.
»Ich sagte: ›Guten Appetit, Sir.‹«
Er presst die Lippen zusammen, als wolle er sich etwas verkneifen, und brummt: »Sei vorsichtig, Agatha Oddlow. Ganz, ganz vorsichtig.«
Liam Lau, mein bester Freund, läuft bereits im Flur auf und ab, als ich aus dem Büro des Rektors komme. Er dreht sich zu mir um und sein Gesicht ist vor Sorge völlig verkniffen. Es dauert einen Moment, bis ich begreife, warum. Ach ja – Liam weiß, dass ich in Schwierigkeiten stecke, und fürchtet, dass ich deswegen von der Schule fliege. Gut, genau genommen rechnet Liam schon seit dem Tag, als wir uns kennengelernt haben, damit, dass St.Regis mich rausschmeißt. Allerdings ist er dieses Mal davon überzeugt, dass mein letztes Abenteuer auch wirklich mein letztes gewesen sein wird. Um ihn noch ein bisschen länger auf die Folter zu spannen, setze ich eine traurige Miene auf.
Liam schlägt die Hände vors Gesicht. »Was hab ich dir gesagt?«, jammert er. »Mit wem soll ich denn jetzt Mittag essen?«
Es stimmt, Liam und ich essen wirklich zusammen zu Mittag. Jeden Tag sogar. Oder jedenfalls immer, wenn wir dazu kommen. Wir sitzen auf der »Insel der Verbannten«, also an dem Tisch, wo sich all die schrägen Vögel treffen.
»Liam …«, setze ich an.
»Ich weiß, ich soll nicht rumheulen«, seufzt er dramatisch.
»Liam …«
»Rausgeworfen …« Er seufzt erneut. »Oh, Agatha, vielleicht können wir ihn ja irgendwie überreden, dass er es sich noch mal anders überlegt? Was, wenn wir deinen Dad dazu bringen, ihm einen Brief zu schreiben …«
»Liam!« Ich packe ihn bei den Schultern und schüttle ihn. Endlich hält er die Klappe.
»Ich fliege nicht von der Schule«, versichere ich ihm.
Er erstarrt. »Du fliegst …«
»Nicht. Von. Der. S-c-h-u-l-e.« Während ich das letzte Wort in aller Deutlichkeit buchstabiere, betrachte ich meine abgekauten, waldgrün lackierten Fingernägel.
Ein Lächeln breitet sich auf Liams Gesicht aus und glättet seine Sorgenfalten. Er umarmt mich stürmisch. »Was hat Dr.Hargrave gesagt?«
Ich werfe ihm an meinem Vorhang aus Haaren vorbei, die mir ins Gesicht gefallen sind, einen vielsagenden Blick zu. »Erzähl ich dir in Ruhe. Jetzt aber los, sonst kommen wir noch zu spät zu Chemie.«
»Das ist keine Superkraft.«
»Ich sag ja nur, nicht von der Schule zu fliegen, wäre eine ziemlich nützliche Superkraft.«
»Aber Superkräfte sind so was wie Unsichtbarkeit oder dass man Sachen zum Schweben bringen kann. ›Nicht von der Schule fliegen‹ gehört zu den Dingen, die normale Menschen andauernd tun.«
Der Schultag ist rum und Liam und ich sitzen allein im Klassenzimmer.
»Normale Menschen haben aber auch nicht so viel Spaß wie ich.«
Liam macht die Schulbibliothekarin nach und wirft mir über den Rand seiner Brille einen missbilligenden Blick zu. Ich kann mir ein Lächeln nicht verkneifen. Er schafft es einfach immer, mich aufzumuntern. Ihn stört es nicht, dass ich ab und zu wegzappe oder mit Leuten rede, die gar nicht da sind. »Und, hast du noch was über den Hausmeister rausgefunden?«, fragt er.
Ich zucke erneut mit den Schultern. Das ist der Grund, weshalb ich überhaupt im Büro des Rektors antanzen musste: Ich habe mich als jemand vom Gesundheitsamt ausgegeben, um dem Hausmeister auf die Schliche zu kommen. Seit Wochen verhält er sich äußerst verdächtig.
Schon seit ich klein war, will ich Detektivin werden, und ich liebe es, mich zu verkleiden. Mum hat mich darin immer unterstützt. Sie hat sich sogar kleine Rätsel für mich ausgedacht, die ich lösen sollte, mit richtigen Spuren und allem Drum und Dran. Aber na ja, nach mehreren, ähm …, »Vorfällen« hat mir der Rektor – ja, man kann sagen, verboten, jemals wieder irgendetwas zu tun, was auch nur ansatzweise so aussehen könnte, als würde ich »Unschuldige bespitzeln«.
Liam betreibt die ganze Detektivsache nicht ganz so leidenschaftlich wie ich, aber auch er hat Spaß daran, Rätsel zu lösen und Codes zu knacken. Deswegen haben wir auch die Agentur Oddlow gegründet. (Erst wollten wir uns »Detektei« nennen, aber nach dem ganzen Ärger mit dem Rektor erschien es uns sinnvoll, uns ein bisschen bedeckt zu halten.)
»Sollen wir dann mit unserer Besprechung beginnen, Agatha?«
»Ja.« Ich nicke. »Wir müssen uns allerdings ein bisschen beeilen: Ich muss noch was fürs Abendessen einkaufen.«
»Ich verstehe. Haute Cuisine? Cordon bleu?«, fragt Liam mit dem gleichen aufgesetzten französischen Akzent, den ich manchmal verwende, wenn Poirot gerade bei mir ist.
»Oui. Das ist jedenfalls der Plan.«
Er nickt ernst und schlägt unser nagelneues Notizbuch auf, in dem wir den Stand unserer Ermittlungen festhalten. Die Leute machen sich andauernd über meinen Namen lustig (Plumpsklo gehört noch zu den netteren Varianten), aber weil »Odd« auf Englisch »sonderbar« heißt, nennen mich die meisten einfach Oddly. Oder gleich Sonderbar, weil sich das auch noch halbwegs auf Agatha reimt. Was zwar nicht gerade nett ist, aber da stehe ich drüber. Ich habe es sogar zum Motto unserer Agentur gemacht: »Agentur Oddlow – kein Fall ist uns zu sonderbar.« Leider hat uns bis jetzt noch niemand mit der Lösung eines Falls beauftragt. Aber das ist noch lange kein Grund, bei den Aufzeichnungen zu schludern.
»Erster Tagesordnungspunkt«, verkünde ich, »ist das Design unseres Logos, das wir für unsere Geschäftskorrespondenz, Visitenkarten und Stempel verwenden. Irgendwelche Vorschläge?«
Liam denkt einen Moment nach.
»Wie wär’s mit einem Löwen … mit einer Lupe!«
Echt jetzt? Ich werfe ihm einen durchdringenden Blick zu und wechsle das Thema. Die Idee ist ja nun wirklich nicht besonders originell. »Warum heben wir uns das nicht für später auf? Wir könnten ja erst mal üben, Identifikationslisten zu schreiben.«
»Wie du willst. Aber nur, wenn du mir sagst, was ›Identifikationslisten‹ überhaupt sind.« Er grinst.
Ich sehe ihn an und lächle. »In einer Identifikationsliste hältst du die wichtigsten Merkmale einer Person fest. Ich erstelle die für alle möglichen Leute – jeden, der für eine Ermittlung entscheidend sein könnte.« Ich zucke mit den Schultern. »So kann ich mich leichter erinnern, wie sie aussahen, wie sie angezogen waren, welches Parfüm sie getragen haben … solche Sachen halt.«
»Alles klar, ich denke, das kriege ich hin.« Liam nickt. »Lass es uns doch so machen, dass du eine über mich schreibst und ich eine über dich.«
»Okay, dann nimm dein Notizbuch und schreib drei Merkmale auf, die dir an mir auffallen. Dinge, die ungewöhnlich sind. Die mich von anderen unterscheiden. Ich mache das Gleiche über dich.«
Wir senken die Köpfe und schreiben einige Minuten lang drauflos. Dabei kaue ich nachdenklich auf meinem Bleistift herum.
Meine Identifikationsliste zu Liam Lau:
Wir tauschen unsere Notizen. Liams Identifikationsliste über mich sieht so aus:
Ich will gerade anmerken, dass meine Haare dunkelbraun sind, nicht haselnussbraun, als die Tür auffliegt und jemand ins Klassenzimmer rauscht.
»Wir können hier rein, da sind nur Sonderbar und Wunderkind drin«, ruft eine Stimme.
Ich weiß, wem diese Stimme gehört, noch bevor ich mich zu ihr umdrehe: Sarah Rathbone, eine der drei KS. Die anderen beiden sind auch da: Ruth Masters und Brianna Pike. Sie behaupten, »KS« stehe für »Killerstyle«, aber für alle anderen ist es bloß die Abkürzung für »Klonschwestern«. Mit ihren blonden Haaren, manikürten Nägeln und ihrem ganzen aufgestylten Hochglanzlook stehen sie für alles, wofür St.Regis steht. Die Schule wimmelt nur so von Schönen und Reichen und die KS sind ausgesprochen gut darin, alle anderen, die nicht so sind wie sie, wie Fußabtreter zu behandeln.
Eine Identifikationsliste, um die drei KS voneinander zu unterscheiden:
Tapfer stelle ich mich Sarah entgegen. »Tut mir leid, aber dieser Raum ist schon besetzt«, sage ich.
»Ach ja, und was machst du hier so Wichtiges?«, spottet Sarah. »Detektiv spielen? Mit deinem kleinen Freund?«
Brianna kommt auf mich zu. Sie strafft die Schultern und wirft ihre Haare mit solchem Schwung zurück, dass sie sie fast schon als Waffe einsetzen könnte. »Verschwindet.«
»Aber wir sind gerade mit was beschäftigt«, erwidere ich.
»Wir sind gerade mit was beschäftigt«, äfft Ruth mich mit Kleinmädchenstimme nach. »Tja, dann beschäftigt ihr euch jetzt halt mit was anderem – FREAK.« Dabei bringt sie ihr Gesicht so nah an meins, dass ich unwillkürlich vor ihr zurückweiche. Sie nimmt mein Buch vom Tisch – Die Giftpflanzen der Britischen Inseln – und drückt es mir in die Hand.
»Genug gespielt«, stimmt Brianna zu. »Raus hier, Agatha. Macht euch vom Acker.« Sie versetzt mir einen Stoß gegen die Schulter.
Ich wische meinen Blazer ab, als sei ich mit etwas Dreckigem in Berührung gekommen. »Komm, Liam«, sage ich und sammle meine Sachen ein. »Sie sind uns zahlenmäßig überlegen.« Leise füge ich hinzu: »Wenn auch nicht gerade intellektuell.«
Bis den KS auffällt, dass sie beleidigt worden sind, haben wir das Klassenzimmer längst verlassen. Mit einem Knall fällt die Tür hinter uns zu. Ich seufze frustriert.
»Alles okay, Aggie?«
»Ja … danke, Liam.« Ich zucke mit den Schultern. Manchmal hasse ich St.Regis mehr als alles andere auf der Welt. Meine alte Schule, die Meadowfield Primary, war da ganz anders. Die Gebäude waren zwar ziemlich runtergekommen und es gab nie genug Geld für neue Bücher, aber alles war hell und freundlich und die Lehrer legten großen Wert darauf, dass wir alle miteinander auskamen. Ich hatte auch dort schon einen Spitznamen – Schlaukopf –, doch das war nicht böse gemeint. Klar, besonders originell war er nicht, aber ich mochte ihn. An der Meadowfield Primary war es okay, viel zu wissen. Wenn niemand sonst die Antwort auf eine Frage kannte, fragten die Lehrer mich. Dann brachte meine Lehrerin eines Tages die Bewerbungsunterlagen für dieses Stipendium in St.Regis mit. Um ein Haar hätte ich sie Dad gar nicht erst gezeigt. Doch als er das Schreiben sah, meinte er, es wäre ziemlich dumm, nicht wenigstens den Test zu machen. Damit hatte er ja auch irgendwie recht, oder? Ich hatte nichts zu verlieren. Selbst wenn sie mir einen Platz anboten, konnte ich schließlich immer noch ablehnen. Und außerdem würden sie mich doch sowieso niemals nehmen. Richtig?
Also machte ich den Test.
Und bekam das Stipendium.
Dad schrieb ihnen, dass ich annehmen und im September anfangen würde.
Anfangs freute ich mich auch wirklich darauf, auf so eine renommierte Schule zu gehen. Diese Schule hatte mehr Geld zur Verfügung, als sich die Meadowfield Primary jemals hätte erträumen können. Es gab neue Computer, frisch eingerichtete Klassenzimmer und makellose Wände und Böden. Zwischen all diesen schönen, neuen Dingen war ich diejenige, die plötzlich armselig wirkte. Auf einmal spielte es keine Rolle mehr, dass ich so viel wusste. Und es war auch egal, ob ich nett war oder lustig oder was auch immer mich ausmachte. Ich passte einfach nicht rein. Bis ich Liam kennenlernte …
In der zweiten Woche auf St.Regis saß ich in der Cafeteria (oder vielmehr im Speisesaal, wie man den Raum hier nannte) und aß mein Mittagessen. Irgendwann zog ich die Sunday Times aus meiner Tasche und beschloss, mich an dem verteufelt schweren Kreuzworträtsel zu versuchen.
22 senkrecht – Immanuel optimierte karges Archiv, brachte alles durcheinander.
»Vielleicht ist Immanuel ein Hinweis. Hieß Kant nicht so? Dann könnte es irgendwas Philosophisches sein«, meldete sich eine Stimme von der anderen Seite des Tisches zu Wort. Ich zuckte zusammen – ich hatte gar nicht gemerkt, dass ich laut gedacht hatte. Als ich hochsah, entdeckte ich einen Jungen in meinem Alter, den ich aus dem Unterricht kannte. Sein Name war Liam Lau. Ich glaube, ich hatte ihn noch nie etwas sagen hören. Oder zumindest nichts außer »anwesend«, wenn die Lehrer morgens die Namensliste durchgingen.
»Tut mir leid, hab ich dich erschreckt?«
»Nein, ich … Mir war bloß nicht klar, dass ich Selbstgespräche geführt habe.«
Er lächelte. »Machst du das öfter?«
»Kann sein. Manchmal.«
»Ich auch.« Er nickte grinsend. »Angeblich ist das ein erstes Anzeichen dafür, dass man verrückt wird.«
»Hmm … vielleicht hast du mit dem Philosophen recht. Warum sollten sie sonst so einen konkreten Namen benutzen?«, überlegte ich. Und als hätte mein Hirn plötzlich beschlossen, doch mithelfen zu wollen, kam mir noch ein Gedanke: »Oh, und was, wenn wir das mit dem Durcheinanderbringen wörtlich nehmen sollen? Weil da irgendwo ein Anagramm drinsteckt?«
»Ja, das klingt logisch … warte mal, wie hieß das? ›Optimierte karges Archiv‹?«, entgegnete Liam. »Das kommt mir bekannt vor. Irgendwas klingelt da bei mir.«
Eine ganze Weile betrachteten wir gemeinsam die Buchstaben OPTIMIERTEKARGESARCHIV. Dann riefen wir wie aus einem Mund: »Kategorischer Imperativ!«
Mit einem breiten Grinsen griff ich nach meinem Stift und trug die richtige Antwort ein.
»Agatha …«
Liams Stimme reißt mich aus meiner Erinnerung. Seitdem ist ein Jahr vergangen. Ich bin immer noch ein Außenseiter, aber wenigstens habe ich Liam zum Freund. Ich sehe ihn an. »Ja?«
»Versprichst du mir was?«
»Was?«, frage ich.
»Kannst du versuchen, morgen nicht von der Schule zu fliegen?«
Ich verdrehe die Augen. »Ich verspreche es.«
Er grinst. »Dann komm … du kannst mich noch zur Bushaltestelle bringen.«
ch bin gerade damit fertig, einen ganzen Berg Gemüse zu pürieren, als Dad in die Küche kommt. Er ist von oben bis unten voller Dreck und stinkt nach Mist. Vor lauter Begeisterung über mein neues Rezept habe ich gar nicht gemerkt, wie müde ich bin.
»Was um alles in der Welt machst du da, Aggie?«
»Abendessen«, antworte ich.
»Dann ist ja gut. Beim Anblick der grünen Pampe dachte ich schon, es handle sich um ein wissenschaftliches Experiment.« Er lacht.
Ich seufze. Dad kann manchmal soooo engstirnig sein. Er ist kein schlechter Koch, aber ein besonders guter ist er auch nicht. Meistens mache ich das Abendessen für uns, doch fast immer gibt es eins von seinen Lieblingsgerichten – irgendwas Einfaches wie Würstchen mit Kartoffelbrei oder Baked Beans auf Toast. Ist es da wirklich so überraschend, dass ich zur Abwechslung mal was anderes ausprobieren möchte?
In einem Buchladen auf der Charing Cross Road habe ich eine eselsohrige Ausgabe von Escoffiers Le Guide Culinaire gefunden und dann einen ganzen Abend lang versucht, das Rezept, das ich mir ausgesucht habe, aus dem Französischen zu übersetzen. Dad betrachtet wortlos das Chaos, schüttelt den Kopf und stapft aus der Küche, um zu duschen.
Dad – oder Rufus, wie ihn alle anderen nennen – ist Landschaftspfleger bei der Königlichen Parkverwaltung, seit er sechzehn ist. Mittlerweile hat er sich zum obersten Gärtner im Hyde Park hochgearbeitet, weshalb wir dort im Groundskeeper’s Cottage wohnen. Aber obwohl er der Chef ist, lässt er nicht zu, dass die anderen die ganze Drecksarbeit für ihn machen. Am glücklichsten ist er, glaube ich, wenn er die Ärmel hochkrempeln und sich die Hände schmutzig machen kann.
Als er zurückkommt, hat er ein frisches Hemd an und riecht durchdringend nach Teerseife, was aber immer noch besser ist als der Mistgestank davor. Während er mein aufwendig zubereitetes Essen beäugt, streicht er sich über den rotblonden Bart.
»Was … ist das?«
»Gemüsemousse mit Forellenfilets unter einer Kruste aus Garnelen und gehacktem Kerbel.«
»Ziemlich ausgefallen, Liebes.«
»Probier es einfach … vielleicht schmeckt es dir ja.«
Dad zuckt mit den Schultern und setzt sich.
Ich habe einige Wochen gespart, bis ich mir die Zutaten leisten konnte. Für mein Taschengeld muss ich an den Wochenenden stundenlang Kompost schippen – dieses Essen ist also buchstäblich hart erarbeitet. Aber das ist es wert. Jeder sollte doch die Möglichkeit haben, die schönen Dinge im Leben zumindest einmal probieren zu können, oder? Dad greift nach seiner Gabel und starrt auf den Teller mit dem Essen. Er versucht krampfhaft, sich irgendetwas Diplomatisches einfallen zu lassen. Es gelingt ihm nicht. »Das ist nicht besonders englisch.«
Ich lächle.
»Poirot sagt: ›Die Engländer haben keine Cuisine, sie haben nur Essen.‹ Oder so ähnlich«, entgegne ich.
Dad stöhnt auf, als ich meinen Lieblingsdetektiv ins Spiel bringe. Ich rede so oft über Hercule Poirot, dass Agatha Christies berühmter Detektiv inzwischen eine Art rotes Tuch für Dad geworden ist.
»Du und deine Bücher, Agatha! Nicht alles, was Poirot sagt, ist heilig, weißt du?«
Ich ignoriere seine Bemerkung und lege ihm Fisch und Gemüsepüree auf den Teller. Er nimmt etwas von allem auf seine Gabel und ich tue es ihm gleich.
»Bon appetit!«, wünsche ich lächelnd, bevor wir beide reinhauen.
Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt ganz und gar nicht.
Ich blicke zu Dad hinüber, der tapfer versucht, sich nichts anmerken zu lassen. Ich bin beeindruckt, wie lange er das durchhält.
Irgendwas Furchtbares passiert gerade mit meinen Geschmacksknospen. Es dauert eine Weile, bis ich den Mut aufbringe, den Bissen runterzuwürgen. Er kommt mir beinahe wieder hoch.
»Ich glaube, ich habe da was … falsch übersetzt.«
Dad schluckt runter. Seine Augen tränen.
»Kann ich bitte ein Glas Wasser haben?«
Der Rest der Gemüsemousse verschwindet in der Mülltonne und dann gehen wir los und kaufen uns Fish & Chips. Ich beschließe, mir Poirots Gedanken zu diesem Thema zu verkneifen: »Wenn es kalt und dunkel ist und sich nirgends sonst etwas zu essen auftreiben lässt, ist es ganz passabel.« Ich glaube nicht, dass Dad das gerade hören will, und außerdem liebe ich Fish & Chips.
Mit knurrendem Magen tragen wir unser Essen in seiner typischen Papierverpackung nach Hause und lassen es uns schmecken. Eine Weile ist nichts anderes zu hören als zufriedenes Kauen. Es geht doch nichts über den knusprigen Teigmantel, die weichen Fischstücke, die einem förmlich auf der Zunge zergehen, und die tröstlich salzigen Pommes. Ich gebe es nicht gerne zu, aber ich glaube, in diesem einen Punkt hat sich Poirot zur Abwechslung mal geirrt.
Während wir essen, erkundigt sich Dad, wie mein Tag war. Ich habe aber keine Lust, über die Schule, die KS und mein Treffen mit dem Rektor zu sprechen oder darüber, wie ich in Chemie mal wieder komplett ausgestiegen bin. Deswegen frage ich ihn stattdessen nach seinem Tag.
»Wie machen sich die Orchideen im Gewächshaus dieses Jahr?«
»Nicht schlecht«, brummt er.
Mir fällt das Buch ein, das ich gerade lese.
»Habt ihr auch Digitalis?«
»Wenn du damit Fingerhut meinst, dann ja. Bei der Serpentine Bridge gibt es einige Beete, wo er wächst.«
»Und Aconitum?« Ich schiebe mir zwei Pommes in den Mund, um Dad nicht ansehen zu müssen.
»Eisenhut? Du kennst ja echt viele lateinische Namen … ja, ich glaube, auf der Wiese gibt es welchen, aber ich würde ihn jetzt nicht gezielt anpflanzen. Obwohl er zugegebenermaßen gut für die Bienen ist.«
»Aha … was ist mit Belladonna?«
»Belladonna …« Seine Miene verfinstert sich, als er die Verbindung erkennt. »Fingerhut, Aconitum, Belladonna … Agatha, interessierst du dich nur für giftige Pflanzen?«
Ich werde rot. Erwischt! Die Giftpflanzen der Britischen Inseln steckt immer noch in meiner Tasche.
»Ich bin bloß neugierig.« Ich atme tief durch.
»Das weiß ich doch, Liebes. Aber manchmal mache ich mir eben Sorgen um dich. Wegen deiner … morbiden Interessen. Ich habe ein bisschen Angst, dass du nicht ganz in der echten Welt zu Hause bist.«
Ich seufze. Diese Unterhaltung führen wir nicht zum ersten Mal. Dad redet ständig von der ECHTEN WELT, als sei sie ein Ort, an dem ich noch nie war. Dad macht sich Sorgen, dass ich eine Träumerin bin – dass alles, was mich interessiert, Bücher über Mord und Totschlag sind. Womit er natürlich recht hat.
»Ich mach den Abwasch«, sage ich schnell, um das Thema zu wechseln. Dann fällt mein Blick auf die Siebe, Pfannen und unzähligen Schüsseln, die ich für mein kulinarisches Desaster benutzt habe. Vielleicht auch nicht.
»Damit bin ich heute dran«, meint Dad. »Geh du lieber früh ins Bett, du siehst müde aus.«
»Danke.« Ich umarme ihn, wobei mir der Geruch von Teerseife und frisch gebügeltem Hemd in die Nase steigt, und renne dann nach oben.
Als wir ins Groundskeeper’s Cottage gezogen sind, habe ich mir gleich den Dachboden ausgesucht. Mum meinte, das sei das perfekte Zimmer für mich – weit oben, sodass ich von dort den Überblick hätte. Wie ein Krähennest auf einem Schiff. Ich war damals erst sechs und Mum war noch am Leben. Bis dahin hatten wir in einer winzigen, viel zu engen Wohnung im Norden Londons gewohnt und Dad war jeden Morgen mit dem Fahrrad zum Hyde Park gefahren. Als ich auf die Welt kam, war er noch mitten in seiner Gärtnerausbildung. Die kleine Wohnung war immer voll mit irgendwelchem Grünzeug – Tomatenpflanzen auf den Fensterbrettern, Orchideen im Badezimmer, zwischen dem Duschgel und den Shampooflaschen …
Mein Zimmer hat eine Dachschräge mit einem Fenster direkt über meinem Bett, sodass ich in wolkenlosen Nächten die Sterne sehen kann. Manchmal markiere ich ihre Positionen mit einem weißen Filzstift auf dem Glas – den Großen Wagen, Orion, die Plejaden – und beobachte, wie sie im Lauf der Nacht weiterziehen.
Auf dem Holzboden liegt ein großer, bunter Teppich, damit ich morgens beim Aufstehen keine kalten Füße kriege. Es gibt keine Zentralheizung und das Haus ist ein bisschen zugig, aber Mitte Juli ist es immer warm. Heute herrscht schon den ganzen Tag eine Affenhitze, deswegen stelle ich mich auf die Zehenspitzen und öffne das Dachfenster, um kühlere Luft hereinzulassen. Meine Klamotten hängen an zwei freistehenden Kleiderständern. Dad spart gerade auf einen richtigen Kleiderschrank, aber ich mag es eigentlich, sie alle auf einmal sehen zu können.
An der einen Schräge hängt ein Filmplakat von Frühstück bei Tiffany, auf dem Audrey Hepburn in ihrem schwarzen Kleid abgebildet ist. Neben ihr hängt das Model Lulu. Über meinem Bett habe ich ein großes Foto von Agatha Christie festgepinnt, das Liam mir zum Geburtstag geschenkt hat. Und an der anderen Schräge klebt ein Stadtplan von London … mehr brauche ich nicht.
Mein Zimmer ist nicht unordentlich. Finde ich jedenfalls, auch wenn Dad das anders sieht. Es ist einfach nur so, dass ich ganz schön viele Sachen habe und nicht genug Platz, um sie alle zu verstauen. Deswegen liegen eben überall Schallplatten, Bücher und sogar eine Porzellanbüste von Königin Viktoria, die ich in einem Müllcontainer gefunden habe, herum. Hin und wieder zwingt Dad mich zum Aufräumen.
Also versuche ich jetzt, für ein bisschen Ordnung zu sorgen. Der Erfolg hält sich in Grenzen: Am Ende sieht es aus, als hätte jemand mein Zimmer mit einem riesigen Löffel umgerührt.
Ich hebe die gewichtige Ausgabe von Le Guide Culinaire auf und stelle sie in mein Bücherregal, das eine der beiden geraden Wände einnimmt. Ich seufze – was für eine Zeitverschwendung. Mit dem Tag hätte ich auch etwas Besseres anfangen können.
Ich streiche über die grünen, goldgeprägten Rücken der gesammelten Werke von Agatha Christie – die Abenteuer von Hercule Poirot, Miss Marple und Tommy und Tuppence Beresford –, nach der Mum mich benannt hat. Sie gab sie mir zum Lesen, weil ich so gerne Rätsel löse, und sagte, ich solle mehr über richtige Rätsel nachdenken, nicht bloß über Wortsuchbilder und Zahlencodes. Als ich fragte, was sie meinte, antwortete sie: »Jeder Mensch ist ein Rätsel, Agatha. Jeder da draußen auf der Straße hat eine eigene Geschichte, eigene Gründe dafür, warum er so ist, wie er ist, eigene Geheimnisse. Das sind die wirklich wichtigen Rätsel.«
Bei dem Gedanken, dass sie nicht mehr hier ist, brennen mir heiße Tränen in den Augen.
»Ich musste heute mal wieder zum Rektor …«, berichte ich. »Aber es war okay, er hat mich mit einer Warnung davonkommen lassen.« Während ich weiterrede, räume ich ein paar von meinen Klamotten weg. Das mache ich manchmal: Mum von meinem Tag erzählen.
Ich ziehe meine Schuluniform aus, hänge sie an den Kleiderständer, schlüpfe in meinen Schlafanzug und lege meine rote Baskenmütze in ihre Schachtel. Was soll ich morgen anziehen? Ich entscheide mich für einen von Mums Seidenschals, einen wunderschönen roten mit asiatisch angehauchtem Blumenmuster. Ich liebe es, Mums alte Sachen mit Stücken zu kombinieren, die ich auf dem Flohmarkt oder in irgendwelchen Secondhandläden gefunden habe, auch wenn manche davon zu kostbar sind, um damit aus dem Haus zu gehen.
Als Nächstes gehe ich zu meinem Schreibtisch in der Ecke und ziehe meinen Laptop hervor, der unter einem Berg Klamotten begraben ist. Ich schalte ihn an und logge mich ein. Die Leute in der Schule glauben, ich würde keine sozialen Netzwerke nutzen, aber das stimmt nicht. Mag ja sein, dass ich lieber eine Ausgabe der Times lese, statt auf meinem Handy herumzuscrollen, und dass ich meine Notizen immer noch mit der Hand schreibe. Aber ich interessiere mich sehr viel mehr für Technik, als sie ahnen. Nicht zuletzt, weil man anhand dessen, was die Leute so ins Netz stellen, unheimlich viel über sie herausfinden kann. Natürlich habe ich kein Profil unter meinem echten Namen angelegt. Nein – online heiße ich Felicity Lemon.
Bis jetzt scheint niemandem aufgefallen zu sein, dass Felicity nicht echt ist. Einige aus der Schule haben meine Freundschaftsanfragen angenommen, darunter auch alle drei KS. Keiner hat gemerkt, dass »Felicity Lemon« der Name von Hercule Poirots Sekretärin ist und dass ich als Profilbild ein Foto der französischen Sängerin Françoise Hardy aus den 1960ern verwende.
Ich scrolle durch Felicitys Timeline, die im Großen und Ganzen aus einer endlosen Abfolge von Fotos von Sarah Rathbone, Ruth Masters und Brianna Pike besteht. Anscheinend sind sie vor Kurzem für ein verlängertes Wochenende irgendwo nach Südeuropa geflogen, denn sie posieren auf Liegestühlen, lassen ihre Füße in einen Hotelpool baumeln und sitzen zusammen am Bug eines Schiffes, während ihre Haare hinter ihnen herflattern wie in einem Shampoo-Werbespot. Gegen meinen Willen verspüre ich einen Anflug von Neid und klappe den Laptop wieder zu.
Ich wühle in meiner Tasche und ziehe das Notizbuch hervor, mit dem ich heute Morgen begonnen habe. Zusammen mit meinem Füller lege ich es neben mein Bett, für den Fall, dass ich mitten in der Nacht eine plötzliche Eingebung habe. So machen das gute Detektive: Sie schreiben alles auf, weil sie nie wissen, welches noch so kleine Detail ihnen am Ende dabei helfen wird, den Fall zu lösen.
Die meisten meiner Notizbücher haben einen schwarzen Einband, aber es gibt ein paar – na ja, zweiundzwanzig – mit rotem Cover. In denen geht es um meine Mum. Sie stehen ganz oben in meinem Bücherregal, alle zusammen auf einem Brett. Ich habe ausführlich alles aufgeschrieben, was ich über meine Mum weiß: von dem Frisör, bei dem sie sich die Haare hat schneiden lassen, bis zu den Leuten, mit denen sie sich in unserem Gemeinschaftsgarten am liebsten abgegeben hat. Jedes kleine Detail. Ich will nichts vergessen.
Ich sehe zu dem Bilderrahmen mit Mums Foto auf meinem Nachttisch. Sie sitzt auf ihrem Fahrrad, hat einen Fuß abgesetzt, um nicht umzufallen, und lächelt sanft. Sie trägt eine Sonnenbrille mit großen Gläsern, einen Rock aus Seidenkrepp und einen Schlapphut. Hinten auf dem Gepäckträger ist ein Stapel Bücher festgezurrt. Die Polizei hat später behauptet, die Bücher seien schuld gewesen, dass sie an jenem Tag die Kontrolle über ihr Fahrrad verloren hat – aber Mum hatte immer einen Stapel Bücher dabei. Deswegen glaube ich nicht, dass das die Ursache für ihren Unfall war. Mum ist nicht wegen ihrer Bücher gestorben. Es muss einen anderen Grund geben.
Ich klettere ins Bett, ziehe mir die dünne Sommerdecke unters Kinn und werfe einen letzten Blick auf das Foto.
Plötzlich habe ich einen Kloß im Hals. »Nacht, Mum«, sage ich und schalte das Licht aus.
ad, kannst du bitte mal dafür sorgen, dass Oliver nicht ständig auf der Arbeitsfläche rumturnt? Das ist unhygienisch.« Ich versuche gerade, die Schüssel abzuwaschen, die ich fürs Frühstück benutzt habe, aber unser Kater sitzt neben dem Waschbecken und schlägt immer wieder mit dem Schwanz nach meiner Hand. Offensichtlich gefällt ihm dieses neue Spiel, denn er schnurrt nach Leibeskräften. Ich drehe mich zu Dad um, der vornübergebeugt vor seiner Schüssel sitzt und seine Frühstücksflocken in sich reinschaufelt. Er zuckt bloß mit den Schultern. Er ist mal wieder spät dran. Wie immer.
»Ich kann ihn nicht ständig im Auge behalten, Agatha.«
Seufzend hebe ich Oliver hoch, um ihn auf den Boden zu setzen. Er ist grau und von den vielen Leckerlis, mit denen Dad ihn ständig füttert, ein bisschen pummelig. Obwohl er es faustdick hinter den Ohren hat, kann ich ihm nie lange böse sein. Dafür habe ich ihn viel zu lieb. In Katzenjahren würde man wohl sagen, er ist ein Kater mittleren Alters, und sein größtes Hobby ist Herumsitzen – auf der Arbeitsfläche in der Küche, vor dem Spiegel im Flur oder auf dem abgewetzten Sessel, in dem Mum früher immer saß. Ich glaube, er vermisst sie auch. Wenn er nicht gerade sitzt, liegt er.
Oliver reibt sein Köpfchen an meinem Kinn und ich kraule den weichen Pelz an seinem Hals. Ich kann sein tiefes, grollendes Schnurren in meiner Brust fühlen. Dabei muss ich an den Tag denken, als ich ihm das erste Mal begegnet bin. Es war ein regnerischer Nachmittag und ich saß vor dem Kamin und las. Mum kam mit einem Karton zur Tür rein, den sie vor mir abstellte.
»Was ist das?«
»Warum findest du es nicht heraus?«, erwiderte sie lächelnd, während sie sich die Regentropfen aus den Haaren schüttelte.
Ich öffnete den nassen Karton. Auf den ersten Blick sah es aus, als sei er bloß voller Decken. Verwirrt sah ich Mum an.
»Such weiter … aber sei vorsichtig.«
Ich zog die Decken behutsam beiseite. In der Mitte befand sich eine Art Kuhle, fast wie ein kleines Nest. Und darin lag ein Kätzchen – zusammengerollt und kaum größer als meine Faust. Ich bekam ganz große Augen und traute mich zuerst nicht, das schlafende Wesen anzufassen.
»Nur zu, du kannst ihn streicheln.«
»Ihn?«
»Ja, es ist ein kleiner Kater. Du musst dir einen Namen für ihn einfallen lassen.«
Ich dachte einen Moment darüber nach. »Warum muss ich mir einen Namen einfallen lassen?«
Mum lachte. »Weil er dir gehört.«
»Er gehört … mir?«
Mir lief fast so was wie ein Schauer über den Rücken, als er seine großen, tintenschwarzen Augen aufschlug und mich ansah.
Dann schlang meine Mum von hinten die Arme um mich und hielt mich fest, während ich Oliver in meinen Armen hielt. Ich schloss die Augen.
Die Erinnerung ist noch so deutlich. Obwohl dieses winzige Kätzchen inzwischen ausgewachsen ist, steht Mum immer noch irgendwo hinter mir und hält mich fest. Mag sein, dass er mein Kater ist, doch sein Herz gehörte immer Mum.
Ich setze ihn auf den Fliesen ab und atme tief ein. Als ich mit Abwaschen fertig bin und mir die Hände abtrockne, steht Dad auf und bringt seine leere Schüssel zum Waschbecken.
»Alles okay, Liebes?«
Ich nicke und ringe mir ein Lächeln ab. »Ja, alles bestens.«
»Es ist bloß, du siehst aus …« Er legt den Kopf schief.
»… wie ein Genie?«, frage ich, um ihn abzulenken und gleichzeitig den Kloß in meinem Hals loszuwerden, doch er lacht nicht.
»Ist irgendwas nicht in Ordnung?« Für gewöhnlich interessiert sich Dad mehr für Dinge, die in der Erde wachsen, als für Dinge, die in Häusern wohnen. Aber manchmal kriegt er doch mehr mit, als ich ihm zutraue.
»Es geht mir gut, Dad, wirklich …«
»Wirklich?« Er legt mir eine seiner schaufelgroßen Pranken auf die Schulter.
»Ja, wirklich, Dad. Jetzt geh … auf zur Arbeit, bevor du noch zu spät kommst!« Ich stelle mich auf die Zehenspitzen und umarme ihn. Dad versteht Taten besser als Worte. Er entspannt sich.
»Warte«, sage ich, »dein Kragen ist total verdreht.« Während ich sein Poloshirt richte, steht er ganz still, wie ein artiges kleines Kind.
![Agatha Oddly. Das Verbrechen wartet nicht [Band 1] - Lena Jones - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4d525a2d44e7b97f058e74022cb9264f/w200_u90.jpg)
![Agatha Oddly. Die London-Verschwörung [Band 2] - Lena Jones - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/17124f731c69daad345eb40f7c1830f7/w200_u90.jpg)
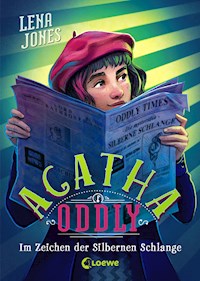
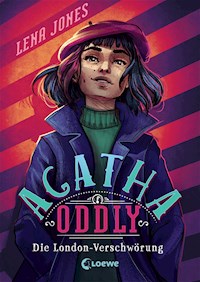













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











