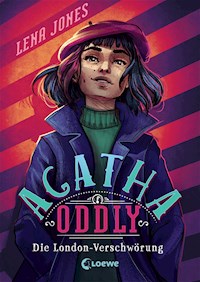
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Agatha Oddly
- Sprache: Deutsch
Smart, smarter, Agatha Agatha möchte endlich in die geheime Torwächter-Gilde aufgenommen werden, aber vorher muss sie noch einen höchst brisanten Fall aufklären: Im British Museum ist ein Mord verübt worden und die Polizei tappt komplett im Dunkeln. Wieder einmal ermittelt Agatha auf eigene Faust und stößt dabei auf eine Verschwörung, eine ungenutzte U-Bahnstation, ein riesiges Feuerwerk und fünftausend Tonnen Gold ... Hier kommt Agatha, die Meisterdetektivin mit messerscharfem Verstand! Eine starke Mädchenheldin, die jedes Rätsel lösen kann! Für alle Leser ab 10 Jahren und Fans von Ruby Redfort. Die mitreißende Detektivgeschichte spielt imheutigen London. Dieses Buch ist bei Antolin.de gelistet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1. Gesetzesbrecher
2. Schnupperpraktikum
3. Das Loch in der Wand
4. Zum Schwarzen Bambus
5. Der Krater
6. Der vergessene Untergrund
7. Die Neue
8. Hausaufgaben
9. Der Schmugglerhafen
10. Ertappt
11. Keine Zeit zu verlieren
12. Im Reich des Goldes
13. Ein kaltes Bad
14. Ein Pulli im Getriebe
15. Gerettet!
Epilog
Lautschlüssel
Der Film war echt irre!«, seufzt Liam zufrieden, als wir aus dem Odeon kommen.
Die Abendluft ist angenehm warm und rund um den Leicester Square wimmelt es immer noch von Menschen.
Liam schaltet sein Handy wieder ein, während ich die letzten Popcornkrümel aus meiner Tüte fische. Wir haben gerade Lieferung um Mitternacht gesehen und können es kaum erwarten, all die Ungereimtheiten und Logikfehler aufzuzählen.
»Ich wusste gleich, dass es der Fensterputzer war«, sage ich grinsend. »Er war viel zu neugierig. Und was den Ermittler angeht – Gott, war der schwer von Begriff. Brianna hätte einen Riesenspaß gehabt! Was hat sie noch mal gesagt, weswegen sie nicht mitkommen konnte?« Liam ist mein bester Freund, aber Brianna kommt gleich danach. Wir drei machen super viel zusammen.
»Oh … äh, ich glaube, sie hatte noch Hausaufgaben zu erledigen«, antwortet Liam.
Ich lache. »Das ist mal wieder typisch Brianna. Der vorletzte Ferientag und sie fängt endlich damit an.« Liam und ich machen unseren gesamten Schulkram immer schon zu Beginn der Ferien, während Brianna lieber alles bis zur allerletzten Sekunde aufschiebt. Ich habe sogar mal gesehen, wie sie noch auf dem Weg zur Schule etwas in ihr Heft gekritzelt hat – im Gehen, wohlgemerkt.
Liam ist zu sehr in sein Handy vertieft, um etwas zu erwidern, also schlendere ich zum nächsten Mülleimer und entsorge meine leere Popcorntüte. Ganz in der Nähe steht ein Pappaufsteller mit einem Poster, das in großen Buchstaben ein GIGANTISCHES FEUERWERKSSPEKTAKEL! ankündigt. Ich überfliege die Angaben. Das besagte Spektakel – »mehr als 15.000 Feuerwerkskörper!« – soll nächsten Sonntag am Themseufer stattfinden.
»Ist September nicht ein bisschen früh für das jährliche Stadtfeuerwerk?«, frage ich, als Liam sich zu mir gesellt. »Findet das nicht sonst immer erst im November statt? Irgendwann rund um die Guy Fawkes Night? Und ich bin mir sicher, dass es bis jetzt immer an einem Samstag war«, sage ich nachdenklich.
Statt einer Antwort hält Liam mir sein Handy unter die Nase und meint: »Guck mal.« Es ist eine Nachrichtenseite:
Während ich die roten Buchstaben lese, spüre ich, wie in mir eine inzwischen vertraute Aufregung hochsteigt. Es ist fünf Wochen her, seit ich meinen letzten Fall gelöst und aufgedeckt habe, woher der rote Schleim kam, der das Londoner Wasser verunreinigt hatte. Es juckt mir in den Fingern, endlich wieder loszulegen. Die letzte Zeit war definitiv zu ruhig für mich. Ohne einen einzigen Fall konnte ich die Sommerferien gar nicht richtig genießen!
Ich nehme Liams Handy und tippe hastig auf den Link. Besonders viele Informationen gibt es allerdings noch nicht:
Heute Abend, kurz nach Ende der Öffnungszeiten, wurde ein Mitarbeiter des British Museum erstochen aufgefunden. Die Polizei hat noch keine Details zur Identität des Opfers veröffentlicht, doch Gerüchten zufolge soll es sich um einen Museumswärter handeln. Erste Indizien deuten darauf hin, dass er einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt haben könnte, denn aus einer der Vitrinen soll ein Ausstellungsstück verschwunden sein.
Ich kann meine Begeisterung kaum verbergen. »Endlich, ein richtiger Fall!« Als ich Liam sein Handy zurückgebe, fange ich seinen Blick auf. »Komm schon – dem müssen wir nachgehen!«
Er mustert mich kritisch. »Agatha, bitte sag mir, dass du dich nicht ernsthaft darüber freust, dass jemand ermordet worden ist …«
Ich laufe knallrot an. Hoffentlich merkt er es nicht. »Natürlich nicht.« Ich betrachte meine Fingernägel, die ich schwarz lackiert und mit silbernen Sternchen verziert habe. Die Sternchen sind mir wirklich gut gelungen …
»Außerdem«, fährt er fort, »ist das eine Mordermittlung. Da kannst du nicht einfach so reinspazieren.«
Das ist exakt die Art von Herausforderung, für die ich lebe. »Und ob ich da reinkomme. ›Kein Fall ist uns zu sonderbar‹, schon vergessen?« Das ist das Motto der Agentur Oddlow, unseres Detektivbüros. Ich hatte die Nase voll davon, dass sich alle ständig über meinen Namen lustig machten (Sonderbar, No-Go, Plumpsklo … Oddly war da fast noch das Netteste), und deswegen beschlossen, dem Ganzen eine positive Note zu verleihen.
»Aber so sonderbar wirkt dieser Fall eigentlich gar nicht …«, erwidert Liam zweifelnd.
Um keine weitere Zeit zu verschwenden, packe ich ihn kurzerhand am Arm und bahne mir mit ihm im Schlepptau einen Weg durch die Menschenmassen am Leicester Square zur U-Bahn. Während Liam hinter mir herstolpert, liest er sich auf seinem Handy den Rest der Meldung durch. »Hier steht, dass sie das gesamte Museumsgebäude abgeriegelt haben. Da kommt also keiner rein – nicht mal du.«
»Wer sagt denn, dass ich den Vordereingang nehme?« Ich drehe mich um und werfe ihm einen vielsagenden Blick zu. Mit meiner freien Hand greife ich nach dem Schlüssel meiner Mum, den ich an einer Kette um den Hals trage. Er ist nicht bloß ein Erinnerungsstück: Der Schlüssel stammt von einer Geheimorganisation namens Torwächtergilde und verschafft seinem Besitzer Zutritt zu den Tunneln und Gängen unter London.
Liam runzelt die Stirn. »Du kriegst echt Ärger, wenn Professor D’Oliveira rausfindet, dass du die Tunnel benutzt, bevor du mit deiner Prüfung begonnen hast.«
Professor D’Oliveira ist meine Kontaktperson bei der Gilde. Wenn ich eine ihrer Agentinnen werden will – eine Torwächterin, wie meine Mum es war (und das will ich wirklich, wirklich sehr) –, muss ich erst die Torwächterprüfung schaffen, die aus drei einzelnen Tests besteht.
Ich seufze. »Ich weiß … aber ich hätte nicht gedacht, dass das so lange dauert! Ich warte jetzt schon seit fünf Wochen!«
»Ja, aber denk doch mal darüber nach, was passiert, wenn sie dich erwischen! Professor D’Oliveira hat ausdrücklich gesagt, dass du keine Torwächterin werden kannst, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Du wärst am Boden zerstört.«
Ich verdrehe die Augen. »Aber ich mache es ja nur dieses eine Mal. Das kriegen sie doch bestimmt nicht mit, oder? Ich bin mir sicher, dass ich ihnen aus dem Weg gehen kann.«
Liam schüttelt meine Hand ab.
»Kommst du nicht mit?«, frage ich überrascht. Normalerweise ist Liam sofort dabei, wenn es etwas Spannendes zu erleben gibt.
»Agatha, du bist meine beste Freundin – aber du redest gerade davon, dich in eine Mordermittlung einzumischen und gleichzeitig deine Chancen, eine Agentin der Gilde zu werden, aufs Spiel zu setzen.«
Ich beschließe, mich ganz auf seinen ersten Einwand zu konzentrieren und den zweiten schlichtweg zu ignorieren. »Ich mische mich nicht ein«, erwidere ich empört, »ich suche lediglich nach Hinweisen …«
»… und kommst dabei möglicherweise der Polizei in die Quere, die ebenfalls genau das tut.«
Ich halte einen Moment inne und überlege, ob ich versuchen soll, ihn auf meine Seite zu ziehen. Doch er hat seinen entschlossenen Gesichtsausdruck aufgesetzt. Und ich weiß: Da ist nichts zu machen.
»Okay«, gebe ich mich geschlagen. »Kein Thema – dann guck du doch einfach, was in den Nachrichten über den Mord berichtet wird, und wir vergleichen unsere Notizen am Donnerstag in der Schule.«
»Wie du meinst … aber sei einfach vorsichtig, ja?«
»Mach dir keinen Kopf. Ich besorge mir einen Löffel und grabe mir meinen eigenen Tunnel«, sage ich in Anspielung auf einen unserer Lieblingsfilme.
»Na, solange du einen Plan hast«, antwortet er mit unüberhörbarem Sarkasmus (auch wenn der gewünschte Effekt dadurch zunichtegemacht wird, dass er sich sichtlich anstrengen muss, nicht loszuprusten).
»Ich habe immer einen Plan.«
»Soll ich dir Bescheid geben, wenn in den Nachrichten weitere Informationen veröffentlicht werden?«, fragt er.
»Oh, das habe ich ganz vergessen, dir zu sagen! Dad hat den losen Ziegelstein entdeckt und ihn festgemauert. Wir können unser Geheimversteck also nicht mehr nutzen.«
»Ernsthaft? Hättest du ihn nicht davon abhalten können?«
Ich zucke mit den Schultern. »Ich habe es erst gemerkt, als er das ›Problem‹ bereits behoben hatte. Wir müssen uns eben etwas Neues überlegen, wie wir einander Nachrichten zukommen lassen können.«
Liam schüttelt traurig den Kopf. »Ich mochte unseren Stein«, seufzt er, als hätten wir einen guten Freund verloren.
Ich zucke erneut mit den Schultern. »Hör mal, ich muss dann jetzt los, okay? Wir sehen uns Donnerstag in der Schule.« Ich winke kurz zum Abschied und jogge dann die letzten Meter zur U-Bahn-Station.
Während ich am Bahnsteig stehe und auf die nächste U-Bahn warte, spüre ich, wie mein Adrenalinspiegel steigt. Heute Abend bin ich nicht Agatha Oddlow, Stipendiatin an einer teuren Londoner Privatschule, sondern Agatha Oddly, Privatdetektivin. Nicht umsonst bin ich nach der weltberühmten Krimiautorin Agatha Christie benannt.
Auf der Fahrt lasse ich mich vom Rhythmus der Bahn dahintragen und lege mir einen Plan zurecht, wie ich ins Museum gelangen kann. Ich verfüge über die nützliche Fähigkeit, mich »wegzappen« zu können: Ich blende aus, was um mich herum vorgeht, um so Zugriff auf andere Bereiche meines Gehirns zu erhalten. Diese Technik wende ich auch jetzt an. Ich schließe die Augen und konzentriere mich ganz auf die bevorstehende Aufgabe. Klar ist schon mal, dass ich ein Kostüm brauchen werde. Und einen plausiblen Grund, warum ich mich nach Ende der Öffnungszeit im Museum aufhalte.
Als ich am Hyde Park ankomme, habe ich alles minutiös ausgearbeitet und kann es kaum erwarten, endlich loszulegen.
Während ich am Ufer des Serpentine entlangeile, wandert mein Blick automatisch zu den Bänken hinüber, um nachzusehen, ob mein alter Freund JP dort irgendwo sitzt. Dann fällt mir wieder ein, dass JP nicht mehr obdachlos ist und deswegen auch nicht mehr im Park hausen muss. Er hat einen Job gefunden, zu dem sogar ein kleines Apartment gehört, das er billig mieten kann. Natürlich freue ich mich wahnsinnig für ihn, aber unsere täglichen Gespräche fehlen mir schon irgendwie.
Als das Groundskeeper Cottage in Sicht kommt, konzentriere ich mich wieder ganz auf meinen Plan. Zunächst muss ich dafür sorgen, dass mein Dad, Rufus, mich sieht, damit er denkt, ich würde in mein Zimmer gehen und mich schlafen legen. Außerdem scheint es unendlich lange her zu sein, dass ich mein Popcorn aufgegessen habe, von daher sollte ich mir vermutlich noch ein Sandwich machen, bevor ich losziehe.
»Hey, Dad!«
»Hi, Aggie. Wie war der Film?«
»So mies, dass er schon wieder gut war – echt zum Schießen!« Ich gehe zum Küchentisch, wo Dad gerade in irgendwelche Pläne für die Parkgestaltung vertieft ist, und gebe ihm einen Kuss auf die Wange.
»Das ist schön. Hast du schon was gegessen?«
»Nur Popcorn«, gestehe ich (Dad mag es nicht, wenn ich Mahlzeiten auslasse).
»Dann solltest du dir ein Sandwich machen«, rät er.
Ich grinse. »Kannst du Gedanken lesen?«
Ich mache mich an die Arbeit. Als Erstes streiche ich mir Butter aufs Brot, dann Erdnussbutter und zum Schluss noch eine Schicht Salatmayonnaise. Diese Kombination habe ich bisher noch nicht ausprobiert, aber ich experimentiere immer gerne. Vor einigen Monaten bin ich dabei ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, als ich versucht habe, ein Meisterwerk aus einem französischen Kochbuch nachzukochen. Das Ergebnis war die reinste Katastrophe – und hat meinem Selbstbewusstsein einen herben Schlag versetzt –, aber inzwischen bin ich wieder offen für neue kulinarische Erfahrungen.
Während ich die beiden Brotscheiben aufeinanderlege, gehe ich im Kopf den Plan noch mal in allen Einzelheiten durch. Ich werde einige Schlüssel aus Dads Sammlung als oberster Gärtner brauchen – er hat Unmengen davon, die alle irgendwelche Tore oder Gitter im Hyde Park öffnen.
Doch Dad reißt mich jäh aus meinen Gedanken. »Ich werde morgen früh übrigens nicht hier sein.«
»Ach ja? Wieso?« Ich sehe mich nach dem Brotmesser um. Sandwiches schmecken immer besser, wenn man sie in Dreiecke schneidet.
»Na ja, ich … ähm, ich habe einen Termin mit einer Orchideenexpertin von der Royal Horticultural Society.«
Etwas an seinem Tonfall kommt mir merkwürdig vor. Ich drehe mich um und sehe ihn an. »Eine Orchideenexpertin?«
»Ja … eine namhafte … und sie hat nur frühmorgens Zeit. Deswegen werde ich nicht hier sein, wenn du aufstehst.«
Er räuspert sich und wendet sich wieder den Plänen vor ihm auf dem Tisch zu. Etwas zu konzentriert, um glaubhaft zu sein, wenn man mich fragt. Aber ich habe jetzt keine Zeit, mir Gedanken darüber zu machen, was Dad wohl im Schilde führt. Wenn ich den Tatort inspizieren will, bevor die Polizei sämtliche Beweise eintütet und mitnimmt, muss ich los.
»Okay, ich geh dann mal hoch.«
Dad wirft einen Blick auf die Uhr. »Es ist erst halb neun. Ist das nicht ein bisschen früh für dich?«
»Es ist allgemein bekannt, dass Teenager mehr Schlaf brauchen als Erwachsene.«
»Das ist mein Part«, erwidert er stirnrunzelnd. »Was heckst du jetzt wieder aus?«
Ich setze meine unschuldigste Unschuldsmiene auf. »Nichts. Ich muss bloß noch was für Englisch lesen und möchte noch mal die Aufsätze durchgehen, die ich zu Beginn der Ferien geschrieben habe.« Ich schnappe mir meinen Teller und laufe zur Küchentür. »Bleib nicht zu lange auf, Dad. Bis morgen!«
»Okay … gute Nacht, Liebes.«
Ich lege einen Zwischenstopp im ersten Stock ein und schleiche in Dads Zimmer, wo unser Kater Oliver zusammengerollt auf dem Bett liegt und schläft. Dad findet, dass Katzen im Bett nichts zu suchen haben, aber das interessiert Oliver nicht im Geringsten. Ich angle mir die Schlüssel, die ich brauche, von Dads überquellendem Schlüsselbrett und stecke sie ein.
Während ich die Treppe zum Dachgeschoss hochsteige, schlinge ich mein Sandwich runter. Igitt. Diese Kombi probiere ich definitiv nicht noch mal aus! Ich stelle den leeren Teller auf meinem Nachttisch ab und blicke mich zufrieden in meinem Zimmer um. Es befindet sich auf dem Dachboden unseres kleinen Häuschens und ist randvoll mit allen möglichen interessanten Gegenständen und Artefakten: Muscheln, Federn und Fossilien, Zeitungsausschnitte und raffinierte Verkleidungen. Dazwischen steht eine Büste von Königin Victoria, die ich in einem Schuttcontainer gefunden habe, und an der Wand hängt ein Poster mit allen Augenfarben, die es gibt, und den dazugehörigen Codes, die ich in- und auswendig gelernt habe. An der Dachschräge über meinem Bett habe ich ein Porträt meiner Lieblingskrimiautorin Agatha Christie aufgehängt und an der Tür klebt ein etwas kleineres Bild von einer ihrer berühmtesten Figuren, Hercule Poirot.
Kurz wandern meine Gedanken zurück zur Gilde und – noch wichtiger – zur Prüfung. Das Thema geht mir schon den ganzen Sommer nicht aus dem Kopf wie ein lästiger Ohrwurm. Es macht mich nervös, dass es jeden Moment mit der ersten Aufgabe losgehen könnte, sogar mitten in der Nacht, und ich dann bereit sein muss. Das ist wahrscheinlich auch der Sinn des Ganzen: Wer nicht jederzeit Gewehr bei Fuß steht, hat in der Gilde nichts zu suchen. Aber es wäre schon schön, wenn sie langsam mal zu Potte kommen würden.
Ich nehme meine rote Baskenmütze ab – mein absolutes Lieblingskleidungsstück – und lege sie vorsichtig zurück in ihre Schachtel. Dann gehe ich zu den beiden Kleiderstangen mit meinen Klamotten und mache mich auf die Suche nach der passenden Ausrüstung.
Glücklicherweise habe ich die Gegebenheiten im British Museum bei meinen vorherigen Besuchen ausgekundschaftet. Ich schließe die Augen und zappe mich durch den Bereich meines Gehirns, wo ich die entscheidenden Informationen abgelegt habe. Vor meinem inneren Auge sehe ich eine Reihe altmodischer Aktenschränke. Ich gehe zu dem, in dem ich mein Wissen über Uniformen aufbewahre, und blättere durch die handbeschrifteten Kärtchen, bis ich zu »M« wie »Museum« komme. Von da ist es nicht mehr weit bis zur Unterkategorie »B« wie »British«. Hier sind sämtliche Uniformen, die ich im British Museum gesehen habe, als imaginäre Fotos abgeheftet. Ich möchte mich als Wärterin einschleichen, weil das für jemanden in meinem Alter am glaubwürdigsten ist. Die Uniform, die ich aus meinem geistigen Aktenschrank ziehe, ist einfach und schlicht: schwarze Hose und weiße Bluse.
Ich durchstöbere meine Klamotten, bis ich etwas Passendes finde. Aus einer Schachtel unter dem Kleiderständer hole ich einen Gürtel aus schwarzem Kunstleder und ein Paar Doc Martens mit dicken Gummisohlen, die mich ein paar Zentimeter größer machen. Die Schuhe habe ich günstig in einem Secondhandshop erstanden – ein echter Glücksfund – und ich liebe sie heiß und innig. Dann ziehe ich mein knielanges rotes Hemdblusenkleid aus (noch ein Lieblingsstück aus dem gleichen Laden) und tausche es gegen die schwarze Hose und die weiße Bluse. Als Nächstes kommen die Accessoires: ein Angestelltenausweis, den ich mit einem Band an meinem Gürtel befestige, und ein Namensschild, auf dem steht, dass ich »Felicity« heiße. Das ist der Name, den ich verwende, wenn ich im Internet unterwegs bin. Ich habe ihn mir von Hercule Poirots Sekretärin Felicity Lemon geborgt. Zu guter Letzt binde ich meine Haare zu einem losen Dutt und setze zur Tarnung noch eine Brille mit dickem Rahmen auf. Ich besitze eine ganze Kommode voll mit solchen Accessoires: falsche Wimpern, Sonnenbrillen, Kopftücher, täuschend echt aussehende Narben zum Aufkleben, buschige Augenbrauen … Zum Schluss schnappe ich mir die Schlüssel und stecke sie zusammen mit meiner Detektiv-Standardausrüstung – ein kleiner Notizblock mit Stift, eine LED-Stirnlampe, ein Satz Dietriche und ein Plastikröhrchen mit einem sterilen Wattestäbchen – in die Hosentasche. Die ist jetzt proppenvoll und ziemlich ausgebeult, aber ich will die Sache nicht noch komplizierter machen, indem ich eine Tasche mitnehme, die ich dann möglicherweise irgendwo zurücklassen muss.
Fertig. Ich betrachte mich im Spiegel.
Sieht ziemlich überzeugend aus.
Ich ziehe einen langen Plastik-Regenmantel über, damit mein Outfit unterwegs nicht schmutzig wird. Das Ding ist eine von diesen formlosen Scheußlichkeiten, wie sie Touristen kaufen, die nach London gereist sind, ohne daran zu denken, dass es in Großbritannien öfter mal regnet. Normalerweise würde ich mich mit so was niemals in der Öffentlichkeit zeigen. Aber was muss, das muss.
»Bis später, Mum«, sage ich zu dem Foto meiner Mutter, das neben meinem Bett steht. Darauf trägt sie einen langen, fließenden Rock, eine große Sonnenbrille und einen Schlapphut. Ich mag ihren Stil – bequem, aber schick. Sie hält ihr Fahrrad fest, als würde sie jeden Moment aufsteigen und losfahren. Auf dem Gepäckträger türmt sich wie immer ein riesiger Bücherstapel. Die Polizei meinte später, wegen dieses Bücherstapels sei das Fahrrad schwer zu lenken gewesen. Deshalb habe Mum die Kontrolle darüber verloren, sei gegen ein Auto geprallt und tödlich verunglückt. Doch das glaube ich nicht. Nicht zuletzt deshalb, weil ich ihr Fahrrad gefunden habe und es nicht den kleinsten Kratzer hatte. Wenn ich in die Torwächtergilde aufgenommen werde, kann ich vielleicht herausfinden, in welcher Angelegenheit meine Mutter damals ermittelt hat. Und vielleicht liefert mir das endlich ein paar Antworten.
Tief Luft holen – jetzt kommt der schwierige Teil.
Ich schalte das Licht in meinem Zimmer aus. Falls Dad hochkommt, um nach mir zu sehen, soll er nicht denken, ich sei noch wach. Im Dunkeln bahne ich mir einen Weg durch mein herumliegendes Zeug und klettere aufs Bett. Der Abendhimmel ist wolkenverhangen, aber gerade noch hell genug, dass ich das Dachfenster ausmachen kann. Ich öffne es, halte mich am Rahmen fest und ziehe mich nach draußen, bis ich rittlings auf dem Dachfirst sitze.
Oben halte ich einen Augenblick inne. Ich mag diesen Platz. Es geht eine leichte Brise und nun, da der Sommer langsam zu Ende geht, ist es nachts weder zu warm noch zu kalt.
In der Ferne, dort wo der Park aufhört, kann ich die funkelnden Lichter von Kensington erkennen. In Gedanken unterteile ich meine Mission in mehrere Phasen. Phase eins: mich von zu Hause wegstehlen, ohne dass Dad etwas merkt. Phase zwei: durch einen langen, ungemütlichen Tunnel schleichen. Phase drei: ins Museum kommen.
Ich hole erneut tief Luft.
Also dann. Zeit zu gehen.
Ich schwinge ein Bein über den Dachfirst und rutsche zur Dachkante vor, wo ich ganz vorsichtig den rechten Fuß ausstrecke und damit so lange in der Luft herumtaste, bis ich auf den Ast der uralten Eiche stoße. Dann folgt der linke Fuß. Jetzt kommt der beängstigendste Teil. Ich muss das Dach loslassen und darauf vertrauen, dass es auch der Rest meines Körpers sicher hinüberschafft …
Natürlich schafft er es, schließlich klettere ich an diesem Baum hoch und runter, seit ich zehn war. Während ich mich mit beiden Armen am Stamm festklammere, tastet mein Fuß nach dem nächsten Ast und so hangele ich mich langsam abwärts. Zum Glück habe ich an den Regenmantel gedacht, denn sonst wäre die weiße Bluse jetzt voller Moos und Flechten.
Mit einem Satz springe ich vom letzten Ast auf Dads perfekt getrimmten Rasen, wobei ich darauf achte, dass sich die Eiche zwischen mir und dem Küchenfenster befindet. Dad darf mich auf keinen Fall sehen. Ich hole ein letztes Mal tief Luft, dann renne ich durch unser Gartentor hinaus in den Park und ins Dunkel der Nacht.
Phase eins: abgeschlossen.
Um in das unterirdische Tunnelnetzwerk der Torwächtergilde zu gelangen, muss ich durch ein Gitter beim Serpentine-See. Ich laufe die kurze Rampe hinab, die zu dem dunklen, abgesperrten Tunneleingang führt. Als ich vor dem Gitter stehe, fische ich Dads Schlüsselbund aus der Tasche und suche den richtigen Schlüssel heraus. Ich stecke ihn ins Schloss – doch aus irgendeinem Grund passt er nicht richtig hinein und lässt sich somit auch nicht drehen.
Nachdem ich es eine Weile erfolglos versucht habe, gebe ich auf und lasse mich auf den vom Tau feuchten Boden plumpsen. Was jetzt?
In meinem Kopf höre ich die Stimme von Hercule Poirot mit ihrem vertrauten belgischen Akzent: »Venez, Mademoiselle Oddlow, wir werden uns doch nicht von un petit Schloss auf’alten lassen, n’est-ce pas?«
Auch wenn Poirot bloß eine erfundene Figur ist, schafft er es doch immer wieder, mich auf neue Gedanken zu bringen. Warum lässt sich der Schlüssel nicht drehen? Vielleicht blockiert ja irgendwas den Mechanismus. Ich stehe auf und nehme das Vorhängeschloss genauer unter die Lupe. Tatsächlich, da steckt eine Tannennadel im Schlüsselloch! Mit Daumen und Zeigefinger fummele ich die Nadel heraus, dann schiebe ich den Schlüssel wieder hinein. Diesmal lässt er sich problemlos drehen. Ich ziehe das Gitter auf, zwänge mich hindurch und mache es hinter mir wieder zu.
Unwillkürlich läuft mir ein Schauer über den Rücken, als ich an das letzte Mal hier unten denke. Damals war der Tunnel voller giftiger Rotalgen und Liam und ich hatten Atemschutzmasken tragen müssen, um uns vor den giftigen Dämpfen zu schützen. Aber auch ohne den stinkenden Schleim ist es hier nicht gerade behaglich.
Ich hole die Stirnlampe aus meiner Tasche, schalte sie ein und setze sie auf. Das Licht ist so hell, dass ich mühelos den schmutzigen Betonboden erkennen kann. Die Decke aus bröckelndem Backstein ist unangenehm niedrig, selbst für eine Dreizehnjährige von durchschnittlicher Körpergröße, sodass ich gezwungen bin, den Kopf einzuziehen. Seufzend mache ich mich auf den ungemütlichen Weg durch den langen, abschüssigen Tunnel, der mich immer weiter in die Tiefe führt.
Angesichts der tonnenschweren Erdschicht über mir kostet es mich alle Mühe, Bilder von einstürzenden Tunneln zu ignorieren, die unwillkürlich vor meinem inneren Auge auftauchen. Immer wieder schürfe ich mir Handflächen und Fingerknöchel an den rauen Backsteinwänden auf und wegen der unnatürlichen Kopfhaltung habe ich schon bald tierische Nackenschmerzen. Außerdem muss ich alle paar Meter stehen bleiben, um meine brennenden Beine zu massieren, die es nicht gewohnt sind, so lange in Hockstellung zu laufen.
Mir wird erst klar, dass ich die ganze Zeit schon den Atem anhalte, als der Tunnel in ein hohes, weites Gewölbe übergeht und ich keuchend nach Luft schnappe – als wäre ich den gesamten Weg getaucht. Ich muss über mich selber lachen. Vor lauter Anspannung habe ich es mir unnötig schwer gemacht! Ich strecke meinen Rücken und schüttele mich. Was für eine Erleichterung, endlich wieder aufrecht stehen zu können.
Phase zwei: abgeschlossen.
Am hinteren Ende des Gewölbes befindet sich eine mit Nieten beschlagene Eisentür, die aussieht wie der Eingang zu einer mittelalterlichen Burg. Sie ist so verrostet, dass sie sich farblich perfekt in die Ziegelmauer darum herum einfügt, was sie nahezu unsichtbar macht. Jetzt ist der nächste Schlüssel an der Reihe: der, von dem ich Professor D’Oliveira versprochen habe, ihn nicht mehr zu benutzen.
Ich angle die silberne Kette unter meinem Shirt hervor und stecke den großen, altmodischen Schlüssel ins Schloss. Mums Schlüssel. Einen kurzen Augenblick sehe ich sie vor mir, wie sie damit alle möglichen Geheimtüren und -tore aufschließt. Jedes Mal, wenn ich ihn benutze, fühle ich mich ihr ganz nahe.
In dem gut geölten Schloss lässt er sich geräuschlos drehen. Ich lege meine Stirnlampe auf den Boden und schiebe die Tür vorsichtig einen kleinen Spaltbreit auf – gerade weit genug, um mich zu vergewissern, dass niemand da ist –, dann trete ich ein und ziehe sie hinter mir zu.
Das war viel zu einfach. Die Torwächtergilde sollte dringend ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärfen.
Ich laufe durch einen langen, gut beleuchteten Korridor, der mit einem flauschigen roten Teppich ausgelegt ist. Nach ein paar Hundert Metern weicht der Teppich nacktem Stein. Von hier ist es nicht mehr weit bis zu den Fahrradständern. Dort stehen Hunderte Fahrräder aller Art bereit, von Hightech-Mountainbikes und anderen geländegängigen Modellen bis hin zu Citybikes und Hollandrädern. Das Tunnelnetz der Gilde erstreckt sich meilenweit, weswegen ihre Mitglieder gerne auf die Fahrräder zurückgreifen, um darin herumzukommen. Das spart Zeit und Energie. Ich nehme mir einen Moment und versuche, von den Fahrrädern Rückschlüsse auf ihre Besitzer zu ziehen. Das große, schwere schwarze Mountainbike da vorne gehört bestimmt einem Mann mit ernsthaftem Auftreten und einem dunklen Anzug. Das rosafarbene, über und über mit Glitzer verzierte Barbiemodell dagegen hat sich wohl jemand von seinem Kind ausgeliehen. Ich weiß schon, welches ich nehmen werde: das von meiner Mum, ein babyblaues Damenrad mit Körbchen. Professor D’Oliveira hat versprochen, es für mich aufzubewahren.
Aber ich kann es nirgendwo finden.
Ich gehe die Fahrradständer auf und ab, doch es ist definitiv nicht hier. Hat jemand anderes es sich geschnappt? Oder wird es bloß an einem sichereren Ort aufbewahrt? Ich nehme mir vor, die Professorin danach zu fragen. Trotzdem versetzt es mir einen Stich, dass es weg ist. Als hätte ich einen weiteren Teil meiner Mum verloren. Es ist nur ein Fahrrad, rufe ich mir ins Gedächtnis. Ich spiele mit dem Gedanken, einfach ein anderes zu benutzen, aber das kommt mir irgendwie wie Stehlen vor. Ich werde also wohl laufen müssen.
Langsam jogge ich los und werde dann nach und nach schneller, bis ich ein Tempo erreiche, in dem ich gut vorankomme. Der Boden im Haupttunnel ist ungewöhnlich glatt – wahrscheinlich von den Füßen unzähliger Torwächter, die hier im Laufe von wer weiß wie vielen Jahren entlanggegangen sind. Schließlich entdecke ich eine schmalere Passage, die nach rechts abzweigt. Ein Schild zeigt an, dass es hier zum British Museum geht. Ich biege ab und stehe bald darauf vor einem Metallgitter, das vom Boden bis hoch zur Decke reicht. Auch dieses Schloss kann ich mit meinem magischen Schlüssel öffnen. Ich trete hindurch, schließe das Tor hinter mir wieder und lasse meinen abscheulichen Regenmantel am Fuß einer kurzen Steintreppe zurück, die hinauf zum Museum führt. Oben versperrt mir eine Holztür den Weg. Eine Umdrehung meines Schlüssels und ich bin drin.
Ich finde mich in einem winzigen Raum wieder, der bis auf eine Treppe nach oben völlig leer ist. In lockerem Trab laufe ich hinauf. Ich habe den ganzen Sommer über trainiert, deswegen bin ich gerade in ziemlich guter Form, und es dauert nicht lange, bis ich das Ende der Treppe erreiche. Wenn mich mein Gefühl nicht täuscht, müsste das hier das Erdgeschoss des Museums sein. Vor mir befindet sich eine Tür mit einem schmutzigen Fenster. Ich wische mit der Hand darüber und stelle fest, dass sie auf einen langen Korridor hinausführt. Weit und breit ist niemand zu sehen, sodass ich unbemerkt durch die Tür schlüpfen kann. Leise mache ich mich auf den Weg zum Eingangsbereich des Museums.
Phase drei: abgeschlossen.
Ich kenne mich im British Museum ziemlich gut aus. Dad war unzählige Male mit mir hier, wann immer es eine neue, spannende Ausstellung gab, und so laufe ich jetzt leise, aber bestimmt durch den öffentlich zugänglichen Teil des Gebäudes. Unterwegs begegne ich niemandem, doch als ich mich dem Bereich nähere, wo sich der Mord ereignet hat, kann ich Stimmen hören. Vorsichtig gehe ich auf die Tür zu, bemüht, keine Aufmerksamkeit zu erregen. Als ich den Raum betrete, ziehe ich Stift und Notizbuch aus der Tasche, stelle mich vor die erstbeste Vitrine und tue so, als würde ich mir Notizen zu den Ausstellungsstücken machen. Falls ich erwischt werde, brauche ich eine glaubhafte Begründung, weshalb ich hier bin.
Trotz meiner sorgfältigen Planung erstarre ich vor Schreck, als plötzlich ganz in meiner Nähe eine Stimme ertönt. Haben sie mich etwa schon bemerkt?
Doch die Stimme redet nicht mit mir. »Bei dem fehlenden Stück handelt es sich also um ein Tongefäß?«
Ich schiele unauffällig hinüber. Die Stimme gehört einer Polizistin, deren hellbraunes Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden ist. Sie schreibt sich etwas auf.
Der Mann, an den ihre Frage gerichtet war, ist etwa Mitte dreißig, mit kurz geschorenem Haar und einer runden Brille, die er andauernd zurechtrückt. Er ist eindeutig nervös – ich kann die Schweißperlen auf seiner Stirn erkennen. In Kombination mit seinem teuren Anzug weist diese Anspannung darauf hin, dass es sich um einen hochrangigen Museumsmitarbeiter handeln muss. Ist ja eigentlich auch kein Wunder, dass er gestresst ist, immerhin ist einer seiner Angestellten bei der Arbeit ums Leben gekommen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schrecklich es sein muss, sich für so etwas verantwortlich zu fühlen.
Er räuspert sich. »Das ist korrekt, ja. Seltsame Wahl für einen Einbrecher.«
»Wieso?«
»Nun ja, sehen Sie das Artefakt, das gleich daneben platziert ist?«
Ich verrenke mir schier den Hals, um etwas zu erkennen, doch vergebens.
»Das mit dem Löwenkopf?«
»Ganz genau. Dabei handelt es sich um ein herausragendes Beispiel etruskischer Keramik. Praktisch unbezahlbar. Das Tongefäß dagegen … ist nicht besonders viel wert.«
»Sie wollen also sagen …«
»Ich will damit sagen, dass es außerordentlich merkwürdig ist, dass jemand bereit ist, für dieses Tongefäß jemanden zu töten. Aber vielleicht hat der Einbrecher das falsche Artefakt erwischt? Ich kann immer noch nicht glauben, dass einer unserer Wärter tot ist!«
»Mein aufrichtiges Beileid. Das muss eine wirklich belastende Erfahrung für Sie sein. Ich möchte Sie auch nicht länger aufhalten. Aber alles, was Sie uns sagen können, jeder noch so kleine Hinweis, kann uns dabei helfen, den Täter so bald wie möglich zu fassen.«
»Ich verstehe.«
»Hey! Wo kommst du denn her?«
Ich zucke zusammen. Als ich mich umdrehe, stehe ich einem Polizisten gegenüber, der mich missbilligend mustert. »Du solltest nicht hier sein.«
Anfängerfehler: Ich hätte auf das Geschehen hinter mir achten müssen, statt wie gebannt zu verfolgen, was sich vor mir abspielt.
»Das stimmt nicht«, widerspreche ich beflissen. »Ich soll sehr wohl hier sein, Officer. Ich mache gerade ein Schnupperpraktikum im Museum und war hinten im Archiv, um die Sammlung exoskelettaler Organismen zu katalogisieren.« Ich habe keine Ahnung, ob es so eine Sammlung gibt (oder ob »exoskelettal« überhaupt ein richtiges Wort ist), aber ich hoffe, ihn mit möglichst hochtrabenden Wörtern zu verwirren.
»Und was machst du dann hier?« Er deutet auf die Vitrine. Ich habe mir die Ausstellungsstücke darin noch gar nicht angesehen. Ein schneller Seitenblick verrät mir, dass es sich um Fruchtbarkeitsstatuen zu handeln scheint.
Mein Gehirn arbeitet auf Hochtouren.
»Ach so, ja. Ich war mit meinem heutigen Pensum früher fertig, und da meinte die Praktikumsleiterin, ich könne gerne schon mal ein wenig für mein Schulprojekt über Fruchtbarkeitsrituale in der antiken Welt recherchieren.«
»Hast du denn die Aufforderung, das Museum zu räumen, nicht gehört?«
Ich schüttele den Kopf und setze meine Unschuldsmiene auf. »Nein, ich habe nichts gehört. Warum … ist was passiert?«
»Dir hat doch bestimmt irgendjemand gesagt, dass dieser Bereich des Museums tabu ist, oder?« Meine Anwesenheit scheint ihm zutiefst zu missfallen.
Wieder schüttele ich den Kopf. Ich muss mir schnell irgendein anderes Thema einfallen lassen, um ihn abzulenken. So diskret wie möglich lasse ich den Blick über seine Uniform wandern. Viel gibt es da nicht zu sehen – Uniform ist Uniform –, aber ein paar kleine Hinweise finde ich doch.
»Mögen Sie Hunde?«, improvisiere ich. »Ich liebe Hunde!«
Seine Miene hellt sich auf. »Ich auch! Ich habe vier«, antwortet er stolz.
»Sie Glückspilz«, seufze ich. »Ich hätte auch gerne einen Hund, aber mein Dad erlaubt es nicht.«
Sein Funkgerät knistert, dann meldet sich eine Frauenstimme zu Wort, die irgendwelche Anweisungen zu geben scheint. »Oh, das ist für mich«, sagt er. »Na los, hol deine Sachen und geh nach Hause.«
»Okay … danke! Ich hoffe, mein Lehrer hat nichts dagegen, dass ich mein Projekt etwas später abgebe.«
»Tut mir leid, da kann ich dir nicht helfen. Vergiss deine Jacke nicht«, ergänzt er und zeigt auf eine Tür mit einem Schild: NUR FÜR PERSONAL.
Solange er mich beobachtet, kann ich nicht auf dem Weg zurück, auf dem ich gekommen bin, also gehe ich gehorsam in die Richtung, in die er mich schickt.
Von dort gelange ich in ein weiteres Treppenhaus. Ich renne hinunter in den Keller. Hoffentlich gibt es hier auch einen Zugang zum Tunnel. Und tatsächlich: Am Fuß der Treppe befindet sich eine Tür, die ich öffne und durch die ich erleichtert hindurchstürme.
Schnell ziehe ich die Tür hinter mir zu. Danach stehe ich allerdings komplett im Dunkeln und muss eine Weile blind umhertasten, bis ich den Lichtschalter finde. Der Geruch von feuchtem Stein steigt mir in die Nase.
Flackernd geht die nackte Glühbirne über mir an. Das Licht ist so funzelig, dass ich kaum etwas sehen kann, und wirft zudem überall seltsame Schatten.
Der Keller selbst ist nichts Besonderes. Boden, Decke und drei der vier Wände sind aus stinknormalem Beton. Nur die Wand mir gegenüber ist aus Backstein gemauert und sieht deutlich älter aus. Entlang der Wände stehen Metallregale mit allen möglichen Putzutensilien: Schwämme und Wischer, Eimer und Plastikwannen sowie eine ganze Armada an Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Ansonsten gibt es nur noch einen weiteren Gegenstand, der ganz hinten in der Ecke steht.
Das Ding ist groß wie ein Bär und so alt, dass es komplett schwarz ist. Daher brauche ich einen Moment, um zu erkennen, dass es sich um einen alten, ausgemusterten Boiler handelt. Wahrscheinlich steht er hier, weil es zu aufwendig gewesen wäre, ihn auseinanderzunehmen und die schmale Treppe hinaufzuschleppen. Die vielen Nieten und Ventile lassen das klobige Metallteil irgendwie knubbelig erscheinen. Mehrere Wasserrohre ragen aus seinem Körper, die jedoch allesamt gekappt worden sind und nun kurz vor der Decke enden.
Ich schnüffele. Es riecht nicht nur feucht, sondern auch nach Putzmittel. Das könnte an der Armee von Wischmopps liegen, die hier unten aufbewahrt werden, doch dafür ist der Geruch eigentlich zu stark und zu frisch. Im Licht der schwachen Glühbirne lasse ich den Blick über den Boden schweifen. Zur Sicherheit hocke ich mich hin und fahre mit dem Finger darüber. Staub – und zwar eine dicke Schicht davon.
Drüben beim Boiler wirkt der Boden dunkler. Ich gehe hinüber. Tatsächlich: Der Beton hier ist feucht. Offenbar wurde er erst vor Kurzem gewischt. Warum sollte jemand diese Ecke putzen, den Rest des Raumes aber nicht?
Vor meinem inneren Auge erscheint eine Polaroidkamera und schwebt vor mir in der Luft. Ich halte sie ruhig und mache damit ein paar Fotos von der Umgebung. Jedes Foto gleitet gemächlich aus dem Schlitz an der Kamera und verwandelt sich von einer undurchsichtigen schwarzen Fläche in ein buntes Farbfoto. Als ich genug Bilder gemacht habe, lege ich sie in meinem Gedächtnisarchiv ab.
Nun zur nächsten Aufgabe. Ich hole das Plastikröhrchen aus meiner Tasche und streiche mit dem Wattestäbchen über den Boden. Kann sein, dass ich mich irre, aber irgendwas an diesem feuchten Fleck kommt mir komisch vor. Ich verstaue das Wattestäbchen sicher in seinem Röhrchen, um es später in Briannas Geheimlabor zu untersuchen.
Dann nehme ich den ausgemusterten Boiler genauer unter die Lupe. Auch er ist mit einer dicken Staubschicht überzogen und offensichtlich schon lange außer Betrieb. Da die Rohre abgetrennt worden sind, kann die Feuchtigkeit nicht von ihm stammen.
Ich sehe nach, ob ich hinter dem Boiler etwas finde, doch dort ist es so dunkel, dass ich nichts erkennen kann. Zum Glück habe ich eine kleine Taschenlampe an meinem Schlüsselbund, die Dad mir letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt hat. Damit leuchte ich in die dunkle Ecke. Immer noch nichts. Obwohl … Ich schaue genauer hin. Na bitte! Sieht aus, als wäre da ein Loch in der Wand!
Aus diesem Winkel kann ich nicht hineingucken, aber die Rückseite des Boilers ist komplett staubfrei. Als wäre jemand dort hinten herumgekrabbelt.
Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ich stecke die Taschenlampe zwischen meine Zähne und zwänge mich in gebückter Haltung am Boiler vorbei in den winzigen Freiraum dahinter. Jetzt kann ich es besser sehen. Genau wie ich vermutet habe: Da ist ein Loch in der Ziegelmauer, groß genug, dass ein Erwachsener hindurchkriechen könnte. Offenbar wurde der Boden hier nicht geputzt, denn ich kann die schwachen Umrisse eines Stiefelabdrucks im Staub ausmachen. Es muss also vor Kurzem jemand durchgekommen sein!
![Agatha Oddly. Das Verbrechen wartet nicht [Band 1] - Lena Jones - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4d525a2d44e7b97f058e74022cb9264f/w200_u90.jpg)
![Agatha Oddly. Die London-Verschwörung [Band 2] - Lena Jones - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/17124f731c69daad345eb40f7c1830f7/w200_u90.jpg)
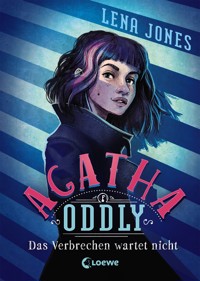
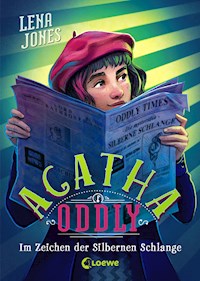













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











