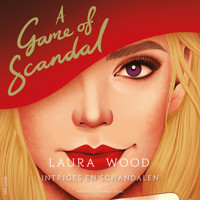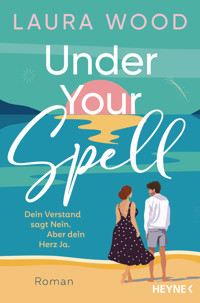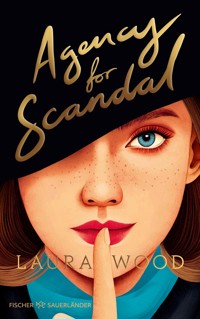
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die "Agency for Scandal"-Reihe
- Sprache: Deutsch
Historical Romance mit feministischer Detektiv-Handlung: Das perfekte Wohlfühl-Buch für alle Leser*innen ab 14! Izzy Stanhope hat viele Geheimnisse: etwa, dass sie Hals über Kopf in einen Duke verliebt ist, der nicht einmal weiß, dass sie existiert. Oder dass ihre Familie hoch verschuldet ist, was niemand je erfahren darf. Und dann ist da noch die Tatsache, dass sie mühelos jedes Schloss knacken kann und sich regelmäßig als Straßenjunge verkleidet. Denn Izzy arbeitet in einer besonderen, rein weiblichen Detektei: Zusammen mit anderen Detektivinnen deckt sie Skandale in der High Society auf, bewahrt Frauen vor dem Verruf und zieht mächtige Männer zur Rechenschaft. Als Izzy in einen Juwelendiebstahl verwickelt wird, setzt sie nicht nur den Ruf ihrer Familie aufs Spiel, sondern auch ihr Herz. Denn ausgerechnet »ihr« Duke ist tiefer in den Fall verstrickt, als Izzy lieb ist. Zudem besitzt er das nervtötende Talent, ihre sorgsam gehüteten Geheimnisse eines nach dem anderen ans Licht zu bringen … Historical Romance mit einer cleveren Detektivin und jeder Menge Glamour, Intrigen und Feminismus: DasCosy Crime-Buch für alle Leser*innen ab 14! - Zum Niederknien charmant, modern und überaus romantisch ... Jane Austen wäre entzückt! - Der perfekte Lesestoff für Fans von »Anatomy« und »Enola Holmes« für alle ab 14 Jahren - Band 2 »Season for Scandal« erscheint im Frühjahr 2025!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Laura Wood
Agency for Scandal
Band 1
Über dieses Buch
Erfolgsgenre Historical Romance mit feministischer Detektiv-Handlung: Das perfekte Wohlfühl-Buch für alle Leser*innen ab 14!
Izzy Stanhope hat viele Geheimnisse: etwa, dass sie Hals über Kopf in einen Duke verliebt ist, der nicht einmal weiß, dass sie existiert. Oder dass ihre Familie hoch verschuldet ist, was niemand je erfahren darf. Und dann ist da noch die Tatsache, dass sie mühelos jedes Schloss knacken kann und sich regelmäßig als Straßenjunge verkleidet. Denn Izzy arbeitet in einer besonderen, rein weiblichen Detektei: Zusammen mit anderen Detektivinnen deckt sie Skandale in der High Society auf, bewahrt Frauen vor dem Verruf und zieht mächtige Männer zur Rechenschaft. Als Izzy in einen Juwelendiebstahl verwickelt wird, setzt sie nicht nur den Ruf ihrer Familie aufs Spiel, sondern auch ihr Herz. Denn ausgerechnet »ihr« Duke ist tiefer in den Fall verwickelt, als Izzy lieb ist. Zudem besitzt er das nervtötende Talent, ihre sorgsam gehüteten Geheimnisse eines nach dem anderen ans Licht zu bringen …
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischerverlage.de/kinderbuch-jugendbuch
Biografie
Laura Wood wurde in den englischen Midlands geboren und ist preisgekrönte Schriftstellerin. Sie promovierte im Bereich Literatur des neunzehnten Jahrhunderts und schreibt Bücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Laura Wood lebt mit ihrem Mann und ihrem Hund in Warwickshire und hat eine Schwäche für Liebesromane, Tee, schönes Briefpapier, salziges Karamell und Feminismus.
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
TEIL EINS
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
TEIL ZWEI
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
TEIL DREI
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
TEIL VIER
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
TEIL FÜNF
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
[Danksagung]
[Hinweise zu sensiblen Themen]
Für Gen, Louise und Sophie –
mit euch Bücher zu machen, ist die reine Freude.
Das menschliche Herz hütet verborgene Schätze,
Im Geheimen aufbewahrt, im Schweigen versiegelt;
Die Gedanken, die Hoffnungen, die Träume,
die Freuden, deren Zauber gebrochen wird,
so sie offenbart werden.
Charlotte Brontë
TEIL EINS
LondonJuni 1897
KAPITEL 1
Wenn man während der Londoner Saison auf der Jagd nach Geheimnissen und Skandalen ist, dann gibt es keinen besseren Ort dafür als die Oper. Auf engstem Raum findet man dort fein gekleidete Menschen, die alle so tun, als würden sie das Drama auf der Bühne verfolgen, während sie sich in Wirklichkeit gegenseitig beobachten. Ein Ort wie gemacht für Intrigen. Genau aus diesem Grund war ich dort.
Ich fand schon immer, dass das Royal Opera House wie das Schaufenster einer Konditorei aussieht: ganz in Weiß und Gold und mit verschlungenen Akanthusblättern, die aussehen wie aus Zucker und nur darauf warten, dass man hineinbeißt. Und dann sind da noch die Logen mit den Sitzen aus karmesinrotem Samt, einhunderteinundzwanzig an der Zahl. Ringsherum säumen sie den Saal und reichen in ihrer goldenen Pracht über mehrere Etagen bis zur Kuppeldecke hinauf. Wenn der Theatersaal voll ist, fasst er beinahe zweitausend Menschen – zweitausend Augenpaare, zweitausend Stimmen, die den neuesten Klatsch und Tratsch austauschen. Wo gibt es das sonst noch?
»Izzy«, ertönte eine Stimme dicht an meinem Ohr. »Ist das da drüben nicht der Earl of Rathmore? Wenn ja, ist er eindeutig nicht in Begleitung seiner Frau.«
Teresa Wynter ist schon seit achtzehn Jahren meine beste Freundin, und sie ist vieles, aber ganz sicher nicht diskret. Als würden ihre unüberhörbare Stimme oder ihr strahlendes Lächeln allein nicht bereits ausreichen, um alle Aufmerksamkeit auf sie zu lenken – spätestens das blendende Zitronengelb ihres Kleides erzielte den gewünschten Effekt (»Bei der Schneiderin hatte es noch die Farbe einer blassen Primel, Iz, ganz sicher …«). Mehrere Köpfe wandten sich der Loge zu, in der wir saßen, und alle Augen blickten in unsere Richtung. Oder vielmehr: in ihre Richtung. Denn über mich glitten die Blicke hinweg. Wie gewohnt war ich kaum mehr als ein Schatten, ein Flackern im Augenwinkel der Damen und Herren der besseren Gesellschaft. Was meinen Zwecken höchst dienlich war.
Wenn man als Detektivin für eine Geheimagentur arbeitet, ist es von Vorteil, unsichtbar zu sein.
»Hm?« Das Geräusch kam von Teresas Großtante Louisa, die für einen kurzen Moment zum Leben zu erwachen schien und sich im Samtsessel aufrichtete. »Wie bitte?« Sie beäugte uns misstrauisch. Wann immer sie etwas zu uns sagte, war es in der Regel, um ihre Missbilligung zu äußern.
Teresa lächelte engelsgleich. »Nichts, Tante.«
Louisa schniefte, döste dann aber ohne weiteren Kommentar wieder ein. Teresas Großtante war eine Dame fortgeschrittenen Alters, stocktaub und mit dem besonderen Talent gesegnet, praktisch überall einschlafen zu können. Mit anderen Worten: Sie war die perfekte Anstandsdame, und besonders bei Teresa war das vonnöten. Meine Freundin behauptete immer, dass, wäre sie etwa achtzig Jahre früher geboren, sie eine garantiert höchst skandalöse Affäre mit Lord Byron gehabt hätte – vorausgesetzt natürlich, es hätte sich die Gelegenheit dazu ergeben. Ich hatte nie daran gezweifelt, wobei ich mich allerdings fragte, ob Byron auch nur ansatzweise gewusst hätte, worauf er sich da einlässt.
»Mach dir nicht zu viele Sorgen um Lady Rathmore«, flüsterte ich Teresa zu, als Louisa wieder weggedämmert war. »Ich habe gehört, dass sie die Untreue ihres Mannes satthat und mit einem gutaussehenden jungen Diener durch Europa reist.«
Ich konnte die Genugtuung in meiner Stimme kaum verbergen. Lady Rathmore zählte zu den Klientinnen der Agentur, und es war ein erfreulicher Ausgang für einen unserer schwierigeren Fälle gewesen. Wir hatten ihr das nötige Erpressungsmaterial geliefert, mit dem sie dann ihren untreuen Ehemann gezwungen hatte, für ihre finanzielle Unabhängigkeit zu sorgen. Es war eine äußerst befriedigende Aufgabe gewesen. Schließlich hatte sie das Geld überhaupt erst in die Ehe gebracht.
Teresas Augen weiteten sich. »Woher um alles in der Welt weißt du solche Dinge?«
»Ich habe da meine Quellen.« Ich strich den Rock meines blassgrauen Kleides glatt, das – gelinde gesagt – langweilig und gewöhnlich war und von der Garderobe jeder anderen Frau in der Oper in den Schatten gestellt wurde. Vor dem roten Samt der Logen funkelten die Kleider der feinen Damen wie Edelsteine in einem Schmuckkästchen.
Es war inzwischen zwei Jahre her, dass Vater gestorben war, aber trotz allen guten Zuredens von meiner Freundin fiel es mir immer noch schwer, auf meine Trauerkleidung zu verzichten.
In der Loge, die fast direkt gegenüber von unserer war, erschien jetzt Sylla Banaji am Arm ihres Vaters, Sir Dinshaw Banaji. Sie warf nicht einmal einen Blick in unsere Richtung. Viele Köpfe drehten sich jedoch in ihre Richtung. Mehr als nur ein Opernglas wurde gezückt, und so manche Hälse wurden gereckt, um zu sehen, wie die schöne Tochter des Baronets gekleidet war und ob sie eine interessante Begleitung mitgebracht hatte.
Mit ihren neunzehn Jahren, ihrer natürlichen Anmut und spöttischen Haltung gegenüber der Gesellschaft stand Sylla oft im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Auch jetzt konnte ich beobachten, wie die Operngäste ihr Aussehen begutachteten und anerkennendes Murmeln durch die Reihen ging. Sie trug ein blassblau-silbernes Kleid, das ihr rabenschwarzes Haar und ihren gelbgoldenen Teint betonte, dazu silberne Armreifen, die von ihren Handgelenken bis zu den hohen Manschetten hinaufreichten.
»Wie … originell«, hörte ich eine Frau raunen, in einem Ton, der an den säuerlichen Geschmack von vergorenem Wein denken ließ.
Sylla war die Tochter von Lady Anne Stanton und deren in Bombay geborenen und in Oxford erzogenen Ehemann – weswegen Sylla einen komplizierten Platz in der Gesellschaft einnahm. Ihr Vater war ein pensionierter Dragoneroffizier, der dank seines Vermögens und seiner philanthropischen Bemühungen (sowie seiner Freundschaft mit dem Prinzen von Wales) vor fast einem Jahrzehnt zum Baronet ernannt worden war – was jedoch nichts daran änderte, dass viele nicht über seine Hautfarbe hinwegsehen konnten. Oder die seiner Tochter Sylla.
Nach einer Weile wanderte Syllas Blick zu mir, hielt kurz inne, wenn auch nur für den Bruchteil einer Sekunde, und glitt dann weiter. Aber ich begriff die Botschaft in aller Deutlichkeit: Wehe, du vermasselst das hier.
Ich seufzte. Ich pflegte zwar keine Fehler zu machen, aber Sylla behandelte mich immer noch wie die unerfahrene Anfängerin, die sie vor anderthalb Jahren angesprochen hatte. Ich zog Vaters Taschenuhr aus meinem Retikül, in dem sich noch ein Parfümfläschchen, ein zusammengeklappter Fächer und ein Taschentuch befanden. Es waren noch mehr als dreißig Minuten bis zum Beginn der Aufführung, also genug Zeit.
Ich blätterte im Programmheft und versuchte, mir die Ungeduld nicht anmerken zu lassen. Ich hatte Manon Lescaut gesehen, als die Oper vor fast drei Jahren hier in Covent Garden ihre Premiere gefeiert hatte. Damals war ich sechzehn und Vater noch am Leben gewesen. Wir hatten eine eigene Familienloge, die wir inzwischen aufgegeben haben. Offiziell aus dem Grund, dass Vater derjenige gewesen sei, der die Oper geliebt habe, und wir die Loge daher kaum noch brauchen würden. In Wahrheit konnte ich es mir keinen Tag länger leisten, sie zu behalten.
Damals hatte mein Leben aus Ballkleidern bestanden und darin, nach einem Ehemann Ausschau zu halten. Das schien eine halbe Ewigkeit her zu sein, und manchmal dachte ich sogar, es sei das einer anderen Person gewesen. Aber, um ehrlich zu sein, vermisste ich nicht viel aus jener Vergangenheit. Natürlich würde ich alles dafür geben, Vater wiederzuhaben … aber der Rest? Mein Leben war jetzt so viel interessanter.
»Oh, ich liebe dieses Rosa!« Teresas Stimme lenkte meine Aufmerksamkeit wieder auf die Szene, die sich vor uns abspielte. »Meinst du, es würde mir stehen?«
Mein Blick folgte ihrem ausgestreckten Finger und landete auf einem Kleid, das sich durch einen albtraumhaften Farbton hervortat: irgendwo zwischen Puterrot und Lachsfarben. »Du würdest in jeder Farbe reizend aussehen«, erwiderte ich – zum einen, weil es die diplomatischste Antwort war, und zum anderen, weil ich es genau so meinte.
Teresa schnaubte, aber ich merkte ihr an, dass sie sich freute. »Auf dem Ball in Devonshire House werde ich Rosa tragen, aber es ist ein viel hellerer Farbton, und jetzt frage ich mich, ob es die richtige Entscheidung war …« Sie neigte den Kopf zur Seite. »Vielleicht sollte ich noch einmal mit meiner Schneiderin sprechen.«
»Lass die arme Frau in Ruhe!«, sagte ich. »Ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft du deine Meinung über dieses Kleid geändert hast.«
»Es ist immerhin das gesellschaftliche Ereignis des Jahres!«, schmollte Teresa. »Wahrscheinlich des Jahrzehnts. Ich finde, du nimmst die Sache nicht ernst genug, vor allem da es sich um ein Kostümfest handelt. Ich habe gehört, der Duke of Marlborough habe fünftausend Francs für ein Kostüm aus dem Hause Worth ausgegeben. Da kannst du nicht in irgendeinem alten Fetzen auftauchen.«
Ich zuckte mit den Schultern. Niemand würde darauf achten, was ich anhatte, also schien es kaum der Mühe wert, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Teresa gab ein irritiertes »Ts« von sich und sah sich weiter im Theater um.
Plötzlich spürte ich, wie meine Nackenhärchen sich aufstellten und mich ein Schauder überlief. Ich brauchte mich nicht umzudrehen, um zu wissen, was passiert war.
Max Vane war eingetroffen.
»Dieser Mann«, murmelte Teresa und blickte verträumt über meine Schulter, »ist wirklich der attraktivste, den ich je gesehen habe.«
Fast gegen meinen Willen wandte ich mich um, und sofort spürte ich denselben innerlichen Ruck, den ich immer verspürte, wenn ich Max sah. Eigentlich sollte ich daran gewöhnt sein – ich war ihm schon bei vielen gesellschaftlichen Anlässen begegnet –, und doch empfand ich immer noch diesen eigenartigen Schrecken … halb Vergnügen, halb Schmerz. Er stand im Lichtschein an der Tür zu seiner Loge – direkt neben der Loge der Königin und nur zwei Logen von Sylla entfernt – und sah geradezu unverschämt gut aus in seinem perfekt sitzenden schwarzen Frack und einer schlichten schwarzen Seidenweste. Er schaute sich im Opernsaal um, scheinbar ungerührt von allem, was er sah.
Ich war jetzt seit achtzehn Monaten in Max Vane verliebt. Er hingegen wusste nicht einmal, dass ich existierte.
Teresa hatte nicht übertrieben, was sein gutes Aussehen anging. Max Vane hatte die Statur eines klassischen griechischen Helden, über 1,80 Meter groß, und keine noch so maßgeschneiderte Jacke konnte seine breiten Schultern und ausgeprägten Muskeln verbergen. Sein Gesicht hatte die perfekten Proportionen, mit einem kantigen Kiefer und vollen Lippen, die meist zu einer Linie zusammengepresst waren. Sein blondes Haar war leicht gelockt und kürzer geschnitten, als es derzeit Mode war.
Und die Tatsache, dass es unter all diesen unverkennbaren Vorzügen vor allem seine Augen waren, die einem nicht mehr aus dem Kopf gingen, zeigte schon, wie außergewöhnlich sie waren. Ein tiefes, warmes Grün mit einem strahlenden Funkeln darin – die Art von Augen, über die Gedichte geschrieben wurden … vorausgesetzt, man war ein Mensch, der dazu neigte, Gedichte zu schreiben. (Ich hatte es nur ein einziges Mal versucht – mit grauenhaftem Ergebnis –, und die Beweisstücke waren sofort im Kamin meines Schlafzimmers gelandet.)
»Es ist eine Schande, dass er immer so korrekt und ernst ist«, sinnierte Teresa. »Ich glaube nicht, dass ich je auch nur den Anflug eines Lächelns auf seinem Gesicht gesehen habe.«
Ich schon. Tatsächlich hatte ich Max Vane sogar lachen sehen.
KAPITEL 2
Vor achtzehn Monaten hatte ich mich gerade aus dem tiefsten Loch der Trauer um Vater gekämpft. Dem gesellschaftlichen Leben hatte ich immer schon zwiespältig gegenübergestanden – vieles davon schien mir langweilig, wenn auch notwendig. Aber jetzt empfand ich bei derlei Ereignissen geradezu klaustrophobische Gefühle, die mir die Luft zum Atmen raubten. In den Salons spürte ich die vielen prüfenden Augenpaare auf mir, sie lösten ein kribbelndes Gefühl der Panik aus, das ich weder verstand noch zu beherrschen wusste. Zudem wurde immer deutlicher, dass Mutter, Henry und ich in finanziellen Schwierigkeiten steckten, und die quälende Sorge, wie es mit uns weitergehen würde – mit einer kranken Mutter und Henry in der Schule –, hielt mich Nacht für Nacht wach.
Eines Abends war ich auf einem Hausball in Kent mit etwa zweihundert Gästen. In einem großen Saal wurde getanzt, es war heiß und stickig, und das Gedränge war mir schier unerträglich. Teresa war nicht da, und ich hatte den größten Teil des Abends in einer Ecke verbracht und mich an ein Glas Limonade geklammert. Mit meiner leeren Tanzkarte hatte ich mir Luft zugefächelt. Schließlich hielt ich es nicht mehr aus und schlich nach draußen. Es gehörte sich nicht für eine junge Dame, nachts allein auf dem Anwesen herumzulaufen, aber niemand nahm Notiz von mir.
Die ersten Atemzüge in der kühlen Abendluft waren belebend wie ein Schluck klaren Wassers. Ich schlenderte durch den Park und entfernte mich immer weiter vom Lärm und dem Tanzgeschehen. In meinen Stoffschuhen bewegte ich mich beinahe lautlos und verschmolz mit der Dunkelheit. Mit jedem Schritt, den ich zwischen mich und den Ballsaal brachte, ließ die Enge in meiner Brust nach. Nach einiger Zeit kam ich an einen Bach und folgte seinem Lauf, bis er breiter wurde. Das Wasser funkelte silbern im Mondlicht. Es war ein friedlicher Ort, und ich spürte, wie sich mein Herzschlag verlangsamte und meine Schultern lockerten.
Zumindest bis ich plötzlich eine herrische Stimme hörte: »Komm her.«
Ich erstarrte, alles in mir sträubte sich gegen diesen unmissverständlichen Befehl. Mit einer wütenden Erwiderung auf den Lippen drehte ich mich in Richtung der Stimme – nur um festzustellen, dass die Worte von der anderen Seite einer großen Eiche kamen und gar nicht mir gegolten hatten.
Ich spähte um den Baumstamm herum. Dort stand Maximillian William Spencer Vane, der achte Duke of Roxton, und blickte stirnrunzelnd auf das Wasser hinab. Er schien meine Anwesenheit nicht einmal bemerkt zu haben.
Zu diesem Zeitpunkt war ich nicht in Max Vane verliebt. Natürlich hatte ich ihn schon in etlichen Ballsälen mal gesehen und war stets ein wenig überwältigt gewesen von seiner Aura von Macht und Privilegien, die er ausstrahlte, und auch davon, dass die Leute ihn umschwirrten wie Motten die Flamme. Wir besuchten zwar dieselben Feste, bewegten uns aber in ganz anderen Kreisen. Zwischen einem Duke und der Tochter eines niederen Barons klaffte ein großer Abstand, und Vane schien sich seiner Stellung sehr bewusst zu sein. Bei den gesellschaftlichen Zusammenkünften kannte man ihn als ernst dreinblickenden Mann mit dem Ruf, ein Verfechter strenger Anstandsregeln zu sein.
Es war merkwürdig, dass er hier draußen war, und ich fragte mich, mit wem er wohl sprach. Als ich mich noch etwas näher heranwagte, hörte ich ein Winseln und entdeckte an der anderen Uferseite einen kleinen Hund. Er stand mitten im Fluss, als hätte er es mitten bei der Durchquerung mit der Angst zu tun bekommen. Jetzt wimmerte er und schien sich weder dazu durchringen zu können, durch das tiefe Wasser zu schwimmen, noch den Rückweg anzutreten.
Vane seufzte. »Ich sagte, komm her«, versuchte er es noch einmal in einem aufmunternden Tonfall.
Der Hund spitzte die Ohren, aber das war auch schon alles. Er zitterte jetzt am ganzen Leib, und sein Winseln wurde immer lauter.
»Zwing mich nicht, dich zu holen.« Vanes Stimme war tief, volltönend und voll Selbstvertrauen. Ganz klar gehörte sie einem Mann, dem Rang und Namen in die Wiege gelegt worden waren. »Meinen Kammerdiener trifft der Schlag, wenn ich das mache.«
Der Hund zeigte sich völlig ungerührt, und ich biss mir auf die Lippe, um mir ein Lachen über den Ausdruck auf Vanes Gesicht zu verkneifen.
Mit einem erneuten Seufzer bückte sich Vane und begann, seine Schuhe aufzuschnüren. Meine Augen weiteten sich vor Schreck, als mir bewusst wurde, dass der attraktivste Mann des Landes, der beste Fang dieser – oder auch jeder folgenden – Saison sich jeden Moment vor mir ausziehen würde.
Du darfst nicht hinsehen, ermahnte ich mich streng. Du darfst auf keinen Fall hinsehen.
(So unglaublich es auch klingen mag: Damit sind wir noch nicht einmal bei dem Teil der Geschichte angelangt, an dem er mein Herz hoffnungslos für sich einnahm.)
Just in diesem Moment schien der Hund neuen Mut zu schöpfen und sprang jaulend durch das Wasser auf Vane zu.
Der arme Mann, der gerade dabei war, seine Hose auszuziehen, konnte gerade noch den Kopf drehen, ehe ein sehr nasser, sehr schmutziger Hund gegen seine Brust prallte, ihn mit einem übermütigen Bellen von den Füßen riss und dann mit einem Platschen in den Schlamm am Flussufer stieß.
Der Hund – undankbare Kreatur, die er war – rannte in die Nacht davon und ließ den Duke of Roxton im Matsch zurück.
Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte: Wut? Verärgerung? Enttäuschung? Ein Duke war sicherlich äußerst darauf bedacht, stets seine Würde zu wahren. Ich rechnete mit Geschrei, Tadel oder ein bis zwei phantasievollen, an den Hund gerichteten Flüchen, der sich bereits aus dem Staub gemacht hatte.
Der Duke of Roxton aber warf seinen Kopf zurück, versank dabei noch tiefer im Morast und – lachte. Sein Lachen war schön, genauso wie alles andere an ihm, es begann als ein leises Brummen und wurde dann warm und übermütig.
Das war er. Der Moment, in dem der Blitz bei mir einschlug. Er kam so plötzlich und unerwartet wie ein elektrischer Schlag, und ich fasste unwillkürlich an meine Brust, um den neuen Rhythmus meines Herzens zu spüren.
Als ich Vane dort im Morast liegen und über sich selbst lachen sah, hörte er auf, der Duke of Roxton zu sein, und wurde in meinen Gedanken einfach Max.
Sich quasi aus heiterem Himmel in einen wildfremden Menschen zu verlieben, der nicht einmal weiß, dass es einen gibt, ist überwältigend und kommt eher ungelegen. Daher nahm ich meine Umgebung kaum wahr, als ich mich umdrehte, um schleunigst den Rückzug anzutreten.
Sein Lachen verstummte abrupt. »Hallo?«, rief er. »Ist da jemand?«
Aber ich hielt nicht an, sondern eilte zurück zum Fest, während mein Gehirn versuchte, die bizarre Flut von Gefühlen zu verarbeiten. Gefühle, die einzig durch ein nettes, aber ganz gewöhnliches Lachen ausgelöst worden waren.
Wenig später beobachtete ich von der Ecke des Ballsaals aus, wie Max den Raum betrat, tadellos gekleidet, nicht ein einziges Haar am falschen Platz. Ich habe keine Ahnung, wie er das angestellt hat – nun ja, ein Duke hat so seine Möglichkeiten, nehme ich an. Keiner ahnte, was passiert war. Keiner außer mir. Er blickte wieder ziemlich ernst und streng drein, weshalb ich es als etwas beinahe Intimes empfand, den Klang seines Lachens zu kennen.
Ich verstand selbst kaum, wie und warum ich so Hals über Kopf in die Verliebtheit gestolpert war. Ich ließ die letzte halbe Stunde Revue passieren, als wären sie Teile eines Puzzles, die ich richtig platzieren könnte, wenn ich mir nur Mühe gab. Ich hatte beobachtet, wie ein Duke hinter einem Baum in den Schlamm fiel (ich schreckliche Schnüfflerin!), und dann – was? Hatte ich mich einfach so in ihn verliebt? Wie albern. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich ein recht vernünftiger Mensch gewesen. Ich glaubte nicht an eine Liebe, die einen aus dem Nichts wie ein Pfeil in die Brust trifft.
Andererseits fühlte ich wenigstens etwas. Nach der Trauer über den Verlust meines Vaters, nach dem Schock über die finanzielle Misere, in der wir uns befanden, war dieser Kopfsprung in die Verliebtheit wie ein Wunder für mich. Es war ein neues Gefühl, eines, das die Trauer und Sorge in mir durchbrach. Obwohl ich wusste, dass meine Gefühle unerwidert bleiben würden, spürte ich mit einem Mal etwas, das mir in letzter Zeit abhandengekommen war: Hoffnung.
Diese Nacht war in mehr als einer Hinsicht bedeutsam. Es war auch die Nacht, in der ich Sylla zum ersten Mal begegnete.
»Tja, ich nehme alles zurück.« Teresas Stimme riss mich aus meinen Erinnerungen und holte mich in die Oper zurück, wo ich einen Auftrag zu erledigen hatte. »Das ist der attraktivste Mann, den ich je gesehen habe.«
Meine Freundin saß aufrecht da, und ihr Blick war auf den Mann gerichtet, der jetzt neben Max stand. Ich runzelte die Stirn. Der Fremde sah gut aus, mit seinem rötlich braunen Haar, dem gepflegten Bart und den braunen Augen, in denen ein Lachen blitzte. Aber er war – objektiv betrachtet – nicht der attraktivste Mann im Raum. Dennoch sah meine Freundin so aus, als würde sie plötzlich Engelschöre singen hören. Ich fragte mich, ob ich an jenem Abend, in meinem Versteck hinter dem Baum, ebenfalls so ausgesehen hatte.
In diesem Moment drehte der Mann seinen Kopf in unsere Richtung. Sein Blick begegnete Teresas. Sie lächelte. Er lächelte. Sie stieß ein »Oh!« aus, seine Augen bekamen einen träumerischen Ausdruck. Er drehte sich zu Max und sagte etwas. Max sah zu uns herüber, und ich spürte, wie mein Puls in die Höhe schoss – aber er blickte nicht mich an, sondern Teresa. Dann wandten sich beide ab und betraten ihre Loge.
Teresa atmete langsam aus. »Izzy«, kiekste sie. »Izzy, hast du gesehen …«
»Natürlich habe ich das gesehen!« Ich lachte.
Teresa kicherte und fächelte sich mit dem Programmheft Luft zu. »Wer er wohl ist?«
Sie wurde nicht lange auf die Folter gespannt, denn einen Moment später ertönte hinter uns ein Geräusch – und da waren sie. Überrascht richtete ich mich auf. Das Retikül, das in meinem Schoß gelegen hatte, fiel zu Boden. Auch Teresa sprang auf, ein erfreutes Lächeln auf den Lippen.
»Miss Wynter.« Max’ Stimme hatte ein angenehm dunkles Timbre, das etwas Seltsames mit meinem Inneren anstellte. »Ich hoffe, Sie verzeihen mir die Störung.«
Natürlich kannte Max Teresa – er war mit ihrem Cousin Nick, dem neuen Earl Wynter, befreundet. Ihr hatte ich es zu verdanken, dass ich nun schon mehr als ein Mal mit Max bekannt gemacht worden war. Und auch jetzt war ich wie immer hin und her gerissen zwischen Verärgerung und Belustigung darüber, dass er sich nie daran zu erinnern schien, wer ich war.
»Euer Gnaden«, säuselte Teresa, den Blick schnurgerade an Max’ Schulter vorbei gerichtet. »Wie schön, Sie zu sehen. Sie stören nicht im Geringsten.«
Interessiert beobachtete ich die Szene und versuchte, die Hitze zu ignorieren, die dank Max’ Erscheinen meinen Körper erfasste. Das Opfer unerwiderter Leidenschaft zu sein, war schon schlimm genug, da musste ich mich nicht auch noch zur Närrin machen.
Max’ Blick glitt zu Louisa, die weiter tief und fest schlief und seltsame Schniefgeräusche von sich gab. An seinem Gesicht war unschwer abzulesen, was ihm durch den Kopf ging. Es gab Anstandsregeln zu beachten, und er wollte sie unbedingt einhalten.
Teresa schmunzelte. »Es wäre nicht gut, sie zu wecken«, flüsterte sie. »Sie wäre entrüstet darüber, dass jemand sie aus ihrem Nickerchen reißt, selbst wenn es sich dabei um einen Duke handelt.«
Max runzelte die Stirn, aber der Mann hinter ihm lachte laut auf.
»Miss Wynter«, sagte Max ein wenig steif. »Darf ich Ihnen meinen guten Freund, Mr James St. Clair, vorstellen.«
James St. Clair trat vor und beugte sich über Teresas Hand. »Es ist mir ein Vergnügen, Ihre Bekanntschaft zu machen, Miss Wynter.«
Ich mochte ihn auf Anhieb. Zum einen hatte er nicht einen Hauch von Lord Byron an sich. Er wirkte solide und strahlte Zuversicht aus; seine Haltung, seine Art zu sprechen, das Funkeln in seinen Augen – als ob er immer zuerst das Humorvolle in jeder Situation sehen würde – verliehen ihm eine Leichtigkeit. Teresa fühlte sich sonst zu Männern hingezogen, die aussahen, als würden sie in transsilvanischen Schlössern in Särgen schlafen, das Blut von Jungfrauen trinken und voll Inbrunst entflammen, wenn sie ihre selbst verfassten, grässlichen wie endlosen Gedichte vorlasen.
Jetzt aber starrte Teresa diesen ganz normal aussehenden jungen Mann mit demselben Ausdruck an, den sie als kleines Mädchen gehabt hatte, wenn man ihr den Besuch in Gunters Teesalon in Aussicht gestellt hatte. Wobei James St. Clair durchaus Chancen hatte, in einem Wettbewerb gegen Erdbeer-Eiscreme als Sieger hervorzugehen.
»Die Freude ist ganz meinerseits, Sir«, flötete Teresa ihm augenklimpernd zu. Sie standen einen Moment lang da, ihre Hand in seiner, bis Max sich räusperte.
Spielverderber.
James errötete und ließ Teresas Finger los. Teresa drehte sich zu mir um, ihre Wangen waren vor Entzücken rosa angehaucht.
»Und ich bin sicher, Sie erinnern sich an meine liebe Freundin, Miss Isobel Stanhope.« Sie lächelte mir kurz zu. Obwohl ich nie ein Wort gesagt hatte, ahnte Teresa meine Gefühle für den Duke of Roxton, und es bereitete ihr eine diebische Freude, mich so oft wie möglich damit zu necken.
»Mr St. Clair.« Ich machte einen Knicks. »Euer Gnaden.«
Die Herren verbeugten sich. In Max’ Augen flackerte nicht der leiseste Funken des Wiedererkennens auf. Ich schluckte einen Seufzer hinunter und rief mir in Erinnerung, dass meine Tendenz zum Vergessenwerden einen nicht unbedeutenden Anteil daran hatte, dass ich in meinem Beruf so erfolgreich war.
Apropos … Ich sah zu Sylla hinüber, und diesmal warf sie mir einen Blick zu, den zu deuten wenig Phantasie erforderte. Hör auf, dich mit unwichtigen Männern abzugeben, und mach dich an die Arbeit.
Nun gut. Ich blickte hinunter ins Parkett und sah, dass meine Zielperson endlich aufgetaucht war. Adrenalin schoss durch meine Adern. Ich genoss diesen Teil meiner Mission.
»Wenn Sie mich entschuldigen würden«, sagte ich und wandte mich lächelnd an Max. »Ich habe gerade jemanden gesehen, mit dem ich vor Beginn der Vorstellung noch sprechen muss.«
Er sah verblüfft aus, ebenso Teresa. Ich nehme an, der begehrteste Junggeselle des Landes war es nicht gewohnt, dass die Damen sich davonmachten, wenn er ihnen die Gunst seiner Aufmerksamkeit gewährte.
»Ich beeile mich«, sagte ich zu Teresa und setzte mich bereits in Bewegung. »Versprochen. Ich bin wieder da, bevor der Vorhang aufgeht.«
»Ich glaube, Sie haben Ihr Retikül fallen lassen«, sagte Max. Er hielt mir die kleine Seidentasche hin, und ich nahm sie. Für den Bruchteil einer Sekunde berührten sich unsere Finger, und selbst durch meine Handschuhe hindurch spürte ich es bis in die Zehenspitzen. Unsere Blicke trafen sich, und ich erlaubte mir einen kurzen Moment des Schwelgens, in dem ich im Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit stand. Mein Blick fiel auf seine Lippen, und ich musste daran denken, wie sie aussahen, wenn er lächelte … wenn er lachte.
»Danke«, brachte ich heraus, bevor ich nach einem hastigen Knicks entschwand.
Zeit, mich an die Arbeit zu machen.
KAPITEL 3
Ich betrat das Parkett und bahnte mir einen Weg durch die Menge. Hier unten war es viel wärmer. Die Leute schlenderten herum, tranken und unterhielten sich. Ich erspähte meine Zielperson. Der Mann befand sich in einer Gruppe von Freunden – eine Schar rauflustiger Studenten, die an diesem Abend offensichtlich bereits ziemlich tief ins Glas geschaut hatten. Ich nahm mir einen Moment Zeit, um ihn zu beobachten. Und stellte fest, dass er bei jeder Bewegung schwankte, wenn auch kaum wahrnehmbar. In der Hand hielt er ein Getränk. Gut, das würde die Sache vereinfachen.
Ich sah wieder auf meine Uhr. Fast neun, jetzt müsste eigentlich …
Und dann war sie da, wie aus dem Nichts: Maud, eine weitere Mitstreiterin. Sie trug ein tief ausgeschnittenes Kleid und hatte viel Rouge aufgelegt. Ihr rotes Haar löste sich aus den Haarnadeln, und sie bewegte sich, als würde eine Musik spielen, die nur sie hören konnte. Dafür erntete sie allseits bewundernde Blicke. Als sie mich bemerkte, zwinkerte sie mir kurz zu.
Unsere eigentliche Zielperson, Mr Wyncham, ein vierundzwanzigjähriger Mann, von dem wir annahmen, dass er sich mit seinen neuen Freunden in schlechte Gesellschaft begeben hatte, ließ sich nur allzu leicht von Maud und dem Schwung in ihren Hüften ablenken. Er drehte sich zu ihr und grinste sie ungeniert an. Maud kicherte – ein kokettes Glucksen, das sie im wirklichen Leben nie von sich geben würde –, und Wynchams Lächeln wurde breiter. Es war alles erstaunlich vorhersehbar.
Langsam näherte ich mich den beiden, und dann, kurz bevor ich sie erreichte, tat ich so, als würde ich stolpern, ließ mich dabei gegen Wyncham fallen, so dass sein Getränk überschwappte und sich auf seine Brust ergoss.
»Verzeihung!«, rief ich. »Wie ungeschickt von mir. Oje, Sie haben Ihr Getränk verschüttet, und das ist meine Schuld! Meine Tante sagt immer, ich soll aufpassen, wo ich hingehe, denn meine Füße scheinen jede Ritze oder Unebenheit im Boden treffsicher aufzuspüren, und schwupps, schon segle ich wieder durch die Luft!« Ich plapperte vor mich hin und hielt mich an Wynchams Arm fest, während Maud näher kam. Ich hatte festgestellt: Je mehr ich plapperte, desto weniger Aufmerksamkeit schienen die Leute, vor allem die Männer, mir zu schenken.
»Nichts passiert«, warf Wyncham ein, der kaum einen Blick für mich übrig hatte. Ich sah Maud an, aber sie schüttelte nur kurz den Kopf.
Das Dokument, das wir brauchten, steckte nicht in seinen Außentaschen. Es musste sich also im Inneren seiner Jacke befinden. Ich überlegte kurz. Mit Herrenjacken kannte ich mich aus, und diese hier war ordentlich verarbeitet, aber schäbig und mehrfach ausgebessert. Das Innenfutter war jedoch sauber, und der Schnitt passte gut. Es gab keine versteckten Taschen, entschied ich. Das Dokument musste innen auf der linken Seite sein.
Ich drückte meine Hand auf die Brust, und Maud nahm den Hinweis sofort auf. »Lassen Sie mich Ihr Hemd ein wenig trocknen, Sir«, säuselte sie und tupfte über die Vorderseite der Jacke. In der Zwischenzeit zog ich aus meinem Retikül ein Taschentuch, das ich mit »Parfüm« besprüht hatte, bevor ich die Treppe hinuntergegangen war.
Während der Mann über Mauds Neckereien lachte, fischte sie den Brief aus seiner Brusttasche. Versteckt zwischen ihren ausladenden Rockfalten hielt sie mir den Brief hin, und ich verdeckte ihn mit dem Taschentuch, presste die Rückseite des Papiers an meinen Bauch und mit einigem Druck gegen mein Korsett, während ich leise bis drei zählte und betete, dass Winnies neuester Trick funktionieren würde. Dann gab ich den Brief an Maud zurück, die ihn geschickt wieder in Wynchams Tasche manövrierte. Was auch immer sie dem Mann ins Ohr flüsterte, ihre wandernden Hände erregten keinesfalls sein Misstrauen.
Die ganze Angelegenheit war binnen Sekunden vorbei. Wyncham würde mein Gesicht in der Menge nicht wiedererkennen – selbst wenn er dahinterkäme, was passiert war.
Die Glocke läutete zum Vorstellungsbeginn. Auf dem Weg in die Loge zog ich einen silbernen Fächer aus meinem Retikül. Ich klappte ihn auf, so dass ein leerer Rahmen zum Vorschein kam, steckte schnell das Taschentuch hinein und faltete den Fächer wieder zusammen, während ich die Treppe hinaufging. Wieder einer von Winnies Tricks.
Sylla erschien an der Tür zu ihrer Loge. »Nein, nein, ich bin mir sicher, dass ich ihn hier draußen verloren habe, und dabei ist er eines meiner Lieblingsstücke«, sagte sie über die Schulter.
»Suchen Sie den hier, Miss Banaji?«, fragte ich und hielt ihr den Fächer mit einem kleinen Knicks hin.
Syllas Finger umschlossen den Fächer, der perfekt zu ihrem Kleid passte. Sie klappte ihn kurz auf und faltete ihn wieder zusammen.
»In der Tat, Miss …« Sie blickte zu mir herab.
»Stanhope«, murmelte ich.
»Miss Stanhope«, wiederholt Sylla desinteressiert, während ihr Blick bereits über mich hinwegglitt. »Ich danke Ihnen.«
Damit wandte sie sich wieder zum Eingang ihrer Loge und rief: »Ich habe ihn gefunden!« Sie ließ mich stehen und kehrte zu ihrer Familie zurück.
Ich ging den Korridor entlang, um meinen Platz einzunehmen, schlüpfte zur Tür hinein und setzte mich ohne viel Aufhebens hin.
»Wo bist du gewesen?«, zischte Teresa und sah mich mit großen Augen an. »Die beiden sind fast zehn Minuten geblieben, und er ist wundervoll, und ich hatte niemanden, mit dem ich darüber reden konnte, außer Großtante Louisa.« Sie deutete auf die zusammengesunkene Anstandsdame, die weiterhin mit leicht geöffnetem Mund schlief.
Ich brauchte nicht zu fragen, wer er war. »Liebe auf den ersten Blick!«
Meine Freundin seufzte und ließ sich mit einem seligen Lächeln in ihrem Sitz zurücksinken.
Teresa war dafür bekannt, in jeder Saison mindestens dreimal ihr Herz zu verlieren, deshalb war ich mir nicht sicher, wie ernst ich diese Liebeserklärung nehmen sollte. Allerdings mochte ich James St. Clair auf den ersten Blick, und meine Fähigkeit, Menschen einzuschätzen, hatte sich im Lauf des letzten Jahres erheblich verbessert. »Ich freue mich, dass du ihn magst«, sagte ich. »Du hast dich schon in viel dümmere Männer verguckt.«
»Mögen?« Teresa rümpfte die Nase. »Ich mag ihn nicht nur. Was für ein fades Wort. Ehrlich, Izzy, wir müssen auch für dich jemanden finden, mit dem du dich in eine leidenschaftliche Liebesbeziehung stürzen kannst. Du bist immer so vernünftig und … und heiter. Das ist ganz und gar nicht poetisch.«
»Ich bin sicher, es gibt auch jede Menge heitere Poesie«, widersprach ich. »Denk doch nur an Wordsworths ›Narzissen‹. Es gibt nichts, was heiterer ist als eine Narzisse.«
Teresa stieß einen spöttischen Laut aus, was ich als Kritik an Wordsworths lyrischem Talent interpretierte, und da wusste ich, dass ich sie erfolgreich abgelenkt hatte.
Glücklicherweise wurde unser Gespräch unterbrochen, als das Licht im Opernsaal abgedunkelt wurde und Stille im Publikum eintrat. Ich blickte hinunter zu Wyncham. Maud war nirgends zu sehen. Da bemerkte ich, wie er seine Hand gedankenverloren auf die Brust legte, genau über der Tasche, in der sich der Brief befand. Nachdem er sich offensichtlich vergewissert hatte, dass das Dokument noch da war, ließ Wyncham die Hand sinken und lehnte sich zurück.
Ich konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen. Nichts war befriedigender als ein Auftrag, der gut über die Bühne ging.
Als das Orchester die ersten Töne anschlug, brandete Applaus auf.
Ich ließ mich in das Polster zurücksinken, bereit, die Oper zu genießen, entschied mich dann jedoch dafür, die Gelegenheit nicht verstreichen zu lassen und mich – jetzt, wo die Lichter gedämpft und alle Augen auf die Bühne gerichtet waren – zur Seite zu drehen, um einen Blick auf Max zu werfen.
James St. Clair hatte sich nach vorne gebeugt, die Unterarme auf die Brüstung gestützt, und konzentrierte sich ganz auf die Oper. Dass er nicht dasaß und in Byron’scher Manier Teresa anschmachtete, brachte ihm eindeutig Pluspunkte ein. Auch wenn Schmachten genau das war, wonach mir gerade der Sinn stand. Ich ließ meinen Blick zu Max hinüberschweifen …
… der mich direkt ansah. Seine Augen glitzerten im Halbdunkel, und zwischen seinen Brauen hatte sich eine Stirnfalte gebildet. Sogar seine Augenbrauen sahen gut aus. Aber jetzt war nicht der Moment, sich ablenken zu lassen. Trotz meines hämmernden Herzens gelang mir ein Lächeln, und dann drehte ich mich in aller Ruhe zur Bühne, um die Aufführung zu verfolgen.
Von der Oper nahm ich keinen einzigen Ton wahr.
KAPITEL 4
Stunden später fuhren wir in Teresas Kutsche vor meinem Haus vor, und sie hauchte mir einen Kuss auf die Wange. Wie immer war es stockdunkel, nirgendwo brannte ein Licht.
»Ist wirklich alles in Ordnung?«, fragte sie mit einem Blick auf die unbeleuchtete Fassade. »Es sieht aus, als wäre keine Menschenseele zu Hause!«
»Natürlich ist alles in Ordnung«, sagte ich munter. »Mama ist da und wartet bestimmt schon darauf, den ganzen Klatsch und Tratsch zu hören. Du weißt ja, dass ihre Räume zum Garten hinausgehen, wo der Straßenlärm sie weniger stört.«
»Und die Dienerschaft steht auch oben bereit, nehme ich an.« Teresa nickte. »Du solltest sie wirklich bitten, ein Licht für dich brennen zu lassen.«
»Da hast du recht.« Ich lächelte sie an. »Ich werde morgen vorbeikommen, damit du mir alles über James St. Clair erzählen kannst.«
»Klingt herrlich«, stimmte Teresa zu, die sich wieder einmal leicht ablenken ließ.
»GUTE NACHT, MISS TRENT!«, rief ich in die Kutsche zu Großtante Louisa.
Sie öffnete ein Auge und blickte mich finster an. »Kein Grund, so zu plärren«, brummte sie.
Ich sprang von der Kutsche und winkte, als sie wegfuhr, trat durch das schmiedeeiserne Tor und eilte den Weg zum Haus entlang. Dann holte ich den Schlüssel aus seinem Blumentopfversteck und sperrte auf.
Drinnen war es so düster, dass ich einen Moment lang innehielt, bis sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Wenigstens war es nicht so eisig kalt wie im Winter. Dem Himmel sei Dank für die warmen Sommermonate, in denen ich mir keine Sorgen um die Kohlenrechnung machen musste.
Ich griff nach dem Kerzenstummel, den ich auf den Tisch in der Eingangshalle gelegt hatte, bevor ich gegangen war, und zündete ein Streichholz an. Die Flamme warf tanzende Schatten in dem leeren Raum. Mit dem Licht in der Hand huschte ich den Flur entlang und die Treppe hinunter in die Küche. Ich platzierte meine Kerze auf dem großen, geschrubbten Tisch, füllte den Teekessel mit Wasser und stellte ihn auf den Herd. Dann öffnete ich die (größtenteils leere) Speisekammer, nahm die Teedose vom Regal und schüttelte sie. Da war eindeutig etwas drin, aber als ich den Deckel anhob, stellte sich heraus, dass es weniger war, als ich gehofft hatte. Nun ja, an dünnem Tee ist noch niemand gestorben, soweit ich weiß.
Ich trug das Tablett die Treppe hinauf zu den Räumen meiner Mutter. Auf dem Weg dorthin kam ich an einem Zimmer nach dem anderen vorbei, in dem weder Möbel noch Kunstwerke und manchmal nicht einmal mehr Vorhänge waren. Inzwischen hatte ich mich daran gewöhnt – so wie man sich an die meisten Dinge gewöhnen kann, nehme ich an. Noch vor nicht allzu langer Zeit war mir die Brust eng geworden, wenn ich unser Haus so sah – leer wie eine Austernschale –, jetzt aber konnte ich an den Räumen vorbeigehen, ohne von Erinnerungen an frühere Zeiten überfallen zu werden. So war es nun einmal, da nützte es nichts, zu weinen und zu klagen. Besser, man konzentrierte sich darauf, die Löcher zu flicken, als im Nachhinein darüber zu jammern, dass sie überhaupt entstanden waren.
Ich klopfte an Mamas Schlafzimmertür. Sie schwang auf, und ich blickte in das mürrische Gesicht von Button, der Zofe meiner Mutter.
»Ist es nicht etwas spät, um Ihre Ladyschaft zu stören?«, fragte sie.
Button hatte bereits als persönliche Zofe für meine Mutter gearbeitet, da war Mama noch jünger gewesen als ich heute, und von Kleinigkeiten wie ausbleibenden Löhnen ließ sie sich nicht davon abhalten, sich weiterhin um »Ihre Ladyschaft« zu kümmern. Falls Button eigentlich einen anderen Namen hatte, war er mir nie zu Ohren gekommen, sie war einfach mein ganzes Leben lang Button gewesen – ein missgelaunter Engel, der nicht nur die Hypochondrie meiner Mutter ertrug, sondern Ihre Ladyschaft zudem verwöhnte, als wäre sie ein hilfloser Säugling. Die beiden verband eine Beziehung, in die ich mich besser nicht einmischte.
»Ist das Izzy?« Mamas Stimme drang aus dem Zimmer, und Buttons Stirnrunzeln vertiefte sich.
»Komm rein, komm rein! Du musst mir alles erzählen. War Lady Farnworth wirklich mit ihrem neuen Cicisbeo da? Die liebe Andrea hat in ihrem letzten Brief geschrieben, es sei ganz fürchterlich, wie sie sich von ihm umgarnen lässt, man sollte meinen, sie hätte in ihrem Alter etwas mehr Würde, andererseits hieß es ja immer, sie und ihr Mann …«
Mama plapperte munter weiter, während ich ins Zimmer trat und das Teeservice abstellte, wobei Button mich mit Argusaugen beobachtete, um sicherzustellen, dass ich nichts Unverzeihliches tat. Wie etwa einen Tropfen Tee zu verschütten oder den sorgfältig arrangierten Nachttisch Ihrer Ladyschaft in Unordnung zu bringen.
Der Kontrast zwischen diesen Zimmern und dem Rest des Hauses war enorm. Trotz des sommerlichen Wetters knisterte ein Feuer im Kamin. An den rot tapezierten Wänden hing ein Ölgemälde neben dem nächsten, und der Fußboden war mit farbenprächtigen Teppichen ausgelegt. Auf dem Schminktisch stand eine Vase mit einem Strauß Seidenrosen. (Es hatte nur einer Andeutung bedurft, ihre Allergien könnten sich womöglich verschlimmern, um sie davon zu überzeugen, dass Seidenblumen besser waren als echte; und schon hatte ich die wöchentliche Rechnung vom Blumenladen streichen können, ohne dass Mama sich wunderte).
Mitten im Zimmer lag meine Mutter in einem riesigen Himmelbett mit Samtüberwürfen und einem Stapel Kissen. Sie trug ein wunderschön besticktes Spitzennachthemd und ein Seidenhäubchen, das mit Bändern unter ihrem Kinn zusammengebunden war. Auf dem Tisch neben ihr lagen Dutzende von Briefen – Korrespondenz mit ihren Freundinnen, die sie um jeden Preis aufrechterhielt, oft mit sechs oder sieben Briefen pro Tag. Ich war überrascht, dass die Neuigkeiten aus der Oper nicht schneller zu uns nach Hause gekommen waren als ich. Trotz meiner Kontakte war meine Mutter manchmal, auch ohne es zu ahnen, meine beste Quelle für Informationen.
»Ich glaube, man benutzt das Wort Cicisbeo nicht mehr, Mama.« Ich beugte mich vor, um sie auf die Wange zu küssen, und ließ mich dann in den Sessel fallen, den Button auf Mamas Anweisung hin neben das Bett geschoben hatte, damit ich mich immer zu ihr setzen konnte.
»Tatsächlich?« Mama runzelte die Stirn. »Aber es ist so ein entzückendes Wort, so schön auszusprechen. Cicisbeo. Wie soll ich ihn denn sonst nennen?«
»Ihren Liebhaber, nehme ich an.« Ich nippte am Tee.
Sie seufzte. »Ich wünschte, die Dinge würden sich nicht ständig verändern. Aber die Welt muss sich weiterdrehen, auch ohne alte Damen wie mich.«
»Mama, du weißt ganz genau, dass du keine alte Dame bist. Mrs Tipton erzählt noch immer die Geschichte von dem Ball, als ich fünfzehn war und der General uns für Schwestern hielt …«
Mama lehnte sich in die Kissen zurück, ein zufriedenes Lächeln auf den Lippen. »Ach, der liebe General. Ich bin sicher, der Mann brauchte eine Brille.«
»Unsinn, Eure Ladyschaft«, warf Button ein. »Sie sehen kaum einen Tag älter aus als sechzehn.«
»Oh, ihr beiden Schmeichlerinnen«, schimpfte Mama, warf aber einen Blick auf ihr Spiegelbild über dem Kamin und zupfte sich die Haare zurecht.
»Izzy, du musst dringend mit der Köchin reden«, sagte sie dann. »Der Tee ist viel zu dünn.«
Ich zuckte zusammen. »Ach, findest du?«, fragte ich. »Aber natürlich, ich werde es ihr gegenüber erwähnen.« Ich tauschte einen Blick mit Button, deren Gesicht einen leidgeprüften Ausdruck annahm.
Mutter hatte sich nur wenige Tage nach Vaters Beerdigung für bettlägerig erklärt, eine Mischung aus Trauer über den Verlust ihres Mannes und lebenslanger Hypochondrie, so dachten wir – bis Dr. Roberts bei ihr ein ernstes Herzleiden diagnostiziert hatte. Sie müsse seelische Erschütterungen oder Überanstrengungen vermeiden, hatte der Arzt ihr nahegelegt. Seit diesem Tag hatte sie ihre Suite nicht mehr verlassen, und ich hatte die Führung unseres Haushalts übernommen … der inzwischen nur noch aus mir, Mama und Button bestand. Was Mama natürlich nicht wusste.
Nachdem Mama jahrelang jeden Schnupfen wie eine veritable Lungenentzündung behandelt hatte, war die Diagnose einer ernsten Krankheit ein ziemlicher Schock gewesen, besonders so kurz nach Vaters plötzlichem Tod. Der Gedanke, ein weiteres Elternteil zu verlieren – meine liebe, lustige, exzentrische Mutter –, war unvorstellbar. Die Warnung des Arztes vor zu viel Aufregung noch in den Ohren, hatten Button und ich beschlossen, dass meiner Mutter nicht weh tun konnte, was sie nicht wusste. Und so blieb in ihrem Zimmer, in dieser kleinen heilen Welt, alles so wie immer. Meine Mutter begnügte sich damit, sich per Brief mit ihren Freundinnen auszutauschen – sie war viel zu eitel, um Besuche zuzulassen –, und sorgte so unwissentlich dafür, dass mein Ruf tadellos blieb und die Familiengeheimnisse nicht ans Tageslicht kamen.
In der Tat kannte niemand die ganze Wahrheit über meine Situation.
Niemand außer vielleicht Mrs Finch.
KAPITEL 5
Ich nehme an, das alles verlangt nach einer Erklärung.
Mein Vater war ein liebenswerter Mann. Gütig, sanft, klug, aber immer etwas geistesabwesend. Der Name Stanhope und seine Linie reichen weit in die Vergangenheit zurück, und mein Vater hatte ein kleines Anwesen samt schwindendem Vermögen geerbt. Außerdem besaß er ein besonderes Talent: Er war fasziniert von Türschlössern aller Art. Er verbrachte Stunden damit, daran herumzubasteln, und während andere Mädchen mit Puppen spielten, bekam ich von ihm Dietriche geschenkt. Mein Vater brachte mir das Schlösserknacken bei, manchmal im Wettlauf gegen die tickende Uhr, manchmal gegen ihn selbst. Ich erinnere mich noch genau an das erste Mal, als ich ihn besiegte. Ich war zwölf Jahre alt, und er strahlte voller Stolz übers ganze Gesicht.
Vaters Fähigkeiten sprachen sich herum, und mehrere Unternehmen konsultierten ihn in Sicherheitsfragen und verschafften ihm ein Einkommen. Dieses hielt er stets geheim, weil es sich für einen Baron nicht gehörte, für seinen Lebensunterhalt zu arbeiten. Es war sogar so geheim, dass nicht mal seine Familie davon wusste – bis zu jener Nacht, in der er plötzlich im Schlaf verstarb.
Nach jener Nacht wurde mein acht Jahre alter Bruder Henry der neue Baron, Mama hatte einen spektakulären Nervenzusammenbruch und konnte sich fortan nicht mehr um praktische Dinge kümmern, und ich entdeckte das größte Geheimnis meines Vaters: Die Stanhopes waren so gut wie mittellos.
Henry besuchte eine Schule, die alle Jungen unserer Familie seit Jahrhunderten durchlaufen hatten und die er heiß und innig liebte. Sein Schulgeld war bis zum Ende des Jahres bezahlt, aber das war auch schon die einzige gute Nachricht. Der Anwalt erklärte es mir mit einfachen Worten: Die finanziellen Entscheidungen, die mein Vater in dem verzweifelten Versuch getroffen hatte, das Vermögen seiner Familie wieder etwas aufzustocken, waren katastrophal gewesen. Vater war vieles gewesen, aber kein kluger Investor. Er hatte fast alles verloren, hatte Geld in die falschen Dinge gesteckt – und in seiner Panik sogar auf die Überbleibsel von Mamas Aussteuer und meine eigene kleine Mitgift zurückgegriffen. Das Einzige, was uns über Wasser gehalten hatte, war Vaters Arbeit gewesen, und sein Tod war so schnell und unerwartet gekommen, dass er uns nicht ausreichend versorgt hatte.
»Ich glaube, er dachte, er hätte alle Zeit der Welt, um das Schiff wieder in ruhigere Fahrwasser zu lenken.« Der Anwalt seufzte. »Er hatte fest damit gerechnet, dass irgendetwas passieren und sich die Dinge von selbst regeln würden.«
Ja, das klang ganz nach meinem Vater, dem unverbesserlichen Optimisten. In diesem Fall war Optimismus jedoch fehl am Platz gewesen, und nun lag es an mir, eine Lösung für die prekäre Lage zu finden, in der wir uns plötzlich befanden.
Als Erstes nahm ich Kontakt zu den Unternehmen auf, für die mein Vater gearbeitet hatte. Immerhin war ich bei ihm in die Lehre gegangen – und hatte ihn längst übertroffen. Aber natürlich wollte niemand eine Frau einstellen, schon gar nicht eine Dame von Stand, die sich, wie es in einem Antwortschreiben hieß, doch bitte auf wichtigere Dinge konzentrieren sollte, wie etwa einen Ehemann zu ergattern.
So einfach war das jedoch nicht. Um meine Familie vor dem Ruin zu bewahren, hätte ich eine Heirat sogar in Betracht gezogen, aber ich wurde nicht gerade mit Angeboten überhäuft. Die mausgraue Tochter eines niederen Barons ohne nennenswertes Vermögen war kaum eine attraktive Partie. Eine mittellose junge Frau, die noch dazu eine Familie durchzubringen hatte – um so jemanden machte man lieber einen großen Bogen. Und ich wusste, dass ich niemals würde lügen können, wenn so viel auf dem Spiel stand. Falls mich tatsächlich jemand heiraten wollte, würde ich ihm die Wahrheit über unsere finanziellen Verhältnisse sagen müssen. Schließlich würde ich von meinem Zukünftigen erwarten, dass er sich auch um Henry und Mama kümmerte, zumindest bis Henry volljährig wurde. Also hatte ich mich Button anvertraut, den Rest des Personals entlassen und viel nachgedacht. Denn ich musste einen Weg finden, damit es Mama bald besser ginge, Henry in der Schule bleiben dürfte und wir das Haus nicht aufgeben müssten – zumindest für die absehbare Zukunft.
Gleichzeitig kämpfte ich mich aus meiner Trauer und kehrte in die Gesellschaft zurück. Mama hatte zwar keine Ahnung von unserer wahren Situation, aber sie war genauso daran interessiert wie jede andere Mutter, ihre Tochter zu verheiraten. Mit Hilfe ihres Netzwerks von Freundinnen sorgte sie dafür, dass ich überall eingeladen, chaperoniert und sie stets über meine Fortschritte auf dem Laufenden gehalten wurde. Besser gesagt: über meinen Mangel an Fortschritten.
»Ich weiß nicht, warum so ein Mauerblümchen aus dir geworden ist, Isobel«, sagte sie seufzend. »Als ich in deinem Alter war, habe ich nichts mehr geliebt als einen aufregenden Ball!«
Mama war die Unvergleichliche ihrer Saison gewesen – das wusste ich von den zahllosen Gelegenheiten, bei denen Vater in Erinnerungen an frühere Zeiten geschwelgt und sie die Verlegene gespielt hatte. Und es war leicht zu verstehen, warum. Sie war klug und lebhaft, zierlich und schlank wie ich, aber sie hatte ein engelsgleiches Gesicht, große veilchenblaue Augen und eine goldene Haarpracht. Sie sah aus wie der Engel auf der Christbaumspitze, und trotz ihrer bescheidenen Mitgift hätte sie fast jeden heiraten können – aber sie hatte meinen Vater gewählt, weil sie sich sofort ineinander verliebt hatten. Mein Vater, der sanftmütige Büchernarr, der sich nicht gern auf dem gesellschaftlichen Parkett bewegte, hatte sie in einem überfüllten Ballsaal erspäht und prompt um jeden einzelnen Tanz auf ihrer Ballkarte gebeten. Sie hatten den ganzen Abend Walzer getanzt, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, wie skandalös das war. Sie hatten gelächelt, geredet und getanzt, und noch bevor der Ball zu Ende war, hatten sie gewusst, dass sie sich nie wieder trennen würden.
Es war eine wunderbare Geschichte, eine meiner liebsten. Aber während ich mich nachts hin und her wälzte, um eine Lösung für unser Dilemma zu finden, musste ich mir eingestehen, dass eine solche Liebe nicht oft vorkommt. Schon gar nicht eine, die so von ganzem Herzen erwidert wird.
Wie Teresa nicht müde wurde zu betonen, war ich alles in allem ein recht vernünftiger und heiterer Mensch. Optimistisch, wie mein Vater. Im Grunde glaubte ich daran, dass sich die Dinge zum Guten wenden würden. Aber als mein Vater gestorben war und seit es Mama so schlecht ging, legte sich zum ersten Mal in meinem Leben eine dunkle Wolke auf mich, die ich nicht abschütteln konnte. In Ballsälen oder an Orten mit vielen Menschen überfiel mich eine Angst, wie ich sie zuvor nicht gekannt hatte. Von einem Moment auf den anderen hatte ich das Gefühl, nicht mehr atmen zu können, meine Hände wurden feucht, dann fingen sie an zu kribbeln, und mein Herz begann zu rasen. Es war, als würden sich Kummer und Sorgen immer enger um meine Brust schlingen und das Leben aus mir herausdrücken.
So war es mir an jenem Abend ergangen, als ich von dem Ball floh und mich in Max Vane verliebte.
Am selben Abend lernte ich auch Sylla kennen, und mein Leben änderte sich für immer.
Ich war in den Damensalon geflüchtet – vorgeblich, um den Saum meines Kleides zu flicken, aber in Wirklichkeit wollte ich mich verkriechen wie ein Waldtier für den Winterschlaf, weit weg von all den Menschen, die ich nicht kannte und die mir nicht wichtig waren. Um den Kopf freizubekommen und mir darüber klarzuwerden, was gerade im Park geschehen war, als ich das Lachen von Max Vane gehört und anscheinend umgehend den Verstand verloren hatte.
Da kam Sylla Banaji herein. Ich wusste natürlich, wer sie war, aber wir hatten noch nie ein Wort miteinander gesprochen. In ihrem prachtvollen burgunderroten Kleid und den Saphiren, die an ihren Ohren funkelten, sah sie an diesem Abend aus wie eine Königin. Sie steuerte geradewegs auf die etwas kratzige, reich bestickte Chaiselongue zu, auf der ich saß, und musterte mich abschätzend wie ein Pferd, das zum Verkauf steht.
»Kann ich Ihnen irgendwie helfen?«, fragte ich, nicht gerade höflich. Es war ein nervenaufreibender Abend gewesen.
Ihre Wimpern flatterten, als sie in die Tasche ihres Kleides griff – ein Ballkleid mit Taschen! – und ein weißes Kärtchen herauszog, das sie mir reichte.
»Das ist für Sie«, sagte sie knapp. »Sehen Sie zu, dass Sie kommen.« Damit drehte sie sich um und verschwand in einem Wirbel aus roten Röcken und Gardenienduft.
Ich blickte auf das Kärtchen, auf dem die Adresse eines Geschäfts aufgedruckt war:
Das Finkennest
Mrs Finch
Inhaberin
1 St. Andrew’s Road
London
Das Kärtchen war dick, der Schriftzug mit tiefschwarzer Tinte eingeprägt. Auf die Rückseite hatte jemand gekritzelt: Mittwoch, 17.00 Uhr.
Ich hatte keinen blassen Schimmer, was das zu bedeuten hatte, aber ich hätte schwören können, dass da plötzlich ein Kribbeln in meinen Fingern war, ein neues Gefühl, das meine Nerven kitzelte und sich in meinem ganzen Körper ausbreitete. Es war so etwas wie Vorfreude. Ich hatte keine Ahnung, was mich an diesem Ort namens Finkennest wohl erwartete, aber ich wusste sofort, dass ich zur angegebenen Zeit dort sein würde. Der winzige Funke Hoffnung, der in dieser Nacht in meiner Brust erwacht war, wurde entfacht – und wuchs nicht zu einem lodernden Feuer heran, aber doch zu einer aufflackernden Flamme.
Der Gedanke an das Finkennest erinnerte mich daran, dass mein heutiger Abend längst nicht zu Ende war, und so gemütlich es auch sein mochte, hier in Mamas behaglichem Zimmer zu sitzen, ich hatte noch zu tun.
»Ich denke, ich gehe besser zu Bett, damit du dich etwas ausruhen kannst«, sagte ich und musste das Gähnen nicht einmal vortäuschen.
»Ja, Ihre Ladyschaft ist ein wenig blass für meinen Geschmack«, sagte Button, die an Mamas Bettdecke herumzupfte und sie wieder glatt strich.
Ich verspürte einen Anflug von Sorge, als ich Mama genauer betrachtete. Sie sah tatsächlich blass und erschöpft aus. Sie brachte es zwar einerseits fertig, jede leichte Erkältung zur Grippe hochzustilisieren, andererseits wurde sie seltsam abweisend, wenn sie tatsächliche Symptome oder Anzeichen einer schweren Krankheit hatte.
»Mir geht es gut«, sagte sie jetzt. Meine anfängliche Sorge verwandelte sich augenblicklich in tiefe Beunruhigung, und mein Bauch verkrampfte sich.
Etwas von dem, was in mir vorging, musste sich auf meinem Gesicht widergespiegelt haben, denn Mama tätschelte mir die Hand, und Buttons Züge wurden ein wenig weicher.
»Machen Sie sich keine Sorgen, Miss«, sagte Button. »Es gibt nichts, wogegen eine gute Portion Schlaf nicht Abhilfe schaffen könnte. Morgen früh ist sie bestimmt wieder putzmunter.«
»Oh, da habe ich meine Zweifel.« Mama seufzte. »Mein Nacken schmerzt dieser Tage immer furchtbar, wenn ich aufwache. Ich frage mich, ob wir Doktor Roberts verständigen sollten … es könnte ein frühes Anzeichen für die Schwindsucht sein.«
Ich verbarg ein Grinsen der Erleichterung, und wenn ich mich nicht täuschte, dann zuckte sogar Buttons Mundwinkel für einen Augenblick nach oben.
»Mal sehen, wie Sie sich morgen früh fühlen«, sagte Button gelassen. »Für heute Abend können wir erst einmal etwas von meiner Medizin probieren.«