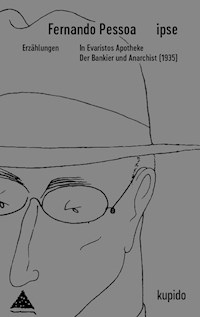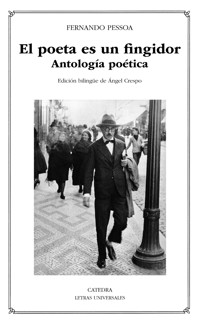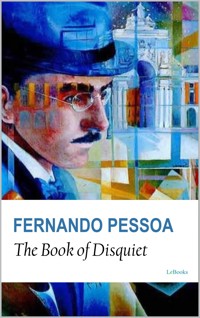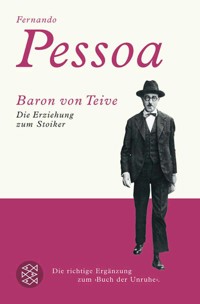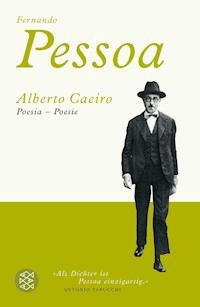
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis - Fernando Pessoa, der größte Dichter Portugals des 20. Jahrhunderts, träumte immer davon, alle Menschen zugleich zu sein. In seinem Werk hat er sich diese Sehnsucht erfüllt: Unablässig erschuf er neue Dichter, schenkte ihnen eine Biographie und schrieb ihnen die unterschiedlichsten Werke zu. Die legendäre Truhe, in der man Pessoas Manuskripte lang nach seinem Tod fand, enthält so das größte Stimmentheater der Weltliteratur, dessen Partitur die neue Pessoa-Ausgabe Band für Band enthüllt. Alberto Caiero (1889 – 1915) schuf nach Pessoa sein Werk während seines kurzen Lebens in völliger Abgeschiedenheit auf dem Land. Eine Tuberkuloseerkrankung, an der er schließlich sterben sollte, hatte ihn dazu gezwungen. Nahezu ohne Vorbildung übersetzte er seine Empfindungen bei der Betrachtung der Natur in zarte Dichtungen, die deren Geheimnis bewahren sollten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Fernando Pessoa
Alberto Caeiro
Poesia – Poesie
Herausgegeben von Fernando Cabral Martins und Richard Zenith
Aus dem Portugiesischen von Ines Koebel und Georg Rudolf Lind
FISCHER E-Books
Revidierte und erweiterte Ausgabe
Mit einem Nachwort von Georg Kohler
Inhalt
Vorwort zu Alberto Caeiros Gedichten
Von Ricardo Reis
Alberto Caeiro da Silva wurde am [16.] April 1889 in Lissabon ge-boren und starb dortselbst […] 1915 an Tuberkulose. Sein Leben hat sich jedoch fast ausschließlich auf einem Gut im Ribatejo abgespielt; in der Stadt seiner Geburt verbrachte er nur seine beiden ersten Jahre und seine letzten Monate. Auf jenem abgelegenen Gut, dessen nahes Dorf er als seine Heimat empfand, schrieb Caeiro fast all seine Gedichte – seine ersten, »von Kinderhand«, wie er sagte, und mit »Der Hüter der Herden« betitelt, als auch die des unvollständigen Buchs, oder was immer es sei, »Der verliebte Hirte« genannt, sowie weitere Gedichte früheren Datums, die ich samt allen übrigen zum Zweck der Veröffentlichung geerbt und unter der mir von Álvaro de Cam-pos ausdrücklich nahegelegten Bezeichnung »Verstreute Gedichte« zusammengestellt habe. Letztere, von Nr. […] an, sind allerdings während des letzten, erneut in Lissabon verbrachten Lebensabschnitts ihres Autors entstanden. Ich halte es für meine Pflicht, diese kleine Unterscheidung vorzunehmen, denn einige dieser durch Krankheit verwirrten Gedichte sind dem allgemeinen Charakter des Werkes, seiner Natur wie seiner Ausrichtung, etwas fremd.
Caeiros Leben läßt sich nicht erzählen, denn von ihm als Person gibt es nichts zu erzählen. Seine Gedichte waren sein Leben. Dar-über hinaus weist es weder besondere Vorkommnisse noch Geschich-ten auf. Selbst die unergiebige und sinnlose Episode, die zur Ent-stehung der [acht] Gedichte von »Der verliebte Hirte« führten, war weniger ein Vorkommnis als vielmehr eine Vergeßlichkeit.
In Caeiros Werk erfährt das Heidentum eine vollständige Er-neuerung, zu der weder Griechen noch Römer, die das Heidentum lebten und folglich nicht darüber nachdachten, fähig waren. Das Werk indessen und sein Heidentum wurden weder gedacht noch empfunden; sie wurden gelebt, mit all dem, was in uns vielleicht tiefer ist als Empfindung oder Verstand. Mehr sagen hieße erklären, was jedoch nutzlos ist; weniger behaupten hieße lügen. Jedes Werk spricht für sich, mit der Stimme, die ihm eigen ist, und in der Spra-che, in der es gedacht wird; wer nicht versteht, kann nicht verstehen, daher gibt es auch nichts zu erklären. Es wäre, als wollte man jeman-dem, Wort für Wort, eine Sprache verständlich machen, die er nicht spricht.
Unkundig des Lebens und fast unkundig der Literatur, nahezu ohne geselligen Umgang und ohne Kultur, hat Caeiro sein Werk ge-schaffen, ein stilles und tiefgreifendes Werk des Fortschritts, gleich jenem, der mittels des unbewußten Bewußtseins der Menschen die logische Entwicklung der Zivilisation steuert. Dies war ein Fort-schritt in den Sinneswahrnehmungen oder vielmehr in der Art und Weise wahrzunehmen, und zudem eine innere Evolution von Ge-danken, wie sie sich aus solch fortschreitenden Sinneswahrnehmun-gen ergeben. Mit Hilfe einer übermenschlichen Intuition, gleich je-ner, die immerwährende Religionen zu stiften vermag, ohne daß ihr deshalb das Attribut religiös zustünde, da sie, wie die Sonne und der Regen, jede Religion und jede Metaphysik ausschließt, hat dieser Mann die Welt entdeckt, ohne über sie nachzudenken, und einen Be-griff des Weltalls geschaffen, der keine bloßen Auslegungen enthält.
Als mir die Aufgabe zuteil wurde, diese Bücher mit einem Vor-wort zu versehen, dachte ich zunächst daran, eine ausführliche und kritische Studie über Caeiros Werk, seine Natur, seine Theorien und seine natürliche Bestimmung zu verfassen. Ich brachte jedoch keine Studie zustande, die mich zufriedengestellt hätte. Wie auch? Denn etwas so Unmittelbares wie Himmel und Erde läßt sich nicht den-ken, sondern einzig sehen und empfinden.
Es bedrückt mich, daß mich der Verstand auf diese wenigen Worte zum Werk meines Meisters beschränkt und ich mit dem Kopf nichts Nützlicheres oder Wichtigeres zu schreiben vermag, als ich es bereits mit dem Herzen in der [XIV] Ode meines Ersten Buches ge-sagt habe, in ihr beweine ich den Mann, der für mich, wie er es für viele andere noch sein wird, der Entdecker der Wirklichkeit ist, oder, wie er selbst es nannte, »der Argonaut der wahren Empfindungen« – der große Befreier, der uns mit seinem Gesang an das lichterfüllte Nichts zurückgab, das wir sind; der uns dem Tod wie dem Leben entriß, indem er uns unter den einfachen Dingen beließ, die in ihrem Ablauf weder vom Leben noch vom Sterben wissen; der uns von Hoffnungen und Verzweiflungen befreit hat, damit wir uns nicht ohne Ursache trösten und nicht grundlos betrüben; wir, wie auch er, zu Gast in der objektiven Wirklichkeit des Weltalls, ohne über sie nachzudenken.
Ich überlasse das Werk, dessen Herausgabe mir anvertraut wurde, dem schicksalhaften Zufall der Welt. Ich übergebe es ihr und sage: Freut euch, ihr alle, die ihr weint während der größten Krankheit der Geschichte!
Der große Pan ist wiedergeboren!
Das gesamte Werk ist auf Wunsch seines Autors dem Andenken Cesário Verdes[1] gewidmet.
deutscher Text
Zum portugiesischen Text
Der Hüter der Herden
O Guardador de Rebanhos
I
Nie habe ich Herden gehütet,
Und doch ist es, als hütete ich sie.
Meine Seele ist wie ein Hirte,
Kennt den Wind und die Sonne
Und geht an der Hand der Jahreszeiten,
Folgt ihnen und schaut.
Aller Friede der menschenleeren Natur
Setzt sich mir zur Seite.
Aber ich werde traurig wie ein Sonnenuntergang
In unserer Phantasie,
Wenn es kalt wird in der Tiefe der Ebene
Und man spürt, die Nacht ist gekommen
Wie ein Schmetterling durchs Fenster.
Doch meine Trauer ist Ruhe,
Weil sie natürlich ist und rechtens,
Und genau sie in der Seele sein muß,
Wird sie sich ihres Daseins bewußt,
Und die Hände Blumen pflücken unbemerkt von ihr.
Wie Viehglockenklang
Hinter der Wegbiegung
Sind meine Gedanken zufrieden.
Nur schmerzt mich zu wissen, daß sie zufrieden sind,
Denn wüßt’ ich es nicht,
Wären sie statt traurig-zufrieden
Heiter-zufrieden.
Denken ist lästig wie ein Gang durch den Regen,
Wenn der Wind zunimmt und es stärker zu regnen scheint.
Ich habe weder Ehrgeiz noch Wünsche.
Dichter zu sein ist nicht mein Bestreben.
Es ist meine Art, einsam zu sein.
Und wenn ich zuweilen –
In meiner Phantasie – ein Lämmlein sein möchte
(Oder die ganze Herde,
Um über den ganzen Hang auszuschwärmen
Und viel Glück zugleich zu sein),
So nur, weil ich fühle, was ich bei Sonnenuntergang schreibe,
Oder wenn eine Wolke mit der Hand über das Licht streicht
Und Stille über die Gräser huscht.
Wenn ich mich setze, Verse zu schreiben
Oder, über Wege und Stege wandernd,
Verse auf ein Papier in meinem Denken schreibe,
Spüre ich einen Hirtenstab in den Händen
Und sehe mein Ebenbild
Von einem Hügel
Auf meine Herde schauen und meine Gedanken sehen,
Oder auf meine Gedanken schauen und meine Herde sehen,
Und vage lächeln wie einer, der nicht versteht, was man sagt,
Und so tun will, als ob er verstünde.
Ich grüße alle, die mich künftig lesen,
Und ziehe vor ihnen meinen breiten Hut,
Wenn sie mich an meiner Tür erblicken,
Sobald die Kutsche erscheint auf dem Hügel.
Ich grüße sie und wünsch’ ihnen Sonne
Und Regen, wenn Regen nottut,
Und in ihren Häusern möge
Nahe einem offenen Fenster
Ihr Lieblingsstuhl stehen,
Auf den sie sich setzen und meine Verse lesen.
Und beim Lesen meiner Verse denken,
Ich sei ein Naturding –
Zum Beispiel der alte Baum,
In dessen Schatten sie sich als Kinder
Fallen ließen, ermattet vom Spiel,
Und mit zerrissenem Schürzenärmel
Den Schweiß von der heißen Stirn wischten.
II
Mein Blick ist offen wie eine Sonnenblume …
Ich habe die Gewohnheit, die Straßen entlangzuwandern,
Nach rechts und nach links zu schauen
Und manchmal auch zurück …
Und was ich mit jedem Augenblick sehe,
Habe ich zuvor nie gesehen
Und weiß dies sehr wohl wahrzunehmen …
Ich kenne den Wesensschauder
Eines Kindes, merkte es bei seiner Geburt,
Daß es wirklich das Licht der Welt erblickt …
Ich fühle mich mit jedem Augenblick
Für die ewige Neuheit der Welt geboren …
Ich glaube an die Welt wie an ein Tausendschönchen,
Weil ich sie sehe. Aber ich denke nicht nach über sie,
Denn denken heißt nicht-verstehen …
Die Welt wurde nicht geschaffen, damit wir über sie nachdenken
(Denken heißt augenkrank sein),
Sondern damit wir sie ansehen und im Einklang sind mit ihr.
Ich habe keine Philosophie, ich habe Sinne …
Rede ich von der Natur, so nicht, weil ich weiß, was sie ist,
Sondern weil ich sie liebe, und darum liebe ich sie;
Denn wer liebt, weiß niemals, was er liebt,
Noch warum er liebt oder was lieben ist …
Lieben ist ewige Unschuld
Und die einzige Unschuld besteht im Nicht-Denken …
III
In der Dämmerung, am Fenster lehnend
Und mit einem Seitenblick wissend, daß vor mir Felder liegen,
Lese ich, bis mir die Augen brennen,
Cesário Verdes Buch.
Der Ärmste! Er war ein Mensch vom Land,
Der sich gefangen frei durch die Stadt bewegte.
Doch seine Art, die Häuser zu betrachten,
Seine Art, auf die Straßen zu achten,
Die Dinge ins Auge zu fassen,
Ist die eines Menschen, der Bäume betrachtet
Und den Weg im Blick hat, auf dem er geht –
Einer, der die Blumen wahrnimmt auf den Feldern …
Daher die große Traurigkeit,
Die er niemals recht zugab –
Doch bewegte er sich in der Stadt wie einer, der sich nicht auf dem Land bewegt,
Und traurig, wie wenn man Blumen in Bücher preßt
Und Pflanzen in Krüge stellt …
IV
Heute nachmittag ging das Gewitter
An den Hängen des Himmels nieder
Wie ein gewaltiger Steinschlag …
Wie wenn jemand aus einem hohen Fenster
Ein Tischtuch ausschüttelt
Und die Krümel machen, weil sie gemeinsam fallen,
Im Niederfallen Geräusche,
Rann laut Regen vom Himmel
Und schwärzte die Wege …
Als Blitze die Luft erschütterten
Und den Raum schüttelten,
Wie ein großes Haupt, das nein sagt,
Schickte ich – warum nur? – ich hatte keine Angst –
Ein Gebet zur Heiligen Barbara,
Als wär’ ich jemandes alte Tante.
Ach, als ich zur Heiligen Barbara betete,
Fühlte ich mich noch schlichter
Als ohnehin …
Fühlte mich häuslich und hausbacken,
Als hätte ich dieses Leben
Still wie die Hinterhofmauer verbracht,
Hatte Gedanken und hatte Gefühle, weil ich sie hatte,
Wie eine Blume Farbe und Duft …
Ich fühlte mich wie einer, der an die Heilige Barbara glauben kann …
Ach, an die Heilige Barbara glauben können!
(Wer da glaubt, es gibt die Heilige Barbara,
Glaubt er, sie ist ein Mensch und sichtbar,
Oder was sonst glaubt er von ihr?)
(Welch eine Täuschung! Was wissen
Die Blumen, die Bäume, die Herden
Von der Heiligen Barbara? … Der Zweig eines Baumes,
Hätte er Verstand, könnte doch niemals
Heilige ersinnen noch Engel …
Er könnte nur denken: die Sonne
Erhellt und das Gewitter
Ist ein plötzlicher Lärm,
Beginnend mit Licht …
Ach, wie sind doch selbst die schlichtesten Menschen
Verworren, töricht und krank
Neben der klaren Schlichtheit
Und dem gesunden Dasein
Von Bäumen und Pflanzen!)
Und ich, an all dies denkend,
Fühlte mich abermals weniger glücklich.
Fühlte mich düster und krank und schwer
Wie ein Tag, über dem ein Gewitter droht,
Und selbst zur Nachtzeit nicht niedergeht …
V
Auch im Nichtdenken steckt genug Metaphysik.
Was ich denke über die Welt?
Was weiß ich, was ich denke über die Welt!
Erkrankte ich, dächte ich darüber nach.
Welche Vorstellung ich habe von den Dingen?
Welche Meinung über Ursache und Wirkung?
Was ich ergrübelt habe über Gott und die Seele
Und die Erschaffung der Welt?
Ich weiß es nicht. Für mich heißt darüber nachdenken, die Augen schließen
Und nicht denken. Heißt die Vorhänge zuziehen
An meinem Fenster (doch hat es keine Vorhänge).
Das Geheimnis der Dinge? Was weiß ich, was Geheimnis ist!
Das einzige Geheimnis ist, daß da einer ans Geheimnis denkt.
Wer in der Sonne steht und die Augen schließt,
Weiß bald nicht mehr, was die Sonne ist,
Und ersinnt überhitztes Zeug.
Aber kaum macht er die Augen auf und sieht die Sonne,
Kann er an nichts mehr denken,
Denn das Sonnenlicht taugt mehr als die Gedanken
Aller Dichter und aller Denker.
Das Sonnenlicht weiß nicht, was es tut,
Und irrt daher nicht, ist für alle da und ist gut.
Metaphysik? Welche Metaphysik haben die Bäume?
Grün zu sein, belaubt und Zweige zu tragen
Und Früchte zu bringen zu ihrer Zeit, und wir nehmen es gedankenlos hin,
Wir, außerstande, sie wahrzunehmen.
Aber welche Metaphysik wäre besser als die der Bäume,
Die nicht wissen, wozu sie leben,
Nicht wissen, daß sie’s nicht wissen?
»Inneres Gefüge der Dinge«,
»Innerer Sinn des Weltalls«.
All dies ist falsch, all dies will nichts besagen.
Wie kann man nur an dergleichen denken!
Es ist, als dächte man an Gründe und Zwecke,
Wenn der Morgen anbricht und bei den Bäumen
Schwebendes Gold die Dunkelheit aufhebt.
Über den inneren Sinn der Dinge grübeln
Ist so müßig wie an die Gesundheit denken
Oder ein Glas zum Quellwasser tragen.
Der einzige innere Sinn der Dinge
Ist, daß sie keinen inneren Sinn besitzen.
Ich glaube nicht an Gott, ich habe ihn nie gesehen.
Wollte er, daß ich an ihn glaube,
Würde er gewiß kommen und mit mir reden,
Durch meine Tür treten
Und sagen: Hier bin ich!
(Das mag lächerlich klingen
Für einen, der nicht weiß, was das heißt: die Dinge betrachten,
Und deshalb nicht begreift, wenn einer auf eine Weise
Von ihnen spricht, die ihr Anblick lehrt.)
Wenn aber Gott die Blumen ist und die Bäume
Und die Berge und die Sonne und der Mondschein,
Dann glaube ich an ihn,
Dann glaube ich an ihn zu jeder Stunde!
Und mein Leben ist ein einziges Gebet, eine einzige Messe,
Eine Kommunion mit Augen und Ohren.
Wenn aber Gott die Bäume ist und die Blumen
Und die Berge und der Mondschein und die Sonne,
Wozu nenne ich ihn dann Gott?
Ich nenne ihn Blumen und Bäume und Berge und Sonne und Mondschein;
Denn wenn er, damit ich ihn sehe,
Sonne wurde und Mondschein und Blumen und Bäume und Berge,
Und mir als Bäume und Berge erscheint
Und als Mondschein und Sonne und Blumen,
Dann will er, daß ich ihn erkenne
Als Bäume und Berge und Blumen und Mondschein und Sonne.
Und darum gehorche ich ihm
(Was weiß ich mehr von Gott als Gott von sich selbst?),
Gehorche ihm als einer, der unmittelbar lebt,
Einer, der die Augen aufschlägt und sieht,
Und nenne ihn Mondschein und Sonne und Blumen und Bäume und Berge,
Und liebe ihn, ohne an ihn zu denken,
Und denke ihn im Sehen und Hören
Und gehe immerfort um mit ihm.
VI
An Gott denken heißt Gott ungehorsam sein,
Denn Gott wollte, daß wir ihn nicht kennen,
Deshalb hat er sich uns auch nicht gezeigt …
Seien wir schlicht und still
Wie die Bäche und die Bäume,
Dann liebt uns Gott und macht uns
Zu uns, wie die Bäume zu Bäumen
Und die Bäche zu Bächen,
Und schenkt uns Grün in ihrem Frühling
Und einen Fluß, in den wir münden, wenn unser Ende kommt …
Und mehr gibt er uns nicht, denn uns mehr geben hieße uns mehr nehmen.
VII
Von meinem Dorf aus sehe ich, was man auf Erden vom Weltall sehen kann …
Darum ist mein Dorf auch so groß wie irgendein anderes Land,
Denn ich bin so groß wie das, was ich sehe,
Und nicht so groß, wie ich bin …
In den Städten ist das Leben kleiner
Als hier in meinem Haus auf dem Hügel.
In der Stadt versperren die großen Häuser die Aussicht,
Verdecken den Horizont, stoßen unseren Blick weit fort vom Himmel,
Machen uns klein, denn sie nehmen uns, was unsere Augen uns geben können,
Und machen uns arm, denn unser einziger Reichtum ist Sehen.
VIII
An einem Mittag gegen Frühlingsende
Hatte ich einen Traum, deutlich wie eine Fotografie.
Ich sah Jesus Christus auf die Erde kommen,
Den Hang eines Berges hinab,
Wieder zum Kind geworden,
Lief und rollte er durchs Gras
Und riß Blumen aus, um sie fortzuwerfen,
Und lachte, daß man es schon von weitem vernahm.
Er war dem Himmel entflohen.
Er war zu sehr unser, um sich
Als zweite Person der Dreifaltigkeit auszugeben.
Im Himmel war alles falsch, stand alles in Mißklang
Zu Blumen und Bäumen und Steinen.
Im Himmel mußte er immer ernsthaft bleiben,
Und immer wieder aufs neue Mensch werden
Und hoch ans Kreuz und sterben
Mit einer Dornenkrone
Und nägeldurchbohrten Füßen
Und einem Tuch um die Hüften
Wie die Schwarzen auf Bildern.
Nicht einmal Vater und Mutter durfte er haben
Wie die anderen Kinder.
Zwei Personen waren sein Vater –
Ein Alter namens Joseph, ein Zimmermann,
Und der war nicht sein Vater;
Und der andere Vater war eine dumme Taube,
Die einzige häßliche Taube dieser Welt,
Denn sie war nicht von dieser Welt noch war sie Taube.
Und seine Mutter hatte nicht geliebt, bevor sie ihn gebar.
Sie war keine Frau: sie war ein Koffer,
In dem er vom Himmel kam.
Und er, der nur Kind einer Mutter war,
Aber nie einen Vater hatte, den er achten und lieben konnte,
Sollte Güte und Gerechtigkeit predigen!
Eines Tages, als Gott gerade schlief
Und der Heilige Geist umherflog,
Lief er zur Truhe mit den Wundern und stahl daraus drei.
Mit dem ersten bewirkte er, daß niemand von seiner Flucht erfuhr –
Mit dem zweiten schuf er sich ewiges Menschensein und wurde zum Kind.
Mit dem dritten schuf er einen ewig gekreuzigten Christus
Und ließ ihn an dem Kreuz hängen, das im Himmel steht
Und allen anderen als Vorbild dient.
Dann flüchtete er zur Sonne
Und stieg an dem ersten Strahl herab, den er fassen konnte.
Heute lebt er bei mir in meinem Dorf.
Er ist ein Kind mit einem hübschen, natürlichen Lachen.
Wischt sich die Nase mit dem rechten Arm,
Planscht in den Pfützen,
Pflückt Blumen, freut sich daran und vergißt sie.
Wirft mit Steinen nach den Eseln,
Stiehlt Obst aus den Gärten
Und läuft schreiend und heulend vor den Hunden davon.
Und weil er weiß, sie mögen das nicht,
Aber alle Leute es spaßig finden,
Läuft er den Mädchen nach,
Die, den Krug auf dem Kopf,
In Gruppen über die Straße ziehen,
Und hebt ihnen die Röcke hoch.
Mich hat er alles gelehrt.
Er hat mich gelehrt, auf die Dinge zu schauen.
Er zeigt mir die Blumen in allen Einzelheiten.
Er zeigt mir, wie hübsch die Steine sind,
Wenn wir sie in den Händen halten
Und mit Muße betrachten.
Von Gott spricht er schlecht.
Sagt, er sei ein kranker, dummer Alter,
Der immerfort auf den Boden speit
Und zotige Reden führt.
Die Jungfrau Maria verbringt ihre Abende in der Ewigkeit mit Strümpfestricken.
Und der Heilige Geist kratzt sich mit dem Schnabel,
Plustert sich auf in den Sesseln und beschmutzt sie.
Alles im Himmel ist dumm wie die katholische Kirche.
Er sagt, Gott versteht nichts
Von den Dingen, die er schuf –
»Wenn er überhaupt ihr Schöpfer ist, was ich bezweifle« –.
»Er sagt zum Beispiel, daß alle Wesen sein Preislied singen,
Aber die Wesen besingen nichts.
Sängen sie, wären sie Sänger.
Die Wesen existieren und nichts weiter,
Und darum heißen sie Wesen.«
Und dann, ermüdet vom Gotteslästern,
Schlummert das Jesuskind ein auf meinem Arm,
Und ich trag’ es an mich geschmiegt nach Haus’.
Es wohnt bei mir in meinem Haus auf halber Höhe[2] des Hügels.
Es ist das Ewige Kind, der Gott, der uns fehlte.
Es ist das Menschliche, das natürlich ist,
Es ist das Göttliche, das lächelt und spielt.
Und darum weiß ich mit aller Gewißheit:
Es ist das wahre Jesuskind.
Und das Kind, so menschlich, daß es göttlich ist,
Ist mein tägliches Dichterleben,
Und weil es mich allzeit begleitet, bin ich auch allzeit Dichter,
Und mein flüchtigster Blick
Schenkt mir eine Fülle von Empfindungen,
Und der geringste Laut, woher er auch kommt,
Scheint mit mir zu sprechen.
Das Neue Kind, das wohnt, wo ich lebe,
Reicht mir die eine Hand
Und die andere allem, was ist,
Und so gehen wir drei über Weg und Steg,
Springen und singen und lachen
Und genießen unser Geheimnis;
Das lautet, allüberall zu wissen:
Es gibt kein Geheimnis auf Erden
Und alles lohnt der Mühe.
Das Ewige Kind ist mein steter Begleiter.
Mein Sehen folgt seinem weisenden Finger.
Mein Gehör, das heiter auf alle Laute lauscht,
Ist der Kitzel, wenn es mich spielerisch an den Ohren zupft.
So gut verstehen wir einer den anderen
In der Gemeinsamkeit aller Dinge,
Daß wir nie aneinander denken,
Doch wir leben vereint und zu zweit
In innerem Einverständnis
Wie die rechte Hand und die linke.
Bei Anbruch der Dämmerung spielen wir
Auf der Schwelle der Haustür Dame,
Ernsthaft, wie es sich ziemt für einen Gott und einen Dichter,
Als ob jeder Stein
Ein ganzes Weltall wäre
Und daher, ihn fallen zu lassen,
Gefährlich.
Dann erzähle ich ihm Geschichten nur von uns Menschen,
Und es lächelt, weil alles unglaublich klingt.
Verlacht die Könige und die Nichtkönige,
Und es tut ihm weh, von Kriegen zu hören,
Von Handelsgeschäften und Schiffen,
Die auf hoher See nur Rauch sind in der Luft.
Denn es weiß, dies alles verfehlt die Wahrheit,
Die eine Blume beim Blühen besitzt
Und die mit dem Sonnenlicht
Berge und Täler verwandelt
Und die Augen blendet beim Anblick gekalkter Mauern.
Dann schlummert es ein, und ich bring’ es zu Bett.
Ich trag’ es ins Haus,
Lege es nieder und ziehe es
Im sorgsam mütterlichen Ritual
Langsam aus.
Es schläft in meiner Seele,
Und zuweilen erwacht es nachts
Und spielt mit meinen Träumen.
Einige läßt es rücklings zappeln,
Andere legt es übereinander,
Klatscht in die Hände
Und lächelt hinein in meinen Schlaf .
Wenn ich sterben muß, liebes Söhnchen,
Will ich das Kind sein, der Kleinste.
Dann nimm du mich auf den Arm
Und trag mich hinein in dein Haus.
Zieh mir das müde, menschliche Wesen aus
Und leg mich in dein Bett.
Und erzähl mir Geschichten, falls ich erwache,
Damit ich wieder einschlafe.
Und leih mir deine Träume, damit ich spielen kann,
Bis der Tag kommt,
Den nur du kennst.
Dies ist die Geschichte von meinem Jesuskind.
Aus welch triftigem Grund
Sollte sie nicht wahrer sein
Als alles, was Philosophen denken
Und Religionen lehren?
IX
Ich bin ein Hirte.
Die Herde sind meine Gedanken
Und meine Gedanken allesamt Sinnesempfindungen.
Ich denke mit Augen und Ohren
Mit Händen und Füßen
Mit Nase und Mund.
Sich eine Blume denken heißt, sie sehen und riechen,
Und eine Frucht verzehren heißt, ihren Sinn erfassen.
Wenn ich mich daher an einem heißen Tag
Vor lauter Freude traurig fühle
Und der Länge nach ins Gras lege
Und die erhitzten Augen schließe,
Spüre ich meinen Körper von Kopf bis Fuß ausgestreckt in der Wirklichkeit,
Kenne die Wahrheit und bin froh.
X
»Heda, du Hüter der Herden,
Dort am Wegesrand,
Was sagt dir der wehende Wind?«
»Daß er Wind ist und daß er weht,
Daß er schon vordem wehte
Und daß er auch künftig wehen wird.
Und was sagt er dir?«
»Noch so manches mehr.
Er spricht mir von vielen anderen Dingen.
Von Erinnerungen und Sehnsucht
Und Dingen, die nie gewesen sind.«
»Du hast den Wind nie wehen gehört.
Der Wind erzählt nur vom Wind.
Was du ihn sagen hörtest, war Lüge,
Und diese Lüge ist in dir.«
XI
Die Dame dort hat ein Klavier.
Es klingt angenehm, aber nicht wie das Strömen der Flüsse
Oder das Rauschen der Bäume …
Wozu braucht man ein Klavier?
Am besten, man hat Ohren
Und hört klar die Klänge, die entstehen.
XII
Die Hirten Vergils spielten Flöten und andere Instrumente
Und sangen literarisch von Liebe
(Heißt es – Ich habe Vergil nie gelesen.
Weshalb auch?).
Aber die Hirten Vergils, die Ärmsten, sind Vergil,
Und die Natur ist hier und nirgendwo sonst.
XIII
Sachte, sachte, sachte
Weht ein sachter Wind,
Weht vorüber, sacht.
Und ich weiß nicht, was ich denke,
Und ich will es auch nicht wissen.
XIV
Reime kümmern mich wenig. Selten
Stehen zwei gleiche Bäume nebeneinander.
Ich denke und schreibe, wie die Blumen bunt sind,
Doch ist mein Ausdruck minder vollkommen,
Da mir die göttliche Schlichtheit fehlt,
Ganz nur Äußeres zu sein.
Ich schaue und lass’ mich ergreifen,
Lass’ mich ergreifen, wie Wasser fließt, ist der Boden geneigt,
Und mein Dichten ist natürlich wie das Aufkommen des Windes …
XV
Die vier folgenden Lieder
Sind anders als alles, was ich sonst denke,
Verleugnen alles, was ich sonst fühle,
Sind das Gegenteil dessen, was ich bin …
Ich schrieb sie, als ich krank war,
Und darum sind sie natürlich
Und stimmen überein mit dem, was ich fühle,
Stimmen überein, womit sie nicht übereinstimmen …
Wenn ich krank bin, muß ich das Gegenteil dessen
Denken, was ich denke, wenn ich gesund bin
(Sonst wäre ich nicht krank),
Muß ich das Gegenteil dessen fühlen, was ich fühle,
Wenn ich gesund bin,
Muß ich mein Wesen
Als ein Geschöpf verleugnen, das auf bestimmte Weise fühlt …
Ich muß ganz und gar krank sein – meine Gedanken und alles übrige.