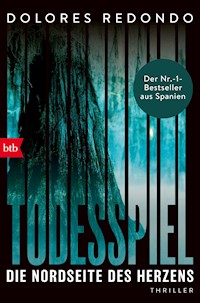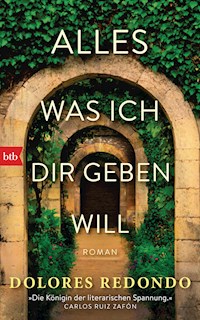
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Ein ungesühntes Verbrechen. Ein grausamer Verdacht.
Der preisgekrönte Bestseller von der »Königin der literarischen Spannung.« Carlos Ruiz Zafón
»Er hatte den Verdacht, dass sein ganzes Leben auf einer Lüge aufgebaut war.« Als der Schriftsteller Manuel Ortigosa erfährt, dass sein Mann Álvaro bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, eilt er sofort nach Galicien. Dort ist das Unglück passiert. Dort ist die Polizei auffallend schnell dabei, die Akte zu schließen. Dort stellt sich heraus, dass Álvaro ihn seit Jahren getäuscht und ein Doppelleben geführt hat. Doch was suchte Álvaro in jener Nacht auf einer einsamen Landstraße? Zusammen mit einem eigensinnigen Polizisten der Guardía Civil und Álvaros Beichtvater stellt Manuel Nachforschungen an. Eine Suche, die ihn in uralte Klöster und vornehme Herrenhäuser führt. In eine Welt voller eigenwilliger Traditionen – und in die Abgründe einer Familie, für die Ansehen wichtiger ist als das Leben der eigenen Nachkommen.
- Ein ungesühntes Verbrechen. Ein grausamer Verdacht.
- Der preisgekrönte Bestseller von der »Königin der literarischen Spannung«. Carlos Ruiz Zafón
- Wie weit geht eine Familie, um ihr Ansehen zu retten?
- »Faszinierend.« (Isabel Allende)
- Ausgezeichnet mit dem Premio Planeta und dem Premio Bancarella.
- »Vor dem Hintergrund der wunderschönen Landschaft Galiciens erzählt Redondo eine aufregend verschlungene Geschichte voller überraschender Wendungen. Ein Spannungsroman, bei dem die Leser voll auf ihre Kosten kommen.« (Publishers‘ Weekly)
- Über 400.00 verkaufte Ex. in Spanien. Gesamtauflage Dolores Redondo in Spanien: 1,5 Mio Leser.
- Erscheint in 21 Sprachen.
- Verfilmung geplant.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 812
Ähnliche
Zum Buch
Ein unerwarteter Tod. Ein dunkles Familiengeheimnis. Die Suche nach der Wahrheit in der legendären Landschaft Galicien.
»Er hatte den Verdacht, dass sein ganzes Leben auf einer Lüge aufgebaut war.«
Als der Schriftsteller Manuel Ortigosa erfährt, dass sein Mann Álvaro bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, eilt er sofort nach Galicien. Dort ist das Unglück passiert. Dort ist die Polizei auffallend schnell dabei, die Akte zu schließen. Dort stellt sich heraus, dass Álvaro ihn seit Jahren getäuscht und ein Doppelleben geführt hat. Doch was suchte Álvaro in jener Nacht auf einer einsamen Landstraße?
Zusammen mit einem eigensinnigen Polizisten der Guardía Civil und Álvaros Beichtvater stellt Manuel Nachforschungen an. Eine Suche, die ihn in uralte Klöster und vornehme Herrenhäuser führt. In eine Welt voller eigenwilliger Traditionen – und in die Abgründe einer Familie, für die Ansehen wichtiger ist als das Leben der eigenen Nachkommen.
»Vor der Folie der wunderschönen Landschaft Galiciens erzählt Redondo eine aufregend verschlungene Geschichte voller überraschender Wendungen. Ein Spannungsroman, bei dem die Leser voll auf ihre Kosten kommen.«
Publishers’ Weekly
»Dolores Redondo ist die Königin der literarischen Spannung.«
Carlos Ruiz Zafón
Zur Autorin
DOLORES REDONDO begeistert mit ihren literarischen Spannungsromanen ein Millionenpublikum auf der ganzen Welt. »Alles was ich dir geben will« stand monatelang auf der spanischen Bestsellerliste und wurde mit dem Premio Planeta, dem höchstdotierten Literaturpreis des Landes, ausgezeichnet. Redondo wurde außerdem für den CWA International Dagger Award nominiert und war Finalistin beim Grand Prix des Lectrices de ELLE. Sie wurde 1969 in San Sebastián geboren und lebt heute in der nordspanischen Region Navarra.
Dolores Redondo
Alles was ich dir geben will
Roman
Aus dem Spanischen von Lisa Grüneisen
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die spanische Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »Todo esto te daré« bei Editorial Planeta, Barcelona. Vorangestelltes Zitat von Mario Puzo, Der Pate. Deutsche Übersetzung von Gisela Stege. Copyright © 1969 by Mario Puzo; Alle deutschen Rechte bei C. Bertelsmann Verlag GmbH, München 1981. Veröffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlags.
Copyright © 2016 Dolores Redondo Meira
By Agreement with Pontas Literary & Film Agency
Copyright © der deutschen Ausgabe 2019 btb Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: semper smile, München
unter Verwendung eines Fotos von © Salamander Hill/David Drummond
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-21376-3 V002 www.btb-verlag.de
Für Eduardo, immer.
Meinem Vater, einem Vollblutgalicier, meiner Mutter – und der Liebe der beiden, die allen Widerständen getrotzt hat, mich umso stolzer
Die meisten Menschen legen Wert darauf, was andere über sie sagen; nicht so die Vagabunden und der Adel. Sie tun, wonach ihnen der Sinn steht, ohne sich darum zu sorgen, welche Folgen ihr Handeln hat. Ich spreche hier nicht von der Bourgeoisie, die ihr Vermögen bei Partys verschleudert, sondern von denen, die über Generationen dazu erzogen wurden, die Meinung anderer geringzuschätzen.
AGATHA CHRISTIE, Die Memoiren des Grafen
Praktisch jeder im Haus könnte es getan haben.
AGATHA CHRISTIE, Das krumme Haus
Michael Corleone hatte sich gegen alle Zufälle abgesichert. Seine Planung war perfekt, seine Vorsichtsmaßnahmen waren unangreifbar. Er ließ sich Zeit, weil er hoffte, ein ganzes Jahr Spielraum für seine Vorbereitungen zu haben. Aber diese Hoffnung sollte sich nicht erfüllen: Das Schicksal selber stellte sich gegen ihn, und zwar in höchst unerwarteter Form. Denn es war der padrino, der große Don Corleone persönlich, der seinen Sohn Michael im Stich ließ.
MARIO PUZO, Der Pate
An deiner Seite werden sie leben und zu dir sprechen, als ob ich bei dir wäre.
ISOLINA CARRILLO, Dos Gardenias
Rettungsanker
Das Klopfen an der Tür klang nachdrücklich. Achtmal schnell hintereinander, als hätte es jemand brandeilig. Kein Bekannter, kein Handwerker oder Postbote würde so klopfen. Später sollte Manuel denken, dass man es sich genau so vorstellte, wenn die Polizei vor der Tür stand.
Ein paar Sekunden lang betrachtete er den blinkenden Cursor am Ende des letzten Satzes. Es lief gut heute Morgen, besser als in den letzten drei Wochen. Er gab es ungern zu, aber das Schreiben fiel ihm leichter, wenn er allein zu Hause war und seine Arbeit nicht zu festen Essenszeiten unterbrechen musste; wenn er sich einfach treiben lassen konnte. In ein, zwei Wochen würde er mit Die Sonne von Theben fertig sein, vielleicht sogar früher, wenn alles gut ging. Bis dahin war dieses Buch sein einziger Lebensinhalt, seine Obsession. So war es bisher bei jedem Buch gewesen. Es war ein beflügelndes und zerstörerisches Gefühl, ein Verzicht, den er brauchte und gleichzeitig fürchtete. An solchen Tagen, das wusste er, war er für andere nicht gerade die beste Gesellschaft.
Er sah auf, warf einen kurzen Blick zum Flur, dann wieder zum Cursor, der mit Wörtern beladen zu sein schien, die niedergeschrieben werden wollten. Eine trügerische Stille hatte sich in der Wohnung breitgemacht und nährte für einen Moment die falsche Hoffnung, der ungestüme Besucher hätte aufgegeben. Aber das war nicht der Fall. Manuel spürte die erwartungsvolle, stumme Energie auf der anderen Seite der Wohnungstür. Erneut sah er zum Cursor, legte die Hände auf die Tasten und war fest entschlossen, den angefangenen Satz zu beenden. Er dachte sogar darüber nach, gar nicht zu reagieren, als es erneut klopfte.
Am Ende lief er in die Diele und riss verärgert die Tür auf. Hatte er dem Concierge nicht mehr als einmal deutlich gemacht, dass er bei der Arbeit nicht gestört werden wollte?
Vor der Tür standen zwei Polizisten in Uniform, ein Mann und eine Frau. Sie traten einen Schritt zurück, als die Tür aufging.
»Guten Tag. Wohnt hier ein Álvaro Muñiz de Dávila?«, fragte der Mann nach einem kurzen Blick auf eine Visitenkarte.
»Ja«, antwortete Manuel. Sein Ärger war augenblicklich verraucht.
»Sind Sie ein Angehöriger?«
»Wir sind verheiratet.«
Manuel sah, wie der Polizist seiner Kollegin einen flüchtigen Blick zuwarf, war aber jetzt schon so beunruhigt, dass er nicht weiter darüber nachdachte.
»Ist ihm etwas passiert?«
»Ich bin Hauptkommissar Castro, und das ist meine Kollegin, Kommissarin Acosta. Dürfen wir reinkommen? Drinnen können wir uns besser unterhalten.«
Manuel war Schriftsteller. Er wusste genau, wie es weitergehen würde. Zwei uniformierte Beamte, die um Einlass baten, brachten keine guten Nachrichten.
Er nickte und trat beiseite. In der schmalen Diele wirkten die Polizisten in ihren grünen Uniformen riesig. Die Sohlen ihrer Schnürstiefel quietschten auf dem dunklen Parkettboden. Manuel führte sie ins Wohnzimmer, wo sein Schreibtisch stand, aber statt ihnen einen Platz auf dem Sofa anzubieten, blieb er unvermittelt stehen, sodass sie fast mit ihm zusammenstießen, und fragte erneut: »Ist ihm etwas passiert?«
Es war im Grunde keine Frage. Noch auf dem Weg ins Wohnzimmer war daraus eine Art Gebet geworden, ein Mantra, das er sich in Gedanken immer wieder vorgesagt hatte: Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Dabei ahnte er jetzt schon, dass alles Bitten und Flehen nichts helfen würde, genauso wenig wie damals, als seine Schwester in nur neun Monaten vom Krebs zerfressen worden war. Fiebrig und erschöpft hatte sie am Ende dagelegen, tief in die Kissen gesunken, von der Krankheit gezeichnet, und hatte noch gescherzt: »Jetzt brauche ich allen Ernstes genauso lange, um diese Erde zu verlassen, wie ich gebraucht habe, um sie zu betreten« – alles nur, um ihn aufzumuntern, um ihn zu trösten. Er hatte eine höhere, nutzlose Macht angefleht, immer und immer wieder die alte Formel wiederholt, während er mit müden Schritten wie ein unterwürfiger Diener zu dem winzigen, stickig heißen Büro geschlichen war, in dem ein Arzt ihm mitgeteilt hatte, dass seine Schwester die Nacht nicht überstehen würde. Nein, es hatte nicht geholfen, dass er dabei die Hände zum stummen Gebet verschränkt hatte.
»Vielleicht sollten Sie sich setzen«, sagte der Polizist und wies zum Sofa.
»Ich will mich nicht setzen. Sagen Sie mir endlich, was los ist.« Er hörte selbst, dass das zu schroff geklungen hatte. Um dem Ganzen die Schärfe zu nehmen, fügte er leise hinzu: »Bitte.«
Der Polizist zögerte kurz, biss sich auf die Oberlippe und starrte einen Punkt irgendwo hinter Manuel an.
»Es geht um … also …«
»Es geht um Ihren Mann«, ergriff die Frau das Wort. Aus dem Augenwinkel sah Manuel, wie erleichtert ihr Kollege dreinblickte. »Es tut uns leid, aber wir haben schlechte Nachrichten für Sie. Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass Álvaro Muñiz de Dávila am frühen Morgen einen schweren Autounfall hatte. Als der Krankenwagen eintraf, war er bereits tot. Mein Beileid.«
Das perfekte Oval ihres Gesichts wurde durch ihr Haar, das sie im Nacken zu einem Knoten gedreht hatte, noch betont.
Manuel hatte es genau gehört: Álvaro war tot. Trotzdem ertappte er sich dabei, wie er ausschließlich über die zarte Schönheit dieser Frau nachdachte und kurz davor war, diese verstörende Wahrnehmung in Worte zu fassen. Sie war bildschön, ohne sich der perfekten Symmetrie ihrer Züge bewusst zu sein, was sie umso schöner machte. Später sollte er sich darüber wundern, welchen Ausweg sein Gehirn da genommen hatte. Jene Sekunden, in denen er sich auf dieses ebenmäßige Gesicht konzentriert hatte, waren der erste Rettungsanker gewesen – ein einziger kostbarer Augenblick, der die Flut von Fragen, die sich in seinem Kopf formierten, letztlich nicht aufzuhalten vermochte. Doch alles, was er sagte, war: »Álvaro?«
Die Polizistin nahm ihn sanft am Arm und führte ihn zum Sofa – wie man es bei einer Festnahme machte, würde er später denken. Dann setzte sie sich neben ihn.
»Der Unfall hat sich in den frühen Morgenstunden ereignet. Wie es aussieht, ist der Wagen auf gerader Strecke und bei guter Sicht von der Straße abgekommen. Es scheint kein weiteres Fahrzeug beteiligt gewesen zu sein. Nach dem, was uns die Kollegen aus Monforte berichtet haben, deutet alles darauf hin, dass er am Steuer eingeschlafen ist.«
Manuel hörte aufmerksam zu und bemühte sich, auf jedes Detail zu achten und die Stimmen in seinem Kopf zu überhören, die immer lauter schrien: Álvaro ist tot. Álvaro ist tot.
Das schöne Gesicht der Frau genügte nicht länger, um ihn abzulenken. Aus dem Augenwinkel sah er, dass ihr Kollege unterdessen den Schreibtisch in Augenschein nahm. Ein Glas mit einem Rest Kaffee und einem Löffel. Darunter die Einladung zur Verleihung eines renommierten Literaturpreises. Das Handy, mit dem er in der vergangenen Nacht noch mit Álvaro telefoniert hatte. Der erwartungsvoll blinkende Cursor am Ende der letzten Zeile, die er eben erst geschrieben hatte, als er in seiner Naivität noch geglaubt hatte, dass es gerade gut liefe. Mit einem Mal hatte all das keine Bedeutung mehr. Es hatte keine Bedeutung mehr, weil Álvaro tot war. Es musste wahr sein, weil diese Polizistin es gesagt hatte, und der griechische Chor in seinem Kopf es in ohrenbetäubendem Crescendo ein ums andere Mal wiederholte. Er griff nach dem zweiten Rettungsanker.
»Monforte, sagten Sie? Aber das ist doch in Galicien …«
»Ja, in der Provinz Lugo. Die dortige Polizeidienststelle hat uns informiert. Der Unfall selbst ist in einer kleinen Gemeinde bei Chantada passiert.«
»Das ist nicht Álvaro.«
Verblüfft sah der Polizist vom Schreibtisch auf und wandte sich Manuel zu. »Wie bitte?«
»Das kann nicht Álvaro gewesen sein. Mein Mann ist vorgestern zu einem Kundentermin nach Barcelona gefahren. Er arbeitet in der Werbung. Er hat wochenlang an einer Kampagne für eine katalanische Hotelkette gearbeitet. Es waren mehrere Meetings geplant. Heute Morgen sollte die Präsentation stattfinden. Er kann unmöglich in Lugo gewesen sein, da muss es sich um einen Irrtum handeln. Ich habe gestern Abend noch mit ihm gesprochen. Heute haben wir nur deshalb noch nicht telefoniert, weil die Präsentation so früh angesetzt war und ich immer erst später aufstehe. Aber ich rufe ihn gleich an.«
Manuel stand auf und ging zum Schreibtisch, ohne auf die Blicke zu achten, die die beiden Beamten wechselten. Daraus sprach Mitleid, schwer wie Blei. Fahrig suchte er zwischen dem Plunder auf der Tischplatte nach seinem Handy. Der Löffel klirrte gegen das Glas, in dem der eingetrocknete Kaffee einen Kranz hinterlassen hatte. Er fand das Telefon, tippte ein paarmal aufs Display und hielt es sich dann ans Ohr, ohne den Blick von der Polizistin abzuwenden, die bedrückt zu ihm herübersah.
Manuel ließ es mehrmals klingeln.
»Er wird gerade bei diesem Meeting sein, deshalb geht er nicht ran.«
Die Polizistin stand auf.
»Manuel – so heißen Sie, nicht wahr?«
Er nickte zögerlich.
»Manuel, kommen Sie. Setzen Sie sich zu mir.«
Mit dem Handy in der Hand kehrte er zum Sofa zurück.
»Manuel … Ich bin auch verheiratet.« Flüchtig sah sie auf ihren mattgoldenen Ehering. »Aber in meinem Job lernt man, dass man nie sicher wissen kann, was der Partner gerade macht. Es gibt bestimmt einen Grund, warum Ihr Mann dort war und es Ihnen nicht erzählt hat. Es besteht nicht der geringste Zweifel, dass er es ist. Wenn niemand an sein Handy geht, dann nur deshalb, weil es bei den Kollegen in Monforte liegt. Der Leichnam Ihres Mannes wurde ins Rechtsmedizinische Institut in Lugo gebracht und von einem Angehörigen identifiziert. Es handelt sich um Álvaro Muñiz de Dávila, vierundvierzig Jahre alt.«
Manuel hatte bei jedem einzelnen Satz den Kopf geschüttelt und der Polizistin, die sich im matten Glanz ihres Ringes anscheinend legitimiert fühlte, Gemeinplätze über Paarbeziehungen von sich zu geben, einen Irrtum unterstellt. Gerade erst vor ein paar Stunden hatte er mit Álvaro telefoniert, und da war er in Barcelona gewesen, nicht in Lugo. Was sollte er denn auch dort? Manuel kannte Álvaro, er wusste, wo er sich zurzeit aufhielt, und das war ganz sicher keine gottverdammte Landstraße bei Lugo. Er hasste Verallgemeinerungen über Paare, er hasste Verallgemeinerungen überhaupt, und allmählich hasste er auch diese neunmalkluge Kommissarin.
»Álvaro hat keine Angehörigen«, entgegnete er.
»Manuel …«
»Nein, natürlich hat er Familie wie jeder andere auch. Aber sie hatten keinen Kontakt mehr. Null. Und zwar schon wesentlich länger, als Álvaro und ich uns jetzt kennen. Sie irren sich gewaltig.«
Dann fiel ihm etwas ein – ein weiterer Rettungsanker.
»Außerdem bin ich nicht angerufen worden. Álvaro hat mich als Notfallkontakt in seinem Handy abgespeichert. Da hätte mich doch jemand anrufen müssen, oder?«
Der Polizist wirkte beinahe froh, das Wort ergreifen zu können.
»Bis vor ein, zwei Jahren wurde das auch so gehandhabt. Aber eine solche Nachricht telefonisch zu überbringen ist heikel und hat immer wieder zu … na ja … unerwünschten Reaktionen geführt. Mittlerweile sagen die Vorschriften, dass erst die zuständige Dienststelle informiert wird. Von dort werden dann zwei Beamte entsandt, die persönlich die Nachricht überbringen oder den Angehörigen zur Identifizierung begleiten.«
Für einen Moment war es still. Keiner rührte sich, bis der Polizist seiner Kollegin einen hilfesuchenden Blick zuwarf.
»Vielleicht möchten Sie einen Verwandten oder Freund anrufen …«, schlug sie vor.
Manuel sah sie ratlos an. Was sie da sagte, kam kaum bei ihm an, als käme ihre Stimme aus einer anderen Dimension.
»Was muss ich denn jetzt machen?«, wollte er wissen.
»Wie gesagt, der Leichnam befindet sich in der Rechtsmedizin in Lugo. Dort kann man Ihnen sagen, was die nächsten Schritte sind, damit Sie ihn beerdigen können.«
Als er die Beamten zur Tür begleitete, täuschte er Ruhe vor, die er nicht empfand. Er versprach ihnen noch, seine Schwester anzurufen. Ihm war klar, dass er einen gefassten Eindruck vermitteln musste, wenn er die beiden loswerden wollte. Als er ihnen die Hand gab, spürte er ihre skeptischen Blicke, die so gar nicht zu den freundlichen Worten passten, mit denen sie sich von ihm verabschiedeten. Er bedankte sich noch mal und schob die Tür ins Schloss.
Ein paar Sekunden lang lehnte er sich an das warme Holz. Er war sich sicher, dass die beiden hinter der Tür ebenfalls lauschten. Wahrscheinlich hatte er noch nie so lange dort gestanden. Auf einmal sah die Wohnung mit dem schmalen Flur, der zum Wohnzimmer führte, wie ein Blumenstrauß aus; die dicht gebündelten Stängel endeten in einer Explosion aus Licht. Aus der ungewohnten Perspektive wirkte sein Zuhause, das er sich seit fünfzehn Jahren mit Álvaro teilte, riesig. Im Licht, das durchs Fenster flutete, lösten sich die Konturen der Möbel auf und verblassten, verschwammen mit dem Weiß der Wände, und im selben Augenblick hörte dieser vertraute, geliebte Ort auf, sein Zuhause zu sein. Er wurde zu einem Ozean aus eisiger Sonne – einer infernalischen, isländischen Sonne, die selbst nachts nicht unterging. Er fühlte sich so allein wie damals in jener Nacht im Krankenhaus.
Seine Schwester anrufen. Bei dem Gedanken lächelte er bitter. Wenn er nur könnte! Er spürte, wie Übelkeit in ihm hochkroch wie ein Tier. Tränen stiegen ihm in die Augen, als ihm dämmerte, dass die einzigen beiden Menschen, die er jetzt gern anrufen würde, tot waren.
Als er zurück ins Wohnzimmer lief und das Handy vom Couchtisch nahm, unterdrückte er ein Schluchzen. Er strich über das Display. Die zuletzt gewählte Nummer wurde angezeigt, darunter Álvaros Name. Er starrte eine Weile darauf hinab. Dann seufzte er und rief einen anderen Namen aus seinen Kontakten auf.
Am anderen Ende hörte er Meis sanfte Stimme. Mei Liu war seit mehr als zehn Jahren Álvaros Sekretärin.
»Ach, hallo, Manuel! Wie geht’s? Wie läuft’s mit dem neuen Roman? Ich bin schon so gespannt! Álvaro hat mir erzählt, dass er super …«
»Mei«, fiel er ihr ins Wort. »Wo ist Álvaro?«
Am anderen Ende wurde es still, und Manuel war sofort klar, dass sie ihn anlügen würde. Es war einer dieser hellsichtigen Momente, in denen man das Räderwerk erkennt, das die Welt antreibt und das unseren Augen gnädigerweise fast ein Leben lang verborgen bleibt.
»Álvaro? In Barcelona …«
»Lüg mich nicht an, Mei.«
Es klang schroff, auch wenn seine Stimme kaum mehr als ein Flüstern war.
Ihr Schweigen gab ihm Gewissheit: Sie rang verzweifelt nach einer Ausrede.
»Ich lüge dich nicht an, Manuel. Warum sollte ich?«
Sie klang ein bisschen schrill, als könnte sie jeden Moment in Tränen ausbrechen. Ausreden, Gegenfragen … Alles Ablenkungsmanöver, um die ehrliche Antwort nicht geben zu müssen.
»Er ist in Barcelona, beim Meeting mit der Geschäftsleitung dieser Hotelkette …«
Manuel schloss die Augen und konnte nur mit Mühe den Impuls unterdrücken, das Handy gegen die Wand zu schleudern, auf dass es in tausend Stücke zersplitterte und die Lügen aufhörten. Als er wieder das Wort ergriff, riss er sich zusammen, um nicht laut loszuschreien.
»Gerade war die Polizei bei mir. Álvaro war nicht in Barcelona. Er ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen und liegt jetzt im Leichenschauhaus in Lugo … Also sag mir verdammt noch mal endlich, wo Álvaro gewesen ist. Du weißt es doch genau!« Er dehnte die Silben, hauchte sie fast, um seine Wut zu beherrschen.
Er bekam ein kaum verständliches Schluchzen zur Antwort. »Es tut mir leid, Manuel, es tut mir so leid …«
Er legte auf. Mei hätte sein letzter Rettungsanker sein können.
Isländische Sonne
Das Wartezimmer roch nach Trauer. Über den engen Sitzreihen hing eine Wolke aus Atemdunst und Körpergerüchen, in der die schmerzverzerrten Gesichter der Wartenden vor seinen Augen verschwammen. Manuel trat erneut hinaus auf den Flur, wo ihm der Mann hinter dem Empfangsschalter durch ein Nicken zu verstehen gab, er möge drinnen warten. Trotzdem blieb er stehen. Nah genug am Ausgang, um zumindest ein bisschen frische Luft zu atmen, lehnte er sich an die Wand.
Bei seiner Ankunft hatte der Himmel über Lugo hinter einer Wolkendecke gelegen, die an trübes Wasser erinnert hatte. Es war ein unterkühlter Empfang gewesen, nicht zuletzt aufgrund der knapp zwanzig Grad, die ihm, verglichen mit der drückenden Hitze und dem gleißenden Licht der ersten Madrider Septembertage, fast inszeniert vorgekommen waren – wie ein literarischer Kunstgriff, um eine beklemmende, deprimierende Stimmung zu erzeugen.
In Lugo gab es keinen Flughafen. Manuel hatte kurz in Erwägung gezogen, nach Santiago de Compostela zu fliegen und sich dort einen Mietwagen zu nehmen, aber irgendetwas in ihm, das er noch immer nicht benennen konnte, hatte ihn davon abgehalten. Er hätte die zwei Stunden bis zum nächsten Flug nicht ertragen.
Den Kleiderschrank zu öffnen, zwischen seinen und Álvaros Anzügen die kleine Reisetasche hervorzuholen und alles Nötige zu verstauen, war am schwierigsten gewesen. Später sollte er feststellen, dass er bei seinem fluchtartigen Aufbruch völlig nutzlose Kleidungsstücke eingepackt und alles Wichtige vergessen hatte. Das Gefühl, geflüchtet zu sein, verstärkte sich, sobald er an seine letzten Minuten in der Wohnung zurückdachte. Wie er überstürzt Flüge gecheckt und die Tasche gepackt hatte; dann der krampfhafte Versuch, an dem Foto von ihnen beiden vorbeizusehen, das auf der Kommode stand und ihm jetzt nicht mehr aus dem Kopf gehen wollte. Ein gemeinsamer Freund hatte es im vergangenen Sommer bei einem Ausflug aufgenommen: Manuel, der gedankenverloren auf das silbern glitzernde Meer blickte, und Álvaro – jünger, schlank, das braune Haar von der Sonne gebleicht –, der ihn versonnen anlächelte. Álvaro hatte das Foto rahmen lassen, dabei konnte Manuel es nicht ausstehen. Wann immer sein Blick darauf fiel, hatte er wie so oft das Gefühl, einen kostbaren Moment verpasst zu haben, der jetzt erst recht unwiederbringlich vorüber war. Jener kurze Augenblick, den die Kamera eingefangen hatte, war zur Bestätigung geworden, dass er in seinem eigenen Leben nie ganz bei der Sache war. Inzwischen kam es einem Urteil gleich.
Dass er jetzt warten musste, kam ihm vor wie eine Vollbremsung. Als hätte eine Minute mehr oder weniger Álvaros Tod abwenden können, war er über die Autobahn hierhergerast. Zuvor war er wie in Trance durch die Wohnung gelaufen und hatte noch einen kurzen Blick in jedes Zimmer geworfen, als wollte er sich vergewissern, dass Álvaros Besitztümer da waren: seine Fotobände, die Skizzenhefte auf dem Tisch, der alte Pullover, der über der Stuhllehne hing. Den Pullover hatte er immer zu Hause angehabt und sich geweigert, ihn wegzuwerfen, obwohl er längst verwaschen und an den Ärmeln verschlissen war. Manuel hatte all diese Dinge fast erstaunt betrachtet, als müssten sie jetzt, da Álvaro tot war, aufhören zu existieren. Er hatte noch einen flüchtigen Blick auf seinen Schreibtisch geworfen und Brieftasche, Handy und Ladekabel zusammengeklaubt. Am erstaunlichsten war vielleicht, dass er seine Arbeit, von der er am Morgen noch geglaubt hatte, sie ginge ihm gut von der Hand, nicht einmal abspeicherte. Dann der furchtbare Moment, als er den Namen der unseligen Stadt ins Navi eingab. Fast fünfhundert Kilometer, knapp viereinhalb Stunden, die Stille nur unterbrochen von Meis wiederholten Anrufen, die Manuel nicht entgegennahm. Er war sich nicht einmal mehr sicher, ob er überall das Licht ausgemacht hatte.
Er warf einen Blick ins Wartezimmer. Ein Mann schmiegte sein Gesicht an den Hals einer Frau. Manuel betrachtete die müde Geste, mit der sie ihm übers Haar strich, dann die anderen Wartenden, die mit zusammengepressten Lippen dasaßen und stoßweise atmeten wie Kinder, die sich das Weinen verkniffen.
Er selbst hatte nicht geweint. Er hatte keine Ahnung, ob das normal war oder nicht. Als die Polizisten gegangen waren, war er kurz davor gewesen; vor seinen Augen waren sämtliche Konturen verschwommen. Aber es war Wärme notwendig, um weinen zu können, oder zumindest irgendeine Art von Empfindung. Doch in der arktischen Kälte, die in ihrer Wohnung geherrscht hatte, war sein Herz zu Eis gefroren. Er hätte sich gewünscht, es wäre vollends erstarrt, und die unwirkliche Kälte hätte die Fasern dieses nutzlosen Muskels samt und sonders zerstört.
Zwei Männer in gut geschnittenen Anzügen steuerten den Empfangsschalter an. Einer blieb ein paar Schritte zurück, während der andere dem Beamten so leise etwas zuflüsterte, dass der sich vorbeugen musste, um ihn zu verstehen. Dann nickte der Beamte, deutete auf Manuel und sah den Besuchern neugierig nach.
»Manuel Ortigosa?«
Manuel nickte. Die beiden waren definitiv zu gut gekleidet, um Polizisten oder Pathologen zu sein.
Einer der Männer gab ihm die Hand.
»Adolfo Griñán«, stellte er sich vor, »und das hier ist mein Mitarbeiter Eugenio Doval. Können wir Sie kurz sprechen?«
Die Namen sagten ihm nichts, trotzdem sah er sich in seiner Vermutung bestätigt, dass die beiden keine Mediziner waren. Manuel machte eine vage Geste in Richtung Wartezimmer.
Die neugierigen Blicke der übrigen Wartenden schienen Griñán ebenso wenig zu stören wie die Dunstwolke. Dann blieb sein Blick an einem rundherum nachgedunkelten gelblichen Fleck an der Zimmerdecke hängen.
»Du liebe Güte, nein, nicht hier. Entschuldigen Sie vielmals, dass wir nicht früher da waren. Sind Sie in Begleitung hier?«, fragte er dann, obwohl er mit einem Blick auf die traurige Gesellschaft vom Gegenteil auszugehen schien.
Manuel schüttelte den Kopf, und Griñán sah erneut hoch zur Decke.
»Gehen wir.«
»Aber ich soll hier warten«, wandte Manuel ein.
»Wir bleiben in der Nähe«, beruhigte ihn Doval. »Es gibt da ein paar Dinge, die Sie wissen sollten.«
Und Manuel wollte ein paar Dinge wissen. Schweigend liefen sie am Empfang vorbei; der Beamte sah ihnen nach, bis sie das Ende des Flurs erreichten, wo in einer kleinen Nische ein Getränkeautomat stand.
»Möchten Sie etwas trinken?«, erkundigte sich Doval.
Manuel schüttelte den Kopf und warf einen beunruhigten Blick zurück zum Warteraum.
»Ich bin Anwalt«, ergriff Griñán wieder das Wort, »Eugenio Doval ist mein Sekretär. Ich habe mich um die rechtlichen Belange Ihres Mannes gekümmert und bin auch sein Testamentsvollstrecker.« Er sah Manuel an, als hätte er soeben seine militärischen Auszeichnungen aufgezählt.
Manuel stand die Verwirrung ins Gesicht geschrieben. Er wandte sich zu Doval um, weil er bei ihm eine Antwort zu finden hoffte – oder zumindest den Hauch eines Lächelns, das ihm verriet, dass er gerade einem Scherz aufsaß.
»Ich weiß, das kommt alles überraschend«, räumte Griñán ein, »aber als Don Álvaros Vermögensverwalter bin ich über die Umstände Ihrer Beziehung auf dem Laufenden.«
»Was soll das heißen?«, fragte Manuel misstrauisch.
Griñán ließ sich nicht aus der Ruhe bringen.
»Mir ist bekannt, dass Sie seit einigen Jahren verheiratet sind und schon lange zusammenleben, aber ich bin mir sicher, dass alles, was ich Ihnen gleich erzähle, neu für Sie sein wird …«
Manuel verschränkte die Arme. Das letzte bisschen Geduld, das ihm seit der Nachricht von Álvaros Tod geblieben war, hatte er eingebüßt, als er mit Mei telefoniert hatte. Trotzdem war er bereit, vorläufig Frieden mit jedem zu schließen, der ihm erklären konnte, weshalb sein Ehemann auf einem Stahltisch im Leichenschauhaus irgendwo am Ende der Welt lag.
»Können Sie mir sagen, was Álvaro hier zu suchen hatte? Was wollte er mitten in der Nacht auf dieser Landstraße?«
Griñán warf Doval einen schnellen Blick zu, worauf der eher zögerlich einen Schritt nach vorne trat und das Wort ergriff.
»Álvaro ist hier in Galicien zur Welt gekommen. Ich weiß nicht, wo er hinwollte, als er den Unfall hatte, aber wie die Polizei Ihnen vermutlich schon mitgeteilt hat, scheint kein anderes Fahrzeug beteiligt gewesen zu sein. Es sieht alles danach aus, als sei er am Steuer eingenickt. Es ist ein Jammer – mit vierundvierzig! Er hatte das Leben noch vor sich. Er war ein feiner Kerl, ich habe ihn sehr geschätzt.«
Manuel erinnerte sich vage daran, in Álvaros Personalausweis mal dessen Geburtsort gelesen zu haben – ein Ort, zu dem er keine Verbindung mehr gehabt zu haben schien. Er konnte sich auch nicht entsinnen, dass Álvaro ihn je erwähnt hätte. Warum auch? Als sie sich begegnet waren, hatte er erzählt, dass er mit seiner sexuellen Veranlagung bei seiner Familie nicht eben auf Akzeptanz gestoßen war. Mit seinem Umzug nach Madrid hatte er mit seiner Vergangenheit abgeschlossen.
»Aber er hätte in Barcelona sein sollen. Was hat er hier gemacht? Soweit ich weiß, hatte er seit Jahren keinen Kontakt mehr zu seiner Familie.«
»Tja, soweit Sie wissen …«, murmelte Griñán.
»Was soll das heißen?«, fragte er scharf.
»Schauen Sie, Manuel – darf ich Sie Manuel nennen? Ich rate meinen Mandanten immer, ehrlich zu sein, insbesondere zu ihren Partnern. Schließlich teilen sie ihr Leben mit ihnen, und sie sind es auch, die mit ihrem Tod zurechtkommen müssen. Álvaro war da keine Ausnahme, aber es steht mir nicht zu, über die Gründe zu urteilen, warum er es Ihnen verschwiegen hat. Ich bin lediglich der Überbringer der Botschaft. Was ich Ihnen mitteilen muss, wird mir keine Sympathien einbringen, aber es ist nun mal mein Job, ich bin Álvaros Anwalt, und ich werde meiner Aufgabe bis zum Ende gerecht.« Er legte eine kleine Kunstpause ein, ehe er weitersprach: »Álvaro Muñiz de Dávila hat seit dem Tod seines Vaters vor drei Jahren den Titel des Grafen von Santo Tomé getragen, einer der ältesten galicischen Grafschaften. Der Familiensitz liegt nur ein paar Kilometer von der Unfallstelle entfernt. Diesmal wusste ich nicht, dass er hier war, aber er kam regelmäßig, um dort gewisse Dinge zu regeln.«
Manuel hatte den Ausführungen des Anwalts zusehends erstaunt zugehört. Jetzt sagte er mit einem ungläubigen Lächeln: »Sie wollen mich auf den Arm nehmen.«
»Ich kann Ihnen versichern, dass jedes Wort wahr ist, und ich kann Ihnen Beweise vorlegen, die jeden Zweifel ausräumen.«
Manuel sah nervös zum Empfang, dann wieder zu Griñán.
»Sie wollen also behaupten, mein Mann war ein Adliger? Ein Graf, sagten Sie? Mit Ländereien, Herrensitz und einer Familie, von der ich nichts weiß? Fehlt nur noch, dass Sie mir gleich erzählen, er hatte Frau und Kinder.«
Der Mann hob abwehrend die Hände.
»Um Himmels willen, nein. Wie gesagt, Álvaro hat den Titel seines Vaters geerbt, als der vor drei Jahren starb. Ich habe ihn kennengelernt, als er die Familiengeschäfte übernommen hat. Ein Adelstitel ist eine Verpflichtung, müssen Sie wissen, und der kam Álvaro nach.«
Manuel merkte erst, dass er die Stirn krauszog, als er sich die Fingerspitzen an die Schläfen legte, um den aufkommenden Kopfschmerz zu bekämpfen, der als Pochen hinter seinen Augen angefangen hatte und sich jetzt in seinem Schädel ausbreitete wie glühende Lava.
»Die Polizei hat erzählt, dass ein Angehöriger ihn identifiziert hat …«
»Ja, sein Bruder Santiago, der Mittlere der drei. Álvaro war der Älteste. Francisco, der Jüngste, ist kurz nach seinem Vater gestorben. Er hatte Depressionen und allem Anschein nach Drogenprobleme. Eine Überdosis. Das Schicksal hat der Familie in den letzten Jahren schlimm mitgespielt. Die Mutter lebt noch, ist aber gesundheitlich angeschlagen.«
Der Kopfschmerz wurde heftiger.
»Das ist unglaublich … Warum hat er das alles vor mir geheim gehalten?«, murmelte Manuel an niemand Bestimmten gerichtet.
Doval und Griñán sahen einander betreten an.
»Was das betrifft, kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Ich weiß auch nicht, warum Álvaro sich entschieden hat, sich so zu verhalten. Aber er hat klare Anweisungen hinterlassen, was im Fall seines Todes zu tun ist, der ja nun leider eingetreten ist.«
»Was soll das heißen – wollen Sie damit andeuten, dass Álvaro mit seinem Tod gerechnet hat? Versetzen Sie sich mal in meine Lage! Ich habe soeben erfahren, dass mein gerade verstorbener Ehemann mir nichts von seiner Familie erzählt hat. Ich verstehe gar nichts mehr …«
Griñán nickte mitfühlend. »Das alles muss ein furchtbarer Schock für Sie sein. Es gibt natürlich ein Testament – das ist ganz normal für jemanden in seiner Position. Wir haben damals, als er seine Aufgaben übernommen hat, eine erste Version aufgesetzt, aber mit den Jahren ist sie mehrmals überarbeitet worden. Álvaro hat darin auch festgelegt, was im Fall seines Todes zu tun ist. Natürlich wird es zu einem späteren Zeitpunkt eine offizielle Testamentseröffnung geben, aber er hat verfügt, dass binnen vierundzwanzig Stunden nach seinem Tod ein vorläufiges Schreiben verlesen werden soll, das den Angehörigen und Erben sicher vieles erleichtert, wenn Sie mir die Bemerkung erlauben. Denn so kennen Sie die Eckdaten noch vor der Testamentseröffnung, die einer entsprechenden Klausel zufolge innerhalb von drei Monaten stattfinden soll.«
In einer Mischung aus Ratlosigkeit und Ohnmacht blickte Manuel zu Boden.
»Wir haben uns erlaubt, Ihnen ein Hotelzimmer in der Stadt zu reservieren. Ich kann mir vorstellen, dass Sie keine Zeit hatten, sich darum zu kümmern. Ich habe die ganze Familie für morgen Vormittag zur Verlesung des Dokuments in meine Kanzlei gebeten. Wir schicken Ihnen einen Wagen, der Sie vom Hotel abholt. Die Beerdigung findet übermorgen auf dem Privatfriedhof des Familienanwesens As Grileiras statt.«
Manuel hatte das Gefühl, sein Kopf könnte jeden Moment platzen.
»Die Beerdigung? Wer hat das entschieden? Mich hat keiner gefragt. Ich habe da doch wohl auch ein Wörtchen mitzureden, oder nicht?«
Er war laut geworden, aber es war ihm inzwischen egal, ob der Schalterbeamte ihn hören konnte oder nicht.
»So will es die Familientradition«, erklärte Doval.
»Die Tradition interessiert mich einen feuchten Kehricht. Für wen halten die mich eigentlich? Ich bin sein Ehemann!«
»Señor Ortigosa«, schaltete Griñán sich wieder ein und fuhr dann versöhnlicher fort: »Manuel. Er selbst hat das verfügt. Es war Álvaros ausdrücklicher Wunsch, auf dem Familienanwesen bestattet zu werden.«
Die Schwingtür hinter Griñán und seinem Sekretär wurde so jäh aufgestoßen, dass die beiden herumwirbelten. Zwei Polizeibeamte kamen auf sie zu: einer noch sehr jung, der andere Ende fünfzig. Der Ältere wäre als Karikatur eines Polizisten durchgegangen: Er war vielleicht einen Meter sechzig groß, und Manuel bezweifelte, dass er mit dem dicken Bauch, den er vergeblich unter der schneidigen, tadellos gebügelten Uniform zu verbergen suchte, auf der Polizeischule heute noch Chancen gehabt hätte. Um das Bild zu vervollständigen, trug er einen Schnauzbart, der, genau wie die Haare an den Schläfen und die altmodischen Koteletten, allmählich ergraute.
Er warf einen abschätzigen Blick auf Dovals und Griñáns teure Anzüge und fragte dann, wobei es eher wie eine Feststellung klang: »Polizeikommissar Nogueira, Guardia Civil – Sie sind die Angehörigen von Álvaro Muñiz de Dávila?«
»Die Anwälte.« Griñán hielt ihm die Hand hin, die der Polizist geflissentlich übersah, woraufhin Griñán auf Manuel deutete. »Und Manuel Ortigosa, sein Ehemann.«
Dem Polizisten war die Überraschung deutlich anzusehen. »Der Ehemann von …« Er wies vage mit dem Daumen über die Schulter und sah angewidert zu seinem Kollegen, der ihm die erwartete Rückendeckung verwehrte und stattdessen in seinem Notizbuch blätterte.
»Haben Sie ein Problem damit?«, blaffte Manuel ihn an.
Statt zu antworten, suchte der Polizist erneut das Einvernehmen seines Kollegen, doch der zuckte bloß mit den Schultern.
»Regen Sie sich wieder ab. Der Einzige, der hier ein Problem hat, ist dieser arme Kerl auf dem Seziertisch«, sagte Nogueira schließlich und zog damit Griñáns und Dovals Missfallen und einen vernichtenden Blick von Manuel auf sich. »Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen.«
Manuel nickte.
»Wann haben Sie Álvaro Muñiz de Dávila zuletzt gesehen?«
»Vorgestern am späten Nachmittag, bevor er losfuhr. Wir leben in Madrid …«
»Aha, in Madrid«, wiederholte Nogueira und vergewisserte sich, dass sein Kollege mitschrieb. »Und wann hatten Sie zuletzt Kontakt mit ihm?«
»Gestern Nacht gegen eins. Er hat mich angerufen, und wir haben eine Weile gesprochen.«
»Aha, gestern Nacht … Hat er Ihnen gesagt, wo er da war oder wo er hinwollte?«
Manuel zögerte kurz.
»Nein. Ich wusste nicht mal, dass er hier in Galicien war. Ich dachte, er wäre in Barcelona bei einem Meeting mit einem Kunden. Er ist … Er war in der Werbebranche und hatte eine Kampagne für eine Hotelkette entwickelt …«
»Aha, Meeting mit einem Kunden.«
Die Art und Weise, wie der Mann Manuels Worte wiederholte, erschien ihm taktlos, auch wenn ihm im Grunde klar war, dass ihn weniger der herablassende Tonfall als vielmehr der Umstand traf, dass er belogen worden war.
»Worüber haben Sie sich unterhalten? Wissen Sie noch, was er gesagt hat?«
»Nichts Konkretes … Er hat erwähnt, dass er sehr müde war und am liebsten wieder nach Hause käme …«
»War er auffallend nervös, verärgert oder aufgebracht?«
»Nein. Nur müde.«
»Hat er Ihnen von irgendeinem Streit erzählt?«
»Nein.«
»Hatte Ihr … Ihr Mann Feinde? Jemand, der es auf ihn abgesehen haben könnte?«
Manuel sah kurz den Anwalt an, bevor er antwortete: »Nein. Nicht dass ich wüsste. Was soll die Frage überhaupt?«
»Nicht dass er wüsste«, echote Nogueira.
»Warum sagen Sie mir nicht endlich, worauf Sie hinauswollen? Was soll die Frage nach Feinden? Sie glauben doch wohl nicht …«
»Gibt es jemanden, der bezeugen kann, dass Sie gestern Nacht gegen ein Uhr in Madrid waren?«
»Ich habe mit Álvaro zusammengelebt. Und der war angeblich in Barcelona. Ich war gestern den ganzen Tag über alleine zu Hause, also kann natürlich niemand bezeugen, dass ich in Madrid war. Aber heute früh war ich daheim, das können Ihre Kollegen bestätigen, die mir die Nachricht überbracht haben. Was soll die Fragerei?«
»Mittlerweile kann ein Handy mit einer Genauigkeit von rund hundert Metern geortet werden, wussten Sie das?«
»Das ist ja fantastisch – aber ich verstehe immer noch nicht, worauf Sie hinauswollen. Erzählen Sie mir, was hier los ist! Ihre Kollegen sagen, Álvaro ist am Steuer eingeschlafen, er ist auf gerader Strecke von der Straße abgekommen, und es waren keine anderen Fahrzeuge beteiligt.«
Manuel klang jetzt beinahe verzweifelt. Dass der Kommissar ihm nicht antwortete und stattdessen immer neue Fragen stellte, machte ihn wahnsinnig.
»Womit verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt?«
»Ich bin Schriftsteller«, antwortete er müde.
Der Mann neigte den Kopf leicht zur Seite und grinste schief. »Sehr schön. Und wovon leben Sie?«
»Habe ich doch gesagt. Ich bin Schriftsteller.«
Allmählich verlor Manuel die Geduld. Dieser Typ war doch ein Idiot.
»Aha, Schriftsteller«, wiederholte Nogueira. »Was für ein Auto fahren Sie? Farbe? Modell?«
»Einen blauen BMW. Können Sie mir jetzt bitte verraten, ob am Tod meines Mannes irgendetwas verdächtig ist?«
Der Polizist wartete, bis sein Kollege fertig geschrieben hatte, bevor er antwortete: »Wenn jemand bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommt, verlangt die Staatsanwaltschaft die äußere Leichenschau vor Ort. Eine Autopsie wird nur dann durchgeführt, wenn ein hinreichender Anfangsverdacht auf eine andere Todesursache besteht. Der Wagen Ihres … Ihres Mannes« – er seufzte – »weist am Heck eine Beschädigung und Lackpartikel eines anderen Fahrzeugs auf.«
Wieder ging die Schwingtür auf, ein weiterer Polizist kam auf sie zu und blaffte Nogueira an: »Was machen Sie hier?«
Die beiden Polizisten nahmen Haltung an.
»Chef … Manuel Ortigosa ist ein Angehöriger des Verstorbenen, er ist gerade aus Madrid eingetroffen. Wir nehmen seine Aussage auf.«
Der Neue kam auf Manuel zu und schüttelte ihm fest die Hand.
»Señor Ortigosa, es tut mir sehr leid, was passiert ist, und bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten, die Kommissar Nogueira Ihnen mit seinem voreiligen Handeln bereitet hat.« Er bedachte seinen Mitarbeiter mit einem vernichtenden Blick. »Wie Ihnen die Kollegen sicher schon mitgeteilt haben, besteht kein Zweifel daran, dass der Tod Ihres Mannes ein tragischer Unfall war.«
Obwohl Nogueira hinter seinem breit gebauten Vorgesetzten teilweise verschwand, konnte Manuel sehen, wie er unter dem Schnauzbart missmutig den Mund verzog.
»Aber Ihr Kommissar hier hat mir doch gerade mitgeteilt, dass Álvaro gar nicht hierhergebracht worden wäre, wenn kein Verdacht bestanden hätte.«
»Da hat er die falschen Schlüsse gezogen«, sagte der Mann, diesmal ohne Nogueira eines Blickes zu würdigen. »Der Verstorbene ist mit Rücksicht auf seine gesellschaftliche Position hierher überführt worden. Seine Familie ist in der Gegend bekannt und hoch angesehen.«
»Wird er jetzt obduziert?«
»Das wird nicht nötig sein.«
»Darf ich ihn sehen?«
»Natürlich. Ich begleite Sie.«
Der Mann legte Manuel eine Hand auf die Schulter und schob ihn sanft in Richtung Schwingtür.
Das Hotelzimmer war blendend weiß gestrichen. Ein halbes Dutzend Kissen lag auf dem Bett. Sämtliche zur Verfügung stehenden Deckenstrahler, Tischlämpchen und Wandleuchten waren eingeschaltet, sodass das Bett wie eine Fata Morgana wirkte. Es war die schmerzliche Fortsetzung der isländischen Sonne, die am Morgen seine Wohnung geflutet und ihn mit gleißendem Licht knapp fünfhundert Kilometer bis Lugo begleitet hatte. Dort hatte der bewölkte Himmel seinen Augen eine Pause beschert, und das Gefühl, wie bei einem Migräneanfall die Welt nur unscharf und verschwommen durch ein Prisma zu sehen, hatte nachgelassen.
Manuel löschte fast alle Lichter, streifte die Schuhe ab, nahm kurz die Minibar in Augenschein und bestellte sich dann beim Zimmerservice eine Flasche Whisky. Ihm entging weder die tadelnde Miene des Kellners, als er dessen Angebot ausschlug, ihm auch etwas zu essen zu bringen, noch der Blick, mit dem der Mann über Manuels Schulter hinweg das Zimmer inspizierte.
Griñáns Redeschwall – wie er sich vergeblich bemüht hatte, die Leer- und Fehlstellen zu füllen, all das, was Álvaro ihm vorenthalten hatte – war während der Fahrt zum Hotel weitergegangen, weil der Anwalt darauf bestanden hatte, ihn zu begleiten. Er hatte ihn bis zur Rezeption gebracht, wo Doval bereits sämtliche Formalitäten erledigt und auf sie gewartet hatte. Eine Weile hatten sie noch vor den Aufzügen herumgestanden, bis Griñán zu guter Letzt bewusst zu werden schien, wie erschöpft Manuel sein musste und dass er sicherlich lieber alleine wäre.
Manuel goss sich einen doppelten Whisky ein und legte sich aufs Bett. Er schob die Kissen am Kopfende zusammen, lehnte sich mit dem Rücken dagegen und leerte das Glas in zwei Zügen, als wäre es Medizin. Dann stand er auf, ging zum Schreibtisch zurück und schenkte sich ein weiteres Glas ein. Auf dem Rückweg zum Bett machte er kehrt und nahm die Flasche mit. Er stöhnte. Selbst wenn er die Augen fest zukniff, sah er diese verfluchte nächtliche Sonne wie eine Brandwunde auf der Netzhaut, gleißend und unscharf wie Ektoplasma.
In seinem Kopf lagen die Notwendigkeit zu denken und der feste Entschluss, es nicht zu tun, im Widerstreit. Wieder füllte er das Glas und kippte den Whisky so schnell hinunter, dass ihm schlecht wurde. Doch sobald er jetzt die Augen schloss, stellte er erleichtert fest, dass das Sonnengleißen nachließ. Stattdessen gingen ihm die Gespräche, die er im Lauf des Tages geführt hatte, durch den Kopf und vermischten sich mit Erinnerungen; so viele kleine, augenscheinlich unbedeutende Details ergaben mit einem Mal Sinn. Der Tod von Álvaros Vater vor drei Jahren, der Tod des jüngsten Bruders wenige Tage später …
Es war im September vor drei Jahren gewesen, als Manuel geglaubt hatte, es wäre alles aus und vorbei. Er war sich sicher gewesen, Álvaro für immer verloren zu haben. Er sah alles noch ganz genau vor sich: Álvaros angespanntes Gesicht, die gespielte Gelassenheit, mit der er ihm mitgeteilt hatte, dass er für zwei Tage verreisen müsse. Die unerschütterliche Ruhe und Sorgfalt, mit der er seine Klamotten zusammengelegt und im Koffer verstaut hatte. »Wo fährst du hin?« Das Schweigen als Antwort, die traurige Miene und der abwesende Blick. Kein Bitten, Betteln und Drohen hatte etwas verändert. Doch in der Tür hatte Álvaro sich noch einmal umgedreht.
»Manuel, ich habe dich nie um etwas gebeten, aber diesmal musst du mir vertrauen. Machst du das?«
Manuel hatte genickt, obwohl er gewusst hatte, dass er gerade zu viel versprach. Aber was hätte er sonst tun sollen? Der Mann, den er liebte, war drauf und dran fortzugehen, und ihre Liebe zerrann zwischen seinen Fingern wie nasses Salz. In jenem Moment war nur eins gewiss gewesen: dass nichts Álvaro aufgehalten hätte. Er wäre so oder so gegangen, und ihn ziehen zu lassen war das Einzige, was sie noch zusammenzuhalten schien.
Álvaro hatte die Wohnung mit einem kleinen Koffer verlassen und Manuel in einen Sturm der Gefühle gestürzt. Die Sorge und Angst vermischten sich nach und nach mit der Gewissheit, dass Álvaro nie mehr wiederkommen würde. Fieberhaft ließ Manuel die vorangegangenen Tage Revue passieren und grübelte über den Moment, in dem alles aus dem Gleichgewicht geraten war. Urplötzlich waren die acht Jahre Altersunterschied zum Problem geworden, und er machte sich Vorwürfe wegen seiner exzessiven Liebe zu den Büchern und seines Wunsches nach einem beschaulicheren Leben. Vielleicht war das zu wenig gewesen für einen so viel Jüngeren, Schöneren … Manuel verfluchte sich selbst, weil er offenbar nicht erkannt hatte, dass die Welt um ihn herum aus den Fugen geraten war.
Nach der anfänglichen Ungewissheit kamen Enttäuschung und Schmerz, die einander in rascher Folge ablösten und ihn in den gleichen emotionalen Abgrund stürzten, gegen den er sich seit dem Tod seiner Schwester für immer gefeit geglaubt hatte. Am vierten Abend wartete er entmutigt auf Álvaros Anruf; wie gebannt und gefangen in seiner Verzweiflung starrte er das Telefon an.
Ihm war bewusst, dass er flehend klang, als der Anruf endlich kam. »Zwei Tage, hast du gesagt … Heute ist schon der vierte.«
Álvaro seufzte. »Es ist etwas Unvorhergesehenes passiert. Es ist komplizierter, als ich dachte.«
Manuel nahm allen Mut zusammen.
»Álvaro, kommst du zurück?«, fragte er leise. »Sag mir die Wahrheit.«
»Natürlich.«
»Sicher?« Dann verdoppelte er den Einsatz, wohl wissend, dass er alles verlieren konnte, und spielte die letzte Karte aus: »Wenn es nur ist, weil wir verheiratet sind …«
Am anderen Ende der Leitung holte Álvaro tief Luft und atmete dann langsam wieder aus. Er klang unendlich müde – oder war es Ärger? Unmut darüber, dass er in Zugzwang war und sich mit etwas Lästigem, Unangenehmem auseinandersetzen musste?
»Ich komme zurück, weil ich es will und weil bei dir mein Zuhause ist. Ich liebe dich, Manuel, und ich will mit dir zusammen sein. Ich will nichts lieber, als wieder nach Hause zu kommen – das hier hat nichts mit uns zu tun.«
In seiner Stimme lag eine derartige Verzweiflung, dass Manuel ihm glaubte.
Dürrezeit
Álvaro kam wieder, aber noch Wochen später hatte er das Gefühl, nicht ganz anwesend zu sein. Es war, als wäre sein wahres Ich viele Kilometer entfernt zurückgeblieben und nur seine leere Hülle nach Hause zurückgekehrt.
Dennoch umarmte Manuel diesen Körper, den er so gut kannte, küsste die versiegelten Lippen und schlug in stiller Dankbarkeit die Augen nieder.
Es folgte weder eine Erklärung noch eine Entschuldigung. Kein Wort darüber, was in den vergangenen Tagen passiert war. In der ersten Nacht sagte Álvaro, nachdem sie sich geliebt hatten und nun still nebeneinanderlagen: »Danke, dass du mir vertraut hast.«
Mit diesen Worten war jede Möglichkeit zu Grabe getragen, eine Erklärung zu erhalten, warum Álvaro ihn in die Hölle gestürzt hatte.
Manuel nahm es hin wie eine Liebkosung über wundem Fleisch. Er war so dankbar und erleichtert, dass er die Demütigung schluckte. Doch in den darauffolgenden Wochen kehrte die Panik wieder, wann immer er von Álvaro getrennt war.
Manchmal beobachtete er ihn verstohlen, während sie sich einen Film ansahen oder wenn Álvaro schlief, und er versuchte, irgendeinen verräterischen Hinweis zu entdecken, fahndete nach Zeichen, die ihm das Herz brechen könnten. Und es gab einige davon. Álvaro machte einen traurigen, niedergeschlagenen Eindruck. Er kam früher als sonst nach Hause und überließ es immer öfter Mei, Projekte außerhalb der Stadt zu präsentieren. Wenn Manuel vorschlug, ins Kino oder essen zu gehen, schützte Álvaro vor, müde zu sein, und Manuel akzeptierte es, weil sein Mann wirklich müde aussah, vom Leben erschöpft, als trüge er eine schwere Last auf den Schultern. Oder furchtbare Schuld.
Dann begannen die Anrufe. Sie waren zuvor immer ganz unbefangen an ihre Handys gegangen – nur während des gemeinsamen Abendessens nicht, das war »ihr Moment«, wie sie es nannten. Jetzt auf einmal verließ Álvaro das Zimmer, um zu telefonieren. Manuel konnte ihm zwar ansehen, wie unangenehm ihm die Anrufe waren, und das war beinahe beruhigend, aber der Dämon des Zweifels kehrte Mal für Mal zurück.
Er wurde zu einem Besessenen, der noch in den geringsten Details einen untrüglichen Hinweis auf Treulosigkeit zu entdecken glaubte und jede von Álvaros Gesten unter die Lupe nahm. Dessen Liebe war weder abgekühlt, noch war sie inniger geworden – was in Manuels Augen noch viel verdächtiger gewesen wäre. Wer etwas bereut, bemüht sich schließlich um Wiedergutmachung, um seine Schuldgefühle zu überspielen. Doch Manuel fand keinen Anhaltspunkt. Die wenigen Male, die Álvaro verreiste, blieb er nie länger als einen Tag weg, und wenn es doch mal zwei wurden, dann nur, weil Manuel darauf bestand: »Ist doch unnötig, dass du die lange Fahrt am Stück runterreißt. Übernachte doch dort und fahr erst am Morgen.«
Dem Anschein nach war also alles in bester Ordnung. Álvaros Lächeln war ein bisschen bemüht und traurig, aber so voller Zärtlichkeit, dass Manuel zu hoffen wagte, Álvaro werde bei ihm bleiben. Nach und nach erkannte er in diesem Lächeln den Mann wieder, den er liebte, und das genügte, um ihn wieder aufzurichten. Es gab nur einen einzigen Hinweis, ein einziges Indiz, von dem er nicht wusste, wie er es deuten sollte. Wenn Álvaro wieder einmal von einer Reise zurückgekehrt war, ertappte Manuel ihn von Zeit zu Zeit dabei, wie er ihn anstarrte, während Manuel in einem Buch blätterte oder am Schreibtisch saß und so tat, als würde er arbeiten. Álvaro lächelte dann sein selbstgewisses, kluges Lächeln, und wenn Manuel fragte, warum er ihn denn so ansehe, schüttelte er bloß den Kopf, als scheute er die Antwort, nur um ihn im nächsten Moment so fest zu umarmen wie ein Schiffbrüchiger, der die rettende Planke umklammert. Dann war da kein Platz mehr zwischen ihnen, keine noch so kleine Lücke, durch die der Zweifel hätte hindurchkriechen können.
Irgendwann beschloss Manuel, nicht länger leiden zu wollen. Die Anrufe seines Verlags häuften sich, und er würde sich nicht mehr mit einer Erkältung oder Arztbesuchen herausreden können, außerdem war er zu ehrlich, um so etwas über einen längeren Zeitraum durchzuhalten. Der Roman, um den es derzeit ging, sollte sein größter Erfolg werden, sein bislang bestes Buch.
Lesen war ihm ein Leben lang Zuflucht gewesen: damals, als er und seine Schwester zu Waisen wurden; in den Jahren, in denen sie bei ihrer alten Tante lebten, bis seine Schwester endlich volljährig war und mit ihm in das Haus zog, das ihren Eltern gehört und bis dahin leer gestanden hatte. Lesen war die Festung, in die er sich zurückzog, während er den aussichtslosen Kampf gegen seine aufkeimende Sexualität führte, ein Schutzschild, hinter dem er sich für den Umgang mit anderen Menschen wappnen und seinen Mut zusammennehmen konnte. Schreiben indes war für ihn noch unendlich viel mehr: Das Schreiben war sein innerer Palast, ein Palast voller geheimer Orte und Plätze, die zusammen eine endlose Flucht von Räumen bildeten, durch die er lachend und barfuß hindurchlief und immer wieder innehielt, um die Schönheit der dort verborgenen Schätze zu bestaunen.
Er war ein guter Student gewesen und erhielt direkt nach dem Abschluss das Angebot, Spanische Geschichte an einer renommierten Madrider Universität zu unterrichten. Weder während des Studiums noch in der kurzen Zeit als Dozent verspürte er den Drang zu schreiben. Dazu musste er erst eine Phase unendlicher Trauer überwinden.
Es gibt eine sichtbare, äußere Trauer mit Tränen und Trauerflor, und dann gibt es eine andere, bodenlose, unendliche, stumme, die sehr viel mächtiger ist. Die sichtbare Trauer hatte er beim Tod seiner Eltern erlebt: das Aufbegehren gegen die Ungerechtigkeit, die ganze elende Kälte kindlicher Einsamkeit, die öffentliche, schwarze Trauer, die ihn und seine Schwester mit dem Kainsmal des Unglücks versah. Aus Angst, es könnte noch einmal passieren, weinte er Nacht für Nacht, während er eng an seine Schwester geschmiegt dalag und ihr das Versprechen abnahm, dass sie ihn niemals im Stich lassen dürfe; dass ihr Leid nur der Preis dafür gewesen sei, dass sie von jetzt an unverwundbar seien.
Irgendwann glaubten sie beide daran.
Später, als sie älter waren, war aus der Überzeugung, ihnen könne nichts Schlimmes mehr zustoßen, Gewissheit geworden. Doch dann traf das Schicksal ihn an seinem einzigen wunden Punkt.
Während ihrer letzten Tage im Krankenhaus sagte seine Schwester zu ihm: »Es tut mir unendlich leid, dass ich dich im Stich lassen muss. Ich dachte immer, der einzige Schmerz, der mich vernichten könnte, hinge mit dir zusammen, aber jetzt stellt sich heraus, dass ich dein wunder Punkt bin.«
»Halt den Mund!«, entgegnete er und brach in Tränen aus.
Sie wartete geduldig, bis er sich wieder beruhigt hatte, dann winkte sie ihn näher, bis ihre schrundigen Lippen sein Gesicht berührten. »Du musst mich vergessen. Du darfst nicht mehr an mich denken und dich mit Erinnerungen quälen. Wenn ich die Augen zumache, sehe ich immer noch den verängstigten Sechsjährigen vor mir, und ich habe Angst, du könntest wieder anfangen zu weinen wie damals als Kind. Früher konnte ich deswegen nicht schlafen. Und auch jetzt komme ich nicht zur Ruhe …«
Er versuchte, sich von ihr zu lösen, um nicht hören zu müssen, was als Nächstes käme, aber es war zu spät, sie hielt ihn mit ihren langen, schmalen Händen fest.
»Versprich es mir, Manuel. Versprich mir, dass du nicht leidest. Ich will nicht der wunde Punkt in deinem Leben sein. Niemand darf jemals dein wunder Punkt sein.«
Er versprach es ihr. Und als sie dann für immer die Augen schloss, war die Trauer unendlich, bodenlos und stumm.
Dutzende Male war er gefragt worden, warum er schrieb. Er hatte ein paar gute, zum Teil sogar ehrliche Antworten parat, die er je nach Gelegenheit gab: die Freude, sich mitzuteilen, das Bedürfnis, andere Menschen zu erreichen … Aber das war nicht die ganze Wahrheit. Er schrieb, um einen Moment des inneren Friedens zu finden, denn nur in derlei Momenten war er imstande, in seinen Palast zurückzukehren, an den einzigen Ort, zu dem die bodenlose Trauer keinen Zutritt hatte. Es war kein vorsätzlicher Entschluss gewesen, sondern der Ausdruck einer tiefen Sehnsucht, die er immer in sich getragen hatte. Eines Tages hatte er sich einfach vor ein weißes Blatt Papier gesetzt und zu schreiben angefangen. Die Wörter sprudelten aus ihm heraus wie kühles Wasser aus einer geheimen Quelle, die er selbst viele Bücher später nicht hätte benennen oder orten können. Er wusste nur eins: Die Quelle war irgendwo in seinem Kopf. So hatte er auch den Palast entdeckt. Dorthin konnte er sich nun zurückziehen, wann immer er wollte. Dieser Ort vollkommenen Glücks inspirierte und schützte ihn.
Als sein erster Roman sich so gut verkaufte, dass er einfach weitermachen musste, ließ er sich an der Universität für zwei Jahre beurlauben. Dort ahnten sie bereits, dass er nicht wiederkommen würde, auch wenn es niemand aussprach. Das Dekanat organisierte eine Abschiedsfeier für ihn, und mit einem Mal war der Ärger über die ständigen Interviews und Fotoreportagen auf dem Campus vergessen, mit denen die Sonntagsbeilagen und Feuilletons den jungen Professor porträtierten, der mit seinem ersten Buch auf Platz eins der Bestsellerlisten gelandet war. Auf reizende Art um seine Zukunft besorgt, kamen sie grüppchenweise oder einzeln zu ihm, wünschten ihm Glück und warnten ihn wohlmeinend vor den Untiefen einer grausamen Verlagswelt, mit der sie selbst nie zu tun gehabt hatten. Ihr Leben, das war die Universität, der Elfenbeinturm, in dem ihn alle mit offenen Armen empfangen würden, wenn er nach seinem kleinen Abenteuer mit der großen Hure Literatur zurückkäme.
Manuel wusste, dass er sich selbst etwas vormachte, wenn er sich einredete, wegen seiner inneren Qualen nicht schreiben zu können. In Wahrheit war es genau umgekehrt. Der Palast war der heilende Ort, der die Wunden schloss. Sein Verlag forderte eine feste Zusage, ein Datum, irgendwas. Und Álvaro war immer noch da. Monate waren vergangen, ohne dass das Unbehagen, das nur Manuel wahrzunehmen schien, tatsächlich zur Bedrohung geworden wäre. Das Leben war weitergegangen, und Álvaro hatte sein Lächeln wiedergefunden. Die Momente der Traurigkeit waren im ruhigen Fluss des Alltags verblasst. Die Anrufe, die ihn so aus der Fassung gebracht hatten, versiegten. Was immer geschehen war, was immer gedroht hatte, ihre Welt zu zerstören – es war vorbei. Und so kehrte Manuel in seinen Palast zurück und begann wieder zu schreiben.
Feng-Shui
In einem Artikel über Feng-Shui hatte Manuel gelesen, dass ein Spiegel in einem Schlafzimmer nichts zu suchen hatte – ein Prinzip, das der Innenausstatter des Hotels nicht gekannt zu haben schien. Selbst im schummrigen Licht konnte er sein Spiegelbild deutlich erkennen. Mit seinem fahlen Gesicht und dem leeren Whiskyglas, das er sich mit beiden Händen vor die Brust hielt, erinnerte er an einen aufgebahrten Leichnam. Er musste an Álvaro denken. Als er ihn dort auf dem Stahltisch hatte liegen sehen, war er sich sicher gewesen, dass der Tote nicht Álvaro war. Der Eindruck war so stark gewesen, dass er sich umgedreht hatte, um den Kommissar, der diskret ein paar Schritte hinter ihm stehen geblieben war, auf den Irrtum hinzuweisen.
Álvaros Gesicht hatte wächsern gewirkt, vielleicht auch nur wegen des gelblichen Lichts; wie eine Maske des Mannes, der er gewesen war. Manuel war sich nicht sicher gewesen, was er jetzt tun sollte. Beinahe hätte er gefragt, ob er ihn berühren dürfe, gleichzeitig wusste er, dass er das nicht fertigbringen würde. Nie wieder würde er dieses Gesicht küssen können, das nur mehr ein Zerrbild des geliebten Mannes war und sich vor seinen Augen auflöste. Er zwang sich, trotzdem hinzusehen; ihm war bewusst, dass sich sein Gehirn hartnäckig weigerte, Álvaro zu erkennen, weil er dessen Tod einfach nicht wahrhaben wollte. Irgendetwas funktionierte nicht richtig, es gelang ihm nicht zu sehen, was er vor Augen hatte. Stattdessen nahm er überdeutlich die Details wahr: die nassen, nach hinten gekämmten Haare. Warum waren die Haare nass? Die geschwungenen Wimpern, in denen Tröpfchen hingen. Die bleichen, geöffneten Lippen. Eine kleine Schnittwunde über der linken Augenbraue, deren dunkle Ränder glatt und sauber aussahen. Sonst nichts. Ihn quälte die absurde Monstrosität seiner Wahrnehmung, die ihn zum teilnahmslosen Beobachter machte. Gleichzeitig spürte er einen heftigen Druck in der Brust, der kaum auszuhalten war.
Manuel hätte gern geweint. Er wusste, dass die Dämme in seinem Inneren alsbald bersten und dem Ansturm der Trauer nachgeben würden. Am liebsten wäre er zusammengebrochen. Stattdessen stand er da wie eine Statue und war nicht imstande, in seinem Inneren den Schlüssel zu jenem Kerker zu finden, in dem der Schmerz eingeschlossen war.
Dann entdeckte er, dass Álvaros Hand ein Stück unter dem Tuch hervorschaute. Die langen, dunklen, kräftigen Finger. Hände von Toten verändern sich nicht. Sie tragen immer noch die Spuren von Liebkosungen in sich. Manuel nahm Álvaros Hand und spürte die Kälte, die vom Seziertisch bis in die Fingerspitzen gekrochen war. Aber es war immer noch Álvaros Hand, die bis auf die erstaunlich rauen Handinnenflächen ganz weich war. »Du bist der einzige Werbemensch mit Holzfällerhänden«, hatte er immer gesagt. Als er die kalte Haut jetzt mit den Lippen berührte, fiel ihm die helle Stelle auf, über der Álvaro so viele Jahre lang seinen Ring getragen hatte.
»Wo ist der Ehering?«
»Wie bitte?« Der Assistent der Rechtsmedizinerin trat einen Schritt nach vorn.
»Er hat einen Ehering getragen.«
»Nein … Um diese Dinge kümmere ich mich immer vor der Sektion. Außer der Uhr hat er keinen Schmuck getragen – und die Uhr befindet sich bei seinen persönlichen Dingen. Möchten Sie sie sehen?«
Manuel legte vorsichtig Álvaros Hand auf den Stahltisch und zog das Tuch darüber zurecht.
»Nein«, antwortete er und verließ den Raum.
Er goss sich noch einen Whisky ein, doch als er das Glas an die Lippen führte, widerte ihn der Geruch an. Er setzte es auf seiner Brust ab und betrachtete sich über den Rand des Glases hinweg im Spiegel.
»Warum?«, fragte er sein Spiegelbild.
Es antwortete nicht, obwohl es die Antwort kannte.
Der Tod des Vaters vor drei Jahren und ein paar Tage später der des Bruders. Álvaros Traurigkeit, die Anrufe, die er nicht in Manuels Hörweite hatte entgegennehmen können. Fünf Tage Hölle – dann die Rückkehr. Die Übelkeit, die Schlaflosigkeit, die innere Leere, monatelang … Und das alles wegen einer Lüge, die letzten Endes nicht einmal eine gewesen war, weil er Álvaro mit seinem blöden Versprechen die Möglichkeit eröffnet hatte, die Wahrheit für sich zu behalten.
Erneut hob Manuel das Glas an die Lippen. Diesmal stürzte er den Whisky hinunter. Dann betrachtete er wieder den Mann im Spiegel und fragte: »Kannst du mir vertrauen?«
Der Spiegelmann sah ihn mit unendlicher Verachtung an.
Manuel packte das Glas und schmetterte es der Fratze im Spiegel entgegen, der mit einem Höllenlärm in tausend Scherben zerbarst.
Nur Minuten später klopfte es an der Tür. Manuel bereute sofort, was er getan hatte. Wahrscheinlich würde man ihn gleich auffordern, das Hotel zu verlassen. Er stellte die Flasche beiseite und legte sich eine Ausrede zurecht.
Er zog die Tür einen Spaltbreit auf – gerade weit genug, um den Kellner und den Rezeptionisten ansehen zu können, ohne dass die beiden ihrerseits das Zimmer inspizieren konnten.
»Guten Abend … Alles in Ordnung bei Ihnen?«
Manuel nickte. Er schöpfte Hoffnung. Immerhin war dies hier ein Fünfsternehotel.
»Die Gäste aus den Nachbarzimmern haben sich über Lärm beschwert …«
Manuel machte ein zerknirschtes Gesicht.
»Ich fürchte, mir ist ein kleines Missgeschick mit dem Zimmerspiegel passiert. Es ist wegen des Feng-Shui …« Erst jetzt spürte er, wie betrunken er war.
»Feng-Shui?«, fragten die beiden wie aus einem Mund.
»Eine fernöstliche Lehre, die sich mit der Harmonisierung des Menschen und seiner Umwelt befasst.«
Die beiden Männer sahen ihn fassungslos an. Manuel musste sich zusammenreißen, um nicht laut loszulachen.