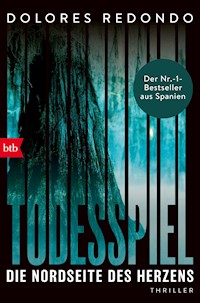4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Baztán-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Das Tal der geheimen Gräber: ein Schauplatz voller Mythen und Legenden - Hochspannung bis zur letzten Seite!
Der rätselhafte Tod eines Babys führt Inspectora Amaia Salazar erneut ins beschauliche Baztán-Tal am Fuß der Pyrenäen. Für die Urgroßmutter des Kindes steht der Täter fest: Inguma, ein mythologisches Wesen, das schlafenden Kindern den Atem raubt. Amaia Salazar dagegen überführt den Vater, der seine eigene Tochter im Schlaf erstickt hat. Doch damit ist der Fall noch lange nicht abgeschlossen, denn die Ermittlerin stößt auf weitere ungeklärte Kindstode, die sich in der Gegend zu häufen scheinen ...
"Ein Meilenstein in der Geschichte des spanischen Romans." El Mundo
Der fulminante Abschluss der Baztán-Trilogie wurde von ZDF/arte verfilmt als "Das Tal der geheimen Gräber".
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 712
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin bei beTHRILLED
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Zitate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Anmerkung der Autorin
Danksagungen
Weitere Titel der Autorin bei beTHRILLED
Die Baztán-Trilogie:
Band 1: Das Echo dunkler Tage
Band 2: Die vergessenen Kinder
Über dieses Buch
Ein Schauplatz voller Mythen und Legenden – Hochspannung bis zur letzten Seite!
Der rätselhafte Tod eines Babys führt Inspectora Amaia Salazar erneut ins beschauliche Baztán-Tal am Fuß der Pyrenäen. Für die Urgroßmutter des Kindes steht der Täter fest: Inguma, ein mythologisches Wesen, das schlafenden Kindern den Atem raubt. Amaia Salazar dagegen überführt den Vater, der seine eigene Tochter im Schlaf erstickt hat. Doch damit ist der Fall noch lange nicht abgeschlossen, denn die Ermittlerin stößt auf weitere ungeklärte Kindstode, die sich in der Gegend zu häufen scheinen …
eBooks von beTHRILLED – mörderisch gute Unterhaltung.
Über die Autorin
Dolores Redondo wurde 1969 in San Sebastián (Baskenland) geboren und hat Jura studiert. Mit ihrer Baztán-Trilogie um Inspectora Amaia Salazar hat Dolores Redondo die spanischen Bestsellerlisten im Sturm erobert, alle drei Romane standen auf Platz 1. Die Trilogie wurde in über 30 Länder verkauft und verfilmt. Dolores Redondo lebt in der nordspanischen Region Navarra, die sie auch als Schauplatz ihrer Krimis gewählt hat. Die »Königin der literarischen Spannung« (Carlos Ruiz Zafón) wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem Premio Planeta und dem Premio Bancarella.
Weitere Infos über die Autorin und ihre Romane: http://www.doloresredondomeira.com.
DOLORES REDONDO
DER NÄCHTLICHE BESUCHER
Inspectora Amaia Salazars dritter Fall
Aus dem Spanischen von Matthias Strobel
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:Copyright © 2014 by Dolores Redondo MeiraTitel der spanischen Originalausgabe: »Ofrenda a la tormenta«Originalverlag: Editorial Planeta, S.A.Published by Agreement with Pontas Literary & Film Agency
Für diese Ausgabe:Copyright © 2017/2021 by Bastei Lübbe AG, KölnCovermotiv: © Nickolay Khoroshkov/shutterstockeBook-Erstellung: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-9847-2
be-ebooks.delesejury.de
Für Eduardo, wie alles, was ich mache.Für meine Tante Ángela und all die stolzen Frauen in meiner Familie, die immer zu tun wussten, was zu tun war.Und vor allem für Ainara.Ich kann dir keine Gerechtigkeit widerfahren lassen, doch wenigstens an deinen Namen kann ich erinnern.
»Wir wollen zusammen hinknien, wir wollen versuchen, uns eines Gebetes zu erinnern.«(…)»Solche Worte haben keinen Sinn mehr für mich.«
OSCAR WILDE, Das Bildnis des Dorian Gray
Alles, was einen Namen hat, existiert.
Volksweisheit aus Baztán, gesammelt von JOSÉ MIGUEL DE BARANDIARÁN in Hexerei und Hexen
Trust I seek and find in youEvery day for us something newOpen mind for a different viewAnd nothing else matters.
METALLICA, Nothing Else Matters
1
Die Lampe auf dem Nachttisch verströmte warmes, rötliches Licht, das sich an den schönen Feenbildern des Glockenschirms in weitere Farbtöne brach. Auf dem Regal saß eine ganze Sammlung kleiner Plüschtiere und betrachtete mit glänzenden Augen den Eindringling, der schweigend das ruhige Gesicht des schlafenden Babys musterte. Der Eindringling horchte auf das Geräusch des Fernsehers, der im Nachbarzimmer lief, und auf das lautstarke Atmen der Frau, die im kalten Licht des Bildschirms auf dem Sofa schlief. Wie verzückt ließ er den Blick durch den Raum schweifen und achtete auf jedes Detail, als könnte er so den Augenblick festhalten und auf ewig bewahren, wie einen Schatz, an dem er sich bis ans Ende seiner Tage erfreuen konnte. Mit einer Mischung aus Gier und Gelassenheit prägte er sich die sanft geschwungenen Linien des bemalten Papiers ein, die gerahmten Fotos, die Reisetasche mit den Windeln und der Wäsche der Kleinen, und ließ den Blick schließlich auf der Wiege ruhen. Ein Gefühl von Betrunkenheit machte sich in ihm breit, eine Art Übelkeit, die am Mageneingang lauerte. Das auf dem Rücken liegende Mädchen trug einen Frotteeschlafanzug und lag bis zur Hüfte unter einer geblümten Daunendecke, die der Eindringling nun wegzog, um es ganz sehen zu können. Das Baby seufzte im Schlaf, zwischen den rötlichen Lippen lief Speichel hervor, der auf der Wange eine feuchte Spur hinterließ. Die drallen Händchen, die leicht geöffnet neben dem Kopf lagen, zitterten kurz und ruhten dann wieder reglos. Angesteckt von der Kleinen, seufzte auch der Eindringling, und eine Welle der Zuneigung durchlief ihn, kurz nur, aber lang genug, um sich gut zu fühlen. Er nahm das Plüschtier, das vor der Wiege saß wie ein stiller Wächter, und konnte die Sorgfalt fast spüren, mit der jemand es dort platziert hatte. Es war ein Eisbär mit schwarzen Äuglein und dickem Bauch. Um seinen Hals trug er ein nicht ganz passendes rotes Band, das ihm bis zwischen die Hinterläufe hing. Der Eindringling strich dem Plüschbären sanft über den Kopf und vergrub seine Nase in dem weichen Bauch, um den süßen Duft des teuren Spielzeugs einzuatmen.
Plötzlich bemerkte er, wie sein Herz zu rasen begann und ihm Schweißperlen auf die Stirn traten. Zorn wallte in ihm auf, und er riss sich den Bären förmlich vom Gesicht. Entschlossen legte er ihn auf den Kopf des Babys und drückte zu.
Die Händchen zuckten, reckten sich gen Himmel, ein Fingerchen streifte das Handgelenk des Eindringlings. Kurz darauf schien das Baby in einen tiefen, erholsamen Schlaf zu sinken, all seine Muskeln entspannten sich, und seine Seesternhändchen ruhten wieder reglos auf dem Laken.
Der Eindringling hob den Plüschbären wieder an und betrachtete das Gesicht des Mädchens. Nichts deutete darauf hin, dass es gelitten hatte, abgesehen von einer leichten Rötung, die wahrscheinlich von der Nase des Bären stammte. Kein Leuchten war mehr in seinem Gesicht, und das Gefühl, es mit einem leeren Gefäß zu tun zu haben, wuchs noch, als der Eindringling das Plüschtier wieder zum Gesicht führte, um den Duft einzuatmen, der nun um den letzten Hauch einer Kinderseele bereichert war. Dieser Duft war so süß und köstlich, dass sich seine Augen mit Tränen füllten. Der Eindringling seufzte dankbar, zupfte das Bändchen zurecht und setzte den Bären wieder vor die Wiege.
Plötzlich hatte er es eilig, als wäre ihm schlagartig bewusst geworden, dass er sich schon viel zu lange aufgehalten hatte. Nur einmal drehte er sich noch um. Das Licht der kleinen Lampe warf einen mitfühlenden Glanz auf die Augenpaare der anderen Plüschtiere, die ihn vom Regal aus entsetzt anstarrten.
2
Amaia saß seit zwanzig Minuten im Auto und observierte das Haus. Sie hatte den Motor ausgemacht, die Scheiben waren beschlagen, und der Regen tat sein Übriges dazu, dass die Fassade mit den dunklen Fensterläden nur verschwommen zu sehen war.
Ein Wagen hielt direkt vor der Tür. Ein junger Mann stieg aus, spannte einen Regenschirm auf, beugte sich über das Armaturenbrett und griff nach einem Notizbuch. Er warf einen kurzen Blick hinein und ließ es dann wieder auf die Ablage fallen. Dann machte er die Tür zu, holte ein flaches Paket aus dem Kofferraum und ging zum Hauseingang.
Amaia war bei ihm, als er gerade läutete.
»Wer sind Sie?«
»Sozialer Dienst. Wir bringen jeden Tag das Mittag- und Abendessen«, erklärte er und deutete auf das in Zellophan eingeschweißte Essen in seiner Hand. »Der Mann darf nicht aus dem Haus und hat niemanden, der sich um ihn kümmert. Sind Sie eine Angehörige?«, fragte er hoffnungsvoll.
»Nein, Policía Foral.«
»Aha«, sagte der Sozialarbeiter, offenbar enttäuscht.
Er klingelte noch einmal, trat näher an die Tür und rief:
»Señor Yáñez, ich bin’s, Mikel, vom Sozialen Dienst. Erinnern Sie sich? Ich bringe Ihnen …«
Bevor er zu Ende sprechen konnte, wurde geöffnet. Das hagere, aschgraue Gesicht von Yáñez erschien in der Tür.
»Natürlich erinnere ich mich, ich bin ja nicht senil. Und wieso zum Teufel schreien Sie so? Taub bin ich nämlich auch nicht«, blaffte er schlecht gelaunt.
»Natürlich nicht, Señor Yáñez«, beschwichtigte der junge Mann grinsend, drückte die Tür auf und schlüpfte hinein.
Amaia suchte nach ihrem Dienstausweis.
»Nicht nötig«, sagte Yáñez, der sie erkannt hatte und beiseitetrat, um sie hereinzulassen.
Er trug eine Cordhose und einen dicken Pullover, über den er einen Frotteebademantel gezogen hatte, dessen Farbe Amaia im spärlichen Licht, das durch die fast vollständig geschlossenen Fensterläden fiel, nicht ausmachen konnte. Sie folgte Yáñez über den Flur in die Küche, wo die Neonlampe mehrmals flackerte, bevor sie ansprang.
»Aber Señor Yáñez!«, rief der junge Mann einen Tick zu laut. »Sie haben Ihr Abendessen ja gar nicht gegessen!« Er hatte den Kühlschrank geöffnet, holte ein paar verschweißte Päckchen heraus und stellte die neuen hinein. »Sie wissen doch, dass ich das in meinem Bericht vermerken muss. Wenn der Arzt mit Ihnen schimpft, dürfen Sie sich nicht bei mir beschweren.« Er sprach wie zu einem kleinen Kind.
»Das kannst du von mir aus sonstwo vermerken«, raunzte Yáñez.
»Hat Ihnen der Seehecht mit Soße nicht geschmeckt?« Ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr er fort: »Heute gibt’s Kichererbsen mit Fleisch und Joghurt, und zum Abendessen Tortilla, Suppe und als Nachtisch Biskuit.« Er drehte sich um, stapelte die nicht angerührten Speisen auf einem Tablett, bückte sich zur Spüle hinunter, verknotete die halbleere Mülltüte und machte sich auf den Weg. An der Tür blieb er noch einmal stehen und sagte wieder etwas zu laut: »Gut, Señor Yáñez, das wär’s dann. Guten Appetit und bis morgen.«
Er nickte Amaia zu und ging los. Yáñez wartete, bis er die Haustür ins Schloss fallen hörte, bevor er das Wort ergriff.
»Na, wie fanden Sie diesen Auftritt? Heute hat er sich ziemlich viel Zeit genommen, normalerweise dauert es keine zwanzig Sekunden. Der arme Kerl will weg, bevor er überhaupt reingekommen ist«, sagte er, schaltete das Licht aus und ließ Amaia fast im Dunkeln stehen. »Hier drin kriegt er das Grausen, und ich kann es ihm nicht verübeln, ist ja auch wie auf dem Friedhof bei mir.«
Auf dem braunen Samtsofa lagen ein Kissen, zwei grobe Decken und ein Laken. Amaia vermutete, dass Yáñez dort schlief und wahrscheinlich auch den größten Teil des Tages dort verbrachte. Überall waren Krümel, und auf einer der Decken prangte ein trockener eigelbfarbener Fleck. Yáñez setzte sich, gegen das Kissen gelehnt. Amaia betrachtete ihn aufmerksam. Ein Monat war vergangen, seit sie ihn auf dem Kommissariat gesehen hatte. Aufgrund seines Alters wartete er unter Hausarrest auf seinen Prozess. Er war dünner geworden, und der harte, misstrauische Gesichtsausdruck hatte sich ihm so tief eingegraben, dass er wie ein verrückter Asket wirkte. Seine Haare waren kurz geschnitten, und er hatte sich auch rasiert, aber unter dem Bademantel und dem Pullover lugte das Schlafanzugoberteil hervor. Amaia fragte sich, wie lange er das wohl schon trug. Es war eiskalt in der Wohnung, als wäre seit Tagen nicht mehr geheizt worden. Dem Sofa gegenüber befanden sich ein Kamin, in dem allerdings kein Feuer brannte, und ein auf lautlos gestellter, ziemlich neuer Fernseher, der den Kamin an Größe noch übertraf und das Zimmer in ein kaltes bläuliches Licht tauchte.
»Kann ich die Fenster öffnen?«, fragte Amaia.
»Tun Sie, was Sie nicht lassen können, Hauptsache, Sie machen sie hinterher wieder zu.«
Sie nickte, öffnete die Fenster und stieß die Holzläden auf, um das spärliche Licht Baztáns einzulassen. Dann drehte sie sich wieder zu ihm und bemerkte, dass er seine ganze Aufmerksamkeit auf den Fernseher gerichtet hatte.
»Señor Yáñez.«
Er starrte auf den Bildschirm, als wäre sie überhaupt nicht anwesend.
»Señor Yáñez.«
Missmutig sah er sie an.
»Ich würde mich gern mal umsehen«, sagte sie und machte eine Geste in Richtung Flur.
»Tun Sie sich keinen Zwang an«, erwiderte er, »aber bringen Sie nicht alles durcheinander. Beim letzten Mal haben Ihre Kollegen das reinste Chaos hinterlassen. Ich hab ewig gebraucht, bis alles wieder so war wie vorher.«
»Natürlich.«
»Außer dem Polizisten gestern, der war etwas rücksichtsvoller.«
»Gestern war ein Polizist hier?«, fragte sie erstaunt.
»Ja, ein netter Mensch. Hat mir sogar einen Milchkaffee gemacht, bevor er wieder gegangen ist.«
Das Haus hatte nur ein Stockwerk. Neben der Küche und dem kleinen Wohnzimmer gab es noch drei Schlafzimmer und ein ziemlich großes Bad. Amaia öffnete die Schränkchen und nahm die Regale genauer unter die Lupe: Rasierzeug, Toilettenpapier, irgendwelche Tabletten. Das erste Schlafzimmer dominierte ein Ehebett, in dem schon seit längerem niemand mehr geschlafen zu haben schien. Die geblümte Tagesdecke, die gut zu den Vorhängen passte, war an den Stellen, auf die seit Jahren die Sonne schien, stark ausgebleicht. Häkeldeckchen auf dem Toilettentisch und den beiden Nachttischen verstärkten noch den Eindruck einer Zeitreise in diesem Zimmer, das jemand in den Siebzigerjahren mit viel Liebe eingerichtet hatte, wahrscheinlich Yáñez’ Frau. Offenbar hatte er daran nie wieder etwas geändert. Die Vasen mit den Plastikblumen in den schrillsten Farben riefen in Amaia ein unwirkliches Gefühl hervor, als wäre das Zimmer eine Rekonstruktion in einem ethnologischen Museum, so kalt und unwirtlich wie ein Grab.
Das zweite Schlafzimmer war leer, bis auf eine alte Schreibmaschine und einen Weidenkorb vor dem Fenster. Amaia erinnerte sich noch gut an den Durchsuchungsbericht. Trotzdem hob sie den Deckel an, um sich die Stoffreste anzusehen, unter denen auch eine farbintensivere Version des Vorhangstoffs aus dem ersten Schlafzimmer war.
Das dritte Schlafzimmer war das Kinderzimmer, so hatte es wenigstens im Bericht geheißen. Und so war es auch: das typische Zimmer eines elf oder zwölf Jahre alten Jungen. Einzelbett mit einer sauberen weißen Tagesdecke; auf den Regalen Exemplare einer Kinderbuchreihe, die auch sie selbst schon gelesen hatte, und Spielzeug, vor allem Modellbauten, Schiffe, Flugzeuge, eine ganze Sammlung Metallautos, alle schön aufgereiht und ohne einen Fussel Staub; an der Innenseite der Tür das Poster eines Ferraris und auf dem Schreibtisch alte Schulbücher und ein Stapel Sammelbildchen, die von einem Gummiring zusammengehalten wurden. Sie nahm ihn in die Hand und stellte fest, dass das Gummi hart, rissig und mit der bleichen Pappe der Bildchen verklebt war. Sie legte den Stapel wieder zurück und verglich im Geist dieses eiskalte Zimmer mit Berasateguis Wohnung in Pamplona. In Yáñez’ Haus gab es noch zwei weitere Räume, eine kleine Waschküche und eine gut gefüllte Brennholzkammer, in der auch Gartenwerkzeuge und Kisten mit Kartoffeln und Zwiebeln verstaut waren. Neben der Tür, die nach draußen führte, befand sich ein ausgeschalteter Gasbrenner.
Amaia holte sich aus der Küche einen Stuhl und stellte ihn zwischen Yáñez und den Fernseher.
»Ich würde Ihnen gern einige Fragen stellen.«
Yáñez nahm die Fernbedienung und schaltete den Fernseher aus. Dann sah er Amaia an, mit seinem typischen Gesichtsausdruck zwischen wütend und verbittert, der Amaia schon bei ihrer ersten Begegnung dazu veranlasst hatte, ihn in der Kategorie unberechenbar abzuspeichern.
»Erzählen Sie mir von Ihrem Sohn.«
Yáñez zuckte mit den Schultern.
»Wie war Ihre Beziehung zu ihm?«
»Er ist ein guter Junge«, antwortete er wie aus der Pistole geschossen. »Und er hat alles getan, was man von einem guten Jungen erwarten konnte.«
»Zum Beispiel?«
Diesmal musste er nachdenken.
»Er hat mir Geld gegeben, ab und zu eingekauft, Essen gebracht, solche Sachen halt.«
»Ich habe da ganz andere Informationen. Im Dorf heißt es, Sie hätten den Jungen nach dem Tod Ihrer Frau zum Studieren ins Ausland geschickt und er hätte sich jahrelang nicht mehr hier blicken lassen.«
»Er hat eben studiert und musste viel lernen, zwei Studiengänge und ein Master, der Junge ist einer der besten Psychiater überhaupt.«
»Seit wann hat er Sie wieder häufiger besucht?«
»Weiß nicht, seit einem Jahr vielleicht.«
»Hat er auch mal was anderes mitgebracht als Essen, etwas, das Sie hier oder woanders für ihn aufbewahren sollten?«
»Nein.«
»Sind Sie sicher?«
»Ja.«
»Ich habe mir das Haus angesehen«, sagte sie und blickte sich um. »Sehr sauber.«
»Das muss so sein.«
»Verstehe, für den Fall, dass Ihr Sohn wiederkommt.«
»Nein, wegen meiner Frau. Es ist alles so, wie es war, als sie gegangen ist.« Er verzog sein Gesicht zu einer Grimasse aus Ekel und Schmerz, ohne einen Laut von sich zu geben. Dass er weinte, wurde Amaia erst klar, als ihm Tränen über die Wangen liefen.
»Das ist das Einzige, was ich tun konnte, alles andere habe ich vermasselt.«
Er ließ den Blick von einem Gegenstand zum anderen schweifen, als läge irgendwo zwischen dem ausgeblichenen Zierrat auf den Fensterbrettern und den Tischchen eine Antwort verborgen, bis er schließlich an Amaias Augen haften blieb. Plötzlich packte er eine Decke, zog sie sich vor das Gesicht und riss sie zwei Sekunden später wütend wieder herunter, als wollte er sich selbst für die Schwäche bestrafen, vor Amaia geweint zu haben. Amaia war fast sicher, dass ihr Gespräch damit beendet war, aber Yáñez hob das Kissen an, an dem er gelehnt hatte, und holte ein gerahmtes Foto hervor, das er wie verzückt ansah, bevor er es ihr überreichte. Diese Geste versetzte Amaia ein Jahr zurück, in ein anderes Zimmer, in dem ein ebenfalls verzweifelter Vater ihr das Porträt seiner ermordeten Tochter überreicht hatte; auch er hatte es unter seinem Kissen aufbewahrt. Sie hatte den Vater von Anne Arbizu nicht wiedergesehen, aber sein Schmerz, der nun in dem Gesicht dieses anderen Vaters stand, traf sie mit großer Wucht. Wie sehr doch der Schmerz zwei unterschiedliche Menschen in einer Geste vereinen kann, dachte sie.
Aus dem Rahmen lächelte ihr eine junge, höchstens fünfundzwanzigjährige Frau entgegen. Sie betrachtete sie kurz, bevor sie Yáñez das Foto zurückgab.
»Ich dachte, ich hätte das Glück gepachtet. Eine junge Frau, hübsch, gutherzig … Aber als der Kleine auf der Welt war, wurde sie komisch, war ständig traurig, lächelte nicht mehr, wollte das Kind nicht in den Arm nehmen, sagte, sie könne ihn nicht lieben, er weise sie ab, das spüre sie. Und ich konnte ihr nicht helfen. Das ist doch Quatsch, habe ich zu ihr gesagt, natürlich liebt er dich, aber das hat sie nur noch trauriger gemacht. Immer trauriger. Trotzdem hat sie das Haus immer sauber gehalten und jeden Tag gekocht. Nur gelächelt hat sie nicht mehr, oder genäht. Wenn sie frei hatte, hat sie geschlafen, die Fensterläden zugemacht und geschlafen, so wie ich jetzt. Ich weiß noch gut, wie stolz wir waren, als wir dieses Haus gekauft haben, wie hübsch sie es eingerichtet hat; wir haben es gestrichen und Blumenkästen angebracht. Es lief alles gut, und ich dachte, so würde es für immer bleiben. Aber ein Haus bedeutet nicht automatisch ein Zuhause, stattdessen verwandelte es sich in ihr Grab. So wie jetzt für mich, nur dass man es in meinem Fall Hausarrest nennt. Der Anwalt meint, wenn das Urteil gefällt ist, werde ich meine Strafe hier absitzen können, also wird dieses Haus mein Grab werden. Nachts kriege ich kein Auge zu, spüre unter meinem Kopf das Blut meiner Frau.«
Amaia betrachtete das Sofa näher. Es passte nicht recht zur restlichen Einrichtung.
»Ich habe es neu beziehen lassen, weil überall Blut war. Diesen Stoff habe ich ausgesucht, weil der ursprüngliche nicht mehr hergestellt wird. Ansonsten habe ich nichts verändert. Wenn ich mich hinlege, kann ich unter dem neuen Bezug das Blut riechen.«
»Ziemlich kalt hier«, sagte Amaia und unterdrückte ein Schaudern, das ihr den Rücken hinunterlief.
Yáñez zuckte mit den Schultern.
»Warum machen Sie nicht die Heizung an?«
»Die ist kaputt, seit dem Abend, als der Strom ausfiel.«
»Das ist doch schon über einen Monat her. Leben Sie seither ohne Heizung?«
Er antwortete nicht.
»Was ist mit dem Sozialen Dienst?«
»Ich lasse nur den Burschen mit dem Tablett rein. Das habe ich denen von Anfang an klargemacht: Wenn sie herkommen, stehe ich mit der Axt in der Tür.«
»Sie haben auch noch den Kamin. Warum zünden Sie den nicht an? Warum sitzen Sie hier in der Kälte rum?«
»Weil ich es verdient habe.«
Amaia stand auf, verließ das Zimmer und kam mit einem Korb voller Brennholz und alten Zeitungen wieder. Sie kniete sich vor den Kamin und stocherte die Asche zurecht, um die Scheite richtig zu platzieren. Dann nahm sie die Streichhölzer, die auf dem Bord lagen, machte Feuer und kehrte an ihren Platz zurück. Yáñez hielt den Blick starr auf die Flammen gerichtet.
»Das Zimmer Ihres Sohnes ist auch noch so wie früher. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Mann wie er dort übernachten möchte.«
»Hat er auch nie. Manchmal kam er zum Mittagessen, blieb auch mal bis zum Abendessen, aber geschlafen hat er hier nie. Lieber ist er abends gegangen und am anderen Morgen wiedergekommen. Im Hotel sei es ihm lieber, hat er gesagt.«
Amaia glaubte das nicht. Sie hatten es überprüft, und es hatte sich kein Hinweis darauf gefunden, dass er in einem Hotel oder Landgasthof im Tal übernachtet hatte.
»Sind Sie sicher?«
»Ja, schon, aber hundert Prozent bestätigen kann ich es nicht. Mein Gedächtnis ist bei weitem nicht mehr so gut, wie ich es der Sozialbehörde weismache, manchmal vergesse ich auch Sachen.«
Amaia holte ihr Handy hervor, das zuvor schon mehrmals in ihrer Manteltasche vibriert hatte. Sie suchte nach einem Foto, tippte auf das Display, um es zu vergrößern, und zeigte es Yáñez, ohne selbst einen Blick darauf zu werfen.
»War er mit dieser Frau hier?«
»Das ist Ihre Mutter.«
»Kennen Sie sie? Haben Sie sie an jenem Abend gesehen?«
»Nein, an jenem Abend nicht, aber ich kenne Ihre Mutter, seit ich denken kann. Sie ist älter geworden, sonst hat sie sich kaum verändert.«
»Denken Sie gut nach, Sie haben ja selbst gesagt, dass Ihr Gedächtnis nachlässt.«
»Manchmal vergesse ich, zu Abend zu essen, manchmal esse ich auch zweimal, weil ich vergessen habe, dass ich schon gegessen habe, aber ich vergesse garantiert niemanden, der zu mir zu Besuch kommt. Und Ihre Mutter hat nie einen Fuß in dieses Haus gesetzt.«
Amaia schaltete das Display aus und ließ das Handy wieder in ihre Manteltasche gleiten. Bevor sie aufbrach, stellte sie den Stuhl an seinen Platz zurück und klappte die Fensterläden zu. Als sie wieder im Auto saß, wählte sie eine Nummer, während das Handy schon wieder vibrierte. Der Mann am anderen Ende sagte seinen Namen und den der Firma.
»Ja, ich hätte gern, dass Sie jemanden schicken, um einen Heizkessel zu reparieren, der seit dem großen Sturm kaputt ist.« Dann gab sie Yáñez’ Adresse durch.
3
Amaia parkte vor dem Lamien-Brunnen. Sie zog sich die Kapuze über den Kopf und durchquerte den kleinen Torbogen, der den Platz von der Pedro-Axular-Straße trennte. Trotz des prasselnden Regens waren die aufgeregten Stimmen deutlich zu hören. Inspektor Iriartes Gesicht verriet die gleiche Dringlichkeit wie seine unzähligen Anrufe. Er nickte ihr von weitem zu, ohne den Menschenpulk aus den Augen zu lassen, den er von dem Streifenwagen fernzuhalten versuchte. In dem Auto saß ein müde wirkender Mann, der seinen Kopf an die von Regentropfen übersäte Scheibe lehnte. Zwei Beamte bemühten sich erfolglos, einen Kordon um einen Rucksack zu bilden, der mitten in einer Wasserlache stand. Amaia ging schneller, um ihnen zu Hilfe zu kommen, und holte gleichzeitig ihr Handy hervor, um Verstärkung herbeizurufen. In diesem Augenblick rasten zwei Streifenwagen mit heulenden Sirenen über die Giltxaurdi-Brücke und zogen die Aufmerksamkeit des Pulks auf sich, der, vom Sirenengeheul übertönt, verstummte.
Iriarte war vollkommen durchnässt. Immer wieder wischte er sich das Wasser aus dem Gesicht, während er mit Amaia sprach. Wie von Zauberhand erschien von irgendwoher Jonan Etxaide und reichte ihnen einen riesigen Regenschirm, bevor er sich zu den Polizisten gesellte, die sich gegen die Menschenmenge stemmten.
»Inspector?«
»Der Verdächtige im Wagen ist Valentín Esparza. Seine vier Monate alte Tochter ist vorgestern Abend im Haus der Großmutter mütterlicherseits gestorben. Der Arzt hat plötzlichen Kindstod attestiert, es handelt sich also vermeintlich um ein Unglück. Nun ist es aber so, dass die Großmutter, Inés Ballarena, gestern im Kommissariat vorstellig wurde. Laut ihrer Aussage war es das erste Mal, dass sie die Kleine hütete, damit die Eltern mit einem Abendessen ihren Hochzeitstag feiern konnten. Sie hatte sich sehr darauf gefreut und dem Mädchen sogar ein eigenes Zimmer hergerichtet. Abends hat sie ihm das Fläschchen gegeben, es ins Bett gelegt und ist dann im Nachbarzimmer vor dem Fernseher eingeschlafen. Sie schwört, dass das Babyphone eingeschaltet war. Nachts weckte sie ein Geräusch. Sie vergewisserte sich, dass die Kleine schlief, und hörte draußen ein Prasseln, wie wenn Autoreifen über Kies rollen. Als sie aus dem Fenster sah, fuhr tatsächlich gerade ein Auto weg. Das Kennzeichen hat sie nicht erkannt, doch sie meint, das Auto ihres Schwiegersohns erkannt zu haben, weil es groß und grau war«, erklärte Iriarte mit einer vagen Geste. »In diesem Moment sah sie auf die Uhr. Es war vier, und sie dachte, die beiden wären vielleicht vorbeigefahren, um zu schauen, ob noch Licht brannte. Ihr Haus liege nämlich auf ihrem Heimweg. Deshalb habe sie sich auch nicht weiter gewundert. Sie legte sich wieder auf das Sofa und schlief weiter. Am nächsten Morgen wunderte sie sich, dass die Kleine nicht nach Essen schrie, und als sie nach ihr sah, war sie tot. Die Frau ist am Boden zerstört, wird schier erdrückt von ihren Schuldgefühlen. Als der Rechtsmediziner den Todeszeitpunkt auf zwischen vier und fünf Uhr morgens bestimmte, fiel ihr wieder ein, dass sie genau um diese Uhrzeit das Auto gehört hatte. Und sie vermutet, dass sie vorher von einem Geräusch im Haus aufgeweckt wurde. Sie fragte ihre Tochter danach, aber die sagte, sie seien gegen halb zwei nach Hause gekommen, weil ihr nach ihrer langen Abstinenz ein Glas Wein und ein Drink in den Kopf gestiegen seien. Als der Schwiegersohn befragt wurde, reagierte er merkwürdig, wurde nervös und verweigerte die Aussage, wahrscheinlich sei in dem Auto irgendein Pärchen gewesen auf der Suche nach einem ungestörten Ort, das sei angeblich schon öfter vorgekommen. Aber da erinnerte sich Inés Ballarena an ein weiteres Detail: Die Hunde hatten nicht gebellt. Sie hält zwei Hunde im Garten und versichert, dass sie sofort wie verrückt bellen, wenn jemand Fremdes sich nähert.«
»Was ist dort drüben los?«, fragte Amaia und richtete den Blick auf den Pulk, der sich eingeschüchtert von der Polizeipräsenz und dem immer stärker werdenden Regen zum Eingang der Leichenhalle zurückgezogen hatte. In der Mitte der Menschenmenge stand eine Frau, die wiederum eine andere Frau umarmte, die hysterisch etwas Unverständliches schrie.
»Die, die schreit, das ist die Mutter; die, die sie umarmt, die Großmutter«, erklärte Iriarte, der Amaias Blick gefolgt war. »Die arme Frau ist erschüttert, hat die ganze Zeit geweint, als sie mir alles erzählt hat. Zuerst dachte ich, sie sucht nur eine Erklärung für etwas, das sie nicht verkraften kann. Es war wie gesagt das erste Mal, dass man ihr das Baby anvertraut hatte, die erste Enkelin, kein Wunder, dass sie am Boden zerstört ist.«
»Was gibt es noch?«
»Ich habe den Kinderarzt angerufen. Plötzlicher Kindstod, ohne jeden Zweifel. Das Mädchen kam zu früh zur Welt. Weil die Lunge noch nicht ganz ausgebildet war, hat es die ersten zwei Monate im Krankenhaus verbracht. Es ist zwar entlassen worden, aber der Kinderarzt hat das Mädchen in dieser Woche untersucht, weil es erkältet war, nichts Schlimmes, ein Schnupfen. Für ihn war die Todesursache jedenfalls klar, weil das Baby noch so klein war und mit Untergewicht geboren wurde. Vor einer Stunde kam die Großmutter aber erneut aufs Kommissariat. Sie behauptete steif und fest, das Mädchen habe einen kleinen Abdruck auf der Stirn, einen etwa knopfgroßen Kreis. Sie habe es ihrem Schwiegersohn gegenüber erwähnt, woraufhin der ihr das Wort abgeschnitten und den Sarg schnell habe schließen lassen. Als wir am Beerdigungsinstitut eintrafen, haben wir ihn gerade noch erwischt. Er hatte diesen Rucksack dabei, und die Art, wie er ihn trug, kam mir komisch vor.« Um deutlich zu machen, was er meinte, verschränkte Iriarte die Arme vor der Brust und trat an den Rucksack heran, der inzwischen nur noch ein feuchtes Bündel war. »Er trug den Rucksack nicht so, wie man normalerweise einen Rucksack trägt. Als er mich sah, wurde er blass und rannte weg. An seinem Auto holte ich ihn ein, und er begann zu schreien, wir sollten ihn in Ruhe lassen, er müsse es beenden.«
»Was beenden? Sein Leben?«
»Das dachte ich zuerst auch. Und dass er womöglich eine Waffe in dem Rucksack hatte.«
Der Inspektor kniete sich neben den Rucksack und stellte den Schirm darüber wie ein Dach. Er öffnete den Reißverschluss und löste die Plastikklemme der Kordel, mit der er zugeschnürt war. Trotz des dunklen Flaums erkannte man deutlich die Fontanellen des kleinen Köpfchens. Die Gesichtshaut war so blass, dass jeder Zweifel ausgeschlossen war, aber die roten Lippen wirkten so lebendig, dass Amaia ihren Blick sekundenlang nicht davon lösen konnte. Erst Doktor San Martín brach den Bann, als er hinzutrat und sich zu ihnen herunterbeugte. Iriarte fasste für den Rechtsmediziner zusammen, was er Amaia erzählt hatte. San Martín holte unterdessen aus seinem Koffer ein Wattestäbchen und machte sich daran, die fettige Schminke zu entfernen, die jemand grobschlächtig auf die Stirn des Babys geschmiert hatte.
»So ein kleines Wesen«, sagte der Arzt traurig. Iriarte und Amaia sahen ihn erstaunt an. San Martín bemerkte es und konzentrierte sich auf seine Arbeit, um sich die Niedergeschlagenheit nicht weiter anmerken zu lassen. »Ein ungeschickter Versuch, eine Druckstelle zu verbergen. Wahrscheinlich entstand sie in dem Moment, als die Atmung aussetzte, wurde aber erst jetzt, da die Leichenblässe eingesetzt hat, so deutlich sichtbar. Helfen Sie mir mal, bitte.«
»Bei was?«
»Ich muss es ganz sehen«, antwortete er und machte ein Gesicht, als läge das auf der Hand.
»Bitte nicht jetzt. Die Gruppe da drüben, das sind die Angehörigen«, sagte Iriarte und nickte in Richtung Bestattungsinstitut, »darunter auch die Mutter und die Großmutter. Wir haben es gerade geschafft, sie einigermaßen zu beruhigen. Wenn sie jetzt die Leiche auf dem Boden liegen sehen, drehen sie womöglich vollends durch.«
Amaia sah San Martín an und nickte.
»Der Inspector hat recht.«
»Dann muss ich sie erst auf dem Tisch haben, bevor ich Ihnen sagen kann, ob noch andere Anzeichen auf eine Misshandlung hindeuten. Sie müssen den Tatort gründlich absuchen. Ich hatte mal einen ähnlichen Fall, da stammte der Abdruck auf der Wange vom Knopf eines Kissenbezugs. In unserem Fall kann ich Ihnen ein bisschen auf die Sprünge helfen.« Er kramte in seinem Gladstonekoffer und holte ein kleines Digitalgerät heraus, das er stolz vorzeigte: »Ein digitaler Messschieber«, erklärte er, während er ihn ansetzte, um den runden Abdruck auf der Stirn des Babys abzumessen. »Da haben wir’s«, sagte er und zeigte ihnen das Display, »13,85 Millimeter. Nach diesem Durchmesser müssen Sie suchen.«
Sie erhoben sich, damit die Kriminaltechniker den Rucksack in einen Leichensack stecken konnten. Als Amaia sich umdrehte, erblickte sie Richter Markina, der nur einige Meter entfernt stand und sie schweigend beobachtete. Wegen des schwarzen Regenschirms und des spärlichen Lichts, das durch die dichten Wolken sickerte, wirkte sein Gesicht düster. Trotzdem konnte sie erkennen, wie sehr seine Augen glänzten, wie intensiv sein Blick war, als er sie begrüßte, eine kurze Geste nur, aber lang genug, um sie nervös zu machen, was auch Iriarte und San Martín bemerkten. San Martín erteilte seinen Mitarbeitern Anweisungen und fasste für den Justizsekretär, der sich zu ihm gesellt hatte, alles zusammen. Iriarte beobachtete, wie unter den Angehörigen Unruhe entstand. Kurz darauf wurden wütende Forderungen nach Aufklärung laut, verstärkt noch durch das laute Wehklagen der Mutter.
»Der Kerl muss schleunigst von hier weg«, sagte Iriarte zu einem der Beamten.
»Bringen Sie ihn direkt nach Pamplona«, befahl Markina.
»Das werde ich, sobald es geht, Euer Ehren. Aber bis der Gefangenentransporter kommt, schaffen wir ihn erst einmal aufs Kommissariat. Wir sehen uns dort.« Iriarte verabschiedete sich.
Sie nickte, grüßte kurz Markina und ging zum Auto.
»Inspectora … Haben Sie eine Minute für mich?«
Sie blieb stehen und drehte sich um. Der Richter kam auf sie zu und trat so nah an sie heran, dass er den Schirm über sie halten konnte.
»Warum haben Sie mich nicht angerufen?« Es war kein Vorwurf, nicht einmal eine Frage, sondern eher eine verführerische Einladung, ein kokettes Spiel.
Der dunkelgraue Mantel, den er über einem ebenfalls dunkelgrauen Anzug trug, das makellose weiße Hemd und die diskrete Krawatte, die nicht recht zu ihm passte, verliehen ihm etwas Seriöses und Elegantes, ein Eindruck, der Lügen gestraft wurde durch das Löckchen, das ihm in die Stirn fiel, und den scheinbar nachlässigen Zweitagebart. Unter dem schmalen Rund des Regenschirms wirkte er noch imposanter, und das teure Parfüm, das seiner weichen Haut entströmte, und der fiebrige Glanz in seinen Augen machten sie noch empfänglicher für dieses gewisse Lächeln.
Jonan Etxaide trat zu ihnen.
»Chefin, die Autos sind voll. Können Sie mich zum Kommissariat mitnehmen?«
»Natürlich, Jonan«, sagte sie errötend. »Euer Ehren, wenn Sie uns entschuldigen würden.« Sie verabschiedete sich und ging mit Jonan zu ihrem Auto. Sie drehte sich nicht noch einmal um, Jonan hingegen schon, was Markina, der noch immer an derselben Stelle stand, mit einem Gruß quittierte.
4
Obwohl es auf dem Kommissariat warm und behaglich war, war Inspector Iriarte noch immer etwas blass um die Nase. Er hatte gerade einmal genügend Zeit gehabt, sich schnell etwas anderes anzuziehen.
»Was hat er gesagt? Was wollte er mit der Leiche?«
»Nichts hat er gesagt, er kauert ganz hinten in der Zelle auf dem Boden und schweigt.«
Amaia stand auf und ging zur Tür. Bevor sie den Raum verließ, drehte sie sich noch einmal um.
»Und Sie? Was glauben Sie? War es eine Kurzschlusshandlung, weil ihn der Schmerz überwältigt hat, oder hat er etwas mit dem Tod des Mädchens zu tun?«
Iriarte dachte nach.
»Keine Ahnung. Kann eine Übersprunghandlung gewesen sein, wie Sie sagen, kann aber auch sein, dass er eine zweite Autopsie verhindern wollte, weil er mitgekriegt hat, dass seine Schwiegermutter ihn verdächtigt.« Er schwieg und sah sie ernst an. »Ich kann mir nichts Abgründigeres vorstellen als einen Vater, der sein eigenes Kind tötet.«
Wie durch einen Zauber sah sie plötzlich das Gesicht ihrer Mutter vor sich. Sie verdrängte es sofort, und es wurde von einem anderen Bild ersetzt: dem der Krankenschwester Fina Hidalgo, wie sie mit ihrem schmutzigen, grün verfärbten Fingernagel frische Triebe köpfte: »Haben Sie irgendeine Vorstellung davon, was es für eine Familie bedeutet, mit so einem Kind zurechtkommen zu müssen?«
»Inspector, war das Mädchen normal? Ich meine, hatte es irgendwelche Gehirnschäden oder war es sonst irgendwie zurückgeblieben?«
»Nein, es war nur etwas untergewichtig wegen der Frühgeburt. Abgesehen davon war es laut Kinderarzt ein gesundes Mädchen.«
Die Zellen des neuen Kommissariats von Elizondo hatten keine Gitterstäbe, sondern eine Wand aus Panzerglas, die freie Sicht erlaubte. Außerdem wurden sie ausgeleuchtet und rund um die Uhr von Kameras überwacht. Amaia ging den Korridor entlang. Alle Türen waren geöffnet. Bis auf eine. Sie trat an die Glasscheibe. Hinten an der Wand saß ein Mann auf dem Boden, zwischen Waschbecken und Kloschüssel. Da er die Knie angewinkelt und seine Arme darum geschlungen hatte, konnte man sein Gesicht nicht sehen. Iriarte drückte auf den Knopf der Sprechanlage, über die man nach drinnen kommunizieren konnte.
»Valentín Esparza«, rief er.
Der Mann hob den Kopf.
»Inspectora Salazar möchte Ihnen einige Fragen stellen.«
Der Mann vergrub den Kopf wieder in seinen Armen.
»Valentín«, rief Iriarte erneut, diesmal bestimmter. »Wir kommen jetzt rein, Sie werden sich ganz ruhig verhalten, okay?«
Amaia beugte sich zu Iriarte hinüber.
»Ich werde allein reingehen, das wirkt weniger feindselig. Ich trage keine Uniform, außerdem bin ich eine Frau.«
Iriarte nickte und zog sich in den Nebenraum zurück. Von dort aus konnte er alles beobachten. Amaia betrat die Zelle und blieb schweigend vor Esparza stehen. Erst nach einigen Sekunden fragte sie:
»Darf ich mich setzen?«
Verwirrt hob er den Kopf.
»Was?«
»Ob es Ihnen etwas ausmacht, wenn ich mich setze«, sagte sie und zeigte auf die Bank, die fast die gesamte Wand einnahm und auch als Bett diente. Indem sie ihn um Erlaubnis bat, erwies sie ihm Respekt. Sie behandelte ihn nicht wie einen Häftling, ja nicht einmal wie einen Verdächtigen.
Er nickte.
»Danke«, sagte sie und setzte sich. »Um diese Uhrzeit bin ich immer ziemlich erschöpft. Ich habe nämlich selbst ein Baby, einen kleinen Sohn. Ich weiß, dass Sie Ihre Tochter verloren haben.« Der Mann hob wieder den Kopf, um sie anzusehen. »Wie alt war die Kleine?«
»Vier Monate«, flüsterte er mit heiserer Stimme.
»Mein herzliches Beileid.«
Er nickte und musste schlucken.
»Heute war mein freier Tag, wissen Sie?«, sagte sie. »Und jetzt muss ich mich um diesen tragischen Vorfall kümmern. Warum erzählen Sie mir nicht, was passiert ist?«
»Haben Ihre Freunde Ihnen das nicht schon erzählt?«
»Ich möchte es von Ihnen hören.«
Er nahm sich Zeit. Jemand mit weniger Verhörerfahrung als Amaia hätte vielleicht gedacht, dass er nicht sprechen würde, doch sie wartete einfach ab.
»Ich habe mir die Leiche meiner Tochter genommen.«
Er hatte Leiche gesagt, also gestand er sich ein, dass sie tot war.
»Um sie wohin zu bringen?«
»Wohin?«, fragte er verwirrt. »Nirgendwohin. Ich … Ich wollte sie nur noch mal bei mir haben.«
»Sie wurden verhaftet, als Sie in Ihr Auto steigen wollten. Wo wollten Sie hin?«
Er schwieg.
Sie versuchte es anders. »Unglaublich, wie sehr sich das Leben verändert, wenn man ein Baby hat. So viele neue Anforderungen, da weiß man manchmal nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Mein Sohn hat jede Nacht Koliken. Wenn ich ihn abends vor dem Einschlafen stille, weint er zwei oder drei Stunden lang durch, und ich kann nichts weiter tun, als ihn in den Armen zu halten und ihn umherzutragen, bis er sich beruhigt hat. Da ist es nicht verwunderlich, wenn man auch mal an seine Grenzen kommt, denke ich des Öfteren.«
Er nickte.
»War es so?«
»Was?«
»Ihre Schwiegermutter sagt, Sie wären mitten in der Nacht bei ihr vorbeigefahren.«
Er schüttelte den Kopf.
»Sie hat Ihr Auto erkannt, als Sie wegfuhren.«
»Meine Schwiegermutter irrt sich.« Die Feindseligkeit in seiner Stimme war nicht zu überhören. »Die kann die Automarken doch gar nicht auseinanderhalten. Das war bestimmt nur ein Pärchen, das in der Einfahrt ein stilles Plätzchen gesucht hat, um … Sie verstehen schon.«
»Ja, aber die Hunde haben nicht gebellt, es kann also nur jemand gewesen sein, den sie kennen. Darüber hinaus hat Ihre Schwiegermutter ausgesagt«, fügte sie mit einem gewissen Unterton hinzu, »dass das Mädchen einen Abdruck auf der Stirn hatte, der noch nicht dort war, als sie es ins Bett brachte; und dass sie ein Geräusch gehört hat und dann Ihren Wagen wegfahren sah.«
»Die alte Schlange würde alles tun, um mir zu schaden, die konnte mich noch nie ab. Fragen Sie doch meine Frau. Wir waren abendessen und sind anschließend direkt nach Hause gefahren.«
»Haben wir schon, aber das hat uns nicht weitergebracht. Ihre Frau widerspricht Ihrer Aussage nicht, kann sie aber auch nicht bestätigen, weil sie sich schlicht nicht erinnert.«
»Ja, sie hat ein bisschen was getrunken. Wegen der Schwangerschaft verträgt sie nicht mehr so viel.«
»Es war bestimmt nicht leicht.«
Er sah sie verständnislos an.
»Ich meine das letzte Jahr. Erst die Risikoschwangerschaft, die Bettruhe, kein Sex, dann die Frühgeburt, zwei Monate Krankenhaus, kein Sex, dann kommt sie endlich nach Hause, aber da steht das Baby im Mittelpunkt, also wieder kein Sex.«
Er zeigte so etwas wie ein Lächeln.
»Das weiß ich aus Erfahrung«, fuhr sie fort. »An Ihrem Hochzeitstag ist es endlich so weit. Sie geben die Kleine in die Obhut Ihrer Schwiegermutter, Sie führen Ihre Frau in ein teures Restaurant aus, und nach dem dritten Glas ist sie so beschwipst, dass Sie sie nach Hause bringen müssen, also wieder kein Sex. Aber noch ist es früh. Sie schnappen sich das Auto, fahren zu Ihrer Schwiegermutter, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Sie kommen an, Ihre Schwiegermutter ist auf dem Sofa eingeschlafen, worüber Sie sich aufregen. Sie gehen in das Zimmer, in dem Ihre Tochter schläft, und da wird Ihnen klar, dass dieses Baby eine Last ist, dass vorher alles besser war. Und dann treffen Sie eine Entscheidung.«
Reglos hörte er zu, ohne sich auch nur ein Wort entgehen zu lassen.
»Sie tun, was Sie tun müssen, und fahren wieder nach Hause. Doch Ihre Schwiegermutter wacht auf und sieht Ihr Auto.«
»Wie gesagt, meine Schwiegermutter ist eine alte Giftspritze.«
»Ja, ich weiß, wovon Sie sprechen, meine auch. Aber Ihre ist nicht nur eine Giftspritze, sondern auch klug. Sie hat nämlich den kleinen Abdruck bemerkt, den das Mädchen auf der Stirn hat. Gestern war er noch kaum zu sehen, aber der Rechtsmediziner heute war sich sicher: Es handelt sich um einen Abdruck, der entsteht, wenn man mit einem Gegenstand fest aufdrückt.«
Er seufzte tief.
»Auch Sie haben den Abdruck gesehen, deshalb haben Sie an dieser Stelle die Schminke aufgetragen, und deshalb haben Sie Anweisung gegeben, den Sarg zu schließen, doch Ihre blöde Schwiegermutter ließ einfach nicht locker. Also haben Sie nur noch einen Ausweg gesehen: Sie mussten die Leiche fortschaffen, um zu verhindern, dass auch andere Leute Fragen stellen. Ihre Frau, zum Beispiel. Jemand hat gesehen, wie Sie sich vor der Leichenhalle gestritten haben.«
»Sie verstehen gar nichts. Das war alles nur, weil sie die Leiche einäschern lassen wollte.«
»Und Sie nicht? Sie wollten eine klassische Bestattung? Deswegen wollten Sie sie fortschaffen?«
Plötzlich schien ihm etwas klarzuwerden.
»Was passiert jetzt mit der Leiche?«
Amaia fiel auf, wie er von seinem Kind sprach, in einem fast neutralen Ton. Ein trauernder Vater würde nicht das Wort Leiche benutzen, er würde Mädchen sagen oder Baby oder … Erst jetzt bemerkte sie, dass sie gar nicht wusste, wie das Kind hieß.
»Der Rechtsmediziner wird eine Autopsie vornehmen, dann wird die Leiche wieder der Familie übergeben.«
»Sie darf nicht eingeäschert werden.«
»Das müssen Sie unter sich ausmachen.«
»Sie darf nicht eingeäschert werden. Ich muss es zu Ende bringen.«
»Was zu Ende bringen?«
»Es zu Ende bringen eben, sonst war alles umsonst.«
Plötzlich war Amaia hellwach. »Was hätte geschehen sollen?«
Schlagartig hielt Esparza inne, als wäre ihm gerade erst bewusst geworden, wo er war und wie viel er schon preisgegeben hatte. Er zog sich in sich selbst zurück.
»Haben Sie Ihre Tochter getötet?«
»Nein.«
»Wissen Sie, wer es war?«
Schweigen.
»Vielleicht war es ja Ihre Frau.«
Verächtlich schüttelte er den Kopf, als wäre schon allein die Vorstellung lächerlich.
»Bestimmt nicht.«
»Wer dann? Wen haben Sie mit zu Ihrer Schwiegermutter genommen?«
»Niemanden.«
»Stimmt, weil nämlich Sie es waren, Sie haben Ihre Tochter getötet.«
»Nein«, schrie er plötzlich. »Ich habe sie nur übergeben.«
»Übergeben? Wem? Wozu?«
Er grinste selbstzufrieden.
»Ich habe sie …« Seine Stimme wurde leiser und leiser, bis sie nur noch ein unverständliches Flüstern war. »… übergeben … wie die anderen …«, murmelte er noch, und dann vergrub er wieder das Gesicht in seinen Armen.
Amaia blieb noch eine Weile in der Zelle, aber sie wusste, dass das Verhör zu Ende war, dass er nichts mehr sagen würde. Sie drückte auf den Knopf der Gegensprechanlage, damit ihr geöffnet wurde. Als sie schon fast draußen war, wandte Esparza sich noch einmal an sie.
»Könnten Sie etwas für mich tun?«
»Kommt drauf an.«
»Sorgen Sie dafür, dass man sie nicht einäschert.«
Jonan und Zabalza warteten zusammen mit Iriarte im Nachbarraum.
»Konnten Sie hören, was er am Ende gesagt hat?«
»Nur, dass er sie übergeben hat. Den Namen habe ich nicht verstanden. Auch auf der Aufzeichnung ist er nicht zu verstehen, man sieht nur, wie er die Lippen bewegt. Vielleicht hat er nur so getan, als würde er was sagen.«
»Zabalza, schauen Sie doch mal, ob man da technisch was machen kann, vielleicht mit Extremvergrößerung. Wahrscheinlich hat Inspector Iriarte recht, und er macht sich über uns lustig, aber wer weiß. Jonan, Montes und du, ihr kommt mit mir mit. Apropos, wo ist Fermín eigentlich?«
»Der hat gerade die Aussagen der Angehörigen aufgenommen.«
Amaia öffnete ihr Feldköfferchen, um zu prüfen, ob alles Nötige darin war.
»Wir müssen irgendwo einen digitalen Messschieber besorgen.« Sie grinste, als Iriarte ein fragendes Gesicht machte. »Ist was?«
»Heute war doch Ihr freier Tag.«
»Das hat sich wohl erledigt.« Sie lächelte, nahm das Köfferchen und machte sich auf den Weg zum Auto, wo Jonan und Montes bereits warteten.
5
Amaia empfand fast so etwas wie eine mitleidige Solidarität mit Valentín Esparza, als sie das Zimmer betrat, das die Großmutter für das Mädchen eingerichtet hatte. Dieses Déjà-vu-Gefühl verstärkte sich noch durch die rosafarbenen Bänder, Spitzen- und Häkelsachen, von denen es nur so wimmelte. Die Großmutter hatte sich für Nymphen und Feen entschieden, statt für Schäfchen wie ihre eigene Schwiegermutter. Ansonsten aber hätte das Zimmer auch von Clarice dekoriert sein können. Amaia zählte mindestens ein Dutzend gerahmter Fotos, und auf allen war das Baby zu sehen, in den Armen der Mutter, der Großmutter, einer anderen älteren Dame, wahrscheinlich einer Tante, nur nicht in denen von Valentín Esparza.
Im oberen Stock war es mollig warm, wahrscheinlich hatte man wegen der Kleinen die Heizung aufgedreht. Aus der Küche unten, in die sich die Angehörigen, Freundinnen und Nachbarn zurückgezogen hatten, hörte man kein Weinen mehr, sondern nur noch gedämpfte Stimmen. Trotzdem schloss Amaia die Tür zum Treppenhaus. Sie sah eine Weile zu, wie Montes und Jonan das Zimmer durchsuchten, und verfluchte das Handy, das seit ihrem Aufbruch vom Kommissariat ununterbrochen vibriert hatte. In den letzten Minuten hatte sich die Frequenz der Anrufe noch einmal erhöht. Sie prüfte, ob sie Empfang hatte. Wie zu erwarten, war er wegen der dicken Mauern des Bauernhauses um einiges schlechter als draußen. Sie stieg die Treppe hinunter, schlich leise an der Küche vorbei, aus der nach wie vor trauriges Murmeln drang, und verließ das Haus. Der Wind hatte vorübergehend den Regen vertrieben. Wolkenmassen zogen mit großer Geschwindigkeit über den Himmel, ohne jedoch Lücken zu reißen, was höchstwahrscheinlich bedeutete, dass es wieder regnen würde, sobald der Wind nachließ. Sie entfernte sich einige Meter von dem Gebäude und sah die Anrufliste durch: einmal Doktor San Martín, einmal Teniente Padua von der Guardia Civil, einmal James und sechsmal Ros. Sie rief zuerst James an, der verstimmt auf die Nachricht reagierte, dass sie nicht zum Mittagessen kommen würde.
»Aber Amaia, heute ist doch dein freier Tag.«
»Ich komme, sobald ich kann, versprochen. Und ich mache es wieder gut.«
Er schien nicht sehr überzeugt. »Wir haben für heute Abend einen Tisch reserviert.«
»Bis dahin bin ich auf jeden Fall wieder da. Ich brauche vielleicht noch eine Stunde.«
Padua ging sofort ran.
»Inspectora, wie geht es Ihnen?«
»Guten Tag, Teniente Padua, ganz gut. Ich habe gesehen, dass Sie angerufen haben, und …« Ihr war deutlich anzuhören, wie aufgewühlt sie war.
»Es gibt nichts Neues, Inspectora. Ich habe heute Morgen mit den Marinebehörden von San Sebastián und La Rochelle telefoniert. Alle Patrouillenboote im Golf von Biskaya sind alarmiert.«
Amaia seufzte, was Padua am anderen Ende der Leitung gehört haben musste.
»Die Küstenwache ist der Meinung, dass die Leiche längst an irgendeiner Stelle der Küste hätte auftauchen müssen, und dieser Meinung schließe ich mich an. Immerhin ist inzwischen ein ganzer Monat vergangen. Die Strömung kann sie überall hingetrieben haben, am wahrscheinlichsten nach Frankreich. Da Ihre Mutter im Fluss ertrunken ist, muss man allerdings noch andere Möglichkeiten in Betracht ziehen. Vielleicht ist sie irgendwo am Grund hängengeblieben, oder die Strömung war wegen der schweren Regenfälle so stark, dass sie regelrecht ins Meer katapultiert wurde und in einem der tiefen Gräben versunken ist. Manchmal tauchen Leichen auch nie wieder auf. Ein Monat ist viel Zeit. Vielleicht sollten wir uns damit abfinden.«
»Danke, Teniente«, erwiderte sie und versuchte ihre Enttäuschung zu verhehlen. »Sollte es was Neues geben …«
»Rufe ich Sie an, keine Sorge.«
Sie legte auf, vergrub das Handy in den Tiefen ihrer Manteltasche und dachte nach über das, was sie von Padua erfahren hatte. Ein Monat ist viel Zeit für eine Leiche im Meer. Das Meer spuckte seine Toten immer aus, oder etwa nicht?
Während des Gesprächs mit Padua war sie instinktiv um das Haus herumgegangen, um das unangenehme Knirschen ihrer Schritte auf den Kieselsteinen in der Einfahrt zu vermeiden. Sie war der Spur gefolgt, die das vom Dach tropfende Wasser auf dem Boden hinterließ. Hinter dem Haus blieb sie an der Stelle stehen, an dem die Traufen von beiden Seiten zusammenliefen. Plötzlich nahm sie hinter sich eine Bewegung wahr. Sie drehte sich um und erkannte sofort die ältere Dame, die sie auf den Fotos im Kinderzimmer gesehen hatte. Sie stand an einem Baum und schien mit jemandem zu sprechen. Immer wieder klopfte sie auf die Rinde, wiederholte Wörter, die auf die Entfernung nicht zu verstehen waren. Nach einer Weile bemerkte die Frau Amaia und kam langsam auf sie zu.
»Früher hätten wir sie hier begraben«, sagte sie.
Amaia nickte und sah zu Boden, wo das heruntertropfende Wasser ein deutlich sichtbares Muster hinterlassen hatte. Sie konnte nichts erwidern, weil sie von Bildern ihres eigenen Familienfriedhofs überwältigt wurde, den Resten eines aus der dunklen Erde ragenden Wiegendeckchens.
»Ich finde das barmherziger, als sie auf einem Friedhof allein zu lassen oder sie einzuäschern, wie meine Enkelin das will. Nicht alles, was modern ist, ist auch besser. Früher hat niemand uns Frauen gesagt, was wir wie zu tun haben. Mag sein, dass wir manches nicht so gut gemacht haben, aber anderes haben wir sogar besser gemacht.« Die Frau redete Spanisch, aber an der Art, wie sie das R aussprach, las Amaia ab, dass ihre Muttersprache Baskisch war. Eine wahre Etxeko Andrea, Herrin des Hauses, eine dieser unverwüstlichen Frauen aus dem Tal des Baztán, die fast ein ganzes Jahrhundert erlebt und trotzdem noch die Kraft hatten, sich jeden Morgen einen Dutt zu stecken, das Essen zu kochen und die Tiere zu füttern. Man sah noch die Reste der Hirse, die sie nach altem Brauch in ihrer schwarzen Schürze getragen hatte. »Man muss tun, was getan werden muss.«
Die Frau kam in ihren grünen Gummistiefeln unsicher näher. Amaia unterdrückte den Impuls, ihr zu helfen, denn sie wusste, dass es ihr nicht recht sein würde. Also blieb sie einfach stehen und reichte ihr die Hand, als sie bei ihr war.
»Mit wem haben Sie gesprochen?«, fragte Amaia und deutete auf das Feld hinter dem Haus.
»Mit den Bienen.«
Amaia machte ein verdutztes Gesicht.
Erliak, erliak
Gaur il da etxeko nausiya
Erliak, erliak,
Eta bear da elizan argía.
Bienen, Bienen,
Heute ist der Herr des Hauses gestorben.
Bienen, Bienen,
In der Kirche braucht er Licht.
Amaia erinnerte sich, dass sie diesen Zauberspruch schon einmal gehört hatte, aus dem Mund ihrer Tante.
Wenn in Baztán jemand starb, ging die Herrin des Hauses hinaus zu den Bienenstöcken und teilte es den Bienen mit, damit sie mehr Wachs für die Kerzen der Totenwache produzierten. Es hieß, die Produktion steigere sich dadurch um das Dreifache.
Amaia war gerührt. Fast hörte sie die Worte ihrer Tante Engrasi: »Wenn alles andere versagt, greifen wir auf die alten Formeln zurück.«
»Mein herzliches Beileid«, sagte sie.
Die Frau ignorierte ihre Hand und umarmte sie überraschend kraftvoll. Als sie von ihr abließ, wandte sie den Blick ab, damit Amaia ihre Tränen nicht sah. Sie wischte sie sich schnell an der Schürze ab, in der sie das Hühnerfutter getragen hatte. Diese tapfere Geste und die feste Umarmung weckten in Amaia einmal mehr den Stolz auf die Frauen Baztáns.
»Er war es nicht«, sagte sie plötzlich.
Amaia schwieg. Sie hatte ein gutes Gespür dafür, wann jemand ihr etwas anvertrauen wollte.
»Auf mich hört keiner, weil ich eine alte Frau bin, aber ich weiß, wer unsere Kleine getötet hat. Der Einfaltspinsel von Vater war es jedenfalls nicht. Der interessiert sich mehr für Autos, Motorräder, den schönen Schein; der giert nach Geld wie Schweine nach Äpfeln. Männer wie den habe ich viele kennengelernt in meinem Leben, manch einer hat mir sogar den Hof gemacht. Als ich jung war, sind sie mit ihren Motorrädern oder Autos bei mir vorgefahren, um mich abzuholen, aber damit konnten sie mir nicht den Kopf verdrehen, ich habe mir einen richtigen Mann gesucht.«
Die alte Dame drohte abzuschweifen. Amaia lenkte das Gespräch wieder auf das eigentliche Thema.
»Sie wissen also, wer es war?«
»Ja, das habe ich denen da schon gesagt«, erklärte sie und machte eine vage Geste in Richtung Haus, »aber weil ich alt bin, nimmt mich niemand ernst.«
»Ich schon. Wer war’s?«
»Inguma. Inguma war’s«, rief sie und unterstrich es mit einem heftigen Nicken.
»Wer ist Inguma?«
Die alte Frau sah sie an, und an ihrem Gesicht konnte Amaia ablesen, dass sie Mitleid mit ihr empfand.
»Das arme Kind! Inguma ist der Dämon, der den Atem schlafender Babys trinkt. Inguma ist durchs Gitter hereingeschlüpft, hat sich auf die Brust der Kleinen gesetzt und ihre Seele getrunken.«
Verblüfft öffnete Amaia den Mund und schloss ihn wieder. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte.
»Sie halten das also auch für das Geschwätz von alten Weibern«, warf ihr die Frau vor.
»Nein …«
»Inguma ist schon einmal erwacht und hat Hunderte von Kindern mitgenommen. Die Ärzte sagten damals, es wäre der Keuchhusten gewesen, dabei war es Inguma, der den Kindern im Schlaf den Atem gestohlen hat.«
Amaia sah Inés Ballarena auf sie zukommen.
»Mama was machst du denn hier? Ich habe dir doch gesagt, dass ich sie heute Morgen schon gefüttert habe.« Sie nahm die alte Frau beim Arm und wandte sich an Amaia. »Sie müssen meine Mutter entschuldigen. Sie ist schon alt, und was passiert ist, hat sie schwer getroffen.«
»Natürlich«, flüsterte Amaia, die dankbar war, dass in diesem Augenblick ihr Handy klingelte. Sie trat ein Stück beiseite und ging ran. »Doktor San Martín, sind Sie schon fertig?«, fragte sie und sah auf ihre Uhr.
»Nein, wir haben gerade erst angefangen«, erwiderte er und musste sich räuspern. »In diesem Fall assistiert mir eine Kollegin«, erklärte er und versuchte zu überspielen, wie nah ihm die Sache ging. »Ich wollte Ihnen trotzdem schon mal einen Zwischenstand durchgeben. Alles deutet darauf hin, dass das Mädchen im Schlaf erstickt wurde, und zwar mit einem weichen Gegenstand, einer Decke oder einem Kissen, den Abdruck über der Nase haben Sie ja selbst gesehen. Dass Sie die Maße des Abdrucks im Auge haben sollten, wenn Sie den Tatort durchsuchen, wissen Sie ja schon. Ich wollte Sie aber schon mal darauf hinweisen, dass wir in den Lippenfalten weiche weiße Fasern gefunden haben, damit Sie Ihre Suche besser eingrenzen können. Wir werden sie näher analysieren, dann melde ich mich noch mal bei Ihnen. Außerdem haben wir die Speichelspuren auf dem Gesicht untersucht. Die meisten stammen von dem Baby selbst, aber mindestens eine ist von jemand anderem, was nichts bedeuten muss, vielleicht hat ein Angehöriger dem Mädchen einen Kuss gegeben, aber wer weiß …«
»Wann wissen Sie mehr?«
»In ein, zwei Stunden.«
Sie eilte den Frauen nach und holte sie an der Haustür ein.
»Inés, haben Sie die Kleine an dem Abend gebadet?«
»Ja, das Bad hat sie immer so schön entspannt.«
»Danke«, sagte Amaia und rannte die Treppe hinauf.
»Ihr müsst nach etwas Weichem, Weißem suchen«, erklärte sie, nachdem sie in das Zimmer gestürmt war.
Montes hob eine Tüte in die Höhe. »Eisbärweiß«, sagte er grinsend und deutete auf das Plüschtier darin.
»Woher wusstet ihr …?«
»Uns fiel auf, dass er schlecht roch«, erklärte Jonan. »Und dann haben wir entdeckt, dass er ein bisschen verfilzt war.«
»Er riecht schlecht?«, fragte Amaia, die sich wunderte, weil ein schmutziges Stofftier so gar nicht zu diesem Zimmer passen wollte, in dem liebevoll auf jedes Detail geachtet worden war.
»Schlecht riechen ist noch untertrieben. Das Ding stinkt«, unterstrich Montes.
6
Auf dem Weg zum Kommissariat rief erneut Ros an, dreimal hintereinander. Amaia hätte am liebsten sofort zurückgerufen, verkniff es sich aber, weil Ros’ Drängen darauf hindeutete, dass das Gespräch in einen heftigen Streit ausarten würde, und den wollte sie lieber nicht vor ihren Kollegen austragen. Kaum saß sie in ihrem Auto, griff sie zu ihrem Handy. Ros ging sofort ran, als hätte sie mit dem Telefon in der Hand auf ihren Rückruf gewartet.
»Amaia«, flüsterte sie. »Kannst du kommen?«
»Ja, was ist los, Ros?«
»Komm lieber her und sieh’s dir selber an.«
Sie grüßte die Angestellten, die im vorderen Teil arbeiteten, und ging nach hinten ins Büro. Ros stand vor der Tür und verwehrte ihr den Blick ins Innere.
»Sagst du mir jetzt endlich, was los ist?«
Als ihre Schwester sich ihr zuwandte, war ihr Gesicht aschfahl. Und Amaia wusste auch sofort, warum.
»Sieh an, die Kavallerie!«, sagte Flora zur Begrüßung.
Amaia überspielte ihre Überraschung, küsste Ros rasch auf die Wange und ging zu ihrer anderen Schwester.
»Ich wusste nicht, dass du auch hier bist. Wie geht’s?«
»Gut, so gut es die Umstände eben erlauben.«
Amaia sah sie verständnislos an.
»Unsere Mutter ist vor einem Monat gestorben, einen schrecklichen Tod gestorben. Bin ich denn die Einzige, der das nahegeht?«
Amaia drehte sich zu Ros um und grinste, bevor sie antwortete.
»Es ist ja gemeinhin bekannt, liebe Flora, dass du auf der Sensibilitätsskala ganz weit oben rangierst.«
Flora reagierte auf diesen Angriff mit einem künstlichen Lächeln und zog sich in den hinteren Teil des Büros zurück. Ros stand nach wie vor an derselben Stelle. Weil sie ihre Arme hängen ließ, bot sie ein Bild der Hilflosigkeit, doch in ihren Augen blitzte eine unterdrückte Wut auf, die sich nun auch um ihren Mund bemerkbar machte.
»Bleibst du lang, Flora?«, fragte Amaia. »Wegen der vielen Dreharbeiten für deine Kochsendung hast du vermutlich wenig Zeit.«
Flora setzte sich an den Tisch und stellte den Stuhl auf ihre Größe ein, bevor sie antwortete.
»Stimmt, viel Zeit habe ich nicht, aber angesichts der Umstände … Ich dachte, ich nehme mir ein paar Tage frei«, erklärte sie und begann den Schreibtisch aufzuräumen. Ros presste ihre Lippen noch stärker zusammen. Flora bemerkte es.
»Und bleibe hier in Elizondo«, sagte sie wie nebenbei, zog mit den Füßen den Papierkorb zu sich heran und warf die bunten Post-its, den Würfelbecher mit dem Blumenmuster und die drei mit Pompons verzierten Kugelschreiber hinein, die eindeutig Ros gehörten.
»Tolle Idee. Tante Engrasi wird sich freuen, wenn du bei ihr vorbeischaust. Solltest du jedoch vorhaben, öfter in der Backstube aufzukreuzen, ruf bitte vorher an. Ros ist sehr beschäftigt. Es ist ihr nämlich gelungen, die französischen Supermärkte zu überzeugen, die sich so lange geziert haben, und da hat sie garantiert keine Zeit, wieder aufzuräumen, was du durcheinanderbringst«, sagte sie, holte alles wieder aus dem Papierkorb und legte es zurück auf den Tisch.
»Martinié«, flüsterte Flora bitter.
»Oui«, erwiderte Amaia lächelnd, als wäre es amüsant.
Floras Gesicht verriet deutlich, dass sie es als Erniedrigung befand, doch noch gab sie sich nicht geschlagen.
»Ich habe ja auch gute Vorarbeit geleistet und die richtigen Kontakte geknüpft. Ein ganzes Jahr habe ich denen die Tür eingerannt.«
»Bei Ros haben sie gleich unterschrieben, schon beim ersten Treffen«, erklärte Amaia süffisant.
Flora starrte Ros an, die ihrem Blick auswich und zur Kaffeemaschine ging und Tassen hinstellte.
»Wollt ihr einen Kaffee?«, fragte sie fast flüsternd.
»Ich ja«, antwortete Amaia, ohne ihren Blick von Flora zu wenden.
»Ich nicht«, antwortete Flora. »Ich will Ros nicht weiter aufhalten, jetzt, wo sie so erfolgreich ist«, sagte sie und stand auf. »Ich wollte euch nur mitteilen, dass ich alles für Mamas Begräbnis vorbereitet habe.«
Die Nachricht traf Amaia unvorbereitet. An ein Begräbnis hatte sie noch überhaupt nicht gedacht.
»Aber …«, begann sie.
»Ja, ich weiß, noch ist es nicht offiziell, und wir würden gern glauben, dass sie sich irgendwie aus dem Fluss gerettet hat, aber ganz ehrlich, das ist doch mehr als unwahrscheinlich«, erklärte sie und sah Amaia in die Augen. »Ich habe in Pamplona mit dem Richter gesprochen, der für den Fall zuständig ist, und der findet ebenfalls, dass eine Trauerfeier durchaus angebracht ist.«
»Du hast den Richter angerufen?«
»Nein, er hat mich angerufen, ein charmanter Mann übrigens.«
»Aha, aber …«
»Was aber?«, sagte Flora schnippisch.
»Na ja …« Amaia schluckte, bevor sie weitersprach, und ihre Stimme klang merkwürdig hohl. »Solange die Leiche nicht auftaucht, können wir nicht sicher sein, dass sie auch wirklich tot ist.«
»Mein Gott, Amaia! Eine ältere Frau, die so lange sediert war, hatte im Fluss keine Chance. Du hast die Kleidung, die man aus dem Wasser gefischt hat, doch selber gesehen.«
»Ich weiß nicht … Offiziell wäre sie trotzdem nicht tot.«
»Ich finde es auch eine gute Idee«, mischte sich Ros ein.
Amaia sah sie überrascht an.
»Du hast schon richtig gehört, Amaia. Ich glaube, wir sollten für die Seele von Mutter ein Begräbnis abhalten, um dieses Kapitel endlich abzuschließen und nach vorne zu schauen.«
»Ich kann nicht. Ich kann nicht, weil ich nicht glaube, dass sie tot ist.«